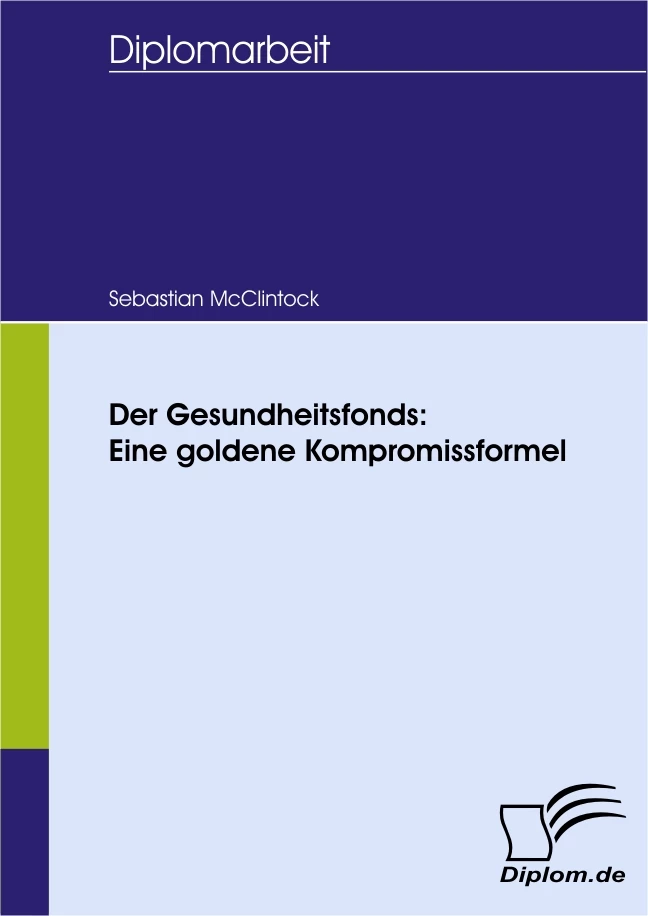Der Gesundheitsfonds: Eine goldene Kompromissformel
Zusammenfassung
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG), welches am 16. Februar 2007 vom Bundesrat verabschiedet und am 26.März2007 vom Bundespräsidenten unterzeichnet wurde, gelang den Parteien der Großen Koalition ein Kompromiss über die Neugestaltung des deutschen Gesundheitswesens. Bereits im Vorfeld hatte keine andere Reform so heftige Kontroversen ausgelöst wie diese. Insbesondere eine Komponente führte zu erregten Diskussionen: Der Gesundheitsfonds. Die Meinungen reichten von völlig überflüssig (Wolfgang Franz, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung) und wettbewerbshemmend (Jürgen Wasem, Essener Sozialökonom) bis hin zu geäußerten Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit (Helge Sodan, Präsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes).
Auch nach der Verabschiedung gab es zahlreiche Kritiker, wie der Bundesärztekammer-Präsident Jörg-Dietrich Hoppe, welcher die völlig falsche Ausrichtung kritisierte. Im Jahresgutachten 2006/07, Ziffer 280 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung ist sogar von einer Missgeburt des Gesundheitsfonds zu lesen. Allerdings gab es auch positive Stimmen. Zum Beispiel bezeichnete der Vorsitzende der Deutschen Betriebskrankenkasse, Ralf Sjuts, den Gesundheitsfonds in einem Interview mit der Zeitung DIE WELT am 06. Juni 2006 als eine Riesenchance um mehr Wettbewerb zu bekommen.
Wie aber entstand der Gesundheitsfonds, der eine Komponente des GKV-WSG ist? Diese Arbeit soll die Frage beantworten, ob der Gesundheitsfonds die goldene Kompromissformel ist nach der alle Parteien gesucht haben. Ist in dieser Reform ein tragfähiges Konzept erarbeitet worden, welches einen Kompromiss beider Volksparteien, mit ihren anfangs unterschiedlichen Konzepten zur Reform des Gesundheitswesens, der Bürgerversicherung (SPD) auf der einen und die Kopfpauschale (CDU) auf der anderen Seite, darstellt?
Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Im Teil I geht es allgemein um die Darstellung des deutschen Gesundheitswesens und dessen Probleme. Es wird auf die historische Entwicklung, die Hauptaufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sowie zukünftige Herausforderungen (zum Beispiel demografischer Wandel) und die daraus entstehenden Veränderungen der Gesundheitsausgaben eingegangen. Anschließend wird kurz das System der privaten Krankenversicherung (PKV) erläutert sowie dessen Stellung im deutschen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Teil I: Das Gesundheitssystem in Deutschland
Historische Entwicklung des deutschen Krankenversicherungssystems
2. Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung
2.1 Besonderheiten und Hauptaufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
Strukturelle Veränderungen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund externer Effekte
Wettbewerbsfaktor private Krankenversicherung
Teil II: Gesundheitsökonomische Konzepte
Bürgerversicherung
Gesundheitsprämie
Bürgerpauschale des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt-schaftlichen Entwicklung
Modell des idealtypischen Gesundheitsfonds
Analyse der Modelle in Hinblick auf die Herausforderungen des heutigen Krankenversicherungssystems
Teil III: Der Gesundheitsfonds als Teil der Gesundheitsreform 2007
Allgemeines zur Gesundheitsreform 2007
3. Ausgestaltung des Gesundheitsfonds
3.1 Einnahme- und Ausgabenseite des Gesundheitsfonds
Veränderungen für die privaten Krankenversicherungen: Wettbewerb zwischen den gesetzlichen und privaten Krankenkassen
Neuordnung des Finanzausgleichs bei den gesetzlichen Krankenkassen und deren Auswirkungen
Ökonomische Analyse des Gesundheitsfonds
Teil IV: Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anlage
1. Einleitung
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG), welches am 16. Februar 2007 vom Bundesrat verabschiedet und am 26. März 2007 vom Bundespräsidenten unterzeichnet wurde, gelang den Parteien der Großen Koalition ein Kompromiss über die Neugestaltung des deutschen Gesundheitswesens. Bereits im Vorfeld hatte keine andere Reform so heftige Kontroversen ausgelöst wie diese. Insbesondere eine Komponente führte zu erregten Diskussionen: Der Gesundheitsfonds. Die Meinungen reichten von „völlig überflüssig“[1] (Wolfgang Franz, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung) und „wettbewerbshemmend“[2] (Jürgen Wasem, Essener Sozialökonom) bis hin zu geäußerten „Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit“[3] (Helge Sodan, Präsident des Berliner Verfassungsgerichtshofes).
Auch nach der Verabschiedung gab es zahlreiche Kritiker, wie der Bundesärztekammer-Präsident Jörg-Dietrich Hoppe, welcher die „völlig falsche Ausrichtung“[4] kritisierte. Im Jahresgutachten 2006/07, Ziffer 280 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung ist sogar von einer „Missgeburt“ des Gesundheitsfonds zu lesen. Allerdings gab es auch positive Stimmen. Zum Beispiel bezeichnete der Vorsitzende der Deutschen Betriebskrankenkasse, Ralf Sjuts, den Gesundheitsfonds in einem Interview mit der Zeitung DIE WELT am 06. Juni 2006 als „eine Riesenchance um mehr Wettbewerb zu bekommen“[5].
Wie aber entstand der Gesundheitsfonds, der eine Komponente des GKV-WSG ist? Diese Arbeit soll die Frage beantworten, ob der Gesundheitsfonds die goldene Kompromissformel ist nach der alle Parteien gesucht haben. Ist in dieser Reform ein tragfähiges Konzept erarbeitet worden, welches einen Kompromiss beider Volksparteien, mit ihren anfangs unterschiedlichen Konzepten zur Reform des Gesundheitswesens, der Bürgerversicherung (SPD) auf der einen und die Kopfpauschale (CDU) auf der anderen Seite, darstellt?
Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Im Teil I geht es allgemein um die Darstellung des deutschen Gesundheitswesens und dessen Probleme. Es wird auf die historische Entwicklung, die Hauptaufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sowie zukünftige Herausforderungen (zum Beispiel demografischer Wandel) und die daraus entstehenden Veränderungen der Gesundheitsausgaben eingegangen. Anschließend wird kurz das System der privaten Krankenversicherung (PKV) erläutert sowie dessen Stellung im deutschen Gesundheitswesen.
Der Teil II behandelt die ökonomischen Konzepte, die zur Problemlösung von verschiedenen Institutionen erarbeitet wurden. Insbesondere werden zwei Modelle vorgestellt, auf die der Kompromiss der beiden Volksparteien beruht. Zum einen die Bürgerversicherung, die die SPD favorisierte, zum anderen die Kopfpauschale, welche von der CDU bevorzugt wurde. Beide Vorstellungen werden erläutert, ihre Funktionsweise sowie deren Vor- und Nachteile dargestellt. Nach diesen Ausführungen wird kurz auf einen Vorschlag des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) eingegangen, der in seinem Jahresgutachten 2004/05 das Konzept der Bürgerpauschale vorschlägt, welches Bürgerversicherung und Kopfpauschale miteinander kombiniert. Im Anschluss wird das zweistufige Modell von Prof. Dr. Wolfram F. Richter diskutiert, welches ebenfalls ein Kompromissvorschlag von Bürgerversicherung und Kopfpauschale darstellt und auf dessen Grundlage der Gesundheitsfond als wichtiger Kernpunkt des GKV-WSG entstand. Nach der Erörterung der zuvor genannten ökonomischen Konzepte folgt eine Analyse der Modelle in Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen der GKV.
Im Teil III geht es um die Analyse der von der Politik beschlossenen Gesundheitsreform. Insbesondere steht die Ausgestaltung des Gesundheitsfonds im Mittelpunkt der Diskussion. Es wird detailliert die Einnahme- und Ausgabenseite des Fonds erläutert, sowie die mit der Reform einhergehenden Veränderungen für die privaten Krankenversicherungen. Anschließend folgt eine Diskussion über die Neuordnung des Finanzausgleichs bei den gesetzlichen Krankenkassen, auch bekannt unter dem Begriff Risikostrukturausgleich (RSA). Im Laufe der Zeit hat sich diese neue Ausgestaltung des Finanzausgleichs, insbesondere Details wie zum Beispiel die Konvergenzklausel, immer wieder zum Streit zwischen Politikern und Gutachtern geführt.[6] Nach den Erläuterungen der Problematik des Risikostrukturausgleichs, folgt die ökonomische Analyse des Gesundheitsfonds. Dabei wird Bezug auf das Idealmodell von Prof. Dr. Richter genommen. Ebenfalls werden unterschiedliche Stellungnahmen zu diesem Thema aufgezeigt sowie ein kurzer Vergleich mit dem niederländischen Gesundheitssystem durchgeführt, das dem Gesundheitsfonds von Deutschland ähnlich ist.
Der Vierte und letzte Teil stellt zusammenfassend die Vor- und Nachteile des Gesundheitsfonds vor und gibt einen kurzen Ausblick auf die eventuelle zukünftige Gestaltung dieser Komponente des GKV-WSG.
Teil I: Das Gesundheitssystem in Deutschland
2. Historische Entwicklung des deutschen Krankenversicherungssystems
Das deutsche Gesundheitswesen geht auf die Bismarcksche Sozialversicherung aus dem Jahr 1883 zurück. Es hatte unter anderem den Zweck, der unter schwersten und schwierigsten Bedingungen arbeitenden und lebenden Bevölkerung einen Schutz vor den Lebensrisiken zu geben. Gleichzeitig sollten revolutionäre Neigungen und Unzufriedenheit ge-genüber der Regierung, besonders aufgrund der Arbeitsbedingungen in der Industrie, in der Arbeiterschaft entgegengewirkt werden.
Circa 90,1 Prozent der deutschen Bevölkerung waren im Jahr 2006 Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung, nur 9,7 Prozent waren privat versichert und lediglich 0,2 Prozent der Bevölkerung hatten keine Krankenversicherung.[7] In Deutschland gibt es die verschiedensten Arten von Krankenkassen, was historisch bedingt ist. Es gibt die Ortskrankenkassen, die Betriebskrankenkassen und die berufsständischen Krankenkassen (zum Beispiel die Angestelltenersatzkassen und die Innungskassen). Bis zum Jahr 1996 wurden fast alle Beschäftigten einer Kasse zugewiesen, so zum Beispiel waren die Landwirte über die Landwirtschaftliche Krankenkasse versichert oder die Angestellten über die Angestelltenersatzkasse. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz konnte jeder seine Kasse frei wählen (siehe Kapitel 3.2, Seite 14). Wie aus dem Statistischen Jahrbuch 2007, Seite 199 ebenfalls hervorgeht, gab es im Jahr 2006 insgesamt 266 verschiedene gesetzliche Krankenkassen.
Für die GKV besteht ein von der Politik vorgegebener einheitlicher Leistungskatalog, der den gesetzlichen Krankenkassen vorschreibt, welche gesundheitlichen Leistungen sie für ihre Mitglieder bezahlen müssen, geregelt im § 11 des Sozialgesetzbuchs, fünftes Buch (SGB V)[8].
Ein Problem der gesetzlichen Krankenkassen ist, dass die Gesundheitsausgaben seit Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Betrugen sie noch 127,92 Milliarden Euro im Jahr 1996, waren es 2005 schon 143,81 Milliarden Euro (Bundesministerium für Gesundheit, Referat LG 5).
Die prozentualen Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) erreichten in Deutschland im internationalen Vergleich den zweithöchsten Wert mit 10,6% im Jahr 2000. Deutschland gab jedoch diese Position im Jahre 2001 an die Schweiz ab (Abbildung 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Gesundheitsausgaben in Prozent des BIP
Quelle: Robert Koch Institut 2006b, eigene Darstellung
Der kontinuierliche Anstieg der Gesundheitsausgaben ist eines der vielen Herausfor-derungen für die zukünftige Gestaltung der GKV. Detaillierter wird darauf im folgenden Kapitel eingegangen.
3. Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung
Wie im vorherigen Kapitel kurz dargestellt wurde, sind die Gesundheitsausgaben in der GKV kontinuierlich gestiegen. Woran liegt das? Was sind die Gründe für die scheinbar unaufhaltsame Kostensteigerung? Nachfolgend werden kurz die Hauptaufgaben der GKV skizziert und anschließend die Herausforderungen für die Zukunft diskutiert. Dabei wird auch auf die wesentlichen Ursachen der steigenden Gesundheitsausgaben eingegangen.
3.1 Besonderheiten und Hauptaufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
Ein wichtiges Merkmal der GKV ist das sogenannte Diskriminierungsverbot. Es untersagt den gesetzlichen Krankenversicherungen Beiträge eines Individuums in Abhängigkeit von der Anzahl seiner Erkrankungen zu erheben. Dies ist eine Umverteilung von Gesunden zu Kranken bei denen erhöhte Risiken oder bestehende Vorerkrankungen unberücksichtigt bei der Beitragskalkulation bleiben. Personen, die sehr oft krank werden beziehungsweise chronische Krankheiten haben („schlechte Risiken“), zahlen den gleichen Beitragssatz wie diejenigen, die nur sehr selten krank werden oder zum Arzt gehen („gute Risiken“). Ebenso sind die gesetzlichen Krankenkassen aufgrund des Kontrahierungszwangs verpflichtet, alle Versicherten aufzunehmen. Dies muss unabhängig von deren Alter, Gesundheitszustand oder ihrer finanziellen Leistungskraft geschehen. Wenn die GKV keine Personen ablehnen darf und es für die Gesünderen unattraktiv ist in einer Krankenkasse zu bleiben bei der sie den gleichen Beitragssatz zahlen wie chronisch Kranke, obwohl sie nur in sehr geringem Maße Leistungen in Anspruch nehmen, muss der Staat die Abwanderung der „guten Risiken“ zur privaten Krankenkasse (PKV) unterbinden. Dies machte der Staat, indem er eine Versicherungspflicht sowie die Beitragsbemessungsgrenze einführte. Ohne sie hätten die gesetzlichen Krankenkassen nur noch die „schlechten Risiken“ und die „Guten“ würden, wie bereits erwähnt, zur PKV wechseln, da dort für sie die monatlichen Beiträge geringer wären. Allerdings gilt bei den privaten Krankenversicherungen nicht der Kontrahierungszwang (siehe Kapitel 4, Seite 19).
Was für Leistungen die Versicherten erwarten können ist per Gesetz geregelt. Die Beitragssätze der Krankenkassen werden allerdings von ihnen selbst festgelegt. Aber diese autonome Entscheidung wird sich mit der Einführung des Gesundheitsfonds ab dem 1. Januar 2009 ändern (siehe Kapitel 11.1, Seite 48). Ein weiteres Merkmal bei der GKV ist, dass seit Einführung der gesetzlichen Krankenkassen der Beitragssatz paritätisch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen wurde. Die bisherige Regelung, am Einkommen des Arbeitnehmers bemisst sich die Beitragshöhe an die GKV, lässt sich mit dem Prinzip der Leistungsfähigkeit beziehungsweise dem Solidarprinzip begründen. Wer mehr verdient, zahlt einen höheren Beitrag an die GKV als jemand der weniger verdient. Dies gilt allerdings nur bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze (43.300 Euro im Jahr 2008). Ein Einkommen welches dieses übersteigt, wird zur Beitragsberechnung nicht herangezogen. Dieses Prinzip ist, wie es im Glossar auf der Homepage des Bundesministerium für Gesundheit unter dem Stichwort „Solidargemeinschaft“ steht, „das Herzstück unseres Sozialstaates und eine der größten Errungenschaften unserer Gesellschaft“ (Bundesministerium für Gesundheit, Referat für Öffentlichkeitsarbeit (c)). Allerdings resultiert aus dieser festgelegten Grenze eine regressive Wirkung, da Besserverdienende, im Vergleich zu Niedrigverdienern, nur einen geringen Anteil ihres Einkommens für die Beiträge aufbringen. Das Solidarprinzip beinhaltet ebenfalls wichtige, politisch gewollte, Umverteilungsprozesse: Die risikobezogene Umverteilung („gute Risiken“ beteiligen sich in höherem Maße an den Kosten, die die „schlechten Risiken“ verursachen), dazu kommt der Generationenausgleich (junge Erwerbstätige zahlen die hohen Gesundheitsausgaben für die RentnerInnen) und der Ausgleich der Familienlast (Mitglieder ohne Kinder und Ledige zahlen für Familien mit Kindern mit, da die Kinder beitragsfrei mitversichert sind - Familienversicherung).
Bei der Familienversicherung sind Kinder bis zum 18. Lebensjahr beitragsfrei bei den Eltern mitversichert. Sie verlängert sich unter bestimmten Voraussetzungen bis zum Ende des 25. Lebensjahres, zum Beispiel aufgrund einer Schul- oder Berufsausbildung. Auch der Ehepartner ist bei einem Einkommen, zum Beispiel aus Kapitalerträgen, bis zu einem Gesamteinkommen von 350 Euro monatlich oder bei einer geringfügigen Beschäftigung in Höhe von 400 Euro monatlich, kostenfrei mitversichert.
Jeder Arbeitnehmer, Auszubildender, Student, Praktikant, Rentner, Künstler, behinderte Mensch, selbstständiger Landwirt und Bezieher von Entgeltersatzleistungen ist in der GKV pflichtversichert. Dies gilt aber nur bis zu einem bestimmten Einkommen, welches in regelmäßigen Abständen neu festgelegt wird. Ab 2008 gilt dies für Arbeitnehmer bis zu einem Brutto-Jahresentgelt in Höhe von 48.150 Euro. Liegt das Einkommen über dieser Versicherungspflichtgrenze, kann der Einzelne wählen, ob er weiterhin freiwillig in der GKV versichert bleibt oder in eine private Krankenversicherung wechselt.
Nachdem im obigen Teil die Besonderheiten und Merkmale der GKV diskutiert wurden, wird nachfolgend kurz auf die Hauptaufgaben der gesetzlichen Krankenkassen eingegangen. Gemäß § 1 Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch, (SGB V) hat „die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft […] die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern.“ Die verschiedenen Leistungsarten, der sogenannte Leistungskatalog, ist im § 11 SGB V geregelt. Das Leistungsspektrum umfasst zum Beispiel die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten, die Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmittel und die Krankenhausbehandlung. Für detaillierte Informationen sei auf § 11 und §§ 20 bis 52 SGB V verwiesen. Jede gesetzlich krankenversicherte Person kann mit ihrer Krankenversichertenkarte die gesetzlich garantierten Leistungen beanspruchen. Dies entspricht dem sogenannten Sachleistungsprinzip, bei dem der Versicherte nach Vorlage seiner Versichertenkarte eine ärztliche Leistung erhält. Aber nicht nur die GKV ist in der Pflicht. Gemäß § 1 SGB V muss der Versicherte „durch eine gesundheitsbewusste Lebensführung und durch die Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen […] den Eintritt von Krankheit […] vermeiden.“
Zusammenfassend lassen sich die Hauptaufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in drei große Bereiche einteilen: Primärprävention, Gesundheitsförderung[9] und Gesundheitsschutz. In den letzten Jahren ist die Primärprävention immer mehr in den Vordergrund gerückt (siehe Kapitel 3.2, Seite 16). Dazu gehört zum Beispiel die aktive Vorbeugung von Krankheiten durch den Versicherten, beispielsweise durch Sport und gesunde Ernährung. Aber auch der Staat kann, zum Beispiel durch empfohlene und von den Krankenkassen bezahlte Impfungen, seinen Beitrag zur sogenannten Primärprävention leisten.
3.2 Strukturelle Veränderungen der gesetzlichen Krankenkassen aufgrund externer Effekte
Trotz verschiedener Maßnahmen der Politik sind ansteigende Beitragssätze der GKV zur Regel geworden, obwohl diese vom Gesetzgeber nur als Ausnahme vorgesehen sind, wie es im § 71, Absatz 1 SGB V steht: „Die Vertragspartner auf Seiten der Krankenkassen und der Leistungserbringer haben die Vereinbarungen über die Vergütungen […] so zu gestalten, dass Beitragssatzerhöhungen ausgeschlossen werden, es sei denn, die notwendige medizinische Versorgung ist auch nach Ausschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven ohne Beitragssatzerhöhungen nicht zu gewährleisten.“ Doch leider ist der Grundsatz der Beitragssatzstabilität nur in der Theorie zu finden. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich wird, ist der durchschnittliche allgemeine GKV-Beitragssatz innerhalb von 16 Jahren um rund 12,5 Prozentpunkte gestiegen. Lag er im Jahr 1993 noch bei 13,22 Prozent, erreichte er 2003 einen Höchststand von 14,31 Prozent, bevor er im Jahr 2007 wieder auf 13,90 Prozent fiel. Grund für den Abschwung ab dem Jahr 2004 waren die verschiedenen Gesundheitsreformen, auf die später in diesem Kapitel noch eingegangen wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Durchschnittlicher GKV-Beitragssatz
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit (2008), eigene Darstellung
Ein Grund für die kontinuierlich ansteigenden Beitragssätze ist die Problematik der Einnahmeseite der GKV sowie die ansteigenden Gesundheitsausgaben. Die Frage ist nun, was sind die Auslöser dafür? Zur Beantwortung dieser Frage lassen sich drei Bereiche definieren, die darauf einen großen Einfluss haben:
- Der Medizinisch-technische Fortschritt,
- der demografische Wandel,
- und die Lohnabhängigkeit der Beiträge.
Weitgehende Einigkeit herrscht über den medizinisch-technischen Fortschritt und dessen Kostenkomponente. Die Vielzahl der medizinischen Verbesserungen schlagen sich überwiegend in qualitäts- und ausgabensteigernde Produktinnovationen nieder. Zum Beispiel gibt es heute die verschiedensten medizinischen Geräte, Arzneimittel und chirurgische Techniken die noch vor 60 Jahren undenkbar waren: Kernspintomographen mit deren Hilfe Bilder vom Inneren des Menschen erzeugt werden können, neuartige Chemotherapie zur Krebsbehandlung oder Organtransplantationen. All diese Innovationen und medizinischen Fortschritte ziehen einerseits höhere Behandlungskosten nach sich und bedeuten somit eine Ausgabensteigerung des Gesundheitswesens, andererseits steigt die Lebenserwartung immer weiter. Lag das durchschnittliche Lebensalter einer Frau 1934 noch bei 62,8 Jahre, so stieg es bis zum Jahr 2004 auf 81,5 Jahre. Ebenso erhöhte sich das Lebensalter eines Mannes von 59,9 Jahre im Jahr 1934 auf 75,9 Jahre in 2004.[10]
Der demografische Wandel nimmt im Zusammenhang mit den Gesundheitskosten eine herausragende Stellung ein. Zum einen ist die niedrige Geburtenziffer zu nennen, zum anderen die Veränderung in der Bevölkerungsstruktur. Seit vielen Jahrzehnten ist in Deutschland die Geburtenziffer kleiner als die Sterbeziffer. Bei der Bevölkerung nimmt der Anteil der Altersgruppe der über 60-Jährigen, bezogen auf die Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen (Altenquotient) beständig zu und die Altersgruppe der bis 19-Jährigen, bezogen auf die Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen (Jugendquotient), kontinuierlich ab. Im Jahr 1965 lag der Jugendquotient bei 56,1 aber 39 Jahre später nur noch bei 37,0. Im Gegensatz dazu stieg der Altenquotient von 36,3 im Jahr 1965 auf 45,5 im Jahr 2004.[11] Das hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in Deutschland. Die gesetzlichen Krankenkassen finanzieren sich nach dem sogenannten Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die Ausgaben eines Jahres durch die eingenommenen Beiträge finanziert werden. Bei einer zunehmenden Veränderung der Versichertenstruktur hat dies jedoch den Nachteil, dass die Einnahmeseite der GKV zurückgeht, da Rentenbezieher niedrigere Beiträge an die Krankenkassen einzahlen als Erwerbstätige. Somit kommt es zu einer Erosion der Bemessungsgrundlage, der durch eine Erhöhung des Beitragssatzes oder durch Kürzungen der Leistungen entgegengewirkt werden kann.
Wie bereits erwähnt, zahlen Rentenbezieher nur den halben Beitragssatz ihrer GKV-Krankenkasse, die andere Hälfte wird vom Rentenversicherungsträger übernommen. Dadurch beteiligen sie sich nur in geringerem Maße an der Finanzierung der Gesundheitsausgaben, obwohl sie mehr medizinische Hilfe benötigen als Jüngere, sei es durch Medikamente oder Krankenhausaufenthalte und somit verursachen sie höhere Ausgaben. Aus diesem Grund gab es eine Änderung mit der Gesundheitsreform 2004. Falls noch andere Versorgungsbezüge neben den Renten bestehen, die sie aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, zum Beispiel Betriebsrenten oder Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit, werden diese mit dem vollen Beitragssatz belegt. Durch diese Modifikation sollen die Rentner stärker belastet werden, da sie nur ca. 43 Prozent ihrer Ausgaben durch ihre Beiträge finanzieren und ca. 57 Prozent werden von den Erwerbstätigen beigesteuert.[12]
Die dritte Herausforderung für die GKV auf der Finanzierungsseite ist die Lohnabhängigkeit der Beiträge. Wie bereits unter 3.1 angesprochen, ist der zu entrichtende Betrag an die GKV proportional zum individuellen Lohn. Als Begründung wurde das Äquivalenzprinzip angeführt, da bis dahin die Leistung der Krankenversicherung, das Krankengeld, eine wichtige lohnabhängige Komponente war. Falls der Beschäftigte krank wurde, zahlte die GKV das Erwerbseinkommen für ihn weiter. Die Begründung der Lohnabhängigkeit der Beitragszahlungen mit dem Äquivalenzprinzip war aber nur bis zum Jahr 1970 gegeben. Seit 1970 muss der Arbeitgeber für die ersten sechs Wochen das Krankengeld an den Arbeitnehmer zahlen, erst danach zahlt es die GKV. Somit ist das Äquivalenzprinzip als Begründung für die Bemessung des Beitrages am Einkommen obsolet geworden, „da es nur noch ca. 6 Prozent der Leistungsausgaben der Kassen ausmacht“ (Breyer, F. et al., 2005, Seite 197). Aus diesem Grund ist der GKV-Beitrag heute nichts anderes als eine Steuer auf das Arbeitseinkommen und hat die gleiche Wirkung wie eine Lohnsteuer.[13]
Durch die paritätische Finanzierung des Krankenkassenbeitrages, bewirkt ein ansteigender GKV-Beitrag höhere Arbeitskosten für den Arbeitgeber und verringert das Nettoeinkommen für den Arbeitnehmer. Somit wird Arbeit unattraktiv und das Arbeitsangebot wird verzerrt, da sich aufgrund des verringerten Nettoeinkommens Mehrarbeit nicht lohnt. Der Kostenanstieg für die Unternehmen wird bei ansteigenden Beitragssätzen wiederum auf die Arbeitnehmer in Form von geringen Lohnzuwächsen umgewälzt. Geringe Lohnzuwächse bedeuten gleichzeitig geringe Einnahmezuwächse der gesetzlichen Krankenkassen. Es findet also eine Erosion der Bemessungsgrundlage, wie schon beim demografischen Wandel, jetzt aber aufgrund von höheren Arbeitskosten und daraus resultierender Lohnzurückhaltung seitens der Arbeitnehmer, statt.
Ein weiterer negativer Effekt, der durch die Koppelung der Beitragszahlung an die Lohneinkommen entsteht, ist die Verringerung der GKV-Einnahmen bei ansteigender Arbeits-losigkeit. Im Falle der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit enthält der nun Beschäftigungslose für die Dauer von bis zu zwölf Monaten Arbeitslosengeld I. Die Arbeitslosenversicherung übernimmt die vollen Krankenversicherungsbeiträge, wobei diese nun geringer sind als im Falle der regulären Beschäftigung. Auch bei Beziehern des Arbeitslosengeldes II (in der Regel bei einer Arbeitslosigkeit von mehr als zwölf Monaten) zahlt die Arbeitslosenversicherung weiterhin die Krankenkassenbeiträge. Aufgrund der lohnabhängigen GKV-Beiträge sorgen eine Abschwächung der Konjunktur und ein oft damit einhergehender Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze für eine Verringerung der Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen.
Zusammenfassend lassen sich folgende externe Faktoren benennen, die die Einnahmeseite der GKV beeinflussen und eine strukturelle Veränderung der GKV nötig machen:
- Der demografische Wandel und der damit einhergehende ansteigende Anteil von Rentenempfängern und
- geringe Lohnzuwächse sowie ansteigende Arbeitslosigkeit, da die Krankenkassenbeiträge lohnabhängig sind.
Auf der Ausgabenseite der GKV lassen sich:
- Der medizinisch-technische Fortschritt und
- die ansteigende Anzahl von älteren Menschen benennen, da sie im Allgemeinen
eine intensivere medizinische Hilfe benötigen und somit höhere Gesundheitsausgaben verursachen.
Auch die verschiedenen Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten haben erkannt, dass die Ausgabenzuwächse der GKV, insbesondere durch den bevorstehenden demografischen Wandel, zu begrenzen sind und versuchen dies seit 1977 mit unterschiedlichen Kostendämpfungsgesetzen zu erreichen.[14] Leitlinie der Gesundheitspolitik ist seitdem der Grundsatz der einnahmeorientierten Ausgabenpolitik. Das heißt, dass der Beitragssatz stabil gehalten werden soll und die Ausgaben nicht stärker als die Einnahmen steigen. Die Kostendämpfungspolitik lässt sich generell auf folgende Maßnahmen zusammenfassen:
- Einführung von Zuzahlungsregelungen,
- Kürzung von Versicherungsleistungen aus dem Leistungskatalog der GKV,
- Neugestaltung der Kassenorganisation,
- Einführung von Wettbewerbsstrukturen innerhalb der GKV,
- Einführung eines Pauschalsystem für einzelne Leistungsbereiche,
- Möglichkeit einer Zusatzversicherung und
- Teilnahme an Bonusprogrammen im Sinne der Primärprävention.
Auf den nachfolgenden Seiten werden kurz das Gesundheitsreformgesetz von 1989, das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 sowie die Gesundheitsreform 2000 und 2004 mit einigen ihrer jeweiligen Maßnahmen vorgestellt, die die Kosten im Gesundheitswesen eindämmen sollten.
Der erste bedeutende Schritt war das 1989 eingeführte Gesundheitsreformgesetz. Bei ihm standen die Erhöhung von Zuzahlungen in den verschiedensten Bereichen (zum Beispiel Arzneimittel) und die Ausgrenzung von Leistungen aus dem GKV Leistungskatalog im Vordergrund.
Danach folgte das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992, bei dem der Schwerpunkt auf der Steuerung der Kostenentstehung und Kostenbegrenzung bei den Leistungserbringern lag. Ein zentrales Element war die Neugestaltung der Kassenorganisation durch die Einführung des Kassenwahlrechts für Angestellte und bestimmte Berufsgruppen. So entstand eine ungleiche Verteilung unter den Krankenkassen, nämlich von gut verdienenden und einkommensschwachen, gesunden und kranken Beitragszahlern. Dies führte zu sehr unterschied-lichen Beitragssätzen. Aus diesem Grund wurde 1994 der Risikostrukturausgleich eingeführt, der die finanziellen Auswirkungen der unterschiedlichen Risikostruktur, welche von den Krankenkassen nicht beeinflusst werden konnte, ausglich (mehr zum RSA, siehe Kapitel 12, Seite 56).
Ab 1996 wurde im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes die Kassenwahlfreiheit für alle gesetzlich Versicherten eingeführt, um für mehr Wettbewerb zwischen den Kassen zu sorgen. Krankenkassen, die im Wettbewerb bestehen wollen, müssen unter anderem ihre Strukturen und Verwaltungsabläufe effizienter gestalten um möglichst günstige Beitragssätze anbieten zu können. Außerdem versuchen sie durch guten Service und über den gesetzlichen Leistungskatalog hinausgehende Angebote neue Mitglieder zu bekommen. In Abbildung 5 ist zu erkennen, dass seit dem Jahr 1992 die Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen von 1223 kontinuierlich zurückgeht auf 280 im Jahr 2004. Wie im Statistischen Jahrbuch 2007 zu lesen ist, gab es 2006 nur noch 266 verschiedene gesetzliche Krankenkassen. Grund dafür ist unter anderem der Zusammenschluss von Krankenkassen um deren ökonomische Position im Wettbewerb zu stärken. Am 1. Juli 2006 kam es zum Beispiel zur ersten länderübergreifenden Krankenkassenfusion, der AOK Rheinland und der AOK Hamburg.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen
Quelle: Statistisches Taschenbuch 2005, Seite 130, eigene Darstellung
Im Rahmen der Gesundheitsreform 2000 gab es eine Vielzahl von Veränderungen. Zum Beispiel wurde das Vergütungssystem für Krankenhäuser reformiert und sogenannte Fallpauschalen vereinbart. Ab Juni 2000 vergütete man bestimmte Behandlungsfälle nach Art der Erkrankung und der erforderlichen Behandlung des Patienten mit einem festen Entgelt, unabhängig davon wie lange der Patient im Krankenhaus bleiben muss. Ab Januar 2003 wurde dieses Fallpauschalensystem auf alle Krankenhausleistungen, mit Ausnahme von psychiatrischen und psychosomatischen Leistungen, übertragen. Ziel dieses Vergütungssystems war es, einen starken Anreiz zu effizientem Verhalten auf Seiten der Ärzte beziehungsweise der Krankenhäuser zu erzielen, da diese nur noch eine Pauschale für die jeweilige Behandlung erhalten. Jedoch ist als problematisch anzusehen, dass durch eine vorsätzliche Fehldiagnose, zum Beispiel die Einstufung des Patienten in eine höher bewertete Krankheitskategorie, der Arzt ein höheres Einkommen erzielen kann.[15]
Desweiteren ist die Kassenwahlfreiheit, welche mit dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 eingeführt wurde, am 1. Januar 2002 erweitert worden. Von diesem Zeitpunkt an kann der Versicherte seine bisherige Mitgliedschaft in der Krankenkasse jederzeit kündigen und zu einer anderen gesetzlichen Krankenkasse wechseln. Allerdings ist er dann in der Regel für mindestens 18 Monate an diese Kasse gebunden. Durch diese Neuerung sollte der Wettbewerb unter den GKV verstärkt werden. Als weiteres Beispiel ist die hausärztliche Versorgung zu nennen. Durch ihre Stärkung sollen Mehrfachuntersuchungen vermieden und unzureichend abgestimmte Behandlungsabläufe verhindert werden. Ziel der verschiedenen Maßnahmen ist es, die Qualität und Effizienz der Versorgung im Gesundheitswesen zu erhöhen.
Als Ergänzung zum 1994 eingeführten RSA, wurde im Rahmen der Gesundheitsreform 2000 der Risikopool beschlossen, welcher ab dem 1. Januar 2002 in Kraft trat. Ziel war es, einen weiteren finanziellen Ausgleich für die GKV zu schaffen, um den immer noch bestehenden Nachteil von verschiedenen Versichertenstrukturen auszugleichen (siehe Kapitel 12, Seite 57).
Die Gesundheitsreform 2004, genauer das Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetz, trat am 1. Januar 2004 in Kraft und gab den gesetzlichen Krankenkassen zum ersten Mal die Möglichkeit, ihren Versicherten neben dem gesetzlichen Krankenversicherungsschutz eine Zusatzversicherung bei einer privaten Krankenversicherung zu vermitteln, zum Beispiel die Chefarztbehandlung oder eine Zahnzusatzversicherung (mehr zum Thema private Krankenversicherungen im Kapitel 4). Allerdings können „schlechte Risiken“ für den Abschluss einer Zusatzversicherung abgelehnt werden, da diese von einer PKV angeboten werden und somit nicht dem Kontrahierungszwang unterliegen.
Die GKV bietet ihren Versicherten neben Zusatzversicherungen nun auch im Rahmen der Gesundheitsreform 2004 beschlossene und am 1. April 2005 in Kraft tretende Bonus-programme an. Ziel ist es, die Primärprävention und den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen zu stärken, da sich jede Kasse durch andere Bonusprogramme profilieren kann und sich die Versicherten aufgrund der verschiedenen Programme die für sie attraktive Krankenkasse auswählen und durch Prämien ebenfalls den Anreiz haben sich an den angebotenen Programmen zu beteiligen. Bonusprogramme können zum Beispiel Raucherentwöhnungskurse, Rückengymnastikkurse oder Kurse zur gesunden Ernährung sein. Oft beteiligt sich auch die gesetzliche Krankenkasse an den Kursgebühren die der Versicherte hat, wenn er einen Sportkurs regelmäßig besucht. Ziel dieser Bonusprogramme und der Primärprävention ist, dass die Versicherten gesund bleiben und weniger krankheitsanfällig werden. Dadurch verursachen sie bei der jeweiligen GKV weniger Kosten, zum Beispiel aufgrund weniger Arztbesuche und Medikamente.
Diese Leistungen sollen gemäß § 20 SGB V „den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und […] einen Beitrag zur Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen erbringen“. Wie aus Abbildung 4 erkennbar ist, sind die Gesundheitsausgaben für Primärprävention, wozu unter anderem der allgemeine Gesundheitsschutz, die Gesundheitsförderung und die Früherkennung von Krankheiten gehören, kontinuierlich angestiegen. Waren es im Jahr 1997 noch 6,816 Milliarden Euro, betrugen die Ausgaben für diesen Bereich sieben Jahre später schon 8,991 Milliarden Euro.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Gesundheitsausgaben für Primärprävention (in Milliarden Euro)
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2007, Seite 251, eigene Darstellung
Um die Lohnnebenkosten zu verringern, wurde mit der Gesundheitsreform 2004 auch beschlossen, dass ab dem 1. Juli 2005 die Mitglieder der GKV einen zusätzlichen Beitragssatz in Höhe von 0,9 Prozent allein zu zahlen haben. Die allgemeinen Beitragssätze sind hingegen um die gleiche Prozentzahl gesenkt worden. Der Grund hierfür war, dass die damalige Bundesregierung die Lohnnebenkosten der Arbeitnehmer senken wollte um eine Ausweitung der Beschäftigung zu erreichen, da sich die Beitragshöhe prozentual vom Bruttoeinkommen, bis zur Beitragsbemessungsgrenze, berechnet. Aufgrund der paritätischen Beteiligung am Beitragssatz, erhöht jede Beitragssatzsteigerung der Krankenkassen die Lohnnebenkosten des Arbeitnehmers und dessen Arbeitskosten, für das jeweilige Unternehmen, steigen an. Um dies etwas abzumildern, senkte man die Beteiligung des Arbeitgebers am Beitragssatz.
Mit dem Ziel der Senkung der Arzneimittelausgaben, wurde die Nichterstattung von sogenannten OTC-Präparaten beschlossen, welche im Rahmen der Gesundheitsreform 2004 am 1. Januar 2004 in Kraft trat. Dies bedeutet, dass rezeptfreie Arzneimittel, wie zum Beispiel Medikamente gegen Erkältungen nicht mehr von der GKV bezahlt werden. Allerdings ist eine ärztliche Verordnung und eine Übernahme der Kosten durch die GKV ausnahmsweise zulässig, wenn das Medikament als Behandlung bei schwerwiegenden Erkrankungen als Therapiestandard gilt. Dazu gibt es eine OTC-Ausnahmeliste, welche gemäß dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses die „Verordnungsfähigkeit rezeptfreier Arzneimittel“ auflistet.[16] Mit dem Ausschluss der Erstattungsfähigkeit wird auch die Preisbindung für rezeptfreie Arzneimittel aufgehoben. Dies soll den Preiswettbewerb zwischen den Apotheken verstärken und somit die Arzneimittelpreise preiswerter machen.
Die meisten der hier dargestellten Maßnahmen haben das Ziel, die Ausgabenseite des Gesundheitswesens einzudämmen. Kurzfristig ist dies auch gelungen, wie in der Abbildung 5 zu sehen ist, allerdings sind die Kosten weiter gestiegen. Tatsächlich lässt sich der Ausgabenrückgang im Jahr 2004 auf das GKV-Modernisierungsgesetz zurückführen,[17] allerdings sind die Gesundheitsausgaben, dazu zählen Leistungsausgaben, Verwaltungskosten sowie sonstige Ausgaben ohne Berücksichtigung des RSA und Risikopools, in 2005 wieder auf rund 144 Milliarden Euro angestiegen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Gesundheitsausgaben und -einnahmen[18] der gesetzlichen Krankenversicherung (in Milliarden Euro)
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Referat LG 5, eigene Darstellung
Aufgrund der immer weiter ansteigenden Gesundheitsausgaben wurde mit der Gesundheitsreform 2007 (siehe Kapitel 11), dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV, welches am 1. April 2007 in Kraft getreten ist, nicht nur die Ausgabenseite in mehreren Schritten reformiert, sondern auch auf der Einnahmeseite werden verändernde Maßnahmen ergriffen. Kernkomponente der Einnahmeseite ist die Einführung des Gesundheitsfonds, worauf detaillierter im Kapitel 11 eingegangen wird.
4. Wettbewerbsfaktor private Krankenversicherung
Das deutsche Krankenversicherungssystem besitzt die Besonderheit, dass Beamte, Selbstständige und Arbeiter sowie Angestellte, deren Einkommen höher als die Beitragsbemessungsgrenze ist, weiterhin freiwillig in der GKV versichert bleiben oder in eine private Krankenversicherung wechseln können. Im Jahr 1988 waren rund 5,9 Millionen Menschen privat krankenversichert und rund 8,5 Millionen 18 Jahre später. Zusätzlich kommen noch einmal ca. 13 Millionen GKV-Versicherte, die eine Zusatzversicherung abgeschlossen haben.
Diese Besonderheit schwächt, wie es Breyer F. et al., 2005, Seite 554 im Buch Gesundheitsökonomik formulieren „die aus Gerechtigkeitsgründen gewünschte Umverteilung in der gesetzlichen Krankenversicherung von niedrigen zu hohen Risiken und von Einkommensstarken zu Einkommensschwachen.“ Oder anders formuliert: Durch diese Zweiteilung des Krankenversicherungssystems kommt es zu Ungleichheiten in der Versichertenstruktur. Kranke und Beschäftigte unter der Bemessungsgrenze bleiben in der GKV, Gutverdienende und gesunde Menschen wechseln zur privaten Krankenversicherung, da diese für sie oftmals billiger ist, aufgrund folgender Besonderheiten:
Anders als bei der GKV orientiert sich in der privaten Krankenversicherung die Höhe der zu zahlenden Prämie nach dem Versicherungsrisiko. Die Prämie, also der monatliche Beitrag den der Versicherte zu zahlen hat, richtet sich nach seinem Gesundheitszustand, Alter, Geschlecht und der gewünschten Versicherungsleistung. Menschen mit „schlechtem Risiko“ müssen demzufolge eine höhere Prämie zahlen als Menschen mit „gutem Risiko“.
Aus diesem Grund ist es unattraktiv für Menschen mit chronischen Krankheiten oder häufigen Erkrankungen in die PKV zu wechseln, da für sie die Prämie sehr hoch wäre. Risikomerkmale sind zum Beispiel, wenn bei Abschluss der Versicherung bereits chronische oder schwere Krankheiten bestehen oder diese im Zuge der Gesundheitsprüfung festgestellt werden. Besonders ältere Menschen haben einen steigenden Bedarf an medizinischer Versorgung und müssen deshalb bei Vertragsabschluss eine höhere Prämie als Jüngere zahlen. Ebenso entrichten Frauen tendenziell höhere Prämien, da sie im Zusammenhang mit Schwangerschaften, Geburten sowie einer höheren Lebenserwartung höhere Kosten nach sich ziehen. Desweiteren variiert die Prämie je nach hinzu gewählter Versicherungsleistung, zum Beispiel Chefarztbehandlung, Einbettzimmer im Krankenhaus oder Heilpraktikerbehandlung.
Anders als in der GKV gibt es somit keinen einheitlichen Leistungskatalog für alle Versicherten. Es gilt auch nicht das Solidarprinzip, sondern dass Äquivalenzprinzip. Die vom Versicherten zu zahlende Prämie ist äquivalent zu seinem Risiko mit welcher Wahrscheinlichkeit er Kosten für die Gesundheitsversorgung verursacht. Ein weiterer Unterschied zur gesetzlichen Krankenkasse ist, dass die Höhe des Einkommens, für die Bemessung der Prämie, die der Versicherte zahlen muss, unabhängig ist. Es zählen nur das Krankheits-risiko und der gewünschte Versicherungsumfang.
Anders als bei der GKV gilt nicht das Sachleistungsprinzip, sondern das Kostenerstattungsprinzip. Bei diesem Prinzip erhält der Versicherte eine Rechnung für alle Leistungen, die er in Anspruch genommen hat und zahlt diese vorerst selbst. Erst dann stellt er die Kosten seiner Krankenkasse in Rechnung und diese prüft, ob alle Voraussetzungen für die Erstattung erfüllt sind. Das Kostenerstattungsprinzip ist für Geringverdiener eine weitere Hürde, neben der Beitragsbemessungsgrenze, nicht in die PKV zu wechseln. Sehr oft haben sie nicht die finanziellen Mittel um in Vorleistung treten zu können. Zudem gibt es in der privaten Krankenversicherung keine Familienversicherung. Jedes Familienmitglied muss sich selbst versichern und dafür eigene Prämien zahlen. Deshalb ist der Wechsel für Familien zur PKV oft nicht lohnenswert, da Kinder bei der gesetzlichen Krankenversicherung kostenlos mitversichert sind.
Wie im Kapitel 3.2 im Rahmen der Gesundheitsreform 2004 bereits diskutiert wurde, haben die gesetzlichen Krankenkassen vom 1. Januar 2004 an die Möglichkeit ihren Versicherten Zusatzversicherungen zu vermitteln. Diese werden von privaten Krankenkassen, angeboten, mit denen die jeweilige GKV besondere Konditionen ausgehandelt hat. Dieses zusätzliche Angebot „trägt dem Wunsch vieler Versicherter Rechnung, bestimmte Versicherungen, die den Krankenversicherungsschutz ergänzen, über ihre gesetzliche Krankenkasse abschließen zu können“ (Bundesministerium für Gesundheit (b)).
Insbesondere für Leistungen die im Leistungskatalog gekürzt oder gestrichen wurden, gibt es eine zunehmende Nachfrage nach Zusatzversicherungen. Zum Beispiel wurden Zahnzusatztarife verstärkt abgeschlossen, nachdem die Leistungen dafür gekürzt wurden. Im Jahr 2006 hatten nach Angaben des Robert Koch Institutes 9.376.300 GKV-Versicherte einen Zahnzusatztarif abgeschlossen. Dies ist eine Steigerung von ca. 20 Prozent im Vergleich zu 2005. Durch Zusatzversicherungen und das Anbieten von Selbstbehalt- oder Rückerstattungsoptionen sowie verschiedenen Wahltarifen, die seit der Gesundheitsreform 2007 den gesetzlichen Krankenkassen möglich sind (siehe Kapitel 11.2, Seite 52) soll unter anderem die Abwanderung der Gutverdienenden aus der GKV begrenzt werden. Als Folge dieser veränderten Bedingungen, setzen immer mehr PKV-Unternehmen auf den Ausbau ihrer Zusatzversicherungsangebote und auf Kooperationen mit den gesetzlichen Krankenver-sicherungen.
[...]
[1] Gammelin, C., 2006
[2] Gammelin, C., 2006
[3] ZEIT online, 2006
[4] ZEIT online, 2007
[5] Neumann, P., 2006
[6] Neumann, P., 2008b
[7] Statistisches Jahrbuch 2007, Seite 45
[8] Das SGB V ist beim Bundesministerium der Justiz online abrufbar unter: http://www.bundesrecht.juris.de/sgb_5/index.html
[9] Dazu gehören die Diagnostik, die Therapie und die Nachsorge.
[10] Statistisches Bundesamt, 2006b, Seite 12
[11] Statistisches Bundesamt, 2006c, Seite 31
[12] Breyer F. et al., Seite 240
[13] Breyer, F., 2007, Seite 29
[14] Bäcker, G. et al., 2000
[15] Breyer, F. und Buchholz, W., 2007, Seite 222
[16] Die Liste ist online abrufbar unter: http://www.die-gesundheitsreform.de/gesundheitssystem/themen_az/ tabellen/ausnahmeliste_otc_praeparate/index.html?param=zs, letzter Zugriff am 23.05.2008
[17] Statistisches Bundesamt, 2006a, Seite 10
[18] Zu den Gesundheitseinnahmen zählen Beiträge und sonstige Einnahmen. Jedoch wurden Einnahmen aus dem Risikostrukturausgleich, der seit 1994 besteht, nicht berücksichtigt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836616737
- DOI
- 10.3239/9783836616737
- Dateigröße
- 1005 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Volkswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2008 (August)
- Note
- 2,7
- Schlagworte
- gesundheitsfonds bürgerversicherung gesundheitsprämie kopfpauschale gesundheitssystem
- Produktsicherheit
- Diplom.de