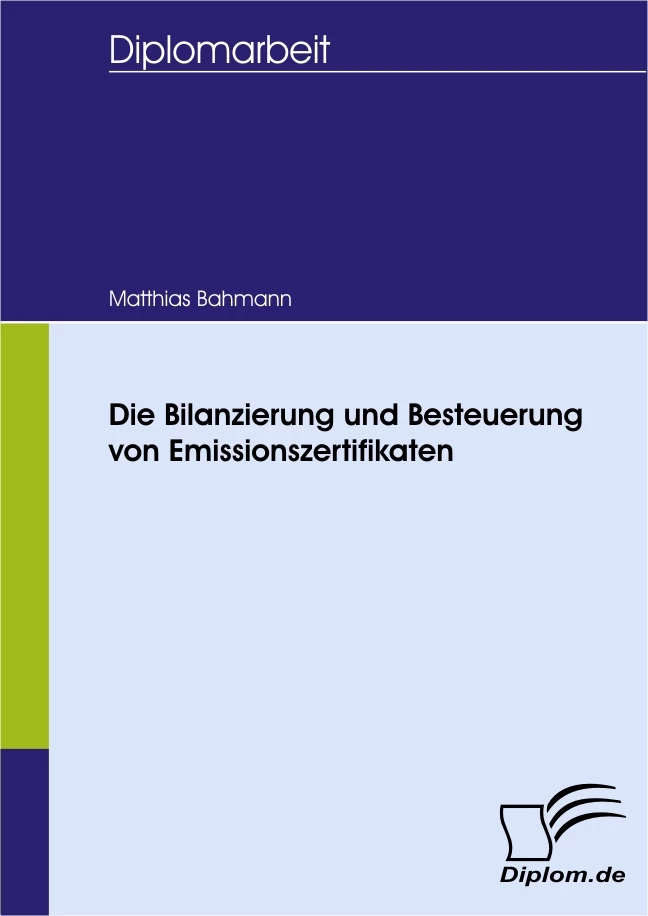Die Bilanzierung und Besteuerung von Emissionszertifikaten
Zusammenfassung
Durch die Umsetzung des EU-Emissionshandels wird seit dem 01. Januar 2005 in der Bundesrepublik Deutschland ein umweltökonomisches Instrument eingesetzt, dass seit langem an den Hochschulen diskutiert wird. Vereinbarte Umweltziele sollen erstmals durch Instrumente der Marktwirtschaft erreicht werden, was Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen stellt. Dabei sind von dem System des Emissionshandels keineswegs nur Energieerzeuger oder andere Unternehmen energieintensiver Branchen betroffen. Dem Emissionshandel unterliegen vielmehr Anlagen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Um davon einen Eindruck zu bekommen, werden hier nur einige der betroffenen Anlagenbetreiber exemplarisch genannt: Audi, BASF, BMW, EON, Flughafen München, Friedrich Alexander Universität Erlangen/Nürnberg, Heidelberger Zement, Löwenbräu und eine Vielzahl von Stadtwerken. Auch wenn sich die zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichteten Anlagenbetreiber aus den unterschiedlichsten Branchen zusammensetzen, so ist doch allen gemein, dass dort, wo marktwirtschaftliche Kräfte greifen, es in den Unternehmen letztendlich immer um Geschäftsvorfälle geht, die im Rechnungswesen abzubilden sind. Daher stellt sich die Frage, wie der Emissionshandel im Rechnungswesen der Unternehmen abzubilden ist. Eng mit der Frage nach der handelsrechtlichen Beurteilung des Emissionshandels ist auch die Frage nach der ertragssteuerlichen Behandlung des Emissionshandels verbunden. Darüber hinaus könnten sich durch den Emissionshandels umsatzsteuerliche Konsequenzen ergeben.
Es ist daher Zielsetzung dieser Arbeit, zum einen die Auswirkungen auf das externe Rechnungswesen zu behandeln und zum anderen die sowohl ertragssteuerlichen als auch umsatzsteuerlichen Konsequenzen des Emissionshandels zu untersuchen. In diesem Zusammenhang soll geklärt werden, ob die Emissionsrechte Vermögensgegenstände sind, die bilanziert werden müssen. Außerdem wird untersucht, wie eine Bewertung der Emissionsrechte vorgenommen werden kann. Des Weiteren soll geklärt werden, ob die Verpflichtung zur Abgabe von Emissionsrechten in der Bilanz abzubilden ist und schließlich, welche Angabepflichten sich für den Unternehmer im Anhang und Lagebericht ergeben. Ferner soll ermittelt werden, welche ertragssteuerlichen Konsequenzen sich durch den Emissionshandel bei den Einkunftsarten ergeben und wie eine Abbildung in der Steuerbilanz aussehen könnte. Abschließend wird untersucht, ob der Handel mit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Problem und Aufgabenstellung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Gang der Untersuchung
2. Umweltschutzpolitik und Emissionshandel
2.1 Umweltschutzpolitische Maßnahmen
2.1.1 Internationale Klimaschutzpolitik
2.1.1.1 Protokoll von Kyoto
2.1.1.2 Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls
2.1.2 Europäisches Klimaschutzprogramm
2.1.2.1 EU Lastenteilungsvereinbarung
2.1.2.2 Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG
2.1.3 Nationale Klimaschutzpolitik
2.1.3.1 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)
2.1.3.2 Der nationale Allokationsplan Deutschlands
2.1.3.3 Zuteilungsgesetz 2007 (ZuG 2007)
2.2 Emissionshandel
2.2.1 Grundlagen des Emissionshandels
2.2.2 Emissionshandel in der Praxis
2.2.2.1 Anlagen und Gase
2.2.2.2 Zuteilung und Ausgabe von Emissionsberechtigungen
2.2.2.3 Monitoring und Sanktionen
2.2.2.4 Banking und Borrowing
2.2.2.5 Abgabe von Emissionsberechtigungen
2.2.2.6 Handel und aktuelle Entwicklung am C02-Zertifikatmarkt
3. Die handelsrechtliche Bilanzierung des EU-Emissionshandels
3.1 Regelungslücke im HGB
3.2 Bilanzansatz von Emissionsrechten
3.2.1 Der Aktivierungsgrundsatz
3.2.2 Gesetzliche Aktivierungsvorschriften
3.2.3 Die Bilanzierungsfähigkeit von Emissionsrechten
3.2.4 Ausweis der Emissionsrechte in der Bilanz
3.2.5 Der Zeitpunkt des Bilanzansatzes
3.3 Bewertung von Emissionsrechten
3.3.1 Die allgemeinen Bewertungsregeln
3.3.2 Die Zugangsbewertung von Emissionsrechten
3.3.2.1 Entgeltlicher Erwerb von Emissionsrechten
3.3.2.2 Anschaffungsnebenkosten
3.3.2.3 Unentgeltliche Zuteilung von Emissionsrechten
3.3.3 Die Folgebewertung von Emissionsrechten
3.3.4 Die Folgebewertung des Sonderpostens
3.3.4.1 Auflösung des Sonderpostens bei außerplanmäßigen Abschreibungen der Zertifikate
3.3.4.2 Auflösung des Sonderpostens bei Verbrauch der Zertifikate
3.3.4.3 Beibehaltung des Sonderpostens beim Verkauf von Zertifikaten
3.3.4.4 Zuführung zum Sonderposten beim Verkauf von Zertifikaten (Erinnerungswert)
3.3.5 Folgebewertung Emissionsrechte als Sachdarlehen
3.4 Bilanzierung der Verpflichtung zur Abgabe von Emissionsrechten
3.4.1 Der Passivierungsgrundsatz
3.4.2 Gesetzliche Passivierungsvorschriften
3.4.3 Die Bilanzierungsfähigkeit der Abgabeverpflichtung
3.4.4 Bewertung der Abgabeverpflichtung
3.4.4.1 Erfüllung aus vorhandenen Beständen
3.4.4.2 Emissionsrechte müssen zur Erfüllung beschafft werden
3.4.5 Berücksichtigung von Sanktionen nach § 18 TEHG
3.5 Angabepflichten im Anhang und Lagebericht
3.5.1 Anhang
3.5.2 Lagebericht
4. Die ertragsteuerliche Behandlung des Emissionshandels
4.1 Auswirkung der Zuordnung von Emissionsrechten zu den Einkunftsarten
4.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb
4.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
4.4 Sonstige Einkünfte
5. Die bilanzsteuerrechtliche Behandlung des Emissionshandels
5.1 Bilanzansatz von Emissionsrechten in der Steuerbilanz
5.2 Die Zugangsbewertung der Emissionsrechte in der Steuerbilanz
5.2.1 Entgeltlicher Erwerb von Emissionsrechten
5.2.2 Unentgeltliche Ausgabe von Emissionsrechten
5.3 Die Folgebewertung von Emissionsrechten in der Steuerbilanz
5.4 Handel mit Emissionsrechten
5.5 Bilanzierung der Verpflichtung zur Abgabe von Emissionsrechten in der Steuerbilanz
5.5.1 Erfüllung aus vorhandenen Beständen
5.5.2 Emissionsrechte müssen zur Erfüllung beschafft werden
6. Der Emissionshandel im Umsatzsteuerrecht
6.1 Staatliche Betätigung im Emissionshandel
6.1.1 Unentgeltliche Ausgabe von Emissionsrechten durch die DEHSt
6.1.2 Handel mit Emissionsrechten durch den Staat
6.2 Emissionshandel durch Unternehmer
6.2.1 Emissionshandel durch Unternehmer im Inland
6.2.2 Grenzüberschreitender Emissionshandel durch Unternehmer
6.2.3 Kauf von Emissionsrechten aus dem Ausland
6.3 Emissionshandel durch Privatpersonen
6.4 Handel mit Derivaten von Emissionsrechten
7. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: CO2-Äquivalente der Treibhausgase gemäß Kyoto-Protokolls
Abbildung 2: Flexible Mechanismen
Abbildung 3: EU Lastenteilungsvereinbarung
Abbildung 4: Deutsches Emissionsziel gemäß ZuG 2007
Abbildung 5: Kosteneinsparung durch den Emissionshandel
Abbildung 6: Teilnehmerländer Europäischer Emissionshandel
Abbildung 7: Anhang 1 TEHG
Abbildung 8: Zeitplan der 1. Zuteilungsperiode
Abbildung 9: Ablauf des Antragsverfahren
Abbildung 10: Zuteilung gemäß ZuG 2007
Abbildung 11: Basisperiode gemäß § 7 ZuG 2007
Abbildung 12: Gebühren für die Zuteilung der Berechtigungen
Abbildung 13: Banking und Borrowing Regelungen in Deutschland
Abbildung 14: Handelsablauf
Abbildung 15: Preisindex an der EEX vom 16.09.2005 – 16.09.2006
Abbildung 16: Zusammenfassung Bilanzierungsfähigkeit von Emissionsrechten
Abbildung 17: Bewertungsmöglichkeiten der unentgeltlich zugegangenen Emissionsrechte
Abbildung 18: Bilanzierung nach Alternative 1
Abbildung 19: Bilanzierung nach Alternative 2
Abbildung 20: Bilanzierung nach Alternative 3
Abbildung 21: Bilanzierung nach Alternative 4
Abbildung 22: Auflösung des Sonderpostens bei außerplanmäßiger Abschreibung der Zertifikate
Abbildung 23: Auflösung des Sonderpostens bei Rückstellungszuführung
Abbildung 24: Beibehaltung des Sonderpostens beim Verkauf von Zertifikaten
Abbildung 25: Aufgliederung des Sonderpostens
Abbildung 26: Aufteilung des Veräußerungsgewinns in seine Komponenten
Abbildung 27: Bildung des Sonderpostens beim Verkauf von Emissionsrechten
Abbildung 28: Fingierte Reihenfolge für die korrespondierende Bewertung der Verbindlichkeit
Abbildung 29: Übersicht der Kosten verursachenden Vorgänge
Abbildung 30: Übersicht mögliche Kosten
Abbildung 31: Leistungsort beim Handel mit Emissionsrechten durch Unternehmer im Inland
Abbildung 32: Übersicht der Handelsmöglichkeiten Inland => Ausland
Abbildung 33: Zusammenfassung Ort der sonstigen Leistung und umsatzsteuerliche Folgen Inland => Ausland
Abbildung 34: Übersicht der Handelsmöglichkeiten Ausland => Inland
Abbildung 35: Zusammenfassung Ort der sonstigen Leistung und umsatzsteuerliche Folgen Ausland => Inland
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Problem und Aufgabenstellung
1.1 Problemstellung
Durch die Umsetzung des EU-Emissionshandels wird seit dem 01. Januar 2005 in der Bundesrepublik Deutschland ein umweltökonomisches Instrument eingesetzt, dass seit langem an den Hochschulen diskutiert wird. Vereinbarte Umweltziele sollen erstmals durch Instrumente der Marktwirtschaft erreicht werden, was Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen stellt. Dabei sind von dem System des Emissionshandels keineswegs nur Energieerzeuger oder andere Unternehmen energieintensiver Branchen betroffen. Dem Emissionshandel unterliegen vielmehr Anlagen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Um davon einen Eindruck zu bekommen, werden hier nur einige der betroffenen Anlagenbetreiber exemplarisch genannt: Audi, BASF, BMW, EON, Flughafen München, Friedrich Alexander Universität Erlangen/Nürnberg, Heidelberger Zement, Löwenbräu und eine Vielzahl von Stadtwerken. Auch wenn sich die zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichteten Anlagenbetreiber aus den unterschiedlichsten Branchen zusammensetzen, so ist doch allen gemein, dass dort, wo marktwirtschaftliche Kräfte greifen, es in den Unternehmen letztendlich immer um Geschäftsvorfälle geht, die im Rechnungswesen abzubilden sind. Daher stellt sich die Frage, wie der Emissionshandel im Rechnungswesen der Unternehmen abzubilden ist. Eng mit der Frage nach der handelsrechtlichen Beurteilung des Emissionshandels ist auch die Frage nach der ertragssteuerlichen Behandlung des Emissionshandels verbunden. Darüber hinaus könnten sich durch den Emissionshandels umsatzsteuerliche Konsequenzen ergeben.
1.2 Zielsetzung
Es ist daher Zielsetzung dieser Arbeit, zum einen die Auswirkungen auf das externe Rechnungswesen zu behandeln und zum anderen die sowohl ertragssteuerlichen als auch umsatzsteuerlichen Konsequenzen des Emissionshandels zu untersuchen. In diesem Zusammenhang soll geklärt werden, ob die Emissionsrechte Vermögensgegenstände sind, die bilanziert werden müssen. Außerdem wird untersucht, wie eine Bewertung der Emissionsrechte vorgenommen werden kann. Des Weiteren soll geklärt werden, ob die Verpflichtung zur Abgabe von Emissionsrechten in der Bilanz abzubilden ist und schließlich, welche Angabepflichten sich für den Unternehmer im Anhang und Lagebericht ergeben. Ferner soll ermittelt werden, welche ertragssteuerlichen Konsequenzen sich durch den Emissionshandel bei den Einkunftsarten ergeben und wie eine Abbildung in der Steuerbilanz aussehen könnte. Abschließend wird untersucht, ob der Handel mit Emissionsrechten umsatzsteuerliche Auswirkungen nach sich zieht.
1.3 Gang der Untersuchung
Der Aufbau dieser Arbeit unterteilt sich in sieben Kapitel. Neben dieser Einführung (Kapitel 1), und der Zusammenfassung (Kapitel 7) gliedert sich die Arbeit in zwei Themenschwerpunkte: die handelsrechtliche (Kapitel 3) und die steuerrechtliche (Kapitel 4, 5 und 6) Beurteilung des Emissionshandels.
Um die bilanziellen Gesichtpunkte im Einzelnen erläutern zu können, wird zu Beginn dieser Arbeit (Kapitel 2) auf die Notwendigkeit und die Funktionsweise des Systems des Emissionshandels in der Bundesrepublik Deutschland eingegangen. Eine entscheidende Rolle wird dabei der praktischen Ausgestaltung des Emissionshandels, insbesondere dem Zugang und dem Abgang von Emissionsrechten, zugeteilt.
Im Anschluss daran steht die Bilanzierung des Emissionshandels nach deutschem Handelsrecht im Vordergrund. Hier werden Bilanzansatz- und Bewertungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung handelsrechtlicher Vorschriften untersucht und anschließend die notwendigen Angaben im Anhang und Lagebericht erläutert.
Im nächsten Abschnitt werden die Auswirkungen des Emissionshandels auf die einkommenssteuerlichen Einkunftsarten untersucht. Ein Schwerpunkt wird dabei auf den Bilanzansatz- und Bewertungsmöglichkeiten in der Steuerbilanz gelegt. Anschließend wird auf die Umsatzbesteuerung von Emissionsrechten eingegangen.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhaltspunkt dieser Arbeit.
2. Umweltschutzpolitik und Emissionshandel
„Längere Trockenperioden, stärkere Regenfälle und zerstörerische Stürme sprechen nach Ansicht der meisten Klimaforscher eine klare Sprache. Der Klimawandel findet bereits statt – und das auch in Deutschland.“[1] Zunächst waren sich die Experten noch uneinig, ob ein Zusammenhang zwischen der Klimaveränderung und dem menschlichen Verhalten der Natur gegenüber besteht. Doch mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf Grund einer Reihe von Untersuchungen kann mit einem sehr hohen Grad an Wahrscheinlichkeit der Mensch als Verursacher des Klimawandels ausgemacht werden.[2] „In vorausgegangenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass der Klimawandel des Industriezeitalters (letzte 100 – 200 Jahre) insbesondere in den Daten der globalen mittleren bodennahen Lufttemperatur der letzten 100 Jahre dem anthropogenen Treibhauseffekt und somit dem Klimafaktor Mensch zugeordnet werden kann.“[3] Aus dem Klimawandel resultieren gravierende ökologische, ökonomische und soziale Konsequenzen. Bereits heute spüren Menschen auf der ganzen Welt die Folgen. „Immer häufiger sind weltweite Klimaanomalien in Form von Überschwemmungen, Stürmen, Trockenheiten oder anhaltenden Wald- und Buschbränden zu beobachten.“[4] Der globale Temperaturanstieg, der auf die anthropogenen Emissionen klimarelevanter Spurengase zurückgeführt werden kann, gilt als Hauptursache für den weltweiten Klimawandel. Um die Rasanz des Klimawandels zu bremsen, ist die Politik gefordert, geeignete Maßnahmen für den Klimaschutz zu finden. Da eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik nur greifen kann, wenn sie länderübergreifend mitgetragen wird, ist es unerlässlich, umweltpolitische Lösungsansätze auf internationale Ebene anzustreben. Einer dieser Lösungsansätze stellt der Emissionshandel dar. Neben dem Weg hin zum Lösungsansatz Emissionshandel und der politischen Umsetzung sowohl auf europäischer Ebene als auch nationaler Ebene werden auch die Mechanismen und die konkrete Ausgestaltung des Emissionshandels in den folgenden Kapiteln aufgezeigt.
2.1 Umweltschutzpolitische Maßnahmen
2.1.1 Internationale Klimaschutzpolitik
Der Klimawandel wurde bereits in den 1970er Jahren als ernst zu nehmendes Problem identifiziert. Auch die Erkenntnis, dass dieser sich Anbetracht seiner globalen Ursachen und Auswirkungen nur durch internationale Kooperationen lösen lässt, wurde zu dieser Zeit festgestellt. Aus diesem Grund weist auch die abschließende Erklärung der Klimakonferenz von Genf (1979) auf dieses Problem hin. Auf der Klimarahmenkonferenz in Rio de Janeiro (1992) hat die Völkergemeinschaft die UN-Klimarahmenkonvention mit dem Ziel verabschiedet, „die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird.“[5] Seit 1994 ist diese Klimarahmenkonvention völkerrechtlich bindend und wurde mittlerweile von etwa 190 Staaten ratifiziert.[6] Auf der Konferenz von Kyoto (1997) gelang der internationalen Staatengemeinschaft der bislang größte Erfolg im Bemühen um die globale Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen.[7] Dort wurde ein Protokoll angenommen, in dem sich die Industrie- und Transformationsländer auf internationaler Ebene verpflichten, ihre Treibhausgase zu reduzieren und zu begrenzen.
2.1.1.1 Protokoll von Kyoto
Mit dem Protokoll von Kyoto und den im Anschluss der Kyoto-Konferenz auf weiteren Klimaschutzkonferenzen in Bonn (2001), Marrakesch (2001), Neu Delhi (2002), Mailand (2003) und Buenos Aires (2004) aufgenommenen Konkretisierungen und Detailregelungen gingen die OECD-Staaten und die Staaten des ehemaligen Ostblocks die Verpflichtung ein, gemeinsam ihre Emissionen von Treibhausgasen im Zeitraum von 2008 bis 2012 um mindestens 5% unter das Niveau von 1990 zu senken.[8] Statt eines einzelnen Stichjahres wurde dabei ein 5-Jahres-Zeitraum gewählt. Dadurch soll die Wirkung von außergewöhnlichen Ereignissen und Einflüssen reduziert werden. Als klimaschädliche Treibhausgase und somit von den Reduktionsverpflichtungen des Protokolls betroffen wurden Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O) Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6) eingestuft.[9] Diese sechs Kyoto-Treibhausgase können über ihr Erwärmungspotenzial in CO2-Äquivalente umgerechnet werden. Als Referenzwert dient dabei CO2. Dies hat den Hintergrund, dass Gase wie CO2, CH4 oder Stickoxide unterschiedlich stark in ihrer Klimawirksamkeit sind. Durch die CO2-Äquivalente kann ein einheitliches Maß geschaffen werden, welches einen Vergleich der Treibhausgase, gemessen an ihrer Klimaschädlichkeit zulässt. Abbildung 1 nennt die Kyoto-Treibhausgase und den Faktor ihrer Klimawirksamkeit, auch Global Warming Potential (GWP) genannt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: CO2-Äquivalente der Treibhausgase gemäß Kyoto-Protokolls [10]
Betrachtet man z.B. Methan (CH4) mit einem GWP-Faktor von 23, so bedeutet dies, dass die Emission von einer Tonne Methan für das Klima so schädlich ist, wie die Emission von 23 Tonnen CO2.
Obwohl das Kyoto-Protokoll bereits 1997 angenommen wurde, konnte es erst im Februar 2005 für die Unterzeichnerstaaten völkerrechtlich verpflichtend werden. „Denn gem. Art 25 des Protokolls konnte dieses formell erst 90 Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft treten, an dem es von mindestens 55 Vertragsstaaten ratifiziert worden ist, auf die insgesamt mindestens 55% (Bezugsjahr 1990) der gesamten CO2-Emission entfallen.“[11]
Diese Voraussetzung wurde mit der Ratifizierung des Protokolls durch Russland am 22. Oktober 2004 erfüllt. Die Reduktionsverpflichtung aus dem Kyoto-Protokoll wird dadurch umgesetzt, dass jeder Staat nur eine bestimmte Menge an Treibhausgasen ausstoßen darf. Die Gesamtsumme der bewilligten Emissionen, die einem Staat rechtlich zusteht, wird als Assigned Amount (AA) bezeichnet. Einzelne Emissionsrechte haben die Bezeichnung Assigned Amount Units (AAU).[12]
2.1.1.2 Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls
„Die nach dem Kyoto-Protokoll zu erfüllenden Emissionsreduktionen finden grundsätzlich in dem verpflichteten Vertragsstaat statt.“[13] Doch um eine möglichst kostengünstige Erfüllung der Reduktionsverpflichtungen zu ermöglichen, sieht das Kyoto-Protokoll verschiedene Flexible Mechanismen vor. Durch die Flexiblen Mechanismen wird den Vertragsstaaten die Möglichkeit gegeben, einen Teil ihrer Emissionsreduktionsverpflichtungen durch Projekte im Ausland bzw. durch den Ankauf von Emissionszertifikaten aus anderen Vertragsstaaten zu erfüllen.[14] Das Grundprinzip der Flexiblen Mechanismen ist Folgendes:
„emissionssparende Maßnahmen können dort durchgeführt werden, wo sie am kostengünstigsten sind.“[15] Die Idee die dabei dahinter steckt ist die, dass es für den weltweiten Klimaschutz unerheblich ist, wo Emissionen abgebaut werden, sondern dass es vielmehr entscheidend ist, dass sie abgebaut werden.[16] Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Flexiblen Mechanismen nur ergänzend „zu den nationalen Anstrengungen der Industrieländer angewendet werden, um zu verhindern, dass sich die verpflichteten Staaten völlig von der Notwendigkeit freikaufen, im eigenen Land Maßnahmen vorzunehmen.“[17]
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Flexible Mechanismen [18]
Zu den Flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls gehören:
- Internationaler Emissionsrechtehandel (EH)
Der internationale Emissionsrechtehandel nach Artikel 17 des Kyoto-Protokolls erlaubt den Industrieländern, vom Kyoto-Protokoll zugestandene, aber nicht selbst genutzte Emissionsrechte (AAU) an andere Industriestaaten zu verkaufen. In der EU wurde dieser Ansatz übernommen und von Länderebene auf die Unternehmensebene übertragen.
- Clean Development Mechanism (CDM)
Der CDM nach Artikel 12 des Kyoto-Protokolls wird auch als Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung bezeichnet. Dabei beteiligt sich ein Industrieland bzw. ein Unternehmen aus einem Industrieland, an einem
emissionssparenden Projekt in einem Entwicklungs- oder Schwellenland. Dadurch erhält es Emissionsgutschriften, so genannte Certified Emission Reduktions (CER).
- Joint Implementation (JI)
Nach Artikel 6 des Kyoto-Protokolls ermöglicht JI, dass Industrieländer durch die Investition in Minderungsprojekte in anderen Industrieländern
Emissionsgutschriften erwirtschaften können, so genannte Emission Reduktion Units (ERU).[19]
2.1.2 Europäisches Klimaschutzprogramm
„Auf europäischer Ebene wurden unabhängig vom in Kraft treten des Kyoto-Protokolls kurz nach dessen Unterzeichnung die bereits bestehenden Überlegungen zur Minderung des Ausstoßes von Treibhausgasen verstärkt.“[20] In Folge dessen entwickelte die EU eine eigene Strategie, die so genannte Strategie nach Kyoto. Mit dieser Strategie wollte die EU eine Erfüllung der durch die Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls eingegangenen Verpflichtungen sicherstellen. Ziel dieser Strategie war es, „möglichst bald eine Reihe prioritärer Maßnahmen in den Sektoren Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft zu realisieren.“[21] Ein Schwerpunkt bei der Umsetzung wurde dabei auf den Bereich
Energiewirtschaft gelegt. Diese Fokussierung lag nach Ansicht der EU darin begründet, dass die Energiewirtschaft innerhalb der Gemeinschaft mit etwa 80% der Emissionen die mit Abstand wichtigste Quelle für den Gesamtausstoß von Treibhausgasen bildet. Aus diesem Grund sind Richtlinien von der EU erlassen worden, die der Förderung der Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung und aus regenerativen Energiequellen besondere Bedeutung beimessen. In der Bundesrepublik Deutschland wurden diese Richtlinien mit dem Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG 2002)[22] und dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG)[23] vom Gesetzgeber in nationales Recht umgesetzt.[24] Die Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls fallen für die einzelnen Länder sehr unterschiedlich aus. Die EU und die Bundesrepublik Deutschland haben im Rahmen des Protokolls eine Minderung ihrer Emissionen um 8% bis zum Zielhorizont 2008 bis 2012 auf Basis der Emissionen von 1990 übernommen. „Nachdem die Europäische Union schnell festgestellt hatte, dass die auf Grundlage ihrer Strategie von Kyoto begonnenen prioritären Maßnahmen alleine nicht ausreichen, das im Kyoto-Protokoll zugesicherte Reduktionsziel zu erreichen, versuchte sie den Prozess der europäischen Klimaschutzpolitik durch weitere Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen auf Ebene der Mitgliedsstaaten wie auch auf Gemeinschaftsebene fortzusetzen.“[25] Daher wurde von der Europäischen Kommission am 08. März 2000 das Europäische Klimaschutzprogramm aufgelegt. Ausgangspunkt dieses Programms ist ein zweigleisiges Konzept, welches als Garant für die Realisierung der Minderungsziele dienen soll. Auf der einen Seite möchte man „durch gezielte Politiken und Maßnahmen die Reduzierung der Emissionen aus spezifischen Quellen herbeiführen.“[26] Auf der anderen Seite „soll ein EU-internes System für den Emissionshandel in den Bereichen Energie und industrielle Großanlagen eingeführt werden.“[27]
2.1.2.1 EU Lastenteilungsvereinbarung
Das Ziel der EU, ihre Emissionen um 8% unter das Niveau von 1990 zu senken, wurde in einer gesonderten Vereinbarung, dem so genannten Burden-Sharing-Agreement (Lastenteilungsvereinbarung) auf die EU-15 aufgeschlüsselt. Die aufgeteilten Minderungsverpflichtungen sind in der Abbildung 3 aufgezeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: EU Lastenteilungsvereinbarung [28]
Dabei wurden die Reduktionsverpflichtungen entsprechend der ökonomischen Entwicklung der Mitgliedsstaaten in unterschiedlichem Umfang auf diese verteilt. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich „im Rahmen der Aufteilung dieser Minderungsverpflichtung auf die einzelnen EU-Staaten – das so genannte Burden Sharing – ein Minderungsziel von -21% gesetzt.“[29] Dies entspricht 76% oder 254 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente der von der EU insgesamt übernommenen Minderungsverpflichtung in Höhe von 336 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente.[30]
2.1.2.2 Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG
In Folge des europäischen Klimaschutzprogramms hat die EU mit der Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG[31] ein Basisdokument auf europäischer Ebene geschaffen, „das den Ausstoß von Treibhausgasen genehmigungspflichtig macht und ein europäisches Handelssystem mit EU-Berechtigungen für große CO2-Emittenten der Sektoren Energiewirtschaft und Industrie etabliert.“[32] Mit dem in Kraft treten der Richtlinie am 25. Oktober 2003 wurden die Rahmenbedingungen für den europaweiten Emissionshandel auf Unternehmensebene fixiert. Inhaltlich umfasst die Emissionshandelsrichtlinie dabei folgende Regelungsschwerpunkte: das Ausmaß des Handelssystems, die Teilnehmer, das System von Genehmigung und Zertifikat und die Zuteilung der Zertifikate. Beim Ausmaß des Handelssystems hat die EU den Schwerpunkt des Handelssystems nicht auf nationale, sondern auf Gemeinschaftsebene gelegt. Dies liegt darin begründet, dass sich dadurch nach Ansicht der EU bessere Wettbewerbsbedingungen und ein höherer wirtschaftlicher Nutzen ergeben werden. In der Anlage I der Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG wird der Teilnehmerkreis beschrieben. Demnach sind Anlagen aus den Branchen Energiewirtschaft, Eisenmetallerzeugung und –verarbeitung, Mineralverarbeitung sowie Industrieanlagen zur Herstellung von Zellstoff und Erzeugnissen aus Papier und Pappe zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichtet. Die Richtlinie verfolgt ein zweispuriges System von Genehmigung und Zertifikat. Basis des Handelssystems ist die von den Mitgliedsstaaten zu erteilende Genehmigung. Diese ist nach Artikel 4 der Richtlinie ab dem 01. Januar 2005 Voraussetzung für die in Anlage I der Richtlinie aufgeführten Tätigkeiten. Gegenstand des Emissionshandels ist nur das Zertifikat, welches den Inhaber zur Emission einer Tonne CO2-Äquivalent in einem bestimmten Zeitraum berechtigt. Die Unternehmen erhalten die Berechtigungen entweder durch Zuteilung oder durch Handel und müssen diese für getätigte Emissionen einlösen. Für die Zuteilung soll gemäß der Richtlinie jeder Mitgliedsstaat für die jeweilige Handelsperiode einen nationalen Zuteilungsplan (NAP) aufstellen.[33] Die Emissionshandelsrichtlinie bildet außerdem die Rechtsgrundlage für eine dreijährige Testphase in den Jahren 2005 bis 2007, die der Kyoto-Periode von 2008 bis 2012 vorangestellt wird. Damit will die EU sicherstellen, dass die ehrgeizigen Ziele des Kyoto-Protokolls erreicht werden und dass bereits vor Beginn der ersten Kyoto-Periode wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes eingeleitet werden.
2.1.3 Nationale Klimaschutzpolitik
Damit der europaweite Emissionshandel wie vorgesehen zum 01. Januar 2005 auch auf nationaler Ebene starten konnte, waren die Gesetzgeber der Mitgliedsstaaten gefordert, die Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG, die gegenüber den Unternehmen keine direkte Gesetzeskraft entfaltet, in nationales Recht umzusetzen.
Die europäischen Richtlinien geben dabei den Mitgliedsstaaten ein zu erreichendes Ziel vor. Außerdem legt die Richtlinie die Rahmenbedingungen für den Weg zur Zielerreichung fest. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip müssen dazu von den nationalen Gesetzgebern die entsprechenden Gesetze und Verordnungen zur Umsetzung der Richtlinie auf den Weg gebracht werden. Bei der Bestimmung des konkreten Weges zur Zielerreichung sind die Mitgliedsstaaten „innerhalb der durch die europäische Richtlinie gesetzten Rahmenbedingungen“[34] frei.[35] In der Bundesrepublik Deutschland ist der Gesetzgeber den Vorgaben der Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG in zwei getrennten Gesetzen, dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)[36] und dem Zuteilungsgesetz 2007 (ZuG 2007)[37] nachgekommen.[38] Zur Konkretisierung des ZuG 2007 wurde zusätzlich die Zuteilungsverordnung (ZuV 2007)[39] erlassen. Außerdem wurden in der Emissionshandelskostenverordnung (EHKostV 2007)[40] vom Bundesministerium für Umwelt „die Höhe der Gebühren und zu erstattenden Auslagen für Amtshandelungen“[41] bei der Durchführung des Emissionshandels festgelegt.
2.1.3.1 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)
Das Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz – TEHG) stellt das zentrale
Element bei der nationalen Umsetzung der EU-Emissionshandelsrichtlinie in der Bundesrepublik Deutschland dar. Es enthält die primären Regelungen der Richtlinie und ist am 15. Juli 2004 in Kraft getreten. Das TEHG enthält 25 Paragraphen, die in sechs Abschnitte untergliedert sind. Im 1. Abschnitt des TEHG (§§ 1-3) wird der Zweck und der Anwendungsbereich des Gesetzes bestimmt. Zweck des TEHG ist es gemäß § 1 TEHG, für Tätigkeiten, durch die in besonderem Maße Treibhausgase emittiert werden, die Grundlagen für den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen in einem gemeinschaftsweiten Emissionshandelssystem zu schaffen. Außerdem enthält der 1. Abschnitt zahlreiche Begriffsbestimmungen. Eine explizite Erläuterung des Anwendungsbereichs bezüglich der vom TEHG betroffenen Tätigkeiten unter Einbeziehung der Begriffsdefinitionen erfolgt im Kapitel 2.2.2.1. Der anschließende Abschnitt 2 des TEHG (§§ 4, 5) befasst sich mit der Genehmigung von Emissionen und deren Überwachung. Abschnitt 3 (§§ 6-14) beinhaltet mehrere Regelungen über die Berechtigungen und deren Zuteilung. Die Abschnitte 2 und 3 des Gesetzes finden ausführliche Betrachtung in dem Kapitel 2.2.2.2. Im Abschnitt 4 TEHG (§§ 15, 16) wird der Handel mit Emissionsberechtigungen geregelt. Im Anschluss enthält Abschnitt 5 TEHG (§§ 17-19) Sanktionsbestimmungen. Diese sind im Kapitel 2.2.2.3 spezifiziert. Abschließend finden sich im Abschnitt 6 des TEHG (§§ 20-25) gemeinsame Vorschriften mit Regelungen über die Zuständigkeit, Überwachung, elektronische Kommunikation, Anlagenfonds, einheitliche Anlagen und Kosten von Amtshandlungen.
2.1.3.2 Der nationale Allokationsplan Deutschlands
Ein weiteres Kernelement „des EU-Emissionshandels im Hinblick auf die Anfangsallokation ist der Nationale Allokationsplan (NAP), den die EU-Mitgliedsstaaten für jede Zuteilungsperiode getrennt aufstellen müssen.“[42] Der Nationale Allokationsplan legt dabei „die Gesamtmenge der in einer Zuteilungsperiode zuzuteilenden Emissionsberechtigungen sowie die Regeln, nach denen diese Berechtigungen an die Verantwortlichen für die einzelnen Tätigkeiten zugeteilt und ausgegeben werden“[43] fest. Der Nationale Allokationsplan hält dabei eine doppelte Funktion inne. Zum einen dient er der Europäischen Kommission als Informationsquelle über die Gesamtmenge der zuzuteilenden Berechtigungen und Zuteilungsregeln in allen EU-Mitgliedsstaaten. Zum anderen fungiert er in der Bundesrepublik Deutschland der Vorbereitung des Zuteilungsgesetzes 2007, da der Nationale Allokationsplan gemäß § 7 III TEHG Grundlage für ein Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für die jeweilige Zuteilungsperiode darstellt.[44] Der deutsche Nationale Allokationsplan 2005 bis 2007 wurde von der Bundesregierung am 31. März 2004 beschlossen und definiert gemäß Artikel 9 der Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG die zuteilungsfähige Gesamtmenge an CO2-Emissionsberechtigungen (Emissionshandelsbudget) sowie konkrete Festlegungen von Regeln und Mengen, nach denen diese Berechtigungen an die betroffenen Anlagen in der Handelsperiode 2005 bis 2007 ausgegeben werden.
„Bevor mit dem Emissionshandel begonnen werden kann, muss die zu verteilende Menge an Emissionsberechtigungen festgelegt und das Zuteilungsverfahren gewählt werden.“[45] Bei der Zuteilung kann grundsätzlich zwischen zwei Verfahren unterschieden werden, der Gratisvergabe und der Versteigerung der Emissionsrechte. Die EU-Richtlinie gibt für die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 vor, dass mindestens 95% des Emissionshandelsbudgets gratis vergeben werden müssen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass höchstens 5% des Emissionshandelsbudgets versteigert werden können. In der zweiten Periode 2008 bis 2012 müssen mindestens 90% der Berechtigungen gratis abgegeben werden. Die Bundesregierung hat sich im deutschen Nationalen Allokationsplan 2005 bis 2007 dazu entschlossen, 100% der Berechtigungen gratis an die betroffenen Unternehmen zu vergeben.[46] „Der Nationale Zuteilungsplan vom 31. März 2004 enthält … drei wichtige Festlegungen“[47], den Makroplan, den Mikroplan und den Erfüllungsfaktor. Zunächst wird in einem Makroplan die „Aufteilung des nationalen Emissionsziels auf die verschiedenen Treibhausgase (THG) und Makro-Sektoren (Energiewirtschaft, Industrie, Gewerbe/Handel/Dienstleistung (GHD), Verkehr und private Haushalte (HH))“[48] vorgenommen. Der Makroplan steckt dabei vor allem die Menge an Emissionsberechtigungen ab, die den Betreibern von Anlagen, die unter die EU-Emissionshandelsrichtlinie fallen und den Sektoren Energiewirtschaft und Industrie zuzurechnen sind, insgesamt zugeteilt werden. Der Makroplan orientiert sich bei den Allokationskriterien insbesondere an den Vorgaben der EU-Burden-Sharing-Vereinbarung. Das Gesamtbudget für Emissionen beträgt für die Bundesrepublik somit 859 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Eine genaue Aufsplittung auf die Makro-Sektoren erfolgt im ZuG 2007.[49] Als zweite wichtige Festlegung bestimmt der Mikroplan die Zuteilungskriterien für die dem Emissionshandel unterliegenden Anlagen. Der Mikroplan schließt dabei den so genannten Reservefond, aus dem die Zuteilung vor allem für neue Anlagen zu speisen ist, mit ein. Der Erfüllungsfaktor, aus dem sich die Reduktionsverpflichtung ergibt, enthält schließlich die dritte Festlegung des Nationalen Allokationsplans.[50] Der Erfüllungsfaktor soll dabei garantieren, „dass die Summe der anlagenspezifischen Zuteilungen einschließlich der Sonderzuteilungen nicht höher ist, als die im Makroplan festgeschriebene Gesamtmenge.“[51] Daher erfolgt die Zuteilung für die Bestandsanlagen mit einem Abschlag, der im Kapitel 2.2.2.2 genauer spezifiziert wird.
Für den Zeitraum 2008 bis 2012 hat die Bundesregierung am 28. Juni 2008 den zweiten Nationalen Allokationsplan (NAPII) beschlossen, dessen gesetzliche Umsetzung im ZuG 2012 erfolgen soll.
2.1.3.3 Zuteilungsgesetz 2007 (ZuG 2007)
Die wesentlichen Inhalte des Nationalen Allokationsplans 2005 bis 2007 wurden in das Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsgesetz 2007 – ZuG 2007) übernommen, dass gemäß § 7 TEHG die gesetzliche Verankerung des Nationalen Allokationsplans bildet. Das Zuteilungsgesetz 2007 für die erste Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 ist am 31. August 2004 in Kraft getreten. „Es beinhaltet die Zuteilungsregelungen für Bestandsanlagen, für Neuanlagen, für Anlagenstilllegungen sowie Sonderregelungen für frühzeitige Emissionsminderungen, prozessbedingte Emissionen, für Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung sowie für den Ausstieg aus der Kernenergie.“[52] Das ZuG 2007 besteht aus 24 Paragraphen, die in fünf Abschnitte unterteilt sind. Abschnitt 1 des ZuG 2007 (§§ 1-3) enthält ähnlich wie das TEHG eine Umschreibung von Zweck, Anwendungsbereich des Gesetzes und Begriffsbestimmungen. Gemäß § 1 ZuG 2007 ist es Zweck dieses Gesetzes, im Hinblick auf die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 nationale Ziele für die Emission von Kohlendioxid in Deutschland sowie Regeln für die Zuteilung und Ausgabe von Emissionsberechtigungen an die Betreiber von Anlagen festzulegen, die Anhang 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes unterfallen. Im Abschnitt 2 des ZuG 2007 (§§ 4-6) finden sich mit der Mengenplanung die zentralen Regelungen zur Festlegung der nationalen Emissionsziele, des Erfüllungsfaktors und der Reservemenge. Das ZuG 2007 definiert, wie bereits in Kapitel 2.1.3.2 im Zusammenhang mit dem Makroplan beschrieben, die zuteilungsfähige Gesamtmenge an CO2-Emissionsberechtigungen. Die derzeit emissionshandelspflichtigen Unternehmen fallen fast ausschließlich in die Sektoren Industrie und Energiewirtschaft.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Deutsches Emissionsziel gemäß ZuG 2007 [53]
Wie man aus der Abbildung entnehmen kann, dürfen von diesen Sektoren zwischen 2005 und 2007 bis zu 503 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr ausgestoßen werden. In der zweiten Zuteilungsperiode sollen die Emissionen in den Bereichen bis 2012 auf 495 Mio. Tonnen jährlich reduziert werden. Abschnitt 3 des ZuG 2007 (§§ 7-18) legt in drei Unterabschnitten die Grundregeln für die Zuteilung (§§ 7-11), die besonderen Zuteilungsregeln (§§ 12-15) sowie die allgemeinen Zuteilungsvorschriften (§§ 16-18) fest und wird in Kapitel 2.2.2.2 beleuchtet. Nach Abschnitt 4 (§§19,20), der die Ausgabe und Überführung von Berechtigungen regelt, enthält abschließend Abschnitt 5 (§§ 21-24) gemeinsame Vorschriften. Diese beinhalten neben Regelungen über Ordnungswidrigkeiten, Zuständigkeiten und dem Inkrafttreten des Gesetzes auch eine Regelung über Kosten für Amtshandlungen, die in der Emissionshandelskostenverordnung 2007 konkretisiert sind.
2.2 Emissionshandel
Der Emissionshandel ist das wichtigste Instrument des Kyoto-Protokolls. Mit Beginn des Jahres 2005 haben die EU und die Bundesrepublik Deutschland den Emissionshandel auf Unternehmensebene als neues Instrument für den Klimaschutz eingeführt. In den folgenden Kapiteln werden das Prinzip des
Emissionshandels, die konkrete Ausgestaltung in der Praxis sowie deren Umsetzung in Unternehmen speziell in der Bundesrepublik Deutschland aufgezeigt.
2.2.1 Grundlagen des Emissionshandels
Der Emissionshandel stellt ein neues marktwirtschaftliches Instrument der Klimapolitik dar. Die essentielle Idee, die diesem Instrument zu Grunde liegt, besteht darin, Treibhausgas-Emissionen zu einem handelbaren Gut zu machen.[54] In einem ersten Schritt legt der Staat dabei eine Gesamtmenge an Emissionen fest, „die innerhalb eines bestimmten Zeitraums im Rahmen des Systems freigesetzt werden darf.“[55] Dabei ist der Ausstoß von Schadstoffen insgesamt begrenzt (cap) und den verpflichteten Unternehmen nur dann gestattet, wenn sie über Emissionsrechte verfügen. Zunächst wird den verpflichteten Emittenten die Gesamtmenge in der so genannten Anfangsallokation vom Staat zugeteilt. Nach Ablauf einer Periode ist jeder Emittent dazu verpflichtet, eine Menge an Emissionsberechtigungen abzugeben, die seinen in dieser Periode getätigten Emissionen entspricht. Andernfalls sind Sanktionszahlungen fällig. Die Menge der tatsächlich getätigten Emissionen wird entweder gemessen oder berechnet.[56] „Entscheidend ist dabei, dass die Emittenten über ihre anfangs zugeteilte Emissionsmenge hinaus emittieren dürfen, wenn sie eine entsprechende Anzahl an Emissionsberechtigungen erwerben.“[57] Falls die vom Unternehmen getätigten Emissionen unterhalb der staatlichen Zuteilung liegen, können die überschüssigen Emissionsberechtigungen verkauft werden. Dadurch entsteht ein Handel (trade) mit Emissionsrechten. Die Recheneinheit für die Emissionen ist eine Tonne CO2-Äquialent.[58] „Statt alle Betreiber auf die gleichen starren
Emissionswerte festzulegen, wird den Unternehmern ökonomische Flexibilität ermöglicht.“[59] Infolgedessen werden Emittenten mit hohen Vermeidungskosten Emissionszertifikate hinzukaufen, im Gegensatz zu Emittenten mit niedrigen Vermeidungskosten, die verkaufen.[60] „Dadurch lassen sich Umweltziele kosteneffizient erreichen.“[61] Diese Aussage soll im folgenden Beispiel zusammen mit Abbildung 5 verdeutlicht werden.
„Bei zwei Unternehmen A und B fallen bei der Produktion mit ihren vorhandenen Anlagen Emissionen von jeweils 11.000 t CO2 pro Jahr an, zusammen also 22.000 t CO2. Das staatlich vorgegebene Emissionsziel beträgt jedoch insgesamt nur 20.000 t CO2, wobei jedes der beiden Unternehmen Emissionsberechtigungen für 10.000 t CO2-Emissionen gratis zugeteilt bekommt. Folglich besteht ein Minderungsbedarf für beide Unternehmen von zusammen 2.000 t CO2. Die Unternehmen verfügen über Maßnahmen zur Emissionsminderung, die unterschiedliche Kosten verursachen. A kostet jede vermiedene t CO2 5 € und B 9 €. Handeln die Unternehmen ihre Emissionsberechtigungen nicht, entspricht dies einem vorgegebenen Emissionsgrenzwert von 10.000 t CO2 je Unternehmen. In diesem Fall werden beide Unternehmen ihre Emissionen jeweils um 1.000 t auf die geforderten 10.000 t verringern. Für A fallen Kosten in Höhe von 1.000-mal 5 €, d.h. 5.000 € an für B 1.000-mal 9 €, was 9.000 € entspricht. Somit kostet die gesamte Emissionsminderung 14.000 €. Das Emissionsziel von 20.000 t CO2 lässt sich allerdings kostengünstiger erreichen, wenn nur A seine Emissionen mindert. D.h. B emittiert weiterhin 11.000 t CO2 und A verringert seine Emissionsmenge auf 9.000 t CO2. Dies würde 2.000-mal 5 €, d.h. insgesamt 10.000 € kosten. Der Anreiz für A besteht im Verkauf seiner überschüssigen 1.000 t Emissionsberechtigungen für mehr als 5 € je t. Da B genau diese Menge an Rechten fehlt und seine Minderung 9 € je Tonne kosten, wird B bereit sein, diese Emissionsberechtigungen für einen Preis zu kaufen, der unter 9 €/t liegt. Wenn sich beide beispielsweise auf 7 € einigen, fallen bei B Kosten von 7.000 € (für den Kauf) an und bei A von 3.000 € (10.000€ Minderungskosten abzüglich 7.000 € Verkaufserlös). Folglich sind nicht nur die Gesamtkosten kleiner als im zuvor betrachteten Fall, sondern auch die Kosten für jedes der beiden Unternehmen.“[62]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Kosteneinsparung durch den Emissionshandel [63]
Der Emissionshandel als flexibles Instrument schafft zum einen statische Effizienz und zum anderen dynamische Effizienz. Unter statischer Effizienz versteht man in diesem Zusammenhang, dass der Emissionshandel ein bestimmtes Umweltziel dadurch erreicht, dass unter Ausnutzung der Marktmechanismen klimaschädliche Gase dort vermindert werden, wo dies zu den geringsten Kosten geschehen kann. Für die Emissionszertifikate bildet sich am Markt ein Preis, der Angebot und Nachfrage zum Ausgleich bringt.[64] Durch die Begrenzung der gesamten Emissionsmenge und deren kontinuierliche Herabsetzung erreicht der Staat die Verminderung des gesamten Schadstoffausstoßes. Aufgrund dieser von staatlicher Seite herbeigeführten Verknappung wird der Preis für die Zertifikate höher steigen, je knapper die Emissionsberechtigungen werden.[65] Der Preis, der beim Verkauf von Emissionszertifikaten von den Unternehmen erzielt werden kann, „setzt auch Anreize, durch Forschung, Entwicklung und Innovation weitere Minderungspotentiale zu erschließen, da frei werdende Emissionsberechtigungen am Markt verkauft werden können.“[66] In diesem Kontext spricht man auch von der dynamischen Effizienz des Emissionshandels.
2.2.2 Emissionshandel in der Praxis
Seit dem 01. Januar 2005 ist das Instrument des Emissionshandels in die Praxis umgesetzt worden. Für die Europäische Union ist ein Handelssystem auf Basis des Kyoto-Protokolls entwickelt worden, dass in allen 25 Mitgliedsstaaten der EU (vgl. Abbildung 6) sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein gilt. In der Bundesrepublik Deutschland wurde der Emissionshandel gemäß den Vorgaben der EU-Emissionshandelsrichtlinie als CAP- and TRADE Programm ausgelegt (vgl. hierzu Kapitel 2.2.1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Teilnehmerländer Europäischer Emissionshandel [67]
Als erste feste Handelsperiode wurde der Zeitraum von 2005 bis 2007 fixiert, daran werden sich weitere Handelsperioden im Fünfjahresrhythmus einreihen (2007 bis 2012, 2013 bis 2017, etc.). Ferner werden auch die anderen Flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls in der EU umgesetzt werden. Für die projektbezogenen Maßnahmen CDM und JI hat der Rat der Europäischen Union im Oktober 2004 die Linking Directive zur Änderung der Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG endgültig angenommen. Mit dem Inkrafttreten am 13. November 2004 können CER-Zertifikate bereits in der ersten Handelsperiode von den Unternehmen zur Tilgung ihrer Verpflichtung aus der Emission von Treibhausgasen eingelöst werden. ERU-Zertifikate können allerdings erst in der zweiten EU-Handelsperiode ab 2008 verwendet werden.[68] Der Vollzug des
Emissionshandels in der Bundesrepublik Deutschland liegt in den Händen der beim Bundesministerium für Umwelt eingerichteten Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt). Die DEHSt fungiert hierbei als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen der deutschen Wirtschaft, deren Anlagen dem Emissionshandel unterliegen. Hauptaufgabe der DEHSt ist die Vergabe und die Löschung der nicht verbrieften Emissionszertifikate. Hierbei führt die DEHSt ein Register, in dem ähnlich wie bei einem Grundbuch eingetragen ist, wer im Besitz welcher Emissionsberechtigungen ist.[69] Laut § 14 II TEHG kann neben den Anlagenbetreibern jede natürliche und juristische Person Emissionszertifikate kaufen, besitzen, verkaufen oder löschen. Hierzu ist die Eröffnung eines Kontos beim deutschen Register eine notwendige Bedingung. „Diese so genannten Personenkonten können auf Antrag für Privatpersonen, professionelle Händler oder NGO’s eingerichtet werden.“[70] Für die Kontoeinrichtung ist in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 gemäß EHKostV 2007 eine einmalige Gebühr von 200 € zu entrichten.
Für die Unternehmen die zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichtet sind, stellt dessen Umsetzung eine große Herausforderung dar. Der Gesetzgeber verpflichtet die ca. 1.200 Betreiber, mit ihren 1.849 in der Bundesrepublik Deutschland zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichteten Anlagen, zu folgenden Schritten:
- Beantragung der Genehmigung
- Beantragung der Zuteilung an Berechtigungen
- Monitoring und Verifizierung
- Rückgabe der Zertifikate[71]
2.2.2.1 Anlagen und Gase
In der Vergangenheit war die Emission von Treibhausgasen von Unternehmen grundsätzlich erlaubt. Dies hat sich seit dem 01. Januar 2005 grundlegend gewandelt. Gemäß § 4 I TEHG bedarf die Freisetzung von Treibhausgasen der Genehmigung, sofern die Freisetzung der Treibhausgase durch eine Tätigkeit im Sinne des Anhang 1 des TEHG erfolgt. Mit Anhang 1 des TEHG (vgl. Abbildung 7) folgt das Gesetz der EU-Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG. „Die betroffenen Anlagen, die im Anhang 1 des Gesetzes aufgeführt sind, decken sich mit den Vorgaben der EU-Richtlinie.“[72] Das deutsche Gesetz sieht darüber hinaus einige Ausnahmeregelungen zum Beispiel für Anlagen, die Forschungszwecken oder ausschließlich der Verbrennung von Siedlungsabfällen dienen, vor.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Anhang 1 TEHG [73]
[...]
[1] Umweltbundesamt (Hrsg.), Spürbarer Klimawandel, 2005.
[2] Vgl. Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 17.
[3] Jonas, M./Staeger, T./Schönwiese, C., Wahrscheinlichkeit, 2005, S. 8.
[4] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Umweltpolitik, 2002, S. 1.
[5] Art 2 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) vom 09.05.1992.
[6] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 9.
[7] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 16.
[8] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 16.
[9] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 11.
[10] Eigene Darstellung, Quelle: www.umweltbundesamt.de.
[11] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 17.
[12] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 11.
[13] Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 45.
[14] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 15.
[15] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 15.
[16] Vgl. Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 45.
[17] Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 45.
[18] Quelle: Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 48.
[19] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 15f.
[20] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 18.
[21] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 18.
[22] Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz - KWKG 2002) vom 19. März 2002.
[23] Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG) vom 21. Juli 2004.
[24] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 18f.
[25] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 19.
[26] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 19.
[27] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 19.
[28] Quelle: Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 44.
[29] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 41.
[30] Vgl. Die Bundesregierung (Hrsg.), Perspektive für Deutschland, 2002, S. 95
[31] Richtlinie 2003/87/EG vom 13.10.2003.
[32] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 72.
[33] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 31f.
[34] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 43.
[35] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 43.
[36] Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz - TEHG) vom 8. Juli 2004.
[37] Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsgesetz 2007 - ZuG 2007) vom 26. August 2004.
[38] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 72f.
[39] Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsverordnung 2007 - ZuV 2007) vom 31. August 2004.
[40] Kostenverordnung zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und zum Zuteilungsgesetz 2007 (Emissionshandelskostenverordnung 2007 - EHKostV 2007) vom 31. August 2004.
[41] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 63.
[42] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 101.
[43] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 144.
[44] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 144f.
[45] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 100.
[46] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 101.
[47] Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 147.
[48] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 104.
[49] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 104f.
[50] Vgl. Elpas, M./Salje, P./Stewing, C., Emissionshandel, 2006, S. 147.
[51] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 106.
[52] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 73.
[53] Eigene Darstellung, Quelle: ZuG 2007.
[54] Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Emissionshandel, 2005, S. 4.
[55] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 68.
[56] Vgl. Völker-Lehmkuhl, K., Bilanzierung und Besteuerung CO2-Emissionsrechte, 2006, S. 10.
[57] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 68.
[58] Vgl. Völker-Lehmkuhl, K., Bilanzierung und Besteuerung CO2-Emissionsrechte, 2006, S. 10.
[59] Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Emissionshandel, 2005, S. 4.
[60] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 68.
[61] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 68.
[62] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 69.
[63] Quelle: Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 70.
[64] Vgl. Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 68.
[65] Vgl. Völker-Lehmkuhl, K., Bilanzierung und Besteuerung CO2-Emissionsrechte, 2006, S. 11.
[66] Betz, R./Rogge, K./Schleich, J., Flexible Instrumente, 2005, S. 68.
[67] Quelle: www.dehst.de.
[68] Vgl. Völker-Lehmkuhl, K., Bilanzierung und Besteuerung CO2-Emissionsrechte, 2006, S. 13f.
[69] Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Emissionshandel, 2005, S. 8.
[70] Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 89.
[71] Vgl. Völker-Lehmkuhl, K., Bilanzierung und Besteuerung CO2-Emissionsrechte, 2006, S. 17.
[72] Levin, T., Emissionshandel, 2005, S. 84.
[73] Quelle: TEHG.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836616355
- DOI
- 10.3239/9783836616355
- Dateigröße
- 2.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Juli)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- emissionszertifikat emissionsrechtehandel estg emissionshandel
- Produktsicherheit
- Diplom.de