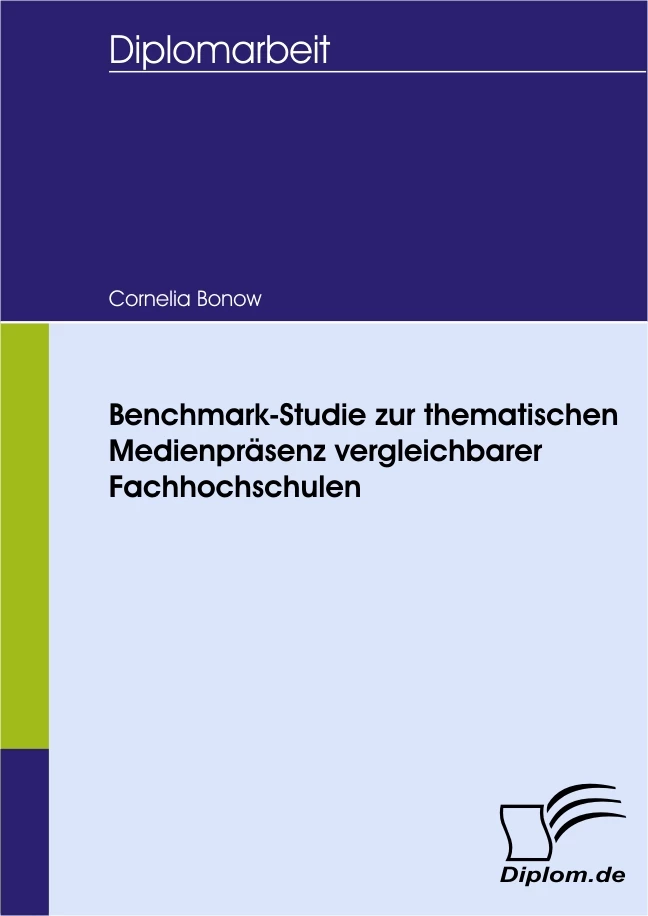Benchmark-Studie zur thematischen Medienpräsenz vergleichbarer Fachhochschulen
Zusammenfassung
Hochschulen, insbesondere deren Pressestellen, stehen aktuell vor drei großen kommunikativen Herausforderungen: Erstens müssen sich Hochschulen dem zunehmenden Wettbewerb untereinander sowohl international als auch national stellen. Zweitens kämpfen Hochschulen derzeit mit steigenden Studentenzahlen, da zum einen die geburtenreichen Jahrgänge von den Schulen abgehen und zum anderen etliche Bundesländer auf Abitur in zwölf Jahren umgestellt haben, so dass 2012 gleichzeitig zwei Jahrgänge an Abiturienten auf den (Aus-)Bildungsmarkt drängen. Drittens sind Hochschulen im Rahmen des Bologna-Prozesses und der damit verbundenen Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes bis 2012 dazu verpflichtet, auf Bachelor- und Masterabschlüsse umzustellen.
Daraus ergeben sich folgende Problemstellungen für die Hochschulen: Erstens, der Wettbewerb nimmt durch den bereits erwähnten Bologna-Prozess und die Angleichung an einen einheitlicheren Hochschulraum in Europa zu. Dies äußert sich aber nicht nur im Konkurrenzkampf um Studenten oder Professoren und Dozenten, sondern auch im Wettstreit um Gelder, Forschungsaufträge der Wirtschaft und Industrie sowie der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit allgemein. Zweitens führt eine Erhöhung der Zahl der potentiellen Studenten zu einer vergrößerten Zielgruppe, die mit Hilfe von Werbemitteln, Events und Messen angesprochen werden soll. Auch die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Ansprache. Erfahrungsgemäß bedeutet eine vergrößerte Zielgruppe für dieses Kommunikationsinstrument, dass der Kreis der anzusprechenden Personen zunimmt, während gleichzeitig die Reichweite in diesem Personenkreis für die bisher genutzt Medien proportional hingegen kein Wachstum erfährt.
Aus diesem Grund reicht es nicht aus, lediglich die Anzahl der Studienplätze aufzustocken. Vielmehr ist es auch notwendig, die Aufwendungen für den Bereich Kommunikation anzupassen. Sollte das Budget nicht mitwachsen und die Mediaplanung nicht entsprechend angepasst werden, kann man davon ausgehen, dass es zu erhöhten Streuverlusten kommt und damit bei gleichbleibender Kommunikation die durchschnittliche Kontaktzahl sinkt. Die Anzahl der erzielten Kontakte nimmt ab, da sie sich auf eine wesentlich größere Anzahl Personen verteilt, die es zu erreichen gilt. Gerade diese Durchschnittskontakte entscheiden aber über die Wahrnehmung in der Zielgruppe, denn nur wenn eine bestimmte Kontaktzahl erreicht wird, erfolgt die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung der Diplomarbeit und Vorgehensweise
2 Allgemeine Grundlagen und Begriffsklärungen
2.1 Hochschulen in Deutschland
2.2 Benchmarking und Benchmarks
2.3 Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit
2.3.1 Begriffsklärung
2.3.2 Instrumente der Public Relations
3 Medienarbeit an Hochschulen
3.1 Interne und externe Umwelt der Hochschulen
3.2 Ziele der Hochschul-Public Relations
3.3 Kommunikative Herausforderungen an Hochschulen
3.3.1 Konkurrenzkampf auf nationaler und internationaler Ebene im Zuge des Bologna-Prozess
3.3.2 Steigende Zahl der Studienanfänger
3.4 Auswahl der Vergleichshochschulen
3.4.1 Beschränkung der Auswahl
3.4.2 Studiengänge der Hochschule der Medien
3.4.3 Vergleich der Studienangebote der relevanten Hochschulen
3.5 Bedeutung von Medienanalysen
3.6 Methodik der Medienanalyse im Printbereich
3.7 Anforderungen an die Medienanalyse
3.8 Grenzen und Probleme bei der Medienanalyse
3.8.1 Probleme basierend auf der Vorgehensweise
3.8.2 Einschränkungen bezüglich des zugrundeliegenden Materials
3.8.3 Grenzen durch unterschiedliche Medien- und Hochschullandschaften
4 Umsetzung der Anforderungen an eine Medienanalyse
4.1 Angabe der Stichprobe
4.2 Regelwerk für die Vorgehensweise
4.2.1 Auswahl der gelieferten Clippings
4.2.2 Einteilung nach Relevanz der Clippings
4.2.3 Festlegung der Themen für die Analyse
4.2.4 Herkunft der Pressemitteilungen
4.3 Kriterien für Tonalität der Veröffentlichung
4.4 Differenzierung der Clippings
4.5 Gültige Saldierung der Werte
4.6 Gültigkeit der Interpretation der Befunde
4.7 Einschränkungen bei der vorliegenden Medienanalyse
4.7.1 Analyse des Datenmaterials
4.7.2 Beschreibung der Medienlandschaft
4.7.3 Abbildung der Pressestellen und Hochschullandschaft
5 Analyse und Auswertung der Ergebnisse
5.1 Quantitative Analyse
5.2 Qualitative Analyse
5.3 Bewertung der grafischen Auswertungen
5.3.1 Allgemeine Analyse
5.3.2 Thematische Analyse
5.4 Schlussfolgerungen für die Pressearbeit der HdM
5.4.1 Thematische Unique Selling Proposition (USP)
5.4.2 Nutzung bereits stark besetzter Themen
5.4.3 Chancen bei noch wenig belegten Themen
5.5 Zusammenfassung
6 Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland
Abb. 2: Makro- und Mikroumwelt deutscher Hochschulen
Abb. 3: Anzahl der Clippings
Abb. 4: Anzahl Clippings im Beobachtungszeitraum
Abb. 5: Anzahl Clippings im Beobachtungszeitraum in Prozent
Abb. 6: Anzahl Clippings nach Relevanz der Hochschulen
Abb. 7: Anzahl Clippings nach Relevanz der Hochschulen in Prozent
Abb. 8: durchschnittliche Anzahl der Wörter eines abgedruckten Artikels
Abb. 9: durchschnittliche Anzahl der Wörter nach Relevanz der Hochschule im Artikel
Abb. 10: Gruppierungen für die durchschnittliche Anzahl der Wörter eines Artikels
Abb. 11: Gruppierung für die durchschnittliche Anzahl der Wörter eines Artikels, wenn Hochschule Hauptthema ist
Abb. 12: Gruppierung für die durchschnittliche Anzahl der Wörter eines Artikels, wenn Hochschule Nebenthema ist
Abb. 13: Gruppierung für die durchschnittliche Anzahl der Wörter eines Artikels, wenn Hochschule Randthema ist
Abb. 14: Tonalität der Artikel
Abb. 15: Tonalität der Artikel in Prozent
Abb. 16: Tonalität der Artikel je Hochschule, wenn Hochschule Hauptthema ist
Abb. 17: Tonalität der Artikel in Prozent je Hochschule, wenn Hochschule Hauptthema ist
Abb. 18: Tonalität der Artikel je Hochschule, wenn Hochschule Nebenthema ist
Abb. 19: Tonalität der Artikel in Prozent je Hochschule, wenn Hochschule Nebenthema ist
Abb. 20: Tonalität der Artikel je Hochschule, wenn Hochschule Randthema ist
Abb. 21: Tonalität der Artikel in Prozent je Hochschule, wenn Hochschule Randthema ist
Abb. 22: Themen der Berichterstattung
Abb. 23: Themen der Berichterstattung, wenn Hochschule Hauptthema ist
Abb. 24: Themen der Berichterstattung, wenn Hochschule Nebenthema ist
Abb. 25: Themen der Berichterstattung, wenn Hochschule Randthema ist
Abb. 26: Nennungen der Hochschule in allen Clippings
Abb. 27: Art der Nennungen der Hochschule der Medien
Abb. 28: Art der Nennungen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
Abb. 29: Art der Nennungen der Hochschule Pforzheim
Abb. 30: Art der Nennungen der FHM
Abb. 31: durchschnittliche Anzahl der Nennungen im Artikel
Abb. 32: Anzahl der Nennungen in der Headline
Abb. 33: Einteilung der Clippings nach Mediengattung
Abb. 34: Einteilung der Clippings nach Mediengattung in Prozent
Abb. 35: Einteilung der Clippings nach Verbreitung in regional und überregional
Abb. 36: Einteilung der Clippings nach Verbreitung in regional und überregional in Prozent
Abb. 37: Top3-Medien nach Häufigkeit der Veröffentlichung (HdM)
Abb. 38: Leserschaft des Top-Mediums Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter
Nachrichten bezogen auf HdM
Abb. 39: Top3-Medien nach Häufigkeit der Veröffentlichung (HTWK)
Abb. 40: Leserschaft des Top-Mediums Leipziger Volkszeitung bezogen auf HTWK
Abb. 41: Top3-Medien nach Häufigkeit der Veröffentlichung (HS Pforzheim)
Abb. 42: Leserschaft des Top-Mediums Pforzheimer Zeitung bezogen auf HS Pforzheim
Abb. 43: Top3-Medien nach Häufigkeit der Veröffentlichung (FHM)
Abb. 44: Leserschaft des Top-Mediums Süddeutsche Zeitung bezogen auf FHM
Abb. 45: Einteilung der Clippings nach veröffentlichter Auflage
Abb. 46: Einteilung der Clippings nach veröffentlichter Auflage in Prozent
Abb. 47: Pressemitteilungen im Beobachtungszeitraum
Abb. 48: Verhältnis der ausgesandten Pressemitteilungen zum Abdruck der Pressemitteilungen (Input-Output-Analyse)
Abb. 49: Grad der Adaption der Headline einer Pressemeldung
Abb. 50: Grad der Adaption der Headline einer Pressemeldung in Prozent
Abb. 51: PM der HdM und deren Veröffentlichungen nach Wortarten
Abb. 52: PM der HdM und deren Veröffentlichungen nach Wortarten in Prozent
Abb. 53: PM der HTWK und deren Veröffentlichungen nach Wortarten
Abb. 54: PM der HTWK und deren Veröffentlichungen nach Wortarten in Prozent
Abb. 55: PM der HS Pforzheim und deren Veröffentlichungen nach Wortarten
Abb. 56: PM der HS Pforzheim und deren Veröffentlichungen nach Wortarten in Prozent
Abb. 57: PM der HS München und deren Veröffentlichungen nach Wortarten
Abb. 58: PM der HS München und deren Veröffentlichungen nach Wortarten in Prozent
Abb. 59: Anzahl der Sätze in der herausgegebenen PM der HdM und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 60: Anzahl der Sätze in der herausgegebenen PM der HTWK und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 61: Anzahl der Sätze in der herausgegebenen PM der HS Pforzheim und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 62: Analyse der Sätze in der herausgegebenen PM der HS München und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 63: Analyse der Sätze in der herausgegebenen PM der HdM und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 64: Analyse der Sätze in der herausgegebenen PM der HTWK und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 65: Analyse der Sätze in der herausgegebenen PM der HS Pforzheim und den Veröffentlichungen der PM
Abb. 66: Anzahl der Sätze in der herausgegebenen PM der HS München und den Veröffentlichungen der PM
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Hochschulen, insbesondere deren Pressestellen, stehen aktuell vor drei großen kommunikativen Herausforderungen: Erstens müssen sich Hochschulen dem zunehmenden Wettbewerb untereinander sowohl international als auch national stellen.[1] Zweitens kämpfen Hochschulen derzeit mit steigenden Studentenzahlen, da zum einen die geburtenreichen Jahrgänge von den Schulen abgehen und zum anderen etliche Bundesländer auf Abitur in zwölf Jahren umgestellt haben, so dass 2012 gleichzeitig zwei Jahrgänge an Abiturienten auf den (Aus-)Bildungsmarkt drängen.[2] Drittens sind Hochschulen im Rahmen des Bologna-Prozesses und der damit verbundenen Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes bis 2012 dazu verpflichtet, auf Bachelor- und Masterabschlüsse umzustellen.[3]
Daraus ergeben sich folgende Problemstellungen für die Hochschulen: Erstens, der Wettbewerb nimmt durch den bereits erwähnten Bologna-Prozess und die Angleichung an einen einheitlicheren Hochschulraum in Europa zu. Dies äußert sich aber nicht nur im Konkurrenzkampf um Studenten oder Professoren und Dozenten, sondern auch im Wettstreit um Gelder, Forschungsaufträge der Wirtschaft und Industrie sowie der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit allgemein.[4] Zweitens führt eine Erhöhung der Zahl der potentiellen Studenten zu einer vergrößerten Zielgruppe, die mit Hilfe von Werbemitteln, Events und Messen angesprochen werden soll. Auch die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Ansprache. Erfahrungsgemäß bedeutet eine vergrößerte Zielgruppe für dieses Kommunikationsinstrument, dass der Kreis der anzusprechenden Personen zunimmt, während gleichzeitig die Reichweite in diesem Personenkreis für die bisher genutzt Medien proportional hingegen kein Wachstum erfährt.[5] Aus diesem Grund reicht es nicht aus, lediglich die Anzahl der Studienplätze aufzustocken. Vielmehr ist es auch notwendig, die Aufwendungen für den Bereich Kommunikation anzupassen. Sollte das Budget nicht mitwachsen und die Mediaplanung nicht entsprechend angepasst werden, kann man davon ausgehen, dass es zu erhöhten Streuverlusten[6] kommt und damit bei gleichbleibender Kommunikation die durchschnittliche Kontaktzahl sinkt. Die Anzahl der erzielten Kontakte nimmt ab, da sie sich auf eine wesentlich größere Anzahl Personen verteilt, die es zu erreichen gilt. Gerade diese Durchschnittskontakte entscheiden aber über die Wahrnehmung in der Zielgruppe, denn nur wenn eine bestimmte Kontaktzahl erreicht wird, erfolgt die bewusste Wahrnehmung.[7] Zu dem erhöhten Wettstreit zwischen den Hochschulen und der vergrößerten Zielgruppe kommt als dritter Punkt die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge. Damit verbunden besteht ein hoher Informationsbedarf zu geänderten Angeboten und auslaufenden Diplomstudiengängen. Aber auch die sich ergebenden Chancen, wie z.B. die Möglichkeit des frühzeitigeren Jobeinstiegs durch die verkürzte Studienzeit oder die verbesserte internationale Vergleichbarkeit der Abschlüsse, müssen kommuniziert werden. Die veränderten Gegebenheiten am Hochschulmarkt machen es folglich dringend erforderlich, die Unterschiede zu den auslaufenden Diplomstudiengängen sowie dieses komplett neue Angebot verstärkt zu kommunizieren.[8]
Für die Hochschule der Medien wird der gesteigerte Wettbewerb bspw. durch die Zunahme ähnlicher Angebote bzw. Studieninhalte an anderen Hochschulen verursacht. Damit es der Hochschule auch weiterhin gelingt, Studenten mit hohem Potential für sich zu gewinnen, muss die Hochschule der Medien auf die gestiegene Zahl der Studienanfänger reagieren und in wachsendem Maße die Kommunikation des eigenen genau definierten Profils betreiben. Nur durch eine ausgeprägte und intensive Werbewirkung, verursacht durch eine hohe Anzahl von Kontakten, kann die notwendige Bekanntheit in der Zielgruppe gehalten bzw. gesteigert werden.[9] Im Bereich der Umstellung auf das Bachelorsystem scheint die Kommunikation zu funktionieren, aktuell veröffentlichte Zahlen zeigen, dass sich analog zu den Diplom-Studiengängen auch für die Bachelor-Studiengänge wesentlich mehr Interessenten bewerben als Studienplätze vorhanden sind, und sich die zum Sommersemester 2007 eingeführten Studiengebühren nicht negativ auswirken.[10] Im Vergleich dazu präsentieren sich bundesweit die Zahlen für den Bereich der Masterstudiengänge zwar schon recht positiv, wobei die Akzeptanz bei ausländischen Studenten derzeit noch höher als bei Inländern liegt.[11] Auch für die Masterstudiengänge der Hochschule der Medien, die ab dem Wintersemester 2007/2008 belegt werden können, gilt es entsprechende Bewerberzahlen zu erzielen und für eine gute Auslastung der Kapazitäten zu sorgen.
1.2 Zielsetzung der Diplomarbeit und Vorgehensweise
Die vorliegende Diplomarbeit beschreibt eine Untersuchung zur Pressearbeit der Hochschule der Medien im Vergleich zu anderen Hochschulen mit Hilfe einer Medienanalyse. Untersucht werden die quantitativen und qualitativen Merkmale der Presseveröffentlichungen (Clippings). Dabei stehen vor allem die Themen im Vordergrund, mit denen die Hochschule der Medien und die Vergleichshochschulen in den Medien präsent sind. Neben den allgemeinen Informationen aus der Medienanalyse sollen Themen abgeleitet werden, die die HdM besetzen kann, die die Vergleichshochschulen wiederum nicht belegen bzw. nicht belegen können. Zielsetzung ist es, anhand der grafischen und textlichen Auswertung Schlussfolgerungen in Form von Benchmarks zu geben und eine Empfehlung für die Hochschule der Medien zu entwickeln.
2 Allgemeine Grundlagen und Begriffsklärungen
2.1 Hochschulen in Deutschland
Abbildung 1 zeigt die Hochschullandschaft in Deutschland als wichtigen Bestandteil des gesamten Bildungswesens.
Abb. 1: Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), http://www.kmk.org/doku//dt-2006.pdf, Stand 2007-10-05
Laut aktueller Studie des Statistischen Bundesamts gliedern sich die 379 Hochschulen in Deutschland (2005/2006) in 172 Fachhochschulen, 103 Universitäten, 53 Kunsthochschulen, 30 Verwaltungshochschulen, 15 Theologische Hochschulen sowie sechs Pädagogische Hochschulen. Auf eine detaillierte Unterscheidung wird in dieser Arbeit aus Gründen des Umfangs verzichtet. Der Begriff Hochschule bezieht sich im Folgenden auf alle Hochschularten.[12]
Der Begriff Hochschule selbst definiert sich i.S. des Hochschulrahmengesetzes als alle Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen und sonstige Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind.[13]
Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden die Begriffe Hochschule und Universität nicht von einander abgegrenzt, sondern synonym verwendet.
2.2 Benchmarking und Benchmarks
Der aus dem Englischen stammende Begriff Benchmark bedeutet übersetzt Festpunkt. Mit seiner ursprünglichen Bedeutung aus dem handwerklichen Bereich, nämlich dem Einritzen von Markierungen in eine Werkbank, hat er heutzutage nicht mehr viel gemein. Im weitesten Sinne ist ein Benchmark ein Vergleichsstandard, mit Hilfe dessen andere Größen beurteilt werden. Der Begriff kann auch als Referenzpunkt für die bestmögliche Leistung verstanden werden, aus dem sich Werte ableiten lassen, die Vergleiche mit dem Wettbewerb möglich machen.[14]
Benchmarking selbst ist „ein systematischer Prozess, bei dem das Unternehmen seine Prozesse, Methoden, Produkte, Dienstleistungen und/oder Strategien mit anderen [...] Benchmarking-Partner [...] vergleicht“.[15] Ziel ist es, in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit, von anderen Firmen oder Bereichen zu lernen und so Verbesserungen im eigenen Unternehmen zu ermöglichen.
Man unterscheidet dabei internes, extern-branchenbezogenes und extern-branchenübergreifendes Benchmarking. Intern bedeutet der Vergleich im eigenen Unternehmen, z.B. zwischen Tochtergesellschaften. Beim extern-branchenbezogene Benchmarking vergleicht sich das Unternehmen mit dem direkten Wettbewerb, während beim branchenübergreifenden sogar auf branchenfremde Bereiche zurückgegriffen wird.
Als Basis für den Vergleich wird die sog. Best Practice genutzt, also Aspekte, die im jeweiligen Unternehmen, als vorbildlich umgesetzt gelten und ein gewisses Leistungsniveau widerspiegeln. Rota und Fuchs verstehen Benchmarks dabei als Messlatte, die auf der Best Practice beruht und bei Verbesserungen im eigenen Unternehmen unterstützt.[16]
Daraus lässt sich ableiten, dass es sich bei einer Benchmark-Studie, um einen Vergleich mittels der verschiedenen genau definierten Referenzpunkte handelt. Als Ergebnis dieser Analyse können anschließend Schlussfolgerungen oder Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Für die vorliegende Ausarbeitung bedeutet dies: Nach der Gegenüberstellung und Analyse der Pressearbeit der Vergleichshochschulen werden die gewonnen Erkenntnisse für Handlungsempfehlungen genutzt. Insbesondere anhand von thematischen Gesichtspunkten sollen Schlussfolgerungen für die zukünftige Pressearbeit gezogen werden.
2.3 Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit
2.3.1 Begriffsklärung
In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen für Public Relations (PR). Damit zusammenhängend existiert keine eindeutige Abgrenzung der Begriffe Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit, weswegen diese häufig synonym verwendet werden. Bisher konnte sich keine allgemein gültige Begriffsbestimmung durchsetzen, jedoch sollen im Folgenden kurz relevante Ansätze zum Begriffsverständnis vorgestellt werden. Dem Terminus Public Relations soll sich auf diese Art genähert werden, um ein der Arbeit zweckdienliches Verständnis zu schaffen. Nach Silbermann ist PR nunmehr „eine Strategie zur systematischen Beeinflussung der Öffentlichkeit“.[17]
Man kann diese Definition aber auch, wie Graf Zedtwitz-Arnim im Titel seines gleichnamigen Buches „Tue Gutes und rede darüber“[18] in Form einer Handlungsanweisung formulieren. Die sehr häufig verwendete Begriffsauslegung von Center und Cutlip beschreibt PR frei übersetzt als alle geplante Anstrengungen, um Meinungen und Handlungen zu beeinflussen. Entscheidend dabei sind zum einen die gründliche Planung der Aktivitäten, und zum anderen ein ethisch-moralisches, verantwortungsvolles Auftreten. Center und Cutlip verstehen PR als eine wechselseitige Kommunikation, durch welche alle Beteiligten zufrieden gestellt werden sollen.[19] Koschnik fasst sein Begriffsverständnis wie folgt zusammen: PR bzw. Öffentlichkeitsarbeit ist die „Information aller relevanten Öffentlichkeiten über die wesentlichen Ereignisse, Ergebnisse und Planungen einer Organisation nach innen und nach außen“.[20]
Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden die Begriffe Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit nicht von einander abgegrenzt, sondern gleichbedeutend verwendet.
2.3.2 Instrumente der Public Relations
Einen vollständigen Überblick aller denkbaren PR-Instrumente zu geben, ist im Rahmen dieser Arbeit aus Gründen des Umfangs nicht möglich, ist doch die in der Literatur beschriebene Menge an kommunikativen Möglichkeiten erheblich. Nachfolgend werden vollständigkeitshalber die wichtigsten PR-Instrumente genannt, ohne dabei näher auf Ziele und Zielgruppen der einzelnen Aktivitäten einzugehen.
Grundsätzlich unterscheidet man dabei in interne und externe PR. Aufgabe des Bereichs Human Relations als wichtigstem Teil der internen Kommunikation, ist die Verständigung mit und die Pflege der Beziehungen zu den Mitarbeitern.[21] Dadurch erhöht sich das Wissen der Mitarbeiter und das Verständnis für die internen Zusammenhänge sowie das Unternehmen selbst wird verstärkt. Ein informierter Mitarbeiter kann überzeugter mitarbeiten, sich effizienter einbringen und zudem fundiertere Entscheidungen treffen. Die Zusammenarbeit im und die Identifikation mit dem Unternehmen wird deutlich verbessert, Schnittstellenprobleme werden reduziert und die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter gesteigert. Langfristig ergibt sich daraus eine größere Zufriedenheit am Arbeitsplatz, wobei die Motivation der Mitarbeiter steigt.[22]
Instrumente der Human Relations können zum einen die personale Kommunikation durch Mitarbeiter-Gespräche oder -Veranstaltungen sein und zum anderen die mediale Kommunikation in schriftlicher oder elektronischer Form. Dazu gehören Printmedien wie die Mitarbeiter-Zeitung oder das Schwarze Brett aber auch elektronische Medien wie Intranet oder Mitarbeiter-Fernsehen. Einrichtungen und Angebote für die Mitarbeiter wie Kinderbetreuung oder Fitness-Kurse sind ebenfalls Elemente der Human Relations.[23]
Für die externe Umwelt und der damit verbundenen Vielzahl von Interessengruppen stehen die unterschiedlichsten Kommunikationsmittel zur Verfügung. Neben der persönlichen Kommunikation zur Beziehungspflege gehört bspw. auch der Bereich Events zum Aufgabenbereich der Public Relations. Auch in Fällen, bei denen die Organisation nicht im Bereich der PR angesiedelt ist, gilt es zumindest, für eine adäquate Berichterstattung zu sorgen. Von der Ausstellung über den klassischen Tag der offenen Tür, bis hin zu Symposien oder Foren gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen, die entweder durch eine eigene Presseinformation kommuniziert werden oder über die, verbunden mit einer Einladung von Journalisten, berichtet wird. Gerade bei wichtigen Themen sollte darüber hinaus eine Pressekonferenz oder ein Interview organisiert werden, wodurch sich die Möglichkeit bietet, gezielt Informationen an die Presse zu kommunizieren. Pressemappen oder Pressefotos bieten hier zusätzlich zum Geschäftsbericht Unterstützung. Zusätzlich zu den im vorangegangenen Abschnitt genannten Instrumenten der PR fallen Kundenzeitschrift, Internetauftritt und Kunden-Newsletter, aber auch Gewinnspiele oder Sponsoring und Fundraising in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.[24]
Neben den genannten Instrumenten spielt die Evaluation der durchgeführten PR-Aktionen eine entscheidende Rolle. Das geplante, zielorientierte Erfassen, Bewerten und Kontrollieren der PR ist insofern von wesentlicher Bedeutung, als dass sich zukünftige Maßnahmen nur dann ableiten bzw. planen und Budgets begründen lassen, wenn eingehend geprüft wurde, ob die PR-Kampagnen in der Vergangenheit erfolgreich waren.[25]
Auch für Hochschulen können die genannten Instrumente angewandt werden. Insbesondere auf diesem Sektor spielt aber die Pressearbeit, begründet in den geringen Budgets, eine entscheidende Rolle. Nach Wangen-Goss bietet der Non-Profit-Charakter zusätzlich eine größere Chance, dass Meldungen im redaktionellen Teil veröffentlicht werden, da Journalisten hier eher bereit sind, zu unterstützen.[26]
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich aus diesem Grund und aufgrund des beschränkten Umfangs der Ausarbeitung auf die Pressearbeit als Teil der Öffentlichkeitsarbeit von Hochschulen. Für die Analyse werden folglich nur die Print-Veröffentlichungen der Vergleichshochschulen im Untersuchungszeitraum genutzt.
3 Medienarbeit an Hochschulen
3.1 Interne und externe Umwelt der Hochschulen
Die Umwelt von Hochschulen setzt sich aus allen Umfeldbeziehungen (Makromarkt), die zugleich die Hauptnutzer und Zielgruppen des Leistungsangebotes beinhalten (Mikromarkt), zusammen.[27]
Abb. 2: Makro- und Mikroumwelt deutscher Hochschulen
Quelle: in Anlehnung an Trogele, Ulrich: Strategisches Marketing für deutsche Universitäten, S. 28
In dieser Abbildung bilden Studenten, Professoren und Fakultäten, aber auch alle Angestellte der Hochschule die interne Umwelt, und gehören folglich zur Mikroumwelt (gestreifte Flächen). Zur Makroumwelt (Flächen ohne Muster) zählen also alle externen Zielgruppen wie Öffentlichkeit, Schüler, Eltern, Lehrer, Kooperations-Partner, Forschungsinstitute, der öffentliche Dienst und die Gewerkschaften, aber auch Gewerbe, Industrie, sowie Bund, EU, andere Universitäten und Lieferanten der Hochschule.[28]
Diese Vielzahl von Zielgruppen erfordert eine individuelle Ansprache, sowohl das gewählte Instrument der Ansprache betreffend, als auch die kommunizierten Inhalte. Nur auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichen Ziele der Hochschul-PR erreichen.
3.2 Ziele der Hochschul-Public Relations
Hochschul-PR umfasst „grundsätzlich alle diejenigen Maßnahmen, die zum einen die internen Beziehungen […] untereinander, zum anderen die Beziehungen […] nach außen gestalten.“[29] Als öffentliche Institutionen unterliegen Hochschulen darüber hinaus dem staatlichen Auftrag, über die Erfüllung ihrer Aufgaben zu berichten.[30]
Nach Wangen-Goss lassen sich aus dem Zielsystem von Hochschulen Marketingziele ableiten, die sie in „quasiökonomische“[31] und „psychografische“[32] Ziele einteilt. Quasiökonomische Ziele für Hochschulen sind bspw. die Zunahme der Studentenzahl, die Steigerung der Nachfragezahlen für Studienplätze oder die Erhöhung der Nachfrage bspw. seitens der Industrie nach Forschung und Dienstleistungen der Hochschule. Psychographische Marketingziele wären nach Wangen-Goss u.a. die Steigerung des Bekanntheitsgrades oder die Veränderung bzw. Verstärkung des Images.[33]
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass ein quasiökonomisches Ziel wie eine Erhöhung der Anzahl der Immatrikulation von Studenten i.d.R. vor allem durch die Erreichung von psychografischen Zielen bspw. einem gesteigerten Bekanntheitsgrad, möglich wird. Folglich ebnet die Erfüllung der psychografischen Ziele den Weg zur Erreichung der ökonomischen Ziele. Die Kommunikationspolitik in Form von Werbung und PR ist dabei eine wesentliche Maßnahme zur Zielerreichung.[34] Wie bereits in Kapitel 2.3.2 erläutert, spielt in diesem Bereich besonders die Pressearbeit eine entscheidende Rolle und stellt ein wirkungsvolles Kommunikationsinstrument dar.
3.3 Kommunikative Herausforderungen an Hochschulen
3.3.1 Konkurrenzkampf auf nationaler und internationaler Ebene im Zuge des Bologna-Prozess
Wie bereits eingangs erwähnt, hat sich der Wettbewerb auf dem Bildungsmarkt sowohl national als auch international verschärft. Hochschulen wetteifern innerhalb Deutschlands nicht nur um Gelder für Forschungsprojekte, Personal und Sachmittel, sondern auch um wissenschaftliche Reputation oder öffentliche Anerkennung. Konkurrenten um staatliche Ressourcen sind dabei nicht mehr nur Hochschulen. In zunehmendem Ausmaß sind es staatliche, gesellschaftliche oder auch private Institutionen.[35]
International erhöht sich der Konkurrenzkampf aufgrund der zunehmenden Angleichung etwa im Zuge des Bologna-Prozesses und der damit verbundenen Schaffung eines europäischen Hochschulraumes durch Umstellung auf Bachelor- und Masterabschlüsse. Zudem wird die internationale Zusammenarbeit in Lehre und Forschung stetig ausgebaut und macht ein präzises Profil für die einzelnen Hochschulen notwendig.[36]
Um den beschriebenen Konkurrenzkampf erfolgreich zu bestehen, muss ein kommunikatives Ziel der Hochschul-PR die präzise Formulierung des eigenen Profils sein. Dazu gehört auch die Ausarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen, die eine klare Abgrenzung und Unterscheidbarkeit vom Wettbewerb ermöglichen. Dies ist besonders im Hinblick auf das Etablieren der Hochschule als Marke von großer Bedeutung.[37]
3.3.2 Steigende Zahl der Studienanfänger
Laut einer Pressemeldung des statistischen Bundesamts sind die Geburtenraten auch 2006 weiter gesunken.[38] Wie wirkt sich dieser seit einigen Jahren andauernde Trend auf die Zahl der studienberechtigten Schulabgänger und damit potentiellen Studienanfänger in Deutschland sowie insbesondere in Baden-Württemberg aus? Es scheint zu einer gegenläufigen Entwicklung zu kommen. Die Prognose der Kultusministerkonferenz vom Oktober 2005 für Studienanfänger, Studierende und Hochschulabsolventen bis 2020 geht davon aus, dass in Deutschland bis 2012 die Zahl der Studienanfänger auf bis zu 450.000 ansteigt, im Vergleich dazu waren es 2004 nur 368.000. Es wird aber weiterhin damit gerechnet, dass sich die Zahl bis 2020 bei maximal 390.000 Studienanfängern einpendelt.[39] Ob diese Zahlen mit Einführung der Studiengebühren zum Sommersemester 2007 so eintreffen werden, ist noch abzuwarten.
Der baden-württembergische Minister für Wissenschaft, Bildung, Forschung und Kunst, Prof. Dr. Peter Frankenberg, skizzierte auf dem Hochschulkongress der Landesregierung Baden-Württemberg Anfang 2006 die Zahlen für Baden-Württemberg wie folgt: 2000 gab es 42.500 Studienberechtigte, 2005 waren es bereits 52.000 und im Jahr 2011 werden es Hochrechnungen zu Folge 64.000 sein. Grund für diesen Zuwachs sind geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt die Schule abschließen. Hinzu kommt die ohnehin steigende Quote in der Höherqualifizierung und die Umstellung einiger Bundesländer z.B. Baden-Württemberg auf das Abitur in zwölf Jahren, so dass 2012 aufgrund von doppelten Abiturjahrgängen 87.000 Abiturienten in Baden-Württemberg auf den Bildungsmarkt drängen. Auch wenn das Spitzenjahr 2012 nicht als Maßstab für die Entwicklung des Hochschulsystems in Baden-Württemberg bzw. bundesweit dienen kann, so rechnet Frankenberg doch langfristig mit einem Zuwachs an Studienberechtigten um 25 bis 30 Prozent, so dass sich die Zahlen bei 65.000 bis 70.000 Studienanfängern jährlich einpendeln werden.[40]
Um diesem Ansturm auf den Bildungsmarkt und dem zunehmenden Wettbewerb sowohl national als auch international Stand zu halten, müssen die Hochschulen quantitativ, strukturell sowie inhaltlich ausbauen und sich qualitativ neuorientierten. Hinzu kommt, dass gerade im internationalen Vergleich in Deutschland weniger Schulabgänger ein Studium beginnen und die Bundesregierung es sich zum Ziel gemacht hat, diese Quote zu erhöhen.[41]
Um diese gesteigerten Anforderungen zu erfüllen, gilt es, sich trotz des enormen Umfangs an Angeboten und einer gewissen Heterogenität der Leistungen im konkurrierenden Umfeld bewusst gesteuert, also mit dem gewünschten Image, zu positionieren.[42]
In dieser Ausarbeitung soll dabei nur die thematische Positionierung in den Printmedien vergleichbarer Hochschulen untersucht werden, d.h. mit welchen Themen eine Hochschule präsent sein kann.
3.4 Auswahl der Vergleichshochschulen
3.4.1 Beschränkung der Auswahl
In Kapitel 2.1 wird das umfangreiche Bildungssystem mit seiner Vielzahl an Hochschulen abgebildet. Aus Gründen des Umfangs beschränkt sich diese Ausarbeitung für die Gegenüberstellung der Pressearbeit der Hochschule der Medien und der Pressearbeit von Wettbewerbern auf drei vergleichbare Hochschulen. Kriterien für die Auswahl sind Ähnlichkeiten in den Inhalten der Studiengänge im Vergleich zum Angebot der Hochschule der Medien. Stand Oktober 2007 wurden die Studieninhalte mit Hilfe der Internetauftritte der Hochschulen recherchiert. Durch eigene Recherchen wurden die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, die Hochschule Pforzheim und die Hochschule München als für eine Gegenüberstellung geeignet bewertet und folglich ausgewählt. Im Folgenden werden die Studieninhalte der Hochschule der Medien abgebildet und denen der Vergleichshochschulen gegenüber gestellt.
3.4.2 Studiengänge der Hochschule der Medien
Fakultät I Druck und Medien[43]
Die Fakultät I der Hochschule der Medien bietet folgende Studiengänge an:
Druck- und Medientechnologie (Bachelor)
Deutsch-chinesischer Studiengang Druck- und Medientechnologie (Bachelor)
Medieninformatik (Bachelor)
Mediapublishing (Bachelor)
Print-Media-Management (Bachelor)
Verpackungstechnik (Bachelor)
Packaging Design & Marketing (Master)
Print and Publishing (Master)
Deutsch-chinesischer Studiengang Drucktechnologie u. Management (Master)
Computer Science and Media (Master)
Fakultät II Electronic Media
In Fakultät II der Hochschule der Medien können nachstehende Studiengänge belegt werden:
Audiovisuelle Medien (Bachelor)
Medienwirtschaft (Bachelor)
Werbung und Marktkommunikation (Bachelor)
Elektronische Medien (Master)
Fakultät III Information und Kommunikation
Zur Fakultät III der Hochschule der Medien gehören die folgenden Studiengänge:
Bibliotheks- und Informationsmanagement (Bachelor)
Wirtschaftsinformatik (Bachelor)
E-Services (Bachelor)
Informationsdesign (Bachelor)
Bibliotheks- und Informationsmanagement (Master)
Information Systems and Services (Master)
3.4.3 Vergleich der Studienangebote der relevanten Hochschulen
An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig finden sich im Fachbereich Medien u.a. die Studiengänge Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Diplom), Buchhandel/Verlagswirtschaft (Diplom), Druck- und Verpackungsherstellung (Diplom), Medientechnik (Diplom) oder Verlagsherstellung (Diplom)[44], die den Studiengängen der Fakultäten I und III der Hochschule der Medien ähneln. Für diese Hochschulen wird untersucht, wie sich die Pressearbeit thematisch unterscheidet. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund: Zum einen nach den Themen, die in der Presse besetzt werden und zum anderen welche Themen davon nur die Hochschule der Medien besetzen kann.
Die Hochschule Pforzheim mit der Fakultät Technik und dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor), der Fakultät Gestaltung und dem Studiengang visuelle Kommunikation (Bachelor) sowie mit den Studiengängen Marketing (Bachelor) und Werbung (Bachelor) der Fakultät Wirtschaft & Recht[45] bietet ähnliche Studieninhalte wie die Fakultäten I und II der Hochschule der Medien an.
Gleiches gilt für die Hochschule München mit dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens (Bachelor und Master) der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen oder dem Studiengang Druck- und Medientechnik (Diplom, Bachelor ab Wintersemester 2007/2008) der Fakultät Versorgungstechnik, Verfahrenstechnik, Druck- und Medientechnik.[46]
3.5 Bedeutung von Medienanalysen
Aus der quantitativen Perspektive heraus betrachtet, leben wir in einer Informationsgesellschaft, in welcher das Informationsangebot stetig weiter ansteigt. Qualitativ betrachtet, kann man von einer Mediengesellschaft sprechen, in der Fiktionen zunehmend gleichberechtigt gegenüber Fakten auftreten und auf diese sogar substituierend wirken können.[47]
Die Agenda-Setting-Theorie geht davon aus, dass Medien aufgrund von enormen Mengen an Informationen als Gatekeeper[48] fungieren, und die Meldungen nach deren Relevanz sortieren und aussortieren.[49]
Dadurch zeigen Medien lediglich Auszüge der Wirklichkeit, und es gilt: Nichts ist relevant, was nicht in den Medien ist.[50]
„Wenn mittlerweile nur noch relevant ist, was von den Medien beobachtet wird, dann nimmt auch die Bedeutung der Medienanalyse als Beobachtung der Medien zu.“[51]
Nach Baerns sind Medienanalysen die schnellstmögliche Variante, um das öffentliche Meinungsbild und damit die eigene Wirkung nach außen zu untersuchen. Da aber die Medienlandschaft immer rasanter wächst und somit stetig unüberschaubarer wird, ist dafür eine systematische Beobachtung mit differenzierten Methoden notwendig.[52]
Ein Beispiel aus der Geschichte zeigt, wie erfolgreich die systematische Beobachtung und Inhaltsanalyse sein kann. Die Alliierten analysierten im Zweiten Weltkrieg die Veröffentlichungen des nationalsozialistischen Propagandaministers Joseph Goebbels, um an Informationen zur sog. „Vergeltungswaffe“, einer Überschall-Rakete V2, zu gelangen. Da die Alliierten über keine Technik zur Abwehr dieser Rakete verfügten, waren sie bestrebt, den Bau dieser Waffe zu verhindern. Sie besaßen zwar Kenntnis darüber, dass die Rakete gebaut wurde, aber nicht an welchem Ort. Aus diesem Grund bombardierten sie verschiedene verdächtige Ziele, wussten aber nicht, ob sie das gesuchte Ziel getroffen hatten. Inhaltsanalytiker entwickelten den Ansatz, mittels Inhaltsanalysen zu prüfen, ob das richtige Ziel zerstört wurde. Man ging davon aus, dass über eine Bombardierung grundsätzlich in den Medien berichtet würde. Wird die Raketenfabrik nicht getroffen, so wird der Propagandaminister weiterhin mit der Vergeltungswaffe drohen und den Endsieg verkünden. Daraus schlussfolgerte man, dass die Bombardierungen an einer anderen Stelle fortgesetzt werden müssen. Die Berichterstattung wurde kontinuierlich analysiert, bis diese nach der Bombardierung von Peenemünde in der Nacht vom 17. auf den 18. April 1943 abbrach. Goebbels schwieg, so dass man davon ausgehen konnte, dass sich die Raketenfabrik in Peenemünde befand und zerstört wurde. Dieser historische Fall zeigt anschaulich, welcher Nutzen aus der Medienanalyse gezogen werden kann.[53]
3.6 Methodik der Medienanalyse im Printbereich
Obwohl es mittlerweile auch einige elektronische Anbieter gibt, ist die Basis vieler Medienanalysen im Printbereich auch heute noch der Pressespiegel. Seit seiner Erfindung durch Comte Auguste de Chambure 1879 in Paris hat sich an der klassisch händischen Form nur wenig geändert. Grund für die Papierform sind u.a., dass für die elektronische Form die strengen Auflagen des Urheberrechts Beachtung finden müssen, und dass Informationen, bspw. zur Größe, bei der digitalen Erfassung verloren gehen können.[54]
Nach Baerns lassen sich vier Qualitätsebenen der Medienanalysen feststellen: Auf der untersten Ebene befindet sich die Dokumentation, die die rein mengenmäßige Erfassung der Presseausschnitte, der sog. Clippings, und die Feststellung der Auflagenhöhe umfasst. Die nächste Ebene beinhaltet die Berechnung des Werbeäquivalenzwertes, also der Umrechnung des Clippings in Anzeigenfläche und der Berechnung der Kostenersparnis durch PR. Wesentlich anspruchsvoller beurteilt Baerns die quantitative Analyse: Bei diesem Ansatz werden Fragen, bspw. um welches Medium es sich handelt, welche Quellen der Autor nutzt bzw. welchen Umfang der Artikel hat, bearbeitet. Dabei gilt es signifikante Korrelationen zu errechnen. Als umfassendste Form ergänzt die qualitative Analyse diese statistischen Analysen dann um fundiertere Aspekte und untersucht bspw. die Themen im Zeitverlauf.[55]
Rota gibt zu bedenken, dass die rein quantitative Erfolgskontrolle (Anzahl der Clippings) vor allem für den Werbeäquivalenzwert, d.h. für Kostenerwägungen interessant ist. Insbesondere Agenturen nutzen quantitative Analysen, um die eigene Arbeit und die damit verbunden Kosten beim Kunden zu legitimieren bzw. abzusichern. Die qualitative Erfolgserfassung hingegen ist wesentlich aussagefähiger. Inhaltsanalysen geben auf Hochschulen abgeleitet z.B. Aufschluss über die Häufigkeit von Nennungen der Hochschule, Fakultäten oder Studiengänge. Sie liefern Informationen zu den Inhalten und Schwerpunkten und zum Grad der Adaption einer Pressemitteilung durch die Journalisten. Mit Hilfe von Input-Out-Analysen kann darüber hinaus untersucht werden, welche von den herausgegebenen Pressemitteilungen tatsächlich in den Medien veröffentlicht wurden. So lässt sich der Erfolg bestimmter Themen messen, und Aussagen darüber können getroffen werden, welche Maßnahmen und Informationen von Interesse waren und welche weniger. Mit den daraus gewonnenen Ergebnissen werden Ableitungen für die zukünftige Pressearbeit möglich.[56]
3.7 Anforderungen an die Medienanalyse
Medienanalysen bilden komplexe, nur schwer nachvollziehbare Vorgänge ab, und erfordern daher ein gewisses Vertrauen in deren Richtigkeit. Um dieses Vertrauen in die Medienanalyse zu stärken, sollte nach den drei Regeln aus der empirischen Sozialforschung vorgegangen werden:
1. Die Untersuchung darf nur nach sachlich-methodischen Regeln erfolgen.
2. Diese Regeln müssen dokumentiert werden.
3. Diese Regeln müssen auf Logik und i.S. der Empirie auf Evidenz und Validität geprüft werden.[57]
Daraus leitet Prof. Dr. Klaus Merten folgende konkrete Anforderungen ab:
1. Die Angabe der Stichprobe ist notwendig, um zu sehen, auf welche Anzahl sich die Ergebnisse z.B. im Falle untersuchter Artikel beziehen.
2. Die Vorlage des Erhebungsinstruments, bzw. eines Regelwerkes, das die genaue Vorgehensweise nach festen Regeln beschreibt, und die Erhebungen so nachvollziehbar macht.
3. Eine Angabe der Zahl positiver und negativer Wertungen ist bei quantitativen Auswertungen unerlässlich.
Beispiel: Zwei zu vergleichende Hochschulen A und B; A erzielte 50 und B 80 Veröffentlichungen. Ohne die Wertung in den Artikeln genauer zu berücksichtigen wäre die Pressearbeit von B subjektiv besser ausgefallen als die von A. Bezieht man die Wertung in die Ergebnisse mit ein, so wurde über A zu 100 Prozent positiv berichtet, bei B hingegen gab es 20 Veröffentlichungen, in denen negativ berichtet wurde. Dies bedeutet, dass über A zu 100 Prozent und über B nur zu 75 Prozent positiv berichtet wurde, was eine andere Bewertung des Ergebnisses der Pressearbeit zur Folge hat.
4. Die Differenzierung von Wertungen und Beiträgen ist aus folgendem Grund dringend erforderlich. Geht man davon aus, dass man mit Hilfe der Anzahl von Beiträgen Aussagen über die Aufmerksamkeit für ein behandeltes Thema treffen kann, kann im Folgenden die Anzahl an Wertungen als Indikator für die Richtung der erzielten Wirkung beim Rezipienten verstanden werden.
5. Die gültige Saldierung der Werte ist gegeben, wenn der benutzte Koeffizient in den Grenzen von 0 bis 1 bzw. 0 bis 100 Prozent variiert, er weiterhin vorzeichenempfindlich ist und einen echten Nullpunkt besitzt.
6. Die gültige Interpretation der Befunde unterliegt drei Kriterien:
Interessenfreiheit, Messvalidität und intersubjektive Nachprüfbarkeit.[58]
Interessenfreiheit meint dabei nichts anderes als eine zwingend notwendige Distanz zum untersuchten Objekt sowie eine neutrale Vorgehensweise bei der Analyse. Nur auf diese Art und Weise lässt sich eine unabhängige, unverfälschte Analyse gewährleisten.[59]
Die Messvalidität versteht Merten als Basis der empirischen Sozialforschung. Sie stellt sicher, dass das genutzte Messinstrument auch tatsächlich das erfasst, was gemessen werden soll.[60]
Die intersubjektive Nachprüfbarkeit steht für den wissenschaftlichen Anspruch. Nur wenn die gewonnen Ergebnisse auch nachprüfbar sind und bei einer Prüfung die gleichen Ergebnisse erzielt werden, kann von einer kompetenten Vorgehensweise bei der Analyse ausgegangen werden.[61]
Sollten diese Anforderungen und Regeln nicht eingehalten werden, so ist die Richtigkeit der Untersuchungs-Ergebnisse i.d.R. zweifelhaft. Merten nennt als Negativ-Beispiel die Arbeit des Medien Tenor, einem Forschungsinstitut für Medienanalysen, das sich selbst als unabhängig einstuft. Merten untersuchte zahlreiche Analysen dieses Instituts auf den wissenschaftlichen Anspruch bzw. die Einhaltung der genannten Anforderungen. Nach Abschluss seiner Auswertung attestierte er dem Institut „interessengesteuerte Ergebnisformulierung, wissenschaftlich inkompetente Vorgehensweise, die mangelnde Offenlegung der Methodik und die so gut wie unmögliche Nachprüfbarkeit der Ergebnisse“.[62]
Für die vorliegende Ausarbeitung findet sich aus diesem Grund in Kapitel 5 die Umsetzung dieser Anforderungen als Methodik für die Vorgehensweise bei der Medienanalyse. Die von Merten genutzten Begrifflichkeiten von 1. bis 6. werden dabei übernommen und um eigene ergänzt.
3.8 Grenzen und Probleme bei der Medienanalyse
3.8.1 Probleme basierend auf der Vorgehensweise
Medienanalysen, insbesondere Resonanz- oder Inhaltsanalysen, sind „komplexe, informationsraffende Prozeduren“[63] mit zahlreichen zu analysierenden Artikeln, deren jeweils individuelle Aussage auf insgesamt einige wenige Inhalte zusammengefasst wird. Aufgrund der Komplexität der Inhaltsanalyse ist es i.d.R. nicht möglich, die gewonnenen Ergebnisse zu hinterfragen. Hinzu kommt, dass einige Institute in der Vergangenheit Ergebnisse den eigenen Interessen angepasst und diese dafür verändert bzw. verfälscht haben.[64]
[...]
[1] Vgl. Bühler, Heike | Naderer, Gabriele | Koch, Robertine | Schuster, Carmen: „Hochschul-PR in Deutschland“, S. 1
[2] Vgl. http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/hochschulen/Dokumentation_
Hochschule_2012.pdf, Stand 2007-09-23, S. 12 f.
[3] Vgl. http://www.studis-online.de/Studieren/art-237-bologna-bericht-2004.php, Stand 2007-10-05
[4] Vgl. Bühler, Heike | Naderer, Gabriele | Koch, Robertine | Schuster, Carmen: „Hochschul-PR in Deutschland“, S. 1
[5] Vgl. Schnettler, Josef | Wendt, Gero: „Konzeption und Mediaplanung für Werbe- und Kommunikationsberufe“, S. 84
[6] Man spricht von einem Streuverlust, wenn mit einem Medium auch Personen erreicht werden, die nicht zur Zielgruppe gehören. Vgl. Schnettler, Josef | Wendt, Gero: „Konzeption und Mediaplanung für Werbe- und Kommunikationsberufe“, S. 84
[7] Vgl. Schnettler, Josef | Wendt, Gero: „Konzeption und Mediaplanung für Werbe- und Kommunikationsberufe“, S. 100 f.
[8] Vgl. http://www.studis-online.de/Studieren/art-237-bologna-bericht-2004.php, Stand 2007-10-05
[9] Vgl. Schnettler, Josef | Wendt, Gero: „Konzeption und Mediaplanung für Werbe- und Kommunika-tionsberufe“, S. 106 f.
[10] Vgl. http://www.hdm-stuttgart.de/aktuell/pressemitteilungen/archiv/view_news?ident=
news20070212181649, Stand 2007-10-05
[11] Vgl. https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,
vollanzeige.csp&ID=1018407, Stand 2007-10-28
[12] Vgl. https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,
vollanzeige.csp&ID=1018407, Stand 2007-10-28
[13] Vgl. Reich, Andreas: Hochschulrahmengesetz, Bad Honnef 1996, 5. Auflage, S. 11
[14] Vgl. Winter, Winni C.: „Benchmarking als Instrument der strategischen Planung“, S. 9 f.
[15] Rota, Franco P. | Fuchs, Wolfgang: „Lexikon Public Relations“, S. 31
[16] Vgl. Rota, Franco P. | Fuchs, Wolfgang: „Lexikon Public Relations“, S. 31
[17] Silbermann, Alphons: „Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung“ Band 2 L-Z“, S. 362
[18] Zedtwitz-Arnim, Graf Georg-Volkmar: „Tue Gutes und rede darüber“, Titel
[19] Vgl. Center, A.H. | Cutlip, S.M.: „Effective Public Relations“ in Bachmann, Cornelia: „Public Relations: Ghostwriting für Medien?“, S. 49
[20] Vgl. Koschnik Wolfgang J. „Standard-Lexikon für Marketing, Marktkommunikation, Markt- und Mediaforschung“, S. 614
[21] Vgl. Kalmus, Michael | Classen, Dorit: „Zielgruppe unbekannt? - Neue Wege der Internen Information“, S. 19 f.
[22] Vgl. Kalmus, Michael | Classen, Dorit: „Zielgruppe unbekannt? - Neue Wege der Internen Information“, S. 19 f.
[23] Vgl. Rota, Franco P. | Fuchs, Wolfgang: „Lexikon Public Relations“, S. 161 ff.
[24] Vgl. Rota, Fuchs: „Lexikon Public Relations“, S. 330 ff.
[25] Vgl. Rota, Fuchs: „Lexikon Public Relations“, S. 117 ff.
[26] Vgl. Wangen-Goss, Margret: „Marketing für Universitäten“, S. 56 f.
[27] Vgl. Trogele, Ulrich: Strategisches Marketing für deutsche Universitäten, S. 27
[28] Vgl. Trogele, Ulrich: Strategisches Marketing für deutsche Universitäten, S. 28
[29] Bühler, Heike | Naderer, Gabriele | Koch, Robertine | Schuster, Carmen: „Hochschul-PR in Deutschland“, S. 31
[30] Vgl. Reich, Andreas: Hochschulrahmengesetz, Bad Honnef 1996, 5. Auflage, S. 11 f.
[31] Wangen-Goss, Margret: „Marketing für Universitäten“, S. 58
[32] Wangen-Goss, Margret: „Marketing für Universitäten“, S. 56
[33] Vgl. Wangen-Goss, Margret: „Marketing für Universitäten“, S. 56 f.
[34] Vgl. Bühler, Heike | Naderer, Gabriele | Koch, Robertine | Schuster, Carmen: „Hochschul-PR in Deutschland“, S. 31
[35] Vgl. Bühler, Heike | Naderer, Gabriele | Koch, Robertine | Schuster, Carmen: „Hochschul-PR in Deutschland“, S. 1
[36] Vgl. http://www.studis-online.de/Studieren/art-237-bologna-bericht-2004.php, Stand 2007-10-05
[37] Vgl. Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik: Öffentlichkeitsarbeit für Nonprofit-Organisationen, S. 102
[38] Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland: Pressemitteilung Nr. 366 vom 10.9.2007, www.destatis.de, Stand 2007-09-23
[39] Vgl. http://www.kmk.org/statist/home.htm?hochschule, Stand 2007-11-23
[40] Vgl. http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/hochschulen/Dokumentation_Hochschule_
2012.pdf, Stand 2007-09-23, S. 12-13
[41] Vgl. http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/hochschulen/Dokumentation_Hochschule_
2012.pdf, Stand 2007-09-23, S. 15
[42] Wangen-Goss, Margret: „Marketing für Universitäten“, S. 210
[43] Vgl. http://www.hdm-stuttgart.de/studienangebot/alle_studiengaenge/, Stand 2007-12-10
[44] Vgl. http://www.htwk-leipzig.de/, Stand 2007-09-12
[45] Vgl. http://www.hs-pforheim.de, Stand 2007-12-10
[46] Vgl. http://www.hm.edu/home/fhm/studiengaenge/d_Welcome.pcms, Stand 2007-12-10
[47] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 21
[48] Gatekeeper sind in diesem Zusammenhang Berufsgruppen in den Medien, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Information bearbeiten oder weiterleiten und so den Informationsfluss beeinflussen. Vgl. Selb, Peter: „Agenda-Setting Prozesse im Wahlkampf“, S. 21
[49] Vgl. Selb, Peter: „Agenda-Setting Prozesse im Wahlkampf“, S. 21
[50] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 21
[51] Wägenbaur, Thomas (Hrsg): „Medienanalyse“, S. 10
[52] Vgl. Baerns, Barbara (Hg.): „PR-Erfolgskontrolle“ S. 115 f.
[53] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 33 f.
[54] Vgl. Heinisch, Christian in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 67
[55] Vgl. Baerns, Babara: „PR-Erfolgskontrolle“, S. 177 f.
[56] Vgl. Rota, Franco P: „Public Relations und Medienarbeit“, S. 303 ff.
[57] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 38 ff.
[58] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 38 ff.
[59] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 38 ff.
[60] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 38 ff.
[61] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 38 ff.
[62] Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 46
[63] Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg): „Medienanalyse“, S. 39
[64] Vgl. Merten, Prof. Dr. Klaus in Wägenbaur, Thomas (Hrsg.): „Medienanalyse“, S. 39
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836616331
- Dateigröße
- 996 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule der Medien Stuttgart – Electronic Media, Studiengang Werbung und Marktkommunikation
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- hochschul-pr public relations benchmarketing hochschule universität
- Produktsicherheit
- Diplom.de