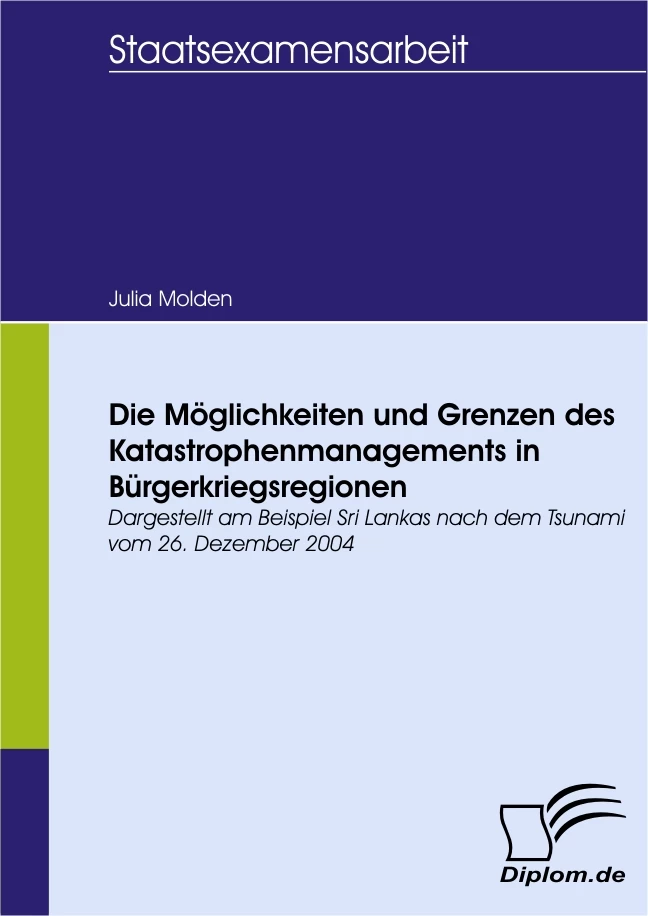Die Möglichkeiten und Grenzen des Katastrophenmanagements in Bürgerkriegsregionen
Dargestellt am Beispiel Sri Lankas nach dem Tsunami vom 26. Dezember 2004
Zusammenfassung
Über 300.000 Menschen an den Küsten Asiens und Afrikas verloren durch den Tsunami am 26. Dezember 2004 ihr Leben. Dies war die Hälfte aller Menschen, die bisher den zehn größten Tsunamis zum Opfer fielen. Darüber hinaus verloren über fünf Millionen Menschen in 14 Ländern Besitz und Einkommensquellen. Zusätzlich haben sie körperliche, seelische und gesundheitliche Folgen davon getragen. Ganze Küstenstreifen, Lebensgrundlagen und Infrastrukturen wurden verwüstet und zerstört.
Auslöser für diesen Tsunami war das Erdbeben im Indischen Ozean mit dem Epizentrum vor der Insel Sumatra. Es erreichte eine Stärke von Magnitude 9,1 bis 9,3 (Maß für die Stärke von Erdbeben) auf der Richterskala und führte zu Hunderten kleinerer und größerer Nachbeben (Reese/Eckhardt 2005: 5). Dies war das stärkste Beben in den letzten 40 Jahren. Es bewegte eine Menge von 30 Kubikkilometer Meerwasser und verursachte somit die bisher schlimmste Tsunami-Katastrophe der Geschichte.
Der Tsunami hätte weit weniger Menschenleben gefordert, wenn es in der Region ein funktionierendes Frühwarnsystem gäbe.
Jedoch auch ohne Frühwarnsystem wären Behörden in der Lage gewesen zu evakuieren, da das Tsunamizentrum auf Hawaii innerhalb von 15 Minuten das Erdbeben und den folgenden Tsunami registriert hatte, die Mitarbeiter aber nicht wussten, wen sie kontaktieren sollen. Sri Lanka, beispielsweise, hätte 2 Stunden Zeit für eine Evakuierung gehabt. Sri Lanka ist auch das Land, das in dieser Arbeit unter dem Gesichtspunkt des Katastrophenmanagements später näher betrachtet werden soll. Ebenso war das meteorologische Amt in Thailand informiert, entschloss sich jedoch nach einem Krisenstabstreffen, die Behörden nicht zu informieren, da negative Auswirkungen eines falschen Alarms auf die lukrative Tourismusindustrie (ebd.) gefürchtet wurden.
Der Tsunami wurde meist als eine Naturkatastrophe wahrgenommen. Das heißt, dass die Katastrophe von Naturgewalten ausgelöst wurde und nicht auf menschliches Handeln zurückzuführen ist und dementsprechend auch nicht durch den Menschen verhindert werden könne. Damit verweisen Reese und Eckhardt darauf, dass die Opfer keine Schuld trifft und es jeden hätte treffen können:
Sie gelten als 'würdige Opfer', die ihre Not nicht selbst verschuldet und daher auch unsere Hilfe verdient haben. Es schien, als ob uns nur eine Möglichkeit zu handeln offen stand: Denen solidarisch unter die Arme greifen, an denen sich die Natur dieses […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Katastrophenmanagement
2.1 Begriffsbestimmung einer Katastrophe
2.2 Wahrnehmung von Risiken und Naturgefahren
2.3 Katastrophenvorsorge und –nachsorge
2.3.1 Katastrophenvorsorge
2.3.1.1 Risikoanalyse
2.3.1.2 Katastrophenvorbeugung und –vorbereitung
2.3.2 Katastrophennachsorge respektive Katastrophenbewältigung
2.3.2.1 Katastrophenhilfe
2.3.2.2 Wiederaufbau
3. Tsunami aus physisch-geographischer Sicht
3.1 Ursachen eines Tsunami
3.1.1 Erdbeben
3.1.2 Vulkanausbrüche
3.1.3 Hangrutsche
3.1.4 Meteoriten
3.2 Merkmale eines Tsunami und physikalische Größen
3.3 Auswirkung eines Tsunami
4. Exkurs: Der Bürgerkrieg in Sri Lanka
4.1 Anfänge der Konflikte
4.2 Gründung der LTTE
4.3 Ausbruch des Bürgerkriegs
4.4 Friedensverhandlungen seit 2001
5. Katastrophenmanagement in Sri Lanka nach dem Tsunami vom 26. Dezember 2004
5.1 Fehlende Katastrophenvorsorge
5.2 Katastrophennachsorge
5.2.1 Strategien und Methoden der srilankischen Regierung
5.2.2 Joint Mechanism (JM)
5.2.3 Zwischen Dankbarkeit und Sündenbocksuche Die Stellung der nationalen und internationalen NGOs
5.2.4 Kritik an der Koordination und dem LRRD-Konzept
5.2.4.1 Mangelnde Koordination
5.2.4.2 Das LRRD-Konzept
5.2.5 Die TRO – Tamil Rehabilitation Organisation
5.2.6 Die Benachteiligten
5.2.6.1 Frauen traf es anders als Männer
5.2.6.2 Die benachteiligten Regionen im Norden und Osten
6. Schlussfolgerung
7. Literatur und Internetseiten
7.1 Literatur
7.2 Internetseiten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Katastrophenkreislauf mit den Elementen der Katastrophenvorsorge und der Katastrophennachsorge
Abb. 2 Konzept eines Frühwarnsystems
Abb. 3 Zeitverlauf des Tsunami
Abb. 4 Entstehung des Tsunami vom 26. Dezember 2004 durch ein Erdbeben
Abb. 5 Die Eurasische und Indisch-Australische Platte
Abb. 6 Tsunami beim Auftreffen auf die Küste
Abb. 7 Übersichtskarte von Sri Lanka
Abb. 8 Vor dem Tsunami, Kalutara Beach, Sri Lanka
Abb. 9 Zurückweichendes Wasser, Kalutara Beach, Sri Lanka
Abb. 10 Nach dem Tsunami, Kalutara Beach, Sri Lanka
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Die folgenschwersten Tsunamis seit 1800
Tab. 2: Vulkanische Ursachen für Tsunamis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Über 300.000 Menschen an den Küsten Asiens und Afrikas verloren durch den Tsunami am 26. Dezember 2004 ihr Leben. Dies war die Hälfte aller Menschen, die bisher den zehn größten Tsunamis[1] zum Opfer fielen. Darüber hinaus verloren über fünf Millionen Menschen in 14 Ländern Besitz und Einkommensquellen. Zusätzlich haben sie körperliche, seelische und gesundheitliche Folgen davon getragen (Reese 2005b: 23). Ganze Küstenstreifen, Lebensgrundlagen und Infrastrukturen wurden verwüstet und zerstört (VENRO[2] 2007: 5).
Auslöser für diesen Tsunami war das Erdbeben im Indischen Ozean mit dem Epizentrum vor der Insel Sumatra. Es erreichte eine Stärke von Magnitude 9,1 bis 9,3 (Maß für die Stärke von Erdbeben) auf der Richterskala und führte zu Hunderten kleinerer und größerer Nachbeben (Reese/Eckhardt 2005: 5). Dies war das stärkste Beben in den letzten 40 Jahren. Es bewegte eine Menge von 30 Kubikkilometer Meerwasser und verursachte somit die “bisher schlimmste Tsunami-Katastrophe der Geschichte “ (www.tsunami-alarm-system.com/phaenomen-tsunami/…).
„Der Tsunami hätte weit weniger Menschenleben gefordert, wenn es in der Region ein funktionierendes Frühwarnsystem gäbe.“ (Ungpakorn zit. n. Reese/Eckhardt 2005: 6)
Jedoch auch ohne Frühwarnsystem wären Behörden in der Lage gewesen zu evakuieren, da das Tsunamizentrum auf Hawaii innerhalb von 15 Minuten das Erdbeben und den folgenden Tsunami registriert hatte, die Mitarbeiter aber nicht wussten, wen sie kontaktieren sollen. Sri Lanka, beispielsweise, hätte 2 Stunden[3] Zeit für eine Evakuierung gehabt (vgl. Reese/Eckhardt 2005: 6) Sri Lanka ist auch das Land, das in dieser Arbeit unter dem Gesichtspunkt des Katastrophenmanagements später näher betrachtet werden soll. Ebenso war das meteorologische Amt in Thailand informiert, entschloss sich jedoch nach einem Krisenstabstreffen, die Behörden nicht zu informieren, da negative Auswirkungen eines falschen Alarms „auf die lukrative Tourismusindustrie“ (ebd.) gefürchtet wurden.
Der Tsunami wurde meist als eine Naturkatastrophe wahrgenommen (ebd.: 5). Das heißt, dass die Katastrophe von Naturgewalten ausgelöst wurde und nicht auf menschliches Handeln zurückzuführen ist und dementsprechend auch nicht durch den Menschen verhindert werden könne. Damit verweisen Reese und Eckhardt darauf, dass die Opfer keine Schuld trifft und es jeden hätte treffen können:
„Sie gelten als 'würdige Opfer', die ihre Not nicht selbst verschuldet und daher auch unsere Hilfe verdient haben. Es schien, als ob uns nur eine Möglichkeit zu handeln offen stand: Denen solidarisch unter die Arme greifen, an denen sich die Natur dieses Mal abreagiert hat.“ (Reese/Eckhardt 2005: 5)
Diese „vorpolitische Sicht“ (ebd.) wurde noch dadurch bestärkt, als ob es so schien, dass die Wellen des Tsunami nur Regionen getroffen hätten, deren Hauptprobleme die Armut sei und „die merkwürdig unberührt von Macht, Herrschaft oder Ausbeutung zu sein“ (ebd.) schienen.
Dies führte zu einer außergewöhnlich hohen Aufmerksamkeit in den Medien, der Bevölkerung und politischer Entscheidungsträger, zumal der Zeitpunkt (Weihnachtsfeiertage) eine besondere Betroffenheit beinhaltete. Die internationale Hilfs- und Spendenbereitschaft brach alle Rekorde (VENRO 2007: 5). Die Reaktionen auf nationaler und internationaler Ebene waren schnell. Die Vereinten Nationen richteten einen Hilfsappell an die Öffentlichkeit und baten ihre Mitgliedstaaten um Gelder für die Soforthilfe, die sie innerhalb von vier Wochen zugesagt bekamen. Auch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung war vergleichsweise hoch. Millionen von Menschen folgten den Aufrufen der Hilfsorganisationen und Medien, um den Opfern des Tsunami helfen zu können. Nach VENRO[4] (2007: 6) kamen insgesamt 13,5 Milliarden US-Dollar zusammen. Die privaten Spenden erreichten ein Rekordniveau von mehr als vier Milliarden US-Dollar. Hunderte von NGOs[5] und INGOs[6], auch neugegründete, baten den betroffenen Ländern ihre Hilfe an.
Die Soforthilfephase wurde rückblickend von VENRO (2007: 6) als erfolgreich bezeichnet. Tote wurden geborgen, Verletzte versorgt, Notunterkünfte aufgebaut, Trinkwasser zur Verfügung gestellt und weitere Maßnahmen, die zu Soforthilfemaßnahmen zählen, wurden schnell realisiert. Somit konnten zum größten Teil Hungersnot und Seuchen verhindert werden (vgl. ebd.: 6).
Nach Angaben deutscher NGOs wurden Hilfsprogramme für die Wiederaufbauphasen auf mehrere Jahre ausgelegt und geplant (ebd: 7). Die Erfahrungen der Bewältigung von Flutkatastrophen können aufgrund der verschiedenen Länder und deren politischen, ökonomischen und sozialen Hintergründe nicht verglichen werden. Ein Katastrophenmanagement, das unter anderem Soforthilfe und Wiederaufbau beinhaltet, kann daher nicht in ein Schema F gepresst werden. Es solle vielmehr idealtypischer Weise auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten werden. In Sri Lanka kam erschwerend hinzu, dass hier seit über zwanzig Jahren ein Bürgerkrieg herrscht. Die Oppositionsparteien widersetzen sich seit dem Ausbruch 1983 einer Lösung. Erst 2001 gelang es den Konfliktparteien, der singhalesischen Mehrheitsbevölkerung und der tamilischen Minderheit, mit der Hilfe norwegischer Vermittler Friedensverhandlungen zu führen und ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen (vgl. Weiberg 2006: 2). „Dieses ist zwar formell bis heute gültig, de facto steht das Land aber wieder kurz vor einem Bürgerkrieg.“ (ebd.)
Die tamilische Befreiungsbewegung LTTE brachte einen Großteil der Gebiete im Norden und Osten unter ihre Kontrolle. Bereits vor dem Tsunami war es schwierig in diesen Gebieten Zugang zu erlangen. Meist gelang es nur über erfahrene Organisationen, die dort seit vielen Jahren arbeiten, Partnerstrukturen aufzubauen, um somit Flutopfern als auch Kriegsflüchtigen zu helfen (vgl. VENRO 2006: 5).
Dass die folgenschweren Ausmaße des Tsunami nicht nur durch die Natur verursacht wurden, wurde schnell klar:
„Sehr bald aber waren die Stimmen immer deutlicher zu vernehmen, die darauf hinwiesen, dass durch menschliche Entscheidungen und Akteure […] die dramatischen – sozialen und ökologischen – Schäden verschlimmert haben, und dass die Gefahr besteht, dass wegen der gesellschaftlichen Strukturen in den Flutländern nicht in erster Linie die Opfer, sondern die Mächtigen von der Flut(hilfe) profitieren werden.“ (Reese/Eckhardt 2005: 5)
Ungleiche Strukturen aus sozialer und politischer Sichtweise vor Ort haben nicht nur dazu beigetragen, dass die Folgen des Tsunami schlimmer waren, sondern sie sind auch in der Katastrophenachsorge entscheidende Faktoren geblieben und haben enormen Einfluss über das weitere Leben der betroffenen Menschen in Sri Lanka bis zum heutigen Tag.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Grenzen und Möglichkeiten des Katastrophenmanagements in Sri Lanka am Beispiel des Tsunami vom 26. Dezember 2004 mit dem Hintergrund des über 20 Jahre andauernden Bürgerkriegs zu beleuchten. Aus dem Blickwinkel des idealtypischen Katastrophenmanagements, mit den Hauptkomponenten der Katastrophenvorsorge und –nachsorge, werden Methoden verschiedener beteiligter Akteure betrachtet. Die Handlungen und Strategien sollen dargestellt und aus verschiedenen Betrachtungsweisen herausgearbeitet werden.
Ein Teilziel ist es, ein idealtypisches Katastrophenmanagement darzustellen, um somit Vergleiche zu den Geschehnissen in Sri Lanka ziehen zu können.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel, die zwischen einer Einleitung (Kapitel 1) und einer Schlussfolgerung (Kapitel 6) eingebunden sind.
Im zweiten Kapitel (2. Katastrophenmanagement) soll das Konzept des idealtypischen Katastrophenmanagements dargestellt werden. Hier werden die verschiedenen Phasen auf theoretischer Basis erläutert und miteinander in Verbindung gebracht. Es soll aufgezeigt werden, auf welche Art und Weise und mit welchen Möglichkeiten die Folgen einer Katastrophe verringert oder vermieden werden können. Aufgrund verschiedener Begriffsauffassungen beziehungsweise Auslegungen, werden zuvor Begriffe wie Katastrophe und die Wahrnehmung von Risiken und Naturgefahren definiert.
Das dritte Kapitel (3. Tsunamis aus physisch-geographischer Sicht) befasst sich mit den physisch-geographischen Betrachtungen der Tsunamis. Hier werden zunächst die Ursachen für einen Tsunami erläutert und Merkmale sowie physikalische Größen bestimmt. Anschließend wird auf die mögliche Auswirkung eines Tsunami an der Küste und auf dem Land eingegangen.
Das vierte Kapitel (4. Der Bürgerkrieg in Sri Lanka) behandelt den Bürgerkrieg in Sri Lanka. Dieses Kapitel stellt einen Exkurs dar. Die Hintergründe des Konflikts werden aus den unterschiedlichen Sichtweisen erläutert. Es sollen die Beweggründe beider Konfliktparteien dargestellt werden, um die Handlungen, die nach dem Tsunami vollzogen wurden, besser verstehen zu können.
Das fünfte Kapitel (5. Katastrophenmanagement in Sri Lanka) beschäftigt sich nun mit dem stattgefundenem Katastrophenmanagement in Sri Lanka nach dem Tsunami vom 26. Dezember 2004. Es werden die Handlungen und Methoden einiger Akteure betrachtet und versucht sie aus verschiedenen Sichtweisen zu erläutern. Im Zentrum sollen jeweils die Möglichkeiten und Grenzen des Katastrophenmanagements im Bezug auf den jahrelangen Bürgerkrieg stehen.
2. Katastrophenmanagement
Katastrophenmanagement beschreibt einen Prozess von systematisch aufeinander abgestimmten Handlungen, die durch Vorsorge eine Vermeidung einer zukünftigen Katastrophe und zur Bewältigung beziehungsweise Nachsorge schon stattgefundener Katastrophen führen soll (vgl. Dikau/Weichselgartner 2005: 127). Das Katastrophenmanagement kommt ursprünglich aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich und wurde „auf Risiken infolge von Naturkatastrophen übertragen“ (Plate/Merz 2001: 13). Da das Konzept für Naturkatastrophen erst wenige Jahre alt ist, sind die Begriffe noch nicht eindeutig definiert.
In folgenden Abschnitten sollen Begriffe wie Katastrophe und Wahrnehmung von Risiko und Naturgefahren, erläutert und die allgemeine Vor- und Nachsorge des Katastrophenmanagements für Risiken von Naturkatastrophen beschrieben werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um idealtypische, theoretische Modelle handelt.
2.1 Begriffsbestimmung einer Katastrophe
Der Begriff Katastrophe ist ein in den Medien sehr beliebter und fast schon inflationär gebrauchter Begriff. Er besitzt eine gewisse Reizwirkung und übt eine große Faszination auf Menschen aus (vgl. Hanke 2002: 1ff.). Da es über diesen Begriff unterschiedliche Auffassungen gibt, bedarf er einer Klärung.
Das Wort Katastrophe stammt aus dem lateinisch-griechischen und bedeutet „Umkehr“ und „Wende“ (Brockhaus Enzyklopädie Bd. 14, 2006: 391). In der Brockhaus Enzyklopädie wird die Katastrophe allgemein als ein schweres Unglück, einen Zusammenbruch und als ein Naturereignis mit verheerender Wirkung beschrieben. Aus dieser Begriffserklärung lässt sich bereits eine negative Beurteilung herauslesen. Ebenso lässt die etymologische Bedeutung des Wortes darauf schließen, dass eine Katastrophe schwere Auswirkungen auf den Menschen haben kann und meist ein Extremereignis darstellt.
Nach Plate et al. (2001: 1) wird eine Katastrophe erst mit Bezug auf die Auswirkungen auf die Menschen definiert. Die Vereinten Nationen definieren eine Katastrophe folgendermaßen:
„Katastrophe ist ein Ereignis, in Raum und Zeit konzentriert, bei dem eine Gesellschaft einer schweren Gefährdung unterzogen wird und derartige Verluste an Menschenleben oder materielle Schäden erleidet, dass die lokale gesellschaftliche Struktur versagt und alle oder einige wesentliche Funktionen der Gesellschaft nicht mehr erfüllt werden können.“ (UNDRO 1987 zit. n. Hanisch 1996: 22 zit. n. Plate et al. 2001: 1)
Diese Definition impliziert, dass die betroffenen Menschen auf auswärtige Hilfe angewiesen sind. In diesem Sinn besteht eine Naturkatastrophe immer aus zwei Teilen, einem auslösenden (externen) Ereignis und den Auswirkungen auf eine Bbtroffene Gesellschaftsgruppe. (Plate/Merz/Eikenberg 2001: 1)
Des Weiteren beschreiben Dikau und Pohl (2007: 1052), dass Katastrophen nicht zuletzt von Regeln der Massenmedien abhängen. Im Vergleich stehen hier unter anderem die Dürren in Indien, die im Zeitraum von 1994 bis 2003 mehr Todesopfer gefordert haben als alle anderen Katastrophen zusammen, und Vulkanereignisse, deren wirtschaftliche Schäden und die Anzahl der dabei umgekommenen Menschen dagegen sehr gering sind, jedoch vergleichsweise sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach Dikau und Pohl (2007: 1052) liegt es daran, dass sie eine gewisse Vorwarnzeit besitzen, gut erreichbar, klar abgrenzbar und darstellbar sind. Des Weiteren sollen Vulkanausbrüche mehr Potenzial des „Schauderns vor der unberechenbaren Natur“ (ebd.) aufweisen. Hier lässt sich wieder auf die Reizwirkung einer Katastrophe zurückkommen, die eventuell auch mit einer gewissen Sensationslust der Nichtbetroffenen zusammenhängt.
Im Hinblick auf den Katastrophenschutzdienst ist eine genaue Definition einer Katastrophe erforderlich. In Deutschland fällt aufgrund der föderalen Staatsgliederung die Zuständigkeit des Katastrophenschutzes auf die einzelnen Bundesländer. Diese verwenden jeweils eigene Begriffsbestimmungen, um die Zuständigkeit der Katastrophenschutzdienste klar zu definieren und Kostenträgerschaften zu bestimmen (vgl. Hanke 2002: 3).
Im hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) ist der Begriff der Katastrophe wie folgt definiert:
„Katastrophe im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ereignis, das Leben, Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung, Tiere oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Maße gefährdet oder beeinträchtigt, daß zur Beseitigung die einheitliche Lenkung aller Katastrophenschutzmaßnahmen sowie der Einsatz von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes erforderlich sind.“ http://www.bbk.bund.de/cln_007/…)
Im Vergleich dazu die Definition des bayerischen Innenministeriums:
„Eine Katastrophe ist ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder die natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutende Sachwerte in ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden und die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn unter Leitung der Katastrophenschutzbehörde die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen, Organisationen und
die eingesetzten Kräfte zusammenwirken.“ (http://www.innenministerium.bayern.de/sicherheit/katastrophenschutz…)
Festzuhalten ist, dass es sich bei einer Katastrophe im Allgemeinen um ein Ereignis handelt, von dem eine schwere Gefährdung ausgeht, und viele Personen oder Sachwerte im erheblichen Ausmaß betroffen sind. Des Weiteren sind zur Bewältigung einer Katastrophe stärkere Kräfte von Nöten als beispielweise in der alltäglichen Gefahrenabwehr (vgl. Hanke 2002: 3).
Hanke (ebd.: 4) spricht von der Betrachtung des gesellschaftsveränderten Charakters von Katastrophen, die von der Einrichtung der Katastrophenforschungsstelle (KFS) an der Universität Kiel verfolgt und erläutert wird. Unter Berücksichtigung aller Formen gesellschaftlicher Krisen, als Beispiel wird hier die Revolution genannt, wird resultiert, dass die einzige existierende Form von Katastrophe die „Kulturkatastrophe“ sei (vgl. ebd.). Der Beitrag anderer Wissenschaften sei im Bezug auf das unmittelbare Ereignis.
Felgentreff und Dombrowsky (2008: 13) beschreiben eine Katastrophe als plötzliche und massive Störungen, die überdurchschnittlich groß empfundene Verluste hervorruft. Der Tsunami vom 26. Dezember 2004 im Indischen Ozean wird beispielsweise in den Medien und in der Öffentlichkeit als eine Natur katastrophe betrachtet. Mit der Hinzufügung von Natur wird hier ein Verursacher oder kausaler Auslöser beigefügt. Einer Naturkatastrophe ist demnach ein Naturereignis vorangegangen, das an und für sich ein tatsächliches Auftreten eines natürlichen Prozesses ist. Mit dem Einfluss auf die Gesellschaft wird ein Naturereignis erst zu einer Naturkatastrophe.
Das System, in dem eine (Natur-)Katastrophe stattfindet, beginnt allerdings bereits vor dem Eintreten eines Naturereignisses, indem sich Personen oder Gesellschaften gewissen Naturgefahren aussetzen. Eine Katastrophe ist nur der Höhepunkt eines Prozesses komplexer Zusammenhänge (vgl. Dikau/Pohl 2007: 1029).
Indem sich Menschen bestimmte Räume in Anspruch nehmen oder Schutzvorschriften missachten, gehen sie immer ein gewisses Risiko ein. Sie wägen dies meist mit einer Chance ab und streben Ziele an. Als Beispiel dafür dient ein Bauer, der durch den fruchtbaren Auswurf eines Vulkans den Hang bewirtschaften kann und dadurch seine Nahrung sichert, aber durch einen Ausbruch dieses Vulkans auch sein Leben verlieren kann (vgl. ebd.: 1033). Somit ist die Katastrophe mit dem Verhalten des Menschen verknüpft und der Umgang mit der Gefahr wird zu einem entscheidenden Teil des Prozesses. Im Bezug auf die Bewältigung von Katastrophen ist dies eine grundlegende Aussage. Sie können teilweise verhindert werden, wenn entsprechende Maßnahmen durchgeführt und auch Phasen der prozesscharakteristischen Katastrophe erkannt werden (vgl. Hanke 2002: 5).
2.2 Wahrnehmung von Risiken und Naturgefahren
Der Mensch ist nicht nur ein Opfer der Naturereignisse, sondern er greift auch selbst in die natürlichen Prozesse der Erde ein und stört somit die Wechselwirkungen der Natur. Das heißt, durch das menschliche Eingreifen in natürliche Strukturen wird das Naturkatastrophenrisiko erhöht und sollte daher Teil der Risikowahrnehmung werden (vgl. Dikau/Weichselgartner 2005: 7).
Nach Dikau und Pohl bestehen meist nur subjektive Risikowahrnehmungen, die oft proportional zu objektiven Eintrittswahrscheinlichkeiten stehen:
„Je länger das letzte Hochwasser (der letzte Hurrikan, der letzte Vulkanausbruch) zurückliegt, umso weniger wird dieses Risiko wahrgenommen, obwohl doch […] die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Extremereignisses mit jedem Jahr steigt […].
Extreme Naturereignisse kommen zwar häufig unerwartet und überraschend, jedoch gerät oft aus dem Blickfeld, dass im Prinzip jeder Einzelne über einen nicht unbeträchtlichen Handlungsspielraum verfügt […].“ (Dikau/Pohl 2007: 1055)
Die Bewohneranzahl in Kalifornien hat sich trotz bekanntem Risiko eines Erdbebens stark erhöht. Kalifornier schätzen den Nutzen und die Chance auf gute Erwerbsfähigkeiten höher ein, als das Risiko ein Erdbebenopfer zu werden. Wie alle, müssen auch sie verschiedene Risiken miteinander abwägen. Um ein Risiko zu vermeiden, müssen sie ein anderes eingehen. (Dikau/Pohl 2007: 1055).
In Risikowahrnehmungsforschungen hat die Kontextabhängigkeit eine große Bedeutung eingenommen. Die Kontextabhängigkeit kann Bedeutung und Funktion des Wahrge-nommenen verändern. Somit ist es wichtig, die beeinflussenden Rahmenbedingungen in die Untersuchungen von Naturkatastrophen einzubeziehen. (vgl. Dikau/Weichselgartner 2005: 100).
Eine weitere Erkenntnis von Risikowahrnehmungsforschungen ist, dass die Bewertung von Laien und Experten sehr gegensätzlich ausfällt. So sind die gefährlichsten Risiken aus Expertensicht nicht diejenigen, die die Menschen am meisten ängstigen. Die Wissenschaft hat die Bewertungen der Laien lange als irrational bewertet und sie als von Medien beeinflusste Unkenntnis eingestuft. Heute werden sie gleichwertig mit denen der Experten, in die Planungsprozesse miteinbezogen (vgl. ebd.: 101).
Die Einschätzung von Risiken ist zwischen verschiedenen Menschen, Gesellschaften und Kulturen unterschiedlich, jedoch auch divergierend zwischen Experten. Des Weiteren zeigen sich zeitliche und lokale Unterschiede.
Folgern lässt sich, dass es die subjektive Wahrnehmung ist, die das Verhalten gegenüber Gefahren beeinflusst.
„Untersuchungen zur Wahrnehmung von Naturrisiken und der auf sie wirkenden Einflüsse können zur Entwicklung von besseren kommunikationspolitischen Strategien und effektiven risikoreduzierenden Maßnahmen beitragen“. (Dikau/Weichselgartner 2005: 105).
2.3 Katastrophenvorsorge und –nachsorge
Die Katastrophenvorsorge und –nachsorge sind die Hauptbestandteile des Katastrophen-managements. Sie unterteilen sich in verschiedene Bereiche, die in den folgenden Kapiteln näher beschrieben werden. Die Abläufe der Vorsorge und Nachsorge können als ein Kreislauf betrachtet werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Katastrophenkreislauf mit den Elementen der Katastrophenvorsorge und der Katastrophennachsorge
(Quelle: Dikau/Weichselgartner 2007: 127)
2.3.1 Katastrophenvorsorge
Die idealtypische Katastrophenvorsorge beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, die eng miteinander in Verbindung stehen und vor einem potenziellen Naturereignis ergriffen werden, um mögliche negative Auswirkungen des Naturereignisses auf die Gesellschaft zu vermeiden oder zu vermindern (vgl. ebd.). Die Katastrophenvorsorge wird unterteilt in die Risikoanalyse, die Vorbeugung und Vorbereitung.
2.3.1.1 Risikoanalyse
Die Risikoanalyse lässt sich in die Gefährdungsermittlung, die Vulnerabilität und die daraus potenziellen Konsequenzen aufteilen (vgl. Plate/Merz 2001: 13). „Sie wird durch Fachleute auf der Basis natur- und sozialwissenschaftlicher Grundlagen durchgeführt. Die Ergebnisse werden heute mittels Geographischer Informationssysteme und Datenbanken in Karten dargestellt.“ (Geo-Informations-Systeme 1997 zit. n. Plate/Merz 2001: 13) Der erste Schritt ist die Gefahrenermittlung beziehungsweise Identifizierung. Nach Dikau und Pohl (2007: 1057) werden Naturgefahren mit Methoden einer Naturgefahrenanalyse bestimmt. „Die Darstellung kann in Form räumlicher (Naturgefahrenkarten) und/oder zeitlicher (Zeitreihen) Naturgefahrenwahr-scheinlichkeiten erfolgen.“ (Dikau/Pohl 2007: 1057) Die Darstellung erfolgt über die Eigenschaften, wie zum Beispiel Häufigkeit, Stärke und räumliche Verteilung.
Der zweite Schritt der Risikoanalyse ist die Vulnerabilitätsanalyse. Unter der Vulnerabilität wird die sozioökonomische Verwundbarkeit verstanden. Also die Schäden, die infolge eines Naturereignisses an der Bevölkerung, des Sachkapitals und Naturkapitals entstanden sind. Diese möglichen Schäden werden in Vulnerabilitäts-karten erfasst und in Kombination mit Gefährdungskarten zu Risikokarten abgeleitet (vgl. Plate/Merz 2001: 18).
Die Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft zum Beispiel kartiert seit einigen Jahren Naturgefahren in der ganzen Welt. Es ist ebenso eine langjährige Tradition, für Lawinen und Vulkane eine Karte anzufertigen. Plate und Merz (ebd.: 12) beschreiben vier Kartentypen: 1. Gefahrenhinweiskarten: Karten, die qualitativ auf Naturgefahren hin-weisen; 2. Gefahrenkarten: Karten, die quantitativ auf Naturgefahren hinweisen (zum Beispiel maximale Stärke); 3. Gefährdungskarten: enthalten zusätzlich zum Inhalt der Gefahrenkarten Informationen über die Auftretenswahrscheinlichkeiten von Gefahren; und 4. Risikokarten: beinhalten zusätzlich zur Gefährdung eine Quantifizierung des Risikos (Auswirkung auf Menschen, Umwelt und Güter). Jedoch sind nicht alle Gefahren analysierbar und können vermessen werden. (vgl. ebd. 2001: 16).
Tsunamigefahrenkarten sind ein Beispiel für Gefahrenkartierungen. Die Tsunamigefahrenkarte gibt an, in welchen Küstenabschnitten und mit welcher Höhe eine Tsunamiwelle treffen wird. Für eine Entwicklung einer solchen Gefahrenkarte sind folgende Informationen notwendig: Tsunamiursachen (Vulkanausbrüche, Meteoriten, Hangrutsche, Erdbeben); Wahrscheinlichkeit des Auftretens; Eigenschaften eines Tsunamis; historische Quellen und Zeugnisse der Tsunamientstehung und der Tsunamifolgen. Eine weitere Methode der Gefahrenbewertung ist die numerische Modellierung der Tsunamiwellen und der Ausweisung von Überflutungsflächen (Dikau/Pohl 2007: 1060).
2.3.1.2 Katastrophenvorbeugung und -vorbereitung
„’Vorbeugen ist besser als Heilen’ – vor allem auch billiger.“ (Dikau/Pohl 2007: 1074)
Nach Dikau und Pohl (ebd.) lässt sich nachweisen, dass der Wiederaufbau ein Mehrfaches der vorbeugenden Maßnahmen kosten würde. Vereinzelt seien zwar die Kosten der Maßnahmen zur Vorbeugung teurer als die Schadensbeseitigung, jedoch im Falle eines Tsunami sind die Vorwarnkosten im Gegensatz zu den entstehenden Schäden zu vernachlässigen.
Die Katastrophenvorbeugung ist ein wichtiges Element, um ein Extremereignis zu vermeiden oder zu vermindern. Ist ein Extremereignis durch frühere Vorkommnisse oder durch Berechnungen bekannt, dann dient dies als Entscheidungsgrundlage für die Planung und Realisierung von Schutzmaßnahmen. Einfache Maßnahmen zur Vorbeugung genügen bereits, damit Extremereignisse nicht zu einer Katastrophe führen (Plate/Merz 2001: 19).
Betroffene mit einem Risiko vertraut zu machen, ist wichtiger Bestandteil der Vorsorge. Das Bewusstsein für die Gefahr ist ein entscheidender Träger für die Bereitschaft, entsprechende Maßnahmen zu vollziehen. Jedoch sind es nicht nur die Wahrnehmungen und Risikoanalysen, die die Planung einer Katastrophenvorsorge beeinflussen und lenken. Es hängt ebenso stark von gegebenen technischen, finanziellen und politischen Möglichkeiten eines Landes oder einer Region ab. Es gibt verschiedene technische und nichttechnische Maßnahmen, die zum einen der Staat ergreifen kann, zum anderen auch der einzelne Bürger (vgl. ebd.).
Nach Dikau und Weichselgartner (vgl. 2005: 131) sind folgende Maßnahmen einige der wichtigsten Komponenten der Vorbeugung:
Landnutzungsplanung und Raumordnung/-planung, verstärkte Vorsorgestrukturen, Fortbildungen der mit der Katastrophenvorsorge befassten Personen und Institutionen, Aufbau von Kommunikationsstrukturen (administrative und private Ebene) und Frühwarnsysteme.
Dass die Raumplanung[7] eine wichtige Rolle in der Katastrophenvorbeugung ist, wurde durch eine Konferenz der Akademie für Raumforschung und Landesplanung im Jahr 2003 festgehalten.
„Auf Grundlage des Problems der unzureichenden Wahrnehmung der räumlichen Dimension von regionalen Umwelt- und Technikrisiken wird in den Schlussfolgerungen erläutert, dass Risiken von individuellen und gesellschaftlichen Entscheidungen abhängig sind. Um Regionen gegenüber Risiken in Umwelt und Technik resistent zu machen, sei ein räumlich differenziertes System der Verantwortung notwendig, das sicherstellt, dass die Risiken den Chancen folgen.“ (ebd.: 132)
Die Schwerpunkte der Raumplanungsaufgaben bei der Katastrophenvorsorge betreffen vier Ebenen. Die Bundesebene, die Länderebene, die regionale Ebene und die kommunale Ebene. In der Bundesebene wird das Raumordnungsgesetz verankert, dass das Vorgehen der Länder abstimmt und Gefährdungskataster erarbeitet. Auf der Länderebene werden Grundsätze der Raumordnungen ersetzt, Gefährdungszonen und raumordnerische Entwicklungen kartographisch dargestellt. Die Darstellung von Gefährdungsbereichen in den regionalen Raumordnungsplänen wird auf einer regionalen Ebene vorgenommen. Ebenso die Berücksichtigung von Gefährdungszonen bei der Planung von Wohngebieten, Industrieanlagen und anderen Funktionsbereichen sowie bei den Verfahren der Umwelt- und Raumverträglichkeit. Auf kommunaler Ebene werden Gefährdungszonen in den Bauleitplänen gekennzeichnet und Ausweisungen von Standorten und Flächennutzungen berücksichtigt (ebd.: 132).
Indem Siedlungen, Infrastruktur und Industrie von potenziellen Gefahrenzonen getrennt werden und Aktivitäten, die ein Risiko hervorrufen können, vermieden werden, können Eintrittswahrscheinlichkeiten mit Hilfe von Raumplanung verringert werden (vgl. ebd. 2005: 133).
Weitere Vorbeugemaßnahmen sind technische Schutzmaßnahmen, wie der Gebäudeschutz (vgl. Plate/Merz 2001: 20). Gebäude sollten so ausgelegt werden, dass sie einem Extremereignis im Weitesten widerstehen können. Beispiele für Lösungen zum Schutz sind: höhergelegene Gebäude bei Hochwassergefahr, Verbesserung der Verbindung zwischen Dach und Wand für Erdbeben etc.
Ingenieure und Wissenschaftler können heute mit fortschreitenden naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sicherere Bauwerke erstellen. Für die Katastrophenvorbeugung ist die Aufstellung verschiedener und für die Baugebiete geeigneter Vorschriften ein wichtiger Beitrag (vgl. ebd.: 21).
Trotz alledem ist eine 100-prozentige Sicherheit vor einem durch ein Extremereignis hervorgegangenen Schaden nicht auszuschließen. Es bleibt stets ein Restrisiko.
„Das bedeutet, […] daß extreme Ereignisse trotz Vorbeugungsmaßnahmen zu Schäden führen, die um so größer sind, je wertvoller die betroffenen Objekte sind. Daraus entsteht die Situation, dass trotz der erhöhten Sicherheit der Bauwerke die Verluste durch Naturereignisse gerade in den Ländern mit hohen Sicherheitsstandards wegen der in Gefährdungsgebieten angesammelten Werte stetig steigen.“ (ebd.: 21)
Ohnehin werden die meisten Gebäude, vor allem in Entwicklungsländern, die häufig durch Extremereignisse bedroht werden, nach traditioneller Art und Weise und ohne statische Berechnungen und Bezüge auf potenzielle Risiken gebaut.
Hochwasserschutz ist eine weitere technische Maßnahme: Deiche, Gegenrückhalte-becken, Kanalisierung zur Beschleunigung, Errichtung von Stauseen etc. Auch computergestützte Warnsysteme zählen zu technischen Maßnahmen. Jedoch ist die Mehrzahl der technischen Maßnahmen mit hohen Kosten verbunden und wird nur bei einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit und Lokalisierbarkeit ergriffen (vgl. Dikau/Pohl 2007: 1071). Die Risikowahrnehmung ist bei der Investition von vorbeugenden Maßnahmen ein entscheidendes Kriterium. Sie muss seitens der Politik und der Bevölkerung gegeben sein.
Liegt ein Extremereignis lange zurück, wird es umso schwieriger, Prioritäten auf Investitionen in Schutzmaßnahmen vor Schäden durch Extremereignisse zu setzen. Ist ein Extremereignis mit vielen Verlusten und hohen Schäden noch „frisch im Gedächtnis“ (ebd.), dann ist die Bereitschaft in schadensmindernde Vorsorge-maßnahmen zu investieren sehr hoch.
Vorbeugende Maßnahmen können auch rechtlich vorgenommen werden. Durch Gesetze und Verwaltungsvorschriften kann ein Staat Einfluss auf die Risikovorsorge nehmen, indem er beispielsweise Selbstbindungen der öffentlichen Hand, wie Planungen und Investitionen zur Schutzminderung, und Ver- und Gebote gegenüber privaten Personen erstellt werden. Da Beeinflussungen des Schutzes vor Extremereignissen nicht immer zu erkennen sind, wurden gerade in westeuropäischen Ländern Verfahren entwickelt, die die Auswirkungen auf Erhöhung oder Minderung von Risiken ermitteln können. Zu diesen Verfahren gehören unter anderem Raumordungsverfahren, Umweltver-träglichkeitsprüfungen, technische Anweisungen und konkrete Gefahrenplanungen (vgl. ebd.).
Ge- und Verbote gegenüber privaten Personen können beispielsweise Vorschriften für eine tiefere Gründung zur Sicherung vor Hangrutschungen, Mauerverstärkung gegen Lawinen- oder Erdbebengefahr oder Verstärkung von Gebäuden in Hurrikanzonen sein. Ebenso gibt es flächenbezogene Bauverbote, wie zum Beispiel Freihaltung von Gebieten, die gefährdet sind, wie Überschwemmungsgebiete (vgl. ebd.: 1072).
Abschlüsse einer Versicherung gehören mit zu den wichtigen Vorbeugungsmaßnahmen. Der Versicherer zahlt durch regelmäßige Prämien im Voraus und bekommt im Schadensfall eine Versicherungssumme, die es dem Geschädigten ermöglicht, schneller in die Normalität zurückzukehren (vgl. ebd.). Ob eine Versicherung für eine Gesellschaft immer bezahlbar ist, ist eine andere Frage.
Eine effektive Maßnahme zur Schadensbegrenzung ist ein Frühwarnsystem. Die Definition für Frühwarnsysteme ist durch eine internationale Strategie für die Katastrophenvorsorge der Vereinten Nationen (ISDR) bestimmt. „Frühwarnung wird hier als die Erstellung und effektive Nutzung von Informationen vor einem gefährlichen Ereignis mit dem Ziel der Risikoverminderung verstanden.“ (Dikau/Weichselgartner 2005: 132) Unter Frühwarnsystem wird im Grunde genommen die rechtzeitige Warnung vor einem drohenden Naturereignis verstanden. Nach Dikau und Weichselgartner (ebd.: 133) werden drei Phasen unterschieden: die Vorhersage, die Warnung und die Reaktion auf die Warnung.
Grundsätzlich besteht ein Frühwarnsystem aus einem Überwachungssystem, das die naturwissenschaftlichen Daten für die Frühwarnung liefert, einer Vorhersage, die einen möglichen Ablauf des Ereignisses beschreibt, einer Leitzentrale, die Informationen sammelt und auswertet, einem Einsatzplan, der den Ablauf einer Evakuierung regelt, und aus Personen, die verantwortlich dafür sind, die Bevölkerung zu warnen. (vgl. ebd.)
Jedoch ist der Erfolg des Frühwarnsystems von dem Zusammenspiel dieser Komponenten abhängig.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Konzept eines Frühwarnsystems[8]
(Quelle: Dikau/Weiselgartner 2005: 134)
Trotz der vielen Alternativen werden vorbeugende Maßnahmen häufig unterlassen. Die Wahrscheinlichkeiten eines Extremereignisses mit hohen Schäden werden als zu gering eingeschätzt und können nicht immer genau bestimmt werden. Die Prioritäten liegen oftmals auf der Verminderung anderer Lebensrisiken. Die Bereitschaft in vorbeugende Maßnahmen zu investieren ist generell sehr gering.
Unter der Katastrophenvorbereitung werden alle Maßnahmen verstanden, die eine schnelle und effektive Reaktion auf drohende Extremereignisse ermöglichen.
Dikau und Weichselgartner (2005: 127) zählen folgende Maßnahmen als wichtige Bestandteile auf: Erstellung von Notfallplänen, Bereitstellung von Notunterkünften, Üben von Katastrophensituationen und Evakuierungsmaßnahmen, Bereitstellung der medizinischen Versorgung und Einsatz des Warnsystems unmittelbar vor dem Ereignis.
Unter den weiteren Maßnahmen der Vorbereitung zählt die Schaffung von Hilfs-strukturen. Darunter zählt beispielsweise die Vorratsbildung an Lebensmitteln oder sonstigem Bedarf des Alltags, die Bereitstellung von Materialien sowie Maschinen. Des Weiteren der (zusätzliche) Aufbau von Informationssystemen, Weiterentwicklung von Koordinationsprozessen auf allen Ebenen, nachhaltiges Ressourcenmanagement, Vorbereitung der Bevölkerung und eine fortlaufende Schwachstellenanalyse, die eine Risikoanalyse erforderlich macht und ein Worst-Case-Szenario mit einschließt.
2.3.2 Katastrophennachsorge respektive Katastrophenbewältigung
Die Maßnahmen während oder nach einer Naturkatastrophe, die das Ziel verfolgen, negative Auswirkungen zu verringern und betroffenen Raum wiederaufzubauen, vereinen sich unter dem Begriff Katastrophenbewältigung – auch Katastrophen-nachsorge genannt. Die Katastrophenbewältigung umfasst für gewöhnlich zwei Phasen: die Katastrophenhilfe und den Wiederaufbau. Um einen möglichst fließenden Übergang zwischen Katastrophenhilfe und Wiederaufbau zu erlangen und somit den Schaden schnellstmöglichst zu verringen, ist es notwendig, dass diese beiden Maßnahmen gut aufeinander abgestimmt sind (vgl. Dikau/Weichselgartner 2005: 139).
2.3.2.1 Katastrophenhilfe
Die Katastrophenhilfe beinhaltet eine Vielzahl von Hilfsaktionen, wie Selbstschutz, Hilfe von freiwilligen Helfern vor Ort, Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, humanitäre Hilfe und vielen anderen. Plate und Merz (2001: 28) zählen zu den bedeutendsten Maßnahmen den vorbeugenden Selbstschutz.
„Gerade während oder unmittelbar nach dem Eintritt des Extremereignisses können besonders wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Katastrophe ergriffen werden. Zu wissen, was im Katastrophenfall als Selbstschutz-maßnahmen zu tun ist, gehört zu den wichtigsten Aufgaben einer Selbsthilfe, zu lernen, was man im Katastrophenfall wissen muß, zu den wichtigsten Aufgaben der Vorsorge.“ (ebd.)
Die Nothilfe kann im Rahmen internationaler oder lokaler Hilfe sein, aber auch Nachbarschaftshilfe oder der Einsatz von Soldaten stehen unter diesem Begriff.
Die Hilfe der unmittelbaren Nachbarn zählt zu den wichtigsten Maßnahmen. Bei Extremereignissen wird oft davon berichtet, dass Menschen mit der gleichen Not zueinander stehen und sich das teilen, was ihnen geblieben ist (vgl. Dikau/Pohl 2007: 1067).
Die Hilfe von Nichtbetroffenen in der Nähe ist eine weitere Hilfemaßnahme. Die Unterstützung kann unter anderem mit Hilfe materieller und persönlicher Zuwendung, Geldspenden, Haushaltsmittelspenden und das Mobilisieren von freiwilligen Helfern stattfinden (vgl. Plate/Merz 2001: 29). Die lokale Selbsthilfe in Deutschland wird durch die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und anderen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Hilfsorganisationen, wie auch der Bundeswehr geleistet. Ein unbürokratischer und schneller Einsatz von Hilfskräften ist unmittelbar während und nach einer Katastrophe ein entscheidender Faktor zur Verminderung von Folgen und Schäden eines Extremereignisses. Nach Dikau und Weichselgartner (2005: 139) sind wesentliche Komponenten der Katastrophen-bewältigung Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, das Notfallmanagement und begleitende humanitäre Hilfeleistungen. Mitunter ist die wichtigste Aufgabe, die der medizinischen Notfallversorgung von Verletzten und Vermeidung von Seuchen durch Trinkwasserkontaminationen (vgl. ebd.).
Es muss nicht nur schnell gehandelt werden, die vorhandenen Ressourcen müssen ebenso gezielt und effizient durch die Helfer eingesetzt werden. Bleibt die Hilfe länger aus, können schwerwiegende Folgen beziehungsweise Sekundarschäden, wie die Entstehung von Krankheiten (Epidemien), oder wirtschaftliche Schäden durch Produktionsausfall entstehen (vgl. Dikau/Pohl 2007: 1066).
Die entstehenden notwendigen Koordinationen und das Einbeziehen von Akteuren (national sowie international) erfordern ein hohes Maß an organisatorischem Geschick (vgl. Plate/Merz 2001: 29) von zuständigen Entscheidungsträgern. Um ein effektives Handeln zu ermöglichen, müssen „die bei der Notfallbewältigung auftretenden analytischen, organisatorischen und kommunikativen Kompetenzen trainiert werden“ (Dikau/Weichselgartner 2005: 139).
Der Informationsfluss ist ein wichtiger Teil der zu bewältigenden Organisation und davon abhängigen Katastrophenhilfe. Jedoch ist es meist so, dass das Kommunikationssystem, welches die Voraussetzung für einen guten Informationsfluss ist, infolge eines Extremereignisses nur teilweise oder gar nicht funktionsfähig ist. Als Beispiel führen Plate und Merz (2001: 29) das Erdbeben in Kobe von 1995 an. Am Tag des Erdbebens stiegen die Telefongespräche in der betroffenen Region auf ein fünfzigfaches des normalen Bedarfs. Dies führte zu einem Zusammenbruch des Telefonnetzes. Hinzu kam, dass viele Leitungen durch das Erdbeben selbst zerstört wurden. Des Weiteren gab es erhebliche Störungen der elektronischen Kommuni-kationen, so dass Zentralcomputer nicht genutzt werden konnten. In dieser Situation erwies sich der Informationsaustausch über Satellit als sehr hilfreich, „beispielsweise konnte die Satellitenverbindung der Supermarktkette Jusco, die seit August 1994 alle Filialen verbindet, zur Koordination von Hilfsmaßnahmen genutzt werden „ (ebd.: 30).
Für eine effektive Kommunikation sind ein modernes Informationsmanagement und neue Technologien daher unabkömmlich (vgl. ebd.). Das Internet ist hierbei eine der effektivsten Technologien, da es „aufgrund seiner dezentralen Organisation und der redundanten Übertragungswege auch bei Ausfall einzelner Pfade die Kommunikation“ (ebd.) sichert.
Wichtige Informationsträger können auch lokale Medien sein. Sie übermitteln beispielsweise über das Radio oder den Fernseher Katastrophenwarnungen an die Bevölkerung und verbessern dadurch die Reaktionen. Für überregionale Medien gilt meist der Wert des Unterhaltungsfaktors, da diese Medien die Sensationslust bedienen möchten, und sich meist aus diesem Grund ein Konflikt zwischen Katastrophen-management und Medien entwickelt. Jedoch spielen sie auch eine wichtige Rolle, da sie Nichtbetroffene im In- und Ausland informieren und zu Spenden aufrufen.
Auch externe Hilfe ist oft in der Katastrophenbewältigung unverzichtbar. Sie bezieht sich zuerst auf die elementarsten Grundbedürfnisse der Menschen. Das heißt, durch sie werden Trinkwasser, Nahrungsmittel, Kleidung und täglich gebrauchte Güter zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden notdürftige Reparaturen an beispielsweise der Infrastruktur vorgenommen. Sachspenden für die Hilfsorganisationen sind zwar beliebt, jedoch laut Dikau und Pohl ein „zweischneidiges Schwert“ (2007: 1067), da sie nicht immer die richtigen Mittel zur richtigen Zeit sind und einen sehr hohen Aufwand bedeuten.
Gerade bei Naturkatastrophen mit einem sehr großen Schaden wird Hilfe aus dem Ausland sowohl angenommen als auch angeboten. Regierungshilfe kann sehr schnell zu Verfügung gestellt werden, jedoch wird sie „durch die Gebundenheiten an die bürokratischen Prozeduren […] – sowohl aufseiten des Helferlandes wie des Landes, das die Hilfe empfangen soll – häufig behindert“ (ebd.). Die Hilfe muss vom Staat, der die Hilfe empfangen soll, angefordert oder akzeptiert werden. Anderseits ist es eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten (vgl. ebd.).
Nichtregierungsorganisationen (NGO) stehen für ein weiteres Hilfsangebot. Sie sind nicht gewinnorientiert und auch nicht vom Staat abhängig. „NGOs fungieren als Katalysator und ausführendes Organ zivilgesellschaftlicher Hilfsangebote, die in erster Linie aus Geldspenden bestehen.“ (ebd.) Sie haben meist langjährige Erfahrung und können daher effizient Handeln. Wie es Dikau und Pohl (2007: 1067) beschreiben, handeln sie scheinbar außerhalb des politischen Systems und können sich hinsichtlich ihrer Berufung auf einen humanitären Hilfsauftrag schneller Betroffenen zuwenden. Jedoch unterliegen sie auch infolge ihrer Unabhängigkeit keiner Kontrolle und handeln oftmals dahingegen, eine gewisse Medienpräsenz zu zeigen, um so an höhere Spenden zu gelangen (vgl. ebd.).
Der Umfang der Hilfe von nichtstaatlichen Einrichtungen ist nicht zuletzt von den Medien abhängig.
„Die Medien folgen […] in Umfang und Art der Berichterstattung ihren eigenen Gesetzen und Zwängen. Pauschal kann man sagen, dass nach der Zugäng-lichkeit des Schadensgebietes und danach, wie geeignet das Ereignis für Medienberichte ist […], die Berichterstattung umso intensiver ausfällt, je geringer die Distanz zum Zuschauer bzw. Leser ist. Je größer die Distanz, desto größer müssen auch die Schäden sein, um einen Platz in den hiesigen Medien zu erringen.“ (Dikau/Pohl 2007: 1067)
2.3.2.2 Wiederaufbau
Der Wiederaufbau beinhaltet Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum Aufbau von Katastrophen betroffenen Räumen. Diese Maßnahmen sind oft langwierig und mit hohen Kosten verbunden. Gerade in Entwicklungsländern ist der Wiederaufbau abhängig von freiwilligen Helfern und der Eigenleistung der betroffenen Personen. Die internationale Hilfe bezieht sich meist nur auf die Erstversorgung und reicht nicht über die Hilfe der Katastrophenbewältigung hinaus (vgl. Plate/Merz 2001: 31).
Der Wiederaufbau hat zum Ziel, den vorkatastrophalen Zustand wieder zu erreichen. Jedoch bietet er auch die Möglichkeit, ihn im Rahmen der Grundsätze der Katastrophenvorsorge zu realisieren (vgl. Dikau/Weichselgartner 2005: 142). Da das gesamte Katastrophenmanagement als ein Kreislauf (siehe Abb….) betrachtet werden kann, kann der Wiederaufbau Ansätze der Vorsorge für eine möglich folgende Katastrophe enthalten.
Des Weiteren sind idealtypischer Weise entwicklungspolitische Kriterien Elemente eines Wiederaufbaus. Der Einbezug von direkt und indirekt betroffenen Personen, Armutsverminderung, Anpassung an die sozioökonomische Situation der Gemeinschaft und eine reduzierte Verwundbarkeit sind einige der wichtigsten Punkte, die enthalten sein sollten (vgl. ebd.: 143).
Allerdings ist nicht immer davon auszugehen, dass ein gelungener Wiederaufbau erfolgt. In einigen Fällen bleibt die Hilfe aus oder wird unsachgemäß ausgeführt, so dass nicht einmal der Zustand von vor der Katastrophe erreicht wird, sondern auf einem niedrigerem Niveau stehen bleibt. Dies kann zur Folge haben, dass Betroffene im Extremfall langjährig oder lebenslang ein provisorisches Leben führen müssen (vgl. Dikau/Pohl 2005: 1069).
„Ein solches ‚Durchwursteln’, häufig als muddling through bezeichnet, hängt auch von der Resilienz ab. Die regionale Wiederaufbaukapazität umfasst wirtschaftliche Ressourcen, infrastrukturelle Voraussetzungen, politische Unterstützung, Ausmaß an Gemeinschaftssinn und Grad der psychischen Stabilität. Möglich ist auch eine passive Sanierung, das heißt, es findet kein oder ein nur verminderter Wiederaufbau statt, nur die gröbsten Schäden werden repariert, der größere Teil der Bevölkerung wandert ab, Betriebe bleiben geschlossen oder wandern ebenfalls ab.“ (ebd.)
Der Wiederaufbau kann auch dazu (aus-)genutzt werden, neu zu strukturieren. Das heißt eine Neuausrichtung der Siedlungen, Infrastruktur etc.
Die Infrastruktur der Straßen sowie die Wasserversorgung erfolgen durch den staatlichen Wiederaufbau. Der individuelle Wiederaufbau wird durch Staatszuschüsse gesteuert. zudem kann der Staat durch unterschiedliche Instrumente den privaten Wiederaufbau fördern. Das kann im Rahmen von verbilligten Darlehen oder Zuschüssen für die Errichtung von Gebäuden, Anschaffungen von Maschinen oder anderer Produktionsmittel stattfinden. Dies wird größtenteils durch Umverteilung finanziert, da die Gelder im Vorhinein nicht in der Haushaltsplanung des Staates enthalten sind.
„Eine vollständige Finanzierung des Wiederaufbaus durch die öffentliche Hand ist in der Regel ausgeschlossen. Allerdings wird die staatliche Quote oft als Solidaritätsbeitrag durch eine Sonderabgabe für das gesamte Hoheitsgebiet refinanziert, es handelt sich also um erzwungene Hilfe durch die anderen Steuerzahler.“ (Dikau/Pohl 2005: 1069)
Bei der Verteilung der Mittel beziehungsweise der Gelder treten häufig zwei Probleme auf. Zum einen werden die Mittel nicht optimal eingesetzt und zum anderen werden Mittel für Investitionen ausgegeben, die nicht oder nur teilweise getätigt werden. Dies geschieht gerade in Ländern mit instabilen und nichttransparenten politischen Verhältnissen. Wenn gesicherte Ordnungskräfte fehlen oder „das Militär ein gewisses Grad an Autonomie“ (ebd.: 1070) überschreitet, dann kann es oftmals vorkommen, dass Hilfsorganisationen an diverse Organisationen Abgaben zahlen müssen, um Hilfe leisten zu können und zu dürfen. Die Beweisbarkeit der ersichtlichen Korruption ist fast unmöglich.
Nichtstaatliche Hilfsorganisationen haben aufgrund der Komplexität und des Misstrauens auf Verteilung von Mitteln an großer Bedeutung hinzugewonnen. Zu den klassischen nichtstaatlichen Hilfsorganisationen gehören zum Beispiel das Rote Kreuz, kirchliche Organisationsformen oder Organisationen wie Greenpeace, die aus sozialen Bewegungen hervorgegangen sind. Um seine Ressourcen effizienter einzusetzen, bedient sich der Staat oftmals solcher Hilfsorganisationen.
„So sehr es in der Stunde der Not geboten ist, den Betroffenen durch die Bereitstellung von Lebensmitteln oder provisorischen Unterkünften zu helfen, so wird die positive Nothilfe von außen ins Negative gekehrt, wenn dadurch die Eigeninitiative unterbunden wird, sich selbst zu helfen. Hier ist oftmals eine schwierige Gradwanderung der Helfer nötig zwischen effizienter, logistischer aber von außen gesteuerter Unterstützung und kleinteiligen, angepassten Hilfsmaßnahmen, die die nötige Anschubenergie liefern, damit die lokale Ökonomie wieder in Schwung kommt.“ (ebd.: 1070)
3. Tsunami aus physisch-geographischer Sicht
Am Sonntag, den 26. Dezember 2004, um 07:58 Uhr Ortszeit vor der Westküste Sumatras ereignete sich in 30 Kilometer Tiefe das viertgrößte Erdbeben seit 1900 (vgl. http://neictest.cr.usgs.gov…). Dieses Erdbeben verursachte eine Seebebenwelle: den Tsunami.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Zeitverlauf des Tsunami
(Quelle: www.physik.uni-karlsruhe.de/.../Vergangene_Veranstaltungen...)
Um die verheerenden Ausmaße des Tsunami in den betroffenen Ländern deutlicher darzustellen und zu verstehen, soll das Naturereignis Tsunami in diesem Kapitel aus physisch-geographischer Sicht beleuchtet und mit mathematischen Größenverhältnissen erläutern werden.
3.1 Ursachen eines Tsunami
Tsunamis unterscheiden sich grundsätzlich von Wellen, die durch Wind entstehen. Bei winderzeugten Wellen werden nur die oberen Wasserschichten aufgeworfen, während die tieferen unberührt bleiben. Diese Wellen können bis zu 30 Meter hoch (Amelung 2005: 18) und 100 bis 200 Meter lang werden. Sie kommen in einem Abstand von 10 bis 20 Sekunden (Schwelien 2005: 31). Tsunamiwellen dagegen bewegen die gesamte Wassermasse vom Meeresboden bis zur Meeresoberfläche und erreichen in wenigen Sekunden mehrere Dekameter (Kelletat 1989: 79). Die Wellenlängen können bis zu 500 Kilometer betragen (Amelung 2005: 3) und zwischen den Tsunamiwellen können Minuten bis Stunden liegen (vgl. Schwelien 2005: 31). Die Wellenperiode seismisch ausgelöster Tsunamiwellen hat oft längere Wellenperioden als Tsunamiwellen anderer Ursachen. Amelung (2005: 18) vergleicht die Entstehung eines Tsunami mit dem Verhalten von Wasser in einem Wassereimer (stark vereinfachte Betrachtungsweise):
„Erhält der auf dem Boden stehende Eimer einen Tritt, schwappt das Wasser über. In der Natur kann ein derartiger Tritt, also die ruckartige Bewegung des Meeresbodens, durch die Verschiebung des Untergrundes bei Erdbeben ausgelöst werden. Dasselbe gilt bei Vulkansausbrüchen und Hangrutschen.“ (ebd.)
Während von Wind ausgelöste Wellen und Gezeiten regelmäßig auftreten, sind Tsunamiwellen selten (vgl. Kelletat 1989: 79).
Die Ursachen eines Tsunami können Erdbeben, Vulkaneruptionen, Hangrutsche und Meteoriteneinschläge sein (Amelung 2005: 19). In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Ursachen für das Auftreten von Tsunamis erläutert.
In der folgenden Tabelle sind schwerwiegende Tsunamis seit 1800 mit unterschied-lichen Auslösern aufgelistet:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Die folgenschwersten Tsunamis seit 1800
(Quelle: http://geol59.uni-graz.at/05W/650136/tsunamis.html)
[...]
[1] Vergleiche dazu die Tabelle auf folgender Internetseite: http://www.tsunami-alarm-system.com/phaenomen-tsunami/phaenomen-tsunami-vorkommen.html#ce_354
[2] Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen
[3] Siehe Rechenbeispiele Kap. 3.2.
[4] Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V.
[5] Non-Governmental Organization
[6] International Non-Governmental Organization
[7] Aufgabe der Raumplanung: Entwicklungsprozesse auf unterschiedlicher Ebene (Stadt, Land etc.) auf unterschiedliche Phänomene (Umwelt, Bevölkerung etc.) zu untersuchen. Ziel der Raumplanung: Nutzungs- und Lösungskonflikte zu vermeiden. Der Begriff Raumplanung ist nicht verbindlich definiert. Er stellt einen Oberbegriff dar, der planerische Maßnahmen mit räumlichen Auswirkungen umfasst.
[8] „Konzept eines gut entwickelten Frühwarnsystems für Naturgefahren. Die zentralen Komponenten umfassen die Erkennung der Bedrohung, die Gefahrenbewertung, die Weitergabe und Kommunikation der Warnung sowie die öffentliche Reaktion auf die Warnung. Es ist zu erkennen, dass der gesamte Führwarnprozess weitere Bereiche der Katastrophenvorbeugung und –vorbereitung enthält […].“ (Smith 2004 zit. n. Dikau/Weichselgartner 2005: 134)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836615815
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main – Geowissenschaften, Humangeographie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- katastrophenmanagement lanka bürgerkrieg tsunami katastrophenhilfe
- Produktsicherheit
- Diplom.de