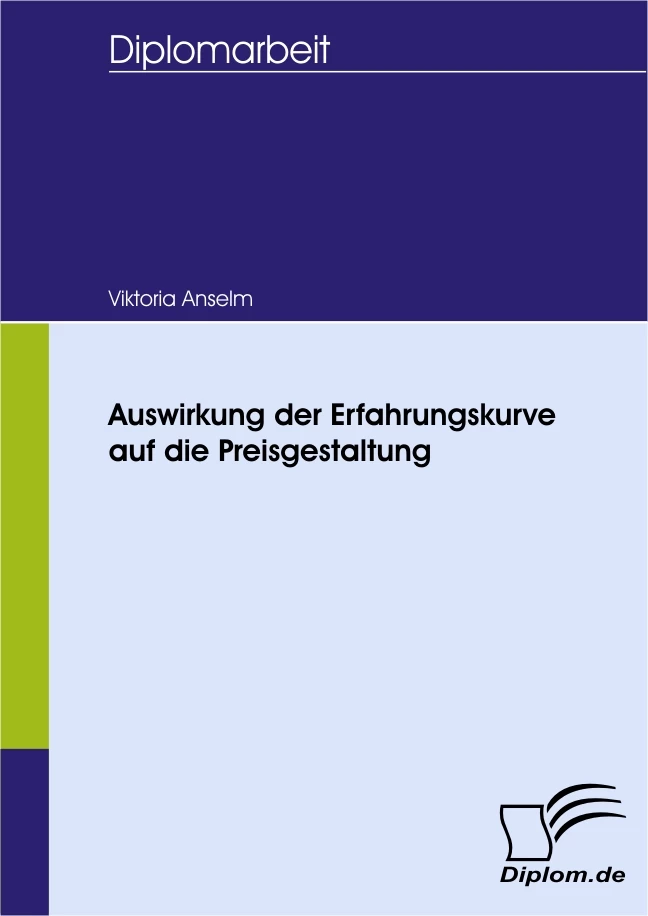Auswirkung der Erfahrungskurve auf die Preisgestaltung
Zusammenfassung
Die Vervierfachung der Ölpreise aufgrund der Ölkrise der 70er Jahre und die mit der Energie zusammenhängende Umweltverschmutzung führten zu neuen Überlegungen hinsichtlich der Art und Weise, wie die Energie genutzt wird. Unmittelbares Ergebnis war die Verbesserung der Effizienz, der in Anlagen und Beleuchtungseinrichtungen, bei der Kühlung, bei Kraftfahrzeugen, der Isolierung von Häusern und in kommerziellen Gebäuden usw. genutzten Energie. Trotz teilweise massiver Effizienzsteigerungen, wächst die weltweite Nachfrage nach Energie jedoch weiterhin stark an. Dies gilt seit Beginn der Industrialisierung vor allem für die Industrie- und Transformationsländer.
Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges nimmt aber auch der Energiehunger in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu. In den am wenigsten entwickelten Ländern dominiert weiterhin die Energiearmut und verhindert damit den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung der Industrieländer, durch den mangelnden Zugang zu modernen Energieformen.
Doch der rasant ansteigende Energiebedarf stellt nicht nur ein Entwicklungshemmnis dar, sondern führt auch zu erheblichen Umweltschäden durch die derzeitige Struktur der Energienutzung. Etwa 30% der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen resultieren aus der derzeitigen Elektrizitätserzeugung. Kohlendioxid (CO2) gehört zu den umweltschädlichen Treibhausgasen. Von den Risiken die die Nutzung der Kernenergie mit sich bringt, ganz zu schweigen. Außerdem lässt sich aus der eingesetzten Primärenergie Kohle, Öl, Gas oder Uran nur rund ein Drittel in Elektrizität umwandeln. Bis zu weitere 20% dieser erzeugten Strommenge geht in Kraftwerken und auf langen Transportwegen verloren.
Der World Wide Fund For Nature (WWF) fordert die Verstromung von Kohle schnellstmöglich zu beenden, den Einsatz der Erneuerbaren Energien voranzutreiben und die Kraftwerkseffizienz zu erhöhen. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen (WBGU) sieht auch in Anbetracht sicherheitspolitischer Risiken, die sich aus der gegenwärtigen Struktur der globalen Energienutzung ergeben, die Energiewende zur Nachhaltigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben globaler Umwelt- und Entwicklungspolitik des 21. Jahrhunderts an.
Gang der Untersuchung:
Wie aber muss eine nachhaltige Wirtschaftspolitik heute und in Zukunft aussehen, damit Erneuerbare Energien, sowohl effektiv als auch effizient gefördert werden? Dieser Frage gehe ich in meiner […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Gang der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen der Arbeit
2.1 Definitionen und Erläuterungen zum Begriffsfeld Preis
2.1.1 Preis als wichtiges Marketing-Mix-Element
2.1.2 Marktfunktionen des Preises
2.2 Grundlagen des Erfahrungskurvenkonzeptes
2.2.1 Einordnung in das Controlling und die Historie
2.2.2 Definition und Abgrenzung: Die Entwicklung von der Lernkurve zur Erfahrungskurve
2.2.3 Aussage des Erfahrungskurvenkonzeptes
2.2.4 Ursachen für das Auftreten der Erfahrungskurveneffekte
2.2.5 Typische Verläufe der Erfahrungskurve
3 Erfahrungskurvenkonzept und Preisstrategie
3.1 Die besondere Bedeutung der Erfahrungskurve für die Preisstrategie
3.2 Die Anfangspreisstrategie bei Nutzung des Erfahrungskurveneffektes
3.3 Die Preisstrategie in späteren Phasen des Produktlebenszyklus
3.3.1 Die vier Phasen des Produktlebenszyklus
3.3.2 Zusammenhang zwischen Produktlebenszyklus und dem Markt- wachstums/Marktanteils-Portfolio (BCG-Portfolio)
3.3.3 Ableitung der Normstrategien aus dem Produktlebenszyklus und dem BCG-Portfolio
3.4 Anwendungsmöglichkeiten der Erfahrungskurve
3.5 Grenzen und Probleme der Erfahrungskurve
3.6 Kritische Beurteilung der Preisgestaltung auf Basis potentieller
4 Erfahrungskurveneffekte erneuerbaren Energieträgern
4.1 Begriff der fossilen Energieträger
4.2 Begriff der Erneuerbaren Energien
4.2.1 Charakteristika Erneuerbarer Energien und ihre Vorteile gegenüber fossilen Energieträgern
4.2.2 Photovoltaik als zukünftige Energiequelle
4.2.3 Entwicklung der Preisdynamik und der Erfahrungskurve für die Photovoltaik
4.2.4 Nachteile der Photovoltaik
4.3 Fossile Energieträger vs. Erneuerbare Energien: Erfahrungskurve und Preisentwicklung heute – und in Zukunft
4.4 Kritische Beurteilung der Aussagekraft des Erfahrungskurvenkonzeptes im Anwendungsbeispiel
5 Schlussbetrachtung
Anhangverzeichnis
Anhang
Literaturverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
Darst. 1: Einordnung des Erfahrungskurvenkonzepts in das Controlling
Darst. 2: Erfahrungseffekte
Darst. 3: Graphische Veranschaulichung der Erfahrungskurve bei linearer bzw. doppeltlogarithmischer Skalierung
Darst. 4: Erfahrungsbasiertes Phasenmodell zur Entwicklung von Kosten und Preisen im Markt
Darst. 5: Produktlebenszyklus
Darst. 6: Marktwachstums/Marktanteils-Portfolio
Darst. 7: Prozentuale Verteilung der öffentlichen Stromversorgung in Deutschland
Darst. 8: Die Veränderung des globalen Energiemix im exemplarischen
Pfad bis 2050/2100
Darst. 9: Die Entdeckung der Photovoltaik
Darst. 10: Globaler Photovoltaikmarkt, Module
Darst. 11: Silizium-Solarzellen-Flachmodule, Preis-Erfahrungskurve
Darst. 12: Erfahrungskurve für Braunkohle und Photovoltaik
Darst. 13: Erwartete Entwicklung der monatlichen EEG-Umlage
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Vervierfachung der Ölpreise aufgrund der Ölkrise der 70er Jahre – und die mit der Energie zusammenhängende Umweltverschmutzung – führten zu neuen Überlegungen hinsichtlich der Art und Weise, wie die Energie genutzt wird. Unmittelbares Ergebnis war die Verbesserung der Effizienz, der in Anlagen und Beleuchtungseinrichtungen, bei der Kühlung, bei Kraftfahrzeugen, der Isolierung von Häusern und in kommerziellen Gebäuden usw. genutzten Energie.[1] Trotz teilweise massiver Effizienzsteigerungen, wächst die weltweite Nachfrage nach Energie jedoch weiterhin stark an. Dies gilt seit Beginn der Industrialisierung vor allem für die Industrie- und Transformationsländer.
Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges nimmt aber auch der Energiehunger in den Entwicklungs- und Schwellenländern zu. In den am wenigsten entwickelten Ländern dominiert weiterhin die Energiearmut und verhindert damit den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung der Industrieländer, durch den mangelnden Zugang zu modernen Energieformen.
Doch der rasant ansteigende Energiebedarf stellt nicht nur ein Entwicklungshemmnis dar, sondern führt auch zu erheblichen Umweltschäden durch die derzeitige Struktur der Energienutzung.[2] Etwa 30% der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen resultieren aus der derzeitigen Elektrizitätserzeugung. Kohlendioxid (CO2) gehört zu den umweltschädlichen Treibhausgasen.[3] Von den Risiken die die Nutzung der Kernenergie mit sich bringt, ganz zu schweigen. Außerdem lässt sich aus der eingesetzten Primärenergie Kohle, Öl, Gas oder Uran nur rund ein Drittel in Elektrizität umwandeln. Bis zu weitere 20% dieser erzeugten Strommenge geht in Kraftwerken und auf langen Transportwegen verloren.[4]
Der World Wide Fund For Nature (WWF) fordert die Verstromung von Kohle schnellstmöglich zu beenden, den Einsatz der Erneuerbaren Energien voranzutreiben und die Kraftwerkseffizienz zu erhöhen.[5] Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen (WBGU) sieht auch in Anbetracht sicherheitspolitischer Risiken, die sich aus der gegenwärtigen Struktur der globalen Energienutzung ergeben, die Energiewende zur Nachhaltigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben globaler Umwelt- und Entwicklungspolitik des 21. Jahrhunderts an.[6]
1.2 Zielsetzung und Gang der Arbeit
Wie aber muss eine nachhaltige Wirtschaftspolitik heute und in Zukunft aussehen, damit Erneuerbare Energien, sowohl effektiv als auch effizient gefördert werden? Dieser Frage gehe ich in meiner Diplomarbeit nach. Um die Effizienz Erneuerbarer Energien und ihrer Technologien zu untersuchen, zielt diese Arbeit darauf ab, insbesondere die Verringerung von Kosten der Photovoltaik-Technologie, als Erneuerbaren Energieträger, an Hand von Erfahrungskurven darzustellen und herauszufinden, inwiefern sich diese Erfahrungskurveneffekte auf die Gestaltung der heutigen sowie zukünftigen Strompreise auswirken.
Die vorliegende Arbeit ist in insgesamt fünf Abschnitte gegliedert. Nachdem in Abschnitt 1 die zu Grunde liegende Problemstellung und die Zielsetzung dieser Arbeit vorgestellt wurden, werden in Abschnitt 2 die theoretischen Grundlagen, auf der diese Arbeit basiert, dargestellt. Der Begriff Preis wird hier definiert und das Erfahrungskurvenphänomen erklärt, sowie die Ursachen für das Auftreten von Erfahrungskurveneffekten aufgezeigt. In Abschnitt 3 wird die besondere Bedeutung der Erfahrungskurve für die Preisstrategie näher erläutert und in diesem Zusammenhang auf die preispolitischen Instrumente, Produktlebenszyklus und Portofolio eingegangen. Ferner werden die Anwendungsmöglichkeiten des Erfahrungskurvenkonzeptes, sowie Kritikpunkte daran aufgezeigt. Im 4. Abschnitt der Arbeit wird das Konzept der Erfahrungskurve an einem Beispiel, dem Einsatz von Photovoltaik in Deutschland, erläutert und angewendet. Am Beispiel sollen die Auswirkungen auf die Strompreise dargestellt werden, die sich durch Erfahrungskurveneffekte bei neuen Energietechnologien ergeben. Eine kurze Zusammenfassung dieser Arbeit, sowie eine Handlungsempfehlung werden in Kapitel 5 beschrieben.
2 Theoretische Grundlagen der Arbeit
2.1 Definitionen und Erläuterungen zum Begriffsfeld Preis
2.1.1 Preis als wichtiges Marketing-Mix-Element
„Der Preis wird traditionell als die monetäre Gegenleistung („Entgelt“) eines Käufers für ein Wirtschaftsgut definiert. Preise werden von Anbietern gefordert („Angebotspreise“), von Nachfragern geboten („Nachfragepreise“) bzw. am Markt akzeptiert („Marktpreise“). Überall dort also, wo Leistungen und Gegenleistungen getauscht werden (sollen), gibt es Preise…“ (Diller).[7]
Zum absatzpolitischen Instrumentarium eines Unternehmens zählt neben der Preispolitik, die Kommunikationspolitik, Produktpolitik sowie Distributionspolitik. Diese Instrumente werden stets kombiniert als „Marketing-Mix“ eingesetzt, da es zwischen ihnen zahlreiche Interdependenzen gibt, die es zu nutzen gilt: So könnte der Hersteller eines Produkts, das so ähnlich auch von seinen Konkurrenten angeboten wird, versuchen, durch kommunikationspolitische Maßnahmen (z.B. Werbung und/oder Verkaufsförderung am „Point of Sale“) einen besonderen „Zusatznutzen“ seines Erzeugnisses glaubhaft zu machen; dies erlaubt ihm dann möglicherweise eine Überschreitung des „üblichen“ Marktpreises.[8]
In den 1980er und 1990er-Jahren traten jedoch deutliche Sättigungstendenzen auf vielen Märkten, sowie Nachfrageschwächen, wegen z.T. sinkender Einkommen auf. Ausgeschöpfte Kunden- und Umsatzpotentiale erzeugten einen „Wachstumsnotstand“, dem man vielerorts nur mit preispolitischen Mitteln beizukommen glaubte. Den Kostenspielraum hierfür hatte oft die Rationalisierungswelle, in Verbindung mit der Einführung des Lean Management, geschaffen. Im Einzelhandel eroberte das Discounting bis heute jeweils 30 – 50% der Märkte, was dann auch schnell zur Anwendung dieses Marketingkonzeptes auf andere Branchen, wie den Flugverkehr, die Finanzdienstleistungen oder die Hotellerie führte. Die Preispolitik erlangte folglich eine Sonderstellung im Marketing-Mix, was im Wesentlichen aus den folgenden fünf Umständen resultiert:[9]
(1) Die Preispolitik ist eine der schärfsten Marketingwaffen(gattungen) im Marketing-Mix, was sich aus den starken Wirkungen („Preisresponse“), die sich mit ihr am Markt erzielen lassen, ergibt. Sowohl Kunden als auch Wettbewerber reagieren auf Preisveränderungen oft drastisch. Bei Kunden gilt dies besonders für Konsumgüter, die in relativ kurzem Abstand erworben werden. Die Reaktion der Wettberber ist vor allem auf die schnelle Umsetzbarkeit von preispolitischen Entscheidungen zurückzuführen. Andere Instrumente, wie Werbung und Produktgestaltung, sind dieser Reaktionsgefahr weniger ausgesetzt. Preise sind zudem leicht kommunizierbar und stoßen somit auf das Interesse vieler Abnehmer, die im preisgünstigen Einkauf die zentrale Aufgabe ihres ökonomischen Verhaltens sehen.[10]
(2) Der Preis zählt zu den stärksten Treibern des Gewinns und anderer Unternehmens-Oberziele, wie Marktanteil oder Kundenbindung. Dies ist vor allem darauf zurück zu führen, dass der Preis zum einen unmittelbar die Umsatzerlöse (Produkt aus Preis und Absatzmenge) bestimmt. Zum anderen beeinflusst er dadurch gleichzeitig die absetzbare Menge, da Kunden i.d.R. weniger kaufen, wenn der Preis steigt. Dadurch werden wiederum indirekt die Kosten beeinflusst, deren Höhe wegen der unterschiedlichen Auslastung der vorhandenen Kapazitäten stark von den Absatzmengen abhängen. Umsatzerlöse und Kosten sind wiederum die beiden Komponenten des Gewinns. Preise haben demnach eine starke Auswirkung auf das Unternehmensergebnis. Bei einer heute typischen Kostenstruktur von Großunternehmen, erhöht eine Steigerung des Preises um ein Prozent den Nettogewinn um ca. 12%.[11]
(3) Die Preispolitik steht in einem äußerst dynamischen Umfeld, so dass über sie häufiger und gründlicher als bei anderen Marketinginstrumenten nachgedacht und ggf. entsprechend nachjustiert werden muss. An dieser Stelle soll nur beispielhaft auf staatliche Deregulierungen, neue Konkurrenzstrategien, veränderte Machtverhältnisse im Distributionskanal, veränderte Preisansprüche der Kunden, oder neue Vertriebskanäle wie das Internet und u.U. völlig neue preispolitische Ausgangsbedingungen, hingewiesen werden.[12]
(4) Die Globalisierung des Wettbewerbs und der damit verbundene grenzüberschreitende Markteintritt einer wachsenden Zahl ausländischer Anbieter (z.B. Anbieter aus „Billiglohnländern“) bewirken einen wachsenden Preisdruck.[13]
(5) In vielen Branchen gleichen sich die Produkte einzelner Wettbewerber qualitativ immer stärker an. Diese Vergleichbarkeit macht die Preispolitik zu einem aggressiven Instrument im Wettbewerb. Auch für den Nachfrager gewinnt der Preis als Entscheidungskriterium zunehmend an Bedeutung. Die Preistransparenz ist auf vielen Märkten deutlich angestiegen. Zum einen wurde die Verfügbarkeit von Preisinformationen durch das Internet drastisch erhöht, zum anderen sind Preisvergleiche länderübergreifend durch die Währungsunion stark vereinfacht.[14]
Die Preispolitik gehört zum schwierigsten und risikoreichsten Marketing-Instrumentarium im Marketing-Mix. Dies liegt einerseits an den zahlreichen Instrumenten die der Preispolitik zur Verfügung stehen, andererseits an den oft ungewissen bzw. schwer einschätzbaren Reaktionen der Kunden und insbesondere der Wettbewerber, auf eigene Preisaktivitäten. Darüber hinaus agiert man in einem hoch komplexen Umfeld mit vielen, oft interdependenten und z.T. nur schwer durchschaubaren Wirkungseffekten. So rangierte die Preisstellung nach einer Befragung von 186 Führungskräften in USA und Europa, hinsichtlich des Problemdrucks deutlich an erster Position, vor der Produktdifferenzierung, der Neuprodukteinführung und der Vertriebskostenrechnung. Preispolitik ist demnach einerseits chancenreich, andererseits aber auch risikoträchtig.[15]
2.1.2 Marktfunktionen des Preises
Der Preis hat innerhalb einer Marktwirtschaft unterschiedliche Funktionen zu erfüllen. Sie sind vordergründig darauf gerichtet, den marktwirtschaftlichen Koordinationsmechanismus zu stützen und zu sichern, d.h. eine bestmögliche Güterversorgung (z.B. Wirtschaftswachstum) oder die Vermeidung oder Beseitigung von Ungleichgewichten (z.B. Arbeitslosigkeit), zu gewährleisten.[16] Es lassen sich folgende Funktionen unterscheiden, die jedoch nicht unabhängig von einander zu betrachten sind:[17]
Mit Hilfe der Rationierungsfunktion des Preises können Knappheiten bzw. Knappheitsrelationen angezeigt werden. Durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Markt, pendelt sich der Preis auf einer solchen Höhe ein, dass die Nachfrager die das Gut zu diesem Preis nicht kaufen wollen oder können, vom Bezug der betreffenden Ware ausgeschlossen werden. Würde der Preis diese Rationierungsfunktion nicht erfüllen, müsste man auf ein anderes Zuteilungsverfahren zurückgreifen, mit dem die begrenzte Gütermenge auf die Wirtschaftssubjekte verteilt wird.[18]
Durch das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage entsteht ein Gleichgewicht, das die Absatzmenge auf dem Markt maximiert. Man spricht deshalb von einer Ausgleichsfunktion des Preises, wenn Angebot und Nachfrage zu diesem Preis zum Ausgleich gebracht werden. So ist für alle Preise oberhalb des Gleichgewichtspreises, mengenmäßig das Angebot höher als die Nachfrage und für alle Preise unterhalb des Gleichgewichtspreises, die Nachfrage höher als das Angebot. Im ersten Fall gilt die Nachfrage und im zweiten Fall das Angebot als begrenzende Größe. Der durch diesen Überbietungs- oder Unterbietungsprozess zustande gekommene Gleichgewichtspreis, koordiniert Angebot und Nachfrage. Man spricht deshalb auch von einer Koordinationsfunktion des Preises. Allerdings herrschen an realen Märkten kaum Gleichgewichtspreise.[19]
Da auf diese Weise, zumindest tendenziell, erreicht wird, dass alles was im marktkoordinierten Wirtschaftssystem an Produktionsleistungen erbracht wird, auch Verwendung findet, kann man in diesem Zusammenhang ebenso von der Allokations-, Zuteilungs- oder Lenkungsfunktion des Preises sprechen, denn die möglichst kostenminimierend bzw. einkommensmaximierend eingesetzten Produktionsfaktoren, wandern an die Stellen wo sie gebraucht werden.[20]
Die Selektionsfunktion des Preises ist eine weitere Funktion, die sich bei Veränderungen der Nachfrage oder des Angebots zeigt. So müssen etwa bei einer Linksverschiebung der Nachfrage, die Anbieter mit den höchsten Kosten, aus dem Markt ausscheiden, da sie durch das gesunkene Marktpreisniveau ihre langfristige Preisuntergrenze und damit ihre Existenz im Markt nicht mehr realisieren können.[21]
Preise haben außerdem eine Signal-, Orientierungs-, oder auch Indikatorfunktion. Dies sei am Beispiel der Verknappung eines Rohstoffes (z.B. Erdöl) aufgezeigt. Kommt es infolge einer solchen Verknappung zu einer Preissteigerung, informiert diese die Wirtschaftssubjekte über die eingetretene Verknappung, welche durch eine Steigerung der Nachfrage, oder durch eine Verringerung des Angebots hervorgerufen worden ist.
Auf dieses Preissignal hin können die Wirtschaftssubjekte auf andere Güter oder Produktionsfaktoren ausweichen, die zwar billiger sind aber prinzipiell den gleichen Zweck erfüllen. Man kann in diesem Fall also von einer Steuerungsfunktion sprechen da ersichtlich wird, dass die Preise das Verhalten steuern.
Gleichzeitig werden andere Wirtschaftssubjekte angeregt, nach neuen Produkten oder Produktionsverfahren zu suchen, um hierdurch Rohstoffeinsparungen zu erzielen, sowie ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen und zu steigern, um nicht durch eventuelle Einkommensverluste ausselektiert zu werden. In diesem Sinne hat der Preis auch eine Anreiz- oder auch Auslesefunktion. [22]
Obwohl das Preissystem seine Funktionen nicht immer reibungslos oder gar perfekt erfüllen wird, kann dennoch seine Leistungsfähigkeit, unter der Voraussetzung einer freien Preisbildung, nicht hoch genug eingeschätzt werden.[23]
2.2 Grundlagen des Erfahrungskurvenkonzeptes
2.2.1 Einordnung in das Controlling und die Historie
Zum ausgewählten Instrumentarium der strategischen Planung und Kontrolle zählt das Erfahrungskurvenkonzept, welches gemeinsam mit dem Instrument der Produktlebenszyklus-Analyse, die Grundlage für das Portfolio-Konzept bildet. Im Rahmen des strategischen Controllings steht es neben weiteren Instrumenten wie z.B. der Stärken-Schwächen-Analyse, Wertschöpfungsketten-Analyse und Früherkennungssysteme.[24]
Darst. 1: Einordnung des Erfahrungskurvenkonzeptes in das Controlling
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung
Gemeinsam mit der Lernkurve, gehört die Erfahrungskurve zu den Skaleneffekten, („economies of scale“), welche besagen, dass mit steigender Ausbringungsmenge, sinkende Erzeugungskosten je Produktionseinheit realisiert werden können. Auf die Erfahrungskurve und die Lernkurve wird im Folgenden näher eingegangen.
Als im Jahre 1925 in den Montagehallen der Wright-Patterson Air Force in Ohio die grundlegende Beobachtung gemacht wurde, dass die Montagezeit von Flugzeugen mit der Zeit sank, wurde dies auf Lerneffekte zurückgeführt, die mit der Wiederholung der Fertigungsvorgänge wirksam wurden. 1938 formulierte Wright diese Erfahrung als ein statistisch erwiesenes Gesetz, wonach die Anzahl der zur Produktion von Flugzeugen benötigten Fertigungsstunden, bei jeder Verdopplung des kumulierten Produktionsvolumens, um einen konstanten Prozentsatz abnimmt. Dieses Phänomen beruhte auf Lernvorgängen der am Produktionsprozess beteiligten Menschen. Ähnliche Effekte wurden in anderen, Wirtschaftzweigen beobachtet.
Mitte der sechziger Jahre stellt Bruce Henderson, aufbauend auf den Grundlagen der Lernkurve, das Konzept der Erfahrungskurve auf, mit dessen Hilfe die mögliche Entwicklung der Stückkosten, in Abhängigkeit von der kumulierten Fertigungsmenge, beschrieben werden konnte. Es gelang Henderson Empfehlungen für ein erfolgreiches Portfolio-Management abzuleiten. Zur Verbreitung des Konzeptes trug schließlich die von Henderson gegründete Bosten Consulting Group (BCG) bei, welche es in ihrer Beratungstätigkeit konsequent anwandte.[25]
2.2.2 Definition und Abgrenzung: Die Entwicklung von der Lernkurve zur
Erfahrungskurve
„Die Erfahrungskurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der insgesamt produzierten Menge eines Produkts (kumulierte Produktionsmenge) und den realen Stückkosten. Durch die fortlaufende Produktion...erwerben Unternehmen zunehmend „Erfahrung“...“ (Coenenberg).[26]
Wie bereits aus der Historie hervorgehen konnte, kann zwischen der Lernkurve und der Erfahrungskurve keine klare Trennlinie gezogen werden, da das Erfahrungskurvenkonzept seinen Ursprung in der Lernkurve hat. Im Laufe meines Literaturstudiums wurden diese Begriffe teilweise sogar synonym verwendet. Dennoch soll an dieser Stelle versucht werden, die Entwicklung von der Lernkurve zur Erfahrungskurve zu beschreiben und die wesentlichen Unterschiede herauszuarbeiten.
Wie bereits erwähnt, konnte in einer Reihe empirischer Studien die „Gesetzmäßigkeit“ bestätigt werden, dass bei jeder Verdopplung der kumulierten Produktionsmenge, die benötigten Faktoreinsatzmengen bzw. Lohnstückkosten der zuletzt gefertigten Produkteinheit, um einen bestimmten Prozentsatz, die sog. Lernrate, abnehmen. Das bedeutet, dass für die Herstellung der letzten Einheit bspw. nur noch 85% des Faktoreinsatzes bzw. Kostenniveaus (vor der Verdopplung) benötigt werden, wenn die Lernrate bei 15% liegt. Obwohl die Ursachen des Effektes nicht exakt begründet werden konnten, besteht grundsätzlich kein Zweifel an einer tendenziellen Senkung einzelner variabler Kostenarten. Für die Entstehung des Lernkurveneffektes können eine Reihe von Einflussfaktoren angeführt werden, die durch das wiederholte Ausführen gleicher Arbeitsgänge als Lernprozesse bezeichnet werden und zu einer Verkürzung der Fertigungszeiten, Qualitäts- und Produktivitätssteigerungen sowie einer verbesserten Zusammenarbeit und Steigerung der Güte von Routineentscheidungen führen.
Auch dispositive Tätigkeiten, d.h. aufbau- und ablauforganisatorische Verbesserungen im gesamten Produktionsbereich unterliegen diesem Lerneffekt und setzen sich mit zunehmender Produktionsmenge durch. Als Beispiele können hier neue Informations-, Kontroll- und Steuerungssysteme, eine effizientere Ersatzteillagerhaltung, eine leistungsfähigere Instandhaltung, verbesserte Arbeitsmethoden usw. aufgeführt werden.
Verbesserte Herstellungstechnologien, Maschinen- und Werkzeugausstattung, die bessere Ausnutzung des Maschinenparks, bauliche Anpassungen, eine Verringerung der Ausschussquote sowie ein geringerer anzurechnender zeitabhängiger Verschleiß durch die Verkürzung der Produktionszeiten, können weitere Gründe für Einsparungen sein.[27]
Die Erfahrungskurve beschreibt einen Zusammenhang zwischen der kumulierten Produktionsmenge und der Gesamtkostenentwicklung. Bei einer Verdopplung der kumulierten Produktionsmenge sollen sich die gesamten Stückkosten (also Kapital-, Verwaltung-, Produktions-, Entwicklungs- und Marketingkosten eingeschlossen) um 20-30 % verringern. Diese Stückkostenreduktion ergibt sich durch permanente verfahrenstechnische Fortschritte und die Fortentwicklung der Produkte und nicht durch das ökonomische Gesetz der Massenproduktion (economies of scale).[28]
Häufig ist es jedoch schwierig nachzuweisen, ob Marktführer-Vorteile auf dem Erfahrungskurveneffekt oder aber lediglich auf Skaleneffekten basieren. Spence geht sogar soweit, dass er Erfahrungskurveneffekte als dynamische Skalenerträge bezeichnet, in dem er sich kleine Zeitintervalle (Perioden) als Marktsegmente vorstellt. Unternehmen, die später in einen Markt eintreten, sind somit von gewissen Marktsegmenten ausgeschlossen.[29] Er betrachtet Erfahrungskurveneffekte also als „result of economies of scale across mulitple market segments“.[30]
Um die wesentlichen Unterschiede zwischen Lern- und Erfahrungskurve zu verdeutlichen kann also grundsätzlich festgehalten werden, dass sich die Erfahrungskurve auf sämtliche Kostenelemente eines Produkts bzw. einer Strategischen Geschäftseinheit (SGE) bezieht. Das bedeutet, es werden alle Kosten berücksichtigt, die mit der Ideenfindung vor Forschung und Entwicklung entstehen, bis hin zu den Kosten, die mit der Herausnahme des Produktes aus dem Markt verbunden sind.[31] Nach dem „klassischen Konzept“ von Henderson wird dabei keine klare Trennlinie zwischen fixen und variablen Kosten gezogen.[32] Die Lernkurve hingegen basiert auf der Annahme, dass das Lernen in der Organisation zur Verringerung eines Teils der variablen Produktionsstückkosten eines Produkts führt.[33]
Somit bezieht das Erfahrungskurvenkonzept, das gesamte Unternehmen mit ein und kann deshalb nicht nur von produzierenden Unternehmen, sondern auch von Dienstleistungsunternehmen (z.B. Banken, Versicherungen, etc.) genutzt werden.
Die Lernkurve hingegen nutzt „lediglich“ die Erfahrungen, welche im Fertigungsbereich gesammelt werden.[34]
Abschließend soll noch hervorgehoben werden, dass sich die Erfahrungskurve auf das Verhältnis zwischen der kumulierten Ausbringungsmenge zu den Produktionskosten, die Lernkurve jedoch auf das Verhältnis der kumulierten Ausbringungsmenge zur Herstellungszeit bezieht.[35] Die mathematische Form der beiden Kurven gestaltet sich jedoch gleich.
Auf Grund der Themenstellung und des begrenzten Umfangs dieser Diplomarbeit werde ich im Weiteren nur auf das Erfahrungskurvenkonzept eingehen und das Lernkurvenkonzept somit nicht näher beschreiben, da es zu einem großen Teil in die Erfahrungskurven integriert ist.
2.2.3 Aussage des Erfahrungskurvenkonzeptes
Wie schon in den vorangegangen Ausführungen bereits angeschnitten, führt das Erfahrungskurvenkonzept nach der BCG bzw. dem Erfinder Bruce Henderson, zu folgenden Aussagen:
„Die in der Wertschöpfung eines Produkts enthaltenen Kosten scheinen um 20-30% abzufallen mit jeder Verdopplung der kumulierten Produkterfahrung im Industriezweig als Ganzes wie auch beim einzelnen Anbieter.“ (Henderson)[36]
„Mit jeder Verdopplung der im Zeitablauf kumulierten (produzierten bzw. abgesetzten) Menge eines Produktes besteht ein Stückkostensenkungspotenzial von 20 bis 30 Prozent, bezogen auf alle in der Wertschöpfung des Produktes enthaltenen (inflationsbereinigten) Stückkosten.“[37]
Nach einer weiteren Aussage der BCG, sei der Erfahrungskurveneffekt eindeutig nachgewiesen und so allgemeingültig, dass man sein Fehlen als Zeichen für schlechtes Kostenmanagement oder falscher Analysen betrachten kann.
Folgt man nun der Aussage, dass eine Verdopplung der gesamten bisher produzierten Fertigungsmenge um so schneller erreicht wird, je stärker die jährlich produzierte Menge wächst, scheint daher ein vorbeugender Kapazitätsaufbau auf expandierenden Märkten durchaus sinnvoll zu sein. Der Zusammenhang zwischen Erfahrungskurve und Kapazitätspolitik ist jedoch nicht so offenkundig wie es scheint, wenn man die in der Wachstumseuphorie der sechziger Jahre entstandenen Formulierungen dieses Zusammenhangs liest.[38] Zur Verdeutlichung soll an dieser Stelle nochmals auf die Abhängigkeit der Kosten von der kumulierten Menge und nicht von der Menge pro Periode, hingewiesen werden. Ein Kostensenkungspotential kann also auch bei gleich bleibender Menge pro Periode, über mehrere Perioden hinweg, aufgrund der steigenden kumulierten Menge, erzielt werden.[39]
2.2.4 Ursachen für das Auftreten der Erfahrungskurveneffekte
Für die Unternehmensplanung ist es von besonderer Bedeutung, die Ursachen für sinkende Kosten bei steigender Ausbringungsmenge zu bestimmen. Sind die Quellen für diese Kostensenkungen gefunden, kann auch gezielt auf sie eingewirkt werden.[40]
Darst. 2: Erfahrungskurveneffekte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung
Solche Ursachen können dynamischen oder auch statischen Ursprungs sein:
Auf den Lerneffekt (Lernkurve) wurde bereits hingewiesen. Durch die Wiederholung bestimmter Tätigkeiten, aber auch eine Umgestaltung der Arbeitsabläufe und der Arbeitsmethoden, werden Menschen bzw. Arbeiter geschickter und erhöhen durch eine Reihe von Verbesserungen und Verkürzungen, die Effizienz der Zusammenarbeit.[41] Durch diese Effizienzsteigerung wird die Produktivität gesteigert und somit der Einsatz von Produktionsfaktoren reduziert, dadurch wiederum kommt es zu einer Senkung der Fertigungs- bzw. Lohnstückkosten.[42] Je größer dabei die Anzahl der von Menschen gesteuerten Tätigkeiten eines Produktionsprozesses ist, desto größer fällt das Lernpotential aus.[43] Vor allem in der Fertigung von homogenen Gütern (Fließbandfertigung) ist dieser Effekt zu beobachten.[44] Aber auch nicht direkt am Produktionsprozess beteiligtes Personal (z.B. Kontrolleure, Meister usw.) kann durch Lernen seine Produktivität steigern. Das gleiche gilt für Verkaufs- und Verwaltungspersonal.
Durch den technologischen Fortschritt werden neue Fertigungsverfahren entwickelt. Dies führt nicht nur zu einer Verbesserung und/oder Erhöhung der Stückzahl der Produkte, welche die Unternehmen nun bei gleichzeitiger Zeitersparnis produzieren, sondern kann auch gleichzeitig eine Stückkostenreduzierung nach sich ziehen.[45]
Durch verschiedene Rationalisierungsmaßnahmen in der Fertigung können betriebliche Strukturen, Prozesse und Ressourceneinsätze verbessert und dadurch Kostenreduzierungen ermöglicht werden.[46] Solche Vorteile nicht einzustreichen, sondern in Form von Preissenkungen an die Kunden weiterzugeben, um nachstoßenden Wettbewerb zu entmutigen und am Markteintritt zu hindern, erscheint plausibel.[47]
Eine Fixkostendegression kann mit zunehmender Beschäftigung bzw. Kapazitätsauslastung erzielt werden. Die benötigten Fixkosten der Produktion sinken dabei mit jedem zusätzlich produzierten Gut. Ein Unternehmen kann seine Fixkosten außerdem durch längere Maschinenlaufzeiten erheblich reduzieren, da die Stückkosten sinken.[48]
Vorteile beim Rohstoffeinkauf, Marktmacht, Know-how aus F&E, sowie Spezialisierungsvorteile können sich nicht nur aus einer verbesserten Auslastung, sondern auch aus einer entsprechenden Betriebsgröße ergeben. Der Betriebsgrößeneffekt wird auch als Skaleneffekt bezeichnet.[49]
Abschließend können als weitere Ursachen – für die Erlangung von Erfahrungskurveneffekten – noch genannt werden: Prozessinnovationen und Verbesserungen (vor allem in kapitalintensiven Branchen) der Ersatz teurer durch billigere Ressourcen (Material, Rohstoffe, Betriebsmittel, Personal), die Standardisierung von Produkten und Produktbauteilen, die eine Vereinfachung des Produktionsablaufs und der Produktionssteuerung erlaubt, sowie Erfahrungssammlung seitens der Hersteller aber auch der Kunden, über die nötigen Eigenschaften eines Produkts, die zu Materialeinsparungen und neuen Produktionsverfahren führen.[50]
2.2.5 Typische Verläufe der Erfahrungskurve
Im Folgenden soll das Erfahrungskurvenmodell formal und graphisch dargestellt werden. Wenn die im Zeitablauf kumulierte Menge mit x und die wertschöpfungsbezogenen Stückkosten mit k bezeichnet werden, lässt sich das Erfahrungskurvengesetz in der Form k(x) = a ∙ x-b ausdrücken. A und b sind produktspezifische Parameter, wobei a die Stückkosten der ersten produzierten Einheit angibt und b die Kostenreduktion bei Verdopplung der produzierten Menge. Bei einem positivem b, welches als Lernrate interpretiert wird, ergibt sich ein hyperbolischer Kurvenverlauf. Aus Vereinfachungsgründen geht man deshalb häufig auf beiden Seiten der Gleichung zum natürlichen Logarithmus über. Es ergibt sich dadurch die Beziehung: ln(k(x)) = ln a – b ∙ ln x. Bei einer logarithmischen Skalierung beider Achsen (im Koordinatensystem), erhalten wir dann einen linearen Verlauf.[51]
Darst. 3: Graphische Veranschaulichung der Erfahrungskurve bei linearer bzw. doppeltlogarithmischer Skalierung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Homburg/Krohmer, Marketingmanagement, Wiesbaden, 2006, S. 447.
Erfahrungskurven müssen jedoch nicht stets linear verlaufen. Im Rahmen empirischer Beobachtungen wurden auch geknickte Verläufe festgestellt. Als Ursache können technologische Veränderungen genannt werden, die wiederum völlig neue Rationalisierungspotentiale eröffnen, oder aber der Wechsel auf eine neue Erfahrungskurve als Übergang auf ein neues Produkt.[52]
[...]
[1] Vgl. Wijkman: Arbeitsdokument, 2000, S. 1.
[2] Vgl. WBGU: Welt im Wandel, 2003, S. 13.
[3] Vgl. Harenberg: Aktuell 2004, 2003, S. 167.
[4] Vgl. Seltmann: Photovoltaik: Strom ohne Ende, 2005, S. 3.
[5] Vgl. Harenberg: Aktuell 2004, 2003, S. 167.
[6] Vgl. WBGU: Welt im Wandel, 2003, S. 13.
[7] Diller: Preispolitik, 2000, S. 23.
[8] Vgl. Schmalen: Preispolitik, 1995, S. 3.
[9] Vgl. Diller: Preispolitik, 2000, S. 16.
[10] Vgl. Diller: Preispolitik, 2000, S. 14 ff; vgl. dazu auch Homburg/Krohmer: Marketingmanagement, 2006, S. 670; Schmalen: Preispolitik, 1995, S. 4.
[11] Vgl. Diller: Preispolitik, 2000, S. 14ff.
[12] Vgl. Diller: Preispolitik, 2000, S. 15.
[13] Vgl. Homburg/Krohmer: Marketingmanagement, 2006, S. 669.
[14] Vgl. Homburg/Krohmer: Marketingmanagement, 2006, S. 669; vgl. dazu auch Schmalen: Preispolitik, 1995, S. 4.
[15] Vgl. Diller: Preispolitik, 2000, S. 15; vgl. dazu auch Simon/Dolan: Profit durch Power Pricing, 1997, S. 14.
[16] Vgl. Von Knorring: Volkswirtschafslehre, 2001, S. 69.
[17] Vgl. Hardes/Mertes: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 1991, S. 39.
[18] Vgl. Fehl/Oberender: Grundlagen der Mikroökonomie, 2004, S. 52.
[19] Vgl. Fehl/Oberender: Grundlagen der Mikroökonomie, 2004, S. 52 ff; vgl. dazu auch Hardes/Mertes: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 1991, S. 40.
[20] Vgl. Fehl/Oberender: Grundlagen der Mikroökonomie, 2004, S. 53; vgl. dazu auch Von Knorring: Volkswirtschafslehre, 2001, S. 70.
[21] Vgl. Fehl/Oberender: Grundlagen der Mikroökonomie, 2004, S. 53.
[22] Vgl. Fehl/Oberender: Grundlagen der Mikroökonomie, 2004, S. 54; vgl. dazu auch Von Knorring: Volkswirtschafslehre, 2001, S. 70.
[23] Vgl. Fehl/Oberender: Grundlagen der Mikroökonomie, 2004, S. 52 ff.
[24] Vgl. Weber/Schäffer: Einführung in das Controlling, 2006, S. 369 ff.
[25] Vgl. Albach: Erfahrungskurve und Unternehmensstrategie, 1987, S. 1; vgl. dazu auch Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 94 ff.
[26] Coenenberg: Kostenrechnung und Kostenanalyse, 2003, S. 185.
[27] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 94 ff.
[28] Vgl. Olbrich/Battenfeld: Preispolitik, 2007, S. 227.
[29] Vgl. Wiese: Lern- und Netzeffekte im asymmetrischen Duopol, 1993, S. 7.
[30] Wiese: Lern- und Netzeffekte im asymmetrischen Duopol, 1993, S. 7.
[31] Vgl. Albach: Erfahrungskurve und Unternehmensstrategie, 1987, S. 8.
[32] Vgl. Olbrich/Battenfeld: Preispolitik, 2007, S. 66.
[33] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 95.
[34] Vgl. Coenenberg/Baum/Simon: Strategisches Controlling, 1987, S. 49.
[35] Vgl. Jung: Controlling, 2003, S. 247.
[36] Albach: Erfahrungskurve und Unternehmensstrategie, 1987, S. 1.
[37] Homburg/Krohmer: Marketingmanagement, 2006, S. 445.
[38] Vgl. Albach: Erfahrungskurve und Unternehmensstrategie, 1987, S. 1 ff.
[39] Vgl. Homburg/Krohmer: Marketingmanagement, 2006, S. 445 ff.
[40] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[41] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[42] Vgl. Ossadnik/Maus: Strategisches Controlling mittels Analytischen Hierarchie Prozesses, 1994, S. 143; vgl. auch Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[43] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[44] Vgl. Jung: Controlling, 2003, S. 247.
[45] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[46] Vgl. Ziegenbein: Controlling, 1998, S. 139; vgl. dazu auch Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[47] Vgl. Albach: Erfahrungskurve und Unternehmensstrategie, 1987, S. 1
[48] Vgl. Ziegenbein: Controlling, 1998, S. 139; vgl. dazu auch Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[49] Vgl. Coenenberg: Kostenrechnung und Kostenanalyse, 2003, S. 187.
[50] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 97 ff.
[51] Vgl. Homburg/Krohmer: Marketingmanagement, 2006, S. 446.
[52] Vgl. Heinen: Betriebswirtschaftliche Führungslehre, 1984, S. 99.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836615051
- DOI
- 10.3239/9783836615051
- Dateigröße
- 4.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen – Betriebswirtschaftslehre, Finanzierungs- und Investitionscontrolling
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Juli)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- erfahrungskurve erneuerbare energien photovoltaik preisstrategie fossile energieträger
- Produktsicherheit
- Diplom.de