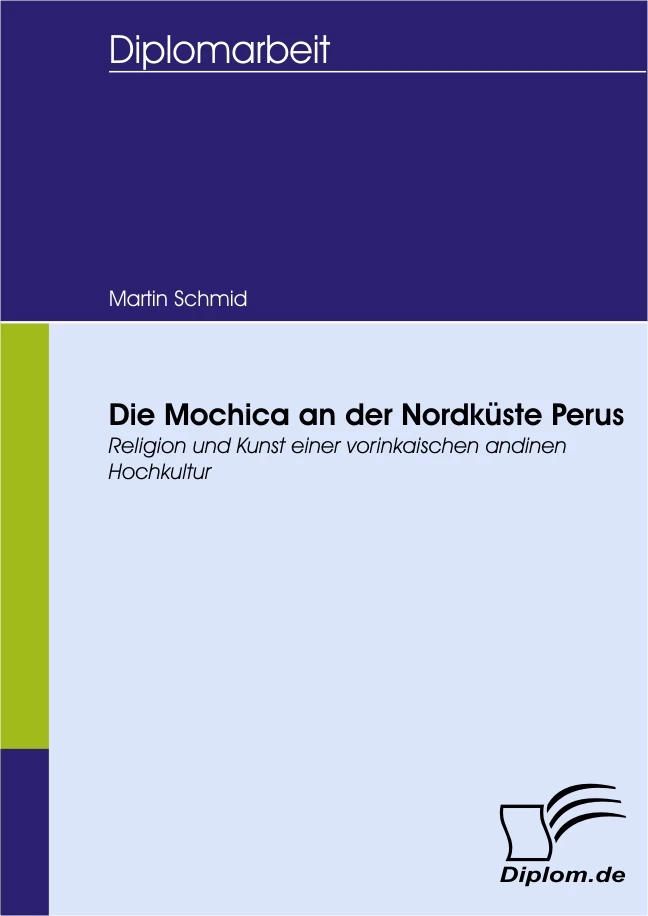Die Mochica an der Nordküste Perus
Religion und Kunst einer vorinkaischen andinen Hochkultur
©2007
Diplomarbeit
68 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Von allen älteren Hochkulturen der Erde entstanden die altamerikanischen am spätesten. Von diesen wiederum sind es vor allem drei, die es geschafft haben, dauerhaft in das kollektive Bewusstsein der Weltöffentlichkeit vorzudringen: die Azteken und Maya in Mexiko sowie die Inka in Peru. Die Moche- oder Mochica-Kultur an der Nordküste Perus ist nicht nur in Europa kaum bekannt, sondern wird selbst in Lateinamerika von vielen nicht als eigenständige Kultur wahrgenommen. Während meiner Recherchen in Peru und später an der Universität Passau stellte ich jedoch fest, welch großen Einfluss diese unscheinbare und beinahe in Vergessenheit geratene Kultur auf die nachfolgenden präkolumbischen Kulturen hatte, an deren Entwicklungsende letztlich die Inka standen. Die von ihnen hinterlassenen Ruinen so beispielsweise Machu Picchu und die erst vor einigen Jahren teilweise frei gelegte Stätte von Choquequirao sind noch heute als mächtige Zeugnisse vergangener Glanzzeiten zu bestaunen.
Gang der Untersuchung:
Im Hauptteil dieser Arbeit werde ich genauer auf die Religion der Mochica eingehen. Dieses Kapitel besteht aus drei Teilen, wobei der erste Abschnitt (Punkt II.1) von den Totenkulten und Opferzeremonien handelt. Um den vorgegebenen Rahmen einzuhalten, werde ich auf die in der Moche-Kultur bedeutende rituelle Hirschjagd ebenso wenig eingehen wie auf das so genannte Reinigungsritual. Im darauf folgenden Abschnitt (Punkt II.2) werde ich zunächst die komplexe Götterwelt der Mochica beleuchten und später auf die Bedeutung der Raubkatzen in den religiösen Vorstellungen der Andenvölker und speziell der Raubkatzengottheit bei den Mochica eingehen. Der letzte Abschnitt (Punkt II.3) des zweiten Kapitels beschreibt drei der vermutlich wichtigsten Pflanzen, die von den Mochica zu religiösen Zwecken verwendeten wurden. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
VORWORTIV
IEINLEITUNG: DIE MOCHICA IM KONTEXT ANDERER PRÄKOLUMBISCHER KULTUREN1
IIRELIGION ALS ZENTRALER ASPEKT DER MOCHE-KULTUR10
1.OPFER, KULT UND RITUALE12
1.1MENSCHENOPFER IM RAHMEN RELIGIÖSER ZEREMONIEN12
1.2TOTENKULT UND BESTATTUNGSRITUALE17
2.RAUBKATZEN UND DEREN RELIGIÖSE BEDEUTUNG24
2.1DIE GÖTTER- UND DÄMONENWELT DER MOCHICA24
2.2DIE SYMBOLHAFTIGKEIT VON TIEREN IN DER ANDINEN WELTANSCHAUUNG27
2.4DIE BEDEUTUNG DES JAGUARS29
2.3DIE ANTHROPOMORPHE GOTTHEIT AI APAEC31
3.PFLANZEN ALS RAUSCHMITTEL ZU RELIGIÖSEN ZWECKEN34
3.1DER SAN-PEDRO-KAKTUS36
3.2DER […]
Von allen älteren Hochkulturen der Erde entstanden die altamerikanischen am spätesten. Von diesen wiederum sind es vor allem drei, die es geschafft haben, dauerhaft in das kollektive Bewusstsein der Weltöffentlichkeit vorzudringen: die Azteken und Maya in Mexiko sowie die Inka in Peru. Die Moche- oder Mochica-Kultur an der Nordküste Perus ist nicht nur in Europa kaum bekannt, sondern wird selbst in Lateinamerika von vielen nicht als eigenständige Kultur wahrgenommen. Während meiner Recherchen in Peru und später an der Universität Passau stellte ich jedoch fest, welch großen Einfluss diese unscheinbare und beinahe in Vergessenheit geratene Kultur auf die nachfolgenden präkolumbischen Kulturen hatte, an deren Entwicklungsende letztlich die Inka standen. Die von ihnen hinterlassenen Ruinen so beispielsweise Machu Picchu und die erst vor einigen Jahren teilweise frei gelegte Stätte von Choquequirao sind noch heute als mächtige Zeugnisse vergangener Glanzzeiten zu bestaunen.
Gang der Untersuchung:
Im Hauptteil dieser Arbeit werde ich genauer auf die Religion der Mochica eingehen. Dieses Kapitel besteht aus drei Teilen, wobei der erste Abschnitt (Punkt II.1) von den Totenkulten und Opferzeremonien handelt. Um den vorgegebenen Rahmen einzuhalten, werde ich auf die in der Moche-Kultur bedeutende rituelle Hirschjagd ebenso wenig eingehen wie auf das so genannte Reinigungsritual. Im darauf folgenden Abschnitt (Punkt II.2) werde ich zunächst die komplexe Götterwelt der Mochica beleuchten und später auf die Bedeutung der Raubkatzen in den religiösen Vorstellungen der Andenvölker und speziell der Raubkatzengottheit bei den Mochica eingehen. Der letzte Abschnitt (Punkt II.3) des zweiten Kapitels beschreibt drei der vermutlich wichtigsten Pflanzen, die von den Mochica zu religiösen Zwecken verwendeten wurden. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
VORWORTIV
IEINLEITUNG: DIE MOCHICA IM KONTEXT ANDERER PRÄKOLUMBISCHER KULTUREN1
IIRELIGION ALS ZENTRALER ASPEKT DER MOCHE-KULTUR10
1.OPFER, KULT UND RITUALE12
1.1MENSCHENOPFER IM RAHMEN RELIGIÖSER ZEREMONIEN12
1.2TOTENKULT UND BESTATTUNGSRITUALE17
2.RAUBKATZEN UND DEREN RELIGIÖSE BEDEUTUNG24
2.1DIE GÖTTER- UND DÄMONENWELT DER MOCHICA24
2.2DIE SYMBOLHAFTIGKEIT VON TIEREN IN DER ANDINEN WELTANSCHAUUNG27
2.4DIE BEDEUTUNG DES JAGUARS29
2.3DIE ANTHROPOMORPHE GOTTHEIT AI APAEC31
3.PFLANZEN ALS RAUSCHMITTEL ZU RELIGIÖSEN ZWECKEN34
3.1DER SAN-PEDRO-KAKTUS36
3.2DER […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Martin Schmid
Die Mochica an der Nordküste Perus
Religion und Kunst einer vorinkaischen andinen Hochkultur
ISBN: 978-3-8366-1370-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Universität Passau, Passau, Deutschland, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
1
Titelbild: Donnan (1976), S. 57: Moche-Krieger mit einem Gefangenen
Abb. auf dieser Seite (ohne Text): Vgl. Real Academia Española (2001), Band I, S. V
1
ALCC, in: http://www.alcc-research.com/wisdom2/Napoleon.html (letzter Zugriff am 18.07.2007):
,,Eine Gesellschaft ohne Religion ist wie ein Schiff ohne Kompass."
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ... iv
I. EINLEITUNG: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen...1
II. RELIGION ALS ZENTRALER ASPEKT DER MOCHE-KULTUR...10
1. Opfer, Kult und Rituale ...12
1.1 Menschenopfer im Rahmen religiöser Zeremonien...12
1.2 Totenkult und Bestattungsrituale ...17
2. Raubkatzen und deren religiöse Bedeutung ...24
2.1 Die Götter- und Dämonenwelt der Mochica...24
2.2 Die Symbolhaftigkeit von Tieren in der andinen Weltanschauung ...27
2.4 Die Bedeutung des Jaguars ...29
2.3 Die anthropomorphe Gottheit Ai Apaec...31
3. Pflanzen als Rauschmittel zu religiösen Zwecken...34
3.1 Der San-Pedro-Kaktus ...36
3.2 Der Koka-Strauch ...40
3.3 Der Villca-Baum...45
3.4 Sonstige Pflanzen...49
III. SCHLUSSBETRACHTUNG ...53
IV. LITERATURVERZEICHNIS ...55
DANKSAGUNG ... vi
Vorwort iv
VORWORT
Zahlreiche deutsche Forscher, allen voran Alexander von Humboldt zu Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts, waren maßgeblich an der Erforschung der ,,Neuen Welt" und
insbesondere Perus beteiligt. Nicht zuletzt dadurch basieren die heutigen kulturellen
Beziehungen zwischen Peru und Deutschland auf einer langen und vor allem fruchtbaren
Tradition. Eine der bedeutendsten Deutschen des zwanzigsten Jahrhunderts in Peru war
Maria Reiche. Die von ihr erforschten Linien von Nazca im Süden des Landes zogen
mich bereits als Kind in ihren Bann, und die Erfüllung meines Wunsches, diese auf
eigene Faust zu erkunden, würde, so hoffte ich, nur eine Frage der Zeit sein.
Im Jahr 1997 hatte ich die Gelegenheit, für sechs Wochen in Paraguay bei einem
Entwicklungshilfe-Projekt der Europäischen Gemeinschaft mitzuarbeiten, und nutzte die
verbleibenden zwei Monate meines damaligen Lateinamerika-Aufenthaltes, um einige
weitere Länder der Region zu bereisen und schließlich auch die rätselhaften Geoglyphen
der Nazca-Kultur selbst zu besichtigen. Neben diesen waren es vor allem die Inka, von
deren Kultur ich vieles erfahren und deren Bauwerke ich an vielen Orten bestaunen
durfte. In den folgenden Reisen wurde mein kulturhistorischer Blickwinkel durch die
alten Hochkulturen der Maya und Azteken im heutigen Mexiko, sowie durch die
Tiahuanaco-Kultur in Bolivien erweitert und mein Bewusstsein für die Komplexität der
präkolumbischen Kulturen geschärft.
Zum ersten Mal mit der Moche-Kultur konfrontiert wurde ich allerdings erst im Jahre
2004, als ich im Rahmen des Austauschprogrammes der Universität Passau ein
Studiensemester an der Universität PUCE in Quito absolvierte. Auf dem Weg von Lima
in die ecuadorianische Hauptstadt nach endlosen Stunden Fahrt durch die peruanische
Küstenwüste erreichten meine Frau und ich Trujillo im Norden des Landes, wo wir die
bekannten und in der Nähe der Stadt gelegenen Ruinen von Chan Chan besichtigten. Auf
der Rückfahrt wies uns der Taxifahrer auf weitere, kaum besuchte und weiter südlich
gelegene Pyramiden hin und bezog sich dabei auf Überreste der Moche-Kultur, welche
von dem deutschen Archäologen Max Uhle 1899 zum ersten Mal als eigenständige
Kultur deklariert worden war.
Vorwort v
Zeitlich bedingt war es uns damals nicht vergönnt, deren Bauwerke zu besichtigen. Doch
zwei Jahre später - nach einem absolvierten Praktikum in der Hauptstadt Perus - nahm ich
die Gelegenheit war, noch einmal in die nördliche Küstenregion zu reisen und die
besagten Ausgrabungsstätten zu erkunden. Dieser bislang letzte Aufenthalt in
Lateinamerika war letztendlich auch ausschlaggebend für meine Entscheidung, mich im
Rahmen dieser Diplomarbeit mit der Moche-Kultur zu befassen und dabei wesentliche
Aspekte der Religion intensiver zu beleuchten.
Martin Schmid
Passau, 20.07.2007
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
1
I. EINLEITUNG: DIE MOCHICA IM KONTEXT ANDERER
PRÄKOLUMBISCHER KULTUREN
Von allen älteren Hochkulturen der Erde entstanden die altamerikanischen am spätesten.
Von diesen wiederum sind es vor allem drei, die es geschafft haben, dauerhaft in das
kollektive Bewusstsein der Weltöffentlichkeit vorzudringen: die Azteken und Maya in
Mexiko sowie die Inka in Peru. Die Moche- oder Mochica-Kultur
2
an der Nordküste
Perus ist nicht nur in Europa kaum bekannt, sondern wird selbst in Lateinamerika von
vielen nicht als eigenständige Kultur wahrgenommen. Während meiner Recherchen in
Peru und später an der Universität Passau stellte ich jedoch fest, welch großen Einfluss
diese unscheinbare und beinahe in Vergessenheit geratene Kultur auf die nachfolgenden
präkolumbischen Kulturen hatte, an deren Entwicklungsende letztlich die Inka standen.
Die von ihnen hinterlassenen Ruinen so beispielsweise Machu Picchu und die erst vor
einigen Jahren teilweise frei gelegte Stätte von Choquequirao sind noch heute als
mächtige Zeugnisse vergangener Glanzzeiten zu bestaunen.
Benannt wurde die Moche-Kultur nach dem gleichnamigen Fluss Moche,
3
der südlich
von Trujillo durch die nordperuanische Wüste in den Pazifischen Ozean fließt und dessen
Tal zusammen mit dem Chicama-Tal das Zentrum dieser Kultur bildete.
4
Lange Zeit ging
man davon aus, dass sich das geographische Kerngebiet mit einer Länge von
zweihundertfünfzig Kilometern durchgehend bis zum Lambayeque-Fluss im Norden
erstreckte und bis zum Nepeña-Fluss im Süden reichte.
5
Neuere Forschungen deuten
allerdings darauf hin, dass es kein einheitliches Moche-Reich gab, sondern zwei große
Staaten. Castillo spricht dabei von einem Nord- und einem Südstaat, vermutet allerdings,
dass es einen stetigen und regen kulturellen Austausch zwischen beiden gab.
6
2
Vgl. Jones / Molyneaux (2002), S. 206: Sowohl ,,Moche" als auch ,,Mochica" werden als Bezeichnungen
für die entsprechende Kultur in der Fachliteratur verwendet, teilweise sogar von demselben Autor in ein
und demselben Werk. Der von Max Uhle eingeführte Begriff ,,Proto-Chimu" gilt heute ebenso veraltet wie
der Begriff ,,Früh-Chimu."
Vgl. Séjourné (1971), S. 260 und Lumbreras (1969), S. 151: In Anlehnung an diese beiden Autoren werde
ich im Folgenden den Begriff ,,Moche" für die Kultur selbst und ,,Mochica" für deren Träger verwenden.
3
Vgl. Helfritz (1979), S. 270: Der ursprüngliche von den Mochica verwendete Namen ging verloren, so
dass man die Kultur nach dem Fluss bzw. dem Flusstal benannte, in dessen Umgebung einige Funde der
Moche-Kultur gemacht wurden.
Vgl. Hovdhaugen (2004), S. 6: Der Name wird aus der Sprache der unmittelbar nach den Mochica
existierenden Chimú-Kultur abgeleitet, welche noch bis 1920 an der Nordküste Perus gesprochen wurde.
4
Vgl. Feest / Kann (1992), S. 59
5
Vgl. Kaulicke (1981), S. 351
6
Vgl. Castillo (2001a), S. 156
Vgl. Castillo / Donnan (1994), S. 147 ff.
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
2
Abb. 1: Das Herrschaftsgebiet der Mochica in seiner maximalen Ausdehnung
Quelle: Vgl. Donnan (2004), S. 2: (eigene Nachbearbeitung)
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
3
Diese Erkenntnisse berücksichtigt auch Donnan in seiner in Abb. 1 dargestellten Karte,
was an den beiden hellbraunen Flächen zu erkennen ist, welche die Territorien der beiden
getrennten Staaten widerspiegeln. In dieser Darstellung ist ebenfalls schön zu sehen, dass
das tatsächliche Einflussgebiet der Moche-Staaten weitaus größer war. Es zog sich auf
einer Gesamtlänge von ca. 600 km an der Küste entlang bis zum Huarmey-Tal im
Süden.
7
Im Osten grenzten die Gebiete bis an die steilen und küstennahen Andenhänge,
wodurch die maximale West-Ost-Ausdehnung der Staaten nur fünfzig Kilometer betrug.
Das erste Auftreten der Mochica als eigenständige Kultur wird auf das erste Jahrhundert
vor Christus geschätzt und ihr Verschwinden auf das Jahr 800 danach
8
. Im Vergleich zur
Inka-Kultur, deren Herrschaft nur etwas weniger als ein Jahrhundert währte, waren die
Mochica somit zeitlich um ein Vielfaches länger auf dem südamerikanischen Kontinent
präsent, was auch aus der folgenden Abb. 2 herauszulesen ist: Nach dem Ploetz entstand
ihre Kultur auf der Basis der Salinar-Kultur mit Einflüssen der Gallinazo
9
und existierte
zeitgleich beispielsweise mit der etwas bekannteren Nazca-Kultur
10
im Süden Perus und
den berühmten Maya im heutigen Mexiko. Die von dem deutschen Forscher Max Uhle
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entworfene Chronologie der präkolumbischen
Kulturen wurde allgemein bestätigt
11
und im Laufe der Zeit weiter verfeinert. Lediglich
die Begrifflichkeiten haben sich geändert, und so spricht man heute von drei Horizonten
12
und zwei Zwischenperioden, in deren erster die Moche-Kultur angesiedelt wird.
13
Die ca.
900 Jahre andauernde Herrschaft wird noch einmal in fünf Phasen
14
unterteilt, wobei auf
die Gründe dieser Unterteilung hier nicht weiter eingegangen werden muss. Die genaue
Ursache für den Untergang der Mochica ist bis heute unklar. Ob das Gebiet der Moche
von einer anderen, mächtigeren Kultur, beispielsweise der Huari bzw. Wari aus dem
Hochland, erobert wurde, wegen interner Spannungen zerfiel
15
oder aufgrund
7
Vgl. Alva (2001), S. 38
8
Vgl. Kaulicke (1981), S. 346
Vgl. Bock (1988), S. 8: Bock datiert das erste Auftreten auf den Beginn unserer heutigen Zeitrechnung. Die
exakte zeitliche Präsenz der Kultur wird in der Forschung nach wie vor diskutiert.
9
Vgl. Ploetz (2002), S. 1265
10
Bekannt ist diese Kultur vor allem durch die zahlreichen Scharrbilder und Linien, die einen großen Teil
der peruanischen Wüste in der Umgebung der heutigen Stadt Nazca durchziehen. Die deutsche Forscherin
Maria Reiche verbrachte einen Großteil ihres Lebens mit der Erforschung der Darstellungen; deren
Entstehung und Bedeutung konnte allerdings bis heute nicht eindeutig geklärt werden.
11
Vgl. Kaulicke (1998), S. 29 f.
12
Vgl. Haberland (1977), S. 165: ,,Horizont" bedeutet in diesem Zusammenhang soviel wie ,,Zeiten
kultureller Vereinheitlichung", während man von Zwischenperioden spricht, wenn man ,,Zeiten kultureller
Vielfalt" zum Ausdruck bringen möchte.
13
Vgl. Frenz (2002), S. 138
14
Vgl. Larco Hoyle (1963), siehe hintere Umschlagseite
15
Vgl. Castillo (2001b), S. 323 f.
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
4
klimatischer Bedingungen verschwand, bleibt als Frage bis heute offen.
16
Durchgeführte
Messungen an peruanischen Gletschern haben jedenfalls ergeben, dass zwischen 562 und
594 n. Chr. eine Dürreperiode das Leben im Hochland von Peru bedrohte. Gleichzeitig
kam es an der Nordküste im Gebiet der Mochica zu verheerenden Überschwemmungen.
Abb. 2: Chronologische Darstellung der präkolumbischen Kulturen und einiger Kulturen der ,,Alten Welt."
Quelle: Vgl. Schindler (2000), S. 18: Schindler unterscheidet in seiner Darstellung nicht den Begriff
,,Früher Horizont" (900 200 v. Chr.) von der ,,Anfangsperiode" (1800-900 v. Chr.) und fasst beide unter
dem Begriff Formativum zusammen. Zum besseren Vergleich habe ich noch eine Spalte mit den präkolum-
bischen Kulturen Mesoamerikas eingefügt.
16
Vgl. Ploetz (2002), S. 1265
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
5
Diese beiden Faktoren führten nach Feest und Kann zu einer Schwächung der
wirtschaftlichen und damit auch politischen Entwicklung im Hochland und an der
Küste, was von der Huari-Kultur möglicherweise ausgenutzt wurde.
17
Shimada vertritt
beispielsweise die Meinung, dass der unter dem Namen ,,El Niño"
18
bekannte warme
Meeresstrom, der in unregelmäßigen Abständen den kalten aus der Antarktis fließenden
Humboldtstrom verdrängt, Schuld an der Schwächung der Moche-Kultur gewesen sein
könnte.
19
Diese Vermutung ist deshalb nahe liegend, weil die Mochica als Küstenkultur
wesentlich von den Erträgen des Pazifischen Ozeans abhängig waren
20
und das El Niño-
Phänomen ein Tiersterben enormer Dimension mit sich brachte und auch in heutigen
Tagen noch verursacht.
21
Möglicherweise wurde dem Volk so die Ernährungsgrundlage
entzogen, Beweise dafür gibt es, wie gesagt, allerdings nicht.
Nachdem nun der zeitliche und geographische Rahmen grob abgesteckt wurde, bleibt
noch zu klären, welche Stellung die Kultur hinsichtlich ihrer Errungenschaften innerhalb
anderer präkolumbischer Kulturen einnimmt. Während uns die alten Mexikaner
aussagekräftige Bilderschriften hinterließen, verfügten die Mochica ebenso wie sämtliche
anderen peruanischen Kulturen mit Ausnahme der Inka
22
vermutlich über keine eigene
Schrift,
23
so dass uns auf diesem Wege nichts über ihr Alltagsleben, ihre Gebräuche und
ihr Gesellschaftssystem übermittelt wurde. Somit beschränken sich die Forschungen zu
den präkolumbischen Kulturen im Wesentlichen auf die archäologischen Funde und die
Chroniken, die von einigen spanischen beziehungsweise von den Inka abstammenden
17
Vgl. Feest / Kann (1992), S. 65
18
Vgl. Waberschek, http://www.wetter-information.de/El-Nino.html: ,,El Niño" heißt übersetzt ,,das Kind"
und wurde deshalb so bezeichnet, weil dieses Phänomen häufig an Weihnachten auftritt, also zur Zeit des
von der katholischen Kirche sog. Christuskindes. (letzter Zugriff am 07.07.2007)
19
Vgl. Shimada (1994), S. 134: Dieser Autor zeigt einen interessanten schematischen Vergleich der
unterschiedlichen Meinungen über die Ursprünge der Moche-Kultur und deren nachfolgende Kulturen.
20
Darüber hinaus ist der durchschnittlich zwanzig Kilometer breite Küstenstreifen durch absolute
Trockenheit gekennzeichnet und vergleichbar mit den klimatischen Bedingungen der Atacama-Wüste in
Chile, der trockensten Wüste der Erde.
21
Vgl. Ammann / Ammann, http://www.elnino.info/index.php: Durch den plötzlich auftauchenden warmen
und an Plankton armen Meeresstrom aus dem Norden sterben die Fische, die sich nicht rechtzeitig in
kältere und nährstoffreichere Gewässer zurückziehen können. Dieser Einschnitt in die natürliche
Nahrungskette beeinflusst auch nachfolgende Glieder der Kette, wie bspw. Meeresvögel und Kormorane,
die sich überwiegend von Fischen ernähren. Das Phänomen des ,,El Niño" ist auch in heutiger Zeit in mehr
oder weniger regelmäßigen Abständen zu beobachten. (letzter Zugriff am 16.07.2007)
22
Vgl. Frenz (2002), S. 142: Die Inka verwendeten zur Übermittlung von Botschaften die so genannten
Quipu, auch Khipu oder Qipu geschrieben, Knotenschnüre, die allerdings in erster Linie als Ersatz für
Rechentafeln dienten und sich zur Aufzeichnung historischer Tatsachen nicht eigneten. Sie bestanden in
der Regel aus gedrehter Baumwolle.
23
Vgl. Feest / Kann (1992), S. 61
Vgl. Larco Hoyle (1966), S. 99 f.: Larco Hoyle spricht als einer der wenigen Wissenschaftler von einer
Moche-Schrift, wenn er die von ihm in Gräbern gefundenen Bohnen erwähnt, welche mit eingeritzten
Punkten und Linien versehen sind. Er vergleicht diese sogar mit dem Schriftsystem der Maya und ist nicht
zuletzt deshalb der Ansicht, es hätten enge Verbindungen zwischen beiden Kulturen bestanden.
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
6
Gelehrten und Priestern nach der Eroberung der neuen Gebiete angefertigt wurden.
Allerdings sollten diese Chroniken mit einer gewissen Skepsis betrachten werden, da sie
teilweise sehr widersprüchlich sind und die Partikularinteressen der Verfasser oft nur
schwer von der Wahrheit zu trennen sind.
Künstlerisch und kulturell stellte die Frühe Zwischenperiode eine Blüte altperuanischer
Kultur dar, wie sie später kaum wieder erreicht wurde, was sich besonders an den
detailgetreuen und teilweise vielfarbigen Zeichnungen auf den gefundenen Tongefäßen
beziehungsweise an den präzisen Formen der Gefäße selbst widerspiegelt. Fischer spricht
in diesem Zusammenhang in Anlehnung an die Kunst des 20. Jahrhunderts von einer
,,realistisch-expressiv anmutenden Kunst",
24
was in Abb. 3 gut zu sehen ist.
Für Larco
Hoyle waren die Mochica ,,die größten Künstler Alt-Perus."
25
Die Keramiken gehören
gleichzeitig zu den wichtigsten Zeugnissen, die von den Mochica hinterlassen wurden. So
sieht man Indios mit Binsenflößen beim Fischfang auf dem Meer, zahlreiche Götter und
Dämonen, Tiere und Pflanzen und sogar erotische Darstellungen, wie sie sonst in keiner
präkolumbischen Kultur zu sehen sind. Als die Moche-Kultur ihrem Ende entgegenging,
wurden die Tongefäße mit Hilfe von Formen in großer Stückzahl von Spezialisten
produziert, die entweder allein oder unter Oberaufsehern in größeren Gruppen arbeiteten.
Auch Textilien sowie Gold-, Silber- und Kupfergegenstände wurden hergestellt. Zwar
lassen diese keine Rückschlüsse auf die staatliche Organisation zu. Doch gilt es als
gesichert, dass es sich um einen theokratischen Staat handelte.
26
Bis ins sechste
Jahrhundert n. Chr. wurde die urbane Struktur bei allen höher entwickelten
lateinamerikanischen Kulturen von einem Zeremonialzentrum dominiert.
27
Die
bekanntesten zeremoniellen Stätten der Mochica sind die beiden Tempel Huaca de la
luna und Huaca del sol,
28
die Mond- und die Sonnenpyramide, welche 500 Meter
voneinander entfernt südlich des Moche-Flusses errichtet wurden; ihre ungefähre Lage ist
ebenfalls in Abb. 1 zu sehen. Zwar ist ist die Pyramide Huaca del Sol im Vergleich zur
24
Fischer (1992), S. 15
25
Larco Hoyle (1966), S. 96
26
Vgl. Helfritz (1979), S. 271
Vgl. Larco Hoyle (2001a), S. 177 f.
27
Vgl. Lumbreras (1981), S. 225 f.
28
Vgl. Mason (1965), S. 338: Die Bezeichnung ,,huaca" (wak'a) bedeutete ursprünglich ,,geheiligte Stätte"
und wird auch heute noch von den Indios in diesem Sinn gebraucht. Ansonsten wird damit aus archäolo-
gischer Sicht eine Lehmziegelpyramide oder eine archäologische Grabstätte der Indianer bezeichnet.
Vgl. Jones / Molyneaux (2002), S. 189: Huacas können sowohl von der Natur als auch von Menschen
geschaffen sein.
Vgl. Polia Meconi (1999), S. 107
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
7
147 Meter großen Cheops-Pyramide in Gizeh eher klein geraten. Doch reichen ihre 48
Meter Höhe immerhin aus, um die höchste Adobe-Pyramide Südamerikas und
gleichzeitig auch das höchste präkolumbische Bauwerk des Subkontinents zu stellen. Die
farbigen Reliefmauern beider Stufenpyramiden, die auf ihrer Plattform einst Tempel
trugen,
29
sind kunstvoll gestaltet und geben Aufschluss über die Lebensweise der
kriegerischen Mochica. Ein Ausschnitt einer
solchen Mauer ist in Abb. 13 auf Seite 31 zu
sehen. Der Bau solch mächtiger Anlagen
erforderte vermutlich Tausende von Arbeitern,
was wiederum eine straff organisierte
Gesellschaft voraussetzte. Diese bestand aus
einer politisch-religiösen Führungsschicht und
einer Masse von Bauern, die mit hoch
entwickelten Anbautechniken
30
die Grundlage
für große Gemeinschaftsarbeiten schufen.
Die Wirtschaft der Mochica basierte auf
Fischerei und Ackerbau, wobei überwiegend
Mais, Kartoffeln, Paprikaschoten, Erdnüsse und
Baumwolle angebaut wurden.
31
Zusätzlich
wurden Enten und Meerschweinchen für die
Deckung des Nahrungsmittelbestandes sowie
eine an das Wüstenklima angepasste Lamarasse
gezüchtet, welche sogar das Gewicht eines
Reiters tragen konnte.
32
Auch die Jagd spielte zumindest bei der herrschenden Schicht
eine bedeutende Rolle, wobei das erlegte Wild vermutlich nur von ihr verzehrt wurde;
diese Schlussfolgerung zieht Larco Hoyle aus der Tatsache, dass die auf den gefundenen
Gefäßen abgebildeten Jagdszenen ausschließlich Moche-Herrscher zeigen.
33
29
Vgl. Krickeberg (1957), S. 376: Der Autor geht davon aus, dass der Bau von Stufenpyramiden von
Mesoamerika her eingeführt wurde, da diese ebenfalls Tempel auf ihrer Plattform trugen. Einen Beweis für
diese Vermutung kann allerdings auch er nicht bringen.
30
Vgl. Lumbreras (2000), S. 23 ff.
31
Vgl. Benson (1972), S. 71 ff.
Vgl. Larco Hoyle (2001a), S. 263: Larco Hoyle bietet darin einen guten Überblick über die
Hauptanbauprodukte der Mochica.
32
Vgl. Alva (2001), S. 39
33
Vgl. Larco Hoyle (2001a), S. 317 ff.
Abb. 3: Portraitgefäß einer
historischen oder legendären
Person
Quelle: Bourbon / Cavatrunci
(2005), S. 50
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
8
Betrachtet man die Errungenschaften der Mochica, so wird deutlich, dass sie einerseits
alte Ideen anderer Kulturen, beispielsweise von Chavin übernommen und andererseits
diese überarbeitet und teilweise durch Neues ergänzt haben. Für Quilter waren die
Mochica ,,das einzige prähistorische Volk Südamerikas, das Gesichter lebender
Menschen in der Kunst überlieferte;"
34
allerdings führt auch er keine Beweise auf, dass es
sich tatsächlich um lebende Personen handelte. Zwar ist bis heute nicht geklärt, wie es
den Mochica gelang, über 800 Jahre eine derartige kulturelle Homogenität, wie sie sich in
der Kunst widerspiegelt, zu schaffen. Doch zeigt sich deutlich, dass ihre kulturellen
Errungenschaften die Basis für die soziale, religiöse und politische Entwicklung der
gesamten Nordküste Perus bildeten.
Im folgenden Hauptteil dieser Arbeit werde ich genauer auf die Religion der Mochica
eingehen. Dieses Kapitel besteht aus drei Teilen, wobei der erste Abschnitt (Punkt II.1)
von den Totenkulten und Opferzeremonien handelt. Um den vorgegebenen Rahmen
einzuhalten, werde ich auf die in der Moche-Kultur bedeutende rituelle Hirschjagd
ebenso wenig eingehen wie auf das so genannte Reinigungsritual. Im darauf folgenden
Abschnitt (Punkt II.2) werde ich zunächst die komplexe Götterwelt der Mochica
beleuchten und später auf die Bedeutung der Raubkatzen in den religiösen Vorstellungen
der Andenvölker und speziell der Raubkatzengottheit bei den Mochica eingehen. Der
letzte Abschnitt (Punkt II.3) des zweiten Kapitels beschreibt drei der vermutlich
wichtigsten Pflanzen, die von den Mochica zu religiösen Zwecken verwendeten wurden.
Der größte Teil dieser Arbeit basiert überwiegend auf deutsch-, englisch- und
spanischsprachiger Literatur, deren größten Teil ich in den Bibliotheken der Universität
PUCP in Lima, sowie der Nationaluniversität von Trujillo erhielt. Besonders hilfreich
war das zweibändige Werk ,,Los Mochicas" des ausgewiesenen Moche-Experten Rafael
Larco Hoyle. Auch die zahlreichen Arbeiten von Christopher B. Donnan, Schüler von
John Rowe an der University of California, sind unverzichtbar für das Verständnis der
Moche-Gesellschaft. Von den erst zu Beginn dieses Jahrhunderts publizierten Büchern
waren vor allem jene von Steve Bourget und Luis Jaime Castillo wertvolle Quellen für
meine Recherchen über die neuesten Forschungsergebnisse. Die oben genannten Bücher
erschienen mir an dieser Stelle besonders erwähnenswert, stellen jedoch nur einen
kleinen Ausschnitt der insgesamt verwendeten Literatur dar.
34
Quilter (2005), S. 89
I. Einleitung: Die Mochica im Kontext anderer präkolumbischer Kulturen
9
Darüber hinaus waren natürlich die zahlreichen Museen in Peru eine hervorragende
Möglichkeit, die archäologischen Funde aus nächster Nähe zu betrachten. Dabei waren es
vor allem drei Museen, die ich als besonders hilfreich fand, ohne die Bedeutung der hier
nicht genannten in irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Die für meine Recherchen
wichtigsten Museen waren das ,,Museo Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia del Perú" in Lima und das nur wenige hundert Meter entfernt liegende ,,Museo
Arqueológico Rafael Larco Herrera", die ich häufiger besuchen konnte. Leider hatte ich
nur einmal die Gelegenheit, das nicht weniger beeindruckende Museum ,,Museo Tumbas
Reales de Sipán" in Lambayeque zu besichtigen. Neben den erwähnten Universitäten und
Museen bleibt als letztes noch das ,,Instituto de Medicina Tradicional del Perú"
(INMETRA) in Lima zu nennen, wo ich mich eingehend über die traditionelle
peruanische Medizin informieren konnte.
II. Religion als zentraler Aspekt der Moche-Kultur 10
II. RELIGION ALS ZENTRALER ASPEKT DER MOCHE-KULTUR
Es ist nicht zu bestreiten, dass alle schriftlichen Quellen, die wir heute über die religiösen
Vorstellungen der präkolumbischen Kulturen besitzen, sich vornehmlich auf die Inka-
Kultur beziehen und von Personen geschrieben wurden, welche in gewisser Hinsicht nur
Außenstehende dieser Kultur und damit auch der religiösen Sichtweisen waren.
Insgesamt gibt es weniger als eine Hand voll Autoren, die in irgendeiner Weise andiner
Abstammung waren, und keiner von ihnen war wirklich Anhänger dieser
Glaubensrichtungen und der dazugehörigen Praktiken, weshalb ihnen ein tieferer
Einblick in die religiösen Vorstellungen der indigenen Bevölkerung vorenthalten war.
Auch die Tatsache, dass bei den meisten Spaniern, die über die Religion in der Neuen
Welt schrieben, ein ausgeprägter Missionierungsdrang mit christlichen Vorstellungen
anzutreffen war, ist schwer zu leugnen. Dass dies die Art und Weise der Niederschrift in
eine gewisse Richtung lenkte, ist plausibel. Trotzdem erachte ich es als unabdingbar,
diese Quellen in Ausschnitten bei passender Gelegenheit zu zitieren. Eine wichtige
Quelle ist der von Felipe Guamán Poma de Ayala, Nachfahre des Inka-Herrschers Topa
Yupanqui (1471-1493), verfasste und über tausend Seiten lange Brief ,,Nueva crónica y
buen gobierno" (Neue Chronik und gute Staatsverwaltung) an König Philipp III. Darin
beschwert er sich über die ungerechte Behandlung der indigenen Bevölkerung seitens der
Spanier und beschreibt mit Sarkasmus und Ironie die Geschichte seines Vaterlandes Peru
und speziell die Zustände während der spanischen Besetzung. In ,,Obras" von Bernabé
Cobo liest man vieles über die Flora und Fauna Perus im 17. Jahrhundert sowie über die
Mythen der Indios, wobei die Bezeichnung ,,Mythen" mit einem gewissen Grad an
kultureller Voreingenommenheit belegt ist, da diese heute als Mythen bezeichneten
Erzählungen für jene Völker ernst zu nehmende Darstellungen ihrer Götter und Teil ihrer
Kulturen waren, weshalb sie durchaus die Bezeichnung ,,Religion" verdienen.
Die Erkenntnis, dass sich die Ikonographie der Andenzivilisationen im Laufe der Zeit
kaum verändert hat, könnte des Weiteren zu dem Schluss verleiten, die schriftlichen
Belege, die sich auf die Inkazeit beziehen, ließen sich auf frühere Kulturen übertragen.
Ich möchte deshalb noch einmal betonen, dass die oben aufgeführten Quellen nicht nur
kritisch zu betrachten sind, sondern natürlich auch nicht als direkte historische Belege für
religiöse Handlungen und Ansichten der Mochica herangezogen werden können. Sie
dienen aber meines Erachtens einem besseren Verständnis der archäologischen,
künstlerischen und architektonischen Zeugnisse, mit Hilfe derer vieles, was in den
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836613705
- DOI
- 10.3239/9783836613705
- Dateigröße
- 2.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Passau – Philosophische Fakultät, Studiengang Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Mai)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- lateinamerika mochica peru anden hochkultur
- Produktsicherheit
- Diplom.de