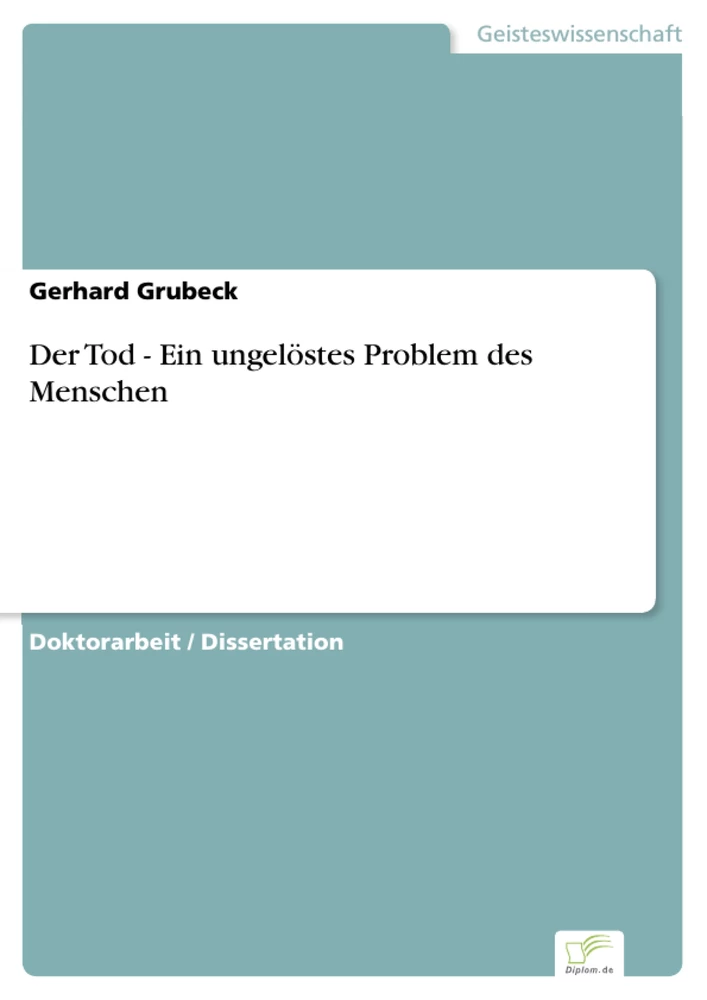Der Tod - Ein ungelöstes Problem des Menschen
Zusammenfassung
Probleme, also schwierige, ungelöste Fragen oder Aufgaben sind es, die den Menschen seit jeher anspornen, antreiben, diese zu bewältigen. Problem, aus griech. problema Vorsprung, Klippe, Hindernis, Bollwerk, übertragen Streitfrage, zweifelhafte Frage, eigentlich das Vorgelegte, Hervorragende, zu proballein vorwärts werfen, hinwerfen, entgegenstellen, aus pro vorn, voran, voraus, vorwärts und ballein werfen; so erklärt Krauss Etymologisches Wörterbuch diesen Begriff, der uns täglich begegnet.
In unserem Leben, in unserem menschlichen Dasein sind wir ungefragt dem Phänomen Problem unausweichlich ausgeliefert. Mit den ersten Gedanken, die das kleine menschliche Hirn produziert, tauchen unwillkürlich Fragen auf, die sich alsbald als Probleme des jeweiligen Individuums herausstellen. Mit Fragen produzieren wir Probleme, die nach Antworten verlangen. Finden wir diese nicht, sind wir zutiefst unzufrieden, unbefriedigt, verunsichert und frustriert. Wir gewöhnen uns im alltäglichen Leben, daraus zu lernen, Probleme zu lösen bzw. von anderen lösen zu lassen. Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden, ist ein bekanntes Sprichwort, das man immer dann zu hören bekommt, wenn man vor schwierigen Situationen steht. Probleme sind Erscheinungen, Erlebnisse oder Reflexionen im menschlichen Leben, im Dasein. Dasein impliziert das Konfrontiert-Sein mit Problemen. Ergo ergibt sich daraus der Schluss, Probleme gibt es nur solange jemand da ist, d.h. am Leben ist. Eigentlich gibt es nur persönliche, individuelle Probleme, die jemeinig eine und nur diese eine Person tangieren und treffen. Allgemeine Probleme sind nichts anderes als ein Konglomerat von vielen, individuellen.
Zeit unseres Lebens stehen wir nach und nach vor Problemen, die wir meistern oder die uns scheitern lassen. Wir lernen uns selbst und von anderen Problemlösungen, die wir immer wieder anwenden. Pawlows Hunde und die SkinnerBox sind Beweise hierfür aus der Psychologie, wie man andere oder sich selbst konditionieren kann, für bestimmte Aufgaben bestimmte erfolg versprechende Aktionen zu setzen, um ein Hindernis zu überwinden. Wir lernen im trial und error (Versuch und Irrtum) System Probleme zu bewältigen. Lernen ist die Grundlage schlechthin, sich Hindernissen und Aufgaben bewusst zu werden und diese aus dem Weg zu räumen bzw. zu lösen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, hören wir gerne unsere Lehrer dozieren. Nun, das mag für das Leben, das Dasein […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung:
a) Anstatt eines Vorwortes:
b) Allgemeines:
2. Geschichte des Todes:
a) Allgemeiner Überblick:
b) Geschichte des Todes anhand von Dokumenten:
3. Der Tod in der Philosophie:
„’Gedanken über Tod und Unsterblichkeit’
4. SELBSTMORD – FREITOD:
a) Geschichtlicher Überblick:
b) Amery – Ringel: Für und Wider den Selbstmord:
c) Moody’s Erfahrungen mit Selbstmördern:
5. Tod und Christentum:
a) Karl Rahner: Schriften zur Theologie:
b) Eberhard Jüngel: Tod:
c) Gisbert Greshake: Stärker als der Tod:
d) Josef Pieper: Tod und Unsterblichkeit:
e) Rudolf Frieling: Christentum und Wiederverkörperung:
f) Chanois Jean Michel: Das Leben, Der Tod, Die Toten:
6. Der Tod in (an die Philosophie) angrenzenden Wissenschaften:
a) Was ist der Tod?
b) Kognition über den Tod bei Kindern:
c) Euthanasie und Ethik:
d) Leben vor dem Leben:
7. Resümee:
8. Schluss:
9. Literaturverzeichnis:
1. Einleitung:
a) Anstatt eines Vorwortes:
„Ein Hund „Alles, was ist, entsteht ohne Grund,
der stirbt schleppt sich durchs Leben aus Schwäche
und der weiß und stirbt durch Zufall."
daß er stirbt (Jean-Paul Sartre)
wie ein Hund
und der sagen kann
daß er weiß
daß er stirbt
wie ein Hund
ist ein Mensch."[1]
(E. Fried)
b) Allgemeines:
Probleme, also schwierige, ungelöste Fragen oder Aufgaben sind es, die den Menschen seit jeher anspornen, antreiben, diese zu bewältigen. Problem, aus griech. problema "Vorsprung, Klippe, Hindernis, Bollwerk", übertragen "Streitfrage, zweifelhafte Frage", eigentlich "das Vorgelegte, Hervorragende", zu proballein "vorwärts werfen, hinwerfen, entgegenstellen", aus pro "vorn, voran, voraus, vorwärts" und ballein "werfen"; so erklärt Krauss Etymologisches Wörterbuch diesen Begriff, der uns täglich begegnet.
In unserem Leben, in unserem menschlichen Dasein sind wir ungefragt dem Phänomen Problem unausweichlich ausgeliefert. Mit den ersten Gedanken, die das kleine menschliche Hirn produziert, tauchen unwillkürlich Fragen auf, die sich alsbald als Probleme des jeweiligen Individuums herausstellen. Mit Fragen produzieren wir Probleme, die nach Antworten verlangen. Finden wir diese nicht, sind wir zutiefst unzufrieden, unbefriedigt, verunsichert und frustriert. Wir gewöhnen uns im alltäglichen Leben, daraus zu lernen, Probleme zu lösen bzw. von anderen lösen zu lassen. "Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden", ist ein bekanntes Sprichwort, das man immer dann zu hören bekommt, wenn man
vor schwierigen Situationen steht. Probleme sind Erscheinungen, Erlebnisse oder Reflexionen im menschlichen Leben, im Dasein. Dasein impliziert das Konfrontiert-Sein mit Problemen. Ergo ergibt sich daraus der Schluss, Probleme gibt es nur solange jemand da ist, d.h. am Leben ist. Eigentlich gibt es nur persönliche, individuelle Probleme, die jemeinig eine und nur diese eine Person tangieren und treffen. Allgemeine Probleme sind nichts anderes als ein Konglomerat von vielen, individuellen.
Zeit unseres Lebens stehen wir nach und nach vor Problemen, die wir meistern oder die uns scheitern lassen. Wir lernen uns selbst und von anderen Problemlösungen, die wir immer wieder anwenden. Pawlows Hunde und die Skinner–Box sind Beweise hierfür aus der Psychologie, wie man andere oder sich selbst konditionieren kann, für bestimmte Aufgaben bestimmte erfolg versprechende Aktionen zu setzen, um ein Hindernis zu überwinden. Wir lernen im trial und error (Versuch und Irrtum) – System Probleme zu bewältigen. Lernen ist die Grundlage schlechthin, sich Hindernissen und Aufgaben bewusst zu werden und diese aus dem Weg zu räumen bzw. zu lösen. "Für jedes Problem gibt es eine Lösung", hören wir gerne unsere Lehrer dozieren. Nun, das mag für das Leben, das Dasein gelten, aber es gilt auch für Probleme, die außerhalb dessen sich befinden. Und sind das überhaupt Probleme? Ist die Frage nach der individuellen Zeit, oder dem Noch–nicht–Dasein vor der Geburt ein Problem? Ist die Frage nach dem Tod, nach dem, ob es etwas und was es danach gibt, nach dem so genannten irdischen Dasein, ein Problem? Und wenn es eines ist, können wir es lösen? Können wir es mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln als Noch-Lebende rational, ohne kosmischem Bewusstsein, esoterischem Wissen oder Okkultismus lösen? Oder ist diese so existentielle Frage des Menschen unlösbar? Können wir vielleicht diese Frage nach dem "Danach" auch erst "danach" beantworten? Gibt es also ein Problem, das nicht im Dasein sondern erst im "Nicht-mehr-Dasein" zu lösen ist? Und muss dieses überhaupt gelöst werden? Diesen und ähnlichen Fragen versucht der Autor dieser Arbeit auf den Grund zu gehen, aufzuwerfen und so gut es geht zu beantworten.
„Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?“ fragte sich dereinst Immanuel Kant zu Königsberg und leitete davon eine vierte Frage ab: „Was ist der Mensch?“ Nun, ich versuche folgender philosophischer Frage nachzugehen: Was ist der Mensch, wenn er nicht mehr (Mensch) ist?
Der Tod ist wieder ‚modern’ geworden. Man braucht nur die zahlreichen Publikationen zu diesem Thema der einzelnen Verlage aus der jüngsten Vergangenheit zur Hand zu nehmen, um diese Behauptung bestätigt zu finden. Nach jahrzehntelanger Verdrängung scheint man sich wieder mit dem Phänomen zu beschäftigen, das uns alle einmal ausnahmslos, unbarmherzig und unsausweichlich tangiert und unsere hiesige personelle und individuelle Existenz vernichtet. Aber der Schein trügt. Mehr als je zuvor versucht unsere westliche, hoch entwickelte, diesseitsorientierte, moderne Zivilisation dieses leidige Thema auszusparen, zu
verdrängen. Doch auch die konsequentesten Mittel der Verdrängung erweisen sich als untauglich zur Bewältigung unserer Ängste, die zumindest periodisch jeden Menschen überfallen. So ungefragt der Mensch auf diese Welt – egal ob man sie zur Realität oder bloßen Einbildung erklärt – gestellt wird, so wenig bleibt es seinem Willen überlassen, diese auch wieder zu verlassen. Weder der Rausch unseres schnelllebigen Alltags noch die Ignoranz können dieses Problem lösen. Aber, können wir überhaupt das Problem des Todes zufrieden stellend lösen? Jemeinig für sich lösen?
Hat man erst einmal den Entschluss gefasst, Reflexionen über dieses Phänomen anzustellen, wird einem unter Umständen dasselbe passieren, was mir persönlich immer wieder widerfuhr: Mit jedem Buch, jedem Film, jedem Vortrag zu diesem Thema erhebt sich die Erwartung, mehr über dieses Phänomen zu erfahren; dieses fällt jedoch nach der Konsumation jäh in sich zusammen und man fragt sich wieder: Wer kann einem schon mehr über den Tod und die Wahr- oder Unwahrscheinlichkeit seines Danach mit Gewissheit mitteilen? Deshalb muss auch diese Arbeit die Zeichen der Unvollendung tragen.
Jeder als Mitglied und Individuum der Gattung Mensch ist verurteilt dazu, früher oder später die Erfahrung des Sterbens und des Todes – falls man im "Tod-Sein" noch erfahren kann – zu machen, wird aber diese, im Gegensatz zu allen anderen Erfahrungen, nicht mitteilen können. Dieser Schranken, dieser Ohnmacht bewusst werdend, flieht ein Großteil der menschlichen Gesellschaft in einen Zustand der Verdrängung. Oft wird noch in einzelnen Kapiteln dieser Arbeit darauf eingegangen werden, doch seien einige symptomatische Sätze vorangestellt:
Peter Härtling: „Diese Gesellschaft, habe ich schreiben wollen, diese Gesellschaft spart den Tod aus. … Wir reden uns Leben ein, kein ewiges, aber doch eines, das sein Ende nicht denkt. … Man stirbt, versteckt, behelligt die Lebenden nicht. … Es ist fraglich, ob es ohne Tod Religionen gäbe. Erst die Grenzüberschreitung, die quälende Frage, was folgt, wohin wir gehen, hat die Überwinder des Todes, die Götter, die Unsterblichen, den Gott, den Ewigen in die Tempel und auf die Altäre geholt. Der Tod ist der Erfinder der Seele. Wenn schon der Leib zu Staub verfällt, muss es etwas geben, das diesem Verfall entrinnen kann. Mit unendlicher Einfallsgabe hat der Mensch sich dieser Grenze widersetzt, sie übersprungen. … Seit Hiroshima ist der Tod eine Angelegenheit für Statistiker. Wir sollten, um Menschen zu bleiben, ihn wieder ins Haus holen."[2]
Raymond A. Moody schreibt in seinem Weltbestseller "Leben nach dem Tod" zum Problem
der Verdrängung u. a. folgende Zeilen:
„Das Todesthema ist tabu. Wir haben vielleicht unbewusst das Gefühl: Wenn wir auf irgendeine Weise mit dem Tod in Berührung kommen, und sei es indirekt, dann werden wir dadurch mit der Aussicht auf unseren eigenen Tod konfrontiert, dann wird dadurch unser eigener Tod angezogen, er wird realer, wird denkbarer.“
"Ebenso kann das Reden über den Tod psychologisch verstanden werden als eine Form der indirekten Annäherung an ihn. Und in der Tat haben viele Menschen das Gefühl vom Tod auch nur zu sprechen, bedeute schon, ihn geistig heraufzubeschwören, ihn näher heranzuholen auf eine Weise, die einen zwingt, der Unausweichlichkeit des eigenen Sterbens ins Auge zu sehen. Und weil wir uns dieses seelische Trauma ersparen wollen, versuchen wir kurz entschlossen das ganze Thema möglichst zu meiden.
Der zweite Grund, weshalb der Tod ein so schwieriger Diskussionsgegenstand ist, liegt noch tiefer verborgen, denn er wurzelt im Wesen der Sprache selbst. Die Wörter der menschlichen Sprache beziehen sich größtenteils auf etwas womit wir Erfahrung gemacht haben durch unsere Sinnesorgane. Der Tod ist etwas, was für die meisten von uns außerhalb der bewussten Erfahrung liegt, weil die meisten von uns durch diese Erfahrung nicht hindurchgegangen sind."[3]
Es sei hier kurz erklärt, warum der Autor zweimal "die meisten" und nicht "alle" schreibt. Sein Buch "Leben nach dem Tod" beschäftigt sich nämlich hauptsächlich mit Fällen, in denen bereits "Gestorbene", namentlich klinisch Tote, wieder ins Leben zurückgeholt wurden. Diese klammert Moody hier natürlich aus.
„Wenn wir überhaupt vom Tod sprechen wollen, dann müssen wir sowohl gesellschaftliche Tabus überwinden als auch die tief eingewurzelten sprachlichen Schwierigkeiten, die auf unseren Mangel an Erfahrung zurückgehen. Häufig tun wir ja doch nichts anderes, als uns in euphemistischen Analogien auszudrücken. Wir vergleichen den Tod oder das Sterben mit angenehmen Seiten, die uns geläufig sind, die wir kennen.
Die gängigste Analogie nach diesem Muster ist wohl der Vergleich zwischen Tod und Schlaf. Sterben, so sagen wir uns, ist wie einzuschlafen. … In der Ilias zum Beispiel nennt Homer den Schlaf "Geschwister des Todes". Und in der Apologie legt Platon seinem Lehrer Sokrates bei seiner Rede kurz nach der Verkündigung des Todesurteils durch ein attisches Gericht die folgenden Worte in den Mund:
‚Ist der Tod gleichsam ein Schlaf, in dem der Schlafende nicht einmal einen Traum sieht, so wäre der Tod ein überschwänglicher Gewinn. Denn ich glaube wirklich, wenn einer eine solche Nacht nimmt, darin er so fest geschlafen, dass er auch keinen Traum gesehen hat, und alle anderen Nächte und Tage seines Lebens mit dieser Nacht vergleicht, und dann aufrichtig sagen sollte, wie viele Tage und Nächte er in seinem Leben besser zugebracht habe als diese Nacht, ich glaube wirklich, dass nicht bloß ein Privatmann, sondern der Großkönig diese
gegen die anderen Tage und Nächte leicht würde zählen können. Wenn also der Tod etwas ist, so nenn ich ihn einen Gewinn und alle Zeit vor uns scheint auf diese Weise nur eine lange Nacht zu sein.’“[4]
Alternierend mit der Verdrängung durch den Menschen dürfte die Hoffnung über den Tod
hinausgehen. Auch hierzu – die Einleitung abschließend – eine bezeichnende Textstelle von
dem an der Universität Wien lehrenden Theologie-Professor Gisbert Greshake:
„Mit der Erfahrung, dass der Tod sinnloser Abbruch des Lebens sei, konnten sich offenbar die Menschen aller Zeiten nicht abfinden. Überall finden wir Dokumente der Überzeugung, dass in der Einheit und Ganzheit von Leben und Tod doch das Leben stärker ist. Die Vorstellungen dafür, wie das möglich sei, sind sehr verschieden. Man weiß nicht, wie eine Zukunft über den Tod hinaus aussehen kann. Aber die Hoffnung darauf entwirft abertausend verschiedene Bilder, denkt sich Möglichkeiten aus und nimmt solche Möglichkeiten in Symbolen, Zeichen und Träumen vorweg. Jede Religion, jede Weltanschauung entwirft so ihre eigenen Hoffnungsbilder.
Aus der Fülle des religionsgeschichtlichen Materials seien nur zwei Hoffnungsbilder genannt, mit denen Menschen ihre Sehnsucht und ihr Vertrauen, dass der Tod nicht das Letzte ist, ausgedrückt haben. …Das erste Hoffnungsbild, das erstmals in der platonischen Philosophie ausgearbeitet wurde, obwohl es selbst viel älter ist, formuliert sich als Überzeugung, dass im Menschen selbst etwas Unsterbliches ist, nämlich seine unvergängliche Seele, die vom Tod des Leibes nicht erreicht wird. … Ganz anders ist das zweite Hoffnungsbild, hebräisch-biblische. Die Hebräer kannten keine unsterbliche Seele, die den Tod überdauert; sie fassten den Menschen nicht auf als zusammengesetzt aus Leib und Seele; sie verstanden ihn als eins und ungeteilt. Darum ergreift der Tod auch den ganzen Menschen; nichts gibt es, was den Tod überdauert.
Hoffnung über den Tod hinaus kann es nur geben, weil man erwartet, dass Gott seinen Geist aufs Neue in den Toten sendet, ihn wiederbelebt, ihn auferweckt.
…Wäre der Tod das Letzte, wäre auch das Schöne, Gelungene, Erfüllende im Leben eigentlich sinnlos. Es stände von vornherein unter dem Vorzeichen des Abbruchs, des Scheiterns, des Nichtigen. Mit einer solchen Sinnlosigkeit kann aber der Mensch offenbar nicht oder nur sehr schwierig leben oder nur oberflächlich leben.“[5]
Diese kurze Passage scheint mir als besonders wichtig. Es wird in dieser Arbeit zu zeigen sein, dass das Prinzip Hoffnung beinahe ausnahmslos jedem Philosophen, jedem Wissenschaftler und Künstler lebendig innewohnt, in welcher Form auch immer. Aber auch einige wenige (Mutige?), die diese negieren, die der Hoffnung eine Abfuhr erteilen, werden später besprochen.
Das Phänomen Tod, das jedem Menschen unzählige Male begegnet, ihn ein ganzes Leben lang verfolgt, ihn erst durch sich selbst "befreit", ist nur greifbar und möglichst begreifbar durch höchste innere Aktivität; nicht durch Resignation oder gar durch Sentimentalität.
2. Geschichte des Todes:
a) Allgemeiner Überblick:
„Das Erkenntnisbemühen um ein Verständnis des Todes und des nachtodlichen Lebens ist so alt wie die Menschheit. Solange die Sinneswelt noch nicht erforscht war, solange es noch keine Naturwissenschaft und Technik gab, lag die übersinnliche Welt vor den Auge des Menschen offen, war der ‚Himmel’ hell und klar. Dementsprechend gab es zu der Zeit auch keine Zweifel an der Tatsache eines nachtodlichen Lebens. Seit sich aber die Erkenntnissicht grundlegend geändert hat, seit die Erde bis ins letzte Atom erforscht und aufgeklärt werden konnte, hat sich der "geistige" Horizont verdunkelt: In dem Maße, wie das Diesseits aufgehellt wurde, verschloss sich das Jenseits. Dementsprechend sind auch die Antworten auf die Frage nach Wesen und Sinn des Todes und des Jenseits verschieden ausgefallen."“[6]
Vergleicht man in dieser Beziehung die zunehmende "Nervosität" der gegenwärtigen Menschheit mit der Lebenshaltung und -stimmung vergangener Zeiten, so kommt man zu dem überraschenden Ergebnis, dass die innere Unsicherheit der Menschen dem Leben und insbesondere dem Todesproblem gegenüber erst in verhältnismäßig neuerer Zeit eingetreten ist, und dass der Tod – je weiter man zurückgreift – den Menschen immer weniger rätselhaft erscheint. Das kann natürlich nicht heißen, dass der Tod früher nicht rätselhaft war. Und die Bereitschaft, dem Tod und dem Danach Sinn zu verleihen und begleitend dazu buntere Bilder zu schaffen, ist in der Gegenwart bei primitiven Stämmen und Kulturen noch ebenso beobachtbar wie uns dies die Vergangenheit darlegt.
Das alte Indien:
Wie der auf einem Gipfel angelangte Bergsteiger mit einem einzigen Blick die Wellenzüge der Grate und die in Nebel gehüllten Täler überschaut, das ewige Auf und Ab betrachtet, so liegt vor dem Blick des indischen Weisen die Reihenfolge der wiederholten Erdenleben sichtbar ausgebreitet.
In den Upanischaden – altindische Textsammlungen, die aus der Zeit zwischen dem 9. Jh.v. und dem 1. Jhdt. n. Chr. stammen und von Schopenhauer sehr geschätzt und mit Vorliebe zitiert wurden – wird folgende Szene geschildert, die mehr als theoretische Betrachtungen geeignet ist, uns einen Blick in die Seelenverfassung des alten Indertums zu gewähren:
Der Knabe Naciketas wird aus religiösen Gründen von seinem Vater dem Tode geweiht, und zum Geleit wird ihm folgende Meditation auf den Weg ins Jenseits mitgegeben:
„ Sieh auf die Früheren rückwärts,
Sieh vorwärts auf die Folgenden.
Zur Ernte reift der Mensch wie das Korn,
Wie das Korn entsteht er wieder neu.“[7]
Der Vergleich mit dem Korn zeigt uns deutlich, was hier gemeint ist: die Wiederkehr der
menschlichen Seele in immer neuen Erdenleben. Das menschliche Denken dieser Zeit ist noch vollkommen naturverbunden; das Betrachten der Naturvorgänge löst im Menschen noch unmittelbare Erkenntnis aus.
"Mit der Gewissheit im Herzen, dass viele frühere Leben schon, hinter ihr liegen und viele künftige noch folgen werden, betritt die Seele den Weg des Todes."[8]
Für Naciketas, den Brahmanen stellt dieser Weg nichts Schreckliches dar. Im Gegenteil, er sieht im Tod die beste und einzige Gelegenheit, um Erkenntnis zu erlangen, die dem menschlichen Geist sonst unzugänglich und verborgen sind.
„Wer mit solcher Kenntnis aus dieser Welt scheidet, geht mit seiner Stimme in das Feuer ein, mit seinem Auge in die Sonne, mit seinem Geist und dem Mond, mit seinem Gehör in die Himmelsgegenden, mit seinem Hauch in den Wind. Zu einem Bestandteil davon geworden, wird er zu der von Gottheiten zu welcher er will, und kommt zur Ruhe. (Aus dem Satapatha-Brahmana)“[9]
Es ist offenbar, dass diese Erzählung nicht wörtlich gemeint sein kann. Es liegt, wie bei allen
hymnischen Texten, eine bildhafte Einkleidung allgemeingültiger ‚Wahrheiten’ zugrunde. Es wird weiters geschildert, wie Naciketas nach dem Überschreiten der Todesschwelle drei Tage in der Wohnung des Todes weilt, ohne von diesem empfangen und bewirtet zu werden. Damit aber begeht der Tod Naciketas gegenüber eine Unterlassung, zu deren Ausgleich er ihm die Erfüllung dreier Wünsche verspricht. Nachdem der Todesgott die beiden ersten Bitten des Knaben erfüllt hatte, äußert dieser als dritten Wunsch zu wissen, wie es sich mit den verstorbenen Menschen verhält. Es entwickelt sich folgender Dialog:
„Naciketas: Es besteht ein Zweifel hinsichtlich des verstorbenen Menschen. Die einen sagen: 'Er ist'; die anderen sagen: ‚Er ist nicht’. Von dir belehrt, möchte ich darüber Aufschluss haben, das ist der dritte meiner Wünsche.
Der Tod: Auch die Götter hatten einst hierüber Zweifel; denn man kann das nicht leicht ergründen; das ist ein sehr feines Gesetz. Bitte dir einen anderen Wunsch aus; bedränge mich nicht, erlass mir diesen.
Naciketas: Auch die Götter hätten einst hierüber Zweifel gehegt? Sagst du, Todesgott, es sei nicht leicht zu ergründen, und solch ein Lehrer wie du ist nicht leicht zu finden, - dann kommt kein anderer Wunsch diesem gleich.“[10]
Es folgen an dieser Stelle Belehrungen über das "Selbst", jedoch gewinnt man den Eindruck, dass der Indische Weise, obwohl sein Schauen in der sinnlichen wie in der geistigen Welt ihm die Gewissheit von der Wiederkehr der menschlichen Seele im neuen Erdenleben gibt, doch nach der Erkenntnis des "Ich" dürstet. Aber dieses entzieht sich seinem Schauen. Und weil er im Leben die Erkenntnis nicht erreichen kann, so sucht er sie im Tode. Der Tod ist der große Lehrer. So heißt es im schon oben erwähnten Satapatha Brahmana:
„Der, der dort brennt (die Sonne), ist fürwahr der Tod. Weil er der Tod ist, darum sterben die Wesen, die sich diesseits von ihm befinden. Jenseits von ihm sind die Götter, darum sind diese unsterblich. Durch seine Strahlenzügel sind alle erweckt.“[11]
Das vielleicht ergreifendste Zeugnis für das innere und innerliche Erleben der indischen Seele ist die Meditation eines Yogi in der Sterbestunde, wie sie uns der Ischa-Upanischad überliefert. Der Sterbende ruft Puschan an, der die Seele geleitet:
„Mit goldener Scheibe
ist das Antlitz der Wahrheit bedeckt.
Enthülle Puschan, uns dies Geheimnis,
dass wir Recht und Wahrheit schauen.
Puschan, zerteile deine Strahlen.
Verteile dein Licht.
Ja, ich sehe deine allerhöchste Gestalt.
Dort, jeder Mann (in der Sonne) bin ich.
Der Hauch werde zum Winde, dem Unsterblichen:
in Asche ende dieser Leib.“[12]
Uraltes Geistesleben tönt in diesem Gebet. Die Sonne wird noch vollkommener als Tor zur Wahrheit erlebt; "ihre physische Erscheinungsform ist durch den irdischen Leib bedingt, also Maya." Und in dem Augenblick aber, wo die Macht des Irdischen nachlässt, kommt der Sterbende an die Wahrheit heran. Die Strahlen zerteilen sich, das wahre Licht wird zur Offenbarung der geistigen Wesenheit der Sonne – des Todes –; derselben Offenbarung, die Jahrtausende später im Leib des Jesus sprach: "Ich bin das Licht der Welt."
Der Inder erlebt in der Sterbestunde das größte Glück seines Lebens. Er schaut den Sonnengeist und weiß, dass sein Ich zu ihm geht. Seine Leiblichkeit jedoch löst sich in Wind und Asche auf.
Für den Inder ist der Tod die Pforte zum Jenseits, eine Pforte aber, die ihm nicht verschlossen bleibt, sondern durch die er in die geistige Welt schaut.
Die persische Zeit:
In der alten indischen Zeit, mit ihrem fast noch unverschleierten Ausblick in die geistige Welt, konnte die Liebe zur Erde noch fast nicht entwickelt werden. Erst in Persien, unter Zarathustras strenger Führung, (8. Jh. v. Chr.), lernte der Mensch die Erde als seine eigentliche Heimat betrachten und die Arbeit an ihr als seinen Lebensinhalt empfinden. Aber, wie schon eingangs erwähnt, entspricht es seiner inneren Gesetzmäßigkeit, dass der Mensch offensichtlich, je mehr er sein Interesse der physischen Welt zuwendet und sozusagen erdentüchtig und –fähig wird, um so mehr den Blick in die geistige Welt verlieren muss. So erscheinen auch die Erlebnisse und Erfahrungen der 'persischen Seele' nach dem Tod ärmer und begrenzter als in der indischen Zeit. Aber auch in Persien existiert die Erkenntnis von der Besonderheit der ersten drei Tage nach dem Tode – wie bei den Indern –, in denen sich die Rückschau auf das vergangene Leben abspielt. Dass es diese Rückschau zwar in zeitlich anderer Dimension auch heute bei ins Leben zurückgeholten klinisch Toten gibt, versucht uns Dr. R. A. Moody mit seinen Veröffentlichungen zu beweisen; aber dazu später. Nach dieser oben genannten Rückschau beginnt die Seele nun ihre Außenwelt wahrzunehmen.
Wie immer in der persischen Zeit wird scharf unterschieden zwischen dem Los der Seele
eines "Rechtgläubigen" und der eines "Falschgläubigen".
„Es fragte Zarathustra den Ahura Mazda: ‚Ahura Mazda, heiligster Geist, Schöpfer des körperlichen Wesen, Rechtgläubiger! Wenn ein Rechtgläubiger stirbt, wo verweilt während der Nacht seine Seele?’
Darauf sprach Ahura Mazda: ‚Nahe bei seinem Haupte sitzt sie ruhig, indem sie die Gatha Ushtavaiti (eine Gebetshymne) aufsagt und sich Glück wünscht…Während dieser Nacht sieht die Seele ebensoviel Freunde wie in der ganzen Zeit ihres Lebens.’“[13]
Ebenso anschaulich wird das Schicksal des ‚Falschgläubigen’ geschildert:
„Seine Seele rennt dicht an seinem Schädel umher,
indem sie verzweifelt spricht: 'Nach welchem Lande soll ich mich wenden?' … Während dieser Nacht sieht die Seele ebensoviel Traurigkeit wie in der ganzen Zeit des Lebens."[14]
An diesen Textbeispielen sieht man, dass sich für die rechtgläubige Seele ein 'Paradies' auftut, das zweifellos in seiner Erscheinungsform durch die noch am Irdischen haftenden Wünsche und Erinnerungen der Seele bedingt ist und dadurch 'luziferische' Züge zeigt. Weiters zeigt sich, dass die Seele nur weiterkommen kann durch die Kräfte, die sie sich durch ein moralisches Leben angeeignet hat. Die Seele eines falschgläubigen Mannes tritt mit ihrem vierten Schritt in die "anfanglose Finsternis", wo man ihr Gift und Giftgestank serviert, die des rechtgläubigen jedoch tritt in die "anfanglosen Lichter" und erhebt sich zu den "goldenen Thronen des Ahura Mazda und der Unsterblichen Heiligen", sie geht ein in die geistige Welt.
Sumer – Babylon:
„Als die Götter die Menschen schufen,
Setzten sie den Tod ein für die Menschheit,
Das Leben aber behielten sie in ihrer Hand.
Gilgamesch-Fragment, etwa 2000 v. Chr.“[15]
Einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Eroberung und Beherrschung der Erde machten die Menschen der sumerisch-babylonischen Zeit. Das Gilgamesch-Epos gewährt uns einen aufklärenden Blick in die Seelenverfassung dieser Kultur. Es schildert die Freundschaft zwischen Gilgamesch und Engidu, die schließlich durch den Tod des Letzteren zerrissen wird. Und dieses Ereignis wird für Gilgamesch zum erschütternden Rätsel.
„Mein Freund, den ich liebe, ist zu Erde geworden,
Engidu, mein Freund, den ich liebe, ist zu Erde geworden!
Werde nicht auch ich wie er mich niederlegen müssen,
Ohne wieder aufzustehen in alle Ewigkeit?“[16]
Gilgamesch kann das Schicksal des Freundes nicht begreifen, weil sein geistiger Blick nicht mehr über die Schwelle des Todes hinüberreicht. Seine Seele ist schon zu stark mit der
irdischen Welt verhaftet, dass ihre Schaukraft verdunkelt wurde. In der Hoffnung, das Rätsel des Todes gelöst zu bekommen, begibt sich Gilgamesch auf den Weg zu seinem Urahn, von dem er weiß, dass dieser den Tod noch nicht als etwas Schreckliches erlebte. Es zeigte sich, dass das Leben auf der Erde und die physische Abstammung dieser Zeit bereits so tief auf die Struktur der Seele eingewirkt haben, dass die Arbeit ihres Erkenntnisweges dadurch bedingt und gelenkt wird. Anstatt unmittelbar in die geistige Welt schauen zu können, muss sie den ‚Weg der Ahnen’ gehen.
Auf seiner Wanderung trifft nun Gilgamesch die göttliche Schenkin Siduri, die auf dem Meeres-Thron sitzt. Sie fragt er nach dem Weg zu seinen Ahnen, doch sie kann ihm keine Hoffnung geben, denn:
„… Niemand, wer auch seit der Vorzeit Tagen kam, kann das Meer überschreiten.
Wohl hat überschritten das Meer Schamasch, der Held (der Sonnengott),
Doch außer Schamasch, wer wird es überschreiten?“[17]
Als Gilgamesch aber doch nach vielen Fährnissen den Zugang zu den Ahnen erreicht hat, sagt ihm dieser:
„Wütend ist der Tod, keine Schonung kennt er,
Bauen wir ewig ein Haus, segeln wir ewig?
Teilen Brüder ewig?
Findet ewig Zeugung statt auf Erden?
Steigt der Fluss ewig, die Hochflut dahinführend? …
Seit jeher gibt es keine Dauer:
Der Schlafende und der Tote, wie gleichen sie einander!
Nicht kann man wiedergeben des Todes Bild …“[18]
Als es aber Gilgamesch endlich gelingt, seinen Freund Engidu aus der Unterwelt heraufzubeschwören, scheut sich dieser, seinem Freund die schreckliche Wahrheit zu sagen:
„Ich will es dir nicht sagen, mein Freund, ich will es dir nicht sagen.
Wenn ich die Ordnung der Unterwelt, die ich schaute, dir sagte,
Müsstest du dich den ganzen Tag hinsetzen und weinen! …
Siehe, den Leib den du anfasstest, dass dein Herz sich freute,
Den frisst das Gewürm, wie ein altes Kleid!
Mein Leib, den du anfasstest, dass dein Herz sich freute,
Ist dahingeschwunden, ist voll von Staub!“[19]
Es zeigt sich, dass für Gilgamesch der Tod durchaus sinnloses Geschehen ist. Dass muss eigentlich erstaunlich erscheinen, das es ihm doch gelingt, durch sein Eindringen in die Welt der Toten die Seele seines Freundes in seinem jenseitigen Zustand zu schauen. Aber dadurch löst sich das Rätsel des Todes nicht für ihn. Für ewig scheint der Tod die Freunde zu trennen.
Im Tod erkennt der Babylonier mehr und mehr ein schreckliches und unverständliches Ereignis, vor dem er am liebsten die Augen verschließen möchte. Zusammenhängend damit ist offenbar auch das 'Wissen von der Wiederkehr der Seele' in wiederholten Erdenleben
Verloren gegangen, obgleich das ganze Denken des Babyloniers dazu neigt, die Wiederkehr des Gleichen zu betonen, was A. Jeremias als das "Kreislaufdenken" bezeichnet hat:
"Das Verlorene kommt nicht wieder, ist 'ägyptisch' gedacht. Das Verlorene kommt wieder, Endzeit (wenn auch relativ gemeint) muss gleich Urzeit sein, ist 'sumerisch' gedacht."[20]
Umso mehr fällt auf, dass dem babylonischen Denken das Wissen von der Reinkarnation verloren ging; denn, dass es ihm ursprünglich zu Eigen war, kann bei der Nähe Indiens nicht zweifelhaft sein.
„Die gnostischen Systeme der Weltreligionen kennen nicht die einfache einmalige geschichtliche Verankerung des Menschen als eines göttlichen Geisteswesens in dieses
Erdendasein. Sie haben vielmehr alle die Anschauung gemeinsam, dass das im Menschen eingeborene Ich selbst in einem Erdenleben nur eine seiner vielen irdischen Wanderstationen hat, in die er immer wieder zurückkehren muss, sei es im Sinn einer allgemeinen Seelenwanderung oder nur in Wiederholung menschlicher Existenzen, bis er die Wanderung, die aus der Entwicklung höherer Sphären kam, mit dem Ertrag des Erdenlebens in außerirdischen Existenzen fortsetzt.“[21]
Dieselbe Erscheinung treffen wir ja auch in anderen Kulturen. So war zum Beispiel in der germanischen Urzeit die Vorstellung von der Wiederverkörperung zumindest nichts Ungewöhnliches (vgl. E. Bock: Wiederholte Erdenleben. 6. Aufl., Stuttgart 1975) und zu Zeit Christi scheint sie in Palästina eine populäre Anschauung gewesen zu sein.
„Wie häufig hören wir in den Talmuden der Pharisäer mit den Sadducäern über die Auferstehung streiten, aber über Seelenwanderung verlautet nichts, außer dass hie und da vorausgesetzt zu sein scheint, ein und derselbe Mensch könne zu verschiedenen Zeiten unter verschiedenen Namen und Verhältnissen in der diesseitigen Geschichte auftreten – eine Vorstellung, welche zur Zeit Jesu Volksaberglaube gewesen zu sein scheint.“[22]
Es wird ja in den Evangelien berichtet, dass die Juden vor dem Kommen Christi die Wiederkunft des Elias erwarteten. Und Christus bestätigte ihnen bekanntlich, dass Elias in Johannes dem Täufer wiedererschienen sei.
In diesem Sinne kann man die vorchristlichen Kulturen als die aufeinander folgenden Stufen des Inkarnationsprozesses der Menschheit sehen und verstehen. In der babylonischen Kulturepoche machte die menschliche Seele einen energischen Schritt vorwärts in der Durchdringung der Leiblichkeit. Sie musste damit aber das Vergessen eines Teiles ihrer früheren 'Weisheit' in Kauf nehmen.
„Die Menschheit schickte sich an, das finstere 'Tal des Todes' zu durchschreiten."[23]
Ägypten:
Keine der früheren Kulturepochen ist uns ihren Äußerlichkeiten nach so gut bekannt wie die ägyptische. Keine Inschrift, die wir nicht lesen könnten, kein Papyrus, dessen Inhalt uns verschlossen wäre, und doch können wir behaupten, den Ägypter wirklich zu verstehen?
Für den Ägypter ist der Tod nicht einfach das Ende des Lebens, sondern sein ganzes Leben
scheint durchdrungen und imprägniert mit dem Gedanken an den Tod. Und so auch die ganze Geschichte, zu deren Anfang die gewaltigen Pyramiden, nach kosmischen Gesetzmäßigkeiten aufgetürmt, stehen, damit der Pharao darin eine würdige Ruhestätte finde.
„Man fühlt: dem Erbauer kam es darauf an, dass der Leib in der ‚richtigen’, d. h. kosmisch ausgerichteten Umgebung ruhe, als dass dieser selbst erhalten bliebe. Eine durchaus spirituelle Gesinnung liegt dem Pyramidenbau zugrunde."[24]
Wie fasziniert ist der Blick des Ägypters auf den Tod gerichtet. Es ist seine erste Sorge, sobald er zu Vermögen gekommen ist, ein schönes Grab vorzubereiten. Er kann sich kein größeres Unglück vorstellen, als dass beim Eintritt des Todes sein standesgemäßes Grab nicht fertig wäre.
Es ist eigentlich ein erschreckender Gedanke, dass die Leichname der ca. 200 Millionen Menschen, deren Leben die dreieinhalb Jahrtausende der ägyptischen Kulturepoche erfüllte, Jahrhundert um Jahrhundert im Sande der Wüste oder in den engen Felsengräbern angehäuft werden, wie abgelegte Hüllen, die niemand mehr gebrauchen kann und auf deren Erhaltung der frühere Träger doch den größten Wert legte. Trotz einer starken Diesseits-Freudigkeit ist das gesamte Leben des Ägypters von einer Stimmung des "Immer bereit sein" durchzogen.
Aber nicht zu allen Zeiten hat man in Ägypten die Leichname mumifiziert. Im alten Reich wurde der Tote in hockender, später in liegender Stellung beigesetzt. Erst als die Pharaonen der 5. Dynastie anfingen, ihre Leichname einbalsamieren zu lassen, wurde dies auch von den Untertanen nachgeahmt. Nicht die äußere Erhaltung der Leiblichkeit war der Leitgedanke, sondern es sollte eine geistige Beziehung zwischen der Seele des Toten und seiner Leiblichkeit hergestellt werden.
„Auch der Sumerer zwar betrachtete den Leib als ein Werk des (geistig gedachten) Kosmos, als einen Mikrokosmos; aber der Leichnam und das Grab interessierten ihn nicht mehr, und vollends zu der Welt der Toten wollte er keine Beziehungen haben.[25]
Und weiter östlich – der Inder sah in der Leiblichkeit nur das Gefängnis der Seele, das sie hindert, die geistige Welt unverschleiert wahrzunehmen; sein Ziel konnte deswegen nur sein, sich ihren Fesseln möglichst schnell durch Yoga, d. h. Übung zu entringen. Sehr viel von dieser Stimmung ist heute noch in Indien, Tibet, China und in verwandelter Form in Japan
lebendig.“[26]
Durch die Einbalsamierung wurde dem alten Ägypter vor Augen geführt, dass der Leib etwas außerordentlich Wichtiges ist, seine Bedeutung über den Tod hinaus, ja bis in alle Ewigkeit hinein reicht. Es entstand so für den alten Ägypter das Problem, wie man der Seele nach dem Tod die Stütze der Leiblichkeit verschaffen kann, damit sie in der jenseitigen Welt sich bewegen, hören, denken, empfinden, mit einem Wort ‚Mensch’ bleiben kann. Und dies versuchte der Ägypter durch die Konservierung der Leiblichkeit zu lösen.
Es tritt hier zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte der unbändige Wille auf, das 'persönliche Bewusstsein', so wie es sich im diesseitigen Leben entwickelt hat, der Auslöschung durch den Tod zu entziehen.
„Der Assyrer hatte sich protestierend in dieses Schicksal ergeben; der Inder sah gerade in dem persönlichen Bewusstsein die Wurzel alles Übels und wollte deswegen das 'Selbst' auflösen, um in Brahman, der Weltseele, aufzugehen. Der Ägypter aber will dem Tode trotzen; er hofft durch einen Kunstgriff der Auflösung des Seelenlebens entgehen zu
können."[27]
Mag man diesen Versuch aus heutiger Sicht als töricht naiv ansehen, hat der Gedanke trotzdem etwas Grandioses an sich: durch menschliche Intelligenz den Tod gewissermaßen zu überlisten. Es entsteht erstmals der ‚Wille zur individuellen Unsterblichkeit’.
Nach Ansicht der Ägypter hatten die Götter selber ein Modell der Leiblichkeit geschaffen, einen kraftbegabten Geistesorganismus, mit Leben erfüllt, eine Lebenskraft, die die Ägypter "Ka" des Menschen nennen. Und, nach ägyptischer Anschauung, lebt der Mensch solange, als er "Herr eines Ka ist", "mit seinem Ka geht".
„Ein alter Mythos spricht davon, dass der Sonnengott Rê nicht einen, sondern 14 Ka's habe, deren Namen uns zwar hieroglyphisch überliefert sind, deren Bedeutung aber durchaus nicht einwandfrei entziffert zu sein scheint. Vergegenwärtigen wir uns aber die wichtigsten unter ihnen: 'Speise, Geschmack, Gedeihen (Mästung), frische Kraft, Stärke, Macht, Sehen, Hören, Erkennen, Lichtglanz, Herrlichkeit', so haben wir auf der einen Seite Beziehungen zum Ernährungsprozess, auf der anderen Seite Beziehungen zum Bewusstseinsprozess. Nach diesen beiden Seiten hin offenbart sich für den Ägypter das Wesen des Lichtes: in der Sonne ursächlich-kraftend, im Menschen nachbildlich-reflektierend."[28]
Kurz gesagt, nicht der Mensch ernährt sich, sondern die Sonne ernährt ihn.
Die Phantasie der 'Spießbürger' hat es noch zu allen Zeiten bis heute vorgezogen, sich die geistige Welt möglichst ähnlich der diesseitigen vorzustellen. Und so könnte man auch ein Bild des primitiven Jenseitsglaubens der Ägypter entwerfen, in dem von spiritueller Auffassung nicht mehr viel zu bemerken wäre. Eine Rückwirkung solcher vermaterialisierter Anschauungen auf die Seelenstimmung gegenüber dem Tod konnte allerdings kaum
ausbleiben, und es ist nicht verwunderlich, dass "Trinklieder" überliefert sind, in denen die Menschen angesichts der Unsicherheit, die über das Jenseits besteht, angehalten werden, das Diesseits unbekümmert zu genießen:
„Niemand kommt von dort,
dass er erzähle, wie es ihnen ergeht,
dass er erzähle, was sie bedürfen,
dass er unser Herz beruhige,
bis ihr dem Orte naht, zu dem sie gegangen sind…[29]
Sei noch fröhlicher,
Lass dein Herz nicht ermatten,
Folg deinem Herzen und deinem Vergnügen.
Verrichte deine Sache auf Erden
und quäle dein Herz nicht,
bis jener Tag des Wehgeschreis zu dir kommt.
Denn Osiris erhört ihr Schreien nicht,
Und die Klage rettet niemanden aus dem Grabe.
Darum: feire den frohen Tag
und werde sein nicht müde –
denn niemandem ist vergönnt,
seine Habe mit sich zu nehmen,
und keiner, der fortgegangen, ist zurückgekehrt!"[30]
Betrachten wir abschließend noch den Osiris-Mythos, auf den später noch genauer eingegangen wird.
Osiris ist gestorben, durch seinen Tod aber ist erst sein eigentliches Wesen offenbar geworden: er ist der König im Seelenreich, im "Reich der Westlichen". Vor ihm muss die Seele erscheinen, wenn sie die irdische Welt verlassen hat. Wenn sie dann die Begegnung mit dem Höllenhund überstanden hat, wenn durch die Prüfung der 42 Totenrichter alles Unreine aus ihr getilgt ist, dann wird im Angesicht des Osiris das Herz des Toten auf die Weltenwaage gelegt, und es wird offenbar werden, welches geistige Gewicht die Seele im Weltzusammenhang hat.
Die Eingeweihten der Ägypter rechneten mit der Wiederverkörperung der Seele in späteren
Zeiten, unter vielleicht ganz anderen äußeren und leiblichen Bedingungen. Und sie wollten offensichtlich durch die Einbalsamierung der Seele ein stärkeres Interesse an der Leiblichkeit einprägen, als sie es bis dahin gehabt hatte.
Dem Grundcharakter der ägyptischen Seelenverfassung erscheint es unmöglich, das geistige Ziel des Lebens schon im Diesseits zu erreichen; das Wesentlichste liegt für die 'ägyptische Seele' jenseits der Todespforte.
Griechenland:
Nichts ist dem griechischen Menschen so verhasst wie der Tod und die Tore des Hades. Und eben dieses geliebte Leben ist sicher dahin mit dem Tode, mag nun folgen, was will. Dessen ist sich der Grieche der damaligen Zeit sicher, auch wenn Eurioides meint:
"Wer weiß denn, ob das Leben nicht ein Sterben ist,
Und, was wir Sterben nennen, drunten Leben heißt?"[31]
Der Tote oder besser dessen ‚Psyche’ geht hinunter in das Reich des Hades. Wie aber stellt sich der Grieche die Psyche vor?
„Ihr Name bezeichnet sie, wie sie in den Sprachen vieler anderer Völker die Benennung der ‚Seele’, als ein Luftartiges, Hauchartiges, im Atem der Lebenden sich Kundgebendes. Sie entweicht aus dem Munde, wohl auch aus der klaffenden Wunde des Sterbenden – und nun wird sie, frei geworden, auch wohl genannt ‚Abbild’ (Eidolon).
Der Mensch ist nach homerischer Auffassung zweimal da, in seiner wahrnehmbaren Erscheinung und in seinem unsichtbaren Abbild, welches frei wird erst im Tode. Dies und nichts anderes ist seine Psyche."[32]
Die Psyche ist also, wenn sie den Leib verlassen hat, besinnungslos, denn sie ist ebenso wenig wie der Leichnam Bergerin des Geistes.
Die Ähnlichkeit des Begriffes ‚Psyche’ mit dem, was der Ägypter ‚Ka’ nannte, ist kaum zu übersehen. Bloß, der Ka ist mikrokosmischer Natur. Der Begriff der ‚Psyche’ dagegen entstammt dem Atmungserlebnis, mit dem der Grieche sein Seelenleben verbunden fühlt; er gehört deswegen dem Mikrokosmos an. Und auch die Gedanken werden zu homerischer Zeit (also etwa im 9. Jh. v. Chr.) nicht in Verbindung mit dem Gehirn erlebt, sondern ‚im Herzen und im Zwerchfell’.
In der Frühzeit aber hat der Begriff der ‚Psyche’ durchaus noch eine bildhafte Nuance. Die Psyche des Sterbenden wird sichtbar, wird zum „Eidolon“, das 3 Jahrtausende später Rudolf Steiner als ‚Ätherleib’ bezeichnet, und bleibt dem Blick der Irdischen auf kurze Zeit – oft wohl nur einige Tage – erreichbar. Während dieser Zeit versucht nun der Grieche, mit dem Toten durch einen Kult in Beziehung zu treten, wie uns die Schilderungen Homers beweisen.
Die ganze griechisch-römische Kultur ist ihrem inneren Wesen nach aus den ‚architektonisch-plastischen’ Kräften der menschlichen Organisation entstanden. Und auch was wir als griechische Philosophie bezeichnen und ansehen, hat im Grunde genommen diesen Ursprung, diese Wurzeln. Die Naturphilosophen, von Pherekydes (6. Jh. v. Chr.) angefangen, erleben noch die starke Verbundenheit der menschlichen Kräfte mit denen der äußeren Elemente. Deswegen:
„Wie sich in ihnen die Elemente mischen, so philosophieren sie! Naturphilosophie ist Philosophie aus dem Temperament – d. i. Mischung der Elemente – heraus."[33]
Und so erscheint dem Thales die Welt aus seinem phlegmatischen – wässerigen – Temperament heraus begreiflich, dem cholerischen Heraklit aber aus dem Feuer. Bei Plato
jedoch sind die plastischen Kräfte schon so tief in die Leiblichkeit eingetaucht, dass er ihr Plastizieren nicht mehr als Relief, sondern nur noch als Schattenbild empfindet.
Er weiß aber, dass diesem Schattenbild einmal ein leuchtendes entsprach, das jedoch vor der Geburt erlebt wurde, noch in der geistigen Präexistenz.
„Wie die untergehende Sonne oft noch am östlichen Himmel sich spiegelt, so erscheint die Gedankenwelt des Plato."[34]
Aristoteles aber erhebt sich nach 'Sonnenuntergang' und beleuchtet die Dinge mit dem Strahl des eigenen Denkens, denn es ist dunkel geworden. Und nun entdeckt er so die Architektur der Gedankenwelt und nennt sie Logik.
„Die Philosophie erhebt sich als der Vogel Phönix aus dem Grabe der Sphinx."[35]
So entschwand dem Blick des Griechen das Gebiet der Totenwelt nach und nach völlig. Mit Recht bezeichnet er es darum als ‚Aides’, ‚Hades’, d.h. das Unsichtbare. Und der Grieche liebt – wie schon erwähnt – die sichtbare Welt umso mehr, je mehr die jenseitige in der Dunkelheit verschwindet. Der Tod erscheint ihm ergo als der Beginn hoffnungsloser Öde.
Heraklit hat die Vergänglichkeit aller natürlichen Dinge durchschaut, und auch das menschliche Leben in seinen verschiedenen Gestaltungen ist ihm nur Schein, hinter dem sich das bleibende Ewige verbirgt:
„Dasselbe ist Leben und Tod, Wachen und Schlafen, jung und alt; dieses sich ändernd ist jenes, jenes wieder dies."[36]
Wie der neue Zustand immer den Tod des alten bedeuten muss, so wird durch den Tod des irdischen das Dasein des ewigen Lebens offenbar:
„Leben und Tod ist in unserem Leben ebenso wie in unserem Sterben."[37]
„Von Persönlichkeit zu Persönlichkeit vermag er sich zu wandeln. Der große Gedanke der Wiederverkörperung springt wie etwas Selbstverständliches aus den Heraklitischen Voraussetzungen."[38]
Sokrates dagegen ist der erste, der empfindet und meint, wenn Philosophieren im Grunde nichts anderes heißt als sich frei machen wollen von dem Schein der Sinnenwelt, dann müssen ja diejenigen,
„die sich auf rechte Art mit Philosophie befassen, ohne dass es freilich die anderen merken, nach gar nichts anderem streben, als zu sterben und tot zu sein.“
Er ist der erste, der die immanente Bedeutung des Todes für alles Philosophieren durchschaut, der erkennt: der Tod hat für die Seele die Bedeutung eines Fermentes, das aus ihrem vergänglichen Sein das Bewusstsein von Ewigen hervorgehen lässt. Und so muss er sich – beschwert von einer plumpen Körperlichkeit – Schritt für Schritt den Weg zu den Grundwahrheiten der Philosophie bahnen. Aber er hat mit seinem Tode der Philosophie die Weihe der Mysterien verliehen.
„Er ist gestorben, wie nur ein Eingeweihter sterben kann. ein Strahl des Osiris war wohl einst in seine Seele gefahren. Und das Horuskind in seinem Herzen lächelte, als der Diener den Schierlingsbecher reichte.“[39]
Von den Mysterien und der Schule des Pythagoras ging auch die Lehre von der Wiederkehr der Seele in wiederholten Erdenleben aus, und von dort übernahm sie dann Plato.
„Die Idee des ewigen Lebens schien selber zu Grabe getragen zu sein – oder sie wurde ins 'Jenseits' verbannt. Bis sie nach zweitausend Jahren in den Denkern des Abendlandes ihre Auferstehung feierte."[40]
Beginn der Neuzeit:
Von Platos Zeiten bis ins 14. Jahrhundert hinein haben die Menschen beim Denken nicht das Erlebnis subjektiver Tätigkeit, sondern die Empfindung: ich nehme teil an der Gedankenwelt. Der Mensch dieser Zeit denkt nicht, er nimmt Gedanken wahr.
Doch in den Tiefen der Seele kündigt sich bereits ein neuer Umschwung an. Die Künstler fühlen es zuerst und finden sofort den richtigen und endgültigen Ausdruck dafür: vom 14. Jahrhundert an stellen sie den Tod als 'Skelett' dar. Vorher diente ihnen dazu das Bild eines geschrumpften Leichnams, dann wird daraus ein entfleischtes Gerippe, dem man Sense und Stundenglas beigibt, in Anlehnung an die Offenbarung Johannes. Eine tiefgehende Wandlung ist mit der menschlichen Seele vor sich gegangen. Statt der lebendigen Imagination des Todes, wie sie der Grieche noch kannte, bleibt das tote Gerippe.
Die Menschen der früheren Kulturen durchdringen mit ihrem geistig-seelischen Wesen den Leib noch nicht völlig. Sie erleben ihn meist nur durch die Atmung; der Inder beispielsweise bezeichnet sein höchstes geistiges Sein mit ‚Atma’. Und noch der Grieche erlebt sich im Leibe eigentlich nur durch den Rhythmus von Puls und Atmung, in ‚Herz und Zwerchfell’.
„Erst zu Beginn unseres Zeitalters dringt die Seele bis zum inneren Erleben des Knochensystems vor, bis dahin, wo der Lebensprozess in der Ausscheidung des Kalkes sich selber ein Ende setzt. Das gibt ihr Sinn und Verständnis für das Materielle: das verleiht ihr die Fähigkeit und den Trieb, auch in der Außenwelt das Tote anzuschauen und zu verstehen. Und Verständnis für das Tote zu haben, ist ja das eigentlich Charakteristische an der Naturwissenschaft, die mit Messen, Zählen und Wägen an die Naturerscheinungen herantritt. Ihr Aufblühen beruht auf dem Grunderlebnis des neuen Zeitalters: dem inneren Ertasten des Knochensystems."[41]
Es ist aber – wie schon hingewiesen – ein Gesetz aller Entwicklung, dass neue Fähigkeiten erworben werden können, wenn dafür alte verschwinden. So musste in dem Maße, als die sinnliche Wahrnehmungswelt erobert wurde, das alte Hellsehen zurücktreten. Ebenso hat diese stärkere Durchdringung der Leiblichkeit bis zum ‚inneren Ertasten des Knochensystems’ zur Folge, dass die Sinnestätigkeit viel von ihrer früheren Lebendigkeit einbüßt, dass sie gewissermaßen erstarrt.
Voraussetzung für Wahrnehmung und Erleben des ‚Lebensprozesses’ würde sein, dass der Mensch die Lebensvorgänge des eigenen Organismus ebenso stark wahrnimmt wie die Vorgänge, die in der Außenwelt der Sinneswahrnehmung zugrunde liegen.
„Das traf nun nach Rudolf Steiners Darstellung für die Menschheit bis zur griechischen Kulturepoche – in ständig abnehmendem Maße – zu, weil die Seele sich immer intensiver mit der Leiblichkeit verband. Der Grieche der Frühzeit lebte noch sehr stark den Wahrnehmungsprozess mit; der Dürer aber empfindet, wenn er in die Welt hinaussieht, eine starre Perspektive. Und der perspektivische Fluchtpunkt ist im Grunde genommen das hinaus projizierte Bild des sich im Leibe erlebenden Ich."[42]
Durch das Bewusstsein vom Ich aber entsteht die Möglichkeit, dass das Wissen in den Bereich des Egoismus hineingezogen wird.
Der Mensch des neuen Zeitalters legt nun selber in sein Geistes-Schicksal den Keim des Todes hinein. Aus dem Empfinden dieses Lebenswiderspruches entsteht die Gestalt des 'Faust', der ein Skelett in seinem Studierzimmer beherbergt und der, weil er ein ehrlicher und mutiger Denker sein will, eines Tages zur Giftschale greifen muss. Der Selbstmord scheint metaphysisch notwendig geworden zu sein.
„Wenn Hans Holbein und andere Künstler dieser Zeit den 'Knochenmann' als den ständigen Begleiter des Menschen in allen Lebensaltern darstellen, so liegt darin mehr als eine 'Kapuzinerpredigt'; es will vielmehr bedeuten: Der Tod ist ja gar nicht ein Ereignis, das uns erst am Ende unseres Lebens trifft, sondern eigentlich tragen wir ihn schon das ganze Leben hindurch in uns – man braucht nur ein wenig auf die Beweglichkeit des Knochensystems zu achten, und man spürt ihn tanzen.
Der Mensch der homerischen Zeit unterschied noch Thanatos, den natürlichen Tod im Alter,
und Ker, den vorzeitigen, schicksalsmäßig bedingten Tod. Der mittelalterliche Mensch, der die Totentänze malt, empfindet den Tod als Lebenseinschlag mit seinem innersten Wesen verbunden; er spürt ihn wie eine schwarze Faser, ohne die der Lebensfaden nicht halten würde, und die eben doch das Leben zum 'Totentanz' macht."[43]
Die Menschen fangen also offensichtlich an, den Tod auf allen Gassen zu spüren, am intensivsten offenbar in den Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kunst.
Das ‚moderne’ Ich hat den Tod endgültig in sich aufgenommen. Es versucht gleichzeitig ihn durch Philosophie, Dramatik und Humor zu überwinden.
Im Zeitalter der Naturwissenschaft ist das Wesen des Lebens das Lebendigsein und das Wesen des Toten das Todsein. Will man das Wesen des Todes verstehen, so muss man zuerst begriffen haben, was das Leben ist.
b) Geschichte des Todes anhand von Dokumenten:
„Der heutige Mensch ist in der Regel zufrieden, wenn er sein Leben innerhalb der Grenzen von Geburt und Tod begreift. Die naheliegenden Fragen: Was war vorher? Was wird nachher sein? tauchen zwar auf, werden aber im Allgemeinen entweder als unbeantwortbar verdrängt oder nur oberflächlich beantwortet. Entweder weist man darauf hin, dass schließlich niemand wissen könne, was vor der Geburt gewesen sei und nach dem Tode sein wird, oder man spricht von den natürlichen Gegebenheiten, vor der Geburt seien die Eltern gewesen, und nach dem Tode werde die Verwesung des Leibes eintreten. Zudem vermutet man, dass alle anderen Aussagen sowieso nur Wunschphantasien seien, mit deren Hilfe der Mensch gegenüber der Unsterblichkeit des Todes Trost suche."[44]
An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass in den Ideen über das Leben nach dem Tod allzu leicht der Wunsch zum Vater des Gedankens werden kann.
Wie bereits unter Punkt bzw. Kapitel 2. a) erwähnt und erläutert, hat es zu allen Zeiten Menschen auf der Erde gegeben, welchen die übersinnliche Welt scheinbar nicht verschlossen war. Aus eigener Erfahrung haben sie ihre Erkenntnisse all denen mitgeteilt, die zur Aufnahme bereit waren. Man nannte diese die "Eingeweihten"; die großen Religionsstifter beispielsweise sind ihnen zuzurechnen. Für sie und ihre Anhänger, für die Inder, Ägypter, Griechen, Juden, und Christen war das Leben nach dem Tod unbezweifelbare Realität, die in ihren Vorstellungen jedoch voneinander abweicht.
Auch dieses Kapitel – wie all die anderen – kann nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Das Ägyptische Totenbuch
Über die Vorstellungen der Ägypter vom Leben und vom Totenreich wurde im vorgegangenen Teil dieser Arbeit bereits genauer referiert. Hier wird nur mehr auf das so genannte 'Ägyptische Totenbuch' näher eingegangen.
Der Name ‚Ägyptisches Totenbuch’ ist insofern missverständlich, als es im alten Ägypten (also ca. 2700 – 950 v. Chr.) niemals ein Buch gegeben hat, das die Totenkunde der Ägypter enthalten hätte. Und dennoch ist uns die Totenkunde der Ägypter detailliert erhalten. Seit der 11. Dynastie (Anfang 2. Jahrtausend v. Chr.) war es üblich geworden, dem Leichnam religiöse Texte mitzugeben. Zunächst erscheinen sie als Inschriften auf den Sarkophagwänden, später auf Papyrusrollen, die man in den Sarg legte. Dem Inhalt nach sind es ursprünglich Sprüche und Gebete, die dem Verstorbenen beim Leben im Totenreich behilflich sein sollten.
Die Zusammenstellung all dieser Texte zu einem Totenbuch verdanken wir schließlich dem Fleiß der Ägyptologen, wie Richard Lepsius (1810 – 1884), der dieser reichhaltigen Sammlung den seither üblichen Namen ‚Ägyptisches Totenbuch’ gab.
Den Schlüssel zum Verständnis der ägyptischen Totenkunde bildet der Osiris-Isis-Mythos, auf den aber hier nicht genauer eingegangen wird. Es sei hier nur noch erwähnt, dass neben den vielen Hinweisen in den Sargtexten auf Osiris und sein jenseitiges Reich als dem hohen Ziel aller Verstorbenen Plutarch (etwa 46 – 125 n. Chr.) in seiner Schrift „Über Isis und Osiris“ Kenntnis und Erkenntnis über dieses zentrale Thema ägyptischer Religion und Totenkunde vermittelt.
Im ‚Ägyptischen ‚Totenbuch’ wird ein wesentlicher Teil des Lebens der Verstorbenen mit dem geheimnisvollen Wort 'Ka' – schon im vorigen Kapitel erwähnt – umschrieben:
„Wir haben heute keinen Begriff, den wir mit ‚Ka’ gleichsetzen könnten. Am ehesten lässt sich dafür vielleicht das Wort 'Entelechie' verwenden, wenn wir darunter die unvergängliche Geistergestalt des Menschen verstehen, die den irdischen Leib schon zu Lebzeiten als ein gefügtes und fügendes Lebenskraftfeld durchdringt. Für den Ägypter war Ka nicht irgendeine Abstraktion im Sinne eines 'Vitalprinzips', sondern ebenso konkret gegeben und vorhanden wie der physisch-materielle Leib."[45]
Der Weg jedes Verstorbenen im Totenreich wird nach dem ‚Ägyptischen Totenbuch’ durch drei Phasen bestimmt: das Gericht, die Läuterung und die Erleuchtung. Strenge des Gesetzes, Unbestechlichkeit des göttlichen Hüters und Hoffnung auf die Durchdringung mit der unsterblichen Kraft von Osiris sind die wesentlichen Bestandteile der ägyptischen Totenkunde.
„Ich war verborgen, verscharrt und begraben; Und doch bin ich vorgedrungen zum Ausgangstor. Durchstreift habe ich Wüsten, da nichts wächst. Habe meine Nacktheit mit Kleidern bedeckt, die ich dort fand.
Die Gerechtigkeitswaage, fürwahr, ist zu suchen in unseren Herzen."[46]
Solange das Ich des Menschen noch unentwickelt war, lag das Ziel individueller Unsterblichkeit noch nicht im Blickfeld des Menschen. Aufzugehen in der Gottheit wie ein
Tropfen Wasser im Meer, das war die Sehnsucht der alten Inder bis hin zu dem Nirwana des
Buddha. Die Mission der Ägypter scheint es gewesen zu sein, durch verstärktes Interesse an den irdischen Vorgängen das Zukunftsideal der in sich geschlossenen Persönlichkeit gepflegt zu haben, also den Willen zur Erhaltung des auf Erden erworbenen Persönlichkeitsbewusstseins im nachtodlichen Dasein.
„Ich bin und ich lebe…!
Einsam, allein bin ich
Einsamer Wanderer
Des Himmels Weiten durchwandere ich…“
Und mit einer Wendung zur Erde spricht der Tote weiter:
"Nun öffne ich die Pforten des Himmels
Und sende Geburten zur Erde.
Und das künftige Kind, noch nicht geboren,
Auf seinem Pfade zur Erden
Ist vor Angriff geschützt."[47]
Anhand dieser Textstelle wird deutlich, dass der Ägypter seinen Unsterblichkeitsglauben in Einklang wusste mit dem Wiederverkörperungsgeschehen. Seelen, die auf Erden an sich gearbeitet haben – "Denn ich habe mich selber geformt und gemeißelt" -, vermögen den Übergang zu finden von der nachtodlichen zur vorgeburtlichen Existenz.
Dementsprechend beginnt das 64. Kapitel des 'Totenbuches', "Vom Heraustreten der Seele in das Tageslicht", mit den folgenden Worten:
„Ich bin das heute.
Ich bin das Gestern.
Ich bin das Morgen.
Meine wiederholten Geburten durchschreitend
Bleibe ich kraftvoll und jung."[48]
Erst im Licht der Wiederverkörperung wird dem Menschen der Gegenwart der Mumienkultus und das ‚Ägyptische Totenbuch’ zumindest teilweise gedanklich nachvollziehbar.
Der Herakles-Pfad:
An der Wende von der vorhistorischen Zeit zu der nach Jahrhunderten und Jahrzehnten bestimmbaren Geschichte Griechenlands stehen zwei überragende Heldengestalten: Theseus und Herakles. Nach dem Mythos mussten sich beide auf Kreta einer schweren Aufgabe stellen:
„Theseus tötete den Minotaurus und erlöste damit Athen von der schmählichen jährlichen Tributpflicht, dem Opfer von sieben Jünglingen und sieben Jungfrauen, sodass sich Athen als freies griechisches Zentrum in selbstständiger Geistigkeit entwickeln konnte. Herakles tötete den Stier nicht, sondern fängt ihn und bringt ihn lebend nach Mykenä zu König Eurystheus,
seinem Auftraggeber.“[49]
Hier ist der Sinn des Mythos ziemlich deutlich zu erkennen. Theseus und Herakles müssen sich zuerst mit dem "Stiergeist" der vorangehenden ägyptischen Kulturepoche auseinandersetzen, ehe in Mykenä und Athen eine neue Kulturperiode ihre Eigenständigkeit ausbilden kann. Da Mythen nicht in den Dimensionen von Raum und Zeit spielen, in denen wir mit unserem Gegenwartsbewusstsein verankert sind, und da ihre Aussagen folglich nicht in begrifflicher, sondern in bildhafter Form geschehen, müssen sie entsprechend gelesen, gesehen und entschlüsselt werden.
So lassen sich die zwölf Taten des Herakles als Vorbereitungen deuten, durch die der Einzuweihende reif und fähig wurde, ein Bewusstsein von der übersinnlichen Welt zu erlangen. Das heißt, der Herakles-Mythos mit seinen zwölf Stufen behandelt das schon bei der Beschreibung des ‚Ägyptischen Totenbuches’ aufgetauchte Thema der Läuterung. Im Folgenden soll nun kurz der Weg beschrieben werden, den der Schüler des 'Herakles-Pfades' zum Ziel der Einweihung zu gehen hatte. Der Name 'Herakles' wurde niemals als bürgerlicher Name von einer Individualität, deren Geburts- und Todesdatum hätte angegeben werden können, getragen, sondern ist der symbolische Name für einen Schüler der Göttin Hera.
Eine erste Entscheidung fiel schon nach der Geburt. Die beiden Göttinnen Athene und Hera streiten sich um das Neugeborene. Und von da an – nach diesem Streit – begleitet Herakles lebenslang die Liebe der göttlichen Weisheit (Athene), und die Tatsache, dass er, wenn auch nur wenige Tropfen des Eigenwillens (Hera) mit der unsterblichen Göttermilch getrunken hat, kennzeichnet seinen Weg.
Die zweite Entscheidung, das Ringen der noch verborgenen Individualität (Herakles) mit den von den Eltern vermittelten Vererbungskräften (Schlangen) fällt zu Gunsten der 'Ichheit'.
Die dritte Entscheidung – wahrscheinlich eine spätere Ergänzung der Sage – ist am bekanntesten geworden. Es ist die des „Herakles am Scheidewege“.
„Hier hat sich der Mythos selbst entmythologisiert und ist zu einer Allegorie geworden. Als der Jüngling Herakles in einsamer Gegend überlegt, welche Lebensbahn er wählen soll, begegnen ihm zwei Frauen, die eine tugendsam, die andere herausfordernd kokett und liederlich. Man weiß: Herakles wird den Weg der Tugend wählen. So simpel diese moralische Darstellung uns heute auch anmuten mag, erhält sie doch die klare Forderung: Nur einer geläuterten Seele öffnet sich der Weg in die höheren Welten."[50]
Nach dieser dritten und letzten Entscheidung kann Herakles nun endlich den eigenen ‚Pfad’ betreten, der in der Lösung der zwölf ihm gestellten Aufgaben besteht. Diese zwölf Taten sind:
1. Besiegung des Löwen zu Nemea und die Gewinnung seines Felles;
2. Erlegung der neunköpfigen Hydra im Sumpf von Lerna;
3. Einfangen der Hirschkuh Kerynitis in den Bergen Arkadiens;
4. Bändigung des Ebers vom Erymanthos-Gebirge;
5. Reinigung des Augiasstalles zu Elis;
6. Jagd auf die Stymphaliden, Raubvögel vom Stymphalos-See;
7. Bändigung eines Stiers auf Kreta;
8. Bändigung der Stuten des Thrakiers Diomedes;
9. Gewinnung des Wehrgehänges der Amazone Hippolyta in Pontos am Schwarzen Meer;
10. Kampf mit dem Riesen Geryones in Spanien und dessen Rinder;
11. die Äpfel der Hesperiden;
12. der Gang in die Unterwelt (Totenreich).
Das Ziel aller vorchristlichen Einweihung war die Fähigkeit, Zugang zum Jenseits, zum Hades, zur Unterwelt zu gewinnen. Dem galten all die Mutproben, Überwindungen und Kraftbeweise. Für den Mensch der griechischen Frühzeit war die Welt noch nicht annähernd
so in ein ‚Innen’ und ‚Außen’ zerfallen wie für uns Heutige. Die Zähmung und Bändigung der 'Tierheit' wurde als die große Aufgabe auf dem Weg zum Menschen erlebt. Wer dem 'Tier in sich' nicht gewachsen ist, wird an der Schwelle zum Totenreich scheitern. Wer dem Tier unterliegt, bleibt in der Sterblichkeit gefangen. Wer es aber besiegt, dem öffnet sich der Weg zum Unsterblichen. In diesem Sinne ist der ‚Pfad des Herakles’ die mythische Darstellung eines Schulungsweges, an dessen Ende die Einweihung in die Todesmysterien erfolgt. Die ersten zehn Aufgaben sind Stufen der ‚Läuterung’, mit der elften beginnt die ‚Erleuchtung’.
Am Ende nun steigt Herakles bei der Stadt Tänaros, wo sich die Mündung der Unterwelt befand, von Hermes, dem Begleiter der Seelen, geleitet, in die Unterwelt hinab. Einzig mit dem Brustharnisch bedeckt (einem Geschenk Athenes) und mit dem Löwenfell bekleidet, findet Herakles an der Mündung der Acheron den Zerberus. Mit nackten Armen – denn irdische Waffen gelten hier nicht – ergreift er das Ungeheuer und schnürt ihm so lange den Hals ein, bis dem Höllenhund die Luft ausgeht. Auf diese Weise schafft er ihn an die Oberwelt und hat so das Ziel des Herakles-Pfades erreicht. Der Sieger bringt auf die Erde und für die auf ihr Lebenden die Kunde vom Totenreich. Was gewöhnlich sterblichen versagt ist, hat Herakles durch seine geistige Muttat mit Hilfe der Götter für seine Mitmenschen erobert: das Bewusstsein vom Schattenreich der Verstorbenen. Das und nichts anderes ist der Sinn des Herakles-Mythos.
Der Hades des Homer:
Zu den klassischen Dokumenten der Totenkunde gehört Homers „Odyssee“. In diesem großartigen Werk, über das im vorigen Kapitel bereits gesprochen wurde, wird uns gezeigt, dass die 'Eingeweihten' der Griechen wussten, dass die einseitige Hinwendung zur Schönheit und zum Reichtum der Welt von Raum und Zeit mit dem Verlust an Ewigkeitserfahrung bezahlt werden musste.
Auf den Inhalt dieses epochalen Werkes soll hier nicht genauer eingegangen werden, doch sollen wenige Zitate daraus die Vorstellungen vom Sinn des Todes der damaligen Zeit in Griechenland aufzeigen. So erhält beispielsweise Odysseus in geradezu nüchternen Worten im Kapitel XI folgende Belehrung:
„Sondern dies ist das Los der Menschen, wann sie gestorben. Denn nicht Fleisch und Gehirn wird mehr durch Nerven verbunden, sondern die große Gewalt der brennenden Flammen verzehret alles, sobald der Geist die weißen Gebeine verlassen, und die Seele entfliegt wie ein Traum zu den Schatten der Tiefe."[51]
In diesen Zeilen ist die Quintessenz der Totenkunde Homers enthalten: Sterben bedeutet die HHHhhhKDFMK hERGHHTrennung von Geist, Seele und Leib. Der Leib wird aufgelöst, sei es durch Verwesung oder Verbrennung. Der Geist kehrt in den Weltengeist zurück. Die Seele aber, der subjektive Persönlichkeitskern des Menschen, steigt nicht empor zu den Göttern, sondern hinab in die Unterwelt und erlebt sich wie ein träumender Schatten.
„Edler Laertiad', erfindungsreicher Odysseus,
Welch noch größere Tat, Unglücklicher, wagest du jetzt?
Welche Kühnheit herab in die Tiefe zu steigen,
wo Tote nichtig und sinnlos wohnen, die Schatten gestorbener Menschen!"[52]
‚Nichtig und sinnlos’ – so empfindet der griechische Mensch des Homerischen Zeitalters für die Mehrzahl der Verstorbenen das Dasein nach dem Tode. Offen und rückhaltlos wird es ausgesprochen. Odysseus sucht den Achilleus zu trösten, doch dieser entgegnet:
„Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, ruhmvoller Odysseus. Lieber möcht' ich fürwahr den unbegüterten Meier, der nur kümmerlich lebt, als Taglöhner das Feld baun, als die ganze Schar vermoderter Toten beherrschen.“[53]
Es gibt zu denken, dass Jahrhunderte hindurch die Totenkunde der Griechen von diesem Pessimismus erfüllt war, während die christliche Totenkunde über ein Jahrtausend hindurch wesentlich unter dem umgekehrten Vorzeichen stand: Nach dem erbärmlichen Leben im Jammertal der Erde folgt nach dem Tode der beseligende Zustand der Erlösten im Himmel. Aber darüber später.
Das Alte Testament – Die Tötenbeschwörerin in Endor:
Wer im alten Testament nach Zeugnissen über das Totenreich sucht, wird zunächst enttäuscht. Erstaunlich wenig ist von einem Leben nach dem Tod die Rede. Frömmigkeit und Religion der Israeliten waren dem Volk und der Erde zugewandt:
„Ihr Gott war der Gott ihres Volkes, der Blutgemeinschaft und des heiligen Bodens, der er seinen auserwählten Völkern zugesprochen hatte. Durch den Tod gehen bedeutete für den Juden: wieder zu den Vätern versammelt werden. Hingegen bedeutete die Geburt eines Sohnes, durch den die Ahnenreihe auf Erden fortgesetzt wurde, den Höhepunkt der Existenz als Vater."[54]
Wir erfahren im AT (Alten Testament) auch nichts über eine individuelle Unsterblichkeit, die Jahwe seinen Erdenkindern versprochen hatte, sondern stets geht es um das Schicksal der Nachkommenschaft.
Eindrucksvoll wird der Tod der Stammväter und Volksführer geschildert. Wir erhielten Kunde vom Sterben und Todesaugenblick des Abraham, Isaak, Jakob, Moses, Saul, David und Salomo. Doch nie wird dabei die Frage von Weiterleben nach dem Tod berührt, stets geht es um Segen oder Unheil der nachfolgenden Generationen auf Erden. Man könnte beinahe vermuten und glauben, dass der heute so populäre Satz „Wir leben doch nur in unseren Kindern weiter“ seinen Ursprung im alten Israel habe.
Dennoch wäre der Schluss, dass das Volk des AT nur die diesseitige Welt gekannt hätte, unberechtigt. Das Gegenteil ist der Fall. Das Reich Gottes wurde stets sinnlich und übersinnlich zugleich gedacht und auch erlebt.
Die persönliche Unsterblichkeit wird im AT zwar nirgends proklamiert, wohl aber stillschweigend vorausgesetzt. Ein besonderes Interesse für das individuelle Leben im Totenreich wird gar nicht gefordert. Umso seltsamer wirkt daher die dramatische Szene zu Endor, wo König Saul verzweifelt kurz vor seinem Tod bei einer als 'Hexe' verschrienen Totenbeschwörerin sich Rat zu holen versucht (I. Samuel, 28). Auf den genauen Text kann aus Platzgründen hier nicht eingegangen werden, doch sei kurz erwähnt, dass an bezeichneter Stelle im AT Saul mit Hilfe eines Mediums – der Totenbeschwörerin – versucht, Samuel aus dem Totenreich zu holen bzw. mit ihm in Verbindung zu treten, was auch gelingt. Dabei weissagt ihm dieser: „Morgen wirst du und deine Söhne mit mir sein (das heißt im Totenreich).“ (I. Sam. 28/19).
Die Schilderung der angegebenen Stelle enthält alle Elemente einer spiritistischen Erkundigung durch ein Medium. Saul stellt die Fragen, die Frau zu Endor erkennt in Trance Saul trotz seiner Verkleidung als König, "zitiert" den Geist Samuels, dieser gibt durch ihren Mund die Antworten. Diese bewirken bei Saul durch ihre Trostlosigkeit einen tiefen Schock, von dem er sich nur durch Annahme von Speise und Trank mit Mühe wieder erholt.
Am Tag darauf kommt es zu dem von Samuel vorausgesagten erbitterten Kampf mit den Philistern, bei dem drei Söhne Sauls fallen und sich dieser selbst – in Erkenntnis der Ausweglosigkeit seiner Lage – ins Schwert fallen lässt.
Sauls Regierungszeit wird im Allgemeinen auf die Jahre 1032 – 1012 v. Chr. datiert. Die Befragung des Mediums in Endor geschah also, bevor die Pythia zu Delphi zu Weltruhm gelangte.
Zum Abschluss dieses Kapitels sei kommentarlos eine der wenigen Stellen zitiert, in dem im AT über den Tod und das Sterben referiert wird:
„Das ist das Schlimme an allem, was unter der Sonne getan wird, dass alle ein und dasselbe Geschick trifft. Außerdem wächst in den Menschen die Lust zum Bösen, und Verblendung erfasst ihren Geist, solange sie leben. Und danach müssen sie zu den Toten. Wer unter die Lebenden eingereiht ist, der kann noch Zuversicht haben. In der Tat, ein lebender Hund ist immer noch besser als ein toter Löwe. Die Lebenden erkennen wenigstens, dass sie
sterben werden. Die Toten aber erkennen überhaupt nichts mehr. Sie erhalten auch keine
Belohnung mehr, denn die Erinnerung an sie ist in der Vergessenheit versunken. Liebe, Hass und Eifersucht gegen sie, all dies ist längst erloschen. Für alle Zeit ist ihnen ihr Anteil genommen an allem, was unter der Sonne getan wird." (Pred. 9/3 – 6)
Die Pythia zu Delphi und die Mysterien des Orpheus:
Wenige Stätten auf Erden haben ihre geistige Anziehungskraft durch Jahrtausende so bewahrt wie das Apollo-Heiligtum zu Delphi. Als Ort eines sakralen Kultus war Delphi schon im 2. Jahrtausend v. Chr. bekannt. Seinen Weltruhm als Orakel der Griechen erlangte es bereits in der Homerischen Zeit (ca. 8. Jahrhundert v. Chr.) und erlebte eine erneute Blüte im 5. Jh. v. Chr. Sein Einfluss auf Religion, Moral und Politik der griechischen Stämme war bedeutend.
In seiner Art ein einmaliges Phänomen öffentlicher Lenkung von Staatsgeschicken mit Hilfe
esoterischer Quellen. So dunkel und trübe die Begegnung des jüdischen König Saul mit der Totenbeschwörerin zu Endor war, so hell und leuchtend erscheint die Gestalt der Pythia im Apollo-Heiligtum zu Delphi im Licht der Geschichte. Dabei handelt es sich sowohl in Endor wie in Delphi um den gleichen Vorgang, um die Befragung jenseitiger Mächte über zukünftiges Schicksal durch ein Medium.
Man wusste in der Antike, dass beim Übergang vom Diesseits zum Jenseits durch Egoismus Gefahr droht, für den Ratsuchenden wie für die Pythia und für ihren Deuter. Unerlaubte Neugier und Sensationslust waren ebenso verpönt wie Machstreben. Durch ein korruptes Medium kann nur Korruption wirksam werden. Auch hier gilt das Gesetz: Erleuchtung im Geiste verlangt zuvor Läuterung der Seele, sonst müssen die Götter schweigen.
Einer wesentlich anderen Welt als zu Delphi begegnen wir in dem Mysterien, in welcher Orpheus, ein Sohn des Apollo, gesucht und verehrt wurde. Obwohl zahlreiche Zeugnisse über den orphischen Kultus trotz seines Mysteriencharakters erhalten sind, bleibt das Bild über seine Wesensart und Ausbreitung unvollständig.
„Orphik, so können wir mit Olof Gigon sagen, ist eine nur in Spuren fassbare Lehre vom Schicksal der Seele und von den Mitteln, durch geziemenden Lebenswandel eine jenseitige Seligkeit zu erlangen. Die Verbindung mit dem Jenseits aber suchten die Orphiker
nicht wie in Delphi mit Hilfe eines einzelnen Mediums."[55]
Orpheus dringt durch sein Leierspiel in die Totenwelt bis zum Thron Plutons vor, um seine verstorbene Gattin Eurydike zurückzuholen. Durch seinen Gesang erhält er die Erlaubnis, dass Eurydike mit ihm ins Tageslicht zurückkehren darf, wenn er sich auf dem Heimweg durch den Hades nicht nach ihr umblicke. Orpheus besteht die Probe nicht und Eurydike ist ihm deshalb auf immer verloren. Das ‚Ewigweibliche’ bleibt im Jenseits ‚drüben’, der männliche Teil der Seele wird dem Licht wiedergeschenkt. Dieser aber ist den Angriffen des Irdisch-Weiblichen nicht gewachsen, es sei denn, er rettet durch Tod und neues Leben sein Haupt und die Musik (Leier) hinüber in den apollinischen Bezirk der Klarheit und Harmonie. Auch hier also ist es das gleiche Thema: Tod und Leben.
[...]
[1] Erich Fried: Warngedichte. München: Hanser 1963/64
[2] Peter Härtling: Vorwort zu: Stella Baum: Der verborgene Tod. Frankfurt am Main, Fischer 1979. S. 9 ff
[3] Dr. R. A. Moody: Leben nach dem Tod. Reinbeck b. Hamburg, Rowohlt 1981, S. 17
[4] Dr. R. A. Moody: Leben nach dem Tod. Reinbeck b. Hamburg, Rowohlt 1981, S. 17
[5] Gisbert Greshake: Stärker als der Tod. Mainz 1976, S. 58 f oHhhH
[6] Johannes Hemleben: Jenseits. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1980, S. 10
[7] Friedrich Husemann: Vom Bild und Sinn des Todes. Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, S. 11
[8] Ebd., S. 11
[9] Ebd., S. 12
[10] Ebd., S. 13 f
[11] Ebd., S. 13 f
[12] Ebd., S. 14
[13] Ebd., S. 16
[14] Ebd., S. 17
[15] Ebd., S. 18
[16] Ebd., S. 18
[17] Ebd., S. 19
[18] Ebd., S. 19
[19] Ebd., S. 20
[20] A. Jeremias: Die Erlösererwartung alter Völker, Berlin 1927
[21] A. Jeremias: Die Erlösererwartung alter Völker, Berlin 1927
[22] F. Delitzsch: System der biblischen Psychologie
[23] F. Husemann: Vom Bild und Sinn des Todes, Frankfurt 1982, S. 24
[24] Ernst Bindel: Die ägyptischen Pyramiden als Zeugen vergangener Mysterienweisheit, 4. Aufl., Stuttgart 1975
[25] F. Husemann: Vom Bild und Sinn des Todes, Frankfurt am Main, Fischer 1982, S. 26 f
[26] Ebd. S. 26 f
[27] Ebd., S. 27
[28] F. W. v. Bissing: Versuch einer neuen Erklärung des Ka'i der alten Ägypter. Sitzungsber. d. Kgl. Bayr. Akademie d. Wissenschaften., München 1911
[29] F. Husemann: Vom Bild und Sinn des Todes, Frankf. 1982, S. 34 f
[30] Ebd. S. 34 f
[31] Ebd., S. 46
[32] Ebd., S. 47
[33] Rudolf Steiner: Die Rätsel der Philosophie (1914), GA 18., Dornach 1968
[34] F. Husemann: Vom Bild und Sinn d. Todes, Frankf. 1982 S. 51
[35] Ebd., S. 51
[36] Ebd., S. 54
[37] Ebd., S. 54
[38] R. Steiner: Das Christentum als mystische Tatsache.
[39] F. Husemann: Vom Bild u. Sinn d. Todes , Frankf. 1982, S. 55
[40] Ebd., S. 56
[41] Ebd., S. 57 f
[42] Ebd., S. 60
[43] Ebd., S. 61 f
[44] J. Hemleben: Jenseits. Reinbeck b. Hamburg, Rowohlt 1980, S. 11
[45] Ebd., S. 18
[46] 'Ägyptisches Totenbuch'. Übers. u. komment. v. Gregoire Koloaktchy. München 1955, S. 186 u. 188
[47] Ebd., S. 103
[48] Ebd., S. 115
[49] J. Hemleben: Jenseits. Reinbeck b. Hamburg, 1980, S. 21 f
[50] Ebd., S. 23
[51] Homers ‚Odyssee’. Übers. v. Johann Heinrich Voss nach dem Text d. ersten Ausgabe. Stuttgart 1951, XI, 218 – 222
[52] Ebd., XI, 473 - 476
[53] Ebd., XI, 488 - 491
[54] J.Hemleben: Jenseits, Reinb. b. Hamburg, 1980, S. 35
[55] Ebd., S. 42
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1989
- ISBN (eBook)
- 9783836611954
- Dateigröße
- 905 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Philosophie, Philosophie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- sterben selbstmord philosophie religion
- Produktsicherheit
- Diplom.de