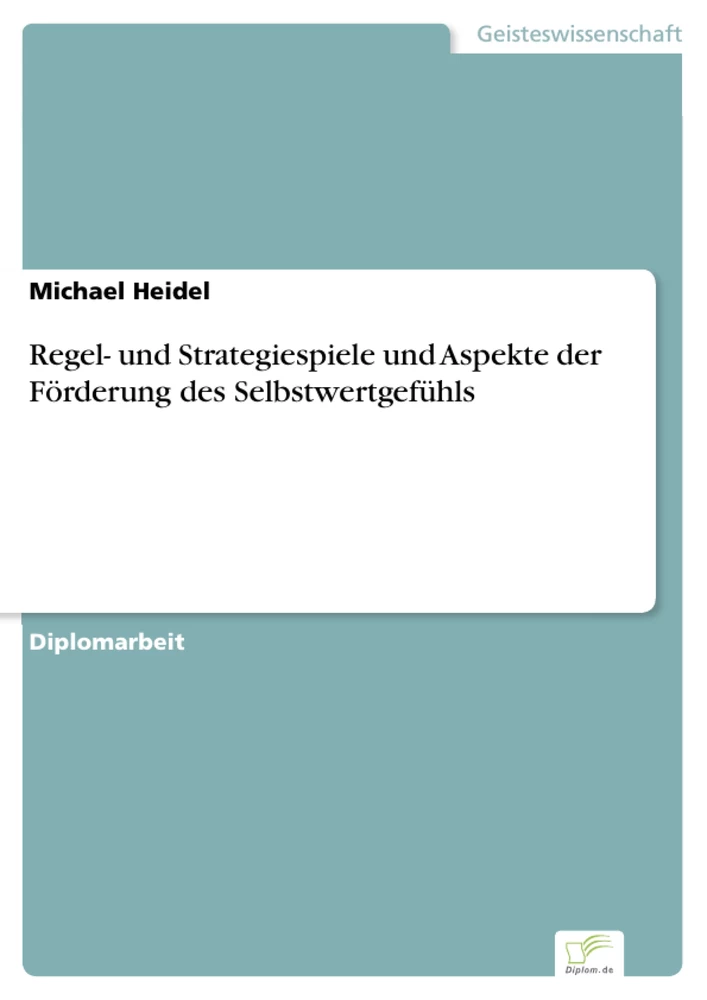Regel- und Strategiespiele und Aspekte der Förderung des Selbstwertgefühls
Zusammenfassung
Der grundlegende Gedanke dieser Diplomarbeit ist die These, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen mittels Regel- und Strategiespielen gefördert werden kann.
Um diese These näher zu ergründen, wird auf das philosophische Grundkonzept, welches der Diplomarbeit zugrunde liegt, eingegangen. Der Leser wird erkennen, dass die soziale Anerkennung durch signifikante Andere eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
Des Weiteren wird auf die Theorie des Spiels verwiesen. Es muss an dieser Stelle auch vermerkt werden, dass es eine Vielzahl von spieltheoretischen Ansätzen gibt, so dass der Verfasser sich im Hauptteil bewusst auf die beiden Ansätze von Jean Piaget und Heinz Heckhausen beschränkt hat. Am Anfang werden einige klassische Spieltheorien bzw. Auffassungen über das Spiel vorgestellt und danach wird auf die oben erwähnten Spieltheorien von Jean Piaget und Heinz Heckhausen eingegangen. Bei Jean Piaget steht die Klassifizierung des Urphänomens Spiel im Vordergrund, während bei Heinz Heckhausen das Spiel eher aus motivationspsychologischer Sicht betrachtet wird. Am Ende der spieltheoretischen Betrachtungen steht der phänomenologische Ansatz, welcher versucht, das Spiel als Ding an sich zu betrachten.
Da im Spiel viele pädagogische Aspekte ausgelebt und so auch trainiert werden können, hat sich der Verfasser auf die vier Grundkompetenzen Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Auge-Hand-Koordination und Problemlösungskompetenz beschränkt. Es lässt sich festhalten, dass diese Kompetenzen das Überleben des Menschen als Subjekt erleichtert haben.
Die Förderung des Selbstwertgefühls setzt auch elementar voraus, dass der Mensch, der gefördert werden soll, eine Identität besitzt bzw. eine Identität im Prozess aufbaut. Der Mensch besitzt durch die Geburt noch keine Identität, sondern muss sich seine Identität erschaffen und dieses kann das Baby bzw. Kind im Spiel erreichen. Diese Möglichkeit der Identitätsbildung im Spiel ist aber kritisch zu betrachten, worauf die Arbeit auch eingeht.
Des Weiteren wird der praktische Bezug der These anhand einer Kulturinstitution in der Dortmunder Nordstadt exemplarisch vorgestellt. Es wird die Planungsphase, die Durchführungsphase und auch die Reflexionsphase erläutert bzw. es werden Spiele vorgestellt, welche der Verfasser speziell für das Training der oben genannten pädagogischen Aspekte entwickelt hat. Auch werden diese Spiele aus spieltheoretischer Sicht beleuchtet. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Gliederung
1. Einleitung
2. Das philosophische Grundkonzept
3. Zur Theorie des Spiels
3.1 Klassische Theorien des Spiels
3.2 Die Spieltheorie von Jean Piaget
3.2.1 Das Übungsspiel
3.2.2 Das Symbolspiel
3.2.2.1 Verarbeitung von Ängsten im Symbolspiel
3.2.2.2 Veränderungen des Symbolspiels
3.2.3 Das Regelspiel
3.3 Die Spieltheorie von Heinz Heckhausen
3.3.1 Merkmale des Spiels nach Heinz Heckhausen
3.3.2 Der Aktivierungszirkel als Hauptmerkmal
3.3.3 Beeinflussung des Aktivierungszirkels
3.3.4 Mittlerer Aktivierungspegel
3.4 Phänomenologische Betrachtung des Spiels
4. Ausgewählte pädagogische Aspekte des Spiels
4.1 Kooperationsbereitschaft
4.2 Kommunikationsfähigkeit
4.3 Auge-Hand-Koordination
4.4 Problemlösungskompetenzen
5. Identität und Spiel
5.1 Das Spiel als Ansatz zur Identitätsbildung
5.2 Probleme bei der Identitätsbildung im Spiel
5.3 Kritische Betrachtung der Identitätsbildung im Spiel
6. Praktischer Umgang im Arbeitsfeld der Kinderarbeit
6.1 Die vorgefundene Situation in einer kommunalen Kulturinstitution
6.2 Planungsphase
6.2.1 Erstellung eines didaktischen Konzeptes
6.2.2 Planung der einzelnen Termine
6.2.3 Entwicklung eigener Spiele
6.2.3.1 Spiel für die Kooperationsbereitschaft
6.2.3.2 Spiel für die Kommunikationsfähigkeit
6.2.3.3 Spiele für die Auge-Hand-Koordination
6.2.3.4 Spiel für die Problemlösungskompetenz (Kreativität)
6.3 Durchführungsphase der Spiele
6.4 Soziale Anerkennung während des Spiels
6.5 Reflexionsphase nach dem Spiel
7. Kritische Betrachtung des Themas
8. Resümee
Anhang
Literatur
1. Einleitung
Der grundlegende Gedanke dieser Diplomarbeit ist die These, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen mittels Regel- und Strategiespielen gefördert werden kann.
Um diese These näher zu ergründen, wird auf das philosophische Grundkonzept, welches der Diplomarbeit zugrunde liegt, eingegangen. Der Leser wird erkennen, dass die soziale Anerkennung durch „signifikante Andere“[1] eine nicht unerhebliche Rolle spielt.
Des Weiteren wird auf die Theorie des Spiels verwiesen. Es muss an dieser Stelle auch vermerkt werden, dass es eine Vielzahl von spieltheoretischen Ansätzen gibt, so dass der Verfasser sich im Hauptteil bewusst auf die beiden Ansätze von Jean Piaget[2] und Heinz Heckhausen[3] beschränkt hat. Am Anfang werden einige klassische Spieltheorien bzw. Auffassungen über das Spiel vorgestellt und danach wird auf die oben erwähnten Spieltheorien von Jean Piaget und Heinz Heckhausen eingegangen. Bei Jean Piaget steht die Klassifizierung des Urphänomens Spiel im Vordergrund, während bei Heinz Heckhausen das Spiel eher aus motivationspsychologischer Sicht betrachtet wird. Am Ende der spieltheoretischen Betrachtungen steht der phänomenologische Ansatz, welcher versucht, das Spiel als „Ding an sich“[4] zu betrachten.
Da im Spiel viele pädagogische Aspekte ausgelebt und so auch trainiert werden können, hat sich der Verfasser auf die vier Grundkompetenzen Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Auge-Hand-Koordination und Problemlösungskompetenz beschränkt. Es lässt sich festhalten, dass diese Kompetenzen das Überleben des Menschen als Subjekt erleichtert haben.
Die Förderung des Selbstwertgefühls setzt auch elementar voraus, dass der Mensch, der gefördert werden soll, eine Identität besitzt bzw. eine Identität im Prozess aufbaut. Der Mensch besitzt durch die Geburt noch keine Identität, sondern muss sich seine Identität erschaffen und dieses kann das Baby bzw. Kind im Spiel erreichen. Diese Möglichkeit der Identitätsbildung im Spiel ist aber kritisch zu betrachten, worauf die Arbeit auch eingeht.
Des Weiteren wird der praktische Bezug der These anhand einer Kulturinstitution in der Dortmunder Nordstadt exemplarisch vorgestellt. Es wird die Planungsphase, die Durchführungsphase und auch die Reflexionsphase erläutert bzw. es werden Spiele vorgestellt, welche der Verfasser speziell für das Training der oben genannten pädagogischen Aspekte entwickelt hat. Auch werden diese Spiele aus spieltheoretischer Sicht beleuchtet. Hierbei wird auf die Wichtigkeit der sozialen Anerkennung durch die Bezugspersonen hingewiesen.
Danach wird in einer kritischen Betrachtung des Themas auf die Pädagogisierung des Spiels bzw. auf die empirische Verifizierung der These, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen mittels Regel- und Strategiespielen gefördert werden kann eingegangen.
Das Resümee beschäftigt sich nochmals kritisch mit der Grundthese der Diplomarbeit.
2. Das philosophische Grundkonzept
Das zugrunde liegende philosophische Grundkonzept dieser Diplomarbeit findet seinen eigentlichen Ursprung in dem lateinischen Satz „ cogito, ergo sum “ von René Descartes[5]. Dieses Zitat bildet die philosophische Grundlage der Diplomarbeit und wird mit den Worten „ Ich denke, also bin ich.“ übersetzen. Das Denken, welches Descartes hier anspricht, ist eine Fähigkeit des Menschen, wie es auch viele andere Fähigkeiten gibt, über die der Mensch verfügt. Hier könnte das Kochen, das Putzen oder auch das Schach-Spielen als eine Fähigkeit des Menschen erwähnt werden. All diese Fähigkeiten lassen sich umgangssprachlich mit dem Begriff des „Könnens“ umschreiben. Der Mensch besitzt die Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erlernen und in sein Handlungsrepertoire einzugliedern, das heißt, dass der Mensch lernfähig ist.
Da die Strategiespiele besonders die Fähigkeit des Denkens fördern, lässt sich also daraus folgendes ableiten: Ich kann denken, also bin ich bzw. ich kann spielen, also bin ich. Aus diesem Satz lässt sich logisch schlussfolgern, dass das Erkennen der eigenen Identität im Spiel möglich ist. Nach dem Erkennen der eigenen Identität besteht auch die Möglichkeit ein Selbstwertgefühl auszubilden.
Der Aufbau eines Selbstwertgefühls wird massiv durch die umgebende Gesellschaft bzw. Gemeinschaft beeinflusst, wichtig ist dabei, dass das Spielen bzw. die Resultate des Spielens als positiv empfunden werden. Dadurch hat die Person über das Spielen bzw. über das Resultat des Spielens eine positive soziale Anerkennung[6] von den „signifikanten Anderen“ erhalten, was sich in Selbstwertgefühl ausdrückt. Für die Pädagogik ergibt sich daraus die Konsequenz, dass Regel- und Strategiespiele bzw. Spiele allgemein dem Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls dienen können. Der Pädagoge[7] könnte dabei unterstützend wirken, indem er den Menschen an Regel- und Strategiespiele heranführt und ihm für die erlernten Fähigkeiten Anerkennung gibt. Die Bedeutung der Regel- und Strategiespiele geht zudem über die konkrete Spielhandlung hinaus, weil sie die generellen kognitiven Fähigkeiten fördern und so auch in anderen Lebensbereichen Erfolgserlebnisse und soziale Anerkennung zu fördern vermögen.
3. Zur Theorie des Spiels
Eine allgemeingültige Theorie über das Spiel[8], eine Spieltheorie[9], die alles umfasst, gibt es nicht. Dieses hängt damit zusammen, dass das Phänomen „Spiel“ unter einer Fülle wissenschaftlicher Ansätze und Fragestellungen betrachtet werden kann. Ulrich Baer[10] erklärt folgendes dazu: „ In den Spieltheorien wird ein wesentlicher Teil des menschlichen Verhaltens erklärt und in den Zusammenhang von Sozialisation, Psychologie und Gesellschaftstheorie gebracht.“[11]. Daher kann geschlussfolgert werden, dass das Spiel mindestens unter drei verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven interpretiert und erklärt werden kann.[12] Hinzu kommen interdisziplinäre Überlegungen und unterschiedliche Herangehensweisen innerhalb der einzelnen Wissenschaften geht. Als Beispiel sei hier die psychoanalytisch geprägte Spieltheorie genannt, welche einen ganzen andere Sichtweise auf das Spiel hat, als zum Beispiel die motivationspsychologische geprägte Spieltheorie oder die kulturanthropologische Spieltheorie. Aufgrund dieser Vielfalt ist es in diesem Rahmen nicht möglich, alle vorhandenen Spieltheorien vorzustellen und zu erläutern. Deswegen wird hier ein kleiner Abriss der klassischen Spieltheorien[13] vorgestellt bzw. wird näher auf die Spieltheorie von Jean Piaget und Heinz Heckhausen eingegangen, welche das Phänomen des Spiels sehr sinnvoll klassifizieren bzw. eine empirisch nachvollziehbare Aussage über die Motivation im Spiel bieten.
Es lässt sich feststellen, dass es bei den Spielforschern nur Einigkeit herrscht über die Grundannahme, dass das Spiel eine elementare Lebensäußerung des Menschen ist.[14]
3.1 Klassische Theorien des Spiels
Das Spiel des Kindes als Phänomen beschäftigte schon die alten Ägypter und auch die Griechen. Bereits Platon[15] und Aristoteles[16] setzten sich mit dem kindlichen Spiel auseinander und hielten es für die Erlernung von Fähigkeiten bzw. für die Ausbildung der Persönlichkeit wichtig.[17]
In der jüngeren Zeit beschäftigte sich Herbert Spencer[18] mit dem Spiel und kam zu der Feststellung, dass das Spiel aus seiner Sicht nur möglich ist, wenn ein Kraftüberschuss des Spielenden vorhanden ist, dieser Kraftüberschuss manifestiert sich dann auch im Spiel. Nach der Auffassung von Herbert Spencer dient das Spiel nicht in erster Linie der Erhaltung des inneren Gleichgewichts, sondern geht über diese unmittelbaren Bedürfnisse hinaus. Die von Herbert Spencer beschriebenen Kraftüberschüsse äußern sich im Übungsspiel bzw. auch im Symbolspiel der Kinder und lassen sich sogar im Wettkampf erkennen.[19] Die Idee des Kraftüberschusses im Spiel wurde auch von anderen Spieltheoretikern übernommen und in abgewandelter Form in die neuen Spieltheorien eingegliedert.[20]
Eine andere Sichtweise auf das Spiel als Phänomen besaß Stanley Hall[21], der das Spielen als Tätigkeit einem Trieb unterordnete und dementsprechend das Spielen als eine triebhafte Erscheinung verstand, wie ähnlich dem Geschlechtsverkehr, welcher dem Arterhaltungstrieb unterliegt. Stanley Hall sah im Spiel des Kindes nicht nur einen Trieb, welcher nach Befriedigung strebt, sondern er vertrat auch die Auffassung, dass das Kind im Spiel die verschiedenen Phasen der Menschwerdung bzw. der menschlichen Kultur nachspielt (Rekapitulationstheorie). Aufgrund dessen ist es nicht verwunderlich, das Kinder Höhlen bauen und sich im Spiel zum Beispiel mit der Lebenswelt im Mittelalter (Ritterburgen usw.) auseinandersetzen.[22]
Die Auffassung von Herbert Spencer fand sich in abgewandelter Form wieder in der Katharsistheorie[23], wonach das Spiel der Reinigung des Spielenden von destruktiven Trieben dient, um die Gesellschaft vor diesen destruktiven Trieben zu schützen. Harvey Carr[24] benutzte die Katharsistheorie als Erklärungsmuster für das Spiel des Kindes.[25] Auch Karl Groos[26] vertrat die Auffassung, dass das Spiel der Katharsis des Spielers dient.[27] Der Gedanke der Katharsis im Spiel wurde in einer veränderten Form auch von den Psychoanalytikern aufgenommen und in die psychoanalytische Spieltheorie[28] integriert, was bis heute noch zu heftigen Auseinandersetzungen führt.[29]
Karl Groos, der sich mit dem Spiel der Tiere und auch der Menschen auseinandergesetzt hatte, ging von der These aus, dass das Spiel des Kindes der Vorübung von lebensnotwendigen Verhaltensweisen dient. Nach der Auffassung von Karl Groos dient das Spiel der Vorwegnahme der Lebensweise der Erwachsenen. Fähigkeiten und Tätigkeiten, welche das Leben der Erwachsenen prägen, werden von den Kindern im Spiel schon eingeübt, ohne dass dabei die Notwendigkeit oder der Ernst des Verhaltens der Erwachsenen eine Rolle spielt. Deswegen wird die Spieltheorie von Karl Groos auch als Einübungstheorie (preexercise theory) bezeichnet.[30] Dieses lässt sich sehr leicht verstehen, wenn die spielerischen Verhaltensweisen von Tieren beobachtet werden. Bernhard Hassenstein erklärt zum Imitationsspiel junger Löwen folgendes: „ Die Prankenschläge – stets mit eingezogenen Krallen – sind dabei weich und freundlich, aber wohlgezielt. Die spielerischen Bisse richten sich eindeutig auf die Kehle oder den Nacken des Spielpartners, so als wäre dieser ein >>Modell<< für ein Beutetier; niemals aber wird so fest zugebissen, dass ein Spielpartner verletzt wird “.[31] Auch hier üben die jungen Löwen ein Verhalten ein, welches sie in diesem Moment nicht wirklich brauchen, weil sie noch vom Rudel ernährt werden und nicht selbst auf die Jagd gehen müssen.
3.2 Die Spieltheorie von Jean Piaget
Aus der Sicht von Jean Piaget besteht eine Verbindung zwischen der Entwicklung der Intelligenz und der Entwicklung des Spiels, deswegen ist seine Spieltheorie verknüpft mit der Entwicklungstheorie der Intelligenz[32].
Nach der Auffassung von Jean Piaget muss die Anpassungsanstrengung durch Nachahmung nachlassen, damit das Kind überhaupt in die Spielphase eintreten kann. Die Spielphase wird von dem Einüben erlernter Aktivitäten geprägt sein, wobei das Kind ein Vergnügen empfinden wird, weil es diese Aktivitäten beherrscht. Das führt im Weiteren dazu, dass das Kind Kraft aus diesem Akt schöpft.[33]
Über das Phänomen Spiel macht Jean Piaget die folgende grundlegende Aussage: Das Spiel dient der Verfestigung von Handlungsschemata und ist dementsprechend auch ein Teil des kognitiven Begreifens, der kognitiven Auffassung. Auf der anderen Seite ist das Spiel in sich noch so frei, dass es dafür sorgt, dass sich die Realität an das Ich des Kindes assimiliert.[34] Also bildet die spielende Person auf der Basis der vorgefundenen Realität eine zweite Realität aus, die sich aus der Sicht eines beobachtenden Dritten als Spielrealität darstellt. Des Weiteren verlässt das Kind beim Übergang von der gesellschaftlichen konstruierten Realität in die Spielrealität seine eigene Identität und nimmt eine neue Spielidentität an.[35] In diesem Kontext erläutert Jürgen Fritz: „ Das Spiel ist ein Bereich, der sich von der „ernsthaften“, festgelegten und festlegenden Wirklichkeit und ihrem hohen Verbindlichkeits- und Wirkungscharakter abhebt. Es ist eine andere Wirklichkeit mit anderen Funktionen und Wirkungen: unverbindlicher, offener, freier. In Bezug auf die Wirklichkeit ist das Spiel eine „lebendige Hüllschicht“, die sich um den Wirklichkeitskern lagert “.[36] Diese Feststellung gilt ausnahmslos für alle Spiele.
Der erste Schritt zu Erforschung des Spiels liegt, nach der Auffassung von Jean Piaget, in der Klassifizierung des Spiels. Um diese Aufgabe überhaupt zu ermöglichen, ging er dabei sehr empirisch vor. Jean Piaget erklärt in seinem Werk „Nachahmung, Spiel und Traum“ auch, dass er und seine Mitstreiter etwa 1000 Beobachtungen von Spielformen gemacht haben.[37] Jean Piaget macht aufgrund seiner empirischen Forschungsarbeit und der kritischen Betrachtung anderer Spieltheorien die Feststellung, dass sobald das Symbol oder die Regel als Merkmal eines Spiels in das Geschehen tritt, eine Unterteilung der Spiele nicht mehr anhand des Inhaltes festgemacht werden kann, so wie es vorherige Spieltheoretiker immer versucht hatten.[38] Daraus schlussfolgernd konnte, nach Jean Piaget, die Klassifizierung des Spiels nicht über den Inhalt des Spiels durchgeführt werden.
Abschließend kommt Jean Piaget zu der Erkenntnis, dass es, aus seiner Sicht, drei grundlegende Typen von Strukturen gibt, die das Spiel als solches charakterisieren. Er nennt diese drei Typen: die Übung, das Symbol und die Regel.[39] Dementsprechend werden die drei Spieltypen nach Jean Piaget wie folgt bezeichnet:
- Übungsspiel
- Symbolspiel[40]
- Regelspiel
3.2.1 Das Übungsspiel
Der grundlegende Aspekt aller Übungsspiele[41] ist die Übung als charakteristisches Merkmal nach Jean Piaget. Das Übungsspiel als solches hat kein Ziel, es verfolgt nicht ein sozial oder individuell erwünschtes Ziel, sondern es findet seine Existenzberechtigung in dem Vergnügen des Funktionierens, in der Übung und im Gelingen der Übung.[42] Nach der Auffassung von Karl Bühler basiert das Übungsspiel auf der Funktionslust und das Kind empfindet eine Freude darüber, dass es sich der neuerworbenen Fähigkeiten versichern kann.[43] Außerdem kann das Kind mittels der Übungsspiele eine allmähliche Trennung zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich vollziehen. Neben der reinen Lust am funktionieren können sich auch konflikthafte Elemente in den Übungsspielen widerspiegeln.[44]
Das Übungsspiel stellt den Anfang aller spielerischen Entwicklungen des Kindes dar und weil das Übungsspiel so elementar ist, vertritt Jean Piaget die Auffassung, dass das einfache Übungsspiel auch im Tierreich bei den höher entwickelten Arten weit verbreitet ist, weil es ohne Symbole bzw. Fiktionen und Regeln auskommt.[45] Dem muss entgegengehalten werden, dass auch die Tiere das Symbolspiel kennen.[46]
Doch werden Übungsspiele nicht nur von Kindern durchgeführt. Beispielhaft sind so genannte klassische Filmszenen, in denen ein Mann mittels eines Revolvers auf Glasflaschen oder Blechdosen schießt oder auch das Musizieren. Piaget erklärt dazu: „ Im übrigen sind diese spielerischen Übungen, die die Ausgangsform des Spiels beim Kind darstellen, keinesfalls nur in den ersten beiden Lebensjahren oder in der Phase der vorverbalen Verhaltensweisen zu beobachten. Im Gegenteil, sie tauchen immer wieder während der ganzen Kindheit auf, und zwar immer dann, wenn eine neue Fähigkeit erworben wurde: Während der Phase ihrer Entstehung und der aktuellen Anpassung (im Gegensatz zur erreichten Anpassung) ist jede Verhaltensweise Gegenstand einer funktionellen Assimilation oder einer Übung „à vide“, die begleitet ist von einer Freude, Ursache zu sein, oder von einem Gefühl der Leistungsfähigkeit. Selbst der Erwachsene reagiert häufig noch auf die gleiche Art und Weise. “[47]
3.2.2 Das Symbolspiel
Die ersten Formen des Symbolspiels treten in dem Moment auf, wenn das Übungsspiel als solches durch eine Fiktion, durch ein Symbol, bereichert wird.[48] Es kommt dabei zu einer Trennung zwischen dem bezeichneten Gegenstand und dem dafür benutzten Begriff, so, dass dieser Begriff auf einen anderen beliebigen Gegenstand übertragen werden kann.[49] Ergänzend formuliert Jean Piaget: “Was übrigens bei diesen symbolischen Kombinationen überrascht, ist, wie sehr das Subjekt die Wirklichkeit reproduziert und weiterführt, wobei das Phantasiesymbol nur ein Ausdrucksmittel und ein Mittel, weitere Bereiche zu erfassen, und nicht Ziel für sich selbst ist”.[50]
Der Vorgang der Symbolbildung setzt im Vorfeld eine Zunahme der Fähigkeit zur Verknüpfung und Kombination bei den Kindern voraus.[51] So kann beispielsweise ein Mädchen, welches aus Freude am Springen, also aus einem Vergnügen des Funktionierens, über einen Stein springt, sich plötzlich vorstellen, dass der Stein ein wildes Tier darstellt. Dadurch dass sie sich vorstellt, dass sie über ein wildes Tier springt, entsteht in diesem Moment aus dem Übungsspiel ein Symbolspiel. Der elementare Unterschied vom Übungsspiel und dem Symbolspiel besteht darin, dass beim Symbolspiel ein nicht anwesender Gegenstand in der Phantasie des Kindes durch das Symbol ersetzt wird.[52] In dem genannten Fall ist der Stein ein Symbol für ein wildes Tier. Durch diesen Vorgang würde aus dem einfachen Übungsspiel ein Symbolspiel werden. Das Übungsspiel wird durch das Symbolspiel nicht verdrängt, sondern assimiliert, sprich das Symbolspiel macht sich die Verhaltensmuster und Bewegungsabläufe des Übungsspiels zu nutzen und baut diese in den neuen Handlungskontext ein.[53]
Eine andere weit reichende Folge des Aufkommens des Symbolspiels ist, dass durch das Symbol die gesellschaftlich vorgebende Wirklichkeit eher an das Ich des Kindes assimiliert werden kann, als es vorher beim Übungsspiel der Fall war. Durch das Symbol tritt eine Steigerung der Effizienz des Assimilierens der gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit an das Ich des Kindes ein.[54]
Beim Symbolspiel werden zwei Untertypen unterschieden:
- Einfaches Symbolspiel
- Imitationsspiel
Beim einfachen Symbolspiel symbolisiert ein Gegenstand einen anderen Gegenstand, der in diesem Moment nicht real vorhanden ist (z.B. wird ein Stock im Spiel zu einem Schwert umgedeutet). Im Imitationsspiel wird der eigene Körper an einen anderen Körper bzw. an einen anderen leblosen Gegenstand angepasst.[55]
Der eigene Körper wird dabei als Symbol verstanden und mittels des eigenen Körpers wird ein anderer Körper (z.B. ein Hund) oder ein anderer lebloser Gegenstand (z.B. ein Kirchturm) symbolisch nachgestellt. Aufgrund dessen sich auch die Vielfältigkeit des Symbolspiels erklärt, weil es über einfache Handlungen, symbolische Zuschreibungen[56], bis zum Spiel mit Puppen bzw. dem Rollenspiel reicht.[57]
Eine der künstlerisch höchsten Formen des Symbolspiels, welches genauer genommen ein Imitationsspiel selbst ist, ist das Theaterspiel[58]. Beim Theaterspiel übernimmt der Schauspieler mittels seines eigenen Körpers die Rolle eines anderen Menschen bzw. Lebewesens. Der eigene Körper wird in diesem Moment zum Symbol für den in diesem Moment nicht real vorhandenen Menschen bzw. für das in diesem Moment nicht real vorhandene Lebewesen.
Weitergehend lässt sich festhalten, dass in der Reproduktion tatsächlicher Begebenheiten mit Puppen dementsprechend der Anteil der Imitation ein Maximum erreicht, weil die spielende Person möglichst nahe am realen Geschehen bleiben möchte. Auf der anderen Seite treten subjektive Ziele auf, welche dazu führen, dass keine vollständige Kopie des Geschehens zustande kommt.[59]
Bei komplexen Symbolspielen vermischen sich sehr stark die Aspekte der Imitation und der Assimilation an das Ich, so dass nicht mehr feststellbar ist, ob die Imitation oder die Assimilation an das Ich in diesem Fall überwiegt. Es wäre gekünstelt, wenn trotzdem versucht werden würde, dem Symbolspiel einen ausschlaggebenden Aspekt in eine Richtung zu verpassen.[60]
3.2.2.1 Verarbeitung von Ängsten im Symbolspiel
Das Symbolspiel besitzt eine wichtige Funktion, denn mittels des Symbolspiels kann gegen Ängste angekämpft werden bzw. kann der Spieler im Symbolspiel in Rollen[61] schlüpfen, die er in der Wirklichkeit nicht durchführen kann. Mit dieser Möglichkeit kann zum Beispiel das Kind einen traumatischen Arztbesuch mit seiner Puppe nachspielen und diesen so auch verarbeiten.[62] So gibt es in der Psychologie die Auffassung, dass Ereignisse, welche mit einem starken Affekt verbunden sind, spontan von den Kindern im Rollenspiel aufgegriffen werden und dass es mittels dieses Mediums zu einer Verarbeitung der Erlebnisse kommt.[63] Dadurch, dass der unlustvolle affektgeladene Impuls der Realität noch nicht im Spiel abgebaut bzw. vermindert wurde, steht das Kind unter dem Wiederholungszwang[64] und versucht so, eine Minimierung des Impulses durch das Spiel zu bewerkstelligen. Die Minimierung wird dadurch verstärkt, dass das Kind die Rollen wechselt und aus der ursprünglichen passiven Rolle rausgeht und eine aktivere Rolle einnimmt. Das Kind könnte zum Beispiel mit seinem Teddybär einen Zahnarztbesuch nachspielen, wobei der Teddybär die passive Rolle des Patienten übernimmt.[65] Gerade diese Möglichkeit des Wechsels der Rollen, also hin zu einer aktiveren bestimmenden Rolle, führt auch dazu, dass das Kind diese unlustvolle affektgeladene Situation überhaupt verarbeiten kann.[66]
3.2.2.2 Veränderungen des Symbolspiels
Ab dem Alter von etwa 4 Jahren setzen langsam Veränderungsprozesse im Symbolspiel ein. Nach der Auffassung von Jean Piaget treten drei neue Merkmale auf, welche charakteristisch für die Veränderung des Symbolspiels sind:
- das Ordnungsprinzip: Die spielerischen Konstruktionen bekommen eine relative Ordnung, gegenüber den vorherigen symbolischen Kombinationen, die zusammenhangslos abliefen.[67]
- die Annäherung an die Realität: „ Das spielerische Symbol entwickelt sich in Richtung auf eine einfache Kopie der Wirklichkeit, lediglich die allgemeinen Themen bleiben symbolisch, und das Detail der Szenen und die Konstruktionen tendieren auf eine präzise Akkommodation hin und gehen häufig selbst in die Richtung einer intelligenten Anpassung im eigentlichen Sinne.“[68]
- die spielerische Differenzierung und Präzisierung der einzelnen Rollen, welche in der Gesellschaft vorhanden sind.[69]
Als Grund für die Entwicklung des Spiels in diese Richtung kann die Sozialisation des Menschen genannt werden, denn mit dem Fortschreiten der Sozialisation verändert sich auch das Symbol als Merkmal des Symbolspiels. Es tritt keine Verstärkung der Symbolik ein, sondern das Symbol wird durch die Sozialisation dazu gebracht, sich immer mehr der objektiven Imitation der Wirklichkeit unterzuordnen.[70]
Gegen Ende dieser Phase wird die Symbolik zugunsten der Regelspiele zurückgehen, oder es werden symbolische Konstruktionen bevorzugt, die nicht mehr eine so stark deformierende Wirklichkeit darstellen, sondern sich immer mehr der zielgerichteten und angepassten Arbeit annähern.[71]
3.2.3 Das Regelspiel
Die dritte Kategorie nach der Spieltheorie von Jean Piaget ist das Spiel nach festgesetzten Regeln, das so genannte Regelspiel.[72] Über die Regel als Charakteristikum eines Spiels lässt sich folgendes festhalten: Die Regel setzt voraus, dass die Spieler im kooperativen Prozess sich über die Spielregeln einigen und dass eine Verletzung der Spielregel als Fehlverhalten betrachtet und von der Spielgemeinschaft sanktioniert wird.[73]
Das Regelspiel ist der Spieltypus, der sich als letztes entwickelt, auf der anderen Seite bleibt es ein Leben lang dem Menschen erhalten und wird sogar noch verfeinert bzw. weiterentwickelt (Sport-, Würfel-, Kartenspiele usw.), während das Übungsspiel und auch das Symbolspiel nur noch in rudimentären Zügen erhalten bleibt.[74]
Dementsprechend ist nach Jean Piaget das Regelspiel die spielerische Tätigkeit des sozialisierten Wesens.[75] Deswegen kann das Regelspiel auch in der früheren Phase des Kindes noch gar nicht auftauchen, weil seine Sozialisation in diesem Moment noch nicht weit genug fortgeschritten ist.[76]
Eine Person gibt sich nie allein Regeln, allenfalls nimmt sie von außen kommende Regeln auf und nutzt sie für sich selbst.[77] Wenn sich eine Person spielerische Regeln gibt, wie zum Beispiel auf dem Weg zur Straßenbahn eine gerade Anzahl von Schritten zu machen, dann handelt es sich eher um eine Form des ritualisierten Übungsspieles. Zum ritualisierten Übungsspiel lässt sich erklären, dass es entweder ein einfaches Übungsspiel ist, welches ritualisiert wurde oder dass das Individuum eine von außen kommende Regel aufnimmt und so bildet diese Spielregel den Überbau bei diesem Spiel.[78]
Weitergehend kann auch unterschieden werden, ob die Regeln traditionell übermittelt sind und dementsprechend eine soziale Realität darstellen, oder ob diese Regeln eher spontan entstehen bzw. entstanden sind.[79] Spontane Regelspiele haben ihren Ursprung in der Sozialisierung von Übungsspielen oder in der Sozialisierung von Symbolspielen, dementsprechend sind sie ein Abbild der sozialen Realität der Personen, die sie sich überlegt haben.[80] So könnte das einfache Springen über Gehwegplatten, welches noch ein Übungsspiel darstellt, spontan mit der Regel verbunden werden, dass derjenige die meisten Punkte bekommt, der am weitesten springt, sprich es wird ein agonaler Faktor[81] (Wettkampf) in das Übungsspiel eingeführt und so aus dem Übungsspiel eine Form von Sport entwickelt.
Des Weiteren lassen sich die Regelspiele in zwei grundlegende Kategorien einordnen:
- sensomotorische Regelspiele (die alle Bewegungsspiele umfassen)
- intellektuelle Regelspiele (wie zum Beispiel Schach, Mühle, Backgammon)[82]
Das verbindende Glied zwischen diesen beiden Gruppen ist der agonale Faktor, sprich der Wettkampf der Spieler gegeneinander.[83]
3.3 Die Spieltheorie von Heinz Heckhausen
Heinz Heckhausen vertritt die Auffassung, dass alle Tätigkeiten, wie auch das Spiel, nicht darauf ausgelegt sind eine Spannungsminderung herbeizuführen. Sondern er erklärt, dass die beobachteten Verhaltensweisen von einigen Wirbeltierarten eher Rückschlüsse darauf zulassen, dass die Spannungsminderung nicht das primäre Ziel dieser Verhaltensweisen ist. Eher wird Steigerung oder Aufrechterhaltung eines gewissen Spannungspegels als primäres Ziel angesehen. Dieses lässt sich aus den beobachteten Verhaltensweisen ableiten.[84] Auch das Spiel dient der Aufrechterhaltung eines Spannungspegels[85] und entsprechend, nach der Auffassung von Heinz Heckhausen, ist die Aufrechterhaltung eines Spannungspegels das Hauptmerkmal, welches das Spiel besitzen kann.
3.3.1 Merkmale des Spiels nach Heinz Heckhausen
Die fünf Merkmale[86] des Spiels sind nach der Auffassung von Heinz Heckhausen:
- die Zweckfreiheit
- der Aktivierungszirkel
- die handelnde Auseinandersetzung[87]
- die undifferenzierte Zielstruktur bzw. die unmittelbare Zeitperspektive
- die Quasirealität
Über die Zweckfreiheit vertritt Heinz Heckhausen die Ansicht, dass das Spiel aus einer Freiwilligkeit heraus entstehen muss bzw. dass der Spieler ein ungezwungenes Grundgefühl besitzen muss, um in diesem Moment überhaupt zum spielen gelangen zu können.[88] Gustav Bally[89] beschreibt dieses mit einem „entspannten Feld“ und auch andere Theoretiker des Spiels[90] vertreten die Auffassung, dass ein angstfreies Feld die Grundlage der Spielfähigkeit bildet.
Ebenso erklären Brian Sutton-Smith und Shirley Sutton-Smith über die Zweckfreiheit des Spiels: „ Spiel ist eine Art von willensgesteuertem Verhalten – d.h. eines Verhaltens, das ausgeführt wird, weil Menschen etwas tun wollen, nicht weil sie es tun müssen. Sie werden von innen heraus dazu motiviert “.[91] Heinz Heckhausen vertritt auch die Ansicht, dass das Spiel von einer intrinsischen Motivation geleitet wird, das heißt, dass das Spiel als Tätigkeit sich selbst genügt und kein außenstehender Endzustand oder kein außenstehendes Ziel verfolgt wird.[92] Im Spiel selbst tritt also die Leistungsfixierung der Gesellschaft immer mehr in den Hintergrund und die Befriedigung bzw. der Lustgewinn durch die Steigerung bzw. Aufrechterhaltung des Spannungspegels wird zum eigentlichen Ziel erklärt.[93]
Die Quasirealität ist das Charakteristikum des Spiels, welches dafür sorgt, dass das Spiel sich abgrenzt von den anderen zweckfreien Aktivitäten, die auch dem Aktivierungszirkel unterliegen. Es darf nicht der Fehler gemacht werden, dass die Quasirealität mit einer Irrealität verwechselt wird. Denn im Gegensatz zu der Irrealität, erkennt der Spieler, dass es außerhalb des Spielfeldes eine andere Realität gibt, welche gesellschaftlich konturiert ist.[94] So seien an dieser Stelle zum Beispiel alle Abenteuer, die experimentelle Grundlagenforschung zu nennen, welche auch einem Aktivierungszirkel unterliegen, aber nicht das Charakteristikum der Quasirealität besitzen.[95] Der amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt die Quasirealität mit dem Eintauchen des Spielers in diese andere Welt, der Spieler geht völlig in der Tätigkeit des Spiels auf.[96] Aus der Sicht der psychoanalytischen Spieltheorie ist die Quasirealität eine Grundvoraussetzung, damit der Spieler im Spiel überhaupt die Möglichkeit besitzt, seine affektbeladenen Erlebnisse spielerisch aufzuarbeiten und dementsprechend auch abzuarbeiten (Verarbeitung von Ängsten im Symbolspiel).[97]
Diese handelnde Auseinandersetzung vollzieht sich immer mit einem Ausschnitt der wahrgenommen Welt und gerade die Auseinandersetzung in der Handlung unterscheidet maßgeblich das Spiel, aber auch das Abenteuer von den rein kognitiven, rein wahrnehmenden oder nur erlebenden Tätigkeiten. Der Konsument wandelt sich in der Handlung und wird zum Produzenten neuer Begebenheiten.[98]
[...]
[1] Signifikante Andere sind alle Bezugspersonen, die an der Erziehung einen prägenden Anteil haben. Hierzu sind exemplarisch neben den Eltern die Großeltern und die Erzieher im Kindergarten zu nennen.
[2] * 9. August 1896 † 16. September 1980.
[3] * 1926 † 30. Oktober 1988.
[4] Diese Terminologie geht auf Immanuel Kant (* 22. April 1724 † 12. Februar 1804) und sein Werk „Kritik der reinen Vernunft“ zurück.
[5] *31.März 1596 †11.Februar 1650.
[6] Angela Hobday und Kate Ollier verstehen die Anerkennung im Spiel als eine Belohnung für eine harte Arbeit (Hobday / Ollier 2001, S. 12). Siehe ergänzend Erikson 1999, S. 230.
[7] Der Verfasser spricht bewusst in dieser Diplomarbeit „nur“ von Pädagogen und versteht darunter alle Formen der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Arbeit, sofern diese auch die klassischen Aspekte des pädagogischen Umgangs mit Mitmenschen umfassen. Die Unterteilung in Schulpädagogen, Diplompädagogen und Fachhochschulabsolventen erscheint dem Verfasser aus der derzeitigen wissenschaftlichen Sicht veraltet. Im weiteren Sinne gehören zu dieser Gruppierung die Absolventen der Höheren Fachschulen (Erzieher und Erzieherinnen).
[8] Eine sehr überzeugende Erkenntnis über das Spiel vertritt Friedrich Fröbel (* 21. April 1782 † 21. Juni 1852), der im Jahre 1838 feststellte: „Das Spiel ist ein Spiegel des Lebens, des eigenen und des Fremdlebens, des Innen- und des „Umlebens“; aber in Freiheit der Darstellung und doch getragen vom inneren Gesetze und deshalb das Leben – wie ein klarer See seine Umgebung – verschönt und geklärt zurückgebend. Das Spiel zeigt verschleiert die Gesetze des Lebens wie der Natur; darum eben hat auch das Spiel wie die Natur, so unendlichen, nie alternden Reiz für jung und alt“ (Fröbel 1982, S. 35). Aus der Sicht des Verfassers erkannte Friedrich Fröbel, dass das Spiel eine Quasirealität schafft (…verschleiert die Gesetze der Natur...). Außerdem ist der Verfasser der Ansicht, dass Friedrich Fröbel schon erkannte, dass das Spiel auch der psychischen Hygiene dient. Friedrich Fröbel erklärte, dass das Spiel ein Spiegel des Innenlebens ist. Daraus kann gefolgert werden, dass alle Eindrücke auch nach wieder außen (zurück-) getragen werden. Nach heutigem wissenschaftlichem Stand ist bekannt, dass Kinder traumatisierende Eindrücke nach außen tragen, um sie dann im Spiel aktiv aufzuarbeiten. Auch Jürgen Fritz und Roger Caillois (* 3. März 1913 † 21. Dezember 1978) vertreten die Auffassung, dass das Spiel ein Spiegel des „Umlebens“ darstellt (siehe Fritz 1993, S. 45 und Caillois 1960, S. 94). George Herbert Mead (* 27. Februar 1863 † 26. April 1931) und Johanna Hartung erkennen im Rollenspiel die Übernahme und Nachahmung von Rollenbildern der Personen, die in der unmittelbaren bzw. mittelbaren Umwelt des Kindes leben (siehe Mead 1969, S. 287 und Hartung 1977, S. 17), dementsprechend zeigt sich auch das Rollenspiel als Spiegel des „Umlebens“, wie es Friedrich Fröbel beschrieben hat.
[9] Neben den hier aufgeführten Spieltheorien gibt es noch viele andere Spieltheorien, so zum Beispiel auch die bekannte mathematische Spieltheorie, welche von dem ungarischen Mathematiker John von Neumann (*28.Dezember 1903 †8.Februar 1957) begründet wurde. Die mathematische Spieltheorie ist auf ökonomische Problemstellungen zugeschnitten und stellt fest, welche Kombinationen zum besten ökonomischen Resultat führen (Eigen / Winkler 1975, S. 28. Siehe ergänzend Schuster, Peter in Baatz / Müller-Funk (Hrg.) 1993, S. 27 ff.). In diesem Zusammenhang sprechen die Mathematiker (mündliche Auskunft eines Mathematikstudenten der Universität Dortmund) von Spielbäumen, an denen sich gut erkennen lässt, dass jede Entscheidung die späteren Entscheidungen beeinflusst und somit über Sieg oder Niederlage entscheidet. Kritik an der mathematischen Spieltheorie übte Roger Caillois, er erklärte, dass die mathematische Spieltheorie nicht das Spiel begünstigen würde, sondern viel mehr die Daseinsberechtigung des Spieles zerstören würde (Caillois 1960, S. 201).
[10] Bei noch lebenden Autoren werden die Geburtsdaten nicht angegeben.
[11] Baer in Baer (Hrg.) 1981, S. 183.
[12] Dass hinter dem Spiel, neben den bereits erwähnten Aspekten, auch ökonomische Aspekte stecken, kann der Leser sich vor Augen führen, in dem er bedenkt, dass in Deutschland der Umsatz mit klassischen Spielwaren mehr als zwei Milliarden Euro beträgt (Müller, Bernd, Focus-Magazin, Heft 48 / 2006a, S. 87 f.). Auf der anderen Seite lässt sich ein Rückgang der klassischen Spielwaren verzeichnen. Georg Giersberg erläutert dazu: „Viele Kinder kommen kaum noch mit traditionellem Spielzeug wie Eisenbahn, Plüschtieren, Puppen, Bilderbüchern oder Modellautos in Berührung. Schon fünf Jahre alte Kinder nutzen zunehmend das Handy. Mit sechs Jahren haben sie eine Videospielkonsole. Mit acht Jahren beginnen sie Computerspiele zu erwerben“ (Giersberg, F.A.Z. vom 6.11.2006). Bernd Müller ergänzt dazu: „Erwachsene nähmen sich oft keine Zeit mehr, mit ihren Kindern zu spielen. Ab etwa dem zwölften Lebensjahr bevorzuge außerdem ein Großteil der Jugendlichen den Computer als Spielpartner – mit Konsequenzen für die schulische Leistung.“ (Müller, Bernd, Focus-Magazin, Heft 48 / 2006a, S. 90). Dazu passt auch die Aussage von Mathias Greve, der Mitbegründer des Informationsportals Web.de ist, der in einem Interview folgendes über den Internetnutzer bzw. Spiele im Internet mitteilte: „Wir sehen, dass die Nutzer zwischendurch auch mal entspannen wollen und bieten dafür kurzweilige Spiele an. Man kann diese Spiele am Computer spielen oder gegen Gebühr auf das Handy laden“ (Pütz, Mobil – Das Magazin der Bahn, Heft 10 / 2006, S. 38). Exemplarisch kann hier auch auf die Homepages www.partypoker.com und www.schachmatt.de verwiesen werden, wo Menschen mittels des Internets gegeneinander spielen können.
[13] Weiterführende Literatur zu der Theorie des Spiels findet sich in „Theorien des Spiels“ von Hans Scheuerl (* 17. Januar 1919 † 5. Mai 2004).
[14] Renner 1997, S. 14.
[15] *428 od. 427 v.Chr. Athen† 347 ebd.
[16] *384v.Chr. Stageira (Chalkidike) †322v.Chr. Chalkis (Euböa).
[17] Henckmann / Lotter (Hrg.) 1992, S. 225. Siehe ergänzend Renner 1997, S. 10.
[18] Herbert Spencer (*1820 †1903) war wie Charles Darwin (* 12. Februar 1809 † 19. April 1882) ein Evolutionstheoretiker und Begründer der These „Survival of the fittest“.
[19] Flitner 1986, S.14.
[20] Siehe Flitner 1986, S. 14.
[21] *1.Februar 1846 †24.April 1924.
[22] Siehe Flitner 1986, S. 15 und Groos 1922, S. 21 f.
[23] Der Gedanke der Reinigung (Katharsis) durch das Spiel ging ursprünglich auf Aristoteles zurück (siehe Flitner 1986, S. 15).
[24] * 1873 † 1954.
[25] Flitner 1986, S. 15.
[26] *1861 †1946.
[27] Siehe Groos 1922, S. 20 ff. und Groos 1930, S. 59 ff.
[28] Zu der daraus folgenden Spieltherapie siehe Erikson 1999, S.217 ff.
[29] Flitner 1986, S. 15.
[30] Flitner 1986, S. 16.
[31] Hassenstein 1980, S. 190. Siehe ergänzend Groos 1930, S. 91 ff.
[32] Schiffler 1976, S. 19. Heinz Heckhausen erklärt in Anlehnung an Jean Piaget folgendes: „Durch sog. Kreisreaktionen – d.h. Wiederholungsfolgen von eigener Handlung, Wahrnehmung der Handlungswirkung usf. – werden kognitive >>Schemata<< von Objekten bzw. Person-Objekt-Bezügen >>assimiliert<<. Diesen kognitiven Prozess der >>reproduktiven Assimilation<< in der spielerischen Auseinandersetzung mit der noch unvertrauten Umwelt entspricht in affektiver und motivationaler Hinsicht wohl genau das, was in der vorliegenden Arbeit als Aktivierungszirkel zu fassen versucht wird. Jedenfalls hat Piaget darauf hingewiesen, dass die Kreisreaktionen (vor allem die sog. sekundären und tertiären) sich sozusagen selbst in Gang halten, solange die Objekte bzw. Handlungswirkungen in sich interessant, d.h. weder zu fremdartig (und damit erschreckend) noch zu vertraut (und damit langweilig) sind, also ein gewisses Anregungspotential besitzen. Es sei jedoch dahingestellt, ob allen Kreisreaktionen im Sinne Piagets ein Aktivierungszirkel zugrunde liegt. Andererseits gibt es ohne Frage in spielerischen oder sonstigen zweckfreien Handlungen Aktivierungszirkel, die nicht mit einer fortschreitenden Assimilation kognitiver Schemata, dem Vertrauterwerden von Umweltausschnitten und –bezügen verbunden sind; wie etwa die Glücksspiele des Erwachsenen“ (Heckhausen in Flitner 1973, S. 146 f.). Der Verfasser der Diplomarbeit hat auch die unveränderte dritte Auflage dieses Buches in der Hand gehabt und stellte fest, dass sich die Seitenzahlen in der dritten Auflage gegenüber der hier aufgeführten ersten Auflage nicht veränderten.
[33] Piaget 1975, S. 120.
[34] Piaget in Flitner (Hrg.) 1973, S. 126.
[35] Horn 1987, S. 70.
[36] Fritz 1993, S. 17.
[37] Piaget 1975, S. 140.
[38] Piaget 1975, S. 142.
[39] Auch bei Karl Bühler (* 27. Mai 1879 † 24. Oktober 1963) findet sich die Unterscheidung zwischen dem Funktionsspiel (Übungsspiel nach der Terminologie von Jean Piaget) und dem Illusionsspiel (Symbolspiel nach der Terminologie von Jean Piaget, siehe Bühler, Karl, 1958, S. 136).
[40] Bei Friedrich Fröbel gibt es schon Ansätze eines Symbolspieles. Die erste Spielgabe, der Ball, wird als Mittel benutzt, um andere Gegenstände darzustellen. Also kann der Ball nach der Auffassung von Friedrich Fröbel einen leblosen oder lebendigen Gegenstand darstellen (Fröbel 1982, S. 47 f.).
[41] Jean Chateau stand der Übung von Funktionen als Spiel kritisch gegenüber, er vertrat eher die Auffassung, dass das Spiel immer an das Vergnügen geknüpft ist und das Erleben von Neuem benötigt wird (siehe Chateau 1969, S. 7, 15 ff., 19).
[42] Piaget 1975, S. 146.
[43] Piaget 1975, S. 155. Weiterführend zur Funktionslust beim Spiel des Kindes kann hier auf Charlotte Bühler (* 20. Dezember 1893 † 5. Februar 1974) “Psychologie im Leben unserer Zeit”, Seite 167 f. verwiesen werden.
[44] Fritz 1993, S. 36 f.
[45] Piaget 1975, S. 147. Es lässt sich über das Spiel von Tieren festhalten: „Den Tieren müsste der agon (Wettkampf, Anm. d. Verf.) im Prinzip unbekannt sein, denn sie wissen weder etwas von Grenzen noch von Regeln; sie suchen lediglich im gnadenlosen Kampf einen brutalen Sieg zu erringen“ (Caillois 1960, S. 23). Ergänzend erklärt Bernhard Hassenstein: „Je höher jedoch die Tierarten entwickelt sind, desto deutlicher schiebt sich ein ganz andersartiger Lebensabschnitt in die Tierjungen-Entwicklung ein: das Spielalter, oder genauer: eine Zeitspanne, in der Erkunden, Neugierverhalten, Spielen und Nachahmen den wesentlichen Lebensinhalt darstellen. Ein solches Spielalter ist bei Säugetieren wie Eichhörnchen, Raubtieren, Affen und Menschenaffen ausgeprägt.“ (Hassenstein 1980, S. 189 ff.). Gustav Bally erklärt, dass, je intensiver die Brutpflege ist bzw. je länger die Jugendphase dauert, desto ausgeprägter auch das Spielverhalten bei der jeweiligen Art (Bally 1945, S. 57). Über das Spielverhalten von Tieren erklärt Brian Sutton-Smith folgendes: „Wie wir wissen, spielen höher stehende Tiere mehr als niedere Tiere“ (Sutton-Smith 1978, S. 83), aus dieser Erkenntnis formuliert er die These, dass höhere und komplexere Kulturen auch über einen größeren Spielereichtum verfügen (Sutton-Smith 1978, S. 83).
[46] Siehe Fußnote 17.
[47] Piaget 1975, S. 151.
[48] Jean Chateau sprach davon, dass mit der Entwicklung der Ich-Identität, überhaupt die Möglichkeit des symbolischen Spiels erst gegeben ist (Chateau 1969, S. 359).
[49] Piaget 1975, S. 162.
[50] Piaget 1975, S. 171.
[51] Fritz 1993, S. 37.
[52] Siehe Piaget 1975, S. 148.
[53] Siehe Piaget 1975, S. 149.
[54] Siehe Piaget 1975, S. 159.
[55] Piaget 1975, S. 164. Aus der Sicht des Verfassers gibt es auch im Tierreich solche Symbole und damit verbunden Symbol- bzw. Imitationsspiele.
[56] Eine symbolische Zuschreibung kann zum Beispiel sein, dass das Kind erklärt, dass dieser Holzklotz nun eine Nagelbürste darstellt und die damit verbundenen Handlungsabläufe imitiert.
[57] Fritz 1993, S. 37. Über die Lernmöglichkeiten im Rollenspiel lässt sich folgendes festhalten: „Es ist für die Ausweitung des Erfahrungsrepertoires im Spiel wichtig, möglichst verschiedene und viele Rollen in einem Spiel gespielt zu haben“ (Finkel / Decker-Voigt 1980, S. 15). Ergänzend erläutert Adelheid Stein († 26. Juni 2001) über die Lernmöglichkeiten beim sozialtherapeutischen Rollenspiel: „Das Sozialtherapeutische Rollenspiel will eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires und die Zunahme der Fähigkeit zu sozialer Kompetenz erreichen. Als Nahziel sind die Freude am Spiel und die Bereitschaft, sich und andere in der Gruppe zu erfahren“ (Stein 1983, S. 31). Karl Bühler erklärt über die Lernmöglichkeiten im Rollenspiel folgendes: „Die Bedeutung des Rollenspiels liegt darin, dass sie dem Kind hilft, die soziale Wirklichkeit zu verstehen, indem es sie nachahmt“ (Bühler, Karl, 1958, S. 140). Weiterführende Literatur zu den Lernmöglichkeiten im Rollenspiel findet sich in „Verhaltensänderung durch Rollenspiel“ von Johanna Hartung (siehe Fußnote Nummer 4).
[58] Peter L. Berger und Thomas Luckmann sowie Erving Goffman (* 11. Juni 1922 † 19. November 1982) stellen fest, dass im Spiel bzw. im Theater eine eigene Wirklichkeit entsteht bzw. aufgebaut wird (siehe dazu Berger / Luckmann 2004, S .28 und Goffman 1996, S. 19). Auch Roger Caillois erklärt, dass der Schauspieler, erst nachdem der Vorhang gefallen ist, wieder in die Wirklichkeit zurückkehrt (Caillois 1960, S.54).
[59] Piaget 1975, S. 170.
[60] Piaget 1975, S. 167.
[61] Sara Smilansky hält fest, dass das Rollenspiel aus einem vorhandenen Wissensvorrat schöpfen muss, welcher durch Beobachtungen erworben wird. Die gemachten Erfahrungen drücken sich im Handeln und Sprechen aus, was dazu führt, dass die Kinder dadurch auch kognitiv gefördert werden (Smilansky in Flitner (Hrg.) 1973, S. 153 f.).
[62] Piaget 1975, S.173 f.
[63] Heckhausen in Flitner (Hrg.) 1973, S. 142
[64] Siehe dazu Freud 1972, S. 251.
[65] Fritz 1993, S. 22. Siehe ergänzend dazu Waelder in Flitner (Hrg.) 1973, S. 52 ff.
[66] Murphy in Flitner (Hrg.) 1973, S. 101. Die These, dass affektgeladene Situationen im Rollenspiel nachgespielt werden, um sie zu kompensieren, wurde auch von Karl Bühler vertreten (siehe Bühler, Karl, 1958, S. 140). Die Erkenntnis, dass im Rollenspiel das Kind die Rollen wechselt und eine passive gegen eine aktive Rolle tauscht, hat bereits Sigmund Freud (* 6. Mai 1856 † 23. September 1939) 1920 in seinem Buch „Jenseits des Lustprinzips“ beschrieben (siehe dazu Freud 1987, S 15).
[67] Piaget 1975, S. 176.
[68] Piaget 1975, S.178.
[69] Piaget 1975, S. 179.
[70] Piaget 1975, S. 180.
[71] Piaget 1975, S. 181.
[72] Georg Herbert Mead vertrat die Ansicht, dass das Spielen etwas anderes ist, als ein Spiel nach Regeln, er vertrat die Ansicht, dass das Spiel mit Verkleidung (mimikry) und Rausch (ilinx) in Verbindung steht und nannte als Beispiel dafür die mythischen Spiele der primitiven Völker (Mead 1969, S. 280).
[73] Piaget 1975, S. 149 f. Johan Huizinga (* 7. Dezember 1872 † 1. Februar 1945) erklärte, dass der Spielverderber sich den Spielregeln widersetzt und dadurch die Illusion des Spiels, die inclusio, zerstört, deswegen muss der Spielverderber der Vernichtung preisgegeben werden, weil er die Spielgemeinschaft in ihrem Bestand bedroht (Huizinga 1958, S. 18 f.). Volker Gerhardt vertritt die Meinung, dass das Spiel aufgrund der Fairness unterbrochen bzw. abgebrochen werden soll, wenn der Spielcharakter gefährdet ist und es im existentiellen Sinne ernst wird (Gerhardt in Gerhardt / Lämmer (Hrg.) 1995, S. 24). Manfred Eigen und Ruthild Winkler erklären, dass die Spielregeln zur Abgrenzung des Spiels gegenüber der Außenwelt dienen und dass der Spielverderber diese Regeln missachtet. Ihrer Meinung nach sind diese Spielregeln trivialer Natur und ihr Erlernen erfordert nicht besondere geistige Anstrengungen, eher ist eine gute Menschenkenntnis wichtig, um zu gewinnen (Eigen / Winkler 1975, S .18 ff.). Sara Smilansky stellt über die Spielregeln fest, dass sie relativ spezifisch und auch relativ willkürlich sind. Sie beruhen einfach auf einer Übereinkunft der spielenden Kinder und meistens sind sie durch Traditionen festgelegt und werden kaum verändert (Smilansky in Flitner (Hrg.) 1973, S. 162 f.). Aus der Sicht des Verfassers ist es das Wichtigste, dass die Kinder erkennen, dass die Spielregeln Absprachen darstellen und diese Absprachen, zusammen mit der Spielgemeinschaft, auch veränderbar sind. Siehe dazu ergänzend Partecke 2002, S. 58 f.
[74] Piaget 1975, S. 183.
[75] Piaget 1975, S. 183.
[76] Deswegen ist es umso wichtiger, dass das Kind die Möglichkeit hat, sein eigenes freies Spiel auszuleben. In diesem Kontext erklärt Erdmute Parte>
[77] Piaget 1975, S. 183.
[78] Piaget 1975, S. 184.
[79] Piaget 1975, S. 184.
[80] Piaget 1975, S. 184 f.
[81] Dieses ist eines der vier Grundprinzipien der Spieltheorie von Roger Caillois, welche da sind: Glück, Wettkampf, Maske und Rausch.
[82] Piaget 1975, S. 185. Nach der Auffassung von Jean Chateau besitzt jedes Spiel, mit Ausnahme der funktionalen Spiele einen agonalen Faktor (siehe Chateau 1969, S. 33).
[83] Der agonale Faktor ist bei uns Menschen weit verbreitet, so lässt sich auch das Wettkampftrinken als „Sport“ erklären. Siehe auch exemplarisch Doubek 1999, S. 113.
[84] Heckhausen in Flitner (Hrg.) 1973, S. 134.
[85] Ein treffendes Beispiel über die Spannung im Spiel bildet der Werbespruch des Wettanbieters betandwin.de, der wie folgt lautet: „Lust auf Spannung?“. Wetten sind nach der Auffassung von Roger Caillois auch Spiele, welche zu dem Spielaspekt „alea“ (Chance) gehören. Siehe dazu auch Scheuerl 1968, S. 91.
[86] Hans Scheuerl vertritt über die Merkmale bzw. die Natur des Spiels folgende Auffassung: „Wir können nun sagen, Spiel sei frei, in sich unendlich, scheinhaft, ambivalent, geschlossen und an eine lebendige erfüllte Gegenwärtigkeit gebunden. Aber was da frei, in sich unendlich, scheinhaft, ambivalent usw. ist, blieb bisher unbeantwortet. Noch ist es fraglich, ob von „dem“ Spiel überhaupt gesprochen werden darf“ (Scheuerl 1968, S. 105).
[87] Nach der Auffassung von Erdmute Partecke braucht jede gedankliche Tätigkeit eine handelnde Auseinandersetzung mit der Umwelt (Partecke 2002, S.59).
[88] Heckhausen in Flitner (Hrg.) 1973, S. 135.
[89] Weiterführend zur Angstfreiheit bzw. über das „entspannte Feld“ als Grundvorrausetzung des Spielens kann hier auf Gustav Bally 1945, Seite 23 f. verwiesen werden.
[90] Siehe Hassenstein 1980, S. 191, Erikson 1999, S. 207, Fritz 1993, S. 34 f. und Sutton-Smith / Sutton-Smith 1986, S. 232.
[91] Sutton-Smith / Sutton-Smith 1986, S. 231.
[92] Heckhausen 1980, S. 608. In der 3. Auflage des Werkes gehen die Verfasser Heinz Heckhausen und Jutta Heckhausen auf das Spiel und ihre intrinsische Motivation nicht mehr ein. Des Weiteren ist der Fachbegriff der intrinsischen Motivation nach den Worten der Verfasser eine Jagd nach einen Phantom und sollte im fachlichen Kontext genauer definiert werden (Heckhausen / Heckhausen 2006, S. 332 f.).
[93] Baer in Baer (Hrg.) 1981, S. 18. Die These der Zweckfreiheit des Spiels wurde auch von Frederik J.J. Buytendijk (* 29. April 1887 † 21. Oktober 1974), Jean Chateau und Roger Caillois vertreten (siehe dazu Buytendijk 1956, S.301, Chateau 1969, S. 14 und Caillois 1960, S. 30).
[94] Siehe weitergehend über die gesellschaftliche Konstruktion der Realität: Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas: „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“.
[95] Heckhausen in Flitner (Hrg.) 1973, S. 147.
[96] Csikszentmihalyi 2001, S. 45 f.
[97] Waelder in Flitner (Hrg.) 1973, S. 60.
[98] Heckhausen in Flitner (Hrg.) 1973, S. 145. Siehe dazu auch den Begriff der „Interpunktion von Ereignisfolgen“ nach Paul Watzlawick (* 25. Juli 1921 † 31. März 2007 [Watzlawick / Beavin / Jackson 2003, S. 57 ff.]).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836611480
- DOI
- 10.3239/9783836611480
- Dateigröße
- 472 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Dortmund – Sozialarbeit
- Erscheinungsdatum
- 2008 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- selbstwertgefühl identität spieltheorie strategiespiele anerkennung
- Produktsicherheit
- Diplom.de