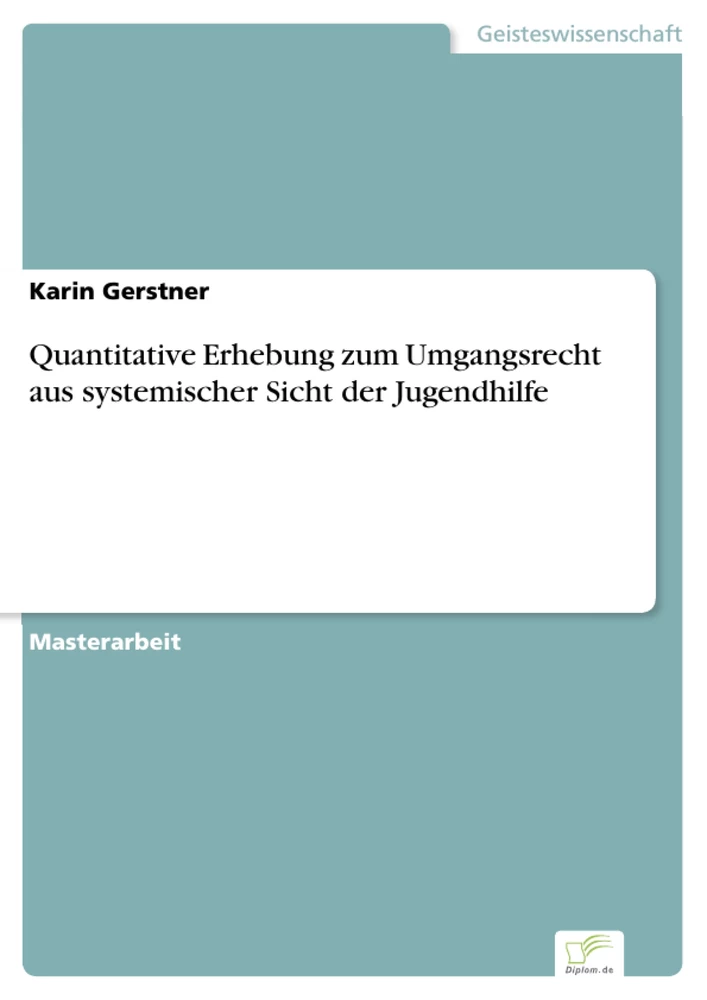Quantitative Erhebung zum Umgangsrecht aus systemischer Sicht der Jugendhilfe
Zusammenfassung
Derzeit kann damit gerechnet werden, dass bundesweit mehr als ein Drittel der Ehen, früher oder später, durch eine Scheidung beendet werden.
Die Anzahl der hiervon bundesweit betroffenen Kinder hat im Vergleich zum Jahr 2001 mit 153.520 Kindern, im Jahr 2002 mit 160.100 Kindern erneut zugenommen. Wahrscheinlich würde sich die Anzahl der betroffenen Kinder weiter erhöhen, wenn die Eltern, die mit ihren Kindern in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben und sich trennen, mitberücksichtigt worden wären.
Trennung und Scheidung verursachen für die Betroffenen, Eltern und Kinder, neben den psycho-sozialen und wirtschaftlichen Folgen auch hohe finanzielle Kosten für die Solidargemeinschaft, deren Begrenzung und Lösung genauso wichtig ist wie Prävention, Beratung und die Weiterentwicklung gesetzlicher Grundlagen.
1982 wurde erstmals durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass nach einer Trennung der Eltern die familiären Sozialbeziehungen fortbestehen und eine entscheidende Grundlage für die psycho-soziale Entwicklung des Kindes/ der Kinder darstellen. Somit wird die Elternschaft durch eine Trennung der Partner nicht beendet. Für die Kinder und Jugendlichen ist es jetzt wichtig, dass ihre getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern ihnen als Mutter und Vater erhalten bleiben, unabhängig von der Sorgerechts- oder Umgangsregelung.
Bei meiner Tätigkeit in einem Jugendamt des Saarlandes konnte ich beobachten, dass es bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern häufig zu Kontaktabbrüchen zwischen einem Elternteil und dem Kind/ den Kindern kommt.
In diesen Fällen haben Eltern die Möglichkeit sich an das Jugendamt zu wenden, um dort eine Klärung ihrer Umgangsangelegenheiten zu erreichen. Scheitert die Vermittlung durch das Jugendamt, dann kann jeder Elternteil das Familiengericht zur Klärung der Umgangsstreitigkeit anrufen.
Trotz des Beratungsangebots des Jugendamtes oder eines Beschlusses durch das Familiengericht kann es wiederholt zu Kontaktabbrüchen zwischen einem Elternteil und dem Kind/ den Kindern kommen. Dabei können sich unausgestandene, nicht geklärte Paarkonflikte erschwerend auf eine verantwortliche Wahrnehmung, Durchführung oder Ausübung der Umgangsregelung auswirken. Häufig werden die nicht bearbeiteten Konflikte nicht auf der Paarebene, sondern auf der Elternebene ausgetragen.
Multiple Problemlagen der Eltern oder eines Elternteils können sich ebenfalls ungünstig auf die Erarbeitung von […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einleitung
2. Rahmenbedingungen des Umgangsrechts
2.1 Gesetzliche Grundlagen
2.2 Kindeswohl und Kindeswille
2.3 Aufgaben des Jugendamtes
2.4 Familiengericht
2.5 Eltern-Kind-Beziehung und Umgangsrecht
2.6 Zusammenfassung
3. Lebenslagen der Eltern und Kinder
3.1 Getrennt lebende oder geschiedene Eltern mit und ohne neuen Lebenspartner
3.2 Trennungs- und Scheidungskinder
3.2.1 Parental alienation syndrom (PAS)
3.3 Zusammenfassung
4. Regelungshilfen
4.1 Begleiteter Umgang
4.2 Verfahrenspfleger
4.3 Hilfe zur Erziehung
4.4 Zusammenfassung
5. Methodisches Vorgehen
5.1 Aktenanalyse
5.2 Erstellung der Forschungsfragen und der Hypothese
5.3 Entwicklung eines Erhebungsbogens
5.3.1 Pretest
5.3.2 Überarbeitung des Erhebungsbogens
5.3.3 Reliabilität
5.3.4 Validität
5.4 Auswahl und Definition der Variablen
5.5 Festlegung der Stichprobe
5.6 Erstellung der Datenmatrix
5.6.1 Eingabe der Daten
5.6.2 Auswertung der Daten
5.7 Anwendung Statistischer Verfahren
5.7.1 Graphische Darstellung der Daten
5.8 Überprüfung der Forschungsfragen und der Hypothese
5.8.1 Erweiterung des Forschungsfeldes
5.9 Diskussion der Ergebnisse
5.10 Zusammenfassung
6. Schlussbetrachtung
7. Literaturverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Erhebungsbogen
Operationalisierung der Variablen
Erhebungsbogen mit der Codierung der Kategorien
Übersicht über Tabellen und Grafiken
Erklärung
Vorwort
Zunächst möchte ich mich bei den Personen bedanken, welche mir die Bearbei-tung des Themas meiner Abschlussarbeit im Masterstudiengang Klinische Sozial-arbeit ermöglichten.
Mein besonderer Dank gilt meinem Arbeitgeber, welcher der Aktenanalyse im Jugendamt zustimmte.
Die Teilnahme am Masterstudiengang Klinische Sozialarbeit ermöglichte es mir, mich in fachlicher, als auch in persönlicher Hinsicht weiter zu entwickeln. Hier gilt mein besonderer Dank Herrn Pauls an der Fachhochschule Coburg und Frau Geissler-Piltz an der ASFH-Berlin, die diesen Studiengang in der jetzigen Form ermöglichten.
Des Weiteren möchte ich mich für die Unterstützung bei der Bearbeitung des Themas bei Herrn Pauls und Herrn Buchholz-Schuster bedanken, welche sich auch dazu bereit erklärten, die gutachterliche Tätigkeit zu übernehmen.
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei meinem Kollegen Reimund Klauke, der mir bei fachlichen Diskussionen immer wieder wertvolle Anregungen zur weiteren Bearbeitung des Themas gab.
Mein ebenso großer Dank gilt auch meinen Freunden Tina Raffauf und Mike Nilles, welche sich dazu bereit erklärten, das Manuskript der Masterarbeit kritisch zu sichten.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Eltern Christine und Dietmar Gerstner sowie bei meiner Schwester Elke Gerstner für die liebevolle Unterstützung und die Motivation, weiter zu schreiben, bedanken.
1. Einleitung
Derzeit kann damit gerechnet werden, dass bundesweit mehr als ein Drittel der Ehen, früher oder später, durch eine Scheidung beendet werden.
Die Anzahl der hiervon bundesweit betroffenen Kinder hat im Vergleich zum Jahr 2001 mit 153.520 Kindern, im Jahr 2002 mit 160.100 Kindern erneut zugenommen.[1]
Wahrscheinlich würde sich die Anzahl der betroffenen Kinder weiter erhöhen, wenn die Eltern, die mit ihren Kindern in einer nichtehelichen Lebensgemein-schaft leben und sich trennen, mitberücksichtigt worden wären.
Trennung und Scheidung verursachen für die Betroffenen, Eltern und Kinder, neben den psycho-sozialen und wirtschaftlichen Folgen auch hohe finanzielle Kosten für die Solidargemeinschaft, deren Begrenzung und Lösung genauso wichtig ist wie Prävention, Beratung und die Weiterentwicklung gesetzlicher Grundlagen.[2]
1982 wurde erstmals durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass nach einer Trennung der Eltern die familiären Sozialbeziehungen fortbestehen und eine entscheidende Grundlage für die psycho-soziale Entwicklung des Kindes/ der Kinder darstellen. Somit wird die Elternschaft durch eine Trennung der Partner nicht beendet (Jugendhilfe 43/2005, 259). Für die Kinder und Jugend-lichen ist es jetzt wichtig, dass ihre getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern ihnen als Mutter und Vater erhalten bleiben, unabhängig von der Sorgerechts- oder Umgangsregelung (von Eckardstein, L. u.a. 1998, 5).
Bei meiner Tätigkeit in einem Jugendamt des Saarlandes konnte ich beobachten, dass es bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern häufig zu Kontakt-abbrüchen zwischen einem Elternteil und dem Kind/ den Kindern kommt.
In diesen Fällen haben Eltern die Möglichkeit sich an das Jugendamt zu wenden, um dort eine Klärung ihrer Umgangsangelegenheiten zu erreichen. Scheitert die Vermittlung durch das Jugendamt, dann kann jeder Elternteil das Familiengericht zur Klärung der Umgangsstreitigkeit anrufen.
Trotz des Beratungsangebots des Jugendamtes oder eines Beschlusses durch das Familiengericht kann es wiederholt zu Kontaktabbrüchen zwischen einem Elternteil und dem Kind/ den Kindern kommen. Dabei können sich unaus-gestandene, nicht geklärte Paarkonflikte erschwerend auf eine verantwortliche Wahrnehmung, Durchführung oder Ausübung der Umgangsregelung auswirken. Häufig werden die nicht bearbeiteten Konflikte nicht auf der Paarebene, sondern auf der Elternebene ausgetragen.
Multiple Problemlagen der Eltern oder eines Elternteils können sich ebenfalls ungünstig auf die Erarbeitung von Umgangsregelungen auswirken.
Anhand einer Aktenanalyse zur Umgangsregelung möchte ich einen Teil der sozialen Realität der Jugendamtsmitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst erfassen. Es interessiert mich zu erfahren, „Warum es den Helfern[3], in einigen Fällen, nicht dauerhaft gelingt, trotz der vielfältigen Handlungsmöglichkeiten, eine Umgangsregelung mit den Eltern, unter Berücksichtigung der Kindesinteressen, zu erarbeiten?“
Im Mittelpunkt meiner Masterarbeit steht wie bereits erwähnt eine Aktenanalyse zur Umgangsregelung.
Im Theorieteil werden die rechtlichen Möglichkeiten der Helfer, sowie die viel-fältigen Lebenssituationen, in welchen sich Kinder, Jugendliche und Eltern be-finden können, beschrieben. Anschließend wird mit Hilfe eines selbst erstellten Erhebungsbogens versucht, die komplexe Situation der Umgangsherstellung aufzuzeigen und darzustellen.
Im ersten Teil (Kapitel 2) meiner Arbeit werden die Rahmenbedingungen des Um-gangsrechts erläutert. Hierzu zählen die gesetzlichen Grundlagen der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts.
Des Weiteren werden die Begriffe „Kindeswohl“ und „Kindeswille“ in diesem Zusammenhang aufgezeigt.
Die Darstellung des Aufgabenbereichs des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Jugendamt im Hinblick auf die Unterstützung der Eltern bei der Erarbeitung von Umgangsregelungen und die Zusammenarbeit mit dem Familiengericht, sowie die Bedeutung des Umgangsrechts für die Eltern-Kind-Beziehung, stellen einen weiteren wichtigen Bereich dieses Abschnitts dar.
Nach dem einführenden Überblick durch Kapitel 2, gliedert sich die Masterarbeit in weitere vier Teile.
Im Blickfeld des zweiten Teils (Kapitel 3) werden die unterschiedlichen Lebenslagen der Eltern und Kinder beschrieben. Hierzu zählt die Lebenssituation getrennt lebender oder geschiedener Eltern mit und ohne neuen Lebenspartner, aber auch die Lebenssituation der Trennungs- und Scheidungskinder wird anhand der bestehenden Literatur kurz aufgezeigt. Das „Parental alienation syndrom“ (PAS) möchte ich unter Punkt 3.1.2 beschreiben, da unter anderem hierdurch Kontaktabbrüche zwischen dem Kind/ den Kindern und einem Elternteil verstärkt werden können.
Im dritten Teil (Kapitel 4) werden ausgewählte Regelungshilfen aufgezeigt, wie die in der Literatur beschriebene Vielfalt der Formen des begleiteten Umgangs und der Verfahrenspflegschaft. Unter Punkt 4.3 wird die Hilfe zur Erziehung in diesen Kontext integriert. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass die Hilfe zur Erziehung nicht zu den in der einschlägigen Literatur beschriebenen Regelungs-hilfen zählt.
Einen Schwerpunkt dieser Arbeit bildet das methodische Vorgehen bei der Akten-analyse zum Umgangsrecht im vierten Teil (Kapitel 5).
Die Formulierung des Forschungsproblems mit den zu testenden Fragen und der erstellten Hypothese, die Entwicklung eines Erhebungsbogens, die Beschreibung der Durchführung des Pretest, sowie die Überarbeitung des Erhebungsbogens und die Gütekriterien wie Reliabilität und Validität werden ausführlich erläutert.
Des Weiteren wird auf die Auswahl und Definition der Variablen, die Definition der Stichprobe, das verwendete Messinstrument sowie die Art der Durchführung, die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Auswertung der Daten mit der Software SPSS beschrieben. Im Anschluss werden die Ergebnisse der quanti-tativen Erhebung zum Umgangsrecht dargestellt und diskutiert.
Mein persönlicher Standpunkt bezüglich des gewählten Themas fließt in den fünften Teil (Kapitel 6) mit ein.
Das Hauptanliegen meiner Masterarbeit ist es, die Komplexität der Fälle, welche dem Jugendamtsmitarbeiter[4] bekannt werden, aufzuzeigen und darzustellen, um diese anschließend anhand der erhobenen Ergebnisse zu diskutieren und der Beantwortung der Frage: „Warum es den Helfern in einigen Fällen nicht dauerhaft gelingen kann, eine Umgangsregelung mit den Eltern, unter Berücksichtigung der Kindesinteressen, zu erarbeiten“ näher zu kommen.
Des Weiteren möchte ich auf das Abkürzungsverzeichnis, den Erhebungsbogen, die Operationalisierung der Variablen, den Erhebungsbogen mit der Codierung der Kategorien und die Übersicht über Tabellen und Grafiken, welche sich im Anhang befinden, hinweisen.
2. Rahmenbedingungen des Umgangsrechts
Eine wichtige Voraussetzung für das Wohlergehen des Kindes nach einer Tren-nung und Scheidung ist der ungestörte Zugang zu beiden Eltern. Dies belegen auch die aktuellen Ergebnisse der Scheidungsforschung.
Zum Beispiel dient ein konfliktfreier Umgang der leichteren Anpassung des Kindes an die Nachscheidungssituation.[5]
Des Weiteren wird dem Bedürfnis und dem Wunsch des Kindes, Kontakt zu beiden Eltern aufrecht zu erhalten, Rechnung getragen, so dass die Beziehung und Bindung zum getrennt lebenden Elternteil erhalten bleibt. Die geschlechts-spezifischen erzieherischen Einflüsse von Mutter und Vater können sich durch die Umgangskontakte weiterhin ergänzen und auf das Kind auswirken (Balloff. 2004, 187).
Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen der elterlichen Sorge, das Umgangsrecht, das Kindeswohl und der Kindeswille, die Aufgaben des Jugend-amtes und des Familiengerichts, sowie die Bedeutung des Umgangsrechts für die Eltern-Kind-Beziehung dargestellt.
2.1 Gesetzliche Grundlagen
Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen (§ 1626 Abs. 3 S.1 BGB). Hieraus folgt ein förmliches Umgangsrecht des Kindes mit jedem Elternteil gemäß § 1684 Abs. 1 HS. 1 BGB. Mit dem Recht des Kindes korrespondiert die Pflicht und das Recht der Eltern, mit dem Kind Umgang zu pflegen, unabhängig von der sorgerechtlichen Lage (§1684 Abs. 1 HS. 2 BGB) (Schwab 1999, 322).
Ein Recht auf persönlichen Umgang mit seinem Kind hat somit auch ein Elternteil, „dem das Personensorgerecht nicht zusteht, weil er etwa als mit der Mutter nicht verheirateter Vater mangels Sorgeerklärung nicht sorgeberechtigt ist (§1626a Abs.2 BGB), ebenso auch der Elternteil, dem aufgrund einer Regelung nach § 1671 BGB nicht mehr zusteht, oder weil es ihm gemäß § 1666 BGB entzogen worden ist (sich um am Kindeswohl orientierte Einzelfallgefährdung handelte). (vgl. Fieseler, Herborth. 2005, 243).
Auch wenn das Kind in einer Pflegefamilie lebt, haben beide Eltern das Recht und die Pflicht, Umgangskontakte wahrzunehmen. Ein Umgangsrecht der Eltern besteht auch, wenn den Eltern die elterliche Sorge entzogen wurde und das Kind zunächst bei einer anderen Person oder in einer Einrichtung lebt, aber nur, wenn durch die Ausübung das Kindeswohl nicht gefährdet wird (Schwab 1999, 323).
Das Umgangsrecht des nichtsorgeberechtigten Elternteils steht ebenso wie die elterliche Sorge des anderen Elternteils gemäß Art. 6 Abs. 2 S.1 GG unter dem besonderen Schutz des Staates.[6] Des Weiteren erwächst das Umgangsrecht aus dem natürlichen Elternrecht und der damit verbundenen Verantwortung.[7]
Bei der Ausübung des Rechts ist der Elternteil gemäß § 18 Abs. 3 S. 3 SGB VIII zu beraten und zu unterstützen. Gleichzeitig soll das Kind darin unterstützt werden, dass die Umgangsberechtigten von diesem Recht Gebrauch machen (§ 18 Abs. 3, S. 2 SGB VIII).
Nach dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz -KICK- haben zu-künftig „Umgangsberechtigte mit tatsächlich oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland ein Recht auf Beratung und Unterstützung durch das Jugendamt bei der Ausübung ihres Rechts im Umgang mit ihren in Deutschland lebenden Kindern.“ (Fieseler, Busch 2005, 254).
„Wesentlicher Aspekt des Umgangsrechts ist die Befugnis des Umgangs-suchenden, „das Kind in regelmäßigen Abständen persönlich zu sehen und zu sprechen, und zwar ohne Gegenwart einer Aufsichtsperson.“[8]
Der Umgangssuchende soll somit die Möglichkeit erhalten, sich von dem Wohl-ergehen des Kindes zu überzeugen. Der persönliche Kontakt zum Kind soll einer Entfremdung zum getrennt lebenden Elternteil entgegenwirken.[9]
Allerdings kann brieflicher oder telefonischer Kontakt den persönlichen Kontakt zum Kind nicht ersetzen. Die Grenzen gerichtlicher Gestaltungsmöglichkeiten und gerichtlicher Eingriffs-befugnisse ergeben sich aus den hier beschriebenen wesentlichen Aspekten des Umgangsrechts (Wiedenlübbert 2005, 248).
In diesem Rahmen wird auf den Personenkreis weiterer Umgangsberechtigter wie Großeltern, Geschwister, Lebenspartner etc. gemäß § 1685 BGB nicht weiter eingegangen (Fieseler, Herborth. 2005, 243).
2.2 Kindeswohl und Kindeswille
Kindeswohl und Kindeswille sind zwei bedeutsame Begriffe, die das Schicksal von Personen stark beeinflussen können und bei der Umsetzung in die Praxis für Unklarheit und Unsicherheit sorgen.
So ist der Kindeswille Bestandteil des Kindeswohls. Allerdings muss das Kindes-wohl nicht dem Kindeswillen entsprechen (Maywald 2005, 236).
Im Begriff des Kindeswohls vereinen sich juristische, psychologische und sozial-pädagogische Aspekte.
Auf internationaler Ebene ist das „Kindeswohl“ in der UN–Kinderrechts-konvention, dem Haager Minderjährigenschutzabkommen, dem Haager Kindes-entführungsübereinkommen und in dem Europäischen Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten verankert.
Im innerstaatlichen Privatrecht wird das Kindeswohl im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in der öffentlichen Jugendhilfe, im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK), angewendet (Fieseler, Herborth 2005, 74).
Auch sind die Regelungszusammenhänge, in denen der Begriff des Kindeswohls gebraucht wird, sehr vielfältig, „wie sich an der elterlichen Sorge, dem staatlichen Wächteramt und dem Jugendhilferecht verdeutlichen lässt.“[10]
Zum Beispiel stellt das Wohl des Kindes die einzige Legitimation dar, in das grundrechtlich geschützte Elternrecht, bei dessen Nichtbeachtung, einzugreifen (Wiedenlübbert, 2005, 246).
Des Weiteren ist das Kindeswohl das Leitprinzip der elterlichen Sorge gemäß § 1626 BGB und entsprechender Gerichtsentscheidungen. Der § 1697a BGB verpflichtet somit alle Gerichte, bei Sorgerechtsentscheidungen auf die Einhal-tung und Verwirklichung des Kindeswohls zu achten. Dies trifft auch für Entscheidungen zum Umgangsrecht zu (Fieseler, Herborth 2005, 74).
Grundsätzlich dient der Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil seinem Wohl, unabhängig davon, ob die Eltern miteinander verheiratet sind, verheiratet waren und die gemeinsame elterliche Sorge oder die alleinige elterliche Sorge besteht.
Nur wenn vorher durch das Gericht festgestellt wurde, dass durch eine be-stehende Umgangsausübung dem Kindeswohl geschadet wird, kann der Umgang ausgesetzt, eingeschränkt oder gar ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss des Umgangsrechts muss geeignet, erforderlich und in der konkreten Situation angemessen sein. So kommt ein Ausschluss des Umgangsrechts nicht in Frage, wenn durch eine Form des begleiteten Umgangs die Kindeswohlgefährdung nicht mehr gegeben ist. Der begleitete Umgang stellt eine zeitlich begrenzte Krisen-intervention dar und verfolgt das Ziel, den Umgang des Kindes mit dem Um-gangssuchenden zu verselbständigen. Hier wird das Familiengericht in regel-mäßigen Abständen seinen Eingriff in den grundrechtlich geschützten Bereich des Umgangsrechts überprüfen müssen.
Ein Ausschluss des Umgangsrechts wird bei bewiesenem sexuellem Missbrauch eher bejaht, allerdings wird es problematisch bei Verdachtsfällen. Selbst in den Fällen häuslicher Gewalt wird ein dauerhafter Ausschluss des Umgangsrechts nicht einfach durchzusetzen sein.
Bei Umgangsstreitigkeiten kann beobachtet werden, dass in einigen Fällen ein Elternteil oder die Eltern das Kind zur Durchsetzung seiner/ihrer eigenen Interessen zu instrumentalisieren versucht/-en. Unter Umständen kann auch hierin eine Kindeswohlgefährdung liegen.
Bei einer Anhörung des Kindes vor dem Familiengericht kann die gedankliche Unterscheidung zwischen dem „erklärten“ und dem „wirklichen“ Willen des Kindes hilfreich sein, um nicht die Widergabe des Willens eines Elternteil zu erhalten (Wiedenlübbert 2005, 247 ff.).
Zum Einem ist der Kindeswille ein Ausdruck für die relativ stärkste Personenbindung. Zum Anderem stellt er eine Möglichkeit der Selbstbestimmung des Kindes dar (Fieseler, Herborth 2005, 82). So kann, wenn keine nachvollziehbaren Gründe vorliegen, eine Entscheidung gegen den Kindeswillen angeordnet werden, um den Kontakt zwischen dem Kind und dem Umgangssuchenden herzustellen. Bei kleineren Kindern geht das Familiengericht davon aus, dass der entgegenstehende Kindeswille durch geeignete erzieherische Maßnahmen des betreuenden Elternteils überwunden werden kann. Je älter ein Kind, desto schwerer wiegt der geäußerte Wille. Die Einsichts-fähigkeit und die persönliche Entwicklung des Kindes werden als Maßstab des Willens des Kindes mitberücksichtigt. Rechtlich bedenklich und auch nicht umsetzbar wäre somit eine gerichtlich angeordnete Umgangsregelung gegen den Willen eines älteren Kindes (Wiedenlübbert 2005, 252).
Um den Begriff des Kindeswohls genauer bestimmen zu können, ist auch ein Bezug auf die Grundbedürfnisse und Grundrechte des Kindes notwendig (Maywald 2005, 237).
Aus familienpsychologischer Sicht heraus kann das Wohl des Kindes wie folgt definiert werden: Das Kindeswohl ist die „für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugendlichen günstigste Relation zwischen seiner Bedürfnislage und seinen Lebensbedingungen“ (Dettenborn 2001, 49).
Das Kindeswohl stellt somit keine konstante Größe dar, sondern bleibt auf den Einzelfall bezogen ein spezifischer und veränderlicher Prozess, welcher von personellen Faktoren des Kindes und seiner Eltern, sowie von sozialen Schutz- und Risikofaktoren mit bedingt wird.
Wie bereits beschrieben können Kindeswohlgefährdungen durch einen Missbrauch der elterlichen Sorge, Versagen der Eltern und Kindesvernach-lässigung auftreten. Eine Gefährdung des Kindeswohls kann auf der körperlichen, geistigen und/oder seelischen Ebene des Kindes geschehen. Aller-dings lassen sich diese einzelnen Gefährdungszonen nicht klar voneinander trennen. Hiermit möchte der Gesetzgeber verdeutlichen, dass es um einen umfassenden Schutz des in der Entwicklung befindlichen Kindes und Jugendlichen geht (Fieseler, Herborth 2005, 77-79).
Eine Kindeswohlgefährdung ist demnach “die Überforderung der Kompetenzen eines Kindes, vor allem der Kompetenzen, die ungenügende Berücksichtigung seiner Bedürfnisse in seinen Lebensbedingungen ohne negative körperliche und /oder psychische Folgen zu bewältigen“ (Dettenborn 2001, 55).
Abschießend kann festgehalten werden, dass es keine allgemeingültigen Min-deststandards zur Bestimmung des Wohls des Kindes gibt, welche „Grund-bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen benennen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in unserer Gesellschaft als verbindlicher, maximaler Standard des Kindeswohls gelten könnten.“[11]
Allenfalls gibt es Urteilsspielräume bei Kindeswohlgefährdungen, welche von einer Vielzahl von personalen und sozialen Schutz- und Risikofaktoren beein-flusst werden. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass das Familiengericht und das Jugendamt nicht nur gegenwärtige Gefährdungen für das Kindeswohl beurteilen, sondern auch künftige Gefährdungen, die durch Nicht- Eingreifen des Gerichtes oder des Jugendamtes auftreten würden, ausschließen sollen (Dettenborn 2001, 56-57).
2.3 Aufgaben des Jugendamtes
Die Deregulierungstendenzen des Gesetzes der Kindschaftsrechtsreform vom 01.07.1998 richten sich bei einer Trennung und Scheidung der Eltern auf eine Phase der familiären Entwicklung, die gekennzeichnet ist von innerer und äußerer Destabilität und mit Risiken für das Wohl des Kindes/ der Kinder verbunden sein kann. Deshalb wurde ein gesetzlich verankertes Beratungsangebot im Kinder- und Jugendhilfegesetz geschaffen (bke. e.V. 2005, 260).
Das Jugendamt wird auf der rechtlichen Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes tätig, wenn minderjährige gemeinschaftliche Kinder von der elterlichen Trennung betroffen sind. Der Elternteil, der den Scheidungsantrag stellt, muss auch die gemeinschaftlichen Kinder angeben. Diese Angabe bedingt eine Informationskette, die vom Gericht ausgeht. Das Gericht informiert das Jugendamt über die Rechtsanhängigkeit von Scheidungssachen und teilt Namen und Anschrift der Betroffenen mit. Jetzt ist das Jugendamt von Amts wegen dazu verpflichtet, die Eltern über die bestehenden Leistungen der Jugendhilfe zu informieren. Zu den Aufgaben der Jugendhilfe zählen gemäß § 17 KJHG die Be-ratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.
Nach § 17 Abs. 1 KJHG haben Mütter und Väter einen Anspruch auf die Beratungsleistung des Jugendamtes. Während sich § 17 Abs. 1 Nr. 3 KJHG auf die Beratung der Eltern zu einer förderlichen Wahrnehmung ihrer Elternver-antwortung beschränkt, bezieht sich § 17 Abs. 2 KJHG auf die Erarbeitung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge unter angemessener Beteiligung des Kindes oder Jugendlichen (Leyhausen 2000, 52-53).
Durch eine angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Beratungsprozess gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2, 3 KJHG, wird ihnen durch die „Achtung ihrer Würde und ihres Rechts auf störungs- und gefährdungsfreie Ent-faltung ihrer Persönlichkeit (Art. 1 GG und Art. 2 GG) in ihrer Familie und mit ihren Eltern (Art. 6 Abs. 2 GG) ausdrücklich unter Beachtung der UN- Kinderrechts-konvention (Art. 3,4,9,18, UN-Kinderrechtskonvention) Rechnung getragen.[12]
Aus psychologischen und pädagogischen Gründen werden Kinder und Jugend-liche nur an den Gesprächen mit den Eltern beteiligt, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen. § 8 Abs. 1 KJHG sieht vor, dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen sind. Dementsprechend sind sie auch auf ihre Rechte im Gerichtsverfahren hinzuweisen. Im Jugendamt finden dementsprechend Ge-spräche mit den betroffenen Kindern statt, um ihre Wünsche, Sorgen und Ängste bzgl. der Umgangskontakte in Erfahrung zu bringen.
In § 17 Abs. 2 KJHG wird das Umgangsrecht nicht explizit erwähnt, allerdings ist es in den Normbereich dieser Vorschrift einzubeziehen, weil es ein notwendiger Bestandteil bei der Erarbeitung eines Sorgerechtskonzepts ist.[13]
§ 18 KJHG bezieht sich auf die individuelle Unterstützung der Umgangs-berechtigten durch das Jugendamt. Die Umgangsberechtigten haben auf diese Beratungsleistung ebenfalls einen Rechtsanspruch und dieser besteht unab-hängig von der Sorgerechtsregelung. Durch den § 18 KJHG kann von allen Berechtigten eine umfassende Vermittlungstätigkeit in Anspruch genommen werden.[14]
Des Weiteren ist das Familiengericht verpflichtet, das Jugendamt vor einer Entscheidung von Sorgerechtsfragen anzuhören. Die Mitwirkung des Jugend-amtes vor dem Gericht wird in § 50 Abs. 2 KJHG konkretisiert.
Hier heißt es: „Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über Angebote und erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin.“. (Walhalla 2003, 30).
Die Mitwirkung des Jugendamtes im familiengerichtlichen Verfahren dient dazu, das Kindeswohl sicher zu stellen und im Verfahren zur Geltung zu bringen.[15]
Es stellt eine eigenständige sozialpädagogische Aufgabe dar.
Im Rahmen seiner sozialpädagogischen Fachlichkeit bestimmt das Jugendamt, in welchem Umfang es vor dem Familiengericht mitwirkt. Das Jugendamt kann die Schriftform, den mündlichen Vortrag oder beides wählen, eine gutachterliche Äußerung bzw. eine Empfehlung zur Entscheidung abgeben oder nicht. Die persönliche Anwesenheit der Jugendamtsmitarbeiter steht in deren pflicht-gemäßen Ermessen. Des Weiteren kann das Jugendamt eine Entscheidung des Familiengerichts mit der Beschwerde bzw. mit der sofortigen Beschwerde anfechten (Balloff 2004, 112 ff.). Trotz der Mitwirkungspflicht gemäß § 49a FGG vor dem Familiengericht ist das Jugendamt eine eigenständige, nicht an fachliche Weisungen gebundene und nicht dem Gericht untergeordnete Behörde.[16] Einerseits unterliegen die Jugendamtsmitarbeiter bei der Trennungs- und Schei-dungsberatung den datenschutzrechtlichen und strafrechtlichen Verschwiegen-heitspflichten, andererseits sind sie im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht vor dem Familiengericht und im Rahmen der Amtshilfe auch auskunftspflichtig. Dies kann unter Umständen die Weiterarbeit mit der betroffenen Familie erschweren, da die Eltern, wie auch die Kinder, bei einer Gefährdung des Kindeswohls die Tragweite der Offenbarung nicht ermessen können (Balloff 2004, 116, 117).
Träger der vorgeschriebenen Trennungs- und Scheidungsberatung gemäß § 17 und 18 KJHG ist die öffentliche Jugendhilfe, allerdings kann diese Aufgabe auch an freie Beratungsstellen deligiert werden.
2.4 Familiengericht
Die Eltern sollen sich in den Angelegenheiten ihres Kindes einigen und selbst über die Art und Häufigkeit der Umgangskontakte entscheiden. Dabei sollen sie die Wünsche ihres Kindes bei der Umsetzung berücksichtigen.
Können sich die Eltern nicht auf eine Umgangsvereinbarung verständigen und ist ggf. ein in Anspruch genommenes Vermittlungsangebot des Jugendamtes oder eines freien Trägers gescheitert, dann ruft gewöhnlich der umgangsberechtigte Elternteil das Familiengericht zur Herstellung einer Umgangsregelung an.
Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 FGG ist der Familienrichter verpflichtet, wenn ein die Person des Kindes betreffendes Verfahren anhängig ist, die Eltern auf das außergerichtliche Beratungsangebot gemäß der §§ 17 und 18 KJHG hinzuweisen.
Es kann gesagt werden, dass bei der Einleitung eines ersten gerichtlichen Verfahrens bzgl. des Umgangs für die Vermittlung zwischen den Elternteilen der Träger der Jugendhilfe zuständig ist.[17] Hat das Familiengericht aber bereits über den Umgang eine gerichtliche Entscheidung getroffen, dann kann der Richter gemäß § 52a FGG (gerichtliches Vermittlungsverfahren), vor Einleitung von Zwangsmaßnahmen zwischen den Eltern vermitteln und sie auf die Bedeut-samkeit des Umgangsrechts für das Kind hinweisen.[18]
Da Kinder im gerichtlichen Verfahren nicht zum Objekt der elterlichen Interessen werden sollen, werden sie ebenfalls vor dem Familiengericht gehört. Kinder unter 14 Jahren werden gemäß § 50b Abs. 1 erster Halbsatz FGG dann angehört, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder gemäß § 50b Abs. 1 zweiter Halbsatz FGG, wenn die Anhörung des Kindes zur Feststellung des Sachverhalts angezeigt erscheint, damit sich das Gericht von dem Kind einen unmittelbaren Eindruck verschafft. Hat das Kind das 14. Lebensjahr vollendet, dann wird es stets persönlich gehört, wenn es um die Personensorge geht (Balloff 2004, 166-167).
In den letzten Jahren hat sich der Grundsatz im Gerichtsalltag durchgesetzt, dass ein Kind „unabhängig vom Lebensalter – meist aber nicht vor dem dritten Lebensjahr – im familiengerichtlichen Verfahren immer dann persönlich angehört wird, wenn gemäß § 50 b Abs. 1 FGG die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes von Bedeutung sind“ (Balloff 2004,169).
Eine Anhörung des Kindes kann somit auch im Verfahren zur Regelung des Umgangs nach den §§1684 und 1685 BGB erfolgen.
Verletzt ein Elternteil seine Wohlverhaltenspflicht gemäß § 1684 Abs. 2 BGB, dann kann der Familienrichter durch Anordnung von Gebots- oder Untersagens-verfügungen zur Einhaltung der Umgangskontakte verpflichten.[19]
Um den unkooperativen Elternteil zur Befolgung der gerichtlichen Umgangs-regelung anzuhalten, kann das Familiengericht Zwangsmittel gemäß § 33 FGG in Betracht ziehen. Zu den Zwangsmitteln zählt die Androhung von Zwangsgeld oder Zwangshaft. Des Weiteren kann der Familienrichter ein Sachverständigengutachten gemäß § 15 Abs. 1 FGG in Auftrag geben. Eine mögliche Beweisfrage im Rahmen der Begutachtung könnte wie folgt lauten: “Welche Regelung des persönlichen Umgangs dient dem Wohl des Kindes am besten?“ (Balloff 2004, 124-125).
Des Weitern besteht die Möglichkeit bei nachhaltiger Vereitelung des Umgangs-rechts dem Elternteil, der die elterliche Sorge nach einer gerichtlichen Sorgerechtsentscheidung innehat, aufgrund einer nicht ausreichenden Erziehungseignung und damit einhergehenden Kindeswohlgefährdung, das Sorgerecht zu entziehen und gemäß § 1696 Abs. 1 BGB auf den anderen Elternteil zu übertragen.[20] Dies bedeutet, dass eine Sorgerechtsänderung angezeigt sein kann, „wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig berührenden Gründen, angezeigt ist.“[21]
Allerdings ist eine Sorgerechtsänderung nur unter Berücksichtigung des Gesichtspunktes des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes möglich. Erst wenn die Ausübung des Umgangs zwischen dem Kind und dem umgangsberechtigten Elternteil durch die Festsetzung eines Zwangsgeldes nicht zustande kommt, könnte eine Sorgerechtsänderung in Betracht gezogen werden. Fraglich ist allerdings die Umsetzung in die Praxis, da es nicht im Interesse des Kindes sein kann, wenn sich hierdurch sein bisheriger Lebensmittelpunkt erneut verändert.[22]
Der Einsatz von Zwangsmitteln oder einer Sorgerechtsänderung bei Umgangs-streitigkeiten kann das Verhältnis des Kindes zu seinen Eltern stark belasten und somit dem Wohl des Kindes schaden. Durch die Kindschaftsrechtsreform setzt der Gesetzgeber eher auf die außergerichtlichen oder gerichtlichen Konflikt-lösungskompetenzen der beteiligten Fachkräfte mit dem Ziel, dass den Eltern ihre Verantwortung bewusst wird und sie so zu einer Kooperation im Sinne ihres Kindes befähigt werden.
2.5 Eltern-Kind-Beziehung und Umgangsrecht
Wie bereits beschrieben korrespondiert mit dem Recht des Kindes auf Umgang mit beiden Eltern, die Pflicht und das Recht der Eltern, Umgang mit ihrem Kind auszuüben. Des Weiteren besitzt das Kind einen vollstreckbaren Anspruch auf Umgang.
Richtschnur für die Ausübung und Ausgestaltung des Umgangsrechts ist das Wohl des Kindes. Im Konfliktfall ist dem Kindeswohl Vorrang vor den Eltern-interessen zu gewähren (Balloff 2004, 187ff.).
Das Umgangsrecht soll dem Berechtigten folgendes ermöglichen:
- „mit dem Kind weiterhin Kontakt zu pflegen,
- sich von dem Befinden und der Entwicklung des Kindes laufend zu überzeugen,
- die verwandtschaftlichen Beziehungen mit dem Kind aufrechtzuerhalten und einer Entfremdung vorzubeugen,
- und dem Liebesbedürfnis beider Eltern Rechnung zu tragen.“[23]
Indem der umgangsberechtigte Elternteil die Umgangskontakte zu seinem Kind wahrnimmt, kann er sein emotionales Bedürfnis nach einer Fortsetzung seiner Beziehung mit dem Kind befriedigen, an seiner Entwicklung teilhaben und sich in der Wahrnehmung von Elternverantwortung betätigen.
Für den betreuenden Elternteil kann ein kontinuierlicher Umgangskontakt zu mehr Freizeit, Entlastung und Vermeidung von Idealisierungen des umgangs-berechtigten Elternteils führen, sowie zu einer stabilen und altersgemäßen Entwicklung des Kindes beitragen.
Für das Kind trägt ein regelmäßig durchgeführter und gewollter Umgangskontakt seinem Bedürfnis nach Beziehung zu beiden Eltern Rechnung. Des Weiteren erleichtert es ihm die Verarbeitung der Trennung und Scheidung der Eltern und ermöglicht eine geschlechtsrollengemäße Persönlichkeitsentwicklung.
In einigen Fällen kann es zu einer Abänderung der elterlichen Sorge gemäß § 1691 Abs. 1 BGB kommen, so dass der bisher nicht sorgeberechtigte Elternteil die Betreuung und Versorgung des Kindes übernehmen muss.
Auch kann der betreuende Elternteil sterben oder ernstlich erkranken, so dass er an der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert ist. Dann kann ein regelmäßig ausgeübter Umgangskontakt den Übergang des Kindes zum anderen Elternteil wesentlich erleichtern (Balloff 2004, 188-189).
2.6 Zusammenfassung
Durch das Neue Kindschaftsrecht von 1998 verbesserte sich die Rechtsstellung des Kindes, z.B. hat das Kind ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil auch nach einer Trennung und Scheidung. Da die bestehenden Konflikte der Eltern die größten Auswirkungen auf das Scheidungserleben der Kinder haben, versuchen die beteiligten Fachkräfte, konfliktreduzierend auf die Eltern einzuwirken. In außergerichtlichen und gerichtlichen Vermittlungsgesprächen wird versucht, die Eltern für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sensibilisieren, indem sie Informationen bezüglich des Scheidungserlebens und der kindlichen Reaktionen erhalten.
Aufgrund der hohen Komplexität des Scheidungsgeschehens kann meistens nur ein Konfliktbereich in der Beratung durch die Jugendamtsmitarbeiter bearbeitet werden, wie die Herstellung einer einvernehmlichen Umgangsregelung. Eine Aufarbeitung sowie eine Bearbeitung der emotionalen Trennung ist in der direkten Vermittlungs- und Bearbeitungsarbeit der Jugendamtsmitarbeiter in der Regel nicht zu leisten. Scheidungsberatung kann unter den vorhandenen Bedingungen im Jugendamt nur eine Krisenhilfe darstellen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mögliche seelische Beein-trächtigungen des Kindes von der Intensität des familiären Konfliktes, dem bisherigen Verhalten der Eltern, dem Lebensalter des Kindes und seiner bisherigen Persönlichkeitsentwicklung abhängen.
Gerade bei schwierigen Familienverhältnissen, wenn Belastungen vom Kind nicht fern gehalten werden können, wird mit den bestehenden Möglichkeiten, unter Beachtung des Kindeswohls; weiterhin versucht, wenigstens zu einer Konflikt-reduzierung beizutragen oder eine Konfliktreduzierung zu erreichen.
3 . Lebenslagen der Eltern und Kinder
Seit den 60er Jahren ist eine zunehmende Pluralisierung der Formen familiären Zusammenlebens zu beobachten.
Mit diesem Wandel ist auch ein Anstieg der gesellschaftlichen Akzeptanz von Ein-Eltern-Familien bzw. Alleinerziehenden verbunden.
Ein-Eltern-Familien schneiden beim Vergleich mit Zwei-Eltern-Familien, was die ökonomischen und sozialen Verhältnisse betrifft, deutlich schlechter ab. Des Weiteren wirkt sich die von der Arbeitswelt geforderte Flexibilität zunehmend auf familiäre Lebensformen aus. Zu nennen sind hier die Entkoppelung von Aus-bildung und Arbeit, Arbeitslosigkeit, Zeitverträge, Arbeit auf Abruf usw. und die damit einhergehende erhöhte Beschäftigungsunsicherheit. Im Zuge der gesell-schaftlichen Veränderungen findet auch eine Loslösung von traditionellen und religiösen Begründungsmustern und den hiermit verbundenen Normen und Leitvorstellungen, was Ehe, Familie, Erziehung, Sexualität sowie die Rolle von Frau und Mann betrifft, statt.
Der weibliche Lebensentwurf ist, heute von einer Doppelorientierung bezüglich Beruf und Familie geprägt. Damit verbunden ist die Forderung nach einer familienfreundlicheren Arbeitswelt und einem bedarfsgerechten Angebot an Kindertageseinrichtungen enthält. Durch den längerfristig andauernden historischen Trend, Sozialisationsleistungen aus der Familie herauszuverlagern, fällt den Kindertageseinrichtungen, Vorschulen, Schulen, sowie der Kinder- und Jugendarbeit ein verstärkter Funktionszuwachs zu.
Die bisherige Entwicklung lässt erkennen, dass die Familie als primärer Lebensmittelpunkt von Kindern, vor allem als Ort zuverlässiger sozialer und emotionaler Beziehungen und Bindungen, vor neuen Herausforderungen steht.[24]
3.1 Getrennt lebende oder geschiedene Eltern mit und ohne neuen Lebenspartner
Nach einer Trennung und Scheidung befinden sich die betroffenen Mütter und Väter in einem Statusübergang, was ihre wirtschaftliche und psycho-soziale Situation betrifft.
Die Eltern sollten die verschiedenen Phasen des prozesshaften Trennungs-geschehens durchlaufen, wie die Ambivalenzphase, Trennungsphase, Schei-dungsphase, Nachscheidungsphase und die Phase der Fähigkeit des Eingehens einer neuen Partnerschaft.[25]
Es sind hauptsächlich immer noch die Mütter, die ihre Kinder nach einer Trennung und Scheidung versorgen und ein Viertel dieser Frauen erhält keinen Kindesunterhalt.
Bei der Empirischen Untersuchung des BMFSFJ, 2003, betreuten 95% aller befragten Mütter mindestens ein minderjähriges Kind nach der Scheidung. Dies traf nur auf 23 % der Väter zu (Fieseler, G., Herborth, R. 2005, 101).
Getrennte Eltern, die bereits eine neue Partnerschaft eingegangen sind, haben häufig das Bestreben, wieder zu einer „normalen“ Familie zu werden. Häufig wird in dieser Lebenssituation der Fehler begangen, dass der Umgang des Kindes/ der Kinder zum außen lebenden Elternteil eingeschränkt oder sogar unterbunden wird. Aber auch für den Elternteil, bei dem das Kind lebt, kann es schwer sei, den Umgang des Kindes mit dem außerhalb lebenden Elternteil und dessen neuen Lebenspartner zuzulassen (Lederle von Eckardstein u.a. 1998, 36-37).
Gelingt den Eltern in dieser Umbruchphase ihres Lebens keine Kooperation im Sinne ihres Kindes, dann kann es im beiderseitigen Kontakt der Eltern zu Streitigkeiten oder sogar zu einem „Kampf ums Kind“ kommen, was häufig mit sehr hohen Belastungen für alle Beteiligten verbunden ist.
Was die Unterhaltszahlung für das Kind betrifft, wurde ein Zusammenhang zwischen gutem Kindeskontakt und gutem Zahlungsverhalten bzw. zwischen mangelndem Kontakt zum Kind und ausbleibenden Unterhaltszahlungen festgestellt. So kommen unterhaltspflichtige Väter ihren Zahlungen seltener nach, wenn kaum oder fast kein Umgangskontakt mehr zu ihrem Kind besteht.[26]
3.2 Trennungs- und Scheidungskinder
Kinder erleben eine Trennung und Scheidung der Eltern sehr unterschiedlich. Ihr Erleben und ihre Möglichkeiten der Trennungs- und Scheidungsbewältigung hängen vor allem mit ihrem Entwicklungsstand zusammen. Das Trennungs- und Scheidungsgeschehen wird nicht durch den Richterspruch beendet, sondern es ist ein belastendes Lebensereignis, welches eine Vorgeschichte hat und meist noch nach der Trennung und Scheidung nachwirkt.
Trennung und Scheidung sind zunächst ein Ausdruck von Erwachsenen-konflikten, in welche die Kinder unfreiwillig hineingezogen und verwickelt werden. Für Kinder ist eine Trennung und Scheidung der Eltern zunächst immer mit vielfältigen und dramatischen Veränderungen verbunden, was zunächst Ängste beim Kind auslöst, auch wenn es während des Zusammenlebens der Eltern vernachlässigt, geschlagen, misshandelt oder sexuell missbraucht worden sein sollte (Balloff 2004, 50).
Auch werden die Kinder bei der Trennungsbewältigung mit den unterschiedlichen Phasen des Trennungs- und Scheidungsprozesses (Stadium der Unent-schiedenheit/ Ambivalenzphase, Stadium der endgültigen Trennung/ Trennungs-phase, Stadium der Anpassung an die Trennung/ Scheidungsphase, Stadium der Neudefinition der Familie und der psychischen Trennung/ Nachscheidungsphase) konfrontiert, in welchen sie unterschiedliche Ereignisse und Belastungen erleben und individuelle Reaktionen und notwendige Anpassungsleistungen erbringen müssen (Jaede, Wolf, Zeller-König 1996, 11 ff.).
Je nach Alter zeigen die Kinder die folgenden normalen Gefühlsqualitäten wie Trennungsangst, Protest, Trennungsschmerz und Verzweiflung, Anklammern, Gleichgültigkeit, aber auch wieder Annäherung an die Eltern und wieder gewon-nene Stabilität des eigenen Selbst.[27]
Die Kinder spüren andererseits auch die seelische Erschütterung (Wut, Depres-sion usw.) und Befindlichkeiten der Eltern und reagieren hierauf.
Es kann gesagt werden, dass „je jünger ein Kind ist, desto hilfloser, verwirrter, beunruhigter und ängstlicher fühlt es sich“.[28]
Vor allem anhaltender Streit der Eltern vor, während und nach der Trennung, kann zu vielfältigen Beeinträchtigungen der Kinder im Leistungs- und Gefühls-bereich führen. Krieger 1997 benannte diese wie folgt:
- „Verstrickungen in Loyalitätskonflikte,
- Überfordert sein, wenn sich die Eltern an das Kind als Bündnis- und Gesprächspartner sowie Tröster klammern,
- Rettungsfantasien, die Beziehung der Eltern kitten zu müssen,
- Schuldgefühle,
- Fantasien, von den Eltern nicht mehr geliebt zu werden,
- Sorgen und Ängste um die Zukunft“ (Balloff 2004, 48).
Allerdings benötigt das Kind zur Entwicklung einer stabilen sozialen Identität beide Eltern.[29]
Bei Jungen und Mädchen kann sich z.B. eine Vaterabwesenheit in einer un-sicheren Geschlechtsrollenidentifikation, sowie negativen Auswirkungen auf das kindliche Selbstwertgefühl und das emotionale Wohlergehen zeigen.[30]
Walper und Gerhard folgerten aus ihren Untersuchungen, dass zumindest in hochstrittigen Familien, reichhaltige, sogar hälftige Kontakte zum getrennt lebenden Elternteil, die positiven Effekte herabsenken, so dass „ein verminderter Kontakt gerade in jenen Familien als hilfreicher Ausweg dienen mag, in denen die Eltern ihre Feindseligkeiten noch nicht überwunden haben und die Kinder dabei instrumentalisieren, indem sie sie in eine Allianz gegen den anderen einbinden wollen.“[31]
3.2.1 Parental alienation syndrom (PAS)
Das Parenteral alienation syndrom, kurz PAS, wird auch elterliches Ent-fremdungssyndrom genannt. Hier lehnt das Kind einen Elternteil kompromisslos ab und wendet sich dem anderen Elternteil zu. Nach Gardner (1992) wird PAS als Ergebnis massiver Manipulation oder „Programmierung“ eines Kindes durch einen Elternteil verstanden.[32]
PAS kann im Trennungsverlauf bei massiven Konflikten zwischen dem betreu-enden Elternteil und dem außen lebenden Elternteil entstehen.
Aus falschen Schutztendenzen, Rache oder Verlustängsten heraus, beeinflusst der betreuende Elternteil, bewusst oder unbewusst das Kind, so dass es die negative Haltung des betreuenden Elternteil gegenüber dem anderen Elternteil übernimmt und diesen ablehnt (vgl. Dettenborn 2001,102).
Das PAS- Geschehen verläuft prozesshaft und im Wechselspiel der folgenden Punkte:
1. „Manipulation durch den betreuenden Elternteil,
2. Anpassung des Kindes an den betreuenden Elternteil durch polari-sierendes Verhalten mit der Gefahr psychischer Schädigung
3. Bewältigung und Willensbildung durch das Kind“ (Dettenborn 2001, 118).
Des Weiteren unterscheidet Gardner (1992) acht Kardinalsymptome des PAS, welche nicht alle gleichzeitig vorhanden sein müssen; als Beispiel werden hier vier der acht Symptome genannt:
- „Herabsetzungskampagnen, d.h. der abgelehnte Elternteil wird als bös-artig, hinterhältig oder gefährlich verunglimpft.
- Die Betonung der eigenen Meinung wird eingesetzt, um sich selbst und andere zu überzeugen, und sei es, indem stereotyp hinzugefügt wird: „Ich weiß genau“.
- Ausdehnung der Feindseligkeit auf Angehörige des abgelehnten Elternteils, d.h., dessen Mutter oder neue Freundin wird auch verunglimpft.
- Fehlende Schuldgefühle, d.h., die eigene Feindseligkeit wird gerechtfertigt und schließt nicht aus, dass Geschenke oder Geld gefordert und ihr Ausbleiben heftig beklagt werden.“[33]
Wie aus der derzeitigen Fachliteratur hervorgeht, lässt die Diagnose PAS aufgrund der Unschärfe des Konzepts eine weite Spanne der Häufigkeits-einschätzung zu.
Da die Entstehung von PAS und ihr Verlauf eine sehr hohe Komplexität des familiären Geschehens aufweisen, sind immer im Einzelfall die Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen und gerichtlichen Mittel (Aussetzung des Umgangs-rechts, Anordnung von Umgangskontakten gegen den Willen des Kindes, Sorgerechtsentzug, Zwangsmittel, Beugehaft) auf den kindlichen Entwicklungs-prozess, vor allem im Hinblick auf die Möglichkeiten der Stressbewältigung und Willensbildung des Kindes, sowie im Hinblick auf die verfestigte Situation der elterlichen Positionierung im Trennungsverlauf, zu berücksichtigen.
3.3 Zusammenfassung
Kinder können während ihrer Entwicklung mehrere verschiedene Beziehungs-konstellationen erleben wie Kind in einer „normalen“ Familie, Kind in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft, Kind in einer Ein-Eltern-Familie oder/ und Kind in einer Stieffamilie.[34]
Zu den umfeldbezogenen Risikofaktoren eines Kindes gehören zudem eine plötzliche Trennung der Eltern, langjährige Zerrüttungsprozesse, dissoziales Milieu oder die psychische Erkrankung von Bezugspersonen (Dettenborn 2001, 56).
Während einer Trennung/ Scheidung besteht zunächst ein Konflikt zwischen den Ehepartnern. Die Kinder werden meist unfreiwillig in diesen hineingezogen (Lederle von Eckardstein u.a. 1998, 8). Dabei hängen die emotionalen Reaktionen der Kinder, sowie ihre Fähigkeit zur Trennungsbewältigung, von ihrer erreichten kognitiven Sichtweise ab. Jüngere Kinder schätzen diese Krise aufgrund äußerer Ereignisse und Verhaltensweisen der Eltern ein. Ältere Kinder können in ihrer Bewertung subjektive Faktoren, unterschiedliche Motive sowie die soziale Perspektive einbeziehen (Jaede 1996, 17).
Bei den geschiedenen Alleinerziehenden steigt das Armutsrisiko, vor allem bei den Frauen. Somit ist eine Trennung und Scheidung der Eltern auch häufig mit einem Statusverlust verbunden.[35]
Allerdings sei auch darauf hingewiesen, dass Kinder, „deren Eltern einander terrorisieren oder sogar gewalttätig gegeneinander sind, weitaus schwerere Schäden davontragen als Kinder nach einer Trennung oder Scheidung.“[36]
Durch eine Trennung und/ oder Scheidung können sich für die Kinder aber auch Ressourcen und Entwicklungspotentiale eröffnen wie die Entwicklung einer größeren Selbständigkeit und mehr Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme.[37] Allerdings benötigt das Kind zur Entwicklung seiner sozialen Identität auch den Kindesvater, wie Untersuchungen im Rahmen der Vaterforschung ergeben haben.[38]
Kindeswohl und Kindeswille sind die Begriffe, welche im Zusammenhang mit PAS in der derzeitigen Fachliteratur heftig diskutiert werden und umstrittene Sichtweisen hervorbringen. Deutlich wird, aufgrund der Komplexität des fami-liären Geschehens, die Notwendigkeit einer multidiziplinären Zusammenarbeit der Fachkräfte, wie Familienrichter, Rechtsanwälte, Sozialarbeiter und Psychologen.
Lehmkuhl und Lehmkuhl stellten sich sogar die Frage, ob es sich bei PAS wirklich um ein neues Syndrom handelt, denn wenn Kinder großen Ambivalenzen und Loyalitätskonflikten ausgesetzt sind, kann der Kontaktabbruch zu einem Elternteil auch eine Entlastung für sie darstellen (vgl. Lehmkuhl, Lehmkuhl 1999, 160).
So wird in der einschlägigen Literatur ebenfalls beschrieben, dass gerade in hochstrittigen Familien, in welchen Eltern ihre Kinder instrumentalisieren, eine Reduzierung der Umgangskontakte zum anderen Elternteil zunächst ein Ausweg darstellen kann.[39]
Im Folgenden werden ausgewählte Hilfen des Jugendamtes und des Familiengerichts dargestellt.
4. Regelungshilfen
Im nun folgenden Text werden Modelle vorgestellt, die bei einer Regelung der Scheidungsfolgen vor, während und nach dem juristischen Verfahren eingesetzt werden können.
Bei der Darstellung der Regelungshilfen beschränke ich mich auf die unter-schiedlichen Formen des begleiteten Umgangs und der Verfahrenspflegschaft, so dass im Rahmen dieser Masterarbeit die weiteren Regelungshilfen wie Mediation, Bewältigungshilfen, Gruppeninterventionen für Scheidungskinder und thera-peutische Angebote usw. nicht thematisiert werden.
Die „Hilfe zur Erziehung“ zählt nicht zu den in der einschlägigen Literatur beschriebenen Regelungshilfen. Ich führe sie jedoch hier an, da diese Hilfe von den Eltern, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, auch vor, während oder nach einer Trennung und Scheidung beantragt werden kann.
4.1 Begleiteter Umgang
Der begleitete Umgang hat durch die Kindschaftsrechtsreform vom 01.07.1998 seine gesetzliche Grundlage gemäß § 1684 Abs. 4 S. 3 u. 4 BGB erhalten.
In der Literatur werden unterschiedliche Begriffe und Formen bezüglich einer Umgangsbegleitung verwendet.
Salzgeber z. B. unterscheidet drei Formen der Umgangsbegleitung:
- der begleitete Umgang (partielle Begleitung)
- betreuter Umgang (Umgang mit Beratung)
- beaufsichtigter Umgang (hier wird das Kind während dem Umgangskontakt andauernd beaufsichtigt, so dass ein geschützter Rahmen für das Kind geschaffen wird).[40]
Durch meine Tätigkeit im Jugendamt konnte ich erfahren, dass Eltern sich auch freiwillig an den Jugendamtsmitarbeiter wenden, damit der Umgang zwischen dem Kind und dem anderen Elternteil wieder hergestellt wird. Dies ist dann besonders sinnvoll, wenn das noch sehr junge Kind z.B. den Kindesvater längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Die Umgangsbegleitung findet nur vorübergehend, entweder durch den Jugendamtsmitarbeiter selbst, durch eine beauftragte kontaktbegleitende Person oder durch eine Institution statt.
Gemäß § 18 Abs. 3 KJHG hat das Kind einen Anspruch auf Mitwirkung des Jugendamtes im familiengerichtlichen Verfahren, so dass das Jugendamt auch dann noch die Möglichkeit hat, dem Kind einen begleiteten Umgang anzubieten. Des Weiteren kann das Jugendamt nicht vom Gericht zu einer Durchführung eines begleiteten Umgangs verpflichtet werden.
In den Fällen des begleiteten Umgangs liegt somit eine „im Gesetz festgelegte koordinierte Kooperation des Familiengerichts mit dem Jugendamt auf der Grundlage des § 49 FGG und § 50 KJHG vor“ (Balloff 2004, 194).
Außerdem können sich die Eltern vor dem Familienrichter auf einen begleiteten Umgang in Form einer Kontaktanbahnung einigen. Der Richter formuliert während der Sitzung eine entsprechende Bereitschaftserklärung der Eltern, in welche weitere Vereinbarungen bezüglich der Durchführung aufgenommen werden können.
Ein begleiteter Umgang kann bei einer Gefährdung des Kindeswohls gerichtlich angeordnet werden, z.B. bei:
- sexuellem Missbrauch, Gewaltanwendung/ Misshandlung, Vernach-lässigung und Verwahrlosung
- einer psychischen Erkrankung eines Elternteils, wodurch die Erziehungsfähigkeit erheblich eingeschränkt wird, wie Psychosen, psycho-pathologischen Persönlichkeitsstörungen, Alkoholismus und Drogen-abhängigkeit
- extremster Abwertung des anderen Elternteils und Verhaltens-auffälligkeiten des Kindes, wie Leistungsstörungen und Bettnässen
- längerem Krankenaus- , Auslands- oder Gefängnisaufenthalt eines Elternteiles, wodurch ein längerer Kontaktabbruch zum Kind entstanden ist
- und Entführungsgefahr
Auch bei diesen Beschlüssen können weitere Modalitäten festgelegt werden wie Ort, Zeit, Umfang, Institution und kontaktbegleitende Person. In diesem Zusam-menhang können jetzt Formulierungen wie „kontrollierter Umgang“, „überwachter Umgang“ oder „beschützter Umgang“ verwendet werden.
[...]
[1] (vgl. Emmerling, D.: Ehescheidungen 2000/200. Die wichtigsten Ergebnisse, in: Wirtschaft und Statistik 12/2002, S. 1056 ff.; ders., Ehescheidungen 2002, in Wirtschaft und Statistik 12/2003, S. 1105 ff.; Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Datenreport 2004, S. 45 ff. in Fieseler, G., Herborth, R., 2005, 101)
[2] (BMFSFJ (Hrsg.): Wenn aus Liebe rote Zahlen werden, Berlin 2003; Empirische Untersuchung von Andreß, H.J./Borgloh, B./Güllner, M., Universität Bielefeld. in Fieseler, G., Herborth, R., 2005, 101)
[3] Unter Helfern werden in diesem Zusammenhang Jugendamtsmitarbeiter und Familienrichter verstanden.
[4] Hier sind stets beide Geschlechter gemeint.
[5] Figdor 1991, 149 in Balloff 2004, 187
[6] Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 1971, 31, 194 in Balloff, R. 2004, 188
[7] Bundesverfassungsgericht 64, 180, 188 in Schwab, D. 1999, 322
[8] BGHZ, 51, 219 in Wiedenlübbert 2005, 248
[9] BGH FamRZ 1984, 1084-1086 in Wiedenlübbert 2005, 248
[10] Zittelmann 2001, 119ff. in Fieseler/ Herborth 2005, 74
[11] Schone u.a. 1997, 22ff. in Fieseler, Herborth 2005, 76
[12] Münder at al 2003, § 17 KJHG Rdnr.3 in Balloff 2004, 118.
[13] Vgl. Coester, FamRZ 1991, 253, 261; vgl. auch Rauscher, FamRZ 1998, 329, 340 in Leyhausen, D. 2000, 54.
[14] Vgl. Rauscher, FamRZ 1998, 329, 340 in Leyhausen, D. 2000, 55.
[15] Vgl. Münder, Baltz et al. 2003, Vor § 50Rz. 1 in Balloff, R. 2004, 110
[16] Münder et al. 2003, Rdnr. 9 in Balloff 2004, 114
[17] Vgl. Greßmann, Neues KindschaftsR, 1998, Rdn. 489 in Leyhausen, D. 2000, 57
[18] Vgl. BT-Drucks. 13/4899, S. 75. in Leyhausen, D. 2000, 57
[19] Vgl. Johannsen, Heinrich, Jaeger, EheR, 3. Aufl., 1998, § 1684, Rnd.15 in Leyhausen, D. 2000, 59
[20] Vgl. OLG München, FamRZ 1997, 45 in Leyhausen, D. 2000, 62
[21] Leyhausen, D. 2000, 62
[22] Vgl. OLG Hamm, FamRZ 1992, 467,468 in Leyhausen, D. 2000, 65
[23] BGH, in: NJW 1965, S. 396. Vgl. auch BGH, in: DAVorm 1984, S. 827. Deshalb Hilfe zum Lebensunterhalt für die Ausübung des Umgangsrechts: BVerfG, NJW 1995 in Fieseler, G., Herborth, R. 2005, 243
[24] Dr. Bindel- Kögel, G. in Seidenstücker, B., Mutke, B. (Hrsg.), 2004, 145 ff.
[25] Schmitz 2000, 22 ff. in Balloff 2004, 48
[26] BMFSFJ (Hrsg.): Wenn aus Liebe rote Zahlen werden, Berlin 2003; Empirische Untersuchung von Andreß, H.J., Borgloh, B. , Güllner, M., Universität Bielefeld in Fieseler, G., Herborth, R. 2005, 104
[27] Figdor 1991 in Balloff 2004, 48 ff.
[28] Goldstein/ Solnit 1989, 28ff.; Fthenakis/ Niesel et al. 1982, 143 ff.; Figdor 1991 in Balloff, R. 2004, 50
[29] Zulehner/ Volz 1999; Kindler 2002a; Steinhardt/ Datler et al. 2002 in Balloff, R. 2004, 58
[30] Vgl. LBS- Initiative Junge Familie 1996, 175ff. in Balloff, R. 2004, 58
[31] Walper/ Gerhard 2003, 107 in Balloff 2004, 58
[32] Gardner 1992 in Dettenborn 2001, 102
[33] Gardner 1992 in Dettenborn 2001, 103 ff.
[34] Münder, np 1990, 352 in Fieseler, G., Herborth, R., 2005, 113
[35] Dr. Gabriele Bindel- Kögel in B. Seidenstücker/ B. Mutke (Hrsg.) 2004, 147-148
[36] Wallerstein/ Blakeslee 1989, 355; Furstenberg/ Cherlin 1993 in R. Balloff, 2004, 59
[37] Schwarz/ Noack 2002, 325 in Balloff, 2004, 56
[38] Zulehner/ Volz 1999; Kindler 2002a; Steinhardt/ Datler et al. 2002 in Balloff 2004, 58
[39] Walper/ Gerhard 2003, 107 in Balloff 2004, 58
[40] Salzgeber 2001, 186 in Balloff 2004, 194
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836610445
- DOI
- 10.3239/9783836610445
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Alice-Salomon Hochschule Berlin – Sozialarbeit / Sozialpädagogik, Masterstudiengang Klinische Sozialarbeit
- Erscheinungsdatum
- 2008 (März)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- familie scheidung umgangsrecht jugendhilfe jugendamt
- Produktsicherheit
- Diplom.de