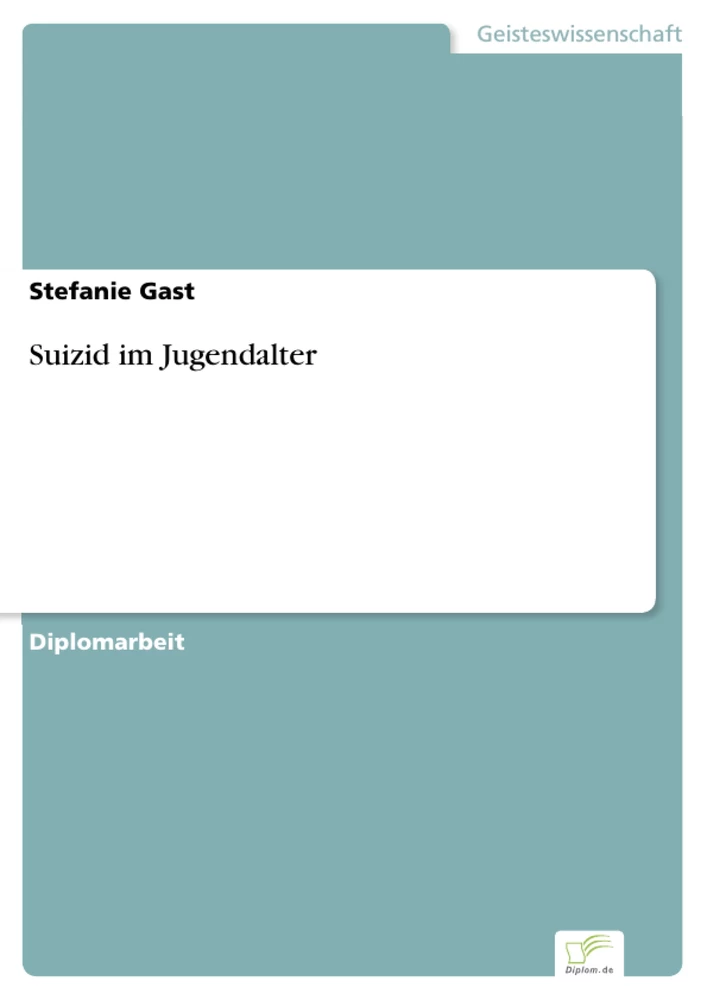Suizid im Jugendalter
Zusammenfassung
Abschied
Warum musste es geschehen? Warum musstest du so jung aus dem Leben gehen?
Warum hast du das getan, lässt uns ganz allein auf der Bahn.
Du kannst uns nicht so stehen lassen. Wir alle fragen nur: Warum?
Wir müssen es einfach akzeptieren, doch keiner wollte dich verlieren.
Deshalb denken wir Tag für Tag an unsere gemeinsame Zeit.
Wir mochten dich alle sehr. Doch hast du auch mal an uns gedacht,
bevor du gingst in dieser Nacht?
Anonymer Verfasser (zit. nach der Zeitschrift GIRL!).
Aus diesen Zeilen spricht die Verzweiflung, die Wut, die Traurigkeit und das Unverständnis der Angehörigen eines jungen Menschen, der Suizid beging.
Immer wieder lesen und hören wir von Suizidhandlungen junger Menschen. Während der letzten Jahre hat sich die Situation der Jugendlichen eher verschlechtert, was sich auch durch stark zunehmende Gewalttaten zeigt. Immer mehr junge Menschen begehen Straftaten und die Täter werden immer jünger. Nun drängt sich die Frage auf, was Gewalt mit Suizidalität zu tun hat. Gewalt kann als eine Vorstufe von Suizidalität gesehen werden. Bei Gewalttaten sind die Aggressionen (noch) nach außen gerichtet. Um einen Suizid zu begehen, muss ein hohes Aggressionspotential vorhanden sein, andernfalls wäre diese Tat undenkbar. Die Wut und der Hass auf andere werden bei einem Suizid gegen sich selbst gerichtet.
In Deutschland begehen täglich drei Jugendliche Suizid und mehr als zehn versuchen es. Damit stellen Suizide, neben Unfällen, die häufigste Todesursache bei Jugendlichen dar. Auch Suizidgedanken sind nicht selten. Da der Suizid allerdings einem gesellschaftlichen Tabu unterliegt, kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlen in der Realität noch wesentlich höher sind. Viele Unfälle sind keine Unfälle, sondern Suizidhandlungen. Und auch so manches Herzversagen ist ein versteckter Suizid. Bleibt es lediglich bei einem Versuch, das heißt, dass der Suizidversuch nicht zum Tod führt, sind die Angaben der Häufigkeiten noch ungenauer, denn anders als der erfolgreiche Suizid muss der Versuch nicht statistisch erfasst werden. Es ist daher unmöglich, präzise Angaben über die Häufigkeit von Suizidversuchen zu machen. Dementsprechend ist man auf Untersuchungen an repräsentativen Stichproben angewiesen. Trotzdem ist den zur Verfügung stehenden Angaben zu entnehmen, dass eine große Anzahl der Suizidalen aus der besonders gefährdeten Personengruppe der Jugendlichen besteht.
Als mögliche Gründe werden unter […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Überblick
1.2 Begriffsbestimmungen
1.3 Allgemeine Erläuterungen zum Thema „Suizid im Jugendalter“
1.4 Lebensphase Jugend
2. Ursachen der Suizidalität
2.1 Neuropsychische Grundlagen von Depressionen
2.1.1 Menschliche Grundbedürfnisse
2.1.1.1 Das Bindungsbedürfnis
2.1.1.1.1 Bindungsbeziehungen und Bindungsstile
2.1.1.1.2 Folgen der Verletzungen des Bindungsbedürfnisses
2.1.1.2 Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle
2.1.1.3 Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz
2.1.1.4 Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung
2.2 Depressive Störungen im Jugendalter
2.2.1 Begriffsbestimmung der Depression
2.2.2 Klassifikation der Depression
2.2.3 Symptomatik der Depression
2.3 Relation zwischen psychischen Erkrankungen und Suizidalität
2.4 Neuronales Netzwerk
2.4.1 Der Präfrontale Cortex (PFC)
2.4.2 Der Anteriore Ciculare Cortex (ACC)
2.4.3 Der Hippocampus
2.4.4 Die Amygdala
3. Epidemiologie
3.1 Probleme bei der Erfassung statistischer Daten
3.2 Die Häufigkeit von suizidalem Verhalten
3.3 Internationaler Vergleich
3.4 Geschlechtsspezifität des Suizidgeschehens
3.4.1 Der „weibliche Suizidversuch“
3.4.2 Der „männliche Suizid“
3.5 Suizidmethoden
4. Soziodemographische Risikofaktoren
4.1 Religionszugehörigkeit
4.2 Klimatische Einflüsse und Verstädterung
4.3 Einfluss der Jahreszeit
4.4 Arbeitslosigkeit
4.5 Schichtzugehörigkeit
4.6 Bedrohliche Lebensumstände
4.7 Heredität
4.8 Neuropsychische und Persönlichkeitsfaktoren
5. Das präsuizidale Syndrom
5.1 Einengung
5.1.1 Situative Einengung
5.1.2 Dynamische Einengung
5.1.3 Wertmäßige Einengung
5.1.4 Zwischenmenschliche Einengung
5.2 Aggressionshemmung
5.3 Suizidphantasien
6. Hintergründe der Suizidalität
6.1 Suizidtheorien
6.1.1 Die soziologische Suizidtheorie
6.1.2 Die psychoanalytischen und psychodynamischen Theorien
6.2 Ungünstige Lebensbedingungen
6.2.1 Ungünstige familiäre Bedingungen
6.2.1.1 Familienarten, die ein Suizidrisiko begünstigen
6.2.1.1.1 Gewaltfamilien
6.2.1.1.2 Trennungsfamilien
6.2.1.1.3 Wir-haben-keine-Probleme-Familien
6.2.1.1.4 Symbiotische Familien
6.2.1.2 Beziehungsstrukturen und Familienklima
6.2.1.2.1 Verlusterlebnisse
6.2.1.2.2 Depression und suizidale Tendenzen von Familienangehörigen
6.2.1.2.3 Sexueller Missbrauch
6.2.2 Schule als Belastungsfaktor
6.2.3 Freundschaftsbeziehungen
7. Ansätze der empirisch – psychologischen Forschung
7.1. Kritische Lebensereignisse
7.2 Daily Hassles
7.3 Kognitiver Ansatz
7.4 Imitationshypothese
8. Auf Suizid hinweisende Botschaften
8.1 Auffälliges Verhalten
8.1.1 Schuleschwänzen
8.1.2 Weglaufen
8.1.3 Auf Trebe gehen
8.1.4 Rückzug
8.1.5 Veränderung der Essgewohnheiten
8.1.6 Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch
8.1.7 Verwahrlosungstendenzen
8.1.8 Gewalttätigkeit
8.2 Sprachliche und bildliche Ebene
8.2.1 Verbale Äußerungen
8.2.2 Philosophisches Interesse
8.2.3 Schriftliche Äußerungen
8.2.4 Zeichen bildlicher Art
9. Schlussbetrachtungen
10. Literatur- und Quellenverzeichnis
11. Eidesstattliche Erklärung
Anhang
Anhang 1: Anzahl der Sterbefälle in Deutschland nach Altersgruppen und Geschlechtern im Jahre 2005
Anhang 2: Anzahl der Sterbefälle durch vorsätzliche Selbstbeschädigung (X60-X84) in Deutschland nach Altersgruppen und Geschlechtern im Jahre 2005
Anhang 3: Sterbeziffer je 100.000 Einwohner durch vorsätzliche Selbstbeschädigung in Deutschland im Vergleich 2004 und 2005
Anhang 4: Suizid und vorsätzliche Selbstbeschädigung in der Europäischen Union im Jahre 2005 (ohne Deutschland)
Anhang 5: Suizid und vorsätzliche Selbstbeschädigung in der Europäischen Union im Jahre 2005 (ohne Deutschland)
1. Einleitung
Abschied
Warum musste es geschehen? Warum musstest du so jung aus dem Leben gehen?
Warum hast du das getan, lässt uns ganz allein auf der Bahn.
Du kannst uns nicht so stehen lassen. Wir alle fragen nur: Warum?
Wir müssen es einfach akzeptieren, doch keiner wollte dich verlieren.
Deshalb denken wir Tag für Tag an unsere gemeinsame Zeit.
Wir mochten dich alle sehr. Doch hast du auch mal an uns gedacht,
bevor du gingst in dieser Nacht?
Anonymer Verfasser (zit. nach der Zeitschrift GIRL!)
Aus diesen Zeilen spricht die Verzweiflung, die Wut, die Traurigkeit und das Unverständnis der Angehörigen eines jungen Menschen, der Suizid beging.
Immer wieder lesen und hören wir von Suizidhandlungen junger Menschen. Während der letzten Jahre hat sich die Situation der Jugendlichen eher verschlechtert, was sich auch durch stark zunehmende Gewalttaten zeigt. Immer mehr junge Menschen begehen Straftaten und die Täter werden immer jünger. Nun drängt sich die Frage auf, was Gewalt mit Suizidalität zu tun hat. Gewalt kann als eine Vorstufe von Suizidalität gesehen werden. Bei Gewalttaten sind die Aggressionen (noch) nach außen gerichtet. Um einen Suizid zu begehen, muss ein hohes Aggressionspotential vorhanden sein, andernfalls wäre diese Tat undenkbar. Die Wut und der Hass auf andere werden bei einem Suizid gegen sich selbst gerichtet.
In Deutschland begehen täglich drei Jugendliche Suizid und mehr als zehn versuchen es. Damit stellen Suizide, neben Unfällen, die häufigste Todesursache bei Jugendlichen dar. Auch Suizidgedanken sind nicht selten. Da der Suizid allerdings einem gesellschaftlichen Tabu unterliegt, kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlen in der Realität noch wesentlich höher sind. Viele Unfälle sind keine Unfälle, sondern Suizidhandlungen. Und auch so manches Herzversagen ist ein versteckter Suizid. Bleibt es lediglich bei einem Versuch, das heißt, dass der Suizidversuch nicht zum Tod führt, sind die Angaben der Häufigkeiten noch ungenauer, denn anders als der „erfolgreiche“ Suizid muss der Versuch nicht statistisch erfasst werden. Es ist daher unmöglich, präzise Angaben über die Häufigkeit von Suizidversuchen zu machen. Dementsprechend ist man auf Untersuchungen an repräsentativen Stichproben angewiesen. Trotzdem ist den zur Verfügung stehenden Angaben zu entnehmen, dass eine große Anzahl der Suizidalen aus der besonders gefährdeten Personengruppe der Jugendlichen besteht (Knapp, 1995).
Als mögliche Gründe werden unter anderen die instabilen Familienstrukturen genannt. Es fehlt den Jugendlichen an Halt und Sicherheit. Ohne diese Grundlagen entstehen Unsicherheit und Angst vor der Zukunft. Wenn Jugendliche mit ihren Problemen nicht mehr zurechtkommen, fehlt es ihnen vielfach an der Hilfe, die notwendig ist, um sie wieder so zu stabilisieren, dass sie mit sich und ihrer Umwelt im Einklang sind (Bründel, 1993).
Suizide und Suizidversuche sind Verhaltensweisen, die den verzweifelten Versuch einer Konfliktbewältigung darstellen. Durch die suizidale Handlung beendet der Jugendliche eine für ihn unerträgliche Situation. Suizid und Suizidversuch werden daher als misslungene Bewältigung von Belastungen angesehen. Sie sind das Ergebnis einer Eskalation am Ende einer langandauernden Problemgeschichte. Daraus folgt, dass ein Suizid nie aus heiterem Himmel geschieht. Er hat immer eine Vorgeschichte. Die Ursachen und auslösenden Momente für den Suizid und Suizidversuch sind sehr vielfältig und in einigen Fällen nur schwer transparent zu machen (Bründel, 1993).
Das einleitende Gedicht macht deutlich, dass suizidale Handlungen junger Menschen meist immer starke Betroffenheit und Anteilnahme auslösen, nicht zuletzt deshalb, weil ein Jugendlicher das Leben noch vor sich hat.
„Warum?“ ist die erste Frage, die wir uns stellen, wenn ein junger Mensch sich das Leben genommen hat oder einen Suizidversuch beging.
In dieser Ausarbeitung möchte ich dieser Frage nachgehen und möchte mögliche Antworten auf das „Warum“ geben, denn die Beantwortung dieser Frage liefert den Schlüssel zur Therapie der Suizidanten. Besonders Sozialarbeiter / Sozialpädagogen können in ihrer alltäglichen Arbeit mit Suizidalität konfrontiert werden. Ich halte es daher für unerlässlich, dass sie ein Basiswissen darüber haben, wie sie Suizidanten angemessen begegnen, wie sie unterstützend tätig werden, professionell intervenieren und Präventionsarbeit leisten. Um in diesem Sinne professionell handeln zu können, ist es erforderlich, über die Ursachen von suizidalem Handeln Jugendlicher informiert zu sein. Diese Informationsleistung möchte ich in der vorliegenden Arbeit erbringen.
Mein Ziel ist es, die Komplexität der Hintergründe zu beleuchten:
- Wie kann es dazu kommen, dass junge Menschen nicht mehr weiterleben wollen?
- Welche Probleme erscheinen ihnen so unüberwindbar?
- Welche familiären Konstellationen können im Hintergrund stehen?
Diese und noch viele andere Fragen sind zwar in der Suizidliteratur nicht unbeantwortet geblieben, aber noch lange nicht eindeutig beantwortet. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher weiterhin, die bisherigen Antworten bzw. Ergebnisse darzustellen.
1.1 Überblick
Im Folgenden sollen die einzelnen Kapitel dieser Ausarbeitung kurz skizziert werden.
Das erste Kapitel dieser Arbeit soll einen Überblick über die zu bearbeitende Thematik geben, wobei Begriffe aus dem Bereich der Suizidalität definiert werden und allgemeine Erläuterungen zum Thema „Suizid im Jugendalter“ Berücksichtigung finden. Auch wird die Lebensphase „Jugend“ charakterisiert und aufgezeigt, in welchen Spannungsfeldern Jugendliche heute leben und mit welchen hohen Anforderungen sie konfrontiert werden.
Im Anschluss daran wird im zweiten Kapitel auf die Ursachen der Suizidalität eingegangen. Im Speziellen wird es um die neuropsychischen Grundlagen von Depressionen, um die menschlichen Grundbedürfnisse und die Folgen derer Verletzungen gehen. Auch werden in diesem Kapitel die depressiven Störungen im Jugendalter, sowie die Relationen zwischen psychischen Erkrankungen und Suizidalität und das neuronale Netzwerk mit seinen unterschiedlichen Hirnarealen berücksichtigt.
Anschließend wird im dritten Kapitel auf die Epidemiologie suizidalen Verhaltens im Jugendalter eingegangen, wobei die Probleme bei der Erfassung statistischer Daten aufgezeigt werden. Die Suizidhäufigkeit im Jugendalter, ein internationaler Vergleich, die Geschlechtsspezifität des Geschehens und die verschiedenen Suizidmethoden werden behandelt.
Im vierten Kapitel wird der Einfluss von verschiedenen soziodemographischen Risikofaktoren auf suizidale Handlungen hinterfragt.
Im fünften Kapitel wird das präsuizidale Syndrom vorgestellt. Es wurde erstmals von Erwin Ringel, einem Wiener Psychiater und Psychotherapeuten beschrieben. Es erklärt den Übergang von den ersten Anzeichen zum tatsächlichen suizidalen Handeln.
Im sechsten Kapitel möchte ich auf die Hintergründe der Suizidalität eingehen. Dabei schildere ich die verschiedenen Suizidtheorien und die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze. Allerdings wird davon ausgegangen, dass es keine Theorie gibt, die flächendeckend die Suizidhandlung erfasst. Ich halte sie dennoch für erwähnenswert, da sie der Transparenz und der Erklärung des Suizidgeschehens dienen sollen. Unter das Kapitel der Hintergründe fällt außerdem die Betrachtung ungünstiger Lebensbedingungen. Diese werden insofern aufgeführt, als dass sie suizidales Handeln begünstigen.
Im siebten Kapitel stehen die Ansätze der empirisch – psychologischen Forschung im Mittelpunkt meiner Betrachtungen.
Unter anderem werde ich auf kritische Lebensereignisse, Daily Hasseles, den kognitiven Ansatz und die Imitationshypothese eingehen. Ein abschließendes Fazit soll dieses Kapitel abrunden.
Die beste Möglichkeit, Suizidhandlungen zu verhindern, liegt im frühzeitigen Erkennen der Alarmzeichen. In der Regel geben die Jugendlichen Notsignale von sich, die jedoch erkannt und richtig interpretiert werden müssen. Deshalb handelt das achte Kapitel von Botschaften, die auf den Suizid hinweisen.
Die Tragik eines jeden Suizids weist auf die dringende Notwendigkeit einer intensiven Suizidprävention hin, deshalb möchte ich im neunten Schlusskapitel kurz auf die Prävention und die verschiedenen Hilfsangebote für suizidale Jugendliche eingehen und die wichtigsten Erkenntnisse der Ausarbeitung zusammenfassen.
Jugendliche wollen nicht wirklich sterben, sie wollen nur so nicht mehr weiterleben. Jeder Suizid ist einer zuviel und wenn wir genau hinsehen und hinhören würden, könnten viele Suizide vermieden werden. Mit dieser Arbeit möchte ich dem gesellschaftlichen Tabu eines Suizids entgegenwirken, um suizidalen Jugendlichen wirkungsvoll helfen zu können. Wir haben eine kollektive Verantwortung für unsere Mitmenschen und eine individuelle Verantwortung für alle, die uns nahe stehen.
Zum allgemeinen Verständnis möchte ich im folgenden Abschnitt die mit dem Thema „Suizid im Jugendalter“ in Verbindung stehenden und in dieser Ausarbeitung verwendeten Begriffe konkreter definieren und erläutern. Zudem möchte ich begründen, warum ich den Terminus Suizid dem des Selbstmordes vorziehe.
1.2 Begriffsbestimmungen
Ein Mensch, der von Selbstmord spricht, ist suizidal.
Aus dieser Definition geht hervor, dass das Aussprechen von Suizidgedanken eine hohe Gefährdung, nämlich Suizidalität bedeutet. Die Suizidgedanken generell stellen noch keine Gefahr dar, aber das Aussprechen dieser Gedanken weist darauf hin, dass der Betreffende sich bereits in einem vorgerückten Stadium der Suizidalität befindet.
Suizidalität ist keine Krankheit, sondern ein Symptom, welches darauf hindeutet, dass ein Mensch sich in einem krisenhaften Zustand des Leidens befindet. Suizidales Denken und Handeln hat es in der Geschichte der Menschheit schon immer gegeben, in allen Kulturen und Gesellschaftsformen. Menschen sind sich ihrer Existenz bewusst und haben damit grundsätzlich auch die Möglichkeit, Suizid zu begehen, wodurch ihre Einstellung zum Leben und zum Tod beeinflusst wird. Suizidalität beschreibt daher ein Denken, Fühlen und Handeln, das prinzipiell allen Menschen möglich ist (Bründel, 2004).
Als „suizidale Persönlichkeit“ wird ein Mensch bezeichnet, der von ernsthaften Suizidgedanken und –impulsen bedroht ist oder bereits eine Suizidhandlung durchgeführt hat (Henseler, 2000).
Laut den Definitionen des „Center for studies of suicide prevention“ wird zwischen einem vollendeten Suizid, einem Suizidversuch und Suizidgedanken unterschieden (Freisleder; Schlamp, 2001).
Alle Handlungen, die darauf abzielen, das menschliche Leben zu beenden, werden als suizidale Handlungen bezeichnet. Selbst wenn das Ziel, der Tod, nicht erreicht wird, spricht man auch bei Suizidversuchen von suizidalen Handlungen. Entscheidend bei dieser Bezeichnung ist, dass der Tod bewusst herbeigeführt wird. Endet die Handlung tödlich, wird sie Suizid genannt und wird die Handlung überlebt, handelt es sich um einen Suizidversuch (Bründel, 1993).
Kommen wir nun zur Terminologie des Suizids, also einer suizidalen Handlung mit tödlichem Ausgang. In der Literatur werden sehr unterschiedliche Begriffe zur Kennzeichnung des Suizids verwendet, z.B. Selbstmord, Selbstzerstörung, Selbstvernichtung, Selbsttötung, Selbstaggression, Selbstschädigung, Freitod usw.
Der Begriff des Selbstmordes suggeriert die Vorstellung, dass sich jemand selbst „mordet“ und stellt damit eine ethisch zu verachtende Handlung dar. Außerdem enthält der Begriff die Vorstellung, dass jemand aus niederen Beweggründen handelt, dies ist jedoch aus zweierlei Gründen nicht zutreffend, denn erstens hat der Betreffende subjektiv schwerwiegende Gründe für sein Handeln und zweitens will er in den häufigsten Fällen nicht wirklich sterben, sondern ein anderes Leben führen. Die Handlung basiert fast immer auf starken Gefühlen der Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Resignation. Aus diesen Gründen verwende ich im Folgenden den Begriff „Suizid“, um die Thematik wertfrei darzustellen und auch der Einfachheit halber, um den Leser nicht vom Wesentlichen abzulenken. Auch werde ich Suizidalität als Sammelbegriff für alle Formen suizidalen Erlebens und Verhaltens gebrauchen, wenn keine besondere Differenzierung angestrebt wird. Unter den Begriff Suizidalität fallen sowohl Suizidideen, Suizidversuche als auch Suizide. Dabei umfassen Suizidideen das Nachdenken über den eigenen Tod, Suizidgedanken, den Wunsch zu sterben als auch konkrete Suizidpläne bzw. die Vorstellung von der Suizidhandlung (Bründel, 1993).
Der Begriff „Suizid“ enthält keine Wertung. Das Wort ist abgeleitet vom lateinischen Verb sui caedere, was „sich töten“ bedeutet und dem Wort suicidium, was sich mit „Selbsttötung“ übersetzen lässt. Laut Shneidman (1985, zit. nach Bründel, 1993) ist Suizid ein Akt selbstzugefügter Lebensbeendigung (Bründel, 1993). Philosophisch ausgedrückt ist der Suizid „die absichtliche Vernichtung des eigenen Lebens, derer nur der Mensch fähig ist, da nur er ein Wertleben führt und sich gegen den Trieb der Selbsterhaltung dazu entschließen kann, ein wertlos oder wertwidrig gewordenes Leben aufzugeben“ (Dickhaut, 1995, S. 17).
Alle weiteren oben genannten Bezeichnungen für dasselbe Geschehen bieten, je nach Betrachtungsweise, Grundhaltung und Weltanschauung, Gelegenheit zur Interpretation. Sie nehmen eine eher verurteilende (Selbstmord), neutrale (Suizid, Selbsttötung), eher verbietende (Selbstvernichtung, Selbstzerstörung, Selbstaggression) oder glorifizierende Haltung (Freitod) ein (Bründel, 2004). Ich möchte vermuten, dass die verurteilende Haltung gegenüber dem Begriff des Selbstmordes zur gesellschaftlichen Tabuisierung beiträgt.
Der Begriff Freitod ist problematisch, da er die Vorstellung einer freien Entscheidung suggeriert. Damit wird verkannt, dass diese Entscheidung eben keine freie Entscheidung ist, denn der Betreffende befindet sich in einer psychischen Krise, befindet sich in einer fortschreitenden Isolierung. Er ist in seinen Entscheidungen eingeschränkt und sieht keinen anderen Ausweg als den Tod (Bründel, 2004).
Für eine Abhandlung über Suizid im Jugendalter ist es notwendig, das Jugendalter, die Adoleszenz so zu definieren, wie das Wort in der folgenden Bearbeitung Verwendung findet. Als Jugendalter fasse ich die „frühe Adoleszenz“ zwischen 11 und 14 Jahren, die „mittlere Adoleszenz“ zwischen 15 und 17 Jahren und die „späte Adoleszenz“ zwischen 18 und 21 Jahren zusammen.
Zum allgemeinen Verständnis möchte ich nun noch einige Grundkenntnisse zum Thema „Suizid im Jugendalter“ erläutern, da sie zur weiteren Bearbeitung dienlich sind.
1.3 Allgemeine Erläuterungen zum Thema „Suizid im Jugendalter“
Suizidgefährdete Jugendliche befinden sich in einem Zustand, in dem das Gleichgewicht der lebenserhaltenden und lebenszerstörenden Tendenzen nicht mehr vorhanden ist. Sie befinden sich in einem Zustand der kognitiven, emotionalen und sozialen Einengung, reagieren gleichgültig und resignierend auf Leistungsanforderungen und zeigen eine depressive Grundstimmung. Sie distanzieren sich von ihren Freunden, leiden unter der selbstgewählten Einsamkeit und Isolation und sie sind nicht fähig, Probleme und Belastungen konstruktiv zu bewältigen. Suizidgefährdete Jugendliche sind sehr belastet und gesundheitlich stark beeinträchtigt. Mögliche Folgen der nicht bewältigten Probleme und Belastungen können psychische Störungen, psychosomatische Leiden oder chronische Krankheiten sein (Bründel, 1993).
Wenn alle anderen Lösungsmechanismen ineffektiv bleiben, wird der Suizid von den Jugendlichen als extremste Form der Problembewältigung in Betracht gezogen. Oft wird der Ausgang einer Suizidhandlung jedoch vom Zufall bestimmt, d.h., dass auch ein nicht ernstgemeinter Suizidversuch tödlich enden kann, gerade bei jüngeren Jugendlichen aufgrund der Verkennung der Wirksamkeit der gewählten Methode oder es wird eine ernstgemeinte suizidale Handlung überlebt. Je häufiger ein Suizidversuch unternommen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines vollendeten Suizids. Es ist jedoch auch anzumerken, dass ein misslungener Suizidversuch auch zu einer positiven Veränderung der Lebenssituation des Betreffenden beitragen kann (Wunderlich, 1999).
Um zu veranschaulichen, was es für Anforderungen und Belastungen sein können, die die Jugendlichen in solchem Ausmaß beeinträchtigen können, möchte ich im nächsten Abschnitt auf die Lebensphase Jugend eingehen.
1.4 Lebensphase Jugend
Durch das biologische Geschehen der Geschlechtsreife wird die Jugendzeit eingeleitet. Ein Beginn kann also relativ genau mit den hormonalen, physiologischen und morphologischen Veränderungen festgestellt werden. Diese setzen allerdings nicht plötzlich, sondern fließend ein. Neben den biologischen Veränderungen wird die Jugendzeit auch von kognitiven, emotionalen, sozialen und generationsbezogenen Veränderungen bestimmt. Das Ende der Jugendzeit lässt sich nicht genau bestimmen. Sie gilt dann als beendet, wenn der Übergang zum eigenverantwortlichen Leben vollzogen wurde, wenn der Jugendliche sich selbst als eigenständig und erwachsen definiert oder ihn die Außenwelt entsprechend bezeichnet. Damit ist ein Übergang von der fremdbestimmten Kindheit in den eigenverantwortlichen Erwachsenenbereich kennzeichnend für das Jugendalter. Durch bestimmte Funktionsbereiche, die vom Jugendlichen übernommen werden, z.B. die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit, Übernahme der Rolle Ehemann / -frau oder Vater / Mutter, erfolgt eine Differenzierung zwischen dem Jugendalter und dem Erwachsenenbereich (Bründel, 2004).
In der internationalen Jugendforschung wir der Begriff der Adoleszenz verwendet und zum größten Teil auf entwicklungspsychologische Veränderungen, die sich in dieser Zeit vollziehen, bezogen. Der Übergang der abhängigen Stellung in der Familie und der Gesellschaft zu einer autonomen, sozial, emotional und finanziell unabhängigen Stellung kann mit achtzehn, zwanzig, fünfundzwanzig Jahren oder auch später vollzogen werden (Bründel, 2004).
Die Lebensphase Jugend scheint für die Jugendlichen immer komplizierter zu werden, viele Jugendliche haben die Scheidung oder Trennung ihrer Eltern erlebt, leben in Familien, in denen nur ein Elternteil präsent ist, leben in Familien mit wechselnden Stiefelternteilen (Patchwork – Familien), haben keinen Schulabschluss, finden keinen Ausbildungsplatz oder haben nur geringe Zukunftsperspektiven. Die veränderten Lebens- und Umweltbedingungen beeinträchtigen erheblich die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Jugendlichen (Bründel, 2004). Speziell in Stieffamilien, einer Familienform, in der aufgrund der veränderten Struktur ein Mehr an Kommunikation von den Familienmitgliedern abverlangt wird und die immer neue Veränderungen mit sich bringt (Kaiser, 2007). Dies kann sich in körperlichen, psychischen und sozialen Befindlichkeitsstörungen bemerkbar machen. Diese entscheidenden Veränderungen, der Wandel in den Familienformen und familiären Beziehungen, die Anforderung, einen guten Schulabschluss zu erreichen, aber auch zu wissen, dass es an Ausbildungsplätzen mangelt und daher die berufliche Zukunft unsicher ist, hat zur Folge, dass sich viele Jugendliche verunsichert fühlen, Ängste haben, mit Panik oder Resignation reagieren (Bründel, 2004).
Trotz der vielen Irritationen wird das Jugendalter nicht mehr als „negative Phase“ angesehen, sondern als eine Zeit, in der es zur produktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt kommt und in der die Jugendlichen bedeutsame Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Diese Aufgaben sind nicht völlig neu, denn sie stehen im Zusammenhang mit den Entwicklungsaufgaben aus der Kindheit, sie konkretisieren sich allerdings dem Alter entsprechend (Bründel, 2004).
Die Entwicklung der Jugendlichen stellt für sie eine Herausforderung dar, an der sie auch scheitern können. Die Bewältigung der einzelnen Entwicklungsaufgaben kann also auch mit Schwierigkeiten, diese adäquat zu lösen, verbunden sein. Die Entwicklungsaufgaben bestehen aus den Breichen Körper, männliches und weibliches Rollenverhalten, Beziehungen zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts, Ablösung von der Familie, Ausbildung und Beruf, Vorbereitung auf eine Partnerschaft und Entwicklung einer Weltanschauung. Oftmals wird auch die „Neukonzeptionalisierung einer eigenen Identität“ als die wichtigste Entwicklungsaufgabe angesehen. Ein Risiko der Nichtbewältigung besteht in allen Bereichen. Einige Jugendliche fühlen sich überfordert und überlastet, sie sehen den Suizid oder Suizidversuch als einzige Lösung ihrer Probleme. Diese Jugendlichen sollen im Mittelpunkt meiner Ausführungen stehen. Auf eine konkrete Betrachtung der Entwicklungsaufgaben im einzelnen soll an dieser Stelle aufgrund der Materialreduktion verzichtet werden (zur Vertiefung vgl. Bründel, 2004).
Die Jugendzeit ist zugleich Integrations- und Individuationsphase. Jugendliche befinden sich in einem Konflikt zwischen der Gewinnung einer eigenen Identität, durch die Abgrenzung von Erwachsenen und Gleichaltrigen und der Integration von Bewährtem in die eigene Persönlichkeit. Sie müssen einen Weg finden, den Konflikt mit einer möglichst geringen Belastung zu lösen. Durch eine Störung der Beziehungen zu den Eltern und Gleichaltrigen erhöht sich die Belastung, sodass die Störung auch zu einer Schädigung des Selbstwertgefühls führen kann. Bei einem Fehlen sozialer Ressourcen und ungenügenden Bewältigungsstrategien kann dies im Extremfall auch zu Suizidneigungen und Suizidhandlungen führen (Wunderlich, 1999).
Auch der Verlust und Abbruch von Freundschaftsbeziehungen kann Auslöser für emotionale Krisen oder auch Suizidhandlungen sein (Wunderlich, 1999).
Aus den bisherigen Erläuterungen folgt, dass Suizidalität bei Jugendlichen von der Suizidalität Erwachsener insofern abgegrenzt werden kann, als dass sie unter dem Einfluss von Entwicklungs- und sozialpsychologischen Randbedingungen und den damit verbundenen Belastungen in dieser Übergangsphase vom Kind zum Erwachsenen gesehen werden muss (Wunderlich, 1999).
Jugendliche stellen eine Risikogruppe für eine erhöhte Unfall-, Alkohol-, Drogen- und Suizidgefährdung dar (Bründel, 1993). Neben der Tatsache, dass die häufigste Todesursache bei Jugendlichen die Unfälle sind, gibt Bründel an dieser Stelle keine genauen evidenzbasierenden Daten an.
Im nächsten Kapitel geht es um die Ursachen der Suizidalität. Insofern sollen in dem zweiten Kapitel auch mögliche Antworten auf meine eingangs gestellte Frage nach dem „Warum“ gegeben werden.
2. Ursachen der Suizidalität
2.1 Neuropsychische Grundlagen von Depressionen
2.1.1 Menschliche Grundbedürfnisse
Um einen Menschen zu verstehen, ist es erforderlich, Informationen darüber zu haben, was ihn sowohl positiv wie auch negativ berührt. Auch Faktoren wie Wünsche, Ziele, Pläne, Werte, Befürchtungen und Abneigungen sind für das Verständnis eines Menschen bedeutsam (Grawe, 2004).
Wenn die Beschaffenheit und die Lebensumgebung eines Menschen gut ausgewogen sind, fühlt er sich wohl. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit er sich wohlfühlen und gut entwickeln kann? Darauf gibt es viele Antworten. Der Mensch braucht die Luft zur Atmung, Nahrung, um Hunger und Durst zu stillen, eine bestimmte Körpertemperatur und ausreichend Schlaf. Diese biologischen Bedürfnisse haben neben dem Menschen alle Lebewesen. Aber für eine gute psychische Gesundheit bedarf es auch bestimmter psychischer Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Wie diese Erfüllung im Speziellen aussieht, kann nur jeder Mensch für sich beantworten. Für einen Beruf, der auf die Hilfe in psychischen Krisen ausgerichtet ist, wie z.B. der des Sozialarbeiters / Sozialpädagogens oder der des Therapeuten, ist es aber außerdem eine zentrale Frage der Profession. Fest steht, dass eine schwere und dauerhafte Verletzung von Grundbedürfnissen die wichtigste Ursache für die Entstehung psychischer Störungen und auch für deren Aufrechterhaltung darstellt. Diese Zusammenhänge sollen folglich betrachtet werden und können mit Hilfe von Grawe als empirisch belegt angesehen werden (Grawe, 2004).
Für eine solche Betrachtung ist es unerlässlich, sich aufgrund der großen Vielfalt auf einige wichtige Grundbedürfnisse zu beschränken, wobei ich mich an den für Grawe wichtigsten vier Grundbedürfnissen im psychischen Geschehen, die auf Seymour Epstein (1990, 1993 zit. nach Grawe, 2004) zurückzuführen sind, orientieren möchte. Diese sind im Einzelnen:
1. das Bedürfnis nach Orientierung, Kontrolle und Kohärenz
2. das Bedürfnis nach Lust
3. das Bedürfnis nach Bindung
4. das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung (Grawe, 2004).
Laut Grawe stellt das Prinzip der Konsistenzregulation die Grundlage des psychischen Funktionierens dar. Konsistenz in diesem Sinne bezieht sich auf einen Zustand des Organismus. Für Grawe bedeutet dieser Begriff die „Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit der gleichzeitig ablaufenden neuronalen / psychischen Prozesse.“ (Grawe, 2004, S. 186). Die Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit wird auf die Beziehungen intrapsychischer Prozesse und Zustände bezogen. Der menschliche Organismus strebt die Konsistenz an und hat viele Strategien entwickelt, Zustände von Inkonsistenz zu verhindern, da eine dauerhafte Inkonsistenz das menschliche Wohlergehen und die Gesundheit negativ beeinflussen kann. Daraus ließe sich schließen, dass auch ein Streben nach Konsistenz ein menschliches Grundbedürfnis darstellen könnte. Da die Konsistenz aber die Funktion einer innerorganismischen Funktion erfüllt und damit eine Sonderstellung einnimmt, stuft Grawe sie nicht als Grundbedürfnis ein, sondern er stellt die Konsistenz als Grundprinzip des psychischen Funktionierens dar. Die Regulation der Konsistenz und die Bedürfnisbefriedigung sind eng miteinander verbunden. Die Verbindung zwischen beiden bezeichnet Grawe als Kongruenz, als Übereinstimmung zwischen den motivationalen Zielen, d.h. den Erwartungen oder Zielsetzungen und den realen Wahrnehmungen aus dem Umfeld eines Individuums (Grawe, 2004).
Ein weiterer Terminus, der Grawes Ausführungen zu entnehmen ist, ist der der motivationalen Schemata (Grawe, 2004). Kaiser spricht in diesem Zusammenhang von neuropsychischen Schemata (Kaiser, 2007).Gemeint sind damit verschiedene Fähigkeiten und Mittel, die der Mensch im Laufe seines Lebens erlernt hat und die der Realisierung und der Erfüllung seiner Grundbedürfnisse dienen (Grawe, 2004). Stellt sich eine Befriedigung der Grundbedürfnisse positiv dar, werden sie als Annäherungsschemata bezeichnet, sind sie allerdings auf Vermeidung, Verletzung, Enttäuschung oder Bedrohung ausgelegt, handelt es sich um Vermeidungsschemata (Kaiser, 2007).
Angeborene neuronale Strukturen zusammen mit den bisherigen gemachten Lebenserfahrungen werden als psychische Grundbedürfnisse deklariert. Diese werden im Gehirn in neuronalen Schaltkreisen gespeichert. Diese Schaltkreise wiederum sind miteinander vernetzt und aktivieren sich gegenseitig, wenn ein Grundbedürfnis bedroht wird (Kaiser, 2007).
Die zuvor erwähnten Grundbedürfnisse werden im Folgenden konkreter beschrieben, wobei mit dem Bindungsbedürfnis begonnen wird.
2.1.1.1 Das Bindungsbedürfnis
Nach vielen unterschiedlichen Beurteilungen steht heute eindeutig fest, das Bindungsbedürfnis ist das Grundbedürfnis, welches empirisch am besten abgesichert ist (Grawe, 2004).
Kaiser definiert den Begriff „Bindung“ als die Neigung eines Menschen, Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln, die von starken emotional geprägten Gefühlen gekennzeichnet sind (Kaiser, 2007).
Das Bedürfnis nach Bindung ist dem Menschen nach Bowlby (2006, zit. nach Schmidt) von Geburt an gegeben. Die neuronalen Grundlagen entstehen im frühen Säuglings- und Kindesalter und werden von den primären Bezugspersonen wie z.B. der Mutter beeinflusst (Schmidt, 2007). Die Kinder machen durch Lernen bestimmte Erfahrungen, die Bowlby (1976, zit. nach Grawe, 2004) als „inneres Arbeitsmodell“ und Grawe als motivationale Schemata, die um das Bindungsbedürfnis herum entwickelt werden, bezeichnet. Das Kind speichert seine frühen Beziehungserfahrungen zur entsprechenden Bezugsperson in seinem Gedächtnis als Wahrnehmungs-, Verhaltens- und emotionale Reaktionsbereitschaften. Die Verfügbarkeit und die Sensibilität der primären Bezugsperson ist für die Entwicklung der motivationalen Schemata verantwortlich. Wird dem Kind Nähe, Schutz, Sicherheit und Trost gegeben, fühlt es sich sicher und gut aufgehoben und wird dann positive motivationale Schemata entwickeln. Sollte das Gegenteil der Fall sein, wenn die Bezugsperson nicht genügend Sensibilität aufweist, entwickelt das Kind ungünstige motivationale Schemata (Grawe, 2004). Für ein Kleinkind ist es äußerst wichtig, eine primäre Bezugsperson zu haben, die Feinfühligkeit besitzt und die eine verlässliche Verfügbarkeit aufweist. Denn diese frühen Erfahrungen werden im impliziten Gedächtnis gespeichert und je nach Situation werden sie später dann als Verhaltensweisen, Emotionen, so wie es als Kleinkind wahrgenommen wurde, abgerufen (Schmidt, 2007).
Eine Mitarbeiterin Bowlbys, Mary Ainsworth (1978, zit. nach Grawe, 2004) entwickelte ein Beobachtungsverfahren zur Untersuchung des Bindungsverhaltens von Kindern im Alter zwischen 11 und 20 Monaten. Dieses Verfahren haben später viele andere Arbeitsgruppen für ihre empirischen Untersuchungen zum Bindungsverhalten übernommen. Aus diesen Untersuchungen heraus haben sich vier immer wieder auftretende Bindungsstile manifestiert (Grawe, 2004), die im nächsten Punkt erläutert werden.
2.1.1.1.1 Bindungsbeziehungen und Bindungsstile
Jeder Säugling bzw. jedes Kleinkind ist von einer Beziehungsperson abhängig. Diese Abhängigkeit kann einmal in der Versorgung mit Nahrung und Kleidung bestehen, um die biologischen Grundbedürfnisse zu befriedigen, aber auch in Dingen, die weniger gut beurteilt werden können, um die psychische Gesundheit des Kindes zu gewährleisten. Ist das Kind mit Nahrung und Kleidung nicht ausreichend versorgt, ist es für die Umwelt ganz offensichtlich. Anders verhält es sich, wenn Defizite bei der Zuwendung oder Nähe vorhanden sind. Diese werden dann mangels Wissen oder Gespür nicht erkannt bzw. nicht beachtet (Schmidt, 2007).
Die unter dem letzten Punkt angesprochenen vier immer wieder vorkommenden Bindungsstile stellen sich wie im Folgenden beschrieben, dar.
1. Kinder mit sicherem Bindungsverhalten. Das Kind vertraut seiner Mutter völlig. Auf eine Trennung reagiert es mit Beunruhigung und sucht deshalb beim Eintreffen der Mutter sofort ihre Nähe. Dieses Bindungsmuster ist Bestandteil der Entwicklung konfliktfreier Annäherungsschemata (Grawe, 2004).
2. Kinder mit unsicherer Bindung und vermeidendem Beziehungsverhalten. Kinder mit diesem Bindungsstil suchen nach einer Trennung nicht mehr die Nähe zur Mutter, sie reagieren auch nicht mit Beunruhigung wie die sicher gebundenen Kinder. Dadurch, dass sich das Kind nicht mehr auf Nähe einlässt, verwendet es ein Vermeidungsschema, das sicherstellen soll, nicht wieder verletzt zu werden. Dadurch kann das Bindungsbedürfnis nicht positiv befriedigt werden (Grawe, 2004).
3. Kinder mit unsicherer Bindung und ambivalentem Beziehungsverhalten. Diese Kinder verhalten sich während der Trennung ausgesprochen ängstlich. Nach Eintreffen der Mutter entsteht eine zwiespältige Reaktion, nämlich eine aggressive Ablehnung des Kontaktes und gleichzeitig eine Suche nach Nähe. Bei Nähe entstehen Verlustängste, bei fehlender Nähe jedoch Angst vor dem Alleinsein. Dieses Bindungsmuster ist von konflikthaften motivationalen Schemata geprägt (Grawe, 2004).
4. Kinder mit unsicherer Bindung und desorganisiert / desorientiertem Bindungsverhalten. Dieses Bindungsmuster findet man weniger häufig als die anderen. Hier liegt durch eine fehlende oder missbrauchende Beziehung zu einer primären Bezugsperson eine schwere Verletzung des Bindungsbedürfnisses vor, die für die intrapsychische Regulierung von größter Bedeutung ist (Grawe, 2004).
Aufschlussreich zu diesen Beziehungsstilen ist eine Untersuchung von Waters, Merrick, Treboux, Crowell und Albersheim (2000, zit. nach Grawe, 2004). Sie untersuchten den Bindungsstil bei Kindern im Alter von 12 Monaten und dann 20 Jahre später noch einmal. Diese Untersuchungen ergaben, dass die Zuordnung zu einem sicheren und einem unsicheren Bindungsstil bei 72% der Kinder zutraf. In den Fällen, in denen es eine negative Veränderung im Bindungsmuster gab, konnten schwerwiegende familiäre Veränderungen wie Scheidungen oder Depressionen dafür verantwortlich gemacht werden (Grawe, 2004). Veränderungen im Bindungsstil findet man nicht nur in negative Richtungen. Liegen kritische Lebensereignisse vor, so kann sich der Bindungsstil der betreffenden Person nicht nur ins Negative, sondern auch ins Positive entwickeln (Grawe, 2004).
Das Bedürfnis nach Bindung ist mehrfach untersucht worden. So liegen beispielsweise auch Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie vor. Es wurden schwere Schädigungen nachgewiesen, wenn das Bindungsgefüge gestört war. Je intensiver die Störung, desto negativer die Entwicklung. Die entsprechenden Untersuchungen wurden aus ethischen Gründen nicht am Menschen durchgeführt, denn das Bindungsbedürfnis ist auch bei sozial lebenden Tieren vorhanden. Dazu wurden Rhesusaffen für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt, weil sie sich am besten untersuchen lassen (Schmidt, 2007). Über diese Untersuchungen an Tieren möchte ich in dieser Arbeit nicht eingehen, da sich nicht alle Ergebnisse aus der Tierforschung auf Kinder übertragen lassen.
Welche Folgen haben nun Verletzungen des Bindungsbedürfnisses für die psychische Gesundheit?
2.1.1.1.2 Folgen der Verletzungen des Bindungsbedürfnisses
Entsprechende Untersuchungen an Familien der unteren Gesellschaftsschicht, die gleichzeitig chaotische Familienverhältnisse offenbarten, in denen die Kinder misshandelt wurden, haben ergeben, dass diese Kinder viel häufiger als andere Kinder, einen unsicheren Bindungsstil entwickelten. Grund dafür war, dass diese Kinder oft emotional und physisch zurückgewiesen, aggressiv und feindselig behandelt und bedroht wurden. Eine Untersuchung hat ergeben, dass der Prozentsatz der Kinder, die einen unsicheren Bindungsstil entwickelt hatten, bei den misshandelten Kindern 80% und bei den Kindern einer Kontrollgruppe 19% betrug (Grawe, 2004).
Ursache für einen unsicheren Bindungsstil des Kindes kann im mütterlichen, negativen, unsicheren Beziehungsverhalten begründet sein. Das liegt in erster Linie daran, welche Beziehungserfahrungen die Mutter selbst mit ihrer Mutter gemacht hat. In mehreren Studien wurde mit verschiedenen Methoden immer wieder festgestellt, dass Mütter von Kindern mit einem unsicheren Bindungsstil selbst einen solchen aufwiesen und der eigenen Mutter eine gute Mutterrolle absprachen. Als weitere Hauptursache dafür, dass Eltern nicht in der Lage sind, eine gute Bindungsbeziehung aufzubauen, sind psychische Störungen der Eltern. Dies ist besonders bei depressiven Störungen der Fall. Eine Studie von Sameroff, Seifer und Zax (1982, zit. nach Grawe, 2004) kam zu dem Ergebnis, dass schon ganz kleine Säuglinge, die depressive Eltern hatten, sich schwerer beruhigen ließen und weniger differenzierte Gefühle hatten als Kinder von Eltern, die keine psychische Störung aufwiesen (Grawe, 2004).
Kinder mit einem ausgeprägten unsicheren Bindungsmuster werden immer negative Lebenserfahrungen machen. Sie entwickeln ein negatives Sozialverhalten, keine ausreichende Emotionsregulation, keine positiven Erwartungen von anderen und machen nicht die Erfahrung, dass sie mit ihrem eigenen Verhalten positive Maßstäbe für andere setzen können. Diese Erfahrungen tragen nicht gerade zu einer Erhöhung des Selbstwertgefühls bei. Bei ihnen wird nicht nur das Bindungsbedürfnis nicht ausreichend befriedigt, sondern als Folge davon auch nicht ihr Kontrollbedürfnis. Statt selbstwerterhöhende und damit emotional positive Erfahrungen zu machen, wird hier das Gegenteil ausgelöst. Die Grundbedürfnisse werden permanent verletzt und jede Verletzung bringt wieder negative Wahrnehmungen mit sich, die die Aussichten auf eine positive Bedürfnisbefriedigung noch verschlechtern (Grawe, 2004).
Bei Kindern mit einem desorganisierten Bindungsmuster, hier wurden verständlicherweise nur wenige Untersuchungen durchgeführt, waren die Auswirkungen der Verletzung noch gravierender. Ein unsicherer Bindungsstil bereits im Kleinkindalter legt sehr früh im Leben die Grundlage für eine permanente Nichtbefriedigung des Bindungsbedürfnisses und infolgedessen fast zwangsläufig auch die der anderen Grundbedürfnisse (Grawe, 2004).
Inwiefern ein unsicherer Bindungsstil mit der psychischen Gesundheit in Verbindung steht, lässt sich an drei Studien, die einigermaßen fundierte Aussagen ergeben, entnehmen. In einer Untersuchung von Fonagy et al. (1994, zit. nach Grawe) an 85 psychiatrischen Patienten hatten 90% ein unsicheres Bindungsmuster. In der Untersuchung von Adam (1994, zit. nach Grawe, 2004) an 132 psychiatrischen Patienten lag der Anteil sicher gebundener Jugendlicher bei 20%. In einer weiteren Analyse über 14 Untersuchungen von 688 Patienten kamen van Ijzendoorn und Bakermans – Kranenburg (1996, zit. nach Grawe, 2004) zu folgendem Ergebnis: unsicher – vermeidender Bindungstyp 41%, unsicher – ambivalent 46% und sicher gebunden 13% (Grawe, 2004).
Grawe kommt zu dem Schluss, dass es die Verletzungen des Bindungsbedürfnisses sind, die letztendlich über viele weitere Schritte zu psychischen Störungen führen und nicht etwa die Störungen sind es, die zum unsicheren Bindungsstil führen (vgl. Grawe, 2004, S. 216).
Auf der Suche nach weiteren Inkonsistenzquellen kommt man nicht umhin, neben dem Bindungsbedürfnis weitere Grundbedürfnisse zu berücksichtigen. Daher befasst sich der nächste Abschnitt mit dem Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle.
2.1.1.2 Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle
Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ist für Epstein (1990, zit. nach Grawe, 2004) das grundlegendste Bedürfnis des Menschen.
Folgt man Powers (1973, zit. nach Grawe, 2004) so ist davon auszugehen, dass der Mensch eine Wahrnehmungskontrolle anstrebt, die Auskunft über die sich stets erneuernden Ziele gibt. Dabei ist es unerlässlich, entweder positive oder negative Kontrollerfahrungen zu machen. Liegt eine positive Kontrollerfahrung vor, spricht man von einer Kongruenz. Liegt eine negative Kontrollerfahrung vor, d.h. die Wahrnehmungen und die aktuelle Zielstellung weichen voneinander ab, spricht man von Inkongruenz, auch als Stress bezeichnet (Schmidt, 2007). Psychische Störungen, die der Mensch als von ihm unkontrollierbar ansieht, sind für ihn immer eine Verletzung des Kontrollbedürfnisses. Das wiederum hat bei ihm Inkongruenz, also Stress zur Folge. Erstreckt sich dieser Zustand auf eine längere Zeit, wird eine Reihe von Ereignissen im Gehirn veranlasst, die schwere Schäden hinterlassen (Schmidt, 2007). Laut Grawe bedeutet Inkongruenz: „Abweichungen zwischen den Wahrnehmungen der Realität auf der einen Seite und aktivierten Zielen, Erwartungen und Überzeugungen auf der anderen Seite“. (Grawe, 2004, S. 237).
Schon als Säugling ist das Kontrollbedürfnis eng mit dem Bindungsbedürfnis verbunden. Wenn Säugling oder Kleinkind die Erfahrung macht, dass mit dem eigenen Verhalten eine zuverlässige, gewünschte Reaktion bei der Mutter eintritt, dass also Einfluss ausgeübt werden kann, wann und wie die Bezugsperson sich ihm zuwendet, bedeutet das alles eine positive Kontrollerfahrung. Eine verfügbare, sensible und responsive Bezugsperson ist in der ersten Lebensphase für die Befriedigung des Kontrollbedürfnisses wie für die Befriedigung des Bindungsbedürfnisses gleich wichtig. Verletzungen des Bindungsbedürfnisses bedeuten aber auch gleichzeitig Verletzungen des Kontrollbedürfnisses (Grawe, 2004).
Hat ein Mensch ein wichtiges Ziel vor Augen, ist sein Kontrollbedürfnis aktiviert. Eine Befriedigung des Kontrollbedürfnisses hat immer eine Verbesserung des Zustandes zur Folge, Vereitelungen und Verletzungen jedoch eine Verschlechterung. Im Grunde genommen ist jedes Individuum bestrebt, alle Grundbedürfnisse gleichzeitig zu befriedigen. Weil Zustände dieser Kongruenz aber sehr selten sind, ist das Bedürfnis nach Kontrolle fast immer aktiviert (Grawe, 2004). Der Mensch ist nicht nur bestrebt, die Grundbedürfnisse positiv zu befriedigen, sondern auch um sie vor Verletzungen zu schützen. Dazu hat er aufgrund seiner Lebenserfahrungen verschiedene Annäherungs- und Vermeidungsschemata entwickelt. Bei den Annäherungszielen hat er ein klares Ziel im Blick, der Weg dorthin lässt sich gut kontrollieren. Dadurch kann er positive Kontrollerfahrungen machen. Sind aber im Gegensatz dazu Vermeidungsziele aktiviert, so kann das Kontrollbedürfnis nicht ausreichend befriedigt werden, denn Vermeidungsziele entfernen sich von etwas weg. Es fehlt am eigentlichen Ziel, das man im Auge haben kann, weil das Ziel nicht eindeutig bestimmt werden kann. Da der Mensch keine Übereinstimmung mit seinen Zielen erreicht, kann er natürlich auch nicht kontrollieren, wo er sich gerade befindet. Das eben Gesagte bedeutet nichts anderes als Inkongruenz. Diese Inkongruenz fordert vom Menschen ständige Aufmerksamkeit, ständiges Wahrnehmen, insgesamt einen höheren psychischen Aufwand und birgt trotzdem ein höheres Risiko für Verletzungen des Kontrollbedürfnisses (Grawe, 2004). Für einen Menschen, der sich dauerhaft im Zustand der Inkongruenz befindet, heißt das, unkontrollierbarem Stress ausgesetzt zu sein. Das wiederum hat zur Folge, dass der Glucocorticoidpegel zu hoch ist und dadurch Teile des Hippocampus und Nervenenden im Cortex geschädigt werden. Ist in Folge dessen der Cortisolpegel zu hoch, kommt es außerdem zur Vernichtung der erworbenen Verhaltensweisen. Bereits bestehende neuronale Verbindungen werden versperrt. In der Regel findet ein Rückkopplungsprozess statt, der bei kontrollierbarem Stress aktiviert wird und den Vorgang wieder normalisiert, indem er die Ausschüttung von Glucocorticoiden verhindert. Dieser Rückkopplungsprozess findet bei unkontrollierbarem, dauerhaften Stress nicht statt, deshalb kommt es zu einem dauerhaft erhöhten Glucocorticoidspiegel und dessen negativen Impulsen für das Gehirn (Schmidt, 2007). Eine bedrohliche Inkongruenzsituation, die unkontrollierbar erscheint, also eine Lage, in der wesentliche Ziele gefährdet oder verletzt werden, ohne dass man sich dagegen wehren kann, löst als natürliche Reaktion Angst aus (Grawe, 2004).
Alloy, Kelly, Mineka und Clements (1990, zit. nach Grawe) entwarfen ein Konzept über die immer wieder festgestellte Abfolge von Reaktionen auf unkontrollierbare, widerwillige Situationen und die damit verbundene Angst und Depression. Ist sich jemand seiner eigenen Kontrollfähigkeit nicht sicher, befällt ihn zunächst ein Zustand erregter Angst. Alloy et al. (1990, zit. nach Grawe, 2004) nennen diese Phase „ungewisse Hilflosigkeit“. Dauert diese unkontrollierbare Inkongruenz an, verschlimmert sich dieser Angstzustand zu einem ängstlich – depressiven Zustand „sichere Hilflosigkeit“ und endet schließlich in einem depressiven Zustand, der als tiefe „Hoffnungslosigkeit“ bezeichnet wird. Auch Chorpita und Barlow (1998, zit. nach Grawe, 2004) sehen einen Weg, in dem die Angst vor der Depression steht. Diese Ansicht teilen auch Angst, Vollrath, Merikangas & Ernst (1990, zit. nach Grawe, 2004) sowie Di Nardo & Barlow (1990, zit. nach Grawe, 2004). Auch nach ihrer Ansicht kommt es erst aufgrund von Angststörungen zu Depressionen. Außerdem sind Chorpita und Barlow (1998, zit. nach Grawe, 2004) überzeugt davon, dass frühe Bindungsbeziehungen eines Kindes eine wichtige Rolle spielen, da unsichere Bindungsstile zur Verletzung des Kontrollbedürfnisses führen und die ständige Inkongruenz und Angst zur Folge haben. Dadurch kommt es zur Aktivierung der neuronalen Schemata. Bei einer fortgesetzten Verletzung des Kontrollbedürfnisses gibt der Mensch nach einer gewissen Zeit die Anstrengungen zur Kontrollerlangung auf, er resigniert. Sein Vermeidungssystem ist zugleich in höchstem Grade aktiviert (Grawe, 2004). Dadurch, dass der ACC seine Aufgabe nicht mehr erfüllt, ist eine für den Menschen zuträgliche Auseinandersetzung mit seinem Umfeld nicht mehr gegeben. Die überaktivierte Amygdala und der hyperaktive rechte PFC geben Zeugnis von anhaltenden negativen Emotionen, die den Weg in die Depression geebnet haben. Verletzungen des Grundbedürfnisses nach Kontrolle rufen also nicht nur Angst und Stress hervor, sondern hinterlassen Spuren, die im späteren Leben Grundlage für psychische Störungen sein können (Grawe, 2004).
Wie noch bei der Narzissmustheorie, bei den psychoanalytischen und psychodynamischen Theorien, zu erkennen sein wird, hat der Selbstwert eines Menschen für die Suizidalität eine große Bedeutung. Deshalb soll im Rahmen der menschlichen Grundbedürfnisse auch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz Beachtung finden.
2.1.1.3 Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz
Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz bildet im Gegensatz zu den anderen psychischen Grundbedürfnissen eine Ausnahme. Diese besteht darin, dass es sich um ein speziell bei dem Menschen vorkommendes Bedürfnis handelt. Es setzt das Bewusstsein des Menschen und seine Fähigkeit zu intensivem Denken voraus. Ohne diese Prämissen wäre kein Selbstwertgefühl und Selbstbild möglich (Grawe, 2004). Das explizite Selbstbild entsteht aus einer Interaktion mit der Umwelt und ist dem menschlichen Bewusstsein zugänglich. Das implizite Selbstbild hingegen entwickelt sich durch das reflexive Denken als Folge verinnerlichter Eindrücke und ist dem Menschen nicht bewusst. Ist sich ein Mensch seiner Charakterzüge bewusst, erst dann setzt das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung ein. Das ist bei einem Kind der Fall, wenn es Gefühle der Kränkung, Scham oder Schuld empfindet oder auch wenn es sich verletzt fühlt. Das Selbstbild kann ausschließlich subjektiv wahrgenommen werden. Da die neuronalen Schemata hierzu sehr umfangreich sind, kann nicht auf neurowissenschaftliche Ergebnisse zurückgegriffen werden, sondern man muss sich sozialpsychologischer Forschungsergebnisse bedienen. Diese weisen empirisch fundierte Resultate auf (Grawe, 2004).
Bei der Untersuchung von kleinen Kindern wurde festgestellt, dass die Befriedigung oder Verletzung der Bedürfnisse nach Bindung und Kontrolle schon in der ersten Lebensphase von enormer Wichtigkeit für die spätere psychische Gesundheit sind. In diesem Alter, in dem eine Verletzung der eben genannten Bedürfnisse möglich ist, hat ein Säugling noch kein Selbst und Selbstbild aufgebaut, das auf- oder abgewertet werden könnte. Aber eventuelle negative Erfahrungen, die ein Kind bezüglich seines Bindungs- und Kontrollbedürfnisses gemacht hat, können enormen Einfluss auf das sich zu entwickelnde Selbst nehmen und dazu führen, dass das Kind schon von Beginn an ein negatives Selbstbild bzw. Selbstwertgefühl besitzt. Solch ein Mensch wird sich später oft selbstabwertend verhalten (Grawe, 2004).
Es gibt Menschen, die über ein schlechtes Selbstwertgefühl verfügen, nicht nach dessen Erhöhung streben und sich außerdem oftmals auch noch selber abwerten. Die Entwicklung eines schlechten Selbstwertgefühls lässt vermuten, dass Menschen dann nach Selbstwerterhöhung streben. Dazu benötigt es aber auch eine geeignete Umwelt. Wenn man bedenkt, dass das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung nicht das einzige zu befriedigende Bedürfnis darstellt, wird auch erklärbar, warum es Menschen gibt, die ihr schlechtes Selbstwertgefühl um jeden Preis aufrechterhalten wollen, denn zur Befriedigung anderer Bedürfnisse wird auf die Befriedigung dieses Bedürfnisses verzichtet, da eine gleichzeitige Befriedigung aller Bedürfnisse gleichermaßen dem Menschen nicht möglich ist. Als Ursache dafür ist festzustellen, dass wegen verletzender Erfahrungen um dieses nicht befriedigte Grundbedürfnis herum Vermeidungsschemata gebildet werden und dass die Zufriedenstellung eines Bedürfnisses der der anderen Bedürfnisse weichen muss (Grawe, 2004). Möchte sich der Mensch vor Abwertungen, Verletzungen und Enttäuschungen schützen, indem er sich eines Vermeidungsschemas bedient, bedeutet das nicht, dass er kein Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung hat. Ihm fehlen lediglich umgebungsbezogene Ziele zur Verwirklichung seines Bedürfnisses. Wenn positive bedürfniserfüllende Erfahrungen vorhanden wären, hätten sich solche Ziele herausbilden können. Liegen solche Erfahrungen aber nicht vor oder sind sie seltener und schwächer als verletzende Erfahrungen, dann werden in entsprechenden Situationen die Vermeidungsschemata stärker aktiviert als die Annäherungsschemata (Grawe, 2004).
Bei gesunden Menschen ist festzustellen, dass sie zu Übertreibungen beim Selbstbild, zu Selbstwertillusionen wie auch zur Überschätzung ihrer Selbstkontrolle neigen. Bei Selbstbeschreibungen werden viel mehr positive als negative Aspekte genannt. Diese Feststellungen konnten von Forschern wie Tayler und Brown (1988, zit. nach Grawe, 2004), sowie Nisbett und Ross (1980, zit. nach Grawe, 2004) und Colvin und Block (1994, zit. nach Grawe, 2004) nachgewiesen werden. Dazu gehört auch, dass eine Selbstbeurteilung bei den meisten Personen viel positiver verlief als bei der Beurteilung eines fremden Menschen. Das liegt daran, dass man sich selbst an positive Dinge besser erinnert, sie werden außerdem auch schneller verarbeitet als Negative. Für die Mehrzahl der von den oben genannten Forschern beurteilten Versuchspersonen trifft das eben Gesagte zu. Bei depressiven Menschen und Personen mit niedrigem Selbstwertgefühl verhält es sich anders. Sie beurteilen sich realistischer, hier sind positive und negative Aspekte ziemlich ausgeglichen, Selbst- und Fremdbeurteilungen stimmen mehr überein, positive und negative den Selbstwert betreffende Situationen sind im Gleichgewicht. Dadurch kommt man zum Schluss, dass seelisch Gesunde eine irrationale Realitätswahrnehmung bei sich selbst haben und nicht diejenigen mit einer psychischen Erkrankung. Diese Tatsache spricht für das allgemeine Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Die meisten befriedigen dieses Bedürfnis, wann immer sie Gelegenheit dazu haben. Es spricht für eine gute seelische Gesundheit, wenn man sich etwas übertrieben positiv beschreibt und sich selbst positiver beurteilt als andere. Tayler und Brown (1988, zit. nach Grawe, 2004) berichteten zudem über Untersuchungen zu realitätsfernem Optimismus. Die meisten Personen glauben, dass sie selbst ein schwerer Schicksalsschlag wie Krebs, Autounfall, Gewaltverbrechen oder Arbeitslosigkeit weniger wahrscheinlich treffen wird wie andere Personen. Auch hier sind es wieder die Depressiven, die diesen Optimismus nicht teilen. Diese positive Einstellung stellt einen wesentlichen Faktor des seelischen normalen Zustands dar. Wenn er nicht mehr funktioniert, ist das Grund zur Besorgnis. Denn die Tatsache, dass bei Depressiven keine Anzeichen zur Selbstwerterhöhung vorhanden sind, geht mit der Tatsache einher, dass bei ihnen ganz allgemein keine Anzeichen von Annäherung da sind. Das Annäherungssystem scheint lahmgelegt (Grawe, 2004). Der linke PFC ist nicht aktiv, also funktioniert auch das Annäherungssystem nicht mehr. Als Folge davon können auch keine positiven Erfahrungen mehr erlebt werden, sie wollen auch nicht mehr versuchen, ihren Selbstwert zu erhöhen. Wahrscheinlich ist, dass der fehlende Antrieb zur Selbstwerterhöhung bei Depressiven mit zur Erhaltung des depressiven Zustandes beiträgt. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass er als Ursache dafür angesehen werden kann (Grawe, 2004).
Interessant und für diese Ausarbeitung sehr wichtig erscheint mir die Beschreibung mehrerer Versuche von Alsaker (1997, zit. nach Grawe, 2004) und Alsaker und Olweus (2003, zit. nach Grawe, 2004), die an Jugendlichen durchgeführt wurden. Hier konnte nachgewiesen werden, dass Ablehnung und Drangsalierung durch Gleichaltrige mit Selbstabwertungen und Depressionen korrelierten. Nach Alsaker und Flammer (1996, zit. nach Grawe, 2004) nahmen depressive Jugendliche häufiger Zurückweisungs- und Isolierungstendenzen wahr als nichtdepressive Gleichaltrige. Die Verletzung des Selbstwertbedürfnisses ist ein Bindeglied in einer negativen Entwicklung, die ihren Ursprung in Verletzungen des Bindungs- und Kontrollbedürfnisses hat (Grawe, 2004).
Um psychische Störungen zu vermeiden, ist es also wichtig, das Bindungsbedürfnis, das Kontrollbedürfnis und das Selbstwerterhöhungsbedürfnis möglichst in positiver Balance zu halten. Das fehlende, vierte Grundbedürfnis wird im nächsten Absatz vorgestellt.
2.1.1.4 Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung
Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung ist das komplexeste aller psychischen Grundbedürfnisse. Jeder Mensch ist bestrebt, ein gutes Wohlergehen zu haben, angenehme Zustände herbeizuführen und unangenehme Zustände zu vermeiden. All das wird vom Gehirn in verschiedenen Abläufen permanent hinsichtlich der Qualität zwischen gut und schlecht bewertet (Schmidt, 2007). Diese Einschätzung findet unter Einbeziehung der bisher gemachten Erfahrungen statt und „durchzieht alle Aspekte menschlichen Erlebens“ (Grawe, 2004, S. 261). Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung darf nicht alleine psychisch betrachtet werden, sondern es besteht in sehr vielen Fällen eine Verbindung zu physischen Faktoren. Ein gutes Beispiel dafür bietet die Nahrungsaufnahme. Hier werden dem Körper Dinge zugeführt, die er für sein tägliches Leben unbedingt benötigt. Aber die Nahrungsaufnahme kann auch einen Lustgewinn erzeugen, wenn sie als angenehm empfunden wird. Wird ein Mensch andererseits zum Essen genötigt oder sogar gezwungen, so erzeugt dieser Umstand beim Betreffenden Unlust. Auf der einen Seite werden zwar grundlegende, überlebensnotwendige und körperliche Bedürfnisse befriedigt, auf der anderen Seite findet aber auch eine Verletzung im emotionalen Bereich statt. Solch eine Verletzung hat bestimmte neuronale Prozesse zur Folge, die wiederum zu psychischen Beeinträchtigungen führen können, wenn sie nicht unterbrochen werden. Eine Beurteilung eintreffender Reize in gut / schlecht erfolgt auch auf emotionaler Basis automatisch und unbewusst. Diese Beurteilung hängt nicht nur von objektiven, sondern von mannigfaltig unterschiedlichen Faktoren ab, wie z.B. dem augenblicklichen Zustand und der Situation des betreffenden Menschen. Auch seine bisherigen Erfahrungen, Erwartungen und Einstellungen spielen dabei eine Rolle (Schmidt, 2007). Zu dem Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung gehört neben der Nahrungsaufnahme auch die Aufrechterhaltung einer bestimmten Körpertemperatur und die Umgehung von Verletzungen usw. Zur Erfüllung dieser Anforderungen haben sich im Laufe der menschlichen Entwicklung besondere Rückmeldesysteme herausgebildet. Dazu gehört das Schmerzsystem, das Ekelsystem, das Paniksystem, das Furchtsystem und andere mehr. Eines haben diese Systeme gemeinsam, sie haben eigene neuronale Grundlagen (Grawe, 2004). Außerdem dienen diese Systeme dem Lustgewinn bzw. dem Bedürfnis nach Unlustvermeidung. Gelingt es, alle Grundbedürfnisse möglichst gut zu koordinieren und zu befriedigen, so wird ein kurzzeitiges, subjektives Wohlbefinden auf das Bestreben nach Lustbefriedigung folgen oder ein relativ andauerndes Wohlbefinden. Hier sei noch einmal das Nahrungsbedürfnis erwähnt. Das Essen stellt für den Menschen einen Lustgewinn dar – bis zur Sättigung. Ist das Lustbedürfnis außer Kontrolle, so wird grenzenlos weitergegessen. Das Sättigungsgefühl wird nicht mehr wahrgenommen. Das Kontroll- und Selbstwertbedürfnis wird außer Acht gelassen und verletzt. Dabei entstehen angenehme Reize, die dafür verantwortlich sind, dass Dopamin in erhöhtem Maße ausgeschüttet wird. Dadurch wird das angenehme Gefühl noch verstärkt, der Lustgewinn wird erhöht. Durch die Verletzung des Kontroll- und Selbstwertbedürfnisses entsteht eine Inkongruenz der Bedürfnisse. In diesem Fall dominieren die Vermeidungs- über den Annäherungsschemata, die sich neuronal gesehen bei oftmals auftretenden Wiederholungen festsetzen und die bestehenden, auf positive Ziele fixierten Annäherungstendenzen überlagern. Ist ein Grundbedürfnis gegenüber den anderen nicht dominant, so kann es durchaus vorteilhaft sein. Überwiegt jedoch das Bestreben nach Lust gegenüber den anderen Bedürfnissen enorm, bleiben alle anderen unbefriedigt. Daraus ergibt sich zwangsläufig ein schlechtes Wohlbefinden, bei depressiven Menschen ist der Lustgewinn schon minimiert. Dauert diese Unlust an, entsteht Inkongruenz (Schmidt, 2007).
Ich habe wiederholt ausgeführt, wie wichtig eine Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse für die psychische Gesundheit ist. Daraus folgt, eine andauernde Nichtbefriedigung oder Verletzung prädisponiert für psychische Erkrankungen. Da diese daraus resultierenden psychischen Erkrankungen einen Menschen wiederum empfänglich für Suizidalität machen können, insbesondere die depressive Störung, die ja auch als eine der Hauptursachen für Suizidhandlungen angesehen wird, soll, nachdem erklärt wurde, wie sie entstehen kann, nun auf diese psychische Störung detailliert eingegangen werden.
2.2 Depressive Störungen im Jugendalter
Depressionen, wie sie uns aus dem Erwachsenenbereich bekannt sind, sowohl nach ihrer Klassifikation als auch nach ihrer Symptomatologie, war für die Psychiatrie für das Kindes- und Jugendalter lange umstritten. Der Grund dafür könnte sein, dass die Feststellung affektiver Störungen im frühen Lebensalter recht problematisch ist, denn während eine depressive Störung bei Erwachsenen relativ leicht feststellbar ist, stellt sie sich bei Kindern und Jugendlichen je nach Alter und Entwicklungsstand oftmals in versteckter Form dar (Freisleder; Schlamp, 2001). So kann sich z.B. hinter häufigen Unfällen, die ein Jugendlicher erleidet, durchaus eine depressive Verstimmung verbergen (Dörner et al., 2007).
Was steckt hinter der Aussage, ein Jugendlicher sei depressiv? Vorrangig denkt man an depressive Gefühle, Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit und Traurigkeit, die das augenblickliche Erleben des Jugendlichen widerspiegeln. Keinesfalls dürfen jedoch auch depressive Verhaltensweisen, die sich entweder nonverbal durch Mimik, Körperhaltung, Rückzugsverhalten wie auch verbal durch Äußerungen von Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit bemerkbar machen, missachtet werden. Häufig kommen noch negative kognitive Einstellungen, bzw. Denkmuster mit negativen Inhalten über sich selbst, über das Leben und der eigenen Zukunft, hinzu. Auch hier bleibt festzustellen, dass die mannigfaltigen Ausdrucksformen depressiver Verstimmungen im Jugendalter sehr vom Alter bzw. vom Entwicklungsstand abhängen (Freisleder; Schlamp, 2001).
Was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff der Depression? Eine Antwort auf diese Frage wird im nächsten Abschnitt gegeben.
2.2.1 Begriffsbestimmung der Depression
Der Begriff Depression stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Niedergeschlagenheit, traurige Stimmung (Duden, das Fremdwörterbuch, 2001). Der ursprünglich geprägte Begriff „endogene Depression“ ist heute nicht mehr gebräuchlich. Die ICD – 10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10; international Classification of Diseases der WHO) verwendet stattdessen die Bezeichnung „Depressive Episode mit somatischen bzw. psychotischen Symptomen“ (Schmidt, 2007). Der DSM – IV (American Psychiatric Association), der überwiegend im anglo – amerikanischen Bereich der Klassifikation dient, unterscheidet sich nicht sehr von derjenigen in der ICD – 10 (Freisleder; Schlamp, 2001). Die ICD - 10 spricht in diesem Falle von einer „Major Depression mit Melancholie“ (Schmidt, 2007). In dem Jahre 2005 hat Wolfersdorf (zit. nach Schmidt, 2007) die Depressionen als affektive Störungen, als Krankheiten, die sowohl eine gewisse typische Symptomatik, als auch Verhalten der Betreffenden aufweisen, bezeichnet (Schmidt, 2007).
2.2.2 Klassifikation der Depression
Die gebräuchlichen psychiatrischen Diagnoseinventare (ICD – 10 und DSM IV) stufen „Depressive Störungen von Kindern und Jugendlichen“ in die Kategorie der „Affektiven Störungen“ ein. Bei der Diagnose einer „Depressiven Episode“ muss sichergestellt sein, dass es sich bei dem Betreffenden um keine körperliche Erkrankung (organisch bedingte psychische Störung), um keinen Drogen- oder Medikamentenkonsum handelt und dass es sich um keine Trauerreaktion handelt, also um eine depressive Verstimmung, die auf den Tod einer nahestehenden Person erfolgt („einfache Trauerreaktion“ (Jost, 2007).
Eine Klassifikation depressiver Störungen erfolgt hauptsächlich aufgrund ihrer Symptomatik, auf die ich mich im nächsten Abschnitt beziehe, des Schweregrades der Störung, sowie der Erfahrungen des Betreffenden mit seinen umgebungsabhängigen Faktoren. Die Frage, ob es eine endogene Depression ist oder nicht, ist diesbezüglich nicht mehr von Bedeutung. Das zuvor erwähnte Konzept stellt eine bessere, empirische Anwendbarkeit der diagnostischen Zuordnung dar. Den vielfältigen Gegebenheiten im Jugendalter genügt es hinsichtlich der Erwachsenenpsychiatrie und der dort verwendeten Definitionen nur eingeschränkt. Hauptkriterien einer depressiven Störung stellen nach ICD – 10 eine gedrückte Stimmung, Hemmung von Antrieb und Aktivität, Interessenverlust, Freudlosigkeit und erhöhte Ermüdbarkeit dar. Vegetative Störungen, Schuldgefühle, suizidale Gedanken und Handlungen und gelegentliche Wahnideen können noch hinzukommen (Freisleder; Schlamp, 2001). Das Kapitel der ICD – 10, F 3, über affektive Störungen unterscheidet sie nach ihrem Schweregrad in leichte, mittelgradige und schwere depressive Episoden. Diese so geschilderte Symptomatik wird man sicherlich oftmals bei älteren Kindern und Jugendlichen feststellen können. Bei jüngeren Kindern wird die gesamte Bandbreite, in der sich depressive Gefühle, Verhaltens- und Denkweisen zeigen können, nur begrenzt erfasst. Die Vorläuferklassifikation ICD – 9 sah hierfür noch eine Einteilung „spezifische emotionale Störungen des Kindes- und Jugendalters mit Niedergeschlagenheit und Unglücklichsein“ vor (Freisleder; Schlamp, 2001). Hierunter wurden weniger gut abgegrenzte, emotionale Störungen, die für das Kindesalter typisch sind, verstanden. In der ICD – 10 hat man auf diese Kategorie zugunsten einer Präzisierung verzichtet. In der Unterteilung F 93 „emotionale Störungen des Kindesalters“ sind noch einige spezifische Syndrome wie emotionale Störungen mit Trennungsangst, phobische Störungen, emotionale Störungen mit sozialer Überempfindlichkeit sowie Geschwisterrivalität aufgeführt. Die typische kindliche Depression findet hier keine Anwendung mehr, depressive Syndrome werden nun wie bei Jugendlichen und Erwachsenen nach einem bestimmten Schweregrad eingeteilt. Eine endogen – depressive Phase bei einem Jugendlichen würde als schwere, depressive Episode klassifiziert, treten im Verlauf auch manische Episoden auf, spricht man von einer bipolaren affektiven Störung (früher wurde von einer manisch depressiven Erkrankung gesprochen) (Freisleder; Schlamp, 2001).
Außer den episodisch auftretenden depressiven Störungen (ICD – 10 : F32 bzw. F 31), teilt die ICD – 10 auch die „anhaltenden affektiven Störungen“, die sogenannte Zyklothymia (F 34,0) und die Dysthymia (F 34,1) in zwei Kategorien ein. Unter einer Zyklothymia ist eine „andauernde Instabilität der Stimmung mit zahlreichen Perioden von Depression und leicht gehobener Stimmung, von denen aber keine ausreichend schwer und anhaltend genug ist, um die Kriterien für eine bipolare affektive Störung oder rezidivierende Störung zu erfüllen“ zu verstehen (vgl. Freisleder; Schlamp, 2001, S.5). Bei einer Dysthymie handelt es sich um „eine chronische, wenigstens mehrere Jahre andauernde depressive Stimmung“, diese ist nicht schwer und anhaltend genug, als dass sie die Kriterien einer depressiven Störung erfüllt. Die früher als depressive Persönlichkeit bezeichneten Patienten und die „neurotisch“ Depressiven reihen sich in die beiden Kategorien der weniger ausgeprägten, doch anhaltenden depressiven Verstimmungen ein (Freisleder; Schlamp, 2001).
Eine weitere Schwierigkeit bei der diagnostischen Zuordnung von depressiven Syndromen im Kindes- und Jugendalter besteht in der Unterscheidung der depressiven Episode und den anhaltenden depressiven Störungen von Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieser Gruppe von Störungen zu den bereits genannten ist, dass äußere Faktoren als relevante ursächliche Bedingungsfaktoren für das depressive Syndrom genannt werden können. So können zum einen einzelne belastende Lebensereignisse Grund für eine akute Belastungsreaktion sein, die in den meisten Fällen ziemlich schnell nach der Belastung beginnt, sich meist aber innerhalb von Tagen zurückbildet und zum anderen können auch bestimmte Lebensveränderungen, die für einen Jugendlichen eine anhaltend unangenehme bzw. belastende Lebenssituation darstellen, für eine Anpassungsstörung ursächlich sein (Freisleder; Schlamp, 2001). Normalerweise setzt diese innerhalb von einem Monat nach den belastenden Veränderungen ein und kann bis zu einem Monat (kurze depressive Reaktion) oder aber auch bis zu zwei Jahren (längere depressive Reaktion) andauern. Eine akute Belastungsreaktion lässt sich oft recht gut diagnostizieren, wenn sich eindeutige auslösende belastende Lebensereignisse feststellen lassen. Bei den Anpassungsstörungen hingegen verhält es sich problematischer, denn belastende Lebensumstände können wie bei vielen psychiatrischen Störungen Ursache sein oder in abgewandelter Form bei depressiven Störungen bedeutsam sein. In der Ätiologie ist ihr Stellenwert bei vorgegebener individueller Vulnerabilität nicht immer leicht feststellbar. Handelt es sich bei den belastenden Lebensumständen lediglich um einen Cofaktor, so sind sie keine ausreichende Erklärung für das Auftreten und die Art der psychischen Störung. Im Gegensatz dazu entstehen sowohl akute Belastungsreaktionen als auch Anpassungsstörungen als direkte Folge von akuten Belastungen bzw. belastenden Lebensumständen. In diesem Fall stellen sie primäre und verantwortliche Kausalfaktoren dar, was heißen will, dass die Störung ohne sie nicht entstanden wäre (Freisleder; Schlamp, 2001). Eine eindeutige Abgrenzung ist bei Kindern nur sehr schwer zu treffen, da die Lebensumstände eines Kindes seine seelische Entwicklung und seine Gesundheit wesentlich beeinflussen (Freisleder; Schlamp, 2001).
Um den Punkt der Klassifikation der Depression zu vervollständigen, möchte ich auf die Klassifikation der Depressiven Episode nach ICD – 10 noch etwas detaillierter eingehen.
F 32 Depressive Episode
Der betroffene Patient einer leichten (F 32.0), mittelgradigen (F 32.1) oder schweren (F 32.2 und F 32.3) Episode, weist eine gedrückte Stimmung und eine Verminderung von Antrieb und Aktivität auf. Auch die Fähigkeit zur Freude, das Interesse sowie die Konzentration sind reduziert. Nach jeder kleinsten Anstrengung kann der Betroffene unter einer ausgeprägten Müdigkeit leiden. Schlafstörungen und Appetitverminderung sind weitere Anzeichen einer depressiven Episode. Dazu gehört fast immer auch eine Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens. Auch bei den leichteren Formen empfindet der betreffende Patient Schuldgefühle oder hat Gedanken über die eigene Wertlosigkeit. Eine Veränderung der gedrückten Stimmung ist über mehrere Tage kaum feststellbar. Der Betreffende reagiert nicht auf Lebensumstände und die Depression kann von somatischen Symptomen wie Interessenverlust, Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust geprägt sein. Ob eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer eingestuft wird, hängt von der Anzahl und der Schwere der eben genannten Symptome ab (DIMDI, 1994). Im ICD – 10 heißt es weiterhin:
„Inkl.: Einzelne Episoden von:
depressiver Reaktion
psychogener Depression
reaktiver Depression (F 32.0, F 32.1, F 32.2)
Exkl.: Anpassungsstörungen (F 43.2)
depressive Episode in Verbindung mit Störungen des Sozialverhaltens (F 91.-, F 92.0)
rezidivierende depressive Störungen (F 33.-)“ (DIMDI, 1994, S. 344).
F 32.0 Leichte depressive Episode
In der Regel lassen sich beim Betreffenden zwei oder drei der oben genannten Symptome feststellen, von denen er zwar beeinträchtigt ist, aber dennoch kann er die meisten Aktivitäten fortführen (DIMDI, 1994).
F 32.1 Mittelgradige depressive Episode
Zumeist leidet der betroffene Patient an vier oder mehr der oben erwähnten Symptome und er hat große Probleme, alltägliche Aktivitäten fortzusetzen (DIMDI, 1994).
F 32.2 Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
Es handelt sich um eine depressive Episode mit mehreren oben genannten, quälenden Symptomen. Typische Merkmale dieser Episode sind der Verlust des Selbstwertgefühls und Schuldgefühle sowie das Gefühl der Wertlosigkeit. Oftmals sind Suizidgedanken und suizidale Handlungen bei den Betreffenden vorhanden und meist liegen somatische Symptome vor (DIMDI, 1994).
„Einzelne Episode einer agitierten Depression
Einzelne Episode einer majoren Depression [major depression] ohne psychotische
Symptome
Einzelne Episode einer vitalen Depression ohne psychotische Symptome“ (DIMDI 1994, S. 344).
F 32.3 Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
Es handelt sich um eine schwere depressive Episode, wie sie unter F 32.2 beschrieben wurde. Hinzu kommen aber Halluzinationen, Wahnideen, psychomotorische Hemmung oder ein Stupor, die dermaßen starke Ausprägungen angenommen haben, dass keine alltäglichen sozialen Aktivitäten mehr möglich sind und Lebensgefahr durch Suizid und ungenügende Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme bestehen kann. Dabei können Halluzinationen und Wahnideen synthym sein (DIMDI, 1994).
„Einzelne Episoden:
majore Depression [major depression] mit psychotischen Symptomen
psychogene depressive Psychose
psychotische Depression
reaktive depressive Psychose
F 32.8 Sonstige depressive Episoden
Atypische Depression
Einzelne Episoden der „larvierten“ Depression o.n.A.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836609210
- Dateigröße
- 1.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Vechta; früher Hochschule Vechta – Sozialwissenschaft, FB Sozialarbeit/Sozialpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- selbstmord neuropsychologie jugend depression suizid
- Produktsicherheit
- Diplom.de