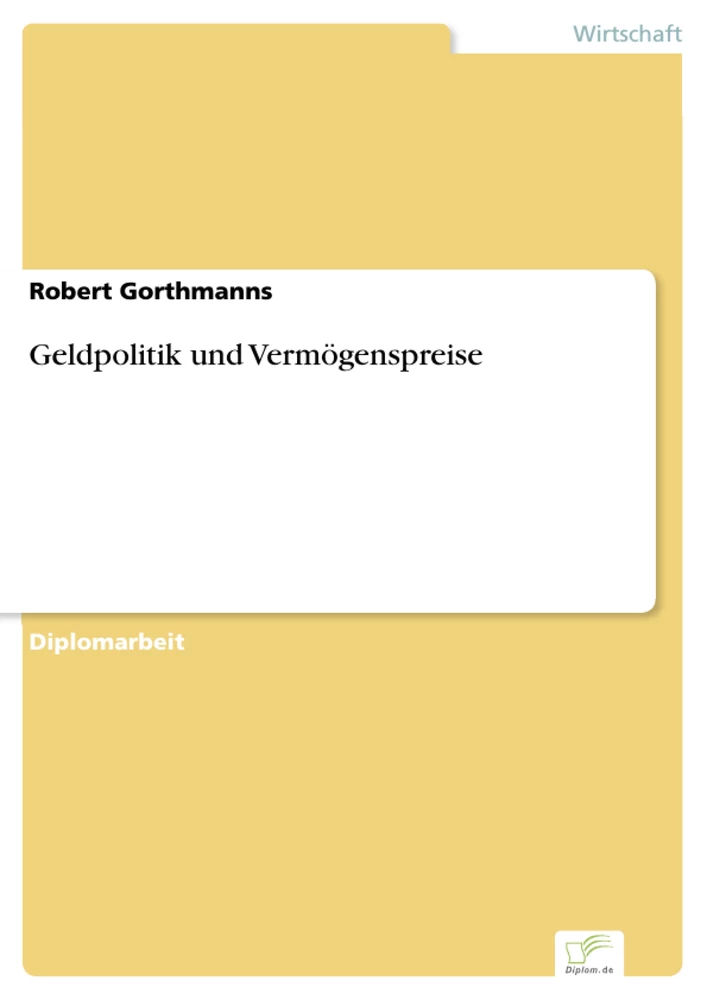Zusammenfassung
Vermögenspreisblasen sind seit langem für Zentralbanken von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Ausgehend von der tulip mania im 17. Jahrhundert über die große Depression in den USA im 20. Jahrhundert bis hin zur Japankrise zu Beginn des 21. Jahrhunderts werden diese asset price bubbles bzw. deren Zusammenbruch für Finanzkrisen mitverantwortlich gemacht. Diese auch als Schocks zu interpretierenden konjunkturellen Einflüsse können die Volatilität von Output und Inflation einer Ökonomie deutlich ausweiten. Dies erschwert das allgemein anerkannte Ziel der Sicherstellung von Preisniveaustabilität. Gleichwohl ist den Zentralbanken der wichtigsten Industriestaaten trotz dieser Störpotenziale insgesamt eine gute Zielerreichung hinsichtlich der Verstetigung des Inflationszieles zu konstatieren die Inflationsraten befinden sich seit vielen Jahren auf niedrigem Niveau. Doch genau dieser Umstand impliziert vor dem Hintergrund der nach wie vor existierenden Gefahren durch Vermögenspreisschocks eine völlig neue Herausforderung, die so genannte zero lower bound, also die nominale Zinsuntergrenze. Denn das zentrale Steuerungsinstrument der Zentralbanken zur Regulierung makroökonomischer Zielgrößen ist der kurzfristige, nominale Zins. Er dient als Bindeglied zwischen Inflationserwartung und Realzins und kann grundsätzlich nicht kleiner sein als null. Ein Erreichen dieser Nullgrenze kann, wie noch zu zeigen ist, die Gefahr einer deflationären Spirale auslösen, die es abzuwenden gilt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob das Vorhandensein einer nominalen Zinsuntergrenze bei der Existenz von Vermögenspreisblasen Auswirkungen auf das Verhalten der jeweils verantwortlichen Geldpolitiker hat. Ausgangspunkt ist nach einigen einführenden Begriffsbestimmungen ein Blick in die Theorie der geldpolitischen Transmissionsmechanismen, deren Wirkungsweise bzw. Interaktion mit Vermögenspreisblasen nach wie vor nicht abschließend geklärt ist. Es folgt ein empirischer Überblick über vergangene Boom- und Bust-Phasen bei Vermögenspreisen, um die Relevanz von asset price bubbles in der Praxis noch einmal herauszuarbeiten.
Die beiden darauffolgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Implikationen für die geldpolitische Instanz. Hierbei werden zunächst die Kernprobleme angesprochen, mit denen sich die Geldpolitik konfrontiert sehen muss, wenn Vermögenspreisblasen auftreten. Danach werden verschiedene Handlungsoptionen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsbestimmungen
2.1 Vermögenspreise
2.2 Inflation, Zinsen sowie monetäre und finanzielle Stabilität
2.3 Deflation und die nominale Zinsuntergrenze
3. Die Bedeutung von Vermögenspreisblasen in Theorie und Praxis
3.1 Überblick über die wesentlichen Transmissionskanäle
3.1.1 Zins- und Wechselkurskanal
3.1.2 Kreditkanal
3.1.3 Erwartungshaltungen
3.2 Vermögenspreisblasen in der Historie
3.2.1 Die „new economy“ Preisblase in den USA 1929 - 1933
3.2.2 Der US-Börsencrash 1987 und die „Dotcom“-Blase 2000
3.2.3 Die Japan-Krise zur Jahrtausendwende
3.2.4 Die US-Immobilienkrise in 2007
3.2.5 Zusammenfassung
4. Ausgewählte Probleme bei Vermögenspreisblasen
4.1 Identifikationsprobleme
4.2 Instrumentenprobleme
4.3 Glaubwürdigkeitsprobleme
5. Geldpolitische Handlungsoptionen
5.1 Integration von Vermögenspreisen in einen Preisindex
5.2 Reaktive Geldpolitik
5.3 Proaktive Geldpolitik
5.4 Kritische Würdigung
5.5 Exkurs: Geldpolitik und die nominale Zinsuntergrenze
6. Das Modell von Gruen, Plumb und Stone
6.1 Vorbemerkungen
6.2 Modellgleichungen
6.3 Ergebnisse
6.3.1 Ausgangspunkt: Preisblase geldpolitisch nicht beeinflussbar
6.3.2 Eintrittswahrscheinlichkeit des Preissturzes beeinflussbar
6.3.3 Integration von Effizienzverlusten
6.3.4 Wachstum der Preisblase geldpolitisch beeinflussbar
6.3.5 Mehrjährige Preisblaseneinbrüche
6.3.6 Rationale Vermögenspreisblasen
6.3.7 Zusammenfassung und kritische Würdigung
7. Die Modellerweiterung von Robinson und Stone
7.1 Integration der nominalen Zinsuntergrenze
7.2 Einleitende Überlegungen zu den erwarteten Ergebnissen
7.2.1 Exogene Preisblasen
7.2.2 Geldpolitisch beeinflussbare Preisblasen
7.2.3 Der Versicherungsaspekt und die ZLB
7.3 Ergebnisse
7.3.1 Wachstum der Preisblase exogen vorgegeben
7.3.2 Variation der Wahrscheinlichkeit des Zerplatzens
7.3.3 Wachstum der Preisblase geldpolitisch beeinflussbar
7.3.4 Eintrittswahrscheinlichkeit des Preissturzes beeinflussbar
7.3.5 Sensitivitätsanalyse
7.3.6 Zusammenfassung und kritische Würdigung
8. Exkurs: Der neutrale Realzins
8.1 Niveaubestimmung des neutralen Realzinses im Eurogebiet
8.2 Interpretation der Ergebnisse
9. Abschließendes Resümee
Literaturverzeichnis
Anhang A: Historische Entwicklungen bei Vermögenspreisen
Anhang B: Grafische Darstellungen zu den Modellen ohne und mit nomineller Zinsuntergrenze
Anhang C: Mathematische Herleitung des Phasendiagramms des Ball-Svensson Modells unter optimaler Geldpolitik
Anhang D: Berechnung der optimalen Taylor-Regel nach Ball
Eidesstattliche Versicherung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht der Politikempfehlungen des Aktivisten
Tabelle 2: Einfluss der ZLB auf die Geldpolitik
Tabelle 3: Herleitung der Ergebnisse zu Abbildung (6.1)
Abbildungsverzeichnis
Abbildung (6.1): Politikempfehlungen bei exogener Preisblase
Abbildung (A.1): Entwicklung des S&P 500 Indexes in den USA
Abbildung (A.2): Entwicklung von Bodenpreisen in den USA
Abbildung (A.3): Entwicklung von Bankkrediten in den USA
Abbildung (A.4): Verlauf des Dow Jones Industrial Average
Abbildung (A.5): Aktien- und Landpreise in Japan 1970 - 2003
Abbildung (A.6): Entwicklung ausgewählter makroökonomischer Größen in Japan zwischen 1980 und 2003
Abbildung (A.7): Hauspreisindex für die USA
Abbildung (A.8): Wirkungskette der Immobilien-Krise 2007
Abbildung (B.1): Preisblase geldpolitisch nicht beeinflussbar
Abbildung (B.2): Eintrittswahrscheinlichkeit des Zerplatzens geldpolitisch beeinflussbar
Abbildung (B.3): Annahme unterschiedlicher Zinssatzsensitivitäten
Abbildung (B.4): Integration von Effizienzverlusten
Abbildung (B.5): Wachstum der Preisblase geldpolitisch beeinflussbar
Abbildung (B.6): Entwicklung des Deutschen Aktienindex (DAX)
Abbildung (B.7) Mehrjährige Preisblaseneinbrüche
Abbildung (B.8): Exogene Preisblasen bei Existenz der ZLB
Abbildung (B.9): Exogene Preisblasen mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten des Zerplatzens
Abbildung (B.10): Wachstum der Preisblase geldpolitisch beeinflussbar
Abbildung (B.11): Eintrittswahrscheinlichkeit des Zerplatzens geldpolitisch beeinflussbar
Abbildung (B.12): Zinsreagibilität von Output bei Existenz der ZLB
Abbildung (B.13): Variation der Outputpersistenz
Abbildung (B.14): Variation des neutralen Nominalzinsniveaus bei exogenen Preisblasen
Abbildung (B.15): Variation des neutralen Nominalzinsniveaus bei Beeinflussbarkeit der Wahrscheinlichkeit des Zerplatzens
Abbildung (C.1): Phasendiagramm nach Reifschneider und Williams
Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
Vermögenspreisblasen sind seit langem für Zentralbanken von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Ausgehend von der „tulip mania“ im 17. Jahrhundert über die große Depression in den USA im 20. Jahrhundert bis hin zur Japankrise zu Beginn des 21. Jahrhunderts werden diese „asset price bubbles“ bzw. deren Zusammenbruch für Finanzkrisen mitverantwortlich gemacht. Diese auch als Schocks zu interpretierenden konjunkturellen Einflüsse können die Volatilität von Output und Inflation einer Ökonomie deutlich ausweiten. Dies erschwert das allgemein anerkannte Ziel der Sicherstellung von Preisniveaustabilität. Gleichwohl ist den Zentralbanken der wichtigsten Industriestaaten trotz dieser Störpotenziale insgesamt eine gute Zielerreichung hinsichtlich der Verstetigung des Inflationszieles zu konstatieren – die Inflationsraten befinden sich seit vielen Jahren auf niedrigem Niveau.[1] Doch genau dieser Umstand impliziert vor dem Hintergrund der nach wie vor existierenden Gefahren durch Vermögenspreisschocks eine völlig neue Herausforderung, die so genannte „zero lower bound“, also die nominale Zinsuntergrenze. Denn das zentrale Steuerungsinstrument der Zentralbanken zur Regulierung makroökonomischer Zielgrößen ist der kurzfristige, nominale Zins. Er dient als Bindeglied zwischen Inflationserwartung und Realzins und kann grundsätzlich nicht kleiner sein als null. Ein Erreichen dieser Nullgrenze kann, wie noch zu zeigen ist, die Gefahr einer deflationären Spirale auslösen, die es abzuwenden gilt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob das Vorhandensein einer nominalen Zinsuntergrenze bei der Existenz von Vermögenspreisblasen Auswirkungen auf das Verhalten der jeweils verantwortlichen Geldpolitiker hat. Ausgangspunkt ist nach einigen einführenden Begriffsbestimmungen ein Blick in die Theorie der geldpolitischen Transmissionsmechanismen, deren Wirkungsweise bzw. Interaktion mit Vermögenspreisblasen nach wie vor nicht abschließend geklärt ist. Es folgt ein empirischer Überblick über vergangene Boom- und Bust-Phasen bei Vermögenspreisen, um die Relevanz von „asset price bubbles“ in der Praxis noch einmal herauszuarbeiten.
Die beiden darauffolgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Implikationen für die geldpolitische Instanz. Hierbei werden zunächst die Kernprobleme angesprochen, mit denen sich die Geldpolitik konfrontiert sehen muss, wenn Vermögenspreisblasen auftreten. Danach werden verschiedene Handlungsoptionen vorgestellt, die eine Handhabung von Vermögenspreisblasen ermöglichen. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Analyse proaktiver und reaktiver Geldpolitik, deren zentrales Unterscheidungsmerkmal die Frage ist, ob bereits während des Entstehungsprozesses einer Preisblase gehandelt werden soll oder erst, nach dem die Preisblase geplatzt ist. Der letztgenannte Aspekt, also eine zinssenkende Maßnahme nach dem Zerplatzen, gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. In Zeiten stabil niedriger Inflation kann ein Erreichen der nominalen Zinsuntergrenze dazu führen, dass die Zentralbank einen wichtigen Aktionsparameter für ihre geldpolitische Arbeit aufgeben muss. Für einen solchen Fall werden weitere Möglichkeiten aufgezeigt, die einen Ausweg aus diesem Dilemma zeigen. Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Standpunkte sowie Vor- und Nachteile einzelner Maßnahmen werden hier gegeneinander abgewogen.
Einen Hauptteil der Arbeit bildet das Modell von Gruen, Plumb und Stone, welches verschiedene Vorgehensweisen von reaktiv bzw. proaktiv eingestellten Geldpolitikern beleuchtet. Hier wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Vermögenspreisblasen heterogene Eigenschaften aufweisen können, die eines unterschiedlichen Zinsanpassungsverhaltens bedürfen. Eine wesentliche Erweiterung erfährt dieses Modell durch die Integration der nominalen Zinsuntergrenze auf Basis der Überlegungen von Robinson und Stone, die ergänzend eingeflochten werden.
Eine wichtige Zielgröße in diesem Modell ist die Erreichung des neutralen Nominal- bzw. Realzinsniveaus, welches die Volkswirtschaft in einen gleichgewichtigen Zustand versetzt. Die Bestimmung dieses Niveaus ist empirisch nicht unproblematisch. Im vorletzten Kapitel wird daher der Versuch unternommen, ein neutrales Nominal- bzw. Realzinsniveau für den Euroraum zu ermitteln und so einen Bezug zwischen der Situation in Australien und der im Eurogebiet herzustellen.[2] Das letzte Kapitel fasst die gefundenen Ergebnisse zusammen.
2. Begriffsbestimmungen
2.1 Vermögenspreise
Für das exakte Verständnis des Begriffs „Vermögenspreise“ ist es sinnvoll, zunächst eine Trennung in „Vermögen“ und „Preis“ vorzunehmen.
Der Begriff des Vermögens unterliegt keiner expliziten Definition. Aus volkswirtschaftlicher Sicht kann man unter Vermögen grundsätzlich alle Güter substituieren, die sich im Besitz von Privathaushalten, Unternehmen und Staat befinden.[3] Das Gesamtvermögen eines Wirtschaftssubjektes stellt also die Summe aller ihm gehörenden Aktiva dar.[4] Hierunter lassen sich insbesondere Geldvermögen, Immobilien und Wertpapiere subsumieren. Bargeld bzw. Geldforderungen stellen grundsätzlich ebenfalls Vermögenswerte dar, da sie Erträge in Form von Zinsen erbringen können.[5] In erster Linie übernimmt Geld jedoch die Funktion als Tauschmittel, Recheneinheit und als Wertaufbewahrungsmittel.[6] Es wird daher in den folgenden Überlegungen nicht weiter berücksichtigt. Somit bilden Immobilien und Wertpapiervermögen die wesentlichen Betrachtungsgrößen im Rahmen dieser Arbeit.
Aus theoretischer Sicht kann der Preis eines Vermögensgutes in einen fundamental begründbaren Teil und in einen fundamental nicht begründbaren, demnach spekulativen Teil unterteilt werden.[7] Der zukünftig erwartete Zahlungsstrom eines Vermögensgegenstandes besteht aus dem Kapitalwert aller zukünftigen und auf den aktuellen Zeitpunkt diskontierten Zahlungen, wie sie von festverzinslichen Wertpapieren oder Aktien bekannt sind.[8] Dies entspricht der fundamental begründbaren Preiskomponente.[9] Weitere preisbildende Faktoren sind der erwartete Ertrag aus einer alternativen Anlageform, der zukünftig erwartete Veräußerungspreis sowie das relative Risiko, das mit dem Halten der Anlage verbunden ist.[10] Folglich besteht der Preis eines Vermögensgutes auch aus subjektiven Erwartungen von Marktteilnehmern über dessen zukünftige Wertentwicklung. Übertriebene Erwartungen können die Ursache für die Entstehung einer sich selbst verstärkenden, irrationalen Preisblase sein.[11]
Demgegenüber steht der Begriff der rationalen Preisblase. Diese wird als ein starker Anstieg von Vermögenswerten definiert, der über Erwartungsbildungen weitere Anstiege generiert und Investoren anzieht, die mehr an Profiten aus dem Handel mit diesen Vermögenswerten interessiert sind als an ihrem Nutzen oder ihrer Ertragskraft.[12]. Sie entstehen also, obwohl die Nachfrager wissen, dass der Preis eines Vermögenswertes bereits „übertrieben hoch“ ist und die Gefahr eines Zerplatzens droht. Gleichwohl ist ihre Ertragserwartung für den Fall des Überlebens der Preisblase so hoch, dass es sich lohnt, weiter investiert zu bleiben.[13] Allen und Gale argumentieren, dass gerade kreditfinanzierte Investoren eher geneigt sind, in einen risikoreichen Vermögensgegenstand zu investieren.[14] Dies induziert eine umso größere Abweichung vom fundamental begründeten Preis.
2.2 Inflation, Zinsen sowie monetäre und finanzielle Stabilität
Unter Inflation wird allgemein ein Anstieg des Preisniveaus verstanden.[15] Die Entstehungsgründe von Inflation sind vielfältig.[16] Etwas vereinfachend dargestellt kann Inflation aus rein marktwirtschaftlichen Effekten auf der Angebots- und Nachfrageseite einer Wirtschaft resultieren. Inflation muss aber auch als monetäres Phänomen gesehen werden. Dies folgt aus der Quantitätsgleichung,[17] nach der eine prozentuale Änderung der Geldmenge stets in gleichem Umfang Auswirkungen auf Output bzw. – bei konstantem Outputniveau – auf das Preisniveau hat.[18] Da die Steuerung der Geldmenge heute in vielen Industrienationen den jeweiligen Zentralbanken obliegt, kommt ihnen in der Konsequenz auch die Aufgabe der Steuerung von Inflation (bzw. rein formal auch dem Outputniveau) oder, etwas formaler ausgedrückt, die Sicherung der Preisniveaustabilität zu.[19]
Die Überwachung und Steuerung von Inflation ist notwendig, weil eine hohe Inflation volkswirtschaftliche Kosten verursacht. Die Höhe dieser Kosten hängt maßgeblich von den Inflationserwartungen der Wirtschaftssubjekte ab. Wurde Inflation korrekt antizipiert, sind die entstehenden Kosten vergleichsweise gering. Hierunter fallen beispielsweise „shoeleather costs“.[20] Sie entstehen durch eine niedrigere durchschnittliche Bargeldhaltung aufgrund (inflationär bedingt) gestiegener Nominalzinsen, welche zu erhöhten „Schuhsohlenkosten“ für die Beschaffung von Bargeld führen. Dieser Zusammenhang zwischen Inflation, Realzins- und nominellem Zinsniveau wurde erstmals durch Irving Fisher beschrieben.[21] Formal stellt er sich folgendermaßen dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Der Nominalzinssatz Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenbezeichnet den Zins, der für die Überlassung von Liquidität gezahlt wird, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenbezeichnet die Inflationserwartung und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenden Realzins bzw. die inflationsbereinigte Zunahme an Kaufkraft.[22] Aufgrund der Neutralitätsannahme des Geldes hat eine Erhöhung der Wachstumsrate der Geldmenge (bei konstantem Output) langfristig lediglich eine proportionale Steigerung der Inflationsrate zur Folge und keine Auswirkungen auf reale Größen.[23] Eine Zunahme der Inflationsrate[24] hat allerdings gemäß Gleichung (2.1) steigende Nominalzinsen zur Folge, was eine geringere Realkassenhaltung impliziert und daher eine häufigere Beschaffung von Geld seitens der Wirtschaftssubjekte zur Folge hat.
Weitere Kosten erwarteter Inflation bestehen durch häufiger erforderliche Preisneuauszeichnung und der nach wie vor üblichen nominalwertorientierten Steuer- und Abgabenpolitik. Die bestehenden Steuertabellen nehmen keine Rücksicht darauf, dass das Einkommen von Wirtschaftssubjekten mehr oder minder inflationär belastet ist.[25]
Bedeutsamer sind die Kosten nicht antizipierter Inflation, die sich grob in Redistributionseffekte, Allokationseffekte und in Auswirkungen auf die Geldwirtschaft gliedern lassen.[26] Redistributionseffekte beschreiben inflationär bedingte Umverteilungen bei Einkommen und Vermögen. Allokationseffekte entstehen einerseits bei volatilen Inflationsraten, da die Wirtschaftssubjekte nur schwer zwischen den Schwankungen von relativen Preisen und denen des allgemeinen Preisniveaus unterscheiden können und folglich Gefahr laufen, ihre knappen Ressourcen falsch einzusetzen. Andererseits führt ein schwankendes Preisniveau zu Problemen in der zukünftigen Wirtschafts- bzw. Investitionsplanung. Unter den Auswirkungen für die Geldwirtschaft versteht man beispielsweise das Problem, dass der Nominalzins einer Ökonomie bei unvollständig antizipierter Inflation seine Funktion als Entschädigung für Kaufkraftverluste nur noch unvollständig erfüllen kann.
Die gebräuchlichste Form zur Messung von Inflation sind Verbraucherpreisindizes. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex der Europäischen Zentralbank (HVPI) ist ein solcher Index auf Basis des Berechnungsverfahrens nach Laspeyres. Er wird auf Basis eines regelmäßig neu festgelegten Warenkorbes ermittelt und zeigt im Zeitvergleich die Entwicklung der Inflationsrate an.[27]
Ein spezielles Problem bei der Messung von Inflation ist die „Vermögenspreisinflation“. Dabei handelt es sich um Preissteigerungen von Immobilien und Finanzaktiva, die vom Preisindex nicht erfasst werden, da beispielsweise eine Steigerung der Immobilienpreise dort nicht eingeht.[28] Steht einer Ausweitung der Geldmenge keine entsprechende Erhöhung des Realgüterangebots gegenüber, so steigt aufgrund der Quantitätsgleichung das Preisniveau,[29] ohne dass diese Tatsache im Index der Lebenshaltungskosten deutlich wird. Dieses „Nichterkennen“ verschärft das Problem spekulativ getriebener Steigerungen von Vermögenspreisen.
Die Einhaltung von Preisniveaustabilität wird in Anlehnung an Issing mit monetärer Stabilität gleichgesetzt.[30] Hiervon ist der Begriff der finanziellen Stabilität zu trennen.[31] Finanzielle Stabilität kennzeichnet einen Zustand, in dem ein Finanzsystem eigenständig in der Lage ist, auftretenden Schocks standzuhalten, finanzielle Ungleichgewichte eigenständig abzubauen und so ineffiziente Kapitalallokation zu vermeiden.[32] Wie nah eine Ökonomie an dem Punkt ist, dessen Überschreitung eine effiziente Allokation von Investition und Sparen beeinträchtigen würde, kann allgemein als Grad der finanziellen Fragilität beschrieben werden.[33]
Studien zeigen, dass das Erreichen monetärer Stabilität nicht zwangsläufig auch finanzielle Stabilität bedeutet.[34] Vielmehr kann ein restriktiver geldpolitischer Kurs zur Sicherung des Preisniveaus die Entstehung von Finanzkrisen begünstigen. Die Wirkungskette verläuft über steigende Zinsen bzw. fallende Börsenkurse zu einem unerwarteten Rückgang des Preisniveaus. Dies erhöht die Unsicherheit an den Finanzmärkten und kann im Extremfall Bankenkrisen hervorrufen.[35] Trotz dieser Problematik wird heute davon ausgegangen, dass sich monetäre und finanzielle Stabilität langfristig gegenseitig stützen.[36]
2.3 Deflation und die nominale Zinsuntergrenze
Deflation wird als ein anhaltendes Sinken des Preisniveaus bezeichnet. Eine längerfristige Abwärtsbewegung impliziert allerdings einen bedeutsamen Unterschied zur Inflation, der aus Gleichung (2.1) hervorgeht. Erwarten die Wirtschaftssubjekte fallende Preise, kehrt sich das Minuszeichen aufgrund negativer Werte für Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenum. Folglich steigt der Realzins. Unerwünschte Realzinssteigerungen kann die Zentralbank durch Reduktion des nominalen Zinses Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenausgleichen. Dies geht bis zu dem Zeitpunkt, an dem er den Wert null erreicht. Negative Zinssätze sind zwar theoretisch denkbar - sie führen aber dazu, dass die Wirtschaftssubjekte diesen negativen Ertrag auf ihre Anlagen meiden und stattdessen unverzinsliche Bargeldhaltung vorziehen. In dieser Situation erhöhen Zunahmen der Deflationsrate direkt den Realzins. Dadurch steigt einerseits die reale Schuldenlast, da die nominal aufgenommenen Schulden real immer teurer werden. Andererseits kommt es zur Kaufzurückhaltung, weil die Wirtschaftssubjekte weiter fallende Preise erwarten.[37] Hieraus resultiert eine kumulative Dynamik, die nicht mehr durch Zinseingriffe gestoppt werden kann.[38]
3. Die Bedeutung von Vermögenspreisblasen in Theorie und Praxis
3.1 Überblick über die wesentlichen Transmissionskanäle
Die Auswirkungen geldpolitischer Maßnahmen auf eine Volkswirtschaft werden als Transmissionsmechanismen bezeichnet. Die genauen Wege und mögliche zeitliche Wirkungsverzögerungen sind bis heute umstritten. Als gesichert gilt lediglich, dass eine Erhöhung der kurzfristigen Zinsen durch die Zentralbank grundsätzlich einen Abwärtsdruck auf das Preisniveau erzeugt und umgekehrt.[39] Langfristig haben geldpolitische Maßnahmen aufgrund der Geldneutralität keine Auswirkungen auf reale Größen.
3.1.1 Zins- und Wechselkurskanal
Eine geldpolitische Änderung des Leitzinses hat direkte Auswirkungen auf die Zinsstrukturkurve am Geld- und Kapitalmarkt. Wenn die Zentralbank aufgrund eines aufkeimenden Aufwärtsdrucks auf das Preisniveau die kurzfristigen Zinsen erhöht, steigen die kurzfristigen Refinanzierungskosten der Geschäftsbanken am Geldmarkt. In der Konsequenz müssen Kundeneinlagen mit marktnaher Verzinsung ebenfalls erhöht werden. Diese beiden Kostensteigerungen werden die Geschäftsbanken durch höhere Kreditzinsen auffangen wollen. Der steigende Kreditpreis hat über eine gedämpfte Kreditnachfrage tendenziell einen dämpfenden Einfluss auf die Ökonomie. Gleichzeitig werden die Banken versuchen, ihre Refinanzierungssituation von kurzfristigen in (zunächst noch) günstigere langfristige Positionen umzuschichten, indem sie längerfristige Wertpapiere emittieren. Dadurch sinken tendenziell deren Kurse und die längerfristigen Renditen (die Marktzinsen) steigen. Diese Arbitrageprozesse führen zu einer nachlassenden Nachfrage nach Aktienwerten. Gleichzeitig trüben sich die Konjunkturaussichten durch die vorgenommene Zinsentscheidung ein.[40] Die originäre Zielgröße geldpolitischer Aktivität ist dabei nicht der Nominalzins, sondern in Anlehnung an Gleichung (2.1) der Realzins.[41] Neben diesen direkten Auswirkungen des so genannten „Zinskanals“ gibt es auch indirekte Auswirkungen. Hierzu zählen insbesondere Substitutions- und Einkommenseffekte[42] sowie Vermögenseffekte. Vermögenseffekte lassen sich wiederum in zwei Kategorien untergliedern. Einerseits führen Zinserhöhungen zu den erläuterten Kursverlusten bei festverzinslichen Wertpapieren und damit unmittelbar zu Vermögenseinbußen bei den Inhabern solcher Wertpapiere. Gleichzeitig steigt die Attraktivität neu emittierter Papiere wegen des höheren Nominalzinses. Beides senkt aber tendenziell die Nachfrage nach Aktien, weswegen deren Kurs fällt.[43] Im Ergebnis werden also verschiedene Vermögenswerte negativ beeinflusst, was sowohl im Privat- als auch im Unternehmenssektor zu einem geringeren Konsum- bzw. Investitionsverhalten führt.[44] Andererseits ist eine ähnliche Wirkung, wenngleich auch aus anderen Gründen, für langlebige Konsumgüter zu beobachten.[45] Diese können in der Regel nur mit relativ hohen Verlusten in Liquidität umgewandelt werden. Die grundsätzliche Gefahr der Illiquidität steigt mit sinkendem Vermögen der Wirtschaftssubjekte. Eine restriktive Geldpolitik und die damit einhergehenden Rückgänge von Aktienwerten und festverzinslichen Wertpapiervermögen führen dazu, dass sich die individuelle Liquiditätssituation anspannt und in der Folge die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern, zu denen insbesondere Immobilienbesitz gehört, sinkt. Diese skizzierten Vermögenseffekte gehen für den Bereich des privaten Konsums auf die Lebenszyklushypothese nach Modigliani[46] und für den Bereich des Unternehmenssektors auf den „Tobins-q“-Effekt zurück.[47]
Im Falle einer offenen Volkswirtschaft ergibt sich ein weiterer Transmissionsmechanismus über den Wechselkurs. Geldpolitische Maßnahmen haben hier in erster Linie Einfluss auf das Verhältnis von inländischem und ausländischem Zinsniveau. Eine Leitzinserhöhung im Inland führt zu verstärkten Kapitalimporten, was die Nachfrage nach heimischer Währung steigen lässt. Diese Aufwertung hat unmittelbare Auswirkungen auf das Preisverhältnis bei handelbaren Gütern. Exporte werden teurer und Importe günstiger. In der Folge sinkt die inländische Produktion.[48]
3.1.2 Kreditkanal
Ein bedeutsamer Wirkungskanal geldpolitischer Aktivität stellt auf die Kreditvergabepolitik von Banken ab. Hiernach schränken Banken Neukredite überproportional ein, wenn die Zentralbank einen restriktiven geldpolitischen Kurs einschlägt. Der Kreditkanal wird in zwei Teilbereiche gegliedert, den Bankenkanal und den Bilanzkanal.
Der Bankenkanal beschreibt den Effekt, dass kleinere Banken mit geringerer Kapitalausstattung aufgrund restriktiverer Geldpolitik ihr Kreditangebot stärker verknappen, als es Banken mit großer Kapitalausstattung tun.[49] Außerdem versteht man darunter eine Kreditrationierung, weil Banken gegenüber bestimmten Kreditnehmern ein selektives Kreditvergabeverhalten an den Tag legen. Beides ist auf die asymmetrische Informationslage zurückzuführen, nach der ein Kreditnehmer grundsätzlich bessere Kenntnisse über die inhärenten Risiken seiner Investition hat als die Bank. In steigenden Zinsphasen werden solidere Finanzierungsvorhaben zurückgestellt. Kapitalschwache Unternehmen werden hingegen mehr risikoreiche Projekte finanzieren wollen.[50] Zusätzlich können diese Kreditnachfrager dem Anreiz unterliegen, derartige Projekte bewusst falsch darzustellen, um den erforderlichen Kredit zu bekommen.[51] Für Banken ist die Einschätzung der tatsächlichen Ausfallwahrscheinlichkeiten allerdings mit hohen Kosten verbunden, weswegen eine Kreditrationierung aus ihrer Sicht sinnvoll sein kann.
Der wesentlich bedeutsamere Bilanzkanal beschreibt hingegen den Zusammenhang zwischen geldpolitischen Maßnahmen und möglichen Wertveränderungen von Kreditsicherheiten. Eine restriktive Geldpolitik mit steigendem Zins führt über den Vermögenseffekt tendenziell zu sinkenden Kursen bei Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Immobilien. Der Bilanzkanal erweitert diese Sicht nun auf den Umstand, dass diese Substanzwerte sehr häufig als Kreditsicherheiten bei Banken hinterlegt werden. Wertverluste dieser Vermögensklassen können die Sicherheitenbasis der Banken schmälern und so zu einer Verknappung des Kreditangebots führen. Ein extremer Wertverfall bei Vermögenspreisen kann letztlich sogar dämpfende volkswirtschaftliche Effekte haben, wenn die Kreditvergabemöglichkeit von Banken dadurch sehr stark eingeschränkt wird. Der Finanzierungsbedarf von Unternehmen und privaten Haushalten wird nur noch unzureichend gedeckt. Dieser Effekt, der sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite der Wirtschaft negativ beeinflussen kann, ist auch unter dem Begriff „Kreditklemme“ bekannt. Zinspolitische Maßnahmen können über Vermögenspreise die Kreditvergabemöglichkeiten demnach überproportional beeinflussen. Dies wird als „finanzieller Akzelerator“ bezeichnet.[52]
Aus theoretischer Sicht ist der Kreditkanal folglich von erheblicher Tragweite. Die Weiterentwicklung der Finanzmärkte kann allerdings dazu beitragen, dass der Kreditkanal an Bedeutung verliert, da über Industrieobligationen und Kreditverbriefungen alternative Formen der Refinanzierung entstehen, die die Gefahr einer Kreditklemme reduzieren können.[53]
3.1.3 Erwartungshaltungen
Geldpolitische Entscheidungen wirken nicht nur auf monetäre und reale Größen, sondern auch unmittelbar auf die Erwartungshaltungen der Wirtschaftssubjekte. Ausgangspunkt war dabei die Vorstellung, über einen expansiven geldpolitischen Kurs mit steigenden Inflationsraten positive Wirkungen bei der Beschäftigung erzielen zu können. Diese Erkenntnis resultierte aus dem traditionellen Phillips-Kurven-Zusammenhang.[54] Allerdings hat sich gezeigt, dass derartige Effekte allenfalls in der kurzen Frist gelten, weil die infolge des gestiegenen Preisniveaus rückläufigen Reallöhne von den Wirtschaftssubjekten früher oder später erkannt und durch entsprechend höhere Nominallohnforderungen kompensiert werden.[55] Anders ausgedrückt, können geldpolitisch positive Beschäftigungseffekte nur generiert werden, wenn die Wirtschaftssubjekte rein auf Basis rückwärtsgerichteter Inflationserwartungen ihre Lohnforderungen stellen. Wird der Inflationseffekt einer geldpolitischen Maßnahme korrekt antizipiert, lassen sich keine realwirtschaftlichen positiven oder negativen Effekte generieren.[56] Eine stabilitätsorientierte Zentralbank muss daher versuchen, Inflationserwartungen auf einem Niveau zu verankern, welches mit Preisniveaustabilität vereinbar ist. Dass dies vor dem Hintergrund volatiler Vermögenspreise ein erhebliches Problemfeld ist, wird an späterer Stelle vor dem Hintergrund des Glaubwürdigkeitsproblems der Zentralbank näher erläutert.
3.2 Vermögenspreisblasen in der Historie
3.2.1 Die „new economy“ Preisblase in den USA 1929 - 1933
Das erste Ereignis im 20. Jahrhundert, das mit einer Vermögenspreisblase assoziiert wird, war der Zusammenbruch der Börsenkurse in den USA in den Jahren 1929 bis 1933. In den 1920er Jahren zeichnete sich die US-Wirtschaft durch ein prosperierendes Wachstum aus, welches durch seinerzeitige „new economy“ Unternehmen getragen wurde.[57] Etwa um 1925 gab es erste Stimmen unter Politikern und Wirtschaftsexperten, die ihre Besorgnis über stark anschwellende Aktienkurse kundtaten.[58] Tatsächlich waren die Kurswerte deutlich angestiegen, wie sich anhand von Abbildung (A.1) im Anhang A nachvollziehen lässt. Die Forderungen nach geldpolitischer Intervention wurden stärker, da man die Entwicklungen für eine Aktienpreisblase hielt.[59] Die seinerzeit führenden Geldpolitiker wendeten jedoch hiergegen ein, dass restriktivere Maßnahmen zur „Marktverlangsamung“ in der restlichen Wirtschaft noch viel größere Schäden erzeugen könnten.[60]
Im Jahr 1928 erfolgte eine Abkehr von dieser Haltung. Es ging nicht mehr darum, „ob“ die Kursentwicklung geldpolitisch zu maßregeln sei, sondern „wie“ dies zu geschehen habe. Da man es aufgrund alternativer Finanzierungsmöglichkeiten für ineffektiv hielt, einfach die Kreditvergabe an Wertpapierhändler zu beschränken, folgte man dem Rat, die Zinsen anzuheben, was dann bis August 1929 auch geschah.[61] In der Folge brachen die Wertpapierkurse zusammen. Dieser Kurssturz wird heute allerdings nicht mehr als alleinige Ursache für die folgende große Depression gesehen. Vielmehr hatten sich bereits zuvor wesentliche wirtschaftliche Rahmendaten deutlich verschlechtert.[62] Dies führte in Verbindung mit dem aggressiv-restriktiven Kurs der Zentralbank dazu, dass erhebliche Vermögenswerte vernichtet wurden. Das betraf nicht nur Aktienwerte, sondern auch Bodenpreise.[63] Da diese beiden Vermögensarten sehr oft als Sicherheit für Bankkredite gegeben werden, kam es in der Folge zu einer Kreditklemme.[64]
3.2.2 Der US-Börsencrash 1987 und die „Dotcom“-Blase 2000
Am 19. Oktober 1987 verzeichnete der Dow Jones Industrial Average (DJIA) den bis dato höchsten Kursverlust an einem einzelnen Börsentag. Diesen Sprung dokumentiert Abbildung (A.4). Die Auswirkungen waren jedoch im Vergleich zu 1929 weit weniger gravierend. Die Börse hatte sich innerhalb von zwei Jahren vollständig erholt.[65] Bis heute ist nicht abschließend geklärt, ob es sich tatsächlich um eine Preisblase handelte und wie es zu diesem Kurssturz kommen konnte. Starke Abweichungen der Kurswerte von ihrem fundamental begründbaren Wert waren scheinbar nicht die alleinige Ursache. Eine mögliche Erklärung liegt im damals zunehmend computergesteuerten Handel, der durch das massenweise Auslösen von Verkaufssignalen zu dem Kursverfall führte. Das entschlossene Eingreifen der Federal Reserve Bank mit Zinssenkungen und Liquiditätsbereitstellung hat dafür gesorgt, dass sich die volkswirtschaftlichen Konsequenzen in Grenzen hielten und die Märkte sich schnell erholten.[66]
Ein Beispiel einer Preisblase im Aktienbereich ist die „Dotcom“-Blase, deren Zusammenbruch sich im Jahr 2000 ereignete und weltweite Dimension annahm. Ähnlich wie im Jahr 1929 war der Ausgangspunkt das Aufkeimen einer neuen Technologiewelle. Die massenweise Verbreitung von Internet und Mobiltelefonie führte zu einer Reihe von Unternehmensgründungen, die das Anlegerinteresse auf sich zogen. In diesem Umfeld glaubten viele Unternehmer an das Potenzial für einen Börsengang.[67] Gleichzeitig stieg das Interesse von Privatanlegern an Aktien weltweit stark an. Neuemissionen waren vielfach überzeichnet, da die Gewinnerwartungen weit über die fundamental begründbaren Daten hinausragten. Dies funktionierte so lange, bis einige der Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten oder direkt Insolvenz anmelden mussten. Der darauf folgende weltweite und mehrjährige Einbruch der Börsenkurse ist am Beispiel Deutschlands in Abbildung (B.6) dargestellt.
3.2.3 Die Japan-Krise zur Jahrtausendwende
Der vielleicht bekannteste Fall einer Preisblasenbildung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Japan ereignet. Ihren Ursprung nahm diese Entwicklung zu Beginn der 1980er Jahre, als die japanische Wirtschaft sich in einer Boomphase befand. Es entstand eine Immobilien- und Aktienhausse, die in Abbildung (A.5) dokumentiert ist. Dieser Boom wurde durch eine aggressive Kreditvergabepolitik in Verbindung mit einer gelockerten geldpolitischen Haltung gefördert.[68] Obwohl das Wirtschaftswachstum zeitweise bei fünf Prozent pro Jahr lag, blieb die Inflationsrate wegen des etwa gleich hohen Produktivitätswachstums von knapp vier Prozent im Zeitraum von 1985 bis 1994 relativ konstant.[69] Auch die Inflationserwartungen blieben auf niedrigem Niveau, da die Bank of Japan die Inflation ausgehend von 12 % in 1974 und trotz zwischenzeitlicher Ölkrise 1979 in den achtziger Jahren auf niedrigem Niveau zwischen null und drei Prozent halten konnte, was die Glaubwürdigkeit ihrer Politik bis zu diesem Zeitpunkt unterstreicht.[70]
Vor dem Hintergrund der steigenden Vermögenspreise stand sie nun vor der Frage, wie auf die erheblichen Wertsteigerungen angesichts konstanter Inflationsraten zu reagieren ist. Man entschied sich zu Beginn der neunziger Jahre zu Zinserhöhungen, um ein weiteres Überhitzen der Wirtschaft zu verhindern. Dies führte zunächst zu einem Einbruch der Aktienwerte und in der Folge auch zu einem Rückgang der Land- und Immobilienpreise. Banken, die bei Kreditvergaben stark auf Immobiliensicherheiten abstellten, mussten ihr Kreditangebot rationieren - es entstand eine Kreditklemme.[71] Das hatte erhebliche negative Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt.[72] Die Bank of Japan musste in den Jahren 1991 bis 1995 den offiziellen Diskontsatz von 6 % auf 0,5 % reduzieren, um die Wirtschaft zu stimulieren.[73] Mit den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA und den weltwirtschaftlich negativen Auswirkungen stand Japan angesichts dieses ohnehin niedrigen Zinsniveaus vor dem Dilemma, die Zinsen aufgrund der Nullzinsgrenze nicht weiter senken zu können. Dadurch geriet das Land für viele Jahre in eine deflationäre Spirale.
3.2.4 Die US-Immobilienkrise in 2007
Abschließend sei auf die jüngsten Vorfälle im Zusammenhang mit der „Subprime-Krise“ eingegangen, die sich im Jahr 2007 ausgehend von den USA auf die weltweiten Finanzmärkte ausweitete. Infolge der US-Rezession zur Jahrtausendwende hat die amerikanische Notenbank die Federal Funds Rate (den Interbankenzins) kontinuierlich bis auf ein Niveau von einem Prozent gesenkt.[74] Dies führte zu einer zunehmenden Kreditaufnahme der privaten Wirtschaftssubjekte zur weiteren Konsumfinanzierung. Dies funktionierte so lange, wie die Marktzinsen niedrig waren und Immobiliensicherheiten im Wert stiegen. Verschärfend kamen Lockerungen der Kreditaufnahmebedingungen hinzu.[75] Dies generierte immer mehr zweitklassige („subprime“) Hypothekenforderungen. Mit den konjunkturell bedingten Zinssteigerungen der amerikanischen Notenbank ab Mitte 2004 stiegen die von den Schuldnern zu leistenden Kapitaldienste, die letztlich viele Schuldner nicht mehr begleichen konnten. Gleichzeitig verfielen die Immobilienpreise. Deren Einbruch ist in Abbildung (A.7) veranschaulicht. Die Grafik zeigt, dass es bereits im Jahr 2005 erste Hinweise auf eine besorgniserregende Entwicklung gab. Eigentlich wäre diese Krise auf den US-Raum konzentriert geblieben; lediglich einzelne größere Baufinanzierer, die sich gerade auf diese Kredite spezialisiert hatten, mussten Gläubigerschutz beantragen.[76] Die Krise erlangte jedoch durch den internationalen Handel mit verbrieften Forderungen (z. B. durch „Asset-Backed-Securities“) weltweite Dimension, da viele Hypothekenkredite schlechterer Qualität über diese strukturierten Anlageformen gebündelt und am Kapitalmarkt refinanziert wurden.[77] Problematisch ist, dass sich der Investor (also der Erwerber dieser Forderungen) neben einer höheren Rendite im Vergleich zu Alternativanlagen das Risiko der Verschlechterung dieser Forderung einkauft. Dieses versucht er zwar über anerkannte Rating-Informationen zu minimieren. Im konkreten Fall gibt es aber Hinweise darauf, dass die Rating-Agenturen das Risiko unterschätzt haben und derartige Produkte zu optimistisch bewertet wurden.[78] Durch die ausbleibenden Zahlungen der amerikanischen Hausbesitzer entstanden große Verluste, die sich über die begebenen Verbriefungen auf die Investoren übertrugen.[79] Dies führte zu einem plötzlichen globalen Kapitalabzug privater und institutioneller Anleger. Zusätzlich entstand ein erhöhtes Misstrauen am Interbankenmarkt, da Unklarheit über die erforderlichen bilanziellen Wertberichtigungen auf derartige Forderungen herrschte. Die Folgen waren Liquiditätsverknappung am Geldmarkt und steigende kurzfristige Zinsen. Letztlich konnte nur eine Notversorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken hier eine Finanzkrise größeren Ausmaßes verhindern.[80]
3.2.5 Zusammenfassung
Resümierend lassen sich drei Gründe vorbringen, warum Vermögenspreisblasen für eine Zentralbank von großer Bedeutung sind.[81] Erstens können sie die finanzielle Stabilität einer Ökonomie gefährden. Überoptimistische Ertragserwartungen bei Investitionen führen zu einer verstärkten Kreditaufnahme. So lange diese Erwartungen in die Vermögenswerte erfüllt werden, ist das Risiko von Kreditausfällen gering. Fallen die Vermögenspreise jedoch ruckartig, sind neben den Wertvernichtungen auch diese Kredite gefährdet, wenn die Vermögenswerte als Sicherheiten gegeben worden sind – dies kann eine Kreditklemme zur Folge haben.
Zum zweiten kann es während der Wertsteigerungsphase zu Überinvestitionen in den betreffenden Vermögensarten kommen. Selbst wenn eine Bankenkrise vermieden werden kann, hat ein Zusammenbruch in vielen Fällen hohes Wertvernichtungspotenzial, was wiederum erhöhte Fluktuationen in der Realwirtschaft auslöst. Denn die Wirtschaftssubjekte werden auf der Suche nach einer verlässlicheren Portfoliostruktur eine Reallokation ihrer Ressourcen vornehmen. Hierfür ist die Japan-Krise ein bekanntes Beispiel.
Drittens kann das Zerplatzen von Vermögenspreisblasen direkte Auswirkungen auf die Preisstabilität haben. Denn die Gefährdung der finanziellen Stabilität infolge eines Rückgangs der Vermögenspreise hat auch Auswirkungen auf die Effektivität geldpolitischer Maßnahmen.[82] Die Japan-Krise kann hier erneut als Beispiel dienen. Zwar wurde das nominale Zinsniveau nach dem Zerplatzen der Preisblase bis fast zur Nullzinsgrenze gesenkt. Aufgrund der bestehenden negativen Inflationsraten kam es aber trotzdem zu hohen Realzinssätzen und damit zum Entstehen einer deflationären Spirale.
4. Ausgewählte Probleme bei Vermögenspreisblasen
4.1 Identifikationsprobleme
Für eine Zentralbank ist die möglichst zweifelsfreie Identifikation einer (rationalen wie irrationalen) Preisblase von großer Bedeutung. Der Begriff der Identifikation lässt sich zeitlich in zwei Sichtweisen, ex ante bzw. ex post, unterscheiden. Sehr anschaulich lässt sich dies bei Kroszner nachvollziehen.[83] Dass das Erkennen von Preisblasen ex ante problematisch ist, wird aus den dortigen Diagrammen (die in einem Fall zum Beispiel nur aus einer waagerechten Linie bestehen) deutlich. Folglich hält Kroszner geldpolitische Maßnahmen auf der Basis solcher Erkenntnisse für schwierig. Wie seine Arbeit zeigt, haben gleichgerichtete Aufwärtsbewegungen der letzten Jahrzehnte nicht automatisch zu einem Einbruch geführt.[84] Auch ex post kann eine „grafisch eindeutige“ Preisblase zu Fehlinterpretationen führen. Dies zeigt eine Studie von McGrattan und Prescott über den Börsencrash von 1929. Ihr Ergebnis ist, dass sogar von einer Unterbewertung der Aktien seinerzeit ausgegangen werden kann.[85]
Einen etwas anderen Weg beschreiten Bordo und Jeanne. Basierend auf historischem Datenmaterial für Immobilien- und Aktienindizes vergleichen sie nach der Methode des gleitenden Drei-Jahres-Durchschnittes die Wachstumsraten dieser beiden Vermögensklassen in einem Land mit dem langfristigen Durchschnitt weiterer 14 OECD-Staaten in den Jahren 1970 bis 2001. Starke Abweichungen vom langfristigen Durchschnitt interpretieren sie dabei je nach Ausprägung als „Boom-Phase“ oder als „Bust-Phase“.[86] Sie stellen fest, dass „Boom/Bust“-Perioden im Bereich der Immobilienvermögen häufiger anzutreffen sind als bei Wertpapiervermögen. Auf 24 Boom-Phasen beim Wertpapiervermögen folgten nur 3 Bust-Phasen. Im Immobiliensektor folgten auf 19 Boom-Phasen 10 Bust-Phasen. Dabei zeigte sich in einigen Fällen, dass Bankenkrisen häufig in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Einbruch von Vermögenspreisen stehen.[87] Offensichtlich gibt es also Entwicklungen bei Vermögenspreisen, die in einer Ökonomie höhere oder niedrigere Kosten beim Zusammenbrechen verursachen. Die Entgleisung von Immobilienpreisen und Kreditwachstum hat dabei scheinbar größeren Einfluss.[88]
Auf der Suche nach zuverlässigen Abgrenzungsmerkmalen für Preisblasen wägt Bernanke mehrere Alternativen gegeneinander ab. Dabei berücksichtigt er die Wachstumsrate eines Vermögenspreises, Wertindikatoren wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Aktien und das Bankkreditwachstum einer Ökonomie.[89] Alle drei hält er jedoch für ungeeignet. Hohe Wachstumsraten haben in der Vergangenheit nicht zwingend einen Preiseinbruch zur Folge gehabt. Bei Wertindikatoren ergibt sich das Problem der fehlenden Messbarkeit der inhärenten Risikoprämien im Vergleich zur sicheren Anlage, und eine hohe Korrelation zwischen Preissteigerungen und Kreditwachstum ist alleine kein ausreichendes Argument für einen direkten Zusammenhang beider Größen.[90] Relativierend merkt die Europäische Zentralbank an, dass eine derartig quantitative Analyse zumindest den Charakter eines Warnsignals haben kann.[91] Neben der grundsätzlich problematischen Abgrenzung von fundamentalen und nicht-fundamentalen Preisfaktoren müsse eine Zentralbank bezüglich des Zustandekommens eines Preises bessere Informationen haben als der Markt, um eine Preisblase als solche eindeutig deklarieren zu können. Dies hält Bernanke für ausgeschlossen.[92] Issing hingegen hält dies unter Bezugnahme auf neuere Literatur zur Markteffizienz für zumindest ansatzweise möglich.[93]
4.2 Instrumentenprobleme
Bei der Bekämpfung von Vermögenspreisblasen steht einer Zentralbank als wichtigster Handlungsoperator der kurzfristige, nominale Zins zur Verfügung. Allerdings ist dessen Anwendung nicht frei von Kritik.[94] Zum einen entfalten zinspolitische Maßnahmen stets gesamtwirtschaftliche Effekte und sind nicht nur gegen eine Preisblase selbst gerichtet. So mag eine Zinserhöhung dämpfenden Einfluss auf das Wachstum einer Preisblase nehmen – gleichzeitig kann sie allerdings auch einen Abwärtsdruck auf die Inflationsrate ausüben, was eine Gefährdung des Zieles der Preisniveaustabilität impliziert.[95] Diese Argumentation wird auch bei der Frage, ob Vermögenspreisblasen durch mehrere aufeinanderfolgende Zinserhöhungen „aufgestochen“ werden sollten, diskutiert.[96] Zum anderen wirken geldpolitische Aktivitäten erst mit einer Verspätung von einer bis zwei Perioden auf die Realwirtschaft. Damit ist weniger das „inside lag“ gemeint, das zwischen dem Erkennen des Anpassungserfordernisses und dem tatsächlichen Tun liegt. Vielmehr müssen nach der Durchführung einer geldpolitischen Maßnahme das „intermediate lag“ und dann das „outside lag“ berücksichtigt werden.[97] Dadurch können die gewünschten Effekte verspätet eintreten und eine ohnehin unerwünschte Entwicklung noch verschlimmern.[98]
4.3 Glaubwürdigkeitsprobleme
Die Basis einer erfolgreichen Stabilisierungspolitik ist die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Will eine Zentralbank ihre Reputation nicht gefährden, bedarf es einer transparenten und konsistenten Strategie, die neben einem definierten Ziel auch den Kommunikationsaspekt berücksichtigt.[99] Viele Zentralbanken verfolgen heute das Ziel der Preisniveaustabilität. Dafür ist die Steuerung von Inflationserwartungen, insbesondere über den kurzfristigen Nominalzins, von zentraler Bedeutung.[100] Denn die Übertragung geldpolitischer Impulse auf die Wirtschaft hängt entscheidend von der erwarteten Entwicklung der kurzfristigen Zinsen ab, was wiederum auf die längerfristigen Zeithorizonte der Zinsstrukturkurve Auswirkungen entfaltet.[101] Die Herausgabe von Projektionen über den zukünftigen Zins, kann die Erwartungsbildungen unterstützen und die makroökonomische Performance verbessern.[102] Gleichzeitig ist die Messung von Inflationserwartungen, etwa über inflationsindexierte Anleihen, für die Zentralbank ein Indiz für ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit.[103]
Die Verstetigung von Inflation bzw. Inflationserwartungen kann durch das Auftreten von Schocks, wie etwa durch entstehende oder zusammenbrechende Vermögenspreisblasen, erheblich gestört werden. Dies kann negative Auswirkungen auf die Reputation der Zentralbank haben. Wenn aufgrund einer Preisblase zinspolitische Maßnahmen zur Sicherung von Preisniveaustabilität getroffen werden müssen besteht die Gefahr, dass ein solches (aus Sicht der Wirtschaftssubjekte diskretionäres) Verhalten nicht nachvollziehbar ist.[104] Auch wenn die Zentralbank in diesem Falle die Wirtschaftssubjekte nicht absichtlich täuschen wollte,[105] so kann dies trotzdem dazu führen, dass sie an Glaubwürdigkeit verliert.
Zur Überwindung des Glaubwürdigkeitsproblems infolge von Effekten aus Vermögenspreisblasen existieren verschiedene Vorgehensweisen. Eine Möglichkeit besteht in der Ankündigung, Preisniveaustabilität nicht kurzfristig, sondern mittelfristig sicherzustellen.[106] Dies erlaubt eine kurzfristige Volatilität der Inflation durch das Auftreten von Schocks und berücksichtigt zeitliche Wirkungsverzögerungen geldpolitischer Maßnahmen.[107] Zusätzlich könnte die Zentralbank die Marktteilnehmer warnen, wenn deren Verhalten mit Preisniveaustabilität nicht vereinbar ist. Ebenso ist denkbar, den analytischen Rahmen sowie die Schlüsselparameter für geldpolitische Entscheidungen bekannt zu geben.[108] Allerdings ist die Kommunikation vor dem Hintergrund von Vermögenspreisblasen lediglich eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, da das Ausgangsproblem damit nicht automatisch gelöst ist. Dazu bedarf es unter anderem auch der Regulierung und Überwachung der Finanzmärkte.[109]
5. Geldpolitische Handlungsoptionen
Die bisherigen Ausführungen zeigen die Gefahren und Probleme, die von Fehlentwicklungen bei Vermögenspreisen ausgehen können. Vor diesem Hintergrund hat die wissenschaftliche Diskussion in den letzten Jahren verschiedene Lösungsansätze hervorgebracht, die in diesem Kapitel erörtert werden.
5.1 Integration von Vermögenspreisen in einen Preisindex
Als erstes wird die Möglichkeit skizziert, Vermögenspreise als Zielgröße der Geldpolitik zu wählen und in einen neu zu definierenden Preisindex aufzunehmen.[110] Es soll ein „cost-of-life“-Index geschaffen werden, in den nicht nur heutige, sondern auch zukünftige Konsumausgaben integriert werden.[111] Da sich das Vermögen eines Individuums auf den heutigen und zukünftigen Konsum verteilt, würden heutige Vermögenswerte als Stellvertreter zukünftigen Konsums durch geldpolitische Maßnahmen gezielt beeinflusst.[112] Diesem Vorgehen steht ein nicht unerhebliches Informationsproblem gegenüber.[113] Eine mögliche Lösung besteht in dem Versuch, nur die wesentlichsten Vermögensklassen heranzuziehen, für die adäquates Datenmaterial verfügbar ist.[114] Dabei werden Vermögensklassen stärker gewichtet, die eine geringere Volatilität besitzen. Deswegen würden insbesondere Immobilienwerte in eine solche Berechnung Eingang finden.[115]
Selbst wenn von dem Informationsproblem abstrahiert wird, verbleiben einige kritische Aspekte. Heutige Vermögenspreise sind einerseits nur schlechte Schätzer, da sie nicht nur von Inflationserwartungen bestimmt werden, sondern auch durch Fundamentaldaten im Wert schwanken. Außerdem birgt eine gezielte Beeinflussung von Vermögenspreisen die Gefahr des „moral hazard“: Die Marktakteure wissen um die „wertstabilisierenden“ Eingriffe der Zentralbank. Dadurch erhöht sich ihre Risikobereitschaft bezüglich eines Engagements in genau diesen Vermögenswerten, was wiederum eine Preisblasenbildung begünstigt.[116] Hinzu kommt, dass bei rationaler Erwartungsbildung folgende problematische Interdependenz zwischen Geldpolitik und Vermögenspreisen entstehen würde. Die aktuellen Vermögenspreise beeinflussen die zukünftige Geldpolitik, während gleichzeitig die zukünftig erwartete Geldpolitik die heutigen Vermögenspreise bestimmt. In Verbindung mit Problemen bei der Frage, welches Gewicht den einzelnen Vermögensarten in einem Index überhaupt zuzuordnen wäre, erscheint die Qualität dieser Handlungsoption insgesamt eher zweifelhaft. Zudem hat die Zentralbank nur wenige Möglichkeiten der Einwirkung auf Vermögenspreise selbst, da langfristig nur Fundamentaldaten und nicht die Geldpolitik ihren Wert bestimmen.[117]
[...]
[1] Exemplarisch sei das Eurogebiet genannt, vgl. EZB (2007), S. 66.
[2] Die Autoren der beiden Primärquellen waren (zumindest zeitweise) bei der Reserve Bank of Australia beschäftigt und haben daher in ihren Arbeiten auf Annahmen abgestellt, die seinerzeit in Australien vorzufinden waren.
[3] Vgl. Merk (2007), S. 611 f.
[4] Vgl. Issing (2007), S. 24.
[5] Vgl. Issing (2007), S. 24.
[6] Vgl. Jarchow (2003), S. 1 ff.
[7] Vgl. Rudebusch (2005), S. 1.
[8] Vgl. Filardo (2004), S. 5.
[9] Vgl. Lansing (2007). S. 1.
[10] Vgl. EZB (2005a), S. 54.
[11] Vgl. Shiller (2005).
[12] Vgl. Visco (2003), S. 165.
[13] Vgl. Dillen und Sellin (2003), S. 123. Irrationale Preisblasen lassen sich demnach derart abgrenzen, dass Marktteilnehmer solch systematische Überlegungen nicht anstellen. Während des weltweiten Börsencrash im Jahr 2000 dürften viele der Privatanleger, die seinerzeit in die Märkte investierten, hierfür ein Beispiel liefern.
[14] Vgl. Allen und Gale (2000), S. 26. Da der Verlust aus einem solchen Investment für einen kreditfinanzierten Investor auf den Kreditbetrag beschränkt ist, er aber bei weiteren Wertsteigerungen erhebliche Gewinne einfahren kann, spricht man hier auch vom Kauf einer „call option“, vgl. Dillen und Sellin (2003), S. 124.
[15] Vgl. Mankiw (2003), S. 36.
[16] Für eine umfangreiche und anschauliche Übersicht der wesentlichen Inflationsursachen wird auf Issing (2007), S. 216 ff. verwiesen.
[17] Die Quantitätsgleichung wird wie folgt definert: M*V=P*Y, mit M = Geldmenge, V = Umlaufgeschwindigkeit, P = Preisniveau und Y = Output, vgl. Mankiw (2003), S. 100 ff.
[18] Dabei wird unterstellt, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit langfristig konstant bleibt. Dies gilt heute als erwiesen. Vgl. Mankiw (2003), S. 103 f.
[19] Am Beispiel der Europäischen Zentralbank sei auf Artikel 105 Abs. 1 des EG-Vertrages verwiesen, in dem die Sicherung der Preisniveaustabilität als Zielgröße genannt wird.
[20] Vgl. Mankiw (2003), S. 116 ff.
[21] Vgl. Fisher (1930). Aufgrund der Bedeutung dieses Zusammenhangs für den weiteren Verlauf der Arbeit wird das Fisher-Theorem hier etwas ausführlicher skizziert.
[22] Die hier gezeigte Form der Gleichung ist eine ex ante Betrachtung, da hier die Inflationserwartung und nicht die tatsächliche Realisation der Inflationsrate (also ex post) in eine Beziehung zu den beiden Zinssätzen gesetzt wird.
[23] Zur Geldneutralität vgl. Görgens et al. (2004), S. 272.
[24] Beziehungsweise ex ante eine Zunahme der Inflationserwartungen bei angenommener Konstanz des Realzinses.
[25] Der letztgenannte Punkt ist auch als „kalte Progression“ bekannt, vgl. Issing (2007), S. 247 f.
[26] Diese eigentlich bedeutsameren Kosteneffekte der Inflation können hier nur äußert knapp skizziert werden, da sie nicht den Schwerpunkt der Arbeit bilden. Für eine ausführliche Darstellung vgl. Jarchow (2003), S. 317 ff.
[27] Preisindizes auf Basis der Laspeyres- oder Paasche-Methode weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich möglicher Schätzfehler auf. Dies liegt beispielsweise an dem sich permanent ändernden Konsumentenverhalten, vgl. Mankiw (2003), S. 37 ff.
[28] Für das Eurogebiet existiert das Ziel, perspektivisch die Erfassung von selbst genutztem Wohneigentum im HVPI darzustellen, vgl. EZB (2005b), S. 73.
[29] Ein Beitrag zum Zusammenhang zwischen monetärer Entwicklung und beispielsweise Immobilienpreisen findet sich in Deutsche Bundesbank (2007), S. 15 ff.
[30] Vgl. Issing (2003), S. 1.
[31] Vgl. ebenda, S. 2.
[32] Vgl. Papademos (2006), S. 2. Effiziente Kapitalallokation kennzeichnet einen Zustand finanzieller Effizienz.
[33] Zu den Definitionsproblemen finanzieller Stabilität vgl. Issing (2003), S. 1 f.
[34] Vgl. Borio und Lowe (2002) und Bean (2003).
[35] Vgl. Mishkin (1996), S. 16.
[36] Vgl. Issing (2003), S. 2.
[37] Vgl. Issing (2007), S. 284.
[38] Alternative Konzepte, sich aus dieser Spirale zu lösen, werden im Kapitel 5.5 behandelt.
[39] Vgl. EZB (2002), S. 48.
[40] Vgl. Görgens et al. (2004), S. 276 f.
[41] Vgl. Mishkin (1996), S. 2 f. Er unterstellt, dass faktisch der Realzins die Entscheidungen der Konsumenten und Unternehmen determiniert. Zumindest kurzfristig sei das Preisniveau konstant, so dass eine Nominalzinsanpassung direkt auf den Realzins übergeht.
[42] Vgl. Görgens et al. (2004), S. 287 f. Substitutionseffekte beschreiben eine zinsinduzierte Umschichtung in den Portfolien der Wirtschaftssubjekte. Infolge geänderter Risiko-Rendite-Relationen wird eine Reallokation zur Wiederherstellung des optimalen Portfolios vorgenommen. Einkommenseffekte ergeben sich aus veränderten Cash-Flow-Strukturen bei Gläubiger-Schuldner-Verhältnissen bezüglich der Zinszahlungsverpflichtungen. Beide Effekte können hier nicht näher beschrieben werden.
[43] Letztlich ist der Aktienkurs nichts anderes als der Kapitalwert zukünftig erwarteter Dividenden, der nun infolge gestiegener Nominalzinsen stärker diskontiert wird.
[44] Vgl. Görgens et al. (2004), S. 288.
[45] Zu diesen langlebigen Konsumgütern zählt insbesondere der Immobilienbesitz.
[46] Vgl. Modigliani (1971). Die Konsumausgaben eines Individuums werden nach dieser Theorie determiniert nach dessen Lebenseinkommen, die sich aus Humankapital, Realkapital und Finanzvermögen zusammensetzen. Letzteres besteht zu einem Großteil aus Wertpapiervermögen, dessen Höhe den Konsum bestimmt.
[47] Vgl. Tobin (1969). Das „q“ beschreibt den Quotienten vom Marktwert eines Unternehmens zu den Wiederbeschaffungskosten. Ein „q“ über 1 verstärkt die Investitionsnachfrage, da Neuinvestitionen vergleichsweise günstig sind und so der Unternehmenswert weiter erhöht werden kann.
[48] Vgl. Görgens et al. (2004), S. 292 f.
[49] Vgl. ebenda, S. 295 ff.
[50] Man bezeichnet diesen Effekt als „adverse Selektion“.
[51] Dieses bereits im Vorfeld der Kreditvergabe auftretende Phänomen ist unter dem Begriff „moral hazard“ bekannt.
[52] Vgl. Bernanke et al. (1994), S. 3 ff. Eine kritische Betrachtung zur Existenz eines finanziellen Akzelerators (zumindest für Deutschland) findet sich dagegen in Deutsche Bundesbank (2005), S. 15 ff.
[53] Dies ist in den USA seit Jahren gängige Praxis und wird auch für das Eurogebiet verstärkt wahrgenommen, vgl. Papademos (2006), S. 4.
[54] Dieser inverse Zusammenhang zwischen der Zuwachsrate des Nominallohnes und der Inflationsrate basiert auf der empirischen Untersuchung von A.W. Phillips, vgl. Phillips (1958), S. 283 ff. Dieser Zusammenhang besteht allerdings nur so lange, wie die Inflationserwartungen vergangenheitsorientiert gebildet werden. Dies wird heute höchstens für die kurze Frist angenommen. Langfristig verläuft die Phillips-Kurve grafisch vertikal. Dann lassen sich keine Beschäftigungseffekte erzielen.
[55] Die Wirtschaftssubjekte unterliegen nicht der hier angesprochenen „Geldillusion“.
[56] Vgl. Görgens et al. (2004), S 308 ff.
[57] Vgl. Bordo und Jeanne (2002), S. 6. Zu diesen Unternehmen zählten unter anderen General Electric (GE) und die Radio Corporation of America (RCA). Beide Unternehmen profitierten von den jüngsten wissenschaftlichen Entwicklungen wie Strom und der Erfindung der Radiotechnik.
[58] Vgl. Bernanke (2002), S. 7.
[59] Über die Frage, ob seinerzeit tatsächlich eine spekulative Blase vorlag, wurde lange gestritten. Ein Überblick über diesbezügliche Literatur findet sich bei Dillen und Sellin (2003), S. 126.
[60] Vgl. Bernanke (2002), S. 7.
[61] Vgl. ebenda, S. 7. Die „discount rate“ wurde dabei sukzessive von 3,5 % bis 6 % erhöht.
[62] Hier sind zum Beispiel Indizes wie der Industrieindex oder auch der Produktionsindex für Automobile gemeint, vgl. ebenda, S. 8.
[63] Vgl. Abbildung (A.2) im Anhang A.
[64] Vgl. Bordo und Jeanne (2002), S. 6 und Abbildung (A.3) im Anhang A.
[65] Vgl. Dillen und Sellin (2003), S. 127.
[66] Vgl. ebenda, S. 127.
[67] Vgl. Dillen und Sellin (2003), S. 130.
[68] Vgl. Bordo und Jeanne (2002), S. 7.
[69] Vgl. Abbildung (A.6) im Anhang. Der Zusammenhang von hohem Produktivitätswachstum bei gleichzeitig niedriger Inflation kann zu überoptimistischen Zukunftserwartungen führen und damit Vermögenspreisen deutlichen Auftrieb geben. Hieraus resultieren Gefahren für die finanzielle Stabilität einer Ökonomie, vgl. Borio und Lowe (2002), S. 20.
[70] Vgl. Ito und Mishkin (2004), S. 4.
[71] Vgl. Fendel und Frenkel (2004), S. 163 f.
[72] Vgl. den Verlauf der “GDP“-Kurven in Abbildung (A.6).
[73] Vgl. Fendel und Frenkel (2004), S. 164.
[74] Vgl. Homepage des Federal Reserve Boards, http://www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.htm (05.10.2007)
[75] Vgl. Stiglitz (2007).
[76] Hierzu zählte bspw. die US-Hypothekenbank American Home Mortgage.
[77] Zur genaueren Darstellung der Funktionsweise dieser Produkte vgl. Abbildung (A.8).
[78] Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung (2007).
[79] Prominentestes Beispiel in Deutschland war die Deutsche Industriebank AG (IKB), deren Schieflage nur mit einer konzertierten Maßnahme nationaler Einlagensicherungssysteme abgefedert und so eine Bankenkrise verhindert werden konnte.
[80] In den ersten Tagen nach dem Auftreten der Krise stellte die Europäische Zentralbank dem Markt 200 Milliarden Euro Liquidität zur Verfügung, vgl. EZB (2007), S. 33 ff.
[81] In Anlehnung an Dillen und Sellin (2003), S. 120 f.
[82] Vgl. Kent und Lowe (1997), S. 6 f.
[83] Vgl. Kroszner (2003), S. 4 ff., insbesondere Figur 1 - 5.
[84] Vgl. ebenda, S. 6, Figur 4.
[85] Vgl. McGrattan und Prescott (2003), S. 271 ff.
[86] Sie unterstellen dabei allerdings nicht explizit, dass dann auch eine Preisblase vorlag.
[87] Vgl. Bordo und Jeanne (2002), S. 8 ff.
[88] Vgl. Adalid und Detken (2007), S. 35 f.
[89] Vgl. Bernanke (2002), S. 4 f.
[90] Vgl. ebenda. Vielmehr plädiert er dafür, aus diesen Informationen eine bessere Deregulierung der Finanzmärkte aufzubauen statt sie zum Anlass zu nehmen, geldpolitische Maßnahmen gegen Preisblasen einzuleiten.
[91] Vgl. EZB (2005a), S. 55.
[92] Vgl. Bernanke (2002), S. 4.
[93] Vgl. Issing (2003), S. 4.
[94] Vgl. Bernanke und Gertler (2000), S. 3.
[95] Vgl. Bollard (2004), S. 5.
[96] Vgl. Trichet (2005), S. 5. Dies wird im folgenden Kapitel näher behandelt.
[97] Vgl. Jarchow (2003), S. 334 f. Das “intermediate lag” entspricht dem Zeitverzug zwischen der Umsetzung und der Wirkung auf das Geld- und Kreditangebot im Markt. Das „outside lag“ beschreibt die Zeit, bis die Wirkung dann auf die Realwirtschaft ausstrahlt.
[98] Vgl. Bollard (2004), S. 5.
[99] Vgl. Görgens et al. (2004), S. 332.
[100] Vgl. Gonzalez-Paramo (2006), S. 1.
[101] Vgl. EZB (2004a), S. 72.
[102] Vgl. Rudebusch und Williams (2007), S. 29 f.
[103] Vgl. Bini-Smaghi, (2005), S. 1.
[104] Vgl. Checchetti (2003), S. 83.
[105] Vgl. Kydland und Prescott (1977) sowie Barro und Gordon (1983). Ein solches Verhalten der zeitlichen Inkonsistenz besagt, dass eine angekündigte geldpolitische Strategie ex post (also nach dem die Wirtschaftssubjekte auf dieser Basis ihre Entscheidungen getroffen haben) möglicherweise suboptimal ist. Daher kann es sich lohnen, von dieser Strategie bewusst abzuweichen, um gewünschte volkswirtschaftliche Effekte zu erzielen. Dies kann jedoch einen Glaubwürdigkeitsverlust zur Folge haben, da rational handelnde Wirtschaftssubjekte ein solches „Fehlverhalten“ zukünftig korrekt antizipieren werden und dies in ihren Erwartungsbildungen berücksichtigen.
[106] Dies entspricht dem Konzept des „flexible inflation targeting“, wie es etwa von Bean (2003), S. 69 f. vorgeschlagen wird.
[107] Vgl. EZB (2004a), S. 57.
[108] Vgl. Bini-Smaghi (2005), S. 4.
[109] Ob diese Aufgabe jedoch auch zu den Tätigkeiten einer Zentralbank gehört, ist strittig, da sie deren Unabhängigkeit beeinträchtigen kann, vgl. Papademos (2006), S. 1 ff.
[110] Dieser Ansatz geht vor allem auf die Arbeit von Alchian und Klein (1973) zurück.
[111] Eine Nichtberücksichtigung zukünftiger Konsumausgaben wäre gleichzusetzen mit dem willkürlichen Herauslassen von anderen Gütern, die ebenfalls in den Index gehörten, so zum Beispiel Bryan et al. (2003), S. 277. Dies führe zu einer verzerrten Darstellung der tatsächlichen Inflation, was sie als „intertemporalen Substitutionsbias“ bezeichnen.
[112] Der Grund ist, dass eine höhere Inflationserwartung bei Konsumgüterpreisen auch zu einer Preissteigerung von Aktien- und Immobilienvermögen führt, vgl. Filardo (2000), S. 16.
[113] Vgl. Alchian und Klein (1973), S. 189.
[114] Vgl. Bryan et al. (2003), S. 277 ff.
[115] Vgl. ebenda, S. 282.
[116] Vgl. Trichet (2005).
[117] Vgl. ebenda.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836608992
- DOI
- 10.3239/9783836608992
- Dateigröße
- 1.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- finanzkrise immobilienpreis geldpolitik realzins subprime-krise
- Produktsicherheit
- Diplom.de