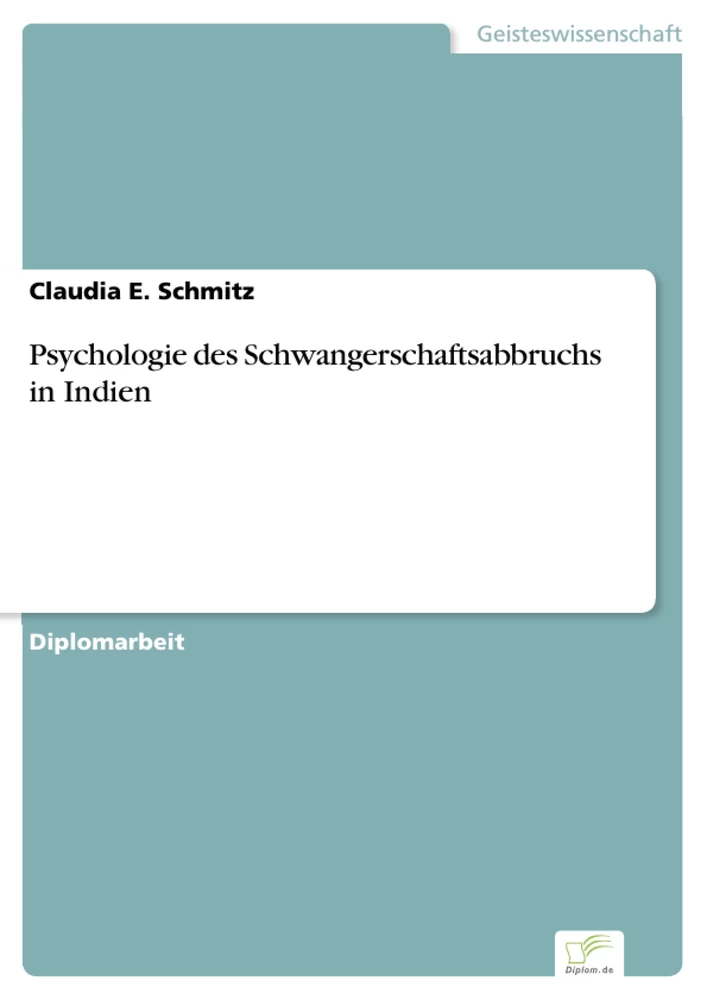Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien. Durch die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes zum Thema soll deutlich werden, welche Beachtung der Schwangerschaftsabbruch in Indien erhält und in welchen Zusammenhängen Schwangerschaftsabbrüche in Indien erlebt und behandelt werden.
Aufgrund des kulturellen Unterschiedes zwischen Indien und westlichen Ländern kann davon ausgegangen werden, dass die Bearbeitung psychologischer Fragestellungen sich jeweils verschieden gestaltet. Die im Westen zugängliche psychologische Literatur ist vorwiegend auf Untersuchungen der westlichen Mittelschicht beschränkt, sodass diese Ergebnisse nicht ohne weiteres auf einen anderen Forschungskontext übertragen werden können. Um Indien mit seinem entsprechenden kulturellen Hintergrund gerecht zu werden, wird daher in dieser Arbeit darauf verzichtet, westliche psychologische Theorien und Ansätze zum Thema Schwangerschaftsabbruch vorzustellen.
Da eine Untersuchung vor Ort den Rahmen dieser Arbeit überschreitet, wird auf vorliegendes Datenmaterial zurückgegriffen, was eine Begrenzung durch fehlende Ortskenntnisse der Verfasserin beinhaltet.
Die Arbeit soll einen Überblick und eine kritische Würdigung der aktuellen Forschungstätigkeit aus den Jahren von 1980 bis 2006 darstellen. Ziel ist dabei, bestehende Tendenzen und gegebenenfalls Lücken der bisherigen Forschung offen zu legen für zukünftige Untersuchungen auf dem Gebiet der Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien.
Die Wahl fiel auf das Untersuchungsthema des Schwangerschaftsabbruchs, weil dieser in den vergangenen Jahren zahlreiche kontroverse Diskussionen ausgelöst hat, wobei das Einzelschicksal der Betroffenen häufig aus den Augen verloren wurde. Der Schwangerschaftsabbruch steht wie kaum ein anderes soziales Phänomen im Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und dessen Einschätzung [hängt] nicht zuletzt von religiösen Überzeugungen, ethischen Grundeinstellungen und gesellschaftlichen Einflüssen ab. So scheint die Frage, wie Menschen mit dem Thema des Schwangerschaftsabbruchs umgehen, für die Betrachtung vor einem spezifischen kulturellen Hintergrund besonders geeignet.
Als anthropologische Universalie verdient der Schwangerschaftsabbruch psychologische Beachtung. Im öffentlichen Diskurs werden die psychologischen Zusammenhänge des Geschehens häufig vernachlässigt, was auch auf andere Bereiche […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Teil I
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen
Teil II
3. Staatliche Informationen zu Indien
3.1 Staatliche Organisation und Bevölkerung
3.2 Medizinische Versorgung
3.3 Politische Maßnahmen zur Familienplanung
3.3.1 Rechtsprechung bei Schwangerschaftsabbrüchen
3.3.1.1 Einrichtungen zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen
3.3.1.2 Eingesetzte Techniken
3.3.2 Vorgeburtliche Untersuchungen
4. Kulturelle Besonderheiten Indiens
4.1 Religion
4.1.1 Hinduismus
4.1.1.1 Dharma
4.1.1.2 Karma
4.1.1.3 Moksha
4.1.1.4 Das Bild der Frau
4.1.1.5 Ideen zum Beginn des Lebens
5. Gesellschaftliche Strukturen
5.1 Das Kastenwesen
5.2 Die Stellung der Frau in der Gesellschaft
6. Psychologie in Indien
6.1 Indische Ethnopsychologie
6.2 Die Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie
6.3 Heutige Situation
7. Zusammenfassung
Teil III
8. Aspekte der Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien
8.1 Internationale Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs
81.1 Internationale Forschung zum Schwangerschaftsabbruch mit Indienbezug
8.2 Exkurs I: Schwangerschaftsabbruch in traditionellen Texten
8.3 Generelle Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs in Indien
9. Untersuchungen zur Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs
9.1 Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen
9.1.1 Kritik und Zusammenfassung
9.2 Soziodemographische Merkmale von Frauen mit der Erfahrung einer Abtreibung
9.2.1 Kritik
9.2.2 Zusammenfassung
9.3 Abtreibungen bei Jugendlichen
9.4 Entscheidungsfindung bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen
9.4.1 Kritische Zusammenfassung
9.5 Psychische Folgen des Schwangerschaftsabbruchs
9.5.1 Kritik am Forschungsvorgehen
9.5.2 Zusammenfassung
10. Selektive Abtreibungen
10.1 Selektive Abtreibungen weiblicher Feten
10.1.1 Häufigkeit selektiver Abtreibung weiblicher Feten
10.1.1.1 Exkurs II: Ungleiches Geschlechterverhältnis
10.1.2 Tötung weiblicher Nachkommen und selektive Abtreibung
10.1.3 Gründe für die Tötung weiblicher Nachkommen
10.1.4 Versuch der Konstruktion eines psychologischen Sinnzusammenhangs
10.1.5 Folgen der Tötung weiblicher Nachkommen
10.1.6 Mögliche Auswege
10.1.7 Kritische Zusammenfassung
10.2 Untersuchungen zum Thema selektive Abtreibung weiblicher Feten
10.2.1 Informationsstand der Bevölkerung zu selektiver Abtreibung weiblicher Feten
10.2.1.1 Kritik und Zusammenfassung
10.2.2 Einstellungen zu selektiver Abtreibung weiblicher Feten
10.2.2.1 Kritische Zusammenfassung
10.2.3 Soziodemographische Merkmale der Schwangeren bei selektiver Abtreibung
10.2.3.1 Kritik
10.2.3.2 Zusammenfassung
10.2.4 Entscheidungsfindung bezüglich selektiver Abtreibung weiblicher Feten
10.2.4.1 Kritik und Zusammenfassung
10.3 Anmerkung
11. Unsichere Schwangerschaftsabbrüche
11.1 Soziodemographische Merkmale der abtreibenden Frauen unter unsicheren Bedingungen
11.2 Gründe für das Vorkommen von unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen
11.3 Zusammenfassung
12. Abschluss
13. Literaturverzeichnis
13.1 Internetquellen
Teil I
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien. Durch die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes zum Thema soll deutlich werden, welche Beachtung der Schwangerschaftsabbruch in Indien erhält und in welchen Zusammenhängen Schwangerschaftsabbrüche in Indien erlebt und behandelt werden.
Aufgrund des kulturellen Unterschiedes zwischen Indien und westlichen Ländern kann davon ausgegangen werden, dass die Bearbeitung psychologischer Fragestellungen sich jeweils verschieden gestaltet. Die im Westen zugängliche psychologische Literatur ist vorwiegend auf Untersuchungen der westlichen Mittelschicht beschränkt (Stubbe 2005), sodass diese Ergebnisse nicht ohne weiteres auf einen anderen Forschungskontext übertragen werden können. Um Indien mit seinem entsprechenden kulturellen Hintergrund gerecht zu werden, wird daher in dieser Arbeit darauf verzichtet, westliche psychologische Theorien und Ansätze zum Thema Schwangerschaftsabbruch vorzustellen.
Da eine Untersuchung vor Ort den Rahmen dieser Arbeit überschreitet, wird auf vorliegendes Datenmaterial zurückgegriffen, was eine Begrenzung durch fehlende Ortskenntnisse der Verfasserin beinhaltet. Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass, wie es Boss (1987, S. 11) ausdrückt, auch bei einer Untersuchung vor Ort die mir vergönnten Zeiträume sowie das Fassungsvermögen eines Einzelnen bei weitem nicht ausreichen, der ganzen Fülle der landschaftlichen und geistigen Schätze, der Vielfalt aller sozialen und zivilisatorischen Einrichtungen dieser großen alten Kulturbereiche gewahr zu werden.
Die Arbeit soll einen Überblick und eine kritische Würdigung der aktuellen Forschungstätigkeit aus den Jahren von 1980 bis 2006 darstellen. Ziel ist dabei, bestehende Tendenzen und gegebenenfalls Lücken der bisherigen Forschung offen zu legen für zukünftige Untersuchungen auf dem Gebiet der Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien.
Die Wahl fiel auf das Untersuchungsthema des Schwangerschaftsabbruchs, weil dieser in den vergangenen Jahren zahlreiche kontroverse Diskussionen ausgelöst hat, wobei das Einzelschicksal der Betroffenen häufig aus den Augen verloren wurde. Der Schwangerschaftsabbruch steht „wie kaum ein anderes soziales Phänomen im Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen … und dessen Einschätzung [hängt] nicht zuletzt von religiösen Überzeugungen, ethischen Grundeinstellungen und gesellschaftlichen Einflüssen ab“ (Eser 1988, S.8). So scheint die Frage, wie Menschen mit dem Thema des Schwangerschaftsabbruchs umgehen, für die Betrachtung vor einem spezifischen kulturellen Hintergrund besonders geeignet.
Als „anthropologische Universalie“ (Stubbe 2005, S. 1) verdient der Schwangerschaftsabbruch psychologische Beachtung. Im öffentlichen Diskurs werden die psychologischen Zusammenhänge des Geschehens häufig vernachlässigt, was auch auf andere Bereiche der modernen Reproduktionsmedizin zutrifft (Telus, 2001). Die Abtreibung, eine „ancient practice“ (Jain, Saha, Bagga & Gopalan 2004, S. 197), stellt die älteste und universalste Form der Verhütung unerwünschter Geburten dar (Mundigo & Indriso 1999; Sherwani & Haq 1998). Sie kann daher als Vorfahre der inzwischen zahlreichen Techniken und Methoden der Reproduktionsmedizin gesehen werden.
Die indische Kultur wählte die Autorin aufgrund persönlicher Interessen. Insbesondere das Problem der selektiven Abtreibung weiblicher Feten fiel ins Auge und verlangte nach eingehender Auseinandersetzung.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Um die Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs in Indien zu untersuchen, ist es zunächst notwendig, einige wesentliche Begriffe zu definieren. Im zweiten Teil sollen dann organisatorische Grundsätzlichkeiten sowie kulturelle Gegebenheiten Indiens kurz vorgestellt werden, vor deren Hintergrund sich das psychologische Geschehen des Schwangerschaftsabbruchs gestaltet. Dabei soll nicht der Eindruck von angenommenen Kausalzusammenhängen entstehen, dergestalt, dass bestimmte soziale Faktoren ursächlich mit den Erscheinungsformen des Schwangerschaftsabbruchs zusammen hängen. Eine derartig festlegende Darstellung kann nicht aufgrund einer Literatursicht geformt werden, sondern bedürfte experimenteller Untersuchungen. Ziel des zweiten Teils der Arbeit ist hingegen, die kulturellen Zusammenhänge wiederzugeben, die bei der Erfahrung des Schwangerschaftsabbruchs eine Rolle spielen können. Die dabei vollzogene Vereinheitlichung der kulturellen Vielfalt Indiens dient als „notwendige und ligitime Verkürzung einer komplexen Realität“ (Kakar & Kakar 2006, S. 10).
Die Darstellung des Forschungsstandes zum Thema Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs bildet den dritten Teil der Arbeit. Zunächst sollen einige internationale Aspekte zur Abtreibung und internationale Untersuchungen mit Bezug zu Indien betrachtet werden. Nach einem Exkurs über die Erwähnung von Schwangerschaftsabbrüchen in altindischer Literatur wird auf den aktuellen Forschungsstand zum Thema eingegangen. Die aussagekräftigen Untersuchungen der letzten 26 Jahre werden nach inhaltlichen Fragestellungen geordnet vorgestellt und mit einer kritischen Würdigung und Zusammenfassung abgeschlossen.
Eigene Aussagen und Anmerkungen werden auf die Autorin zurückgeführt, im Unterschied zu Referenzen auf Forscher und Forscherinnen, deren Untersuchungen die Ausgangsbasis der vorliegenden Arbeit darstellen. Zur Vereinfachung wird die im deutschen Sprachraum übliche maskuline Ausdrucksweise gewählt.
2. Begriffsdefinitionen
Zu Beginn sollen einige grundlegende Begriffe definiert werden. In deutscher Sprache existieren die Ausdrücke Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung synonym. Gemeint ist die vorzeitige Beendigung einer Schwangerschaft in der Zeit nach der Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutter und vor Erreichung der Überlebensfähigkeit des Fetus (etwa ab 24. Schwangerschaftswoche). Als Überbegriff gibt es den Begriff Abort, welcher einen spontanen, natürlichen Abbruch einbezieht. Ein spontaner Schwangerschaftsabbruch wird auch als Fehlgeburt bezeichnet und geschieht ohne geplante Einwirkung von außen. Dieses Phänomen wird in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet. Stattdessen stehen induzierte Schwangerschaftsabbrüche im Fokus der Untersuchung. Dabei handelt es sich um willentlich herbeigeführte frühzeitige Beendigungen von Schwangerschaften (Bhatia & Bohra 1990; Tietze 1986; Stegner 1994).
Therapeutisch wird eine Abtreibung genannt, die zur Sicherung der Gesundheit oder des Lebens der Schwangeren durchgeführt wird. Dabei besteht kein allgemein verbindlicher Konsens darüber, inwieweit die seelische Gesundheit zu einer therapeutischen Abtreibung berechtigt.
Es wird von einem selektiven Schwangerschaftsabbruch gesprochen, wenn der Eingriff aufgrund bestimmter Eigenschaften des Fetus durchgeführt wird, um eine Auswahl zu treffen (Stauber & Weyerstahl 2005). Dies geschieht zumeist bei fortgeschrittener Schwangerschaftsdauer, oft nach der 12. Woche als Spätabbruch. So existiert zum Beispiel die selektive Abtreibung weiblicher Feten oder die selektive Abtreibung aus eugenischen Gründen, bei der Befürchtung von schwerer Krankheit des Fetus. Im Unterschied zu diesen späten Schwangerschaftsabbrüchen werden Abtreibungen bis zur neunten Woche als frühe Schwangerschaftsabbrüche bezeichnet (Mergolis & Goldsmith 1973).
Die Schwangerschaftsabbrüche können zudem nach ihrer Durchführungsart unterschieden werden. Es existieren instrumentelle, mechanische Schwangerschaftsabbrüche durch Absaugung oder Ausschabung und medikamentöse Abtreibungen durch die Einnahme von Mifeprostone und Prostaglandins (Stegner 1994).
Schwangerschaftsabbrüche werden nach der Rechtslage in legale und illegale (kriminelle) Abtreibungen eingeteilt. Illegale Schwangerschaftsabbrüche werden in Indien in der Regel als unsicher angesehen und auch bezeichnet, weil die hygienischen Bedingungen und oft auch hinreichende Kenntnisse zur Durchführung fehlen. Die Unterscheidung zwischen illegal induzierten und spontanen Schwangerschaftsabbrüchen ist in der Praxis oft schwer. Lediglich wenn der Beweis für eine willentliche Manipulation erbracht werden kann, ist auf eine illegale Abtreibung zu schließen (Tietze 1986).
In englischer Sprache wird der Begriff Schwangerschaftsabbruch üblicherweise mit „abortion“ übersetzt. Nach Karkal (1991) wurde in Indien bei der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen die Bezeichnung „medical termination of pregnancy“ gewählt, um Gegner der Abtreibungspraxis nicht zu provozieren (vgl. auch Hirve 2004). Seitdem ist dieser Begriff im indischen Kontext ebenso geläufig.
Das Thema des Schwangerschaftsabbruchs ist in politischen Debatten und zur Konstituierung moralischer Ansprüche im gesellschaftlichen Bereich genutzt worden. Gleichzeitig kann man auch von einer Tabuisierung des Geschehens auf persönlicher Ebene ausgehen. Die Terminologie um die Abtreibung ist nicht zuletzt dadurch bisweilen emotionsgeladen. So nutzen die Abtreibungsgegner in ihren Kampagnen die Bezeichnung „Mutter“ für eine schwangere Frau, „Kind“ für einen Fetus und „pro life“ wird mit „anti abortion“ gleichgesetzt. Die Abtreibungsbefürworter sprechen im Unterschied dazu von „fetalem Umfeld“ statt von einer schwangeren Frau, von „products of conception“ statt von Fetus und beschreiben ihre Einstellung als „pro choice“ (Winter 1988).
Teil II
3. Staatliche Informationen zu Indien
Um das Thema der vorliegenden Arbeit in seinem kulturellen Zusammenhang sehen zu können, wird zunächst ein allgemein gehaltenes Bild von Indien entworfen. Hierzu werden die in großer Anzahl oder weiten Landesteilen auftretenden Erscheinungen beschrieben, um dem Leser einen ersten Eindruck des Lebensraums zu bieten. Trotz der vielfältigen Unterschiede innerhalb des Landes geht die Autorin dabei von der Existenz eines kollektiven „indischen Geistes“ (Kakar & Kakar 2006, S. 9) aus, der alle Erscheinungen Indiens durchdringt und somit auch auf die Gestaltung des Schwangerschaftsabbruchs seine Auswirkung nimmt.
Zunächst werden einige kurze, allgemeine Länderinformationen gegeben. Die medizinische Versorgung wird kurz dargestellt sowie politische Maßnahmen zur Familienplanung. Im Anschluss wird auf die Rechtslage der Schwangerschaftsabbrüche eingegangen. Die Verbreitung von Einrichtungen zur Durchführung von Abtreibungen wird ebenso thematisiert wie verwendete Techniken und vorgeburtliche Untersuchungen.
Des Weiteren steht der kulturelle Bereich im Blickpunkt. Nach kurzer Beschreibung ausgewählter religiöser Konzepte werden die bedeutsamen gesellschaftlichen Strukturen, das Kastenwesen und insbesondere die Stellung der Frau in der Gesellschaft aufgegriffen. Zum Abschluss des zweiten Teils wird die Psychologie in Indien vorgestellt.
3.1 Staatliche Organisation und Bevölkerung
Indien erreichte die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialisierung 1947. Heute umfasst die indische Unionsrepublik ein Gebiet von etwa 3 288 000 km2 und ist in 28 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien unterteilt (vgl. Abbildung 1), die von verschiedenen Regierungen in unterschiedlichen Machtstrukturen relativ autonom voneinander verwaltet werden (Petzold 1986). Indien gilt aufgrund der hohen Bevölkerungszahl als größte parlamentarische Demokratie der Erde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Bevölkerungsdichte Indiens nach Census of India 2001 (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 11)
Indien ist ein Vielvölkerstaat, die Gesamtbevölkerungszahl beläuft sich nach rapidem Wachstum in den letzten Jahrzehnten basierend auf der Zählung im Juli 2006 auf 1.095.351.995[1] Menschen (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 9). Tabelle 1 stellt die Verteilung der Bevölkerung auf die einzelnen Bundesstaaten dar. Die Bevölkerungsdichte je Bundesstaat kann aus Abbildung 1 entnommen werden. Neben einigen Städten wie Delhi und Chandigarh sowie Unionsterritorien wie Lankshadweep sind die Staaten Kerala im Süden und Uttar Pradesh, Bihar und West Bengal im Norden am dichtesten besiedelt. Das Bevölkerungswachstum liegt im Moment bei 1,4 Prozent pro Jahr, was einem jährlichen Zuwachs von 15 Millionen Menschen entspricht. Damit verzeichnet Indien derzeit die größte absolute Vermehrung aller Staaten der Erde. Die Zunahme erklärt sich nicht aus erhöhten Geburtenraten (2006: 22,01 pro 1000), sondern aus verlängerter Lebensdauer, was unter anderem auf eine Verbesserung der in vielen Gegenden immer noch unzureichenden Gesundheitsversorgung zurückzuführen ist.
Tabelle 1:
Bevölkerungszahlen, Alphabetisierung, Religiöse Zugehörigkeit und Anteil weiblicher Bevölkerung nach Bundesstaaten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die durchschnittliche Kinderzahl sank seit 1971 von 5,2 Kindern je Frau bis 1991 auf 3,6 und für 2006 wird sie auf 2,73 Kinder je Frau geschätzt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt für Männer bei 63,9 Jahren und für Frauen bei 65,6 Jahren. Ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 9). Insgesamt ist ein deutlicher Männerüberschuss zu verzeichnen, auf 1000 Männer kamen im Jahre 2001 933 Frauen (vgl. Tabelle 1, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 7). Näheres dazu folgt im Kapitel 10.1.1.1.
Indien ist eine Agrargesellschaft mit über 700.000 Dörfern. Der Urbanisierungsgrad liegt etwa bei 25 % (Petzold 1986). Etwa ein Viertel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze (im Jahr 2000 betrug die Armutsgrenze für Städte: 454,11 Rupien (Rs.), auf dem Land: 327,56 Rs.; Ministry of Health and Family Welfare 2005) , Unterernährung und Umweltkatastrophen stellen alltägliche Probleme des Landes dar. Die Gesundheitsversorgung ist insbesondere in ländlichen Gebieten schlecht. Petzold (1986) sieht die Ursache des Hungers weniger in einer zu geringen Agrarproduktion als in der Sozialstruktur des Landes. Punjab und Maharshtra sind mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 15.390 Rs. bzw. 15.172 Rs. die reichsten Bundesstaaten, Bihar ist mit 4.123 Rs. die ärmste Gegend (Ministry of Health and Family Welfare 2005).
Petzold (1986) beschreibt Indien als einen „riesigen, vielfältigen Subkontinent“ mit Hochgebirgslandschaften im Norden, dem Tiefland der großen Ströme Indus, Ganges und Brahmaputra und dem zentralen Hoch- und Tafelland des Dekkan im Süden. Entsprechend der Landschaft sind verschiedene Klimazonen anzutreffen, wobei das Monsunklima für große Teile Zentralindiens bestimmend ist.
Indien ist ein Vielvölkerstaat und zwischen den einzelnen Regionen des Landes bestehen große kulturelle Unterschiede hinsichtlich sämtlicher Merkmale wie Religion, Erwerbstätigkeit, Bildungsstand, Sprache, etc. (vgl. Tabelle 1), sodass kaum von "der indischen Bevölkerung" gesprochen werden kann, ohne grobe Verallgemeinerungen vorzunehmen. Als Staatssprache gilt seit 1971 Hindi, das nur von etwa 40 % der Bevölkerung gesprochen wird. Zusätzlich existierten 15 Haupt und Regionalsprachen, sowie 24 weitere selbstständige Sprachen und über 720 Dialekte (Meyer & Gaur 1988). Englisch gilt als wichtigste Sprache für nationale, politische und wirtschaftliche Kommunikation (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 3). Das Bildungswesen obliegt größtenteils den Bundesstaaten, sodass es dementsprechend große regionale Unterschiede aufweist, was sich deutlich in der ungleichen Analphabetenrate äußert. Während diese in Kerala 2001 nur 9,1 Prozent betrug, war sie im finanziell ärmsten Staat Bihar mit 53,0 Prozent fast sechsmal so hoch. Die Alphabetisierungsrate lag im gleichen Jahr für ganz Indien bei 64,8 % (Frauen 53,7 %, Männer 75,3%). Zu beachten ist, dass trotz allgemeiner Schulpflicht Mädchen seltener eingeschult werden als Jungen (Einschulungsrate im Durchschnitt 2000 bis 2004: Jungen: 90 Prozent, Mädchen: 85 Prozent). Oft brechen die Mädchen spätestens vor der Pubertät den Schulbesuch ab (Chanana 2001).
In Indien leben hauptsächlich Hindus (80,5 %) und Moslems (13,4 %, meist Sunniten), aber auch Christen (2,3 %), Sikhs (1,9 %), Buddhisten (0,8 %), Jainas (0,4 %) und andere, wie z. B. Adivasi, Baha'i, Parsen (gesamt 0,6 %) (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 9). Jammu & Kashmir ist der einzige Bundesstaat, in dem Moslems anteilmäßig stärker vertreten sind als Hindus.
3.2 Medizinische Versorgung
Es gibt in Indien sowohl staatliche als auch private medizinische Einrichtungen. Man spricht in diesem Zusammenhang von Regierungs-, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und privaten Einrichtungen. Offiziell ist das Gesundheitssystem überwiegend staatlich organisiert und mit öffentlichen Mitteln finanziert (Chandrasekhar 1994). Gleichzeitig gibt es neben den zahlreichen traditionellen Heilern und ihren entsprechenden Einrichtungen inzwischen viele Privatpraxen und Hospitäler moderner Mediziner, deren Qualitätsstandard und finanzielle Zielsetzung stark variieren. In der Praxis liegt die Finanzierung der medizinischen Versorgung tatsächlich heute weitgehend in privaten Händen (Ministry of Health and Family Welfare 2005).
Zwischen Dörfern und Städten ist ein großer Unterschied in der medizinischen Versorgung zu verzeichnen, trotz der Errichtung von Erste-Hilfe Stationen in den Dörfern, von denen nach Chandreasekhar (1994) einige tausend Stationen in insgesamt etwa 700.000 Dörfern existieren. Immer noch gibt es zahlreiche Gemeinden, in denen keine moderne medizinische Versorgung vorhanden ist. Nach Angaben der Regierung weigern sich Ärzte und medizinisches Personal in der Regel, in ländlichen Gegenden zu bleiben (Ministry of Health and Family Welfare 2005). Auch fehlen finanzielle Mittel für adäquate Ausrüstung sowie funktionierende Organisationsabläufe. Manche Dörfer sind nur zu Fuß erreichbar, und die Wege während der Monsunzeit unpassierbar. Dort wenden sich die Menschen an einheimische Heiler, wenn ihre Möglichkeiten der Selbstmedikation Grenzen erreichen. Zahlreiche gesundheitliche Schwierigkeiten, insbesondere gynäkologische Probleme und Anämie werden oft als Teil des Lebens angesehen. Über 70% der Frauen sind anämisch (Pachauri 1999). Schlechte hygienische Bedingungen, wie fehlender Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen sowie unzureichende Nahrung verschlimmern die gesundheitliche Situation der Menschen, insbesondere der Frauen. Seuchen und Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose, Polio und Cholera sind in manchen Regionen noch immer verbreitet (Menon1996).
Einen Arzt suchen die Menschen in der Regel nur bei schwerwiegenden Problemen auf, zuvor wird auf die Fähigkeit der Selbstbehandlung vertraut. Theoretisch sind Besuche bei staatlich praktizierenden Ärzten kostenfrei, was in der Praxis allerdings nicht immer eingehalten wird. Auch ist für die Bevölkerung schwer durchschaubar, wer staatlich und wer privat praktiziert. Häufig wird der Besuch einer privaten Einrichtung vorgezogen, ohne Kenntnis dessen, dass in diesem Bereich auch unqualifizierte und kaum ausgebildete Menschen tätig sind (Pachauri 1999). Nach Reiter (1997) halten die meisten Inder in dörflichem Umfeld die kostenlose medizinische Versorgung in staatlichen Einrichtungen für unwirksam und gesundheitsschädlich. Auch müssen zur Erreichung dieser Gesundheitseinrichtungen oft lange Wege zurückgelegt werden, die Zeit und Kosten in Anspruch nehmen.
Bereits seit den 50er Jahren hatte man versucht, die fehlende Gesundheitsversorgung im Bereich der Schwangerschafts- und Geburtenbetreuung durch Training der „traditional birth attendants“ (im Folgenden als TBA bezeichnet) auszugleichen, was allerdings wenig erfolgreich war. Die TBA sind in den Ortsgemeinschaften integriert und unterstützen die Frauen bei Fragen bezüglich Geburt und Schwangerschaft. Sie weisen unterschiedliches Vorwissen auf, zudem stehen ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in einem kulturellen Kontext, der nicht ohne weiteres mit modernen medizinischen Ansichten verbunden werden kann. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass TBA Frauen zum Besuch eines Krankenhauses überreden (WHO 2005a).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.3 Politische Maßnahmen zur Familienplanung
Da die Ziele der Wirtschaftspolitik auch durch wachsende Bevölkerungszahlen bedroht wurden, wuchs in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung der Gesundheits- und Familienplanungspolitik (Sinha 1986). Indien war einer der ersten Staaten, der 1951 das Thema der Familienplanung in die staatliche Politik aufnahm (Ram 1998). Zur Verringerung der explodierenden Geburtenrate entstanden zahlreiche Programme insbesondere zur Verbreitung von Verhütungsmitteln, mit deren Evaluation sich auch die Klinischen Psychologen beschäftigten. Techniken der Familienplanung, Bildung und Erziehung der Menschen sowie die Etablierung sozialer Verantwortlichkeit wurden in ihrem Bezug auf eine mögliche Verringerung des rapiden Bevölkerungswachstums untersucht. In den Jahren zwischen 1951 und 1972 wurden annähernd 1.300 psychologische Artikel zum Thema Familienplanung veröffentlicht (Sinha 1986), denen meist Wissens-, Einstellungs- und Akzeptanzuntersuchungen zu Grunde lagen. Überblicke bieten Pareek und Rao (1974) sowie Rao (1974).
Aus feministischer Perspektive förderte der Staat eine Technik zur Familienplanung nach der anderen (Ram 1998), häufig ohne notwendige Informations- und Aufklärungsarbeit, nicht um den Menschen eine Wahlfreiheit zu ermöglichen, sondern allein zur Erreichung demographischer Ziele. Als man in den Jahren nach 1960 feststellte, dass die Verteilung von Kondomen, Diaphragmen und oralen Verhütungsmitteln nicht die erwünschte Reduzierung der Geburtenrate einbrachte, wurden andere, dauerhafte Methoden (z.B. Spirale) verbreitet (Karkal 1991). Zwischen 1975 und 1977 wurden mit Druck und Zwang Massensterilisationen von Männern in indischen Slums vorgenommen. Die massive Gegenreaktion der Bevölkerung veranlasste die Regierung, die Maßnahmen der Familienplanung vermehrt auf Frauen zu konzentrieren (Gangoli 1998; Menon 1996). Um schnelle Ergebnisse zu erzielen, wurden Camps und mobile Einheiten durchs Land geschickt, die durch Druck und Massenpersuasion Verhütungsmethoden unter der Bevölkerung verbreiteten. Diejenigen Teilnehmer, die sich für eine Sterilisation entschieden, erhielten Geldprämien (Karkal 1991, vgl. auch Meyer & Gaur 1988). Informal wurde dieses Vorgehen als „coercive persuision“ (Karkal, 1991, S. 224) bezeichnet. Insbesondere Methoden, die endgültig waren (Sterilisation) und eine Abhängigkeit von Medizinern (Spirale und Hormonimplantate) mit sich brachten, wurden befürwortet (Gangoli 1998; Ram 1998).
In den Staaten Maharashtra und Tamil Nadu erfolgten die massivsten Kampagnen. Tietze schreibt, dass 1982/83 29 % der durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche von einer Sterilisation begleitet waren. Dabei ist zu bedenken, dass heute viele Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, verheiratet sind und bereits mehrere Kinder haben (vgl. Kapitel 9.2), gleichzeitig existierte aber auch schon 1986 „mounting concern about undue pressure on women to accept sterilization as the price of abortion“ (Tietze 1986, S. 96).
Bis heute stehen die Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitssystems unter dem Druck, jährlich eine bestimmte Anzahl an Sterilisationen durchführen zu lassen, da entsprechende Ziele von der Regierung formuliert und bis auf die letzte Ebene weitergegeben werden. Erfüllen sie diese Anforderungen nicht, wird ihr Gehalt gekürzt. So geschieht es, dass sie den Menschen für eine Sterilisation zusätzliches Geld zahlen. Bei manchen Paaren werden Mann und Frau operiert (Bullimer 1990). Zudem werden „reversible Sterilisationen“ angeboten (Mehta 1987). Slogans wie „fewer children are better children“ sind weit verbreitet (Moen 1991) und zeigen bereits diskriminierenden Charakter. Groß angelegte Studien westlicher Pharmakonzerne, die ihre neu entwickelten Verhütungsmittel an der unaufgeklärten, dörflichen Bevölkerung Indiens testen, verschärfen die Situation der Frauen (Gangoli 1998; Savara 1987).
1997 wurde in Indien mit Unterstützung der Weltbank das „Reproductive and Child Health Program“ eingeführt, welches eine deutliche Werteveränderung gegenüber dem bisherigen Vorgehen der Regierung darstellt (Pachauri 1999). Im Gegensatz zu einer Betonung von demographischen Zielen, die bisher im Mittelpunkt der Betrachtung standen, wird jetzt die Qualität des Services mehr berücksichtigt, was die Bedürfnisse der Menschen stärker respektieren soll. Dabei verzichtete die Regierung allerdings darauf, die Thematik des Schwangerschaftsabbruchs näher zu berücksichtigen (Duggal & Ramachandran 2004; Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10). Lediglich der Notwendigkeit zur medizinischen Überwachung des Schwangerschaftsverlaufs wurde Rechnung getragen mit der Forderung nach mindestens drei Untersuchungen für jede schwangere Frau, was in der Praxis bisher keine Realisierung findet (Arnold, Kishor & Roy 2002).
Da zur Verringerung der Geburtenrate sowohl die Verringerung der Kindersterblichkeit (54,63 Tode pro 1000 überlebende Kinder, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 9) als auch die Verbesserung der Bildung für Frauen sowie die Verringerung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern beitragen, sollen nach dem „Reproductive and Child Health Program“ auf diesen Gebieten Veränderungen eingeführt werden. Dabei kommt es zunehmend zur Zusammenarbeit zwischen Regierungs-, Nichtregierungs- und privaten Organisationen (Pachauri 1999).
3.3.1 Rechtsprechung bei Schwangerschaftsabbrüchen
Am 1. April 1972 wurden im Zuge der Familienplanungspolitik Schwangerschaftsabbrüche in Indien durch den Medical Termination of Pregnancy Act, No.34, 1971 legalisiert (außer in Sikkim und Lakshadweep, in Kashmir und Jammu erst 1974). Die Verbreitung von Verhütungsmitteln reichte nach Chandrasekhar (1994), der in den 60er Jahren in Indien Minister für Gesundheit und Familienplanung war, nicht zur Verringerung der Bevölkerungszahl aus. Seiner Ansicht nach bedurften unerwünscht entstandene Schwangerschaften ebenfalls einer Lösung. Die hohe Müttersterblichkeit durch illegale und unsichere Abtreibungen sollte verringert werden.
Daher bestimmt der Medical Termination of Pregnancy Act, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche nur durch einen registrierten Arzt oder dafür ausgebildeten, registrierten Praktizierenden durchgeführt werden dürfen. Eingriffe zwischen der 12. und 20. Schwangerschaftswoche erfordern die Anwesenheit zweier registrierter Mediziner.
Schwangerschaftsabbrüche waren von diesem Zeitpunkt an in Indien unter folgenden Bedingungen erlaubt:
1. wenn die Schwangerschaft eine ernsthafte Bedrohung für das Leben oder die körperliche oder geistige Gesundheit der Mutter darstellt,
2. wenn das ernsthafte Risiko besteht, dass das Kind bei seiner Geburt schwer behindert ist (eugenische Indikation).
Es werden zwei Situationen angenommen, die eine ernsthafte Gefährdung der mentalen Gesundheit der Schwangeren hervorrufen können.
1. Die Schwangerschaft ist das Resultat einer Vergewaltigung[2].
2. Die Schwangerschaft entstand in einer Ehe trotz Einsatz von Verhütungsmitteln zur Reduzierung der Kinderzahl, „the anguish caused by such unwanted pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant wife.” (Chandrasekhar 1994, S. 151).
Auch kann für die Erwägung, ob die Fortführung der Schwangerschaft ein Risiko für die Gesundheit der Frau darstellt, das aktuelle wie zukünftige Umfeld der Frau berücksichtigt werden.
Ein Mädchen unter 18 Jahren oder eine geisteskranke Frau benötigt die Zustimmung ihres Vormundes. Jede andere Schwangerschaft darf nur mit Zustimmung der Frau abgebrochen werden, eine Einwilligung des Kindsvaters ist nicht von Nöten. Der Eingriff muss in einem Krankenhaus oder an einem von der Regierung dafür vorgesehenen Ort durchgeführt werden. Die Häuser der Regierung müssen lediglich die Anwesenheit eines Gynäkologen oder eines Arztes nachweisen, der an einem speziellen Training zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen teilgenommen hat und dementsprechend registriert ist. Den privaten Einrichtungen werden höhere Anforderungen an ihre Ausstattung und ihren Service abverlangt (Ganatra & Elul 2003; Iyengar 2002; Sheriar 2004), „… enormous red tape in securing clearness for an institution to undertake MTPs [medical termination of pregnancys] to the cumbersome nature of the reporting procedures requiring very detailed and time bound submission“ (Chhabra 1996, S. 89). So sind zahlreiche Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, nicht registriert (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10). Eine einmal erteilte Zertifizierung gilt dauerhaft, ohne Kontrolle oder Supervision (Ganatra & Elul 2003).
In jeder Einrichtung soll es ein Register geben, in dem Name und einige Daten der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, aufgenommen werden. Die Prxis wird diesem Anspruch oft nicht gerecht. Eine Schwangerschaft, die bereits länger als 20 Wochen dauert, darf nur noch bei akuter Lebensgefahr der Mutter willentlich beendet werden. In Uttar Pradesh ist eine zweite Abtreibung innerhalb von sechs Monaten nicht erlaubt (Singh 1976).
Falls bei dem Eingriff ein Fehler unterläuft, ist es die Angelegenheit der behandelten Frau, dem Arzt nachzuweisen, dass er nicht in „gutem Glauben“ für ihre Gesundheit gehandelt hat, was praktisch unmöglich ist, „… a registered medical practitioner,…, is saved from any liability arising from any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done...” (Singh 1976, S. 52). Die Macht der Ärzte wird durch die Möglichkeit zur Interpretation des Gesetzes verstärkt (Gangoli 1998). Was eine Bedrohung für die Gesundheit der Frau darstellt, kann ein skrupulöser Arzt als seine Entscheidung empfinden, die er möglicherweise ohne Absprache mit der Patientin fällt (vgl. Menon 1996; Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10). Lediglich nach einer Vergewaltigung außerhalb der Ehe ist der qualifizierte Arzt aus rechtlicher Perspektive zur Durchführung eines Abbruchs verpflichtet, wenn die Schwangere dies wünscht (Jesani & Iyer 1995; Meyer & Gaur 1988).
Falls ein Arzt oder jemand anderes ohne die entsprechende Ausbildung und Qualifizierung der Regierung einen Schwangerschaftsabbruch durchführt, droht ihm eine Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren und /oder eine Geldstrafe. Für die Schwangere ergeben sich keine nachteiligen Rechtsfolgen.
Die Regierung bezeichnete die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs als eine Möglichkeit, die Gesundheit von Frauen zu sichern. Kritiker sehen darin eher das Bemühen, die Bevölkerungszahl zu reduzieren (Meyer & Gaur 1988; Singh 1976). Gangoli (1998) bezeichnet Familienplanung und Bevölkerungspolitik in Indien als synonyme Begriffe.
In erster Linie sollten mit dem Gesetz unsichere Schwangerschaftsabbrüche, die im Geheimen von Hebammen oder sonstigen Heilern durchgeführt werden, unterbunden werden. Das Wissen um die Möglichkeit zur legalen Abtreibung ist allerdings noch nicht in ganz Indien verbreitet. So fanden beispielsweise Iyengar und Iyengar (2002), dass im Jahre 1998 in dörflicher Umgebung Rajasthans 79 % der verheirateten Frauen und 76 % der verheirateten Männer nicht wussten, dass Abtreibungen legal und kostengünstig durchgeführt werden. Gupte, Bandewar & Pisal (1997) fanden in ländlicher Umgebung von Pune, Maharashtra, dass nur 64% der interviewten Frauen Abtreibungen für legal hielten und weitere 16 % sich unsicher waren über die Gesetzeslage (vgl. auch Ganatra & Elul 2003; Nair & Kurup 1985).
Das indische Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch kann als eines der liberalsten bezeichnet werden und stellt eine „weitgefasste Indikationslösung“ (Meyer & Gaur 1988, S. 401) dar. Tatsächlich können Ledige nur nach einer Vergewaltigung eine Abtreibung durchführen lassen und Verheiratete außer bei gesundheitlicher Bedrohung nur bei Versagen von Verhütungsmitteln. In der Praxis kommt es folglich häufig zu fehlerhaften Angaben, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 16).
3.3.1.1 Einrichtungen zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen
21.022 Ärzte erhielten bis 1991 ein spezielles Training zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Dieses Training umfasst die Durchführung von mindestens 25 Abtreibungen, wobei diese Zahl oft nicht erreicht und auch in anderen Punkten die Qualität der Ausbildung bemängelt wird (Mohan 2001). Bis 1990 haben in Indien 6681 medizinische Institutionen die legale Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen angeboten (Chandrasekhar 1994). 1997 waren es etwa 9467 (Sheriar 2004), im Jahre 2005 nach Mathai (2005) 11025. Etwa 80 % der registierten Einrichtungen gehören zum privaten Sektor (Duggal & Ramachandran 2004; Mohan 2001).
Die Anzahl autorisierter Einrichtungen kann dem Bedarf immer noch nicht genügen (Dellapenna 2006). Zudem liegt eine ungleiche Verteilung der Institutionen vor (Ganatra & Elul 2003; Mathai 2005). Eine vergleichsweise hohe Anzahl registrierter Einrichtungen findet sich in wirtschaftlich besser gestellten Bundesstaaten wie beispielsweise Maharashtra (Pachauri 1999). Dort existiert eine Einrichtung für 8.000 Paare, während es in Bihar eine Einrichtung für 132.000 Paare gibt (Chhabra 1996). In den vier wirtschaftlich ärmsten Bundesstaaten, nämlich Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, die zusammen 40 % der Gesamtbevölkerung umfassen, sind nur 16,7 % aller registrierten Einrichtungen (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 24).
George (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10) findet für Maharashtra, dass trotz Registrierung zahlreiche Institutionen keine Abtreibungen anbieten (vgl. auch Chhabra 1996). Laut Khan, Barge und Kumar (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 24) sind nur 27% der registrierten privaten Einrichtungen funktionstüchtig. In manchen Einrichtungen fehlt der ausgebildete Arzt, in anderen die medizinische Ausrüstung (Pachauri 1999). Die meisten Einrichtungen befinden sich in den großen Städten, die für viele Frauen nur schwer erreichbar sind. Erste Institutionen in dörflicher Umgebung „are only a drop of relief in the ocean of rural distress“ (Chandrasekhar, 1994, S. 120). Nur 10% der dörflichen Erste Hilfe Stationen bieten die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen an. Häufig müssen die Frauen nach dem Eingriff einen langen Weg zu Fuß bewältigen, um ihr Heimatdorf erreichen zu können. Selten werden sie von Verwandten begleitet, da der Eingriff meist geheim geschehen soll, was Täuschungsmanöver notwendig macht (Iyengar 2002).
Nicht immer werden die persönlichen Daten der Frauen diskret behandelt (Chandrasekhar 1994; Duggal & Ramachandran 2004; Mohan 2001). Sorgfältigkeit in der Protokollierung ärztlicher Tätigkeit ist trotz gesetzlich vorgeschriebener Notwendigkeit nicht immer gegeben.
Eine Einrichtung der Regierung sollte Schwangerschaftsabbrüche kostenlos anbieten. Private Kliniken verlangen grundsätzlich ein Honorar, welches in einer ARTH (Action Research and Training for Health) Klinik im Süden Rajasthans beispielsweise 150 bis 300 Rs. beträgt (Iyengar & Iyengar 2002). Zum Vergleich: Die monatlichen Lebenshaltungskosten betragen in Rajasthan etwa 570 Rs. (Roy & Katoti 2005). Auch in staatlichen Einrichtungen fallen meist Kosten an für Medizin, Gehälter etc. (Duggal 2004). Der landesweite Kostendurchschnitt in staatlichen Einrichtungen beträgt 1294 Rs., je nach Status der Patientin, Dauer der Schwangerschaft und medizinischer Ausstattung. Im privaten Sektor sind Steigerungen um einen Faktor bis zum 7,5-fachen möglich (Duggal & Ramachandran 2004; Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10). Korruption ist auch im medizinischen Bereich üblich (Rao 2005).
3.3.1.2 Eingesetzte Techniken
In Indien existieren keine medizinischen Leitlinien oder Empfehlungen für die Durchführung von Abtreibungen (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10). Die Ausschabung der Gebärmutter war die erste Technik, die legal zur willentlichen Beendigung einer Schwangerschaft eingesetzt wurde. Bis heute findet sie die häufigste Verwendung (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 10). Dabei ist die Weitung des Gebärmutterhalses notwendig, was Schmerzen erzeugt, die mit Betäubungsmitteln behandelt werden können. Zudem besteht Verletzungsgefahr der Gebärmutterwand. Die Durchführung sollte von einem chirurgisch erfahrenen Arzt vollzogen werden, der bei Komplikationen eine Notoperation anschließen kann.
Seit den 70er Jahren ist die Methode der Absaugung bekannt, die innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate genauso effektiv und zusätzlich sicherer ist (WHO 2003). Eine Ausdehnung des Gebärmutterhalses ist nicht im gleichen Umfang notwendig, sodass diese Methode schneller und schmerzfreier anwendbar ist. Dennoch ist sie in Indien nicht in gleichem Ausmaß verbreitet wie die Methode der Ausschabung (Iyengar & Iyengar 2002).
C. Tietze schrieb 1986 über Indien, dass Schwangerschaftsabbrüche auch noch durch chirurgische Bauchoperationen ähnlich einem Kaiserschnitt (Hysterotomie), teilweise mit Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) durchgeführt werden.
Medikamentöse Abtreibung durch Mifepristone mit Misoprostol oder Gemeprost bei Schwangerschaften bis zur neunten Woche sind in Indien erst seit 2002 möglich (Santhya & Verma 2004). Die Tabletten dürfen nur durch einen Gynäkologen oder anderen registrierten Arzt verschrieben und unter Aufsicht genommen werden. Sie verursachen eine Kontraktion der Gebärmutter und die Ausstoßung des Embryos mit einer Blutung. Bei Misslingen der Abtreibung durch die Medikation muss mit Absaugung nachgeholfen werden.
Bei Schwangerschaftsabbrüchen nach der 12. Woche ist der Einsatz von Mifepristone und in mehrfacher Folge Prostaglandine, wie Misoprostol oder Gemeprost möglich. Die bevorzugte chirurgische Technik ist Ausschabung und Entleerung der Gebärmutter durch Absaugung oder mit Hilfe der Geburtszange, wobei eine Überwachung durch Ultraschall als hilfreich angesehen wird (WHO 2003). Zunehmend werden die Techniken kombiniert eingesetzt, um Effektivität und Sicherheit zu erhöhen. Die Medikamente dienen in diesem Fall der vorzeitigen Weheninduktion, mit dem Ziel der spontanen Ausstoßung des Fetus. Anschließend wird die Gebärmutter instrumentell vollständig entleert (Stegner 1994). Medizinische Risiken steigen mit fortschreitender Dauer der Schwangerschaft an, unabhängig von der verwendeten Methode (Stauber & Weyerstahl 2005).
3.3.2 Vorgeburtliche Untersuchungen
Insbesondere private Einrichtungen haben in den letzten Jahren zunehmend vorgeburtliche Untersuchungen als lukrative Finanzquelle genutzt (Kaur 1996). Im Wissen um die ersehnte Geburt eines Sohnes (vgl. auch Kapitel 5.2; 10) bieten sie schwangeren Frauen die Geschlechtsbestimmung ihres Fetus meist durch Ultraschalluntersuchung oder Fruchtwasserpunktion (Amniozentese) an. Falls sich ein Mädchen ankündigt, kann die Frau sich zu einem induzierten Schwangerschaftsabbruch entscheiden, oft nicht nur um sich des Mädchens zu entledigen, sondern auch, um möglichst bald wieder schwanger werden zu können, in der Hoffnung, dass sich dieses Mal der Wunsch nach einem Sohn erfüllen möge.
Ab 1974 wurden vorgeburtliche Untersuchungen zunächst in staatlichen Kliniken zur Kontrolle des Schwangerschaftsverlaufs eingesetzt. Diese Untersuchungen werden meist am Ende des vierten Schwangerschaftsmonats durchgeführt und sollen zur Feststellung schwerer Erbkrankheiten dienen. Die mögliche Geschlechtsbestimmung war zunächst nur nebensächlich. Vielmehr stand die Gesundheit des Fetus im Vordergrund des Interesses, so wollte man beispielsweise ausschließen, dass eine Hämophilie oder ein Down Syndrom besteht. Erst mit der Zeit wurde bemerkt, dass das Wissen um einen weiblichen Fetus häufig eine Abtreibung nach sich zog (Chandrasekhar 1994; Jeffrey, Jeffrey & Lyon 1984; Menon 1996). Der Versuch, die vorgeburtlichen Untersuchungen zur Geschlechtsbestimmung staatlich zu verbannen, förderte ihre Etablierung in privaten Einrichtungen, da die Nachfrage groß blieb (Menon 1996; Ram 1998). Sogar in Gegenden, wo es kein Trinkwasser gab, wurden entsprechende Untersuchungen angeboten (Balakrishnan 1994). Werbung machte auf die neue Technologie aufmerksam (vgl. Abbildung 2, 3).
Werbung für vorgeburtliche Geschlechtsbestimmung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Anzeige aus Times of India, Abbildung 5: Plakatwerbung,
Delhi Edition vom 25.9.1988 (Patel 1989)The Hindu 2001
Seit 1987 gibt es in Maharahstra ein Verbot dieses Vorgehens. 1994 wurde für ganz Indien ein Gesetz erlassen, der Prenatal Diagnostic Techniques Regulations and Prevention of Misuse Act, der die Durchführung vorgeburtlicher Untersuchungen zur Geschlechtsbestimmung mit dreijährigem Gefängnisaufenthalt oder einer Buße von 14.000 Rs. für den Mediziner bestraft (Madhok & Raj 2004) . Dieses Verbot hat laut Ram (1998) keine wesentliche Beschränkung der Technik nach sich gezogen. Lediglich die Werbekampagnen sind inzwischen seltener. Die Befürworter sehen hier eine Möglichkeit zur langfristigen Reduzierung der Bevölkerungszahl (Chandrasekhar 1994; Jeffrey et al. 1984; Menon 1996; Ram 1998).
4. Kulturelle Besonderheiten Indiens
Im Folgenden sollen einige in Indien weit verbreitete kulturelle Phänomene benannt werden, die zum Verständnis der Psychologie des Schwangerschaftsabbruchs notwendig sind. Zunächst stehen ausgewählte religiöse Konzepte im Blickpunkt. Anschließend wird auf bedeutsame gesellschaftliche Strukturen hingewiesen.
4.1 Religion
Der größte Teil der indischen Bevölkerung gehört dem Hinduismus an. Dessen Denkweise hat in Indien insgesamt starken Einfluss genommen. Die „Hindu-Zivilisation [hat] einen Löwenanteil zum „kulturellen Genpool“ der indischen Völker geleistet“ (Kakar & Kakar 2006, S. 9). Daher sollen hier zur thematischen Einordnung nur einige Grundzüge dieser Religion beschrieben werden. Mit dieser Vorgehensweise lehnt sich die Autorin an Kakar (1988), Sineath (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten21) und Kakar und Kakar (2006) an.
4.1.1 Hinduismus
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kaste, die durch die Geburt im Sinne der Weltordnung festgelegt wurde, bestimmt die Zugehörigkeit zum Hinduismus.
Im Hinduismus besteht keine allgemeingültige religiöse Dogmatik, sondern eine große Variabilität, Monotheisten sind genau wie Polytheisten anzutreffen. Eine Vielzahl von religiösen Riten und Praktiken sowie zahlreiche hinduistische Richtungen und Schulen existieren (Petzold 1986). Im Laufe der Zeit vermischten sich hinduistische Praktiken mit den verschiedenen Volksreligionen, sodass große regionale Unterschiede zum Beispiel in der Gestaltung von Festen vorzufinden sind. Es ist unmöglich, den Hinduismus zu definieren, da es keine Institutionen oder Glaubensinhalte gibt, die spezifizierend und für alle Hindus verbindlich sind. Von vielen geteilt werden die zentralen Ideen über dharma, karma und moksha (Kakar 1988; Kakar & Kakar 2006; Petzold 1986), weshalb diese hier kurz vorgestellt werden. Im Anschluss wird auf hinduistische Vorstellungen eingegangen, die für das Thema des Schwangerschaftsabbruchs von Bedeutung sind. Das im hinduistischen Weltbild verankerte Frauenbild wird ebenso benannt wie der angenommene Zeitpunkt des Lebensbeginns.
4.1.1.1 Dharma
Das Sanskritwort dharma stammt aus der Wurzel dhri (Sanskrit, „halten, tragen, befördern“) und bedeutet „das, was zusammenhält, aufrecht erhält, erhält“ (Zimmer 2001). Zum ersten Mal im Rigveda erwähnt, hat der Begriff bis jetzt zahlreiche Interpretationen und Umdeutungen erfahren (Kakar 1981). Heute wird dharma üblicherweise mit „Gesetz“, „moralischer Pflicht“, „richtigem Handeln“ oder „eins sein mit der Wahrheit der Dinge“ übersetzt.[3]
Das Konzept des dharma ist im Hinduismus zentral und umfasst sowohl einen individuellen als auch einen sozialen Aspekt. Einerseits ist die persönliche Lebensaufgabe angesprochen, die durch stufenweise aufeinander folgende Lebenszyklen festgelegt ist, andererseits die Eingebundenheit in die Gesellschaft mit bestimmten Aufgaben und Verpflichtungen durch die angeborene Kastenzugehörigkeit. Durch die Erfüllung des dharma wird die Erlösung von irdischem Leid erreicht. Theoretisch stehen in ihrer Wertigkeit die verschiedenen Kasten und Lebensaufgaben gleich nebeneinander. Jeder hat seine Pflicht und es ist besser, die eigene Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen, als nach der Aufgabe eines anderen zu trachten.
Besser das eigene dharma, auch wenn es keinen Ruhm verspricht, erfüllen, als das eines anderen; der Tod im eigenen dharma ist rühmenswert, das Leben in dem eines anderen furchterregend (Bhagavat Gita III, 35, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten 1).
Es gibt reine und unreine Tätigkeiten, die Tugend des Einzelnen wird aber danach bemessen, inwieweit er sein dharma erfüllt. Nach Kakar (1981, S. 55) handelt es sich um einen grundlegenden Glauben an die „allgemeine, persönliche Gleichheit aller Menschen,… der [in der Realisierung] aber nicht das Versprechen einer egalitären Gesellschaft hält“.
Die sozialen Aufgaben der einzelnen Kastenmitglieder sind zum Beispiel in den Gesetzen des Manu beschrieben.
To Brâmanas he assigned teaching and studying (the Veda), sacrificing for their own benefit and for others, giving and accepting (of alms) (Bühler 1964, I88).
Kshatriyas sollen im Unterschied dazu die Veden studieren, nicht lehren, Opfer darbringen, außerdem Menschen beschützen und sich von sinnlichen Vergnügen fern halten. (Bühler 1964, I89). Vaisya sollen ebenfalls Opfer darbringen, die Veden studieren, Vieh züchten, Land kultivieren, Handel betreiben und Geld verleihen (Bühler 1964, I90). Den Sudras wurde allein die Aufgabe zugeteilt, den anderen drei Kasten zu dienen (Bühler 1964, I91).
Wie die individuellen Verpflichtungen und Aufgaben eines Einzelnen aussehen, ist schwer festzulegen, da sein dharma durch eine Vielzahl von Aspekten bestimmt wird. Insbesondere vier Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Kultur, in die er lebt (desa), die Zeit, zu der er lebt (kala), die angeborenen psychischen und biologischen Eigenschaften (guna) und die Aufgaben während der verschiedenen Lebensphasen (srmam), die weiter unten näher beschrieben werden. Handlungen eines Menschen können nur in Zusammenhang mit diesen Faktoren verstanden werden. Ein Mensch kann sein dharma niemals vollständig kennen und es auch nicht wesentlich beeinflussen.
Nach hinduistischer Vorstellung folgt das Leben bestimmten, festgelegten Entwicklungsphasen, die einander stufenweise ablösen. Für jede Entwicklungsstufe sind klare Aufgaben definiert, deren Erfüllung als wesentlicher Bestandteil der persönlichen Verpflichtungen eines Einzelnen angesehen wird und notwendig für die Erreichung von moksha (vgl. Kapitel 4.1.1.3) ist. Gleichzeitig sind die Stufen an bestimmte Altersphasen gebunden, wobei ein Abweichen zum Beispiel durch vorzeitige Beschäftigung mit einer für spätere Zeit bestimmten Aufgabe als Unzulänglichkeit angesehen wird. Die Stufen des idealen Lebens eines Mannes sind in Tabelle 2 dargestellt (nach Kakar 1981).
Tabelle 2:
Entwicklungsstufen eines hinduistischen Mannes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die erste Stufe dient dem Erwerb von Wissen durch einen Lehrer und endet mit der Eheschließung, traditionell in einem Alter von 16 Jahren. Während der zweiten Stufe ist es Aufgabe eines Mannes, Opfer zu vollbringen, die Familie zu versorgen und Kinder, insbesondere Söhne zu zeugen. Im Alter wird ein zunehmender Rückzug aus weltlichem Geschehen erwartet, der mit der dritten Stufe in Form von einer Intensivierung der Meditationstätigkeit beginnt und ihren Höhepunkt in der Abkehr von allem Weltlichen in der vierten Stufe findet (Srinivas 1962).
Bereits aus dieser stark verkürzten Darstellung ist die existenzielle Bedeutung der Eheschließung und Zeugung von Nachkommen ersichtlich. Die populäre Redewendung „nur wer ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt und einen Sohn aufgezogen hat ist bereit für die letzten Dinge.“ (zitiert nach Kakar 1981, S. 59) unterstreicht die Notwendigkeit zur Erfüllung des dharma, nicht nur Kinder, sondern speziell einen Sohn zu zeugen.
Bereits die Kindheit ist in verschiedene Perioden eingeteilt, die rituell aneinander anschließen und die wachsende Integration des Kindes in die Gesellschaft beschreiben. Dabei erhält die Phase vor der Geburt besondere Bedeutung. Wichtig für eine positive charakterliche Entwicklung des Kindes ist bereits in dieser Zeit die Unterstützung und positive Beeinflussung seiner durch Erbe, Konstitution und Karma festgelegten Eigenschaften. Maßgeblich für die Entwicklung des Kindes ist das Wohlergehen der Mutter, deren Wünsche während der Schwangerschaft wenn möglich vollständig erfüllt werden sollten. Von den Wünschen der Mutter wird auf zukünftige Eigenschaften des Kindes geschlossen, so soll beispielsweise ihr Wunsch, einen König zu sehen, auf späteren Reichtum und Berühmtheit des Kindes hindeuten (Petzold 1986). Es wird angenommen, dass die Zufriedenheit der Mutter vom Embryo bewusst wahrgenommen wird. Was die Bedeutung des Wunsches einer Frau nach vorzeitiger Beendigung ihrer Schwangerschaft angeht, so dürfte nach Ansicht der Autorin entsprechendes gelten.
Die Frage, was einen Mensch davon abhalten kann, im dharma zu leben, leitet über zum nächsten wichtigen Begriff, karma.
4.1.1.2 Karma
Der Sanskritbegriff karman bedeutet in der Übersetzung „Wirken“ oder „Tat“ (Kakar 1988). Bezeichnet wird eine unabänderliche Gesetzmäßigkeit, die alles Leben umfasst. Nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung zieht jede Handlung eine Konsequenz nach sich. Die Konsequenzen für den Handelnden bilden sein Karma. Es ist hierbei nicht eine Beurteilung des Handelnden durch einen Weltenrichter oder Gott gemeint, der strafend oder lobend über das Geschehen der Erde wacht, sondern eine zwangsläufige Folge seiner Handlung, die in der Natur der Welt begründet liegt und nicht vermieden werden kann (Zimmer 2001).
Petzold (1986 S. 60) beschreibt die hinduistische Auffassung von karma als eine „moralische Vergeltungskausalität aller Taten“, nach der jedes Lebewesen seinen Platz in der Welt aufgrund seiner vorausgehenden Handlungen sowohl in vorherigen als auch in diesem Leben erhält. Bereits ein Neugeborenes verdankt seine Konstitution und die Umstände seiner Geburt seinem Karma, weshalb die Natur des Kindes nicht als beliebig formbar angesehen wird (Kakar 1986). Die persönliche Verantwortung eines Einzelnen fokussiert sich auf die Erfüllung des dharmas, damit der Mensch in späteren Zeiten auf Gutes hoffen kann und letztendlich nach zahlreichen Wiedergeburten moksha erreichen kann.
4.1.1.3 Moksha
Der Begriff moksha wird nach Kakar (1981, S. 27) mit „Selbstverwirklichung“, „Transzendenz“ oder „Erlösung“ übersetzt. Gemeint ist ein Zustand oder Daseinsstadium, in dem alle Unterschiede zwischen Subjekt und Objekt aufgehoben sind. Der Gedanke an die Erlösung von allem irdischen Leid steht dahinter. Die Erreichung von moksha gilt als höchstes Ziel des Menschen, als seine Bestimmung. Kakar (1988) benennt die Idee des moksha als „zentral für das Erscheinungsbild der [hinduistischen] Kultur.“ (S. 28). Zimmer (2001, S. 304) sieht als „Hauptmotiv der vedischen Philosophie die[se] ständige Suche nach der letzten Einheit“.
Jedes neugeborene Wesen ist nach hinduistischer Sichtweise mit einer individuellen Mischung dreier fundamentaler Qualitäten (gunas) ausgestattet: Helligkeit (sattva), Begierde (rajas) und Dunkelheit (tamas). Zugleich besteht ein natürliches Streben nach Licht, wobei dieser Tendenz Begierden und Dunkelheit entgegenstehen. Die Ausprägung der einzelnen Qualitäten ist individuell verschieden und im Laufe des Lebens veränderlich durch Handlungen und Gedanken. Das bedeutet, dass die Menschen unterschiedlich starke Bemühungen aufbringen müssen, um ihr dharma zu erfüllen und zu moksha gelangen zu können. (Kakar 1981)
Erst im Zustand von moksha ist es möglich, die Wirklichkeit an sich zu erkennen. Zuvor unterliegt der menschliche Geist zahlreichen Verblendungen durch persönliche Vorlieben und Abneigungen, welche die Wirklichkeit zu einer bloßen Erscheinung werden lassen, die illusorisch ist (maya). Kakar (1981) sieht hier einen wesentlichen Unterscheid zum Denken westlicher Psychologen, da diese das Alltagsbewusstsein des Menschen mit Realitätsprüfung und entsprechenden Grenzen ins Zentrum der Betrachtung setzen und nicht dessen Überwindung anstreben.
4.1.1.4 Das Bild der Frau
Die Stellung der Frau in der heutigen, hinduistisch geprägten Gesellschaft, wie sie im Kapitel 5.2 beschrieben wird, ist zu einem Teil zurückzuführen auf das traditionell hinduistische Frauenbild, welches aus diesem Grund im nächsten Absatz in einigen zentralen Punkten kurz beschrieben wird.
Im Allgemeinen wird angenommen, dass Frauen zur Zeit der Veden (etwa 1500 v. Chr. bis 500 v. Chr.) einen hohen gesellschaftlichen Status innehatten. Es soll größere Freiheit bezüglich der Partnerwahl und Hochzeit bestanden haben, die Teilnahme an religiösen Ritualen möglich gewesen sein und die Position in der Familie respektvoll. Luthra (1990) beschreibt diese Vergangenheit nicht ohne kritische Zweifel an diesem überaus guten Bild. Chanana (2001) betont, dass sich die Gelehrten bezüglich der im Laufe der Zeit im Hinduismus geschehenen Veränderungen zu Ungunsten der Frauen einig seien.
In vedischen Versen wird um die Geburt von Söhnen gebetet und Lobgesänge, sowie Abhandlungen vernachlässigen die Existenz von Töchtern völlig, „die Geburt von Mädchen gewähre sonst wo, hier gewähre einen Sohn“ (Atharveda, zitiert nach Kakar 1981, S. 75). In verschiedenen alten Texten werden Töchter als eine Quelle von Elend und Söhne als Glückbringer bezeichnet, wofür Kakar (1981) ökonomische Gründe annimmt. Ein alter Ritus namens Pumsavana, der nach Kakar (1981) noch heute bei Schwangeren vollzogen wird, hat das Ziel, die Geburt eines Sohnes sicherzustellen, sogar notfalls noch das Geschlecht des Fetus zu verändern.
Bis zum Beginn der Pubertät wird ein Mädchen als rein angesehen, als „Verkörperung einer Göttin“ (Petzold 1986, S. 216). Sie kann zur Vergebung von Sünden beitragen, wenn der Sünende ihre Füße berührt. Mit Einsetzen der Pubertät ändert sich diese Situation. Während der Menstruation gilt ein Mädchen als unrein und unterliegt zahlreichen Beschränkungen, beispielsweise ist ihr verboten, Essen zuzubereiten oder an Familienfeiern teilzunehmen (Kakar 1981). Für eine Heirat ist die Jungfräulichkeit der Braut absolute Bedingung. Sie wird als „kanyadaan“, „das Geschenk einer Jungfrau“ vom Brautvater an die Schwiegerfamilie dargebracht (Kakar 1981; Uberoi 1993).
Das Idealbild einer „guten“ Hindu(haus)frau existiert nach Chanana (2001) kontinuierlich durch die verschiedenen Zeitepochen. Die ideale Frau wird bis heute im Bewusstsein der Hindus durch Sita personifiziert, die Heldin des populären Epos Ramayana. Sie ist die „Quintessenz weiblicher Hingabe“ (Kakar 1981, S. 82) und für die Vorstellungswelt der Hindus die lebendige Wesenheit einer treuen, selbstlos liebenden Ehefrau. Trotz schlechter Behandlung durch ihren Gatten scheut sie keine Mühsal, ihm zu dienen und zu folgen. Sita ist das Ideal der „Keuschheit, Reinheit, zärtlichen Sanftheit, einzigartigen Treue“ (Kakar 1981, S. 86), das nie durch das Verhalten des Mannes beeinträchtigt werden kann. Nach diesem Vorbild sollen dann auch die indischen Ehefrauen streben. „Eine gute Ehefrau zu sein bedeutet per definitionem eine gute Frau zu sein“ (Kakar 1981, S. 87). Trotz vielfältiger Veränderungen in der indischen Gesellschaft beherrscht dieses Idealbild weiterhin nicht nur die innere Vorstellungswelt der Inder, sondern auch die Beziehungen innerhalb der Familie.
In den Gesetzen des Manu werden die Pflichten einer Ehefrau detailliert beschrieben. So wird auch hier betont, dass sie ihren Mann ehren soll, selbst wenn dieser es nicht verdient “though destitue in virtue, or seeking pleasure (elsewhere), or devoid of good qualities, (yet) a husband must be constantly worshipped as a god by a faithful wife.” (Bühler 1964, V, 154). Bei Zuwiderhandlung dieses Gebots muss die Frau mit Bestrafung rechnen, „by violating her duty towards her husband, a wife is disgraced in this world, (after death) she enters the womb of the jackal, and is tormented by diseases for (the punishment of) her sin” (Bühler 1964, V 164). Es wird allerdings auch eine rücksichtsvolle, versorgende Haltung den Frauen gegenüber gefordert, “where women are honoured, there the gods are pleased; but where they are not honoured, no sacred rite yields rewards” (Bühler 1964, III, 56). Die Wichtigkeit der Elternschaft wird besonders hervorgehoben, “to be mothers were women created, and to be fathers men;...” (Bühler 1964, IX, 96). Auch Manu betont die Notwendigkeit zur Geburt eines Sohnes, damit die rituellen Verehrungen zum Seelenheil der Ahnen durchgeführt werden können, wodurch diese vor der Hölle bewahrt werden, “because a son delivers his father from the hell called Put, he was herefore called Put-tra (a deliverer from Put) by the Self-existant himself“ (Bühler 1964, IX, 138).
Dem bewussten Ideal der weiblichen Reinheit steht bei vielen Indern die heimliche Befürchtung vor weiblicher Treulosigkeit entgegen (Kakar & Kakar 2006). Kakar (1994) spricht in diesem Zusammenhang von einer verbreiteten „Angst vor der reifen, weiblichen Sexualität“ (S. 118, vgl. auch Das 1990). Er beschreibt die „Spaltung in eine Mutter und eine Hure“ (Kakar 1994, S. 27; vgl. auch Gupte 1987), bei der er auf die Freudsche Vorstellung von einer Abspaltung der Sexualität von der Zärtlichkeit rekurriert. Die dem Mann zugehörigen Frauen werden idealisiert, sie sind in seiner Vorstellung höher und reiner als er selbst, was seine Impotenz in Kontakt mit ihnen bewirken kann, wobei er in diesem Fall gleichzeitig seine Sexualität mit einer abgewerteten Frau einer niedrigen Sozialschicht lebt.
Diese Zweiteilung der Frau in Mutter und Hure ist für das Verständnis der offiziellen Haltung dieser Kultur gegenüber Frauen und Ehefrauen entscheidend … . Nur in ihrer Rolle als weibliches sexuelles Wesen ergießt sich die Abscheu und der Hohn der patriarchalen Gesellschaft über die unglückliche Ehefrau (Kakar 1994, S. 28).
Die Verehrung weiblicher Gottheiten nimmt im Hinduismus einen bedeutenden Platz ein (Das 1990; Kakar 1981; Sineath 2004). Der Stärke und Kraft der Weiblichkeit (shakti) wird vielerorts rituell gehuldigt. Nandy (1990) spricht sogar von einer Dominanz des Weiblichen in der indischen Symbolwelt. Aktivität, Wettbewerb, Aggression, Kraft, Intuition sind mit dem Weiblichen verbunden, nicht wie im Westen mit dem Männlichen. In jeder Frau wird die universell weiblich göttliche Kraft (shakti) als anwesend erachtet. Aufgabe der Frauen ist es, diese Kraft zu erhalten und zu Gunsten der Gemeinschaft zu nutzen, wodurch sich ihre Stärke erhöht und das Gleichgewicht der Schöpfung erhalten bleibt (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten21).
[...]
[1] Bei statistischen Zahlenangaben ist zu beachten, dass die Registrierung von Geburten, Todesfällen und Hochzeiten in Indien noch unvollständig ist (Bandhyopadhyay 2003). Dennoch sollen in der vorliegenden Arbeit die zur Verfügung stehenden Zahlenangaben als Richtwerte genutzt werden.
[2] außerhalb der Ehe
[3] Die Nennung der Sanskritbegriffe ist nicht ganz unproblematisch, da sie meist mehrdeutig sind und daher eine einfache Übersetzung fehlerbehaftet. Boss (1987) betont, dass im Sanskrit der Substantiv weniger im Zentrum steht als der verbale Aspekt eines Wortes, was zu einem völlig anderen Bedeutungsschwerpunkt führt. So wird beispielsweise beim Ballen einer Hand eher vom „Fausten“ gesprochen, um die momentane, vorübergehende Seinsweise der Hand zu betonen, als von einer Faust als einer unabhängigen Begebenheit. Überträgt man dieses kleine Beispiel auf die Übersetzung der hier genannten Begriffe, wird das Ausmaß an möglichen Missverständnissen durch eine schnelle Übersetzung deutlich.
Zudem darf die Übersetzung nicht mit westlicher Konnotation aufgefasst werden, da sich das zugehörige Gedankensystem unterscheidet. Dies zeigt sich auch darin, dass selbst erfahrene Autoren sich in ihren Übersetzungen unterscheiden. Eine Gleichsetzung mit entsprechenden psychologischen Konzepten im für den Westen üblichen Verständnis soll darüber hinaus hier nicht indiziert sein.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836608572
- DOI
- 10.3239/9783836608572
- Dateigröße
- 1.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Psychologie, Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- schwangerschaftsabbruch abtreibung indien frauen ethnopsychologie
- Produktsicherheit
- Diplom.de