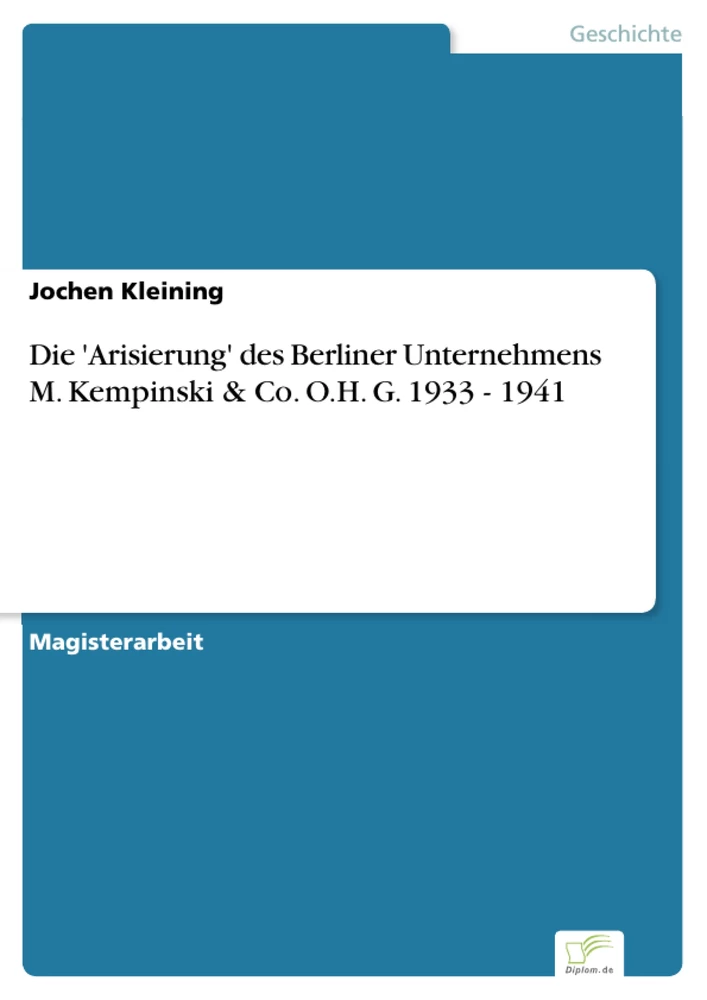Die 'Arisierung' des Berliner Unternehmens M. Kempinski & Co. O.H. G. 1933 - 1941
Zusammenfassung
Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit im nationalsozialistischen Deutschland ist einer der größten Besitzwechsel in der jüngeren deutschen Geschichte und in seinen Ausmaßen nur von den Enteignungen der SBZ/DDR übertroffen. In einem historisch einmaligen Vorgang wurde die Beraubung einer rassisch definierten Minderheit arbeitsteilig von einem modernen Staat und privaten Individuen durchgeführt. Im gewissen Gegensatz zur Ermordung der europäischen Juden in den Vernichtungslagern des Ostens fand die Arisierung in der Mitte der Gesellschaft, für jeden sichtbar, statt. Eine Unzahl von Menschen war daran beteiligt oder profitierte davon. Deshalb zeigen gerade diese Arisierungen, in welchem Ausmaß breite Teile der deutschen Gesellschaft an der antisemitischen Politik der Nationalsozialisten teilhatten.
Die vorliegende Magisterarbeit soll einen Beitrag zur Regionalforschung über die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit im nationalsozialistischen Berlin leisten. Dies soll geschehen anhand einer Analyse der Arisierung des Berliner Unternehmens M. Kempinski & Co.. Zunächst eine Weingroßhandlung, wurde der Name Kempinski schnell zum Markenzeichen für gehobene Gastronomie in Berlin. Die beiden Restaurants in der Leipziger Straße und am Kurfürstendamm entwickelten sich zu einer Bühne für das gesellschaftliche Leben der Reichshauptstadt. Das von Kempinski betriebene und 1929 eröffnete Haus Vaterland schließlich galt als größter Gastronomiebetrieb der Stadt, war mit seiner Kombination aus Varieté, Bar und Restaurant und den zehn Themensälen einzigartig und begründete den Begriff der Erlebnisgastronomie. Kempinski war eines der prominentesten jüdischen Unternehmen der Stadt, mit einem Bekanntheitsgrad weit über ihre Grenzen hinaus. Die Vorgänge die zur Arisierung Kempinskis führten, sind somit ein wichtiger Beitrag für das Verständnis der Ausschaltung jüdischer Gewerbetätigkeit in Berlin insgesamt.
Diese Stadt Berlin wiederum ist von besonderer Bedeutung sowohl für die deutsche Wirtschaft als auch für das deutsche Judentum. Berlin war nicht nur kulturelles Zentrum sondern auch die bedeutendste Industriemetropole Europas und mit der Berliner Börse einer der wichtigsten Finanzplätze des Kontinents. Zugleich war Berlin der unumstrittene Mittelpunkt jüdischen Lebens in Deutschland. Hier lebten mit 170.000 etwa ein Drittel aller Juden des Reiches. Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit in der Reichshauptstadt ist […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung der Arbeit
1.2 „Arisierung“ – eine Definition
1.3 Methodisches Vorgehen
1.4 Aufbau der Arbeit und thematische Abgrenzung
1.5 Quellenlage
1.6 Forschungsüberblick
2. Hauptteil
2.1 Rahmenbedingungen
2.1.1 Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit im „Altreich“
2.1.1.1 Weimarer Antisemitismus, Machtergreifung und –konsolidierung der NSADP
2.1.1.2 Die „Schleichende Verfolgung“ 1935-1938
2.1.1.3 Der gesetzliche Ausschluss der Juden aus der Wirtschaft
2.1.2 „Arisierung“ als gesellschaftlicher Prozess
2.1.2.1 Das gesellschaftliche Umfeld
2.1.2.2 Die Praxis der „Arisierungen“
2.1.3 Berlin
2.1.3.1 Demographie und die Tradition des Antisemitismus
2.1.3.2 Berliner Behördenmaßnahmen ab 1933
2.2 Das Unternehmen Kempinski
2.2.1 Vorgeschichte des Unternehmens 1862-1928
2.2.2 Die Weltwirtschaftskrise 1929-1933
2.2.3 „Arisierung“ als gesellschaftlicher Prozess
2.2.3.1 Der Boykott 1933/34
2.2.3.2 Kündigung von Geschäftsbeziehungen
2.2.3.3 Die Funktion der Banken, innerbetriebliche Spannungen
2.2.3.4 Kapitalschwund und Sparmaßnahmen
2.2.4 Die Betriebsübernahme 1936/37
2.2.4.1 Im Vorfeld der Verhandlungen
2.2.4.2 Die Übernahmeverhandlungen
2.2.4.3 Der Übernahmevertrag
2.2.5Die Abwicklung und „Arisierung“ der Rest-OHG 1937-1941
2.2.5.1 Emigration der Inhaber und Abwicklung des Restunternehmens
2.2.5.2 Das Zusatzprotokoll vom 31. Januar 1939
2.2.5.3 Die „Arisierung“ der Rest-OHG
3. Schlussbemerkungen
4. Quellen und Literatur
5. Anlagen
1 Einleitung
1.1 Erkenntnisinteresse und Fragestellung der Arbeit
Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit im nationalsozialistischen Deutschland ist einer der größten Besitzwechsel in der jüngeren deutschen Geschichte und in seinen Ausmaßen nur von den Enteignungen der SBZ/DDR übertroffen.[1] In einem historisch einmaligen Vorgang wurde die Beraubung einer rassisch definierten Minderheit arbeitsteilig von einem modernen Staat und privaten Individuen durchgeführt.[2] Im gewissen Gegensatz zur Ermordung der europäischen Juden in den Vernichtungslagern des Ostens fand die „Arisierung“ in der Mitte der Gesellschaft, für jeden sichtbar, statt. Eine Unzahl von Menschen war daran beteiligt oder profitierte davon. Deshalb zeigen gerade diese „Arisierungen“, in welchem Ausmaß breite Teile der deutschen Gesellschaft an der antisemitischen Politik der Nationalsozialisten teilhatten.
Die vorliegende Magisterarbeit soll einen Beitrag zur Regionalforschung über die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit im nationalsozialistischen Berlin leisten. Dies soll geschehen anhand einer Analyse der „Arisierung“ des Berliner Unternehmens „M. Kempinski & Co.“.[3] Zunächst eine Weingroßhandlung, wurde der Name „Kempinski“ schnell zum Markenzeichen für gehobene Gastronomie in Berlin. Die beiden Restaurants in der Leipziger Straße und am Kurfürstendamm entwickelten sich zu einer Bühne für das gesellschaftliche Leben der Reichshauptstadt. Das von Kempinski betriebene und 1929 eröffnete „Haus Vaterland“ schließlich galt als größter Gastronomiebetrieb der Stadt, war mit seiner Kombination aus Varieté, Bar und Restaurant und den zehn Themensälen einzigartig und begründete den Begriff der „Erlebnisgastronomie“. Kempinski war eines der prominentesten jüdischen Unternehmen der Stadt, mit einem Bekanntheitsgrad weit über ihre Grenzen hinaus. Die Vorgänge die zur „Arisierung“ Kempinskis führten, sind somit ein wichtiger Beitrag für das Verständnis der Ausschaltung jüdischer Gewerbetätigkeit in Berlin insgesamt.
Diese Stadt Berlin wiederum ist von besonderer Bedeutung sowohl für die deutsche Wirtschaft als auch für das deutsche Judentum. Berlin war nicht nur kulturelles Zentrum sondern auch die bedeutendste Industriemetropole Europas und mit der Berliner Börse einer der wichtigsten Finanzplätze des Kontinents.[4] Zugleich war Berlin der unumstrittene Mittelpunkt jüdischen Lebens in Deutschland. Hier lebten mit 170.000 etwa ein Drittel aller Juden des Reiches. Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit in der Reichshauptstadt ist somit ein zentraler Aspekt der „Arisierung“ insgesamt, seine fast gänzlich ausgebliebene Untersuchung ein großes Desiderat sowohl der NS-Forschung als auch der Regionalgeschichte.
Die Magisterarbeit ist als Fallstudie im Kontext des Forschungsprojektes „Ausgrenzungsprozesse und Überlebensstrategien. Mittlere und kleine jüdische Gewerbe-Unternehmen in Berlin 1929/30 bis 1945“ entstanden. Mit einer detaillierten Rekonstruktion der Vorgänge bei einem der bekanntesten jüdischen Unternehmen Berlins soll dargelegt werden, welche Verlaufsformen „Arisierungen“ in Berlin annehmen konnten, in welchem zeitlichem Rahmen diese stattfanden, sowie welche Akteure an den Vorgängen beteiligt waren. Darüber hinaus wird die dem Projekt eigene Forschungshypothese und –perspektive adaptiert: „Die Beendigung ihrer Wirtschaftstätigkeit wird […] einem längeren Prozess zugeordnet, dessen Rekonstruktion den jüdischen Unternehmer nicht nur als Opfer, sondern auch als aktiv handelnden Unternehmer zeigt.“[5] Welche Handlungsspielräume boten sich den jüdischen Inhabern Kempinskis angesichts einer sich zunehmend verschärfenden antijüdischen Politik der Nationalsozialisten? Welche Strategien verfolgten sie, um diesem Umfeld zu begegnen? Die vorliegende Arbeit versucht, die Handlungsstrategien der jüdischen Inhaber zu rekonstruieren und aufzuzeigen, wie diese auf die zunehmend feindlicher werdende Umwelt reagierten.
1.2 „Arisierung“ – eine Definition
Der Begriff „Arisierung“ hat seinen Ursprung im völkisch-antisemitischen Gedankengut der Weimarer Republik.[6] Er wurde schnell von der nationalsozialistischen Publizistik übernommen und zu einem zentralen Propagandabegriff aufgebaut. Dabei lag dem Ausdruck keine genaue Definition zugrunde. Allgemein war damit, synonym zum ebenfalls gebräuchlichen Begriff „Entjudung“, die Verdrängung der Juden aus dem deutschen Berufs- und Wirtschaftsleben gemeint.[7] Mit Beginn des Verdrängungsprozesses differenzierte sich der Begriff insofern, als dass jetzt mit „Arisierung“, in Abgrenzung zu „Liquidation“, das spezielle Phänomen des Transfers von Unternehmensbesitz in „arische“ Hände beschrieben wurde.[8]
Trotz der problematischen Verwendung eines derart vorbelasteten Begriffes, überwiegt in der Forschung die Meinung, dass eine weitere Verwendung legitim und auch ohne Alternative ist, allerdings kritisch und problembewusst erfolgen muss.[9] Dennoch bleibt die Begrifflichkeit nach wie vor unpräzise und wird in der Forschung unterschiedlich gehandhabt. Zum einen gibt es Tendenzen, die zahlreichen Facetten der „Arisierung“ auch begrifflich zu differenzieren.[10] Zum anderen sind einiger Historiker bestrebt, den Begriff so zu erweitern, dass er alle Aspekte des Raubs an den europäischen Juden umfasst, bis hin zur Verwertung der sterblichen Überreste der Ermordeten in den Vernichtungslagern.[11]
In dieser Arbeit soll der Begriff nur für den Prozess der Verdrängung jüdischer Gewerbetreibenden aus dem deutschen Wirtschaftsleben verwendet werden.[12] Dies schließt zum einen die Entlassung jüdischer Angestellter, zum anderen die Ausplünderung der Juden bei Emigration und Deportation aus. Mit einer derartig verengten Verwendung des Wortes „Arisierung“ verbinden sich jedoch weitere Probleme. Erstens verschleiert der Begriff, dass viele jüdische Unternehmen überhaupt nicht in „arische“ Hände übergingen. Ein großer Teil von ihnen wurde liquidiert.[13] In speziellen Kontext von Liquidation und Verkauf soll „Arisierung“ in dieser Arbeit demnach in einer engeren Definition die Übertragung jüdischen Gewerbes in „arische“ Hände bezeichnen. Zweitens rückt der nationalsozialistische Sprachduktus die jüdischen Akteure vor allem als passive Opfer in den Blick und blendet aus, dass sie Handlungsspielräume entwarfen, die für das Verständnis der Vorgänge wesentlich sind. Diese Opferperspektive soll, wie einleitend beschrieben, in dieser Arbeit erweitert werden. Drittens schließlich erschwert der punktuelle Begriff „Arisierung“ die Erkenntnis, dass es sich dabei um einen langfristigen Prozess handelte, der sich schrittweise vollzog. Im Gegensatz zu den nach 1938/39 angegliederten bzw. okkupierten Gebieten, in denen ein bürokratischer Zentralismus dominierte, war die „Arisierung“ im Altreich ein lange andauernder Prozess, der zunächst schleichend begann und nach mehreren Radikalisierungsschüben 1938/39 seinen Höhepunkt erreichte. „Arisierung“ meint daher nicht nur den eigentlichen Verkauf des Unternehmens an „arische“ Käufer, sondern gerade auch den langsamen Prozess der Verdrängung, der wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und enger werdenden Handlungsspielräume.[14]
Bis 1938 gab es bemerkenswerterweise weder ein zentrales Arisierungs- oder Enteignungsgesetz, noch vollzog sich die „Arisierung“ unter der Regie einer zentralen Genehmigungsinstitution. Ein etatistisches Verständnis der nationalsozialistischen Judenpolitik, das Ausgrenzung und Verfolgung in erster Linie als eine Abfolge legislativ-administrativer Maßnahmen versteht, greift deshalb zu kurz. In kaum einem anderen Bereich der Judenpolitik gab es zudem eine ähnlich hohe Zahl von Akteuren und Profiteuren.[15] Folglich muss „Arisierung“ auch als ein sozialer Prozess, an dem die deutsche Gesellschaft in vielfältiger Weise beteiligt war. Der Begriff muss, so auch die Forderung von Frank Bajohr, um eine gesellschaftsgeschichtliche Perspektive erweitert werden, um bestimmte Verhaltensmuster in der Gesellschaft zu analysieren.[16]
1.3 Methodisches Vorgehen
Eine erste methodische Prämisse dieser Arbeit ist schon angedeutet. Jenseits von intentionalistischen oder strukturalistischen Ansätzen wird „Arisierung“ hier vor allem als ein gesellschaftlicher Prozess, als soziale Praxis, aufgefasst. Diese Praxis schließt verschiedene Akteure mit ein, darunter Banken, Unternehmen und Prüfungsgesellschaften - nicht zuletzt auch die Bevölkerung als Kundschaft des jüdischen Unternehmens. Jeder dieser Akteure verfolgte eigene Interessen, die mitunter sogar vorübergehend mit denen der jüdischen Inhaber konvergieren konnten. Der Staat (vertreten durch die mit der „Arisierung“ befassten lokalen Behörden) erscheint nur als einer von vielen Teilen der Gesellschaft, die an der „Arisierung“ Kempinskis beteiligt waren.
Ein zweiter methodischer Ansatz wurde ebenfalls schon angedeutet. Historiker laufen Gefahr, die nationalsozialistische Judenpolitik stets von ihrem grausamen Ende, der Vernichtung der europäischen Juden zu denken. Dabei wird schnell außer Acht gelassen, dass diese Politik die Summe von ständig neuen, für die Betroffenen oftmals unvorhergesehenen Radikalisierungsschüben war. Erst am Ende dieser Kette stand der Holocaust, der in der für die Geschichte der „Arisierung“ relevanten Zeit zwischen 1933 und 1941 nur ganz allmählich in den Bereich des Vorstellbaren rückte. Es greift also zu kurz, jüdische Gewerbetreibender ausschließlich als passive Opfer einer judenfeindlichen Politik zu begreifen, die von Beginn an auf die Auslöschung dieser Minderheit hinwirkte. Eine solche Herangehensweise geht darüber hinweg, dass diese Unternehmer unterschiedliche Möglichkeiten hatten, der judenfeindlichen Politik der Nationalsozialisten und der Ausschaltung jüdischer Gewerbetätigkeit zu begegnen.[17] Für einen jüdischen Unternehmer konnte etwa 1933 eine durchaus folgerichtig erscheinende Strategie sein, aus der Geschäftsführung seines Betriebes auszuscheiden, gleichzeitig als stiller Teilhaber im Unternehmen zu verbleiben und auf ein baldiges Ende der nationalsozialistischen Herrschaft zu hoffen. Mit der Rekonstruktion derartiger Handlungsweisen, mit denen jüdische Unternehmer aktiv auf ihr Umfeld reagierten und weitere Strategien entwarfen, wird also die nach wie vor in der Forschung dominierende, klassische Opferperspektive erweitert.
In der Arbeit werden zudem Konzepte der modernen Unternehmensgeschichte berücksichtigt. Zum einen wurde von Unternehmenshistorikern eine Debatte darüber geführt, ob betriebswirtschaftliche Aspekte den Vorrang vor traditionellen, eher kulturhistorisch orientierten Unternehmensgeschichten haben sollten.[18] Zum anderen war die Verortung von Unternehmensgeschichte zwischen Personengeschichte und Strukturgeschichte Gegenstand einer methodischen Diskussion. Hier wurde betont, dass Unternehmenshistoriker Gefahr laufen, in einer Art Personengeschichte die Inhaber von Unternehmen zu portraitieren und dabei das Unternehmen selbst zu vernachlässigen.[19] Um beide Theoriediskussionen zu berücksichtigen, wurde in dieser Arbeit eine betriebswirtschaftlich orientierte Herangehensweise gewählt, die sich verstärkt mit dem Unternehmen als Institution und seinen betriebswirtschaftlichen Parametern auseinandersetzt.
In dieser Arbeit werden verschiedene Theorien der Unternehmensgeschichte berücksichtigt. Mit einem „reflektierten Eklektizismus“ wurde versucht, Theorien der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften heranzuziehen, wenn sie zur Erhellung von Vorgängen beitragen konnten.[20] Diese Herangehensweise fand ihre natürliche Beschränkung in den überlieferten Quellen, die für die Untersuchung zur Verfügung standen. Eine mikropolitische Analyse etwa ist kaum möglich, wenn Quellen über unternehmensinterne Vorgänge fehlen. In dieser Arbeit wird vor allem auf Erkenntnisse der Neuen Institutionenökonomie zurückgegriffen.[21] Diese war insbesondere im Zusammenhang von innerbetrieblichen Loyalitätskonflikten, aber auch für die Frage nach der optimalen Unternehmensgröße ein hilfreiches Analyseinstrument.
1.4 Aufbau der Arbeit und thematische Abgrenzung
Nach einem einleitenden Überblick über die Forschung zur „Arisierung“ und zur Situation der Juden in Berlin wird im Hauptteil ein chronologischer Überblick über die „Arisierungspolitik“ des nationalsozialistischen Regimes geboten. Dieser chronologischen Darstellung der einzelnen Radikalisierungsstufen, die zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben führten, wird anschließend die soziale Praxis der „Arisierungen“ gegenübergestellt und Bajohrs Konzept von „Arisierung“ als einem gesellschaftlichen Prozess erläutert. Es bildet die theoretische Folie der Analyse vor allem für den Zeitraum 1933 bis 1936. In Kapitel 2.1.3 schließlich geht es um die spezielle Situation in Berlin. Die besondere Stellung dieser Stadt als Reichshauptstadt und Zentrum des deutschen Judentums stellte besondere Rahmenbedingungen, die bei einer Rekonstruktion der Vorgänge mit berücksichtigt werden müssen.
In folgenden Abschnitt 2.2 geht es um das Unternehmen Kempinski. In einem kurzen Überblick wird zunächst die Vorgeschichte des Unternehmens in den Jahren 1862 bis 1929 skizziert. Ein eigener Abschnitt beschreibt die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sowie den beginnenden Antisemitismus im Zeitraum 1929 bis 1933. Die traditionelle Fokussierung der Forschung auf die Zeit nach 1933 versperrt oftmals die Sicht auf längere Entwicklungslinien des Antisemitismus und auf die bislang unklare Bedeutung der Wirtschafts- und Bankenkrise sowie die daraus resultierenden Strategien jüdischer Unternehmen schon vor 1933. [22]
Die „Arisierung“ Kempinskis selbst wurde in drei Zeitabschnitte unterteilt. Die Zeit zwischen 1933 bis 1936 ist die Phase der allmählichen Verdrängung des Unternehmens ins wirtschaftliche und gesellschaftliche Abseits. In diesem Kapitel geht es wie erwähnt darum, die schleichende „Arisierung“ Kempinskis in den Kontext von Frank Bajohrs Konzeption von „Arisierung“ als einem gesellschaftlichen Prozess zu stellen. Im Zweiten Abschnitt werden die Verhandlungen mit der Aschinger AG rekonstruiert sowie der Inhalt des zwischen Aschinger und Kempinski ausgehandelten Vertrages dargestellt. Bei diesem Vertrag handelte es sich nicht um einen Kauf- sondern um einen Pachtvertrag. Das alte Unternehmen Kempinski existierte weiter, die Inhaber blieben Eigentümer der Grundstücke und einiger Beteiligungen. Die Abwicklung dieses Unternehmens (in der Arbeit als „Rest-OHG“ bezeichnet) sowie die äußerst langwierigen und komplexen „Arisierungs“-verhandlungen, die erst im November 1941 zum Abschluss kamen, werden im dritten Abschnitt dargelegt. Im Schlusskapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst und schließlich die Frage erörtert, in wie weit die jüdischen Inhaber Handlungsspielräume hatten, in welchem Ausmaß sie diese wahrnahmen und welche Strategien sie entwarfen.
Auf die kontroverse und in der Tagespresse wiederholt diskutierte Nachkriegsgeschichte des Unternehmens (die Restitutionsverfahren, die Errichtung eines ersten Hotels am Kurfürstendamm, der Verkauf an die Hotelbetriebs AG und die Umbenennung dieses Unternehmens in „Kempinski AG“) kann nicht Teil dieser Arbeit sein. [23] Es handelt sich bei dieser Untersuchung eben nicht um eine Unternehmensgeschichte im klassischen Sinne, sondern um eine Spezialstudie zur „Arisierung“, die unter übergeordneten Fragestellungen Material für spätere komparative Studien bieten soll.
Zur umfassenden Analyse wäre auch eine Darstellung des „Ariseurs“, der Aschinger AG wünschenswert gewesen. Die Konsolidierung dieses angeschlagenen Konzerns durch die Übernahme der Kempinskibetriebe ist charakteristisch für viele „Arisierungsvorgänge“. Doch angesichts des beschränkten Rahmens dieser Arbeit kann auf die Aschinger AG nur am Rande eingegangen werden. Die Perspektive des Kempinski-Unternehmens und die Strategien seiner Inhaber stehen im Zentrum der Untersuchung.[24]
Die Auflösung der klassischen Opferperspektive birgt die Gefahr, dass die persönlichen Schicksale der jüdischen Inhaber zu kurz kommen. Tatsächlich wird in dieser Arbeit der Leidensweg der Familie bei ihrer Emigration und im Falle Walter Ungers auch die Deportation und schließlich die Ermordung in Auschwitz nur am Rande behandelt werden – zumeist, wenn es um die Rekonstruktion von Handlungsspielräumen und Strategien geht. Diese Tatsache ist zum einen dem methodischen Ansatz einer Unternehmensgeschichte als Institutionengeschichte, vor allem jedoch der Komplexität der Materie geschuldet. Das erfahrene Leid der Familie sollte nicht ausgeblendet werden. Die „Arisierung“ des Unternehmens Kempinski war ein äußerst komplizierter und über einen langen Zeitraum währender Vorgang. Diese Arbeit konzentriert sich daher fast ausschließlich auf die Vorgänge um das Unternehmen konzentrieren.
1.5 Quellenlage
Hauptquelle für diese Magisterarbeit stellt der im Landesarchiv Berlin lagernde Firmenbestand der Aschinger AG dar. In diesem Bestand befinden sich zahlreiche Dokumente aus der alten Registratur der Firma M. Kempinski & Co. OHG sowie ab 1937 der Tochtergesellschaft Aschingers, der Kempinski GmbH. Dieser Firmenbestand bildete auch die hauptsächliche Quellenbasis für die Untersuchung von Elfi Pracht, der einzigen wissenschaftlichen Veröffentlichung zum Unternehmen. Doch zur Zeit ihrer Quellenrecherche 1990 war der Bestand erst ansatzweise geordnet und verzeichnet.[25] Die grobe Verzeichnung auf Karteikarten wurde zudem „…in ihrer Oberflächlichkeit und teilweisen Parteilichkeit der außerordentlichen Vielfalt der Unterlagen…“[26] nicht gerecht. Erst in den Jahren 2002/2003 erfolgte eine systematische Neu- bzw. Ersterschließung, bei der auch eine Bestandstrennung vorgenommen wurde. Nun bilden alle Akten der Registratur Kempinski & Co einen eigenen Aktenbestand, der 115 Akteneinheiten (3,3lfm) umfasst. Die Unterlagen stammen aus den Jahren 1899 bis 1949 und haben ihren Schwerpunkt in den dreißiger Jahren. Daneben waren für den Prozess der Übernahme zum Teil auch die ursprünglichen Unterlagen der Aschinger AG (1377AE; 32,40lfm) relevant. Ein für beide Unternehmen zusammen neu erstelltes Findbuch bietet nun erstmals einen systematischen Überblick über die Firmenbestände.[27] Dieser neue Erschließungsgrad bot eine gute Quellenbasis für eine Analyse und Neubewertung der Übernahmevorgänge. Aus dem Aschinger-Bestand wurden unter anderem Protokolle von Vorstandssitzungen sowie Korrespondenzen mit Banken und Aufsichtsratsmitgliedern ausgewertet. Im Bestand der früheren Kempinski OHG bzw. der späteren Kempinski GmbH waren vor allem die Berichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutsche Revisions- und Treuhand AG (DRTAG), sowie ein ausführliches Gutachten des Wirtschaftsprüfers Dr. J. Semler von 1937 aufschlussreich. Da das Unternehmen Kempinski die Rechtsform einer OHG hatte, existieren für diese Firma weder Protokolle von Vorstandssitzungen, noch Korrespondenzen mit Aufsichtsratsvorsitzenden wie im Falle Aschinger. Dies machte die Rekonstruktion von Strategien der jüdischen Inhaber schwierig. Sie musste auf indirektem Wege erfolgen.
Im Bundesarchiv fanden sich Gegenüberlieferungen von zwei Kreditinstituten, der Reichskreditgesellschaft AG (ERKA) und der Deutschen Bank, sowie der DRTAG. Diese sind eine wichtige Ergänzung zum Firmenbestand. Die Akten der Gauverwaltung Berlin, der Finanzämter sowie des Gewerbeamtes Berlin gelten größtenteils als vernichtet. Deshalb sind Unterlagen staatlicher Stellen, die sich mit Kempinski befassen, nur äußerst spärlich überliefert. Für die Spätphase der „Arisierung“ 1941 waren die Akten des Oberfinanzpräsidenten Berlin Brandenburg aufschlussreich, hier vor allem jene im Bestand des Finanzamtes Moabit West, in dem die Vermögensverwertungsstelle angesiedelt war. Eine weitere Ergänzung waren die Rückerstattungsakten im Berliner Landesarchiv, der Bestand des Reichskommissars für die Behandlung feindlichen Vermögens im Bundesarchiv, sowie zum Teil Akten aus dem Bestand der Amsterdamer Filiale Kempinskis, die im dortigen „Gemeentearchief“ lagern. Frau Prof. Dr. Jersch-Wenzel hat mir freundlicherweise die Abschrift eines Interviews zur Verfügung gestellt. Dieses wurde im Jahre 1990 von Elfi Pracht, Autorin der bislang einzigen Monographie über Kempinski, mit Elisabeth Kohsen geführt. Elisabeth Kohsen war die Tochter des leitenden Geschäftsführers Richard Unger und selbst stille Teilhaberin im Unternehmen. Schließlich konnte ich mit Fritz Teppich, dem Schwager Gerhard Kempinskis, am 1. Juli 2006 in Berlin ein eigenes Interview führen.[28] Auf schriftliche Anfrage teilte schließlich das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen mit, dass auch hier verschiedene abgeschlossene Rückerstattungsverfahren archiviert sind. Da jedoch noch ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Unternehmen und dem Grundstück Leipziger Straße 25 / Krausenstraße 72-74 anhängig sei, müsste bei den Erben eine Einwilligung für die Akteneinsicht eingeholt werden. Da die Auskunft des Bundesamtes erst äußerst spät eingegangen ist, konnte dies aufgrund des Zeitrahmens der Magisterarbeit nicht weiter verfolgt werden.
1.6 Forschungsüberblick
An dieser Stelle kann nicht auf die vielfältigen Gründe und die ebenso vielfältige Forschung zur Entstehung des modernen Antisemitismus eingegangen werden. Es sei im Zusammenhang dieser Arbeit nur darauf hingewiesen, dass die Antisemitismusforschung wiederholt betont hat, wie eng ein neuer, nicht religiös motivierter Antisemitismus mit der wirtschaftlichen und sozialen Krise der modernen kapitalistischen Gesellschaft verbunden ist.[29] Vor allem Esra Bennathan vertrat zudem die Ansicht, dass die während der Wirtschaftskrise um 1930 steigende Konkurrenz vor allem in den mittelständischen Gewerbezweigen ein wichtiger Grund für die spätere Verdrängung der jüdischen Gewerbetreibenden während des Nationalsozialismus gewesen sei.[30]
Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit in der NS-Zeit ist, im Schatten des Massenmordes an den europäischen Juden, nur auf ein begrenztes Interesse der Historiker gestoßen. Den Anfang wissenschaftlicher Forschung machte in den sechziger Jahren Helmut Genschel mit seiner Studie über „Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten Reich“.[31] Genschel zeigte auf, dass die NS-Judenpolitik keineswegs konsequent und linear ablief, sondern von Widersprüchen und Phasen taktischer Zurückhaltung geprägt war. Er stützte seine Arbeit dabei vor allem auf die Verordnungen der Reichsregierung und der Zentralbehörden. Viele Aspekte der Enteignungsprozesse, wie etwa die Konflikte zwischen Partei- und Regierungsinstitutionen auf regionaler Ebene, blieben allerdings bei dieser Pionierstudie noch vernachlässigt.[32]
Die zweite grundlegende Monographie stammt von Avraham Barkai.[33] Er rückte verstärkt die jüdische Perspektive in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Vor allem betonte er die Kontinuität und Intentionalität der Enteignungen. Genschel mit seiner strukturgeschichtlichen Analyse und Barkai mit seiner intentionalen Interpretation spiegeln also im Rahmen der „Arisierung“ den allgemeinen Streit der NS-Forschung zwischen „Intentionalisten“ und „Strukturalisten“ wieder.[34] Genschel hatte noch den Erfolg der nationalsozialistischen Judenpolitik bis 1937 als „recht mäßig“ eingeschätzt und die Phase 1933 bis 1937 als „Schonzeit“ bezeichnet.[35] Barkai sprach nun von einer „Illusion der Schonzeit“ und von im Jahre 1937 schon „weit fortgeschrittenen ‚Arisierungen’“[36]. 1937 hätten lediglich die Restbestände jüdischer Gewerbetätigkeit beseitigt werden müssen. Auch die von Genschel behauptete Schutzfunktion von Reichswirtschaftminister Schacht wurde von Barkai in Frage gestellt.[37]
Götz Aly und Susanne Heim haben 1991 in einer Studie die ideologischen Hintergründe der „Arisierung“ zurückgewiesen und die ökonomisch-utilitaristischen Aspekte hervorgehoben. Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit sei ein Akt ökonomischer Modernisierung gewesen, der auf die strukturelle Bereinigung „übersetzter“ Wirtschaftsbereiche gezielt habe.[38] Diese These stieß jedoch auf breite Ablehnung. Man dürfe, so der Grundtenor, nicht die ideologische Dimension der Judenverfolgung vernachlässigen und die nationalsozialistische Politik nachträglich rationalisieren.[39]
Erst in jüngerer Zeit wurden jenseits dieser Debatten die tatsächliche Praxis der „Arisierungen“, die Genehmigungsinstanzen und der Kreis der Beteiligten und Profiteure näher untersucht. Gerhard Kratzsch analysierte die Funktion der Gauwirtschaftsberater der NSDAP bei der „Arisierung“ der deutschen Wirtschaft beispielhaft am Gau Westfalen-Süd. Im Gegensatz zu Barkai, der die Gauwirtschaftsberater als „ideale Vollzugsorgane“[40] im Verdrängungsprozess beschrieben hatte, kam Kratzsch zu einer vorsichtigeren Bewertung. Der Gauwirtschaftsberater, so Kratzschs Einschätzung für den Gau Südwestfalen, „…wirkte mit, nahm Stellung, war aber kein Vollzugsorgan.“[41]
Die Rolle der deutschen Unternehmer bei den „Arisierungen“ skizzierte erstmals Avraham Barkai.[42] Ihm zufolge haben sich viele mittelständische und auch großindustrielle Unternehmer zu „Komplizen“ der Nationalsozialisten gemacht. Peter Hayes differenzierte dieses Urteil in seiner Studie über Großunternehmer. Deren Verhalten sei eine komplexe Mischung aus Distanz und Ablehnung einerseits sowie Verstrickung andererseits gewesen und dürfe nicht mit den mittelständischen NSDAP-Anhängern gleichgesetzt werden. Die deutsche Wirtschaftselite sei, auch wenn ihre Vorbehalte zunehmend erodierten, nur unterdurchschnittlich an der „Arisierung“ beteiligt gewesen.[43]
Auch die Deutschen Großbanken waren in jüngster Zeit vermehrt Gegenstand von Untersuchungen.[44] Besonders die Dresdner Bank tat sich bei der „Arisierung“ mit einer „branchenunüblichen Aggressivität“ hervor.[45] Doch auch die Deutsche Bank und, in geringerem Maße, die Commerzbank waren in die „Arisierungspraxis“ involviert. Harold James machte in seiner Studie zur Deutschen Bank deutlich, dass der unternehmerische Gewinn dabei nur eines der bestimmenden Handlungskalküle war. Zunehmend habe für die Banken auch der Kampf um politischen Einfluss in einer politisch überformten Ökonomie wachsende Bedeutung erlangt.[46]
Frank Bajohr hat die Forschung mit seiner Studie über die „Arisierung“ in Hamburg um eine entscheidende Perspektive erweitert. Er forderte erstmals, dass die Er forderte erstmals, dass die klassische Perspektive der Judenpolitik, „…welche die wirtschaftliche Ausgrenzung und Verfolgung in erster Linie als eine Abfolge legislativ-administrativer Maßnahmen darstellt, gesellschaftsgeschichtlich erweitert werden muss.“[47] Indem Bajohr neben den administrativen Maßnahmen vor allem informelle Strukturen, personale Netzwerke und Interessenkartelle in den Vordergrund rückte, hat er deutlich gemacht, auf welch vielfältige Weise die deutsche Gesellschaft an diesem Prozess mitgewirkt hat.[48]
Gerade diese informellen Strukturen und gesellschaftlichen Prozesse lassen sich auf regionaler und lokaler Ebene am besten untersuchen. Es mangelt auch nicht an regionalgeschichtlichen Darstellungen zur Judenverfolgung. Doch gehen diese sowohl auf die Wirtschaftstätigkeit der Juden insgesamt als auch auf die „Arisierungen“ nur am Rande ein.[49] Inzwischen existieren einige regionalhistorische Spezialstudien.[50] Doch behandeln diese zumeist nur kleinere Städte, die für die Wirtschaftstätigkeit deutscher Juden insgesamt nur von marginaler Bedeutung waren. Über die wirtschaftliche Existenzvernichtung von Juden in den großen deutschen Städten, in denen die Mehrzahl der deutschen Juden lebte, existieren lediglich für Hamburg, München und Köln wissenschaftlichen Kriterien genügende Arbeiten.[51] Angesichts der Konzentration jüdischer Gewerbetätigkeit in den deutschen Großstädten ist das Fehlen weiterer wissenschaftlicher Lokalstudien zur „Arisierung“ in den deutschen Großstädten unverständlich.
Dies gilt umso mehr für Berlin, die deutsche Reichshauptstadt, in der ein Drittel aller Juden in Deutschland lebte. Zum jüdischen Leben in Berlin während des Nationalsozialismus existieren erstaunlich wenige Publikationen. Eine entsprechende Monographie zum Thema steht noch aus.[52] Darüber hinaus dominiert in der Forschung zum Berliner Judentum augenscheinlich die Bedeutung Berlins als kulturelle und nicht als wirtschaftliche Metropole. Die wirtschaftliche Bedeutung Berlins wurde selten mit der Geschichte der Berliner Juden in Verbindung gebracht.[53] Dies spiegelt sich auch in den Publikationen zur Geschichte der Juden der einzelnen Stadtteile wider, die die ausführlichste Basis für eine Stadtgeschichte der Berliner Juden bilden, oftmals jedoch kaum akademischen Standards genügen und jüdische Unternehmen nur am Rande erwähnen.[54] Die Ausschaltung der Juden aus der Berliner Wirtschaft während des Nationalsozialismus ist nach wie vor so gut wie unerforscht. Gesamtdarstellungen existieren nicht, und institutionengeschichtliche Untersuchungen stehen noch am Anfang.[55] Welche Verwaltungsbereiche waren innerhalb des Magistrats verantwortlich für die ersten Handlungen der Stadtverwaltung, die jüdisches Eigentum betrafen? Welche Auswirkungen hatte der Status Berlins als Reichshauptstadt auf die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit? Welche informellen Netzwerke kamen zwischen Wirtschaftsverbänden, Verwaltung und Partei zum tragen? Zu diesen Fragen können bislang nur Hypothesen anhand von einigen wenigen Einzelfällen aufgestellt werden.
Verschiedene jüdische Firmen in Berlin wurden bislang im Rahmen von Unternehmensgeschichten untersucht. Diese sind jedoch Unternehmensgeschichten im eigentlichen Sinne, sie behandeln den gesamten Zeitraum seit Gründung der Firma und gehen daher auf Liquidation oder Verkauf nur am Rande ein.[56] Die methodischen Errungenschaften der modernen Unternehmensgeschichte fanden dabei in jüdischen Unternehmensgeschichten bislang kaum Beachtung.[57] Gerade die Geschichte jüdischer Unternehmen wird allzu oft als eine Personen- oder Familiengeschichte geschrieben.[58] Dagegen sind die unternehmenshistorischen Fachhistoriker häufig auf die Täterperspektive, auf „Arisierungsprofiteure“ wie IG-Farben oder die Dresdner Bank beschränkt.[59] Rolf Banken hat darüber hinaus kritisiert, dass bei den Darstellungen von Einzelunternehmen keine übergeordneten Fragestellungen existieren, stattdessen nur ausdifferenzierte Faktenergebnisse präsentiert werden.[60] Dies gilt gerade auch für die Arbeiten zu jüdischen Unternehmen. Nur zu drei Berliner Unternehmen existieren spezielle Studien zum Vorgang der „Arisierung“.[61]
Kempinski selbst wurde bislang in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung behandelt.[62] Diese geht allerdings auf die „Arisierung“ jedoch ebenfalls nur im Rahmen einer allgemeinen Unternehmensgeschichte ein. Hinzu kommt die beschriebene, ungenügende Quellenlage bei Entstehung dieses Buches. Nur äußerst knapp wird die Übernahme Kempinskis in der einzigen Monographie über den „Ariseur“, die Aschinger AG, beschrieben.[63] Äußerst kurze Erwähnung findet der Fall Kempinski darüber hinaus noch in der Monographie von Wolfgang Mönninghoff über die Enteignung der Juden.[64] Seine Thesen sind jedoch irreführend, wie noch zu zeigen sein wird.
2 Hauptteil
2.1 Rahmenbedingungen
2.1.1 Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit im „Altreich“
2.1.1.1 Weimarer Antisemitismus, Machtergreifung und –konsolidierung der NSDAP
Schon in der frühen Weimarer Republik hatte es Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte gegeben.[65] In den Nachkriegswirren und ersten Weimarer Jahren waren es aber weniger organisierte Boykotte, sondern vornehmlich Plünderungen von jüdischen Geschäften, die für Aufsehen sorgten. Politisches Chaos, Hungersnot und Kohleknappheit steigerten den Hass gegen die so genannten Kriegs- und Inflationsgewinnler.[66] In den Folgejahren kam es immer wieder zu vereinzelten, spontanen Boykottaktionen, vornehmlich gegen Geschäftsleute, Ärzte oder Rechtsanwälte.[67] 1924/25 wurden die ersten organisierten Boykotte von der DNVP, der NSDAP und der Deutschvölkischen Partei vor allem im Osten Deutschlands initiiert. In der kurzen, relativ stabilen Phase der Weimarer Republik zwischen 1925 und 1928 scheint es nur vereinzelt Boykotte gegeben zu haben, doch seit 1929 nahm ihre Zahl sprunghaft zu.[68] Der zeitliche Zusammenhang zwischen Wirtschaftskrise und Boykottaktionen zeigt dabei deutlich, wie eng offenbar antisemitische Maßnahmen mit der sozioökonomischen Stabilität der Gesellschaft verbunden waren.
Ende 1930 setzten dann nationalsozialistische Boykottaufforderungen mit ungeheurer Macht ein.[69] Die stärker werdende NSDAP bemühte sich nun um einen systematischen Boykott jüdischer Geschäfte. Zwar mahnte die Parteiführung in diesen Jahren noch offiziell zur Zurückhaltung in der „Judenfrage“, doch ihr „Kleinkrieg“ (Longerich) war wesentlicher Bestandteil der lokalen Machteroberungsstrategie.[70] Politische Fragen wurden in nachbarschaftliche Strukturen hineingetragen und das alltägliche Einkaufsverhalten zu einer weltanschaulichen Grundsatzentscheidung gemacht.
Die wirtschaftlichen Folgen der Weimarer Boykotte sind schwer einzuschätzen. Die ältere Forschung hat die Auswirkungen als relativ gering bewertet.[71] Doch zumindest in einigen ländlichen Regionen, besonders im Osten, trafen die Boykotte kleinere Geschäfte, Rechtsanwälte und Ärzte empfindlich und konnten durchaus Existenz bedrohend sein.[72] In den Städten waren die Warenhäuser das vornehmliche Ziel antisemitischer Boykottpropaganda. Die Bedeutung der Boykotte scheint aber vor allem im „…Einsickern antisemitischer Ressentiments in die gesellschaftlichen Infrastrukturen…“[73] zu liegen. Die Verquickung von Alltagshandeln und politischer Weltanschauung wurde unbewusst eingeübt, durch Gewöhnung wurde eine zunehmende Akzeptanz oder zumindest Gleichgültigkeit gegenüber derartigen Aktionen erreicht. Aus jüdischer Sicht war Antisemitismus schon in der Weimarer Republik keine Rand- sondern eine Massenerscheinung, „...die den normalen Umgang von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen erheblich beeinträchtigte.“[74] Auf diesen Grundlagen konnte die nationalsozialistische Judenpolitik nach 1933 aufbauen.
[...]
[1] Frank Bajohr, „Arisierung“ in Hamburg, Hamburg 1998, S.10.
[2] Dieter Ziegler, Die deutschen Großbanken im Altreich 1933 – 1939, in: Dieter Stiefel (Hrsg.), Die politische Ökonomie des Holocaust. Zur wirtschaftlichen Logik von Verfolgung und "Wiedergutmachung", Wien 7 München 2001, S. 74-131, hier: S. 123.
[3] Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die Kurzform „Kempinski“ verwendet. Damit ist immer das Unternehmen, nicht eine Person „Kempinski“ gemeint.
[4] Henning Köhler, Berlin in der Weimarer Republik, in: Wilhelm Ribbe (Hrsg.), Die Geschichte Berlins, Bd. 2, Von der Märzrevolution bis zur Gegenwart, Berlin 2002, S. 797-925, hier: 981ff.
[5] Projektantrag: Ausgrenzungsprozesse und Überlebensstrategien. Mittlere und kleine jüdische Gewerbe-Unternehmen in Berlin, unveröffentlicht, Berlin 2006, S. 3.
[6] Zur Begriffsgeschichte vgl. Cornelia Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin/New York 1998, S. 62.
[7] Yisrael Gutman (Hrsg.), Enzyklopädie des Holocaust, Bd. 1, Berlin 1993, S. 412.
[8] So auch bei Gutman 1993, S. 78.
[9] Zur Problematisierung vgl. Marian Rappl, „Arisierungen“ in München. Die Verdrängung der jüdischen Gewerbetreibenden aus dem Wirtschaftsleben der Stadt 1933-1939, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 63 (2000), S. 123-184, hier: S. 125; Dies., „Unter der Flagge der Arisierung… um einen Schundpreis zu erraffen“. Zur Präzisierung eines problematischen Begriffs, in: Angelika Baumann (Hrsg.), München „arisiert“. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, München 2004, S. 17-30, hier: S. 20.
Den Begriff zu vermeiden versucht Ludolf Herbst. Er spricht von „Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der Juden“. Vgl. Ludolf Herbst u. A., Einleitung, in: Ders. / Thomas Weihe (Hrsg.), Die Commerzbank und die Juden, München 2004, S. 9-19, hier: S. 10.
[10] Siehe auch Constantin Goschler / Jürgen Hillteicher, „Arisierung“ und Restitution jüdischen Eigentums in Deutschland und Österreich. Einleitung, in: dies. (Hrsg.), „Arisierung“ und Restitution, Die Rückerstattung jüdischen Eigentums in Deutschland und Österreich nach 1945 und 1989, Göttingen 2002, S. 7-28, hier: S. 10.
[11] Irmtrud Wojak / Peter Hayes, Einleitung, in; dies. im Auftrag des Fritz Bauer Instituts (Hrsg.), „Arisierung“ im Nationalsozialismus. Volksgemeinschaft, Raub und Gedächtnis, Frankfurt a. M./New York 2000, S. 7-13, hier: S. 7f.
[12] So auch Marian Rappl 2004, S. 20.
[13] Frank Bajohr, „Arisierung“ und Restitution. Eine Einschätzung, in: Constantin Goschler u. Jürgen Hillteicher (Hrsg.), „Arisierung“ und Restitution, Die Rückerstattung jüdischen Eigentums in Deutschland und Österreich nach 1945 und 1989, Göttingen 2002, S. 39-59, hier: S. 39.
[14] Vgl. auch den Abschnitt „Arisierung als gesellschaftlicher Prozess“ in dieser Arbeit, S. 26.
[15] Frank Bajohr, Interessenkartell, personale Netzwerke und Kompetenzausweitung: Die Beteiligten bei der „Arisierung“ und Konfiszierung jüdischen Vermögens, in: Gerhard Hirschfeld / Tobias Jersak (Hrsg.), Karrieren im Nationalsozialismus: Funktionseliten zwischen Mitwirkung und Distanz,Frankfurt a. M. 2004, S. 45-55, hier: S. 47.
[16] Frank Bajohr, Verfolgung aus gesellschaftsgeschichtlicher Perspektive. die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden und die deutsche Gesellschaft, in: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft 26 (2000), S. 629-653, hier: S. 629.
[17] Eine erste Typologie bietet: Herbst 2004, S. 85-87.
[18] Grundlegend die Debatte zwischen Toni Pierenkemper und Manfred Pohl. Vgl. hierzu: Toni Pierenkemper, Was kann eine moderne Unternehmensgeschichte leisten? Und was soll sie tunlichst vermeiden, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 44 (1999), S. 15-31; Manfred Pohl, Zwischen Weihrauch und Wissenschaft? Zum Standort der modernen Unternehmensgeschichte. Eine Replik auf Toni Pierenkemper, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 44 (1999), S. 150-163; sowie die Antwort Toni Pierenkemper, Sechs Thesen zum gegenwärtigen Stand der deutschen Unternehmensgeschichtsschreibung. Eine Entgegnung auf Manfred Pohl, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 45 (2000), S. 158-166.
[19] Jan-Otmar Hesse, „Der Kapitalismus ist das Werk einzelner hervorragender Männer“. Unternehmensgeschichte zwischen Personen und Strukturen, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 56 (2005), S. 148-158.
[20] Zum „reflektierten Eklektizismus“ vgl. Hartmut Berghoff, Moderne Unternehmensgeschichte. Eine themen- und theorieorientierte Einführung, Paderborn 2004, S. 8. Zu Theorieangeboten der Unternehmensgeschichte vgl. Werner Neuss, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre aus institutionenökonomischer Sicht, 2. Aufl., Tübingen 2001; Malcolm H. Dunn, Die Unternehmung als soziales System. Ein sozialwissenschaftlicher Beitrag zur Neuen Mikroökonomie, Berlin 1998, S. 58-61; Wolfgang H. Staehle, Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive, 4. Aufl., München 1989, S. 21-64; Rudolf Richter / Erik G. Furubotn, Neue Institutionenökonomie. Eine Einführung und kritische Würdigung, 2. Aufl., Tübingen 1999, S. 288-452; Georg Kneer / Armin Nassehi, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, 4. Aufl., München 2000; Karl Lauschke(Hrsg.),Mikropolitik im Unternehmen:Arbeitsbeziehungen und Machtstrukturen in industriellen Großbetrieben des 20. Jahrhunderts(Bochumer Schriften zur Unternehmens- und Industriegeschichte 3), Essen 1994; Willy Küpper / Günther Ortmann, Mikropolitik. Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen, 2. Aufl, Opladen 1992.
[21] Eine ausführliche Darstellung ihrer Prämissen und Methoden kann hier aus Platzgründen nicht erfolgen. Es sei lediglich verwiesen auf die instruktive Arbeit von Werner Neus: Neuss 2001, bes. S. 89-137; sowie Richter / Furubotn 1999, S. 288-452.
[22] Peter Hayes, Big Business and „Aryanisation“ in Germany, 1933-1939, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 3 (1994), S. 254-281, hier: S. 255; sowie Dieter Ziegler, Kontinuität und Diskontinuität der deutschen Wirtschaftselite, in: ders. (Hrsg.), Unternehmer und Großbürger. Die deutsche Wirtschaftselite im 20. Jahrhundert, Göttingen 2000, S. 31-53, hier: S. 49.
[23] Beispielhaft seinen folgende Zeitungsartikel genannt: Berliner Zeitung Nr.136 vom 13.06.1994, S. 19; Berliner Zeitung Nr.127 vom 02.06.1994, S.18; Berliner Zeitung Nr.22 vom 27.01.1994, S. 17; TAZ-Berlin Nr. 135 11.06.1994, S. 36.
[24] Zu Aschinger vgl. die Monographie von Karl-Heinz Glaser, Aschingers Bierquellen erobern Berlin. Aus dem Weinort Oberderdingen in die aufstrebende Hauptstadt, unter Mitarbeit von Erwin Breitinger und Thomas Nowitzki, Ubstadt-Weiher 2004.
[25] Elfi Pracht, M. Kempinski & Co., Berlin 1994, S. 13.
[26] Michael Klein, Aschinger-Konzern – Aschinger's Aktien-Gesellschaft, Hotelbetriebs-AG, M. Kempinski & Co. Weinhaus und Handelsgesellschaft mbH. A Rep. 225 (Findbücher, hrsg. vom Landesarchiv Berlin, Nr. 34) , Berlin 2005, S. 22.
[27] Ebd.
[28] Für die Familienverhältnisse vgl. den Stammbaum der Familie in dieser Arbeit, S. 96.
[29] Zuerst: Wilhelm Treue, Zur Frage der wirtschaftlichen Motive im deutschen Antisemitismus, in: Deutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916-1923, Tübingen 1971, S. 387-408; Helmut Berding, Moderner Antisemitismus in Deutschland, Frankfurt a. M. 1988; Bernd Weisbrod, The Crisis of Bourgeois Society in Interware Germany, in: Richard Bessel (Hrsg.), Fascist Italy and Nazi Germany, comparisons and constrasts, Cambridge 1996, S. 29 ff.
[30] Esra Bennathan, Die Demographie und wirtschaftliche Struktur der Juden, in: Werner E. Mosse (Hrsg.), Entscheidungsjahr 1932, 2. rev. u. erw. Aufl., Tübingen 1966, S. 88-131, hier: S. 131.
[31] Helmut Genschel, Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten Reich, Göttingen 1966.
[32] Von Genschels Ergebnissen beeinflusst: Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1972.
[33] Avraham Barkai, Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933-1943, Frankfurt/M 1987. Dien Forschungsstand fasst zusammen: Wolfgang Mönninghoff, Enteignung der Juden. Wunder der Wirtschaft, Erbe der Deutschen, Hamburg 2001.
[34] Für einen Überblick vgl. Ian Kershaw, Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek 1988, S. 80ff.
[35] Genschel 1966, S. 140.
[36] Avraham Barkai, „Schicksalsjahr 1938“. Kontinuität und Verschärfung der wirtschaftspolitischen Ausplünderung der deutschen Juden, in: Walter H. Pehle (Hrsg.), Der Judenpogrom 1938. Von der „Reichskristallnacht“ zum Völkermord, Frankfurt a. M. 1988, S. 94-117, hier: S. 95.
[37] Zum gleichen Ergebnis kommt: Albert Fischer, Hjalmar Schacht und Deutschlands „Judenfrage“. Der „Wirtschaftsdiktator“ und die Vertreibung der Juden aus der deutschen Wirtschaft, Köln 1995.
[38] Götz Aly / Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung, Hamburg 1991, S. 33-43.
[39] Unter anderen: Ulrich Herbert, Rassismus und rationales Kalkül. Zum Stellenwert utilitaristisch verbrämter Legitimationsstrategien in der nationalsozialistischen „Weltanschauung“, in: Wolfgang Schneider (Hrsg.), „Vernichtungspolitik“. Eine Debatte über den Zusammenhang von Sozialpolitik und Genozid im nationalsozialistischen Deutschland, Hamburg 1991, S. 25-35; Dan Diner, Rationalisierung und Methode. Zu einem neuen Erklärungsversuch der „Endlösung“, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 40 (1992), S. 359-382.
[40] Barkai 1987, S. 74ff.
[41] Gerhard Kratzsch,Der Gauwirtschaftsapparat der NSDAP:Menschenführung, "Arisierung", Wehrwirtschaft im Gau Westfalen-Süd; eine Studie zur Herrschaftspraxis im totalitären Staat,Münster 1989, S. 116.
[42] Avraham Barkai, Deutsche Unternehmer und Judenpolitik im „Dritten Reich“, in: Geschichte und Gesellschaft 15 (1989), S. 227-247.
[43] Hayes 1994, S. 272.
[44] Harold James, Die Deutsche Bank und die „Arisierung“, München 2001; Bernhard Lorentz, Die Commerzbank und die „Arisierung“ im Altreich. Ein Vergleich der Netzwerkstrukturen und Handlungsspielräume von Großbanken in der NS-Zeit, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 50 (2002), S. 237-268; Ziegler 2001; Herbst 2004; Dieter Ziegler, Die Dresdner Bank und die Juden, München 2006.
[45] Christopher Kopper, Zwischen Marktwirtschaft und Dirigismus, Bankenpolitik im „Dritten Reich“ 1933-1945, Bonn 1995, S. 278.
[46] James 2001, S. 216.
[47] Bajohr 1997.
[48] Auf diesen Ergebnissen aufbauend: wie Anmerkung 12-14.
[49] Zu den wichtigsten gehören: Regina Bruss, Die Bremer Juden unter dem Nationalsozialismus, Bremen 1983; Kommission zur Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden (Hrsg.), Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933-1945, Frankfurt 1963; Hans-Joachim Fliedner, Die Judenverfolgung in Mannheim 1933-1945, 2 Bde., Stuttgart 1971; Peter Hanke, Zur Geschichte der Juden in München zwischen 1933 und 1945, München 1967; Ulrich Knipping, Die Geschichte der Juden in Dortmund während der Zeit des Dritten Reiches, Dortmund 1977; Erwin Knauss, Die jüdische Bevölkerung Gießens, 1933-1945. Eine Dokumentation, Wiesbaden 1976. Eine Übersicht ferner bei Michael Ruck, Bibliographie zum Nationalsozialismus, Köln 1995, S. 370-394.
[50] Barbara Händler-Lachmann / Thomas Werther, Vergessene Geschäfte, verlorene Geschichte. Jüdisches Wirtschaftsleben in Marburg und seine Vernichtung im Nationalsozialismus, Marburg 1992; Alex Bruns-Wüstefeld, Lohnende Geschäfte. Die „Entjudung“ der Wirtschaft am Beispiel Göttingens, Hannover 1997; Franz Fichtl u. A., „Bambergs Wirtschaft judenfrei“. Die Verdrängung der jüdischen Geschäftsleute in den Jahren 1933 bis 1939, Bamberg 1998; Hans-Christian Dahlmann, „Arisierung“ und Gesellschaft in Witten. Wie die Bevölkerung einer Ruhrgebietsstadt das Eigentum ihrer Jüdinnen und Juden übernahm, Münster u. a. 2001; Werkstattfilm e.V. (Hrsg.), Ein offenes Geheimnis. „Arisierung“ in Alltag und Wirtschaft in Oldenburg zwischen 1933 und 1945, Oldenburg 2001; Andrea Brucher-Lembach, „…wie Hunde auf ein Stück Brot.“ Die „Arisierung“ und der Versuch der Wiedergutmachung in Freiburg, Bremgarten 2004.
[51] Zu Hamburg vgl. Bajohr 1997. Zu München: Rappl 2000, S. 123-184; Wolfram Selig, Leben unterm Rassenwahn. Vom Antisemitismus in der „Hauptstadt der Bewegung“, Berlin 2001; ders., „Arisierung“ in München. Die Vernichtung jüdischer Existenz 1937-1939, Berlin 2004; Angelika Baumann / Andreas Heusler (Hrsg.), München „arisiert“. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, München 2004. Zu Köln: Britta Bopf, „Arisierung“ in Köln. Die Wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933-1945, Köln 2004.
[52] Grundlegend sind die zwei Sammelbände: Beate Meyer / Hermann Simon (Hrsg.), Juden in Berlin 1938-1945. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung in der Stiftung „Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“, Berlin 2000; Andreas Nachama (Hrsg.), Die Juden in Berlin, Berlin 2001; Reinhard Rürup (Hrsg.), Jüdische Geschichte in Berlin. Bd.1: Essays und Studien, Bd.2: Bilder und Dokumente, Berlin 1995.
[53] Einen Überblick bietet Gabriel Alexander, Die jüdische Bevölkerung Berlins in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Demographische und wirtschaftliche Entwicklungen, in: Reinhard Rürup (Hrsg.): Jüdische Geschichte in Berlin, Bd. 1: Essays und Studien Berlin 1995, S. 117-148.
[54] Burkhard Asmuss / Andreas Nachama, Zur Geschichte der Juden in Berlin und das Jüdische Gemeindezentrum in Charlottenburg, in : Wolfgang Ribbe (Hrsg.), Von der Residenz zur City. 275 Jahre Charlottenburg, Berlin 1980, S. 165-228; Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg.), Projektgruppe: Christine Zahn: Fundstücke...Fragmente...Erinnerungen...Juden in Kreuzberg, Berlin 1991; Bezirksamt Weißensee von Berlin (Hrsg.), Juden in Weißensee. „Ich hatte einst ein schönes Vaterland“, Berlin 1994; Bund der Antifaschisten Berlin-Pankow e.V. (Hrsg.), Red. Inge Lammel, Jüdisches Leben in Pankow. Eine zeitgeschichtliche Dokumentation, Berlin 1993; Hans Werner Fabricius, Juden in Marienfelde, Berlin 1990; Regina Girod / Reiner Lidschun / Otto Pfeiffer, Nachbarn. Juden in Friedrichshain, Berlin 2000; Horst Helas, Juden in Berlin-Mitte. Biographien, Orte, Begegnungen Berlin 2000; Alois Kaulen / Joachim Pohl, Juden in Spandau vom Mittelalter bis 1945, Berlin 1988; Dorothea Kolland (Hrsg.), „Zehn Brüder waren wir gewesen…“ Spuren jüdischen Lebens in Berlin-Neukölln, Berlin 1988; Thea Korberstein / Norbert Stein (Hrsg.), Juden in Lichtenberg (mit den früheren Ortsteilen in Friedrichshain, Hellersdorf und Marzahn), Berlin 1995; Kulturamt Prenzlauer Berg, Prenzlauer Berg Museum für Heimatgeschichte und Stadtkultur (Hrsg.), Leben mit der Erinnerung. Jüdische Geschichte in Prenzlauer Berg, Berlin 1997; Gerd Lüdersdorf, Es war ihr Zuhause. Juden in Köpenick, Berlin 1998;
Auf „Arisierungen“ gehen näher lediglich die Publikationen über Pankow, Prenzlauer Berg sowie Marienfelde.
[55] Bislang lediglich: Wolf Gruner, Judenverfolgung in Berlin. Eine Chronologie der Behördenmaßnahmen in der Reichshauptstadt, Berlin 1996; Katharina Ruth Kaiser, Verfolgung und Verwaltung. Die Rolle der Finanzbehörden bei der wirtschaftlichen Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung in Berlin. Dokumentation einer Ausstellung im Haus am Kleistpark, Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Haus am Kleistpark (Hrsg.), Berlin 2003; Christoph Biggeleben, Kontinuität von Bürgerlichkeit im Berliner Unternehmertum. Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (1879-1961), in: Berghahn, Volker/Unger, Stefan/Ziegler, Dieter (Hrsg.), Die deutsche Wirtschaftselite im 20. Jahrhundert: Kontinuität und Mentalität, Essen 2003, S. 241-274.
[56] Simone Ladwig-Winters, Wertheim. Ein Warenhausunternehmen und seine Eigentümer. Ein Beispiel der Entwicklung der Berliner Warenhäuser bis zur „Arisierung“, Münster 1997; Pracht 1994; Wilhelm Treue, Das Bankhaus Mendelssohn als Beispiel einer Privatbank im 19. und 20. Jahrhundert, in: Mendelssohn-Studien 1 (1972), S. 29-80; Petra Woidt, Pankow und die Königin von Saba. Eine Firmen- und Familiengeschichte, Berlin 1997; Inka Bertz, „Keine Feier ohne Meyer“. Die Geschichte der Firma Hermann Meyer & Co., 1890-1990, Berlin 1990; Jüdisches Museum Berlin (Hrsg.), „Dem deutschen Volke“. Die Geschichte der Berliner Bronzegießerei Loewy. Ausstellungsbegleitbuch, Berlin 2003; Kilian Steiner, Ortsempfänger, Volksfernseher und Optaphon. Die Entwicklung der deutschen Radio- und Fernsehindustrie und das Unternehmen Loewe 1923-1962, Essen 2005.
[57] Für einen Überblick vgl. auch Paul Erker, „A new business history“? Neuere Ansätze und Entwicklungen der Unternehmensgeschichte, in: Archiv für Sozialgeschichte 42 (2002), S. 557-604; Jan-Otmar Hesse u. a. (Hrsg.), Kulturalismus, Neue Institutionenökonomik oder Theorienvielfalt. Eine Zwischenbilanz der Unternehmensgeschichte, Essen 2002; Werner Plumpe, Perspektiven der Unternehmensgeschichte, in: Günther Schulz (Hrsg.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte - Arbeitsgebiete, Probleme, Perspektiven. 100 Jahre Vierteljahresheft für Zeitgeschichte (Vierteljahresheft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 169), Stuttgart 2004.
[58] So etwa die Publikation über Wertheim (Ladwig-Winters 1997) oder Hermann Meyer (Bertz 1990).
[59] Exemplarisch geht folgender Band nur am Rande auf jüdische Unternehmer ein: Werner Abelshauser, Jan-Otmar Hesse und Werner Plumpe (Hrsg.), Die Unternehmen im Nationalsozialismus - Eine Zwischenbilanz, in: Wirtschaftsordnung, Staat und Unternehmen. Neuere Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Festschrift für Dietmar Petzina zu seinem 65. Geburtstag, Essen 2003.
[60] Rolf Banken, Kurzfristiger Boom oder langfristiger Forschungsschwerpunkt? Die neuere Unternehmensgeschichte und die Zeit des Nationalsozialismus, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 56 (2005), S. 183-196.
[61] Henning Kahmann, Die Bankiers von Jaquiers & Securius 1933-1945. Eine rechtshistorische Fallstudie zur „Arisierung“ eines Berliner Bankhauses, Frankfurt/M, u.a. 2002; Beate Meyer, „Arisiert“ und ausgeplündert. Die jüdische Fabrikantenfamilie Garbáty, in: dies. / Hermann Simon (Hrsg.), Juden in Berlin 1938-145. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung in der Stiftung „Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“, Berlin 2000, S. 77-88; Jens Schnauber, Die „Arisierung“ der Scala und Plaza, Varieté und Dresdner Bank in der NS-Zeit, Berlin 2002.
[62] Pracht 1994; literarisch-anekdotisch gehalten und ohne wissenschaftlichen Wert: Hans Ermann, Berlin bei Kempinski, Berlin 1954.
[63] Glaser 2004. Andreas Conrad notierte treffend in einer Rezension im Tagesspiegel: „Die Übernahme der M. Kempinski & Co. wäre mehr als nur drei Seiten wert gewesen.“ (Tagesspiegel vom 16. 03. 2005). Ferner gehen auf Kempinski am Rande ein: Baldur Köster, Berliner Gaststätten von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg; Berlin (Diss.) 1964; sowie Keith Allen, Hungrige Metropole. Essen, Wohlfahrt und Kommerz in Berlin, Hamburg 2002.
[64] Vgl. Anmerkung 33.
[65] Für einen Überblick vgl. Sibylle Morgenthaler, Countering the Pre-1933 Nazi Boycott against the Jews, in: Leo-Baeck-Institute Year Book 36 (1991), S. 127-149.
[66] Martin H. Geyer, Teuerungsprotest und Teuerungsunruhen 1914-1923. Selbsthilfe und Geldentwertung, in; Manfred Gailus / Heinrich Volkmann (Hrsg.), Der Kampf um das tägliche Brot. Nahrungsmittel, Versorgungspolitik und Protest 1770-1990, Opladen 1994, S. 319-345, hier: S. 325 sowie: Gerald D. Feldman, Max Warburg, Hugo Stinnes und das Problem des Antisemitismus in der frühen Weimarer Republik, in: Michael Grüttner u. A. (Hrsg.), Geschichte und Emanzipation. Festschrift für Reinhard Rürup, Frankfurt a. M. 1999, S. 315-332, hier: S. 316.
[67] Morgenthaler 1991, S. 148f.
[68] Cornelia Hecht, Deutsche Juden und Antisemitismus in der Weimarer Republik, Bonn 2003, S. 336.
[69] Centralverein an die Landesverbände und Ortsgruppen vom 10. Dezember 1930, zit. nach Arnold Paucker, Der jüdische Abwehrkampf gegen Antisemitismus und Nationalsozialismus in den letzten Jahren der Weimarer Republik, Hamburg 1968, S. 196f.
[70] Peter Longerich, Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung, München 1998, S. 21.
[71] Moshe Zimmermann, Die deutschen Juden 1914-1945, München 1996, S. 44; sowie Eva G. Reichmann, Flucht in den Hass. Die Ursachen der Judenkatastrophe, Frankfurt a. M. 1956, S. 279.
[72] Hecht 2003, S. 344
[73] Ebd.
[74] Ebd., S. 403.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836608244
- Dateigröße
- 573 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin – Philosophische Fakultät I, Geschichtswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- nationalsozialismus kempinski arisierung nazis berlin
- Produktsicherheit
- Diplom.de