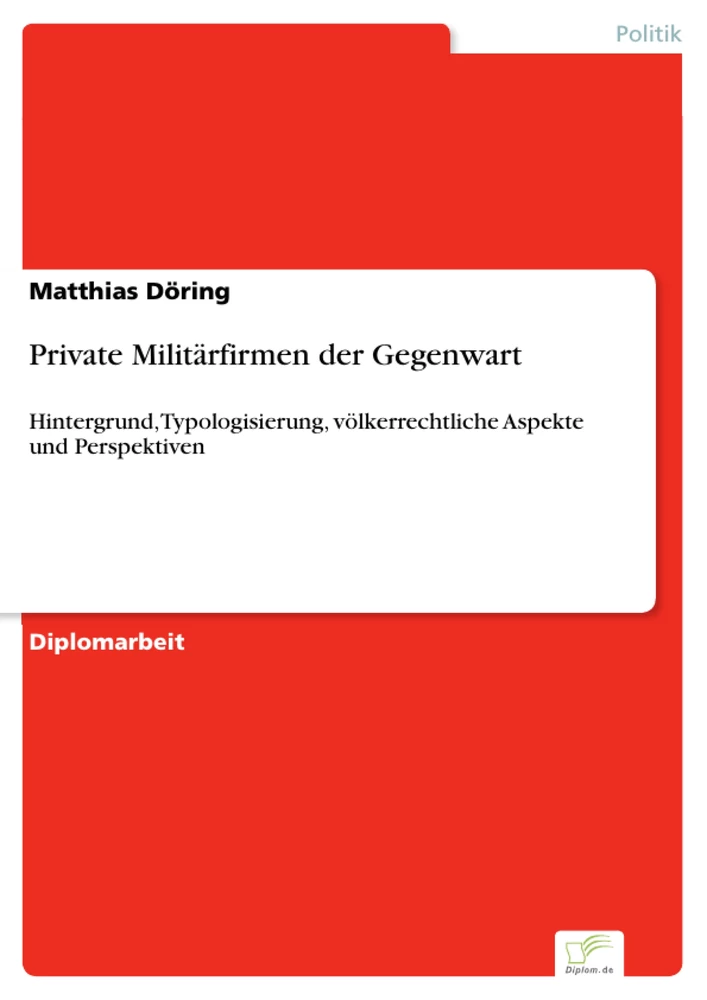Private Militärfirmen der Gegenwart
Hintergrund, Typologisierung, völkerrechtliche Aspekte und Perspektiven
Zusammenfassung
Ziel dieser Arbeit ist es, die konkreten Herausforderungen, welche die aktuelle Entwicklung auf dem Sicherheitssektor an die einzelnen Staaten und die internationale Staatengemeinschaft stellt, herauszuarbeiten und dort, wo ein Handlungsbedarf zur Lösung identifizierbarer Problemstellungen erkennbar ist, praktikable Vorschläge für eine Verbesserung der momentanen völkerrechtlichen und damit auch politischen Situation zu entwickeln.
Um der diffizilen Greifbarkeit und Eingrenzbarkeit der zu behandelnden Materie entgegenzuwirken, beginnt diese Arbeit mit einer Zusammenschau der geschichtlichen Entwicklungslinien des Söldnerbegriffs und der entsprechenden völkerrechtlichen Reaktionen auf diese Privatisierungstendenzen staatlicher Gewalt. Obwohl die Angestellten der PMFs mit ihren Vorläufern nur noch bedingt vergleichbar sind, können die Beispiele aus der Historie doch hilfreich sein, um den Blick für die Entstehungsbedingungen des Söldnertums zu schärfen und negative wie positive Folgen besser zu verstehen, die mit der Privatisierung äußerer Sicherheit verbunden sind.
Kapitel 3 dient der anschließenden Differenzierung der modernen privaten Militäranbieter von ihren historischen Wurzeln. Um dies zu komplettieren, enthält der letzte Abschnitt von Kapitel 3 den Versuch einer typologischen Erfassung und Abgrenzung der einzelnen Akteure der Gewaltprivatisierung über einen tätigkeitsbezogenen Ansatz mit graphischer Umsetzung.
Diese Erfassung des Tätigkeitsbereichs fungiert als Basis für die im Kapitel 4 erfolgende Identifikation sich aktuell stellender Problemfelder. Neben den mit der Entstehung des modernen Gewaltmarkts verknüpften Fragestellungen ist hierbei vor allem die völkerrechtliche Problematik von Interesse. Zur Untersuchung der diesbezüglichen Aspekte wird zuerst der Status der Mitarbeiter solcher Firmen in internationalen und nicht-internationalen bewaffneten Konflikten bestimmt. Im darauf folgenden Abschnitt wird dann geklärt, welche Konsequenzen sich daraus für die Rechtsposition der Mitarbeiter solcher Firmen in Konfliktregionen ergeben. Ergänzt werden diese Untersuchungen von einer Betrachtung der existierenden Regelungen zur jeweiligen Verantwortlichkeit von Staaten und Firmen bei einer PMF-Operation. Durch die im letzten Abschnitt dieses Kapitels erfolgende zusammenfassende Lagefeststellung der mit einem PMF-Einsatz verbundenen Vor- und Nachteile kann schließlich ergründet werden, ob ein genereller […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Problemfeld
1.2 Zielsetzung, Aufbau und Quellenlage der Arbeit
2 (Rechts-)historische Entwicklung der Gewaltprivatisierung
2.1 Von der Antike zum Haager Abkommen 1907
2.1.1 Ursprung des Staatenkriegs – Anfang militärischer Privatisierung
2.1.2 Wandel im Angesicht der Verstaatlichung von Gewalt
2.2 African Nightmares: Söldner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
2.2.1 Ausgangssituation und erste Entwicklungen nach Ende des II. Weltkrieges
2.2.2 Die Internationalen Konventionen zum Söldnerwesen
2.3 Zwischenfazit der rechtshistorischen Entwicklung
3 Das Ende des Kalten Kriegs – Anfang einer neuen Ära
3.1 Ursachen für die Privatisierung der Gewalt
3.1.1 Destabilisierungsfaktor ’New Wars’
3.1.2 Reformationsfaktor ’Transformation der Streitkräfte’
3.2 Akteure, Aktivitäten und Einsatzgebiete der Gegenwart
3.2.1 Einsatzprofile im Auftrag der ’strong states’
3.2.2 Einsatzprofile im Umfeld schwacher Staaten
3.2.3 Organisationsstrukturen und Personalmanagement
3.3 Zwischen Söldnerverband und privater Militärfirma – Versuch einer Typologisierung des privatisierten Gewaltmarktes
4 Privatakteure in Gegenwart und Zukunft – Risiko oder Chance?
4.1 Komplexe Wechselwirkungen als Folge des modernen Gewaltmarktes
4.1.1 Vertragsrechtliche Problematik
4.1.2 Outsourcing als Strategie ökonomisch-politischer Kostenvermeidung
4.1.3 Herausforderung für Transparenz und Verantwortungszuweisung
4.1.4 VN und NGOs: Privatisierung im Peacekeeping-Umfeld
4.2 Soldat ohne Armee oder bewaffneter Zivilist – Rechtliche Fragestellungen
4.2.1 Das Problem der PMF-Kategorisierung: Kombattant vs. Zivilist
4.2.2 Folgen für die Rechtsposition der PMF-Mitarbeiter in bewaffneten Konflikten
4.2.3 Verantwortlichkeiten und Rechtsrealisierung
4.3 Zwischenfazit der Problemfeldanalyse
5 Regulierung als Option kontrollierter Privatisierung
5.1 Nationale Regulierungsansätze der Gegenwart
5.1.1 Südafrika
5.1.2 USA
5.1.3 Großbritannien
5.1.4 Deutschland
5.2 Mittel zur Systemoptimierung: Der Mehrschichtansatz
5.2.1 Optionen zur Verbesserung der nationalen Regularien
5.2.2 und weitere Möglichkeiten anderer Ebenen
6 Lessons Learned: Zusammenfassung und Schlusswort
Literaturverzeichnis
Aufsätze
Zeitungsartikel
Monographien
Sammelbände
Veröffentlichungen von Exekutive, Legislative, Judikative nach Nationen
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Südafrika
Vereinigte Staaten von Amerika
Vereinte Nationen
Weitere Rechtsquellen und Urteile
Internetquellen
Anlagen
Erklärung
Kurzfassung
Die private Sicherheitsindustrie ist auf dem Vormarsch. Obwohl nach traditionellem Verständnis sowohl die Kriegsführung an sich als auch die damit in Verbindung stehenden Aufgaben staatlichen Organen vorbehalten sein sollten, sind private Militäranbieter integraler Bestandteil der amerikanischen Nachkriegsanstrengungen in Afghanistan und im Irak geworden. Auch wenn die Mitarbeiter dieser Firmen dabei nicht primär als Kombattanten auftreten, basieren die von ihnen erbrachten Dienstleistungen auf den Bedürfnissen verschiedener nationaler und internationaler, staatlicher und ziviler Auftraggeber im Zuge potentieller, aktueller oder beendeter Konflikte. Sie beschützen Nachschubkonvois genauso wie hochrangige Vertreter offizieller Abordnungen, verhören Gefangene und sind im Rahmen militärischer Operationen als Berater und Unterstützer regulärer militärischer Kräfte tätig. Der adäquate Umgang mit diesem Phänomen stellt sowohl für politische Entscheidungsträger als auch militärische Befehlshaber auf operativer, rechtlicher und moralischer Ebene eine Herausforderung dar. Private Militärfirmen, die im Auftrag und Namen eines Staates operieren, genießen teilweise selbst im Falle gravierender Menschenrechtsverletzungen Immunität vor der Strafverfolgung im Einsatzland. Sie betreffende Regularien existieren zwar in begrenztem Umfang, tragen der Massivität und Intensität ihres Auftretens jedoch nur eingeschränkt Rechnung. Diese Arbeit untersucht die Problematiken, die mit dem zunehmenden Einsatz jener Firmen verbunden sind und nimmt auf diese Bezug, um Möglichkeiten für eine zukünftig besser angepasste Regulation aufzuzeigen. Eine solche hat der Komplexität des Industriezweiges und den mannigfaltigen Interessen, denen ihr Einsatz dient, gerecht zu werden. Um den Wirkungsgrad der bestehenden Überwachungssysteme bezüglich der Faktoren Transparenz und Verantwortungszuweisung zu steigern, müssen die bestehenden einzelstaatlichen und internationalen Initiativen auf Basis der bisher gemachten Erfahrungen inhaltlich ergänzt und zu einem mehrschichtigen Regulierungsansatz erweitert werden. Eine Verbesserung der momentanen Rechtslage hängt dabei maßgeblich vom politischen Willen vor allem der im PMF-Sektor einflussreichen westlichen Staaten ab, diese Optionen zukünftig umzusetzen und die Vereinheitlichung auf regionaler Ebene voranzutreiben.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung
„Wir haben hier mehr Generäle pro Quadratmeter als im Pentagon.“ [1]
Harry E. Soyster, CEO von Military Professional Incorporated (MPRI)
Das Konzept der Staatensouveränität und mit ihr die Vorstellung von der alleinigen Verfügungsgewalt des Staates über die militärischen Mittel stellt spätestens seit dem Westfälischen Frieden und der Entwaffnung der Wallensteinschen Miliz ein Leitprinzip internationaler Beziehungen und damit auch des Völkerrechts dar.[2] Denn „ it is on this basis that states are recognized as having the right and capacity to declare war, act in self defense, sign peace treaties, etc.” [3] Obwohl dieses Selbstverständnis auch dem vielfach postulierten Anspruch des modernen Staates zugrunde liegt, seine Bürger alleinverantwortlich vor äußerer und innerer Instabilität und Gefahr zu beschützen,[4] war es privaten Firmen nach Ende des Kalten Krieges möglich, sich über die Erbringung militärischer Dienstleistungen einen globalen Absatzmarkt zu erschließen, der mit über 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz beziffert wird.[5] Aufgrund des aktuellen Trends der staatlichen Privatisierungsmaßnahmen scheint es, als müsse der moderne Staat die Rolle des alleinigen Trägers aller Gewalt in Teilen bereits jetzt, zukünftig aber noch verstärkt mit weiteren nichtstaatlichen Protagonisten teilen.[6] Selbst wenn man sich angesichts dieses Wachstums privater Kräfte nicht der Meinung anschließen will, dass folglich „any none–state actor[s] engaging in violence, including mercenaries, [and] PMFs, [can] be classified as a threat to state sovereignty,” [7] muss man doch zumindest anerkennen, dass „ neben die staatlichen Akteure in den internationalen Beziehungen die sog. nicht-staatlichen […] getreten [sind],“ [8] die als Nutznießer der sich wandelnden Weltordnung ihre eigenen Interessen in die internationalen Beziehungen mit einbringen und auf deren Verlauf zunehmend Einfluss ausüben.[9]
1.1 Problemfeld
Der mögliche Einfluss auf die internationalen Beziehungen lässt sich zum Einen an den ambivalenten Auswirkungen ermessen, die der Einsatz klassischer privater Söldnerverbände und damals neuartiger PMFs auf den Verlauf und die Intensität der Dekolonialisierungskriege in Afrika und deren Folgekonflikte hatte. Bereits dort trug ihr Engagement sowohl zur kurzfristigen Befriedung und Entspannung bei, führte aber auch zur Destabilisierung schwacher Regierungen.[10] Neben diesen Erfahrungen hat andererseits auch der massive Einsatz privater Anbieter seitens der USA im Irak „uncovered the tip of what is in fact a very large iceberg of a problem.“ [11] PMFs übernahmen hier verschiedenste, ehemals dem Militär vorbehaltene Rollen, von der Wartung und Bedienung hoch entwickelter Waffensysteme wie unbewaffneter Predator-Aufklärungsdrohnen bis hin zum Personenschutz wichtiger Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Chef der Übergangsregierung CPA, Paul Bremer.[12]
Insgesamt ist „ dieses neue Dienstleistungsuniversum […] wahrscheinlich noch diversifizierter und spezialisierter als die Konsumgüterbranche.“ [13] PMFs protegieren einerseits humanitäre Organisationen und ermöglichen so die Realisierung von Hilfsprojekten in politisch instabilen Regionen, andererseits sind sie an undurchsichtigen und ob ihrer Völkerrechtskonformität fragwürdigen Aktionen westlicher Regierungen in Südamerika und der Dritten Welt beteiligt.[14] Dieser Zustand wirft natürlicherweise Fragen bezüglich der Legalität und der möglichen Transparenz solcher Unternehmungen beziehungsweise hinsichtlich vorhandener oder zu entwickelnder Reglementierungsmöglichkeiten für deren Einhegung auf.[15] Für die Zukunft sind deshalb adäquate Lösungen für den Umgang mit diesen Organisationen und deren Mitarbeitern notwendig. Zumal die Soldaten regulärer Einheiten den Privaten in den Konfliktgebieten der Welt vermehrt gegenübertreten oder mit Ihnen kooperieren und hierbei Handlungssicherheit benötigen. Wo solche Lösungsoptionen noch nicht vorhanden sind, müssen sie geschaffen werden.[16] Überholte politische und rechtliche Ansätze vergangener Zeiten, wie etwa aus denen des Kalten Krieges, müssen überprüft und an die Gegebenheiten und möglichen Folgen eines von multinationalen Unternehmen dominierten, vernetzten Gewaltmarktes mit ungehemmtem Wachstumspotential angepasst werden.[17]
1.2 Zielsetzung, Aufbau und Quellenlage der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, die konkreten Herausforderungen, welche die aktuelle Entwicklung auf dem Sicherheitssektor an die einzelnen Staaten und die internationale Staatengemeinschaft stellt, herauszuarbeiten und dort, wo ein Handlungsbedarf zur Lösung identifizierbarer Problemstellungen erkennbar ist, praktikable Vorschläge für eine Verbesserung der momentanen völkerrechtlichen und damit auch politischen Situation zu entwickeln.
Um der diffizilen Greifbarkeit und Eingrenzbarkeit der zu behandelnden Materie entgegenzuwirken, beginnt diese Arbeit mit einer Zusammenschau der geschichtlichen Entwicklungslinien des Söldnerbegriffs und der entsprechenden völkerrechtlichen Reaktionen auf diese Privatisierungstendenzen staatlicher Gewalt. Obwohl die Angestellten der PMFs mit ihren Vorläufern nur noch bedingt vergleichbar sind, können die Beispiele aus der Historie doch hilfreich sein, um den Blick für die Entstehungsbedingungen des Söldnertums zu schärfen und negative wie positive Folgen besser zu verstehen, die mit der Privatisierung äußerer Sicherheit verbunden sind. Kapitel 3 dient der anschließenden Differenzierung der modernen privaten Militäranbieter von ihren historischen Wurzeln.[18] Um dies zu komplettieren, enthält der letzte Abschnitt von Kapitel 3 den Versuch einer typologischen Erfassung und Abgrenzung der einzelnen Akteure der Gewaltprivatisierung über einen tätigkeitsbezogenen Ansatz mit graphischer Umsetzung.[19]
Diese Erfassung des Tätigkeitsbereichs fungiert als Basis für die im Kapitel 4 erfolgende Identifikation sich aktuell stellender Problemfelder. Neben den mit der Entstehung des modernen Gewaltmarkts verknüpften Fragestellungen ist hierbei vor allem die völkerrechtliche Problematik von Interesse. Zur Untersuchung der diesbezüglichen Aspekte wird zuerst der Status der Mitarbeiter solcher Firmen in internationalen und nicht-internationalen bewaffneten Konflikten bestimmt.[20] Im darauf folgenden Abschnitt wird dann geklärt, welche Konsequenzen sich daraus für die Rechtsposition der Mitarbeiter solcher Firmen in Konfliktregionen ergeben.[21] Ergänzt werden diese Untersuchungen von einer Betrachtung der existierenden Regelungen zur jeweiligen Verantwortlichkeit von Staaten und Firmen bei einer PMF-Operation.[22] Durch die im letzten Abschnitt dieses Kapitels erfolgende zusammenfassende Lagefeststellung der mit einem PMF-Einsatz verbundenen Vor- und Nachteile kann schließlich ergründet werden, ob ein genereller Bedarf für eine völkerrechtliche Regulierung des PMF-Sektors besteht und welchen Umfang diese haben sollte.
Zu Anfang des Kapitel 5 wird anschließend festgestellt, mit welchen momentan vorhandenen Mitteln sich der Absatzmarkt privater Militärfirmen überwachen und regulieren lässt und inwiefern diese für die momentan identifizierbaren Problemfelder als ausreichend zu bewerten sind oder weiterentwickelt werden müssen.[23] Unter Rückgriff auf diese zuvor gewonnenen Ergebnisse werden mögliche praktikable Herangehensweisen für den zukünftigen Umgang mit jenen identifizierten Herausforderungen eruiert. Aus den so erarbeiteten Handlungsoptionen einzelner Staaten, regionaler und internationaler Organisationen sowie der Firmen selbst lassen sich dann entsprechend dem anfangs formulierten Ziel dieser Arbeit Optimierungsansätze für die Zukunft ableiten.[24] Kapitel 6 beinhaltet letztlich ein die maßgeblichen Erkenntnisse der Arbeit nochmals zusammenfassendes Fazit.
Die Recherche gestaltete sich aufgrund einer komplexen Quellenlage teilweise als schwierig. Da zu dem hier behandelten Thema nur wenige Primärquellen wie Vertragsdaten oder anderes internes Material zu Firmenaktivitäten für den wissenschaftlichen Zugang erschlossen sind, musste sich diese Arbeit bei der Marktanalyse zu einem großen Teil auf Sekundärquellen stützen. Gerade über das Tätigkeitsfeld der einzelnen Firmen, ihre Strukturen und Netzwerke ist nur sehr wenig Einblick zu gewinnen. Neben der Tatsache, dass es sich um einen in den heute zu beobachtenden Ausmaßen recht jungen Industriezweig handelt, liegt dies nicht zuletzt an den hochsensiblen Aufgabenfeldern dieser Organisationen: Diskretion über Geschäftsverbindungen ist hier zu einem wichtigen Wettbewerbskriterium und Markenzeichen geworden, das von den Firmen dementsprechend gehütet wird.[25] Erschwerend kam hinzu, dass zwar zahlreiche themenbezogene Zeitungs- und Zeitschriftenartikel veröffentlicht wurden, sich allerdings davon viele – da oft stark polarisierend und sensationsorientiert verfasst – für eine wissenschaftliche Auswertung als nur eingeschränkt geeignet erwiesen, was die zitierfähigen Quellen weiter reduzierte.[26] Ähnlich wirkte sich aus, dass bisher zwar einige wenige Monographien und Übersichtswerke existieren, jedoch bis dato keine mit einer völkerrechtlichen Schwerpunktbildung.
Innerhalb des mit wissenschaftlichem Anspruch publizierenden Umfelds – bei dem der Anteil der englischsprachigen Publikationen an der Literaturbasis sehr hoch ist – lassen sich drei Gruppierungen mit einer jeweils eigenen typischen Argumentationsstruktur identifizieren:[27]
Die Proponenten stellen aus einer pragmatisch-werbenden Position heraus die Vorzüge und Möglichkeiten kommerziell motivierter nicht-staatlicher Akteure – wie beispielsweise Kosteneffizienz oder verbesserte Reaktionsgeschwindigkeiten privatisierter Peacekeeping-Operationen – im Zusammenhang mit den gegenwärtig vorherrschenden asymmetrischen Konfliktszenarien in den Vordergrund.[28]
Die Analysten registrieren das neue Phänomen in den internationalen Beziehungen als faktisch existent und bringen es als solches in Zusammenhang mit Theorien politischen oder wirtschaftlichen Hintergrunds wie der weltweiten Globalisierung und ökonomisch begründeten Privatisierungstendenzen. Besonders hervorzuheben ist hier das den Aufstieg und das globale Wirken privater Militärfirmen in einem ganzheitlich-kritischen Ansatz behandelnde Werk Corporate Warriors von Peter Warren Singer, welches sich seit seinem Erscheinen 2003 als Standardwerk der Fachliteratur durchsetzen konnte.
Für die Bearbeitung der rechtlichen Fragestellung spielten neben einer Vielzahl von Fachaufsätzen zu Einzelaspekten der Problematik besonders die von Christian Schaller im September 2005 publizierte Studie Private Sicherheits- und Militärfirmen in bewaffneten Konflikten sowie der jüngst von Thomas Jäger und Gerhard Kümmel herausgegebene Sammelband Private Military and Security Companies eine wichtige Rolle.
Spätestens seit im März 2004 die Leichen von vier Mitarbeitern der US-Firma Blackwater Security Consulting in Fallujah verstümmelt, anschließend im Beisein der Medien an einen Brückenpfeiler gehängt und zeitgleich Skandale über Foltervorwürfe und überhöhte Rechnungen anderer Anbieter publik wurden, wächst die Zahl der entschiedenen Kritiker solcher Privatisierungsvorhaben.[29] Wobei auch hier die Meinungen von einem völligen Verbot bis zu der Befürwortung strengerer Kontrollen und rechtlicher Lösungen weit auseinander gehen.[30] Insgesamt kann der Stand der Forschung als uneinheitlich bezeichnet werden. So hat sich bis heute keine einheitliche Terminologie bezüglich der Firmenbezeichnungen durchsetzen können.[31] Ein eigenständiger Forschungsbereich scheint sich aus den Disziplinen der Politikwissenschaften sowie des Völkerrechts erst ansatzweise zu entwickeln.
2 (Rechts-)historische Entwicklung der Gewaltprivatisierung
„ 500 years after the demarcation between mercenary and standing armies, 700 years after the formation of the free companies, and 2300 years after Alexander employed mercenary Cretan archers, the international community again wrestles with the question of how to regulate mercenaries.” [32]
In der wissenschaftlichen Diskussion wird im Zusammenhang mit der heutigen Privatisierung im Sicherheits- und Militärsektor häufig die Frage aufgeworfen, inwieweit der Dualismus aus nationalstaatlich monopolisierter Macht im Sinne eines „ultimate symbol of the sovereignty“ [33] und anderen privaten Parallelkräften seit jeher besteht und ob die heutigen Tendenzen demzufolge wirklich, wie oft behauptet, einen Einzelfall der Geschichte darstellen.[34] Zur Beantwortung dieser Frage und als Grundlage für die weiterführende Analyse der heutigen Situation wird im Folgenden entsprechend dem in der Einführung erläuterten Aufbau dieser Arbeit zu klären sein, ob sich tatsächlich – wie von Milliard in obigem Zitat impliziert – Verbindungen zwischen den Söldnern der vergangenen Tage und den privaten Militärfirmen der heutigen Zeit finden lassen. Bei einer solchen Betrachtung ist auch die Entstehung einzelner, für die weitere Erörterung relevanter rechtlicher Konventionen, die als Reaktionen auf die historischen Entwicklungen kreiert wurden, in den historischen Kontext mit einzubeziehen.
2.1 Von der Antike zum Haager Abkommen 1907
„Die Söldner und Hilfstruppen sind unnütz und gefährlich, und wer seine Macht auf angeworbene Truppen stützt, der wird nie fest und sicher dastehen […]. Der Grund dafür ist, dass sie keine andre Liebe und keinen andren Anlass haben, im Felde zu liegen, als den geringen Sold.“ [35]
Niccolò Machiavelli, 1532
2.1.1 Ursprung des Staatenkriegs – Anfang militärischer Privatisierung
Söldner und Privatarmeen bestehen bereits seit Existenz des Krieges. Individuen, Gruppen oder Staaten nutzten sie immer dann, wenn sie selbst nicht in der Lage waren, die Umsetzung von Territorialansprüchen oder den Schutz des Eigentums in eigener Kraft sicherzustellen. Bereits die altertümlichen Armeen der Chinesen und der Griechen, aber auch die römischen Legionen waren zu einem großen Teil von verpflichteten Kräften abhängig.[36] Schon Ramses II hatte 1294 v. Chr. angeworbene Fremdtruppen genutzt, um die an Anzahl überlegenen Hethiter zu besiegen.[37] 413 v. Chr. setzten Athens Führer 1300 thrakische Schwertkämpfer zur Unterstützung ein – mit schrecklichen Folgen: „The Thracians bursting into Mycalessus sacked the houses and temples, and butchered the inhabitants, sparing neither youth nor age but killing all they fell in with.” [38] Trotz des frühen erfolgreichen Einsatzes von Söldnern barg ihr Engagement für den Armeeführer auch immer Risiken. Bereits die erste reine Söldnerarmee der Geschichte zeichnete ein ambivalentes Bild: Obwohl Karthago seine Macht beinahe komplett mit ausländischen Kräften aufgebaut und gesichert hatte, führte die nach der schmerzvollen Niederlage des ersten Punischen Krieges (264–241 v. Chr.) erfolgte Auflösung der teuren Söldnerverbände zu einem wahren „Mercenary War [in which] [t]he rebels were only put down when the Carthaginians were able to hire other mercenary units.“ [39] Im darauf folgenden zweiten Punischen Krieg kämpften die Privatverbände jedoch wieder überraschend loyal auf Seiten Hannibals– was zu einem nicht geringen Maße an den zuvor eroberten Silberminen und einer daraus resultierenden Zahlungsfähigkeit Karthagos gelegen haben dürfte.[40]
Solche und ähnliche Vorfälle, die im Verlauf der Geschichte immer wieder vorkamen, erklären das aus anfänglichen Ressentiments über die Jahrhunderte erwachsene, tief verwurzelte Misstrauen, welches Söldnern und PMFs auch in der aktuellen Diskussion immer wieder entgegengebracht wird.[41] Doch trotz aller negativen Erfahrungen nutzten Römer, Byzantiner und Mamelucken, Könige, Kaiser, Päpste und Fürsten vom Altertum über das gesamte Mittelalter hinweg in Ermangelung adäquater Alternativen immer wieder die Fähigkeiten dieser hochprofessionellen Einheiten.[42] So wurden beispielsweise mit der Entwicklung des Feudalsystems vermehrt Leibeigene zur Verrichtung einfachen Tätigkeiten in den Militärdienst verpflichtet, um in Zeiten mangelnder wirtschaftlicher Prosperität Geld zu sparen. Doch die Neuentwicklung komplexerer Waffensysteme wie etwa von Armbrüsten und Lanzen, später Kanonen, führte – ähnlich wie bei der Verbreitung von PMFs in der Gegenwart –[43] in Verbindung mit einem „revival of an urban-based commercial economy“ [44] im Bankensystem und auf dem Handelssektor zu einem nicht abreisenden Bedarf an qualifizierten Kräften.
Ein chronischer Bevölkerungsmangel trug ebenfalls dazu bei, dass einzelne italienische Städte letztendlich ihre gesamte Verteidigung privatisierten, um die Bevölkerung als Produktivkräfte des ökonomischen Systems zu schonen.[45]
Vor diesem Hintergrund ist es auch zu erklären, dass in der Frührenaissance des 14. Jahrhunderts während des hundertjährigen Krieges (1337–1453) schließlich die ersten kommerziellen Militärdienstleister mit konzernartigen Gewerbestrukturen nachgewiesen werden können:[46] In Italien bildeten sich Firmen mit einer eigenen Hierarchie und entsprechender Befehlsstruktur, an deren Spitze jeweils der verantwortliche Condottiere stand. Diese verpflichteten mittels vertraglicher Bindung – dem sogenannten condotte – neben Kämpfern auch Rechtsanwälte, Bankkaufleute und Händler, um ihre Geschäfte „like other commercial guilds at the time“ [47] zu organisieren und „[a]s men of business, […], their trade, the available markets and their competitors“ [48] zu analysieren. Durch ein systematisiertes Vertragswesen bürokratisierte der Staat die Auftragsvergabe an diese Firmen und übte so eine Kontrollfunktion auf die Söldner aus –[49] ein Verfahren, dessen Anwendbarkeit auch bei der heutigen Regulierungsdebatte immer wieder diskutiert wird.[50] Als spezielle Form der Privatisierung mittels von Staaten vergebener Verträge ist in diesem Zusammenhang das besonders von England und Frankreich praktizierte Kaperwesen zu nennen.[51]
Durch offizielle Kaperbriefe legitimiert und mit festgeschriebenen Prisenansprüchen für die in Kauf genommenen Risiken entschädigt, nahmen Privatinvestoren dem Staat die Last des Unterhalts einer teuren Flotte ab.[52]
2.1.2 Wandel im Angesicht der Verstaatlichung von Gewalt
Den Condottieri erwuchs bald Konkurrenz durch das Auftreten der Schweizer Garden und der Landsknechtsformationen. Diese, darunter viele deutsche Söldner, operierten bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts auf den Schlachtfeldern Europas, in Mexiko unter Cortéz ebenso wie in Südostasien. Erst die Entstehung fester staatlicher Gebilde und der finanzielle Aufschwung, der sich mit der Eroberung Amerikas in den Kolonialstaaten langsam einstellte, machte das Aufrechterhalten größerer ständiger Armeen unter der andauernden Kontrolle des Souveräns politisch sinnvoll und wirtschaftlich möglich. Die meisten Söldnerformationen wurden daraufhin über zwei Jahrhunderte sukzessiv in die ständigen Armeen der entstehenden Nationalstaaten integriert, die freien Söldnerverbände nahmen ab.[53]
Im Jahre 1648 wurde mit dem Zustandekommen des Westfälischen Friedens die Vorstellung vom souveränen, sich über das Gewaltmonopol definierenden Staat endgültig zur politischen Realität. Ohne staatliche Genehmigung war das Anbieten von Kriegsdiensten und Waffen von nun an untersagt.[54] Eine Ausnahme bildeten die Handelskompanien. Als staatlich zugelassene, zur Aufrechterhaltung des Fernhandels und Kolonialsystems geförderte Firmen konnten sie im 17. und frühen 18. Jahrhundert ihr Betätigungsfeld sichern und erweitern.[55] Mit einem Freibrief ausgestattet, welcher der jeweiligen Firma wirtschaftliche Vorrechte wie ein geographisch determiniertes Handelsmonopol zusicherte, und von privaten Anteilseignern finanziert, wurden sie zu dauerhaft bestehenden Kapitalgesellschaften, die durchaus mit modernen Aktiengesellschaften vergleichbar waren.[56]
Während das condottieri -System noch auf die italienischen Stadtstaaten begrenzt war, entwickelten Firmen wie die British South Africa Company oder die berühmte, im Jahre 1600 gegründete English East Indian Company schließlich „an embryonic form of [modern] PMC[s].“ [57] Das Bemerkenswerte an den damaligen Handelskompanien – was sie den heutigen PMFs besonders ähnlich macht – war, dass sie für den beauftragenden Staat in den ihnen zugewiesenen Regionen nicht nur eine Handelsfunktion wahrnahmen, sondern in dessen Vertretung auch autonome militärische Kompetenzen entwickelten, um ihre Ansprüche zu schützen. Ihr Ziel war es, einen ökonomischen Brückenkopf in neuen Gebieten zu bilden und in diesen Regionen ihren politischen Einfluss zu etablieren.[58] Einheimische Verbündete wurden erst auf Kosten der Firmen, später gegen Bezahlung durch europäische Söldner ausgebildet und ausgerüstet.[59]
So funktionierten die Privatarmeen in ihrem Einflussbereich einerseits wie heutige PMFs als Kräftemultiplikator der europäischen Mächte, andererseits wurde das Geschäft mit Waffen und Ausbildung einheimischer Armeen ein lukrativer Nebenverdienst der ursprünglich auf den Handel spezialisierten Großunternehmen.[60] Im Laufe der Zeit entwickelten sich Tochterunternehmen mit einer eigenen Organisation und unabhängigem Management. Zwar blieben sie in die übergeordneten, Handel treibenden Firmen integriert, aber „their military function set them apart, functionally and operationally, from other aspects of the charter business,” [61] weshalb sie insgesamt als das eigentliche historisches Antezedent der modernen PMFs bezeichnet werden können.[62] Mehr noch: In ihren Einflussgebieten waren die Handelsgesellschaften durch ihre autarken militärischen Strukturen der absolute Souverän, dem jegliche Macht untergeordnet war.[63]
Klammert man das Phänomen der Handelsgesellschaften einmal aus, war die wechselnde Einstellung zu Söldnern, die mit dem Westfälischen Frieden ihren Ausdruck fand, eng mit den sich transformierenden Formen von Regierung und sozialer Organisation verbunden. Hatten Könige des 15. und 16. Jahrhunderts zur Staatskonsolidierung noch auf sie vertraut, verpflichteten die erstarkenden Nationen des späten 17. und 18. Jahrhunderts vermehrt ihre eigenen Staatsbürger zum Dienst an der Waffe, um die militärischen Kräfte in ihrem Einflussbereich zu konzentrieren und dadurch die innere und äußere Sicherheit herzustellen und zu bewahren.[64]
Die Praxis der absolutistischen Staaten, eigene Truppen gegen Entgelt an andere Staaten zu verleihen, damit diese sie im Inneren gegen die aufbegehrenden Bürger einsetzen konnten und nicht die eigenen Bürgersoldaten auf ihresgleichen schießen lassen mussten – was im schlimmsten Fall zu einer Revolte hätte führen können – war von diesen Veränderungen jedoch nicht betroffen.[65]
Die Verstaatlichung der Gewalt hatte somit zwar nicht direkt zum Ende der Involvierung privater Kräfte in das Kriegshandwerk geführt, aber der Verrechtlichung des Krieges den Weg geebnet.[66] Dieser fand nun nicht mehr als Auftragsgeschäft zwischen Privaten statt, sondern als Staatenkrieg zwischen Gleichen, weshalb sich die Kriegshandlungen nur gegen die bewaffnete Macht des Gegners richten durften. Hier ist die Wurzel des völkerrechtlichen Kombattantenbegriffes in seiner Abgrenzung zum Nichtkombattanten zu finden, im Zuge dessen auch der Status des Soldaten gewisse Veränderungen erfuhr: Wahrgenommen als Organ des Staates, der seine Pflicht erfüllt, konnte er im Falle der Gefangennahme und Verwundung bestimmte Rechte in Anspruch nehmen. „Während im ausgehenden Mittelalter der Krieg selbst zu einem Teil des Wirtschaftsleben [sic!] mit [z. B.] den italienischen Condottiere geworden war, konnte nun staatliche Gewaltanwendung von privatem Erwerbsleben getrennt werden,“ [67] was zu einer tiefgehenden Zivilisierung des öffentlichen Lebens führte.[68]
Obwohl selbst Napoleon – trotz des Verbots der Söldnerei auf französischem Boden von 1790 – nochmals große Söldnerformationen in die Schlacht führte, war es diese Zivilisierung, die das langsame Ende der Söldnerära einläutete und dahingegen Volksheere im 19. Jahrhundert für viele Staaten immer attraktiver machte.[69] Der dafür maßgebliche Grund ist in der zur damaligen Zeit fortschreitenden Verbreitung nationalistischer Ideen zu suchen, die sich im Zuge der erwähnten Zivilisierung im politischen Umfeld mehr und mehr durchsetzten.[70] Das Konzept einer mit dem Staat durch eine eindeutigen Hierarchie verbundenen Bürgerarmee fügte sich in solche Systeme, die neben ihren politischen Idealen vor allem durch einen hohen Grad an Bürokratisierung staatlicher Strukturen gekennzeichnet waren, insgesamt besser ein als ohne Patriotismus kämpfende Söldnergruppierungen.[71] Wehrpflichtarmeen wurden vermehrt zu einem akzeptierten Element staatlicher Souveränität, bis sie am Ende des 19. Jahrhunderts schließlich als „embodiment of the Nation“ [72] wahrgenommen wurden.
Parallel zu dieser politisch motivierten Verstaatlichung von Gewalt schritt auch die Verrechtlichung des Krieges voran. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden schließlich entsprechende völkerrechtlich verbindliche Grundsätze, die auch den Einsatz von Söldnern mit einschlossen.[73] Das erste dieser Art war das IV. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907, welches Gesetze und Gebräuche des Landkriegs beinhaltet.[74] In der Anlage zum Abkommen ist in Artikel 1 ausdrücklich festgehalten, dass Söldner – soweit sie die für Milizen und Freiwilligen-Korps geltenden Bedingungen erfüllen – wie Soldaten zu behandeln sind.[75] Das V. Haager Abkommen hatte demgegenüber zum Ziel, Rechte und Pflichten von neutralen Staaten bezüglich der Beziehungen zu anderen Staaten im Falle eines solchen Konfliktes festzulegen und darüber hinaus die Rechtsposition von sich in solchen neutralen Staaten aufhaltenden Kriegsteilnehmern zu definieren.[76] So ist es einem neutralen Staat nach Art. 4 HA V aufgrund der Pflicht zur Neutralitätswahrung untersagt, die Bildung von Korps von Kombattanten oder die Eröffnung von Werbestellen zugunsten der Kriegführenden zu dulden. Dies impliziert, dass der Staat gegen solche Aktionen, sofern sie ihm bekannt werden, auch vorgehen muss.[77] Waffenhandel oder andere kriegsrelevante Materiallieferungen sind von dieser Regelung jedoch nach Art. 7 HA V ausgeschlossen und somit weiterhin möglich.
Da die aus der Neutralität abzuleitende Verantwortung nach Art. 6 HA V explizit nicht betroffen ist, insofern einzelne Individuen dieser Staaten die Grenze überschreiten dürfen, um sich einer Kriegspartei anzuschließen, kann bezüglich des Status des Individuums impliziert werden, dass der einzelne Söldner nach dem HA V prinzipiell dem Soldaten gleichgestellt und auch auf neutralem Staatsgebiet dementsprechend zu behandeln ist.[78]
Das Individuum, das seine Kriegsdienste anbietet, wird durch die Neutralitätsverpflichtung seines Heimatstaates nur insofern tangiert, als dass es keine Unterstützungsleistungen seiner Regierung zu erwarten hat und sich nicht auf die Neutralität seines Heimatstaates berufen kann.[79] Darüber hinaus wird dem Söldner die Berufsausübung jedoch nicht weiter eingeschränkt.[80]
Im Endeffekt registriert das V. Haager Abkommen zwar die Söldnerproblematik, aber ohne eine Kriminalisierung des einzelnen Söldners zu bewirken. Aber auch wenn sich somit selbst zu Anfang der 20. Jahrhunderts noch keine expliziten völkerrechtlich verbindlichen Söldnerverbote durchsetzen konnten, ist doch festzuhalten, dass die nationalstaatliche Idee, unter welcher der Kampf für die eigene Nation als hoher anzustrebender Wert angesehen wurde, das egoistische Kämpfen für Geld zumindest kulturell und politisch bis zu diesem Zeitraum entscheidend disqualifiziert hatte.[81] Söldner wurden als illoyal betrachtet und als Gefährdung der staatlichen Souveränität weitgehend abgelehnt, so dass zumindest von Seiten der europäischen Mächte nur mehr eine begrenzte Nachfrage nach solchen Dienstleistungen vorherrschte – und für solch speziellen Aufgaben wurden Söldner dann meist sogar als integraler Bestandteil der jeweiligen Armeen genutzt.[82] „Wer sich daher in den letzten 200 Jahren noch als Söldner verdingen wollte, den trieb die internationale Ächtung meist in weite Ferne,“ [83] so dass Arabien, Indochina, Afrika und Südamerika bis zum letzten Drittel des 20. Jahrhunderts auch für viele deutsche Söldner zu Heimat und Arbeitsplatz wurden.
2.2 African Nightmares: Söldner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
2.2.1 Ausgangssituation und erste Entwicklungen nach Ende des II. Weltkrieges
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten sich auf den Kriegsschauplätzen der Moderne Wehrdienstarmeen durchgesetzt.[84] Der rechtliche Status der wenigen aktiven Söldner wurde nicht besonders beachtet, sondern erfuhr lediglich im Rahmen der am Ende des letzten Abschnitts genannten Abkommen eine indirekte Würdigung. Zu einem Perspektivenwechsel kam es erst, als nach dem Ende des 2. Weltkriegs die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Jene gestattet kriegerische Handlungen in Übereinstimmung mit Art. 2 IV VN-Charta nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Selbstverteidigung und für durch den Sicherheitsrat beschlossene Zwangsmaßnahmen.[85] Das Engagement von Söldnern wurde nun als Gefährdung für „both the spirit and philosophy of this new order“ [86] wahrgenommen. Allerdings war diese Wahrnehmungsveränderung nicht so stark, als dass sich dies auf der Handlungsebene widergespiegelt hätte. Dies mag zum Teil auch daran gelegen haben, dass der aufflammende Kalte Krieg der Internationalen Gemeinschaft eine höhere Aufmerksamkeitspriorität abverlangte und die Söldneraktivitäten in dieser Phase zumeist nur außerhalb der westlichen Welt stattfanden.[87] Jedenfalls folgten die Genfer Abkommen von 1949,[88] welche der Zielsetzung nach zukünftige Kriegsaktivitäten zu regeln und eine faire Behandlung Kriegsgefangener sicherzustellen beabsichtigten, weitgehend der Linie der Haager Abkommens von 1907 und 1910, ohne eine gesonderte rechtliche Würdigung der Söldnerthematik umzusetzen.[89].
Wirkliche Veränderungen der Situation sind erst in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts festzustellen, als Söldnerverbände in Afrika als Protagonisten der Dekolonialisierungskriege eine Renaissance erlebten.[90] Von dortigen Staaten in Ermangelung eigener Truppen angeheuert und oftmals mit Rohstoffen und Konzessionsrechten bezahlt, führten sie beispielsweise in Belgisch-Kongo Rebellen im Gefecht gegen die im Land tätigen VN-Friedenstruppen oder unterstützten in Nigeria von 1967–1977 Regierung und Separatisten gleichermaßen.[91] Oft wurden sie auch von den um ihren Einfluss bangenden europäischen Mächten eingesetzt, um Befreiungsbewegungen niederzuhalten oder noch schwache junge Regierungen zu destabilisieren. Großbritanniens Geheimdienst SIS leistete beispielsweise von 1962–1967 Hilfe bei der Gründung von Watchguard International, einer aus ehemaligen britischen SAS-Soldaten bestehenden Scheinfirma, die im Jemen und in Libyen als verlängerter Arm der britischen Regierung tätig wurde.[92]
Die moralisch und rechtlich fragwürdigen Aktionen der Les Affreux [93] – welche die Interessen der verschiedensten Parteien gegen Entgelt vertraten –trugen sehr zum heutigen negativen Verständnis des Begriffs Söldner bei und erregten auch bereits zur damaligen Zeit großen Unmut.[94] Internationale Aufmerksamkeit kam in diesem Zusammenhang dem Luanda-Tribunal von 1976 zu, in dem zehn britische und drei amerikanische Staatsbürger, die auf Seiten der FNLA mit besonderer Aggressivität und Grausamkeit gekämpft hatten, vor dem Angolan Revolutionary Tribunal wegen eines „crime of mercenarism“ [95] für schuldig befunden und zu langjährigen Haftstrafen beziehungsweise in vier Fällen zum Tode verurteilt wurden.[96] Aufgrund von Verfahrensmängeln und der Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Tribunals weder eine nationale strafrechtliche Komponente noch eine völkerrechtliche Norm existierte, nach der eine individuelle Verantwortlichkeit der Söldner für solche Handlungen begründet gewesen wäre, sah sich sowohl das Prozedere als auch das Urteil des Tribunals schwerer internationaler Kritik ausgesetzt.[97] Der Ruf nach einer einheitlichen Regelung seitens der Vereinten Nationen wurde lauter.[98]
Die VN reagierten mit der Verabschiedung einer Reihe von Resolutionen, welche – obwohl nur in begrenztem Umfang bindend[99] – zu einer näheren Auseinandersetzung mit dem Söldner-Phänomen beitrugen:
Die Basis der Überlegungen zur Entwicklung der Resolutionsinhalte bildete der Rückgriff auf die bereits seit dem Altertum bekannte bellum-justum- Doktrin. Dieser Idee des gerechten Krieges folgend wurde das Streben der Afrikanischen Befreiungsbewegungen nach Unabhängigkeit als legitime und gerechtfertigte Handlung auf dem Weg zur Selbstbestimmung interpretiert.[100] Ergo war jede dem Streben dieser Bewegungen entgegengerichtete Handlung als ungerechtfertigter illegaler Angriff aufzufassen.
Als Konsequenz dieser Logik verurteilte schon die 1967 vom VN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution 241 den Einsatz von Söldnerfirmen während des Umsturzes afrikanischer Nationalstaaten.[101] Die Generalversammlung formulierte im gleichen Jahr mit derselben Intention wie der Sicherheitsrat eine allgemeiner gefasste Resolution, indem sie die finanzielle Unterstützung bewaffneter Aktivitäten zum Zwecke von Regierungsstürzen oder das Einmischen in Bürgerkriege und andere innerstaatliche Angelegenheiten ächtete.[102] Diese Zielrichtung wurde 1968 konkretisiert, als die UNGA-Resolution 2465 die Anwesenheit von Söldnern sowie deren Verpflichtung als unrechtmäßig erklärte, soweit sie in Kolonialgebieten gegen Befreiungsbewegungen eingesetzt würden.[103] Mit der drei Jahre später folgenden UNGA-Resolution 2625 wurde dieser Kurs fortgeführt, indem die Regelungen des V. Haager Abkommens zur Neutralität eines Staates modifiziert wurden.[104] Hatte nach der traditionellen Sichtweise im Falle des Kriegszustandes zwischen zwei Staaten nur der neutrale Staat die Pflicht, die Rekrutierung von Söldnern zugunsten einer der Kriegsparteien auf seinem Territorium zu verhindern,[105] sollten nun alle Staaten der Organisation bewaffneter Gruppen auf ihrem Territorium für den Fall entgegentreten, dass diese in anderen Staaten Einfluss nehmen könnten. Indem die UNGA-Resolution 2625 den Wirkungsbereich des V. Haager Abkommens erweiterte, war somit eine allgemeine Ächtung der staatlichen Förderung von Söldneraktivitäten auf dem eigenen Territorium zuungunsten eines anderen Staates geschaffen worden.[106]
2.2.2 Die Internationalen Konventionen zum Söldnerwesen
Die Resolutionen des VN-Sicherheitsrats und der Generalversammlung hatten die Nutzung von Söldnern als eine auf Destabilisierung und Verletzung territorialer Souveränität ausgerichtete Form der externen Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates interpretiert. In logischer Konsequenz hatten sie sich restriktiv immer gegen den Staat gerichtet, die private Nutzung von Söldnerverbänden oder einzelnen Söldnern jedoch weitestgehend ignoriert. Dem Staat war es folglich möglich, die private Nutzung weiter zu gestatten und auf den Verlauf von Konflikten Einfluss zu nehmen, solange er nicht direkt als Investor auftrat.[107] Außerdem war mit der Verabschiedung der Resolutionen zwar ein wichtiger Schritt zur Schaffung internationaler Grundsätze bezüglich des Söldnerwesens getan worden, allerdings wurde weiterhin den einzelnen Regierungen die Verantwortung bezüglich der Umsetzung konzediert, ohne zu berücksichtigen, dass gerade viele Staaten, in denen Söldner rekrutiert und ausgebildet wurden, durchaus ein Interesse an dem Weiterbestehen solcher Organisationen hatten.[108]
Neben den Resolutionen musste also weiterführend verbindliches Völkerrecht geschaffen werden. Humanitäres Völkerrecht verfolgt dabei in bewaffneten Konflikten generell zwei Ansätze: einerseits die Kodifizierung einheitlicher Verfahrensregeln für den geregelten Ablauf der Konflikte, zweitens die Festlegung von protektorischen Bestimmungen, die den Betroffenen des Konflikts – namentlich Kombattanten und Nicht-Kombattanten – einen ihrem Status entsprechenden individuellen und kollektiven Schutz verschaffen, ohne auf die Hintergrundgegebenheiten wie Ursache oder Legalität des Konflikts abzustellen.[109]
Dieses Rechtsverständnis spiegelt sich auch in der Formulierung der rechtlichen Bestimmungen wider, die in den konkret auf die Söldnerproblematik bezogenen völkerrechtlichen Vereinbarungen enthalten sind. Auch in diesen, namentlich der Art. 47 ZP I und die VN-Söldnerkonvention von 1989, wird nicht die Legalität des Söldners als solche bewertet, sondern auf seinen Status in bewaffneten Konflikten und daraus entstehende oder zu versagende Schutzansprüche Bezug genommen.[110]
- Art 47 ZP I[111]
Bezüglich dem völkerrechtlichen Status und den damit verbundenen Protektionen gab es vor 1977 trotz aller verabschiedeter Resolutionen keinen faktischen Unterschied zwischen Söldnern und Kombattanten. Eine Regelung, die den Söldnern den Kombattantenstatus abgesprochen hätte, war als diskriminierend verworfen worden.[112] Während der Diplomatic Conference on Humanitarian Law, die von 1974–1977 in Genf tagte, forderten die Entwicklungsländer aufgrund ihrer jüngsten Erfahrungen mit der Söldnerproblematik jedoch wiederholt eine konkrete Söldnerdefinition, die über das bereits existente Völkerrecht hinaus nicht nur einzelne spezifische kriegstypische Akte verbieten, sondern den Söldner durch Entzug der mit dem Kombattantenstatus verbundenen Schutzansprüche an sich illegalisieren sollte.[113] Dieser Ansatz ging den Westmächten zu weit. Nach langen Verhandlungen und erst auf Druck der afrikanischen Staaten – insbesondere einer Initiative Nigerias vom 13. Mai 1967 – wurde als Resultat Art. 47 in das 1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen von 1949 eingefügt.[114]
Art. 47 I ZP I stellte zur Zeit der Einführung völkerrechtlich dahingehend ein Novum dar, als dass er jenem Individuum, das unter die Söldnerdefinition des Art. 47 II ZP I fällt, den Kombattanten- und Kriegsgefangenenstatus aberkennt und somit die von ihm verübten Kriegsakte kriminalisiert.[115] Als Begründung für diesen Schritt wurde angegeben, dass der Söldner mit der Konfliktpartei nur über einen Vertrag zur Regelung seines Entgelts verbunden sei, was als nicht ausreichende Liaison mit der Konfliktpartei für eine Berechtigung zur Teilnahme an bewaffneten Konflikten zu interpretieren wäre.[116] Gegen diese Art der Kriegsbeteiligung in Gewinnerzielungsabsicht sollte derart vorgegangen werden, dass ein aus solchen Beweggründen handelndes Individuum schon bei der bloßen Teilnahme an Konflikten mit dem Entzug des Kombattantenstatus und damit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben müsste. Dadurch sollte ein solch abschreckendes völkerrechtliches Umfeld geschaffen werden, dass diese Personen aus eigenem Antrieb auf ein entsprechendes Engagement verzichten würden, ohne dass ein generelles, schwer zu realisierendes Söldnerverbot erarbeitet werden müsste, welches im schlechtesten Fall Auswirkungen auf den Status anderer Kombattanten wie Freiheitskämpfern in afrikanischen Unabhängigkeitskriege hätte.[117]
[...]
[1] In einem Gespräch über die Personalstruktur des von ihm geleiteten Unternehmens; zitiert nach: Kanzleiter, Boris: Der Söldner-Boom. Privatarmeen und Militärunternehmen in den Neuen Kriegen, in: medico international (Hrsg.): Ungeheuer ist nur das Normale: Zur Ökonomie der neuen Kriege, Frankfurt am Main 2002 (=Medico-Report Nr. 24), S. 131–145, hier S. 131.
[2] Vgl. Singer, Peter W.: The Ultimate Military Entrepreneur, in: Military History Quarterly, (o.O. Frühjahr 2003), S. 6–15, hier S. 14f; Meisterhans, Nadja: Globale Rechte, Globales Recht? Zur Konstitutionalisierung der Menschenrechte in Perspektive des Weltbürgerrechts, Hannover 2006 (=Papier zum DVPW-Kongress), S. 1.
[3] Newell, Virginia: Corporate Militaries and States: Actors, Interactions and Reactions, in: Texas International Law Journal, 41 (Austin 2006) 1, S. 67–101, hier S. 70.
[4] Frühe Ansätze der Staatensouveränitätstheorie sind bereits in der englischen Bill of Rights von 1689 mit der Erklärung, dass „the raising or keeping a standing army within the kingdom in time of peace, unless it be with consent of Parliament, is against law,” erkennbar. Zitiert nach: The Bill of Rights 1689. An Act declaring the Rights and Liberties of the Subject and settling the Succession of the Crown, Online-Ausgabe. Eine der Intentionen ihrer Verfasser war es, die Position des legitimen Königs dahingehend zu stärken, dass keine anderen Armeen als die des Souveräns geduldet würden. Das Prinzip des souveränen Staates blieb trotz aller Veränderungen bis in das 20. Jahrhundert grundsätzlich erhalten. Erst durch im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts begonnene, bis heute fortschreitende Privatisierungsmaßnahmen westlicher Staaten, erfolgt eine massive Transformation. Vgl. zu den geschichtlichen Veränderungen zusammenfassend Abschnitt 2.3 und zum Beginn des Wandels Abschnitt 3.1.
[5] Vgl. Singer, Peter W.: War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law, in : CJTL, 42 (New York 2004) 2, S. 521–549, hier S. 521. Wenn nicht explizit anders bezeichnet, wird im Folgenden aus Gründen der Einheitlichkeit der in der Literatur gebräuchliche Begriff private Militärfirma (PMF) benutzt werden. Der Autor versteht unter PMFs rechtlich etablierte, multinational aufgestellte, kommerzielle Unternehmen, welche Dienstleistungen mit dem Potential der direkten oder indirekten Gewaltausübung unter militärischen Gesichtspunkten und/oder die Übertragung oder Steigerung solcher Potentiale bei verschiedenen staatlichen und nicht-staatlichen Klienten anbieten. Es ist hierbei explizit zwischen PMFs und herkömmlichen, im Inland aktiven privaten Sicherheitsfirmen wie Wach- und Schließgesellschaften zu unterscheiden. Diese sollen nicht Gegenstand der Betrachtung sein. Zu einer genaueren Analyse und Diskussion des Profils moderner PMFs beachte Abschnitt 3.3.
[6] Private Militärfirmen agieren heute in über 50 Ländern der Welt. Sie halten für entsprechend vermögende Nachfrager wie etwa NGOs, internationale Institutionen und nicht zuletzt auch Staaten ohne ausreichende Eigenkapazitäten sicherheitspolitisch relevante Machtmittel auf Abruf ebenso vor wie alle anderen Arten militärisch relevanter Dienstleistungen. Vgl. Singer, Peter W.: Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca 2003, S. 10; sowie Abschnitt 3.2.
[7] Newell, Corporate Militaries and States, S. 70.
[8] Kümmel, Gerhard: Die Privatisierung der Sicherheit: Fluch oder Segen? Postheroische Gesellschaft, überlasteter Staat und private Sicherheits- und Militärunternehmen, Strausberg 2004 (=SOWI–Arbeitspapier Nr. 137), S. 7.
[9] Vgl. dazu die Ausführungen zu den Neuen Kriegen in Abschnitt 3.1.1.
[10] Vgl. dazu die Ausführungen zu den Einsatzprofilen im Umfeld schwacher Staaten im Abschnitt 3.2.2; so zwangen sie in Sierra Leone und Angola die Bürgerkriegsparteien UNITA und RUF zu Friedensverhandlungen mit den Regierungen und stabilisierten die Region, vgl. dazu: Hooper, Jim: Bloodsong!, London 2002, S. 227; Shearer David: Private Armies and Military Intervention, London 1998 (=IISS Adelphi Paper Nr. 316), S. 51.
[11] Holmqvist, Caroline: Private Security Companies: The Case for Regulation, Stockholm 2005 (=SIPRI-Policy Paper Nr. 9), Vorwort. Bereits im März 2003 wurde die Zahl der im Irak tätigen Privatakteure auf 15.000-20.000 geschätzt, wonach sie die zweitgrößte Kraft nach den US-Streitkräften darstellen. Vgl. o.V.: Military-industrial Complexities, in: The Economist, 27.03.2003; Stephen, Andrew: America – Andrew Stephen on Mercenaries in Iraq, in: New Statesman, 26.04.2004.
[12] Vgl. Kaplan, Jonathan: Private Army Seeking Political Advice in D.C., in: The Hill, 14.04.2004.
[13] Uesseler, Rolf: Neue Kriege, neue Söldner: private Militärfirmen und globale Interventionsstrategien, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 50 (Bonn 2005) 3, S. 323‑333, hier S. 323.
[14] Vgl. zu einer detaillierten Übersicht über das Tätigkeitsspektrum Abschnitt 3.2.
[15] Aus der Komplexität der vernetzten Firmenstrukturen, sich überschneidenden Aufgabenbereichen und der damit erklärbaren eingeschränkten Firmentransparenz ergeben sich beinahe zwangsläufig definitorische Schwierigkeiten. Somit ist „the most troubling aspect of the industry […] the underlying legal ambiguity.“ O’Meara, Barrie B.: Private Military Firms and Mercenaries: Potential for Liability under International Law, in: TFLR, 12 (Tilburg 2005) 4, S. 324–347, hier S. 329, dazu auch Maogoto, Jackson N.: Contemporary Private Military Firms under International Law: An Unregulated ‘Gold Rush’, Newcastle 2006 (=BEP-Paper Nr. 1345), S. 3f.
[16] Es musste auch eine mangelnde Implementierungsmotivation seitens einzelner Staaten festgestellt werden, die supranationalen Einhegungsversuchen aufgrund anders gelagerter wirtschaftlicher oder politischer Eigeninteressen nur bedingt folgen wollten oder konnten. Vgl. Nossal, Kim R.: Global Governance and International Interests: Regulating Transnational Security Corporations in the Post-Cold War Era, in: MJIL, 2 (Melbourne 2001) 2, S. 459–476, hier S. 460.
[17] Bis zu den Ereignissen des 11. September 2001 und ihren Folgen ging man in Fachkreisen teilweise noch davon aus, dass sich die Nachfrage nach PMF-Leistungen zu Anfang des neuen Jahrtausends nach dem Ende der Post–Kalten-Kriegs–Ära drastisch rückläufig entwickeln würde, dass maximal klassische Sicherheitsleistungen wie Wachdienste Zuwächse verzeichnen könnten und somit sowohl nationale als auch internationale Regulierungsanstrengungen unnötig wären. Vgl. dazu Nossal, Global Governance, S. 459, 461.
[18] Dass bezüglich der Frage, ob es sich bei den Unternehmen der privaten Sicherheitsindustrie um eine moderne Erscheinungsform des klassischen Söldnertums handelt, Klärungsbedarf vorhanden ist, zeigt sich schon daran, dass selbst die aktuelle VN-Beauftragte für das Söldnerwesen sich in dieser Frage unsicher ist. Aber auch in wissenschaftlichen Diskursen und Publikationen als auch in der Berichterstattung – z.B. zu den Vorgängen im Irak – werden unter dem Begriff Söldner verschiedenste Elemente aus dem Bereich privater Sicherheitsdienstleister subsumiert. Vgl. ABC Radio Australia: FIJI. Human Rights Activist appointed UN Expert, o.D., online abrufbar; Ladurner, Ulrich: Helden und Söldner, in: DIE ZEIT, 09.06.2004; Roth, Wolf D.: Die globale Konjunktur der Söldnertruppen, in: Heise-Online, 03.04.2004, online abrufbar.
[19] Eine solche Typologisierung macht auch deshalb Sinn, weil für die anschließende völkerrechtliche Bewertung der PMFs „allein die Art der übernommenen Tätigkeit ausschlaggebend ist.“ Krieger, Heike: Der privatisierte Krieg: Private Militärunternehmen im bewaffneten Krieg, in: Archiv des Völkerrechts, 44 (Tübingen 2006) 2, S. 159–186, hier S. 161.
[20] Daneben ist unter anderem von Interesse, ob die völkerrechtlichen Normen, welche die Stellung und den Einsatz von Söldnern bestimmen, mit den aktuellen Entwicklungen in Übereinstimmung gebracht werden können und welche internationalen Übereinkommen für die Fragestellung generell einschlägig sind.
[21] Bei einer Untersuchung des rechtlichen Status der Mitarbeiter von PMFs sind zwei Problemfelder zu differenzieren: Zum einen können Angestellte aktiv in das Kampfgeschehen verwickelt werden. Hier ist zu klären, welchen Beschränkungen seitens des Völkerrechts sie bei der Durchführung von verschiedenen Aktivitäten unterworfen sind. Andererseits können sie bei der Ausübung ihrer Arbeit passiv von Auswirkungen der Kampfhandlungen betroffen sein. Dabei stellt sich auch die Frage nach den für sie völkerrechtlich geltenden Schutzansprüchen. Vgl. zu möglichen Antworten die Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2.
[22] Vgl. Abschnitt 4.2.3.
[23] Vgl. Abschnitt 5.1.
[24] Vgl. Abschnitt 5.2.
[25] Auf die Problematik der Transparenz wird im Folgenden in Abschnitt 4.1.3 noch einzugehen sein. Beachtung verdient hier die Arbeit investigativer Journalisten. Vgl. ICIJ: Making a Killing. The Business of War, in: Center for Public Integrity-Projekt, Washington D.C. 2007, online abrufbar.
[26] Als Beispiel eines wissenschaftlich auswertbaren Zeitungsberichts – in diesem Fall zur Verwicklung privater Verhörspezialisten der US-Firmen CACI und Titan in den Folterskandal von Abu Ghraib – vgl. Hersh, Seymour M.: Torture at Abu Ghraib, in: The New Yorker, 10.05.2004.
[27] Namentlich Proponenten, Analysten, Opponenten. Vgl. dazu die folgenden drei Absätze.
[28] Vgl. stellvertretend als Sprachrohr des IPOA, der Public-Relations-Organisation der PMF-Branche: Brooks, Doug: Messiahs or Mercenaries? The Future of International Military Services, in: International PeaceKeeping, 7 (Pretoria 2000) 4, S. 129–144; sowie weiterführend IPOA: IPOA-Homepage, Washington D.C. 2006, online abrufbar.
[29] Vgl. zu den schockierenden Bildern sowie einem Video von AP, welches durch die Presse ging: AP: Iraqi Mob desecrates Americans’ Bodies, in: The MemoryHole.Org-Projekt, 31.03.2004, online abrufbar. In einem anderen Fall erregte im Dezember 2005 ein Video Aufsehen, das Mitarbeiter der Firma Aegis Specialist Risk Management bei der scheinbar willkürlichen Beschießung irakischer Zivilisten zeigt. Vgl. o.V.: Video bringt privaten Sicherheitsdienst in Bedrängnis, in: SPIEGEL Online, 09.12.2005, online abrufbar.
[30] Vgl. dazu Schreier, Fred; Caparini, Marina: Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies, Genf 2005 (=DCAF Occassional Paper Nr. 6), S. 11; sowie als Vertreter der entschiedenen Gegner den ehemaligen VN-Sonderbeauftragten für das Söldnerwesen: Ballesteros, Enrique Bernales (Special Rapporteur pursuant to Commission resolution 2000/3), ECOSOC Agenda Item 5, 57th Session (11.01.2001), ECOSOC Doc. E/CN.4/2001/19. Die neue VN-Sonderbeauftragte hat sich allerdings eine differenziertere Perspektive zu eigen gemacht und akzeptiert das mögliche Potential solcher Firmen. Vgl. Shameem, Shaista (Special Rapporteur pursuant to Commission Resolution 2004/5), ECOSOC Agenda Item 5, 61rd Session (08.12.2004), ECOSOC Doc. E/CN.4/2005/14, §§ 66f.
[31] Zur Problematik einer einheitlichen Terminologie und Kategorisierung vgl. Abschnitt 3.3.
[32] Milliard, Todd S.: Overcoming Post-Colonial Myopia: a Call to Recognize and Regulate Private Military Companies, in: Military Law Review, (Washington D.C. 2003) 176, S. 1–95, hier S. 10f.
[33] Isenberg, David: Soldiers of Fortune Ltd.: A Profile of Today’s Private Sector Corporate Mercenary Firms, Washington D.C. 1997 (=CDI-Monograph November), S. 1.
[34] In diesem Zusammenhang ist im wissenschaftlichen Diskurs auch von Interesse, ob die nationalstaatliche Souveränität in der heutigen Zeit insgesamt abgenommen hat oder ob sie sich seit Ende des Ost-West-Konfliktes nur einem weiteren Transformationsprozess unterwerfen musste. Im Rahmen dieser Arbeit kann darauf nicht näher eingegangen werden. Vgl. weiterführend Mandel, Robert: The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Westport 1994, S. 1–14; FCO: Private Military Companies. Options for Regulation 2001-2002, London 2002 (=Green Paper HC Nr. 577), §§57–60; sowie Weingartner, Georg: Krieg als Geschäftszweig. Private Sicherheitsdienstleister und Söldner im Lichte des Kriegsvölkerrechts, in: ÖMZ, 42 (Wien 2004) 2, S. 149‑156, hier S. 150.
[35] Machiavelli, Niccolò: Der Fürst (1532; übers. von Oppeln-Bronikowski, Friedrich), Frankfurt am Main 2001, S. 64.
[36] In römischer Zeit sind auch die sprachlichen Wurzeln der Begriffe Söldner und Soldat zu finden. Abgeleitet wurden sie aus der solidus, einer Goldmünze, die Konstantin der Große 309 v. Chr. einführte. Soldat entwickelte sich zum Begriff für den einzelnen Angehörigen staatlicher Militärorganisationen, während Söldner jemanden bezeichnet, der in einem fremden Land Kriegsdienst gegen Bezahlung leistet. Vgl. Transfeldt, Walter; u.a.: Wort und Brauch im deutschen Heer. Geschichtliche und sprachkundliche Betrachtungen über Gebräuche, Begriffe und Bezeichnungen des deutschen Heeres in Vergangenheit und Gegenwart, 6. Aufl., Hamburg 1967, S. 6.
[37] Vgl. von der Way, Thomas: Die Textüberlieferung Ramses' II. zur Qades-Schlacht. Analyse und Struktur, Hildesheim 1984 (=Hildesheimer Ägyptologische Beiträge Nr. 22), S. 349.
[38] Strassler, Robert B.: The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War, New York 1996, S. 444.
[39] Singer, Corporate Warriors, S. 21.
[40] Vgl. Yocherer, Greg: Second Punic War: Battle of Cannae, in: Military History (o.O. Februar 2000), S. 1–4, hier S. 1, 4; Heftner, Herbert: Der Aufstieg Roms. Vom Pyrrhoskrieg bis zum Fall von Karthago, Regensburg 1997, S. 169f.
[41] Vgl. dazu Zarate, Juan C.: The Emergence of a New Dog of War: Private International Security Companies, International Law, and the New World Disorder, in: SJIL, (Stanford 1998) 34, S. 75–162, hier S. 77.
[42] Vgl. Uesseler, Rolf: Krieg als Dienstleistung. Private Militärfirmen zerstören die Demokratie, 2. Aufl., Berlin 2006, S. 87f.
[43] Technischer Fortschritt sowie politische und ökonomische Kostenvermeidungsstrategien führten und führen auch in der Gegenwart zu einer wachsenden Nachfrage nach den hochqualifizierten Kräften des PMF-Sektors. Vgl. FN 162.
[44] Singer, Corporate Warriors, S. 22.
[45] Vgl. Contamine, Philippe: War in the Middle Ages, New York 1984, S. 158. Im Jahr 1342 bestand die Armee Florenz’ aus 4000 Söldnern und 40 Bürgerlichen, vgl. dazu Bayley, Charles C.: War and Society in Renaissance Florence: The „De Militia“ of Leonardo Bruni, Toronto 1961, S. 15.
[46] Vgl. O’Meara, Private Military Firms, S. 326; Uesseler, Krieg als Dienstleistung, S. 90.
[47] Botta, Christo, zitiert nach: Schreier, Privatising Security, S. 7.
[48] Ebd.
[49] Vgl. Kinsey, Christopher: Corporate Soldiers and International Security. The Rise of Private Military Companies, London 2006, S. 35.
[50] Vgl. zu den Schwierigkeiten bei der heutigen Anwendbakeit rein privatrechtlicher Vereinbarungen Abschnitt 4.1.1, als Beispiel eines auf privatrechtlicher Kooperation basierenden Regulierungsansatzes den von Großbritannien unter Abschnitt 5.1.3.
[51] Hall umschreibt das Kaperwesen entsprechend seinem privatwirtschaftlichen Charakter als „vessels belonging to private owners, and sailing under a commission of war empowering the person to whom it is granted to carry on all forms of hostility which is permissible at sea by the usage of war.“ Hall, William Edward: A Treatise on International Law, 8. Aufl., Oxford 1924, S. 620f.
[52] Diese Praxis wurde bis zum 16. April 1856 aufrechterhalten, als die Bevollmächtigten, die im Namen ihrer Regierungen bereits den Pariser Vertrag vom 30.03.1856 unterzeichnet hatten – und damit im Namen der Hauptseemächte Europas, vor allem Russland, Frankreich und Großbritannien auftraten – dem Überhandnehmen solcher Verfahrensweisen mit der Unterzeichnung einer Erklärung, die die Keperei untersagt, einvernehmlich entgegentraten. Diese gilt im übrigen bis heute und wurde auch von anderen Staaten wie der Schweiz unterzeichnet. Vgl. Erklärung betreffend das europäische Seerecht in Kriegszeiten vom 16.04.1856, AS 11 439; sowie Thomson, Janice: Mercenaries, Pirates and Souvereigns: State Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton 1994, S. 70. Heute ist z.B. im Irak eine Verwendung privater Akteure in Stellvertreterfunktionen souveräner Regierungen wieder zu beobachten. Ähnlich wie damals sind die Gründe dafür in wirtschaftlichen Erwägungen zu suchen. Aufgrund der Struktur demokratischer Staaten ist aber vor allem auch die Vermeidung politischer Kosten in den Vordergrund getreten: Zivile Verluste erregen weniger Aufmerksamkeit als im öffentlichen Fokus stehende militärische Niederlagen und gefährden in weit geringerem Maße eine mögliche Wiederwahl. Vgl. zum heutigen Kontext Abschnitt 4.1.2, insbesonders FN 326f.
[53] Albrecht von Wallenstein, der letzte und erfolgreichste Führer einer Landsknechtsformation, führte sein lukratives Geschäft, welches ihn zum reichsten Mann Europas machte, jedoch bis zum Ende des dreißigjährigen Krieges weiter. Vgl. Uesseler, Krieg als Dienstleistung, S. 92.
[54] Während des 30-jährigen Krieges war es zu großen Verwüstungen und Ausbeutungen der Zivilbevölkerung durch marodierende Söldnergruppen gekommen. Dies trug zu einem Umdenken in der Militärplanung und einer Verstaatlichung der Gewalt in Mitteluropa bei. Vgl. Teske, Gunnar: Bürger, Bauern, Söldner und Gesandte. Der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Frieden in Westfalen, Münster 1998, S. 180.
[55] „The Dutch, English, French, and Portugese all chartered companies during this time. French companies were state enterprises forged by the king and designed to increase state power [...].” Avant, Deborah D.: The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security, Cambridge 2005, S. 28.
[56] Vgl. Thomson, Mercenaries, Pirates and Souvereigns, S. 33–35.
[57] Ortiz, Carlos: Embryonic Multinational Corporations and Private Military Companies in the Expansion of the early-modern Overseas Charter System, San Diego 2006 (=Paper prepared for the 47th Annual ISA Convention), S. 2. 1815 hatte sie 150.000 Soldaten unter Vertrag. Vgl. Shearer, David: Outsourcing War, in: Foreign Policy, (Washington D.C. 1998) 112, S. 68–81, hier S. 70. Zu Parallelen mit der Moderne vgl. die Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2.
[58] Vgl. Kinsey, Corporate Soldiers, S. 40.
[59] Vgl. van Creveld, Martin: The Transformation of War, New York 1991, S. 27.
[60] Vgl. Cipolla, Carlo M.: Guns and Sails in the Early Phase of European Expansion 1400–1700, London 1965, S. 109f; Ortiz, Embryonic Multinational Corporations, S. 11.
[61] Ortiz, Embryonic Multinational Corporations, S. 16.
[62] Sie weisen eine PMF-typische Integration in multinationale Kapitalunternehmen auf und bieten Dienstleistungen mit dem Potential der Gewaltausübung und/oder des Transfers solcher Potentiale an Dritte an. Vgl. zu PMF-Definition und -Charakteristika auch FN 4 und besonders Abschnitt 3.2.3; zu einem direkten Vergleich der damaligen Handelsgesellschaften und heutigen PMFs vgl. Kramer, Daniel: Does History Repeat Itself? A Comparative Analysis of Private Military Entities, in: Jäger, Thomas; Kümmel Gerhard (Hrsg.): Private Military and Security Companies. Chances, Problems, Pitfalls and Prospects, Wiesbaden 2007, S. 23–36, hier S. 33–35. Eine weitere interessante Parallele lässt sich zur Praxis heutiger PMFs – beispielsweise im Irak – ziehen, wenn man beachtet, dass diese Organisationen ihrerseits oftmals einheimische Subunternehmer anheuerten, um größere Aufträge zu realisieren. So hatte etwa die Dutch East India Company bei einer Operation zur Rückeroberung von Kalkutta neben 5000 europäischen 20.000 lokale Söldner unter Vertrag. Vgl. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns, S. 39.
[63] Noch 1780 war die Armee der englischen Handelsgesellschaft deutlich größer als die, über welche die englische Königin verfügen konnte. Vgl. Uesseler, Krieg als Dienstleistung, S. 93.
[64] Vgl. Schreier, Privatising Security, S. 1.
[65] So geschehen beispielsweise durch deutsche Fürsten und die Niederlande während des siebenjährigen Krieges, des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges sowie im Krieg zwischen England und Frankreich 1701 und während des zweiten Jakobiteraufstands 1745/46. Vgl. dazu weiterführend Mockler, Anthony: The New Mercenaries, London 1985, S. 3; Thomson, Mercenaries, Pirates and Souvereigns, S. 28f; Bayley, Charles C.: Mercenaries for the Crimea: the German, Swiss, and Italian Legions in British Service 1854–1856, Montreal 1977, S. 4; Worden, Leon: Downsizing and Outsourcing, we’ve sprung Pandora’s Box, in: The Signal, 27.06.2004.
[66] Zwischen 1500 und 1700 herrschte in 95% der Zeit Krieg. Während dieser Zeitanteil im Laufe der Jahrhunderte sank, stieg die Opferzahl beständig an, was auf die mit konzentrierten Kräften und moderneren Waffen ausgefochtenen Staatenkriege zurückzuführen ist. Vgl. Krieger, Der privatisierte Krieg, S. 165.
[67] Ebd., S. 169.
[68] Vor diesem Hintergrund ist auch die Entstehung des von der verfassungsgebenden Nationalversammlung Frankreichs am 28. Februar 1790 verabschiedeten und im selben Jahr proklamierten Erlasses zum Verbot von Söldnerei auf französischem Staatsgebiet zu sehen – im Original Décret sur la nouvelle Organisation de l'Armée – welcher mit dem Ziel verfasst wurde, die Position des Staates zu festigen und damit in der damaligen Zeit eine Vorreiterrolle einnahm. Vgl. Uesseler, Krieg als Dienstleistung, S. 96.
[69] Allein in der Schlacht von Waterloo kämpften auf Napoleons Seite 350.000, bei Wellington 40.000 Söldner . Ebd., S. 96.
[70] Das durch die nationalistischen Ideen veränderte Verhältnis von Staat und Bürger bringt Paret treffend zum Ausdruck: „The social contract [Vertrag zwischen Regierung und Volk, Anm.d.A.] suggested a different type of connection between citizens and the state than was prevalent [...], sovereignty rested in the people, the defense of the people was an obligation held by all.” Paret, Peter: The Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton 1986, S. 43.
[71] Neben der höheren Motivation der für Volk und Vaterland kämpfenden Wehrpflichtarmeen hatten diese auch den Vorteil, deutlich günstiger zu sein. Dies hatte zwar schon für die Staatsarmeen früherer Zeit gegolten, aber durch die Bildung dauerhafter Strukturen war es nun möglich, die Bürgerarmeen in Teilbereiche wie Artillerie etc. zu unterteilen und so den Nachteil der mangelnden Qualifikation der Bürgerlichen, der früher für das Engagement von teuren professionellen Söldnern gesprochen hatte, aufzuheben.
[72] Howard, Michael: War in European History, 2. überarb. Aufl., Oxford 1977, S. 110.
[73] Die Verbindlichkeit der folgenden Regelungen ergibt sich daraus, dass die Verträge als – von den dazu von den Staaten Bevollmächtigten – kodifiziertes Völkergewohnheitsrecht zu betrachten sind. Vgl. OHCHR: The Impact of Mercenary Activities on the Right of Peoples to Self-Determination, Genf 2002 (=Human Rights Fact Sheet Nr. 28), S. 12; Maogoto, Contemporary Private Military Firms, S. 17.
[74] Vgl. Randelzhofer, Albrecht: Völkerrechtliche Verträge, 10. überarb. Aufl., München 2004, S. 713–720; Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV. Haager Abkommen, mit HLKO, im Folgenden HA IV) vom 18.10.1907, AS 11 409. Zur Problematik der Zuordenbarkeit des Kombattantenbegriffs zu Privatakteuren nach aktuellem Völkerrecht vgl. Abschnitt 4.2.1.
[75] Vgl. Randelzhofer, Völkerrechtliche Verträge, S. 716; Art. 1 HLKO.
[76] Vgl. Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs (V. Haager Abkommen, im Folgenden HA V) vom 25.01.1910, RGBl. 1910 2 3706 151ff, Präambel. Hier „[t]he roots of anti-mercenary laws are to be found.“ Gaultier, Leonard; u.a.: The Mercenary Issue at the UN Commission on Human Rights. The Need for a New Approach, London 2001, S. 26.
[77] Völkergewohnheitsrechtliche Grundlage des Art. 4 HA V ist das Prinzip der Staatenverantwortlichkeit, wonach ein Staat für die von ihm hervorgebrachten Handlungen zur Verantwortung gezogen werden kann. Allerdings ist er nicht für die von Individuen derselben Staatsangehörigkeit verübten Taten verantwortlich zu machen, wenn diese ohne seine Autorisation stattfanden und er seine Aufsichtpflicht nicht schuldhaft verletzte. Vgl. Maogoto, Contemporary Private Military Firms, S. 17, 21. Zur Frage der Staatenverantwortlichkeit im modernen Kontext vgl Abschnitt 4.2.3.
[78] Vgl. zur heutigen Stellung des Söldners in Bezug auf den Kombattantenbegriff FN 418ff.
[79] Vgl. Milliard, Overcoming Post-Colonial Myopia, S. 21.
[80] Während der Verhandlungen brachte die deutsche Delegation den Vorschlag ein, dass kriegführende Staaten dazu verpflichtet werden sollten, auf ausländische Kräfte in ihren Reihen zu verzichten; Neutrale sollten ihren Bürgern eine Teilnahme verbieten müssen. Dieser Ansatz erwies sich aber als nicht konsensfähig. Vgl. de Bustamente, Antonio Sanchez: The Hague Convention concerning the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Land Warfare, in: AJIL, 2 (Washington D.C. 1908) 1, S. 95–120, hier S. 100.
[81] Vgl. Mandel, Robert: Armies without States. The Privatization of Security, London 2002, S. 31f.
[82] Z.B. die im Dienste der britischen Armee tätigen nepalesischen Gurkhas (gegründet 1815) und die französische Fremdenlegion (gegründet 1831). Beide Einheiten setzen sich zu 100% aus Ausländern zusammen und sind den regulären Truppen angegliedert. Gerade die Fremdenlegion wurde für Aufgaben herangezogen, bei denen hohe Verluste abzusehen waren. Vgl. Shearer, Private Armies, S. 16. Das Ziel der Vermeidung hoher eigener Verluste spielt auch beim Einsatz heutiger PMFs eine Rolle. Vgl. FN 327.
[83] Uesseler, Krieg als Dienstleistung, S. 96.
[84] Dennoch wurde auch am Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa nicht gänzlich auf die Dienste privater Firmen verzichtet. Bei der Landung vor Gallipoli 1915 schiffte sich z.B. das australisch-neuseeländische Expeditionskorps mit zivil angemieteten und von ihren Besitzern gesteuerten Landungsbooten ein. Die zivilen Besatzungen zogen sich allerdings zurück, als sie unter Feuer gerieten, ohne wie befohlen eine minensichere Route einzurichten. In der Folge starben 700 Seeleute der nachrückenden Welle durch Minen, 3 Kampfschiffe sanken. Hier zeigte sich bereits das noch heute existente Problem, als Militär von Zivilisten in gefährlichen Situationen eine umfassende Auftragserfüllung erwarten zu müssen, ohne dass diese der militärischen Befehlsgewalt unterliegen. Vgl. Singer, Corporate Warriors, S. 162; McCarthy, John: Expanding Private Military Sector faces structural Change and Scrutiny, in : Jane’s Intelligence Review, 18 (Coulsdon 2006) 2, S. 26–32, hier S. 27; sowie zu diesem Problem im heutigen Kontext FN 301.
[85] Vgl. Charta der Vereinten Nationen (VN-Charta) vom 26.06.1945, 15 UNTS 143. Während des 2. Weltkriegs kämpften auf dem Kriegsschauplatz China–Burma–Indien neben einheimischen Milizen von der US-Regierung für diesen Zweck bewusst aus der US-Luftwaffe entlassene Piloten unter dem Roten Stern und der Bezeichnung Flying Tigers auf Seite der Chinesischen Truppen gegen die Japaner. Vgl. Hemingway, Tom: Outsourcing of War: The Role of Contractors on the Battlefield, in: HV–I/JILPAC, 19 (München 2006) 2, S. 129–132, hier S. 129. Zivile Firmen wie Brown & Root Services (heute KBR) leisteten im II. Weltkrieg und auch in Korea und Vietnam neben der Produktion von Kriegswaffen hauptsächlich logistische und infrastrukturelle Unterstützung. Vgl. Mingo, Patrice: KBR chosen to continue supporting U.S. Navy under CONCAP contract, Houston 2004, online abrufbar; Avant, Deborah D.: The Privatization of Security: Lessons from Iraq, in: FPRI, 50 (Amsterdam 2006) 2, S. 327–342, hier S. 328.
[86] Shearer, Private Armies, S. 15.
[87] Vgl. Kinsey, Christopher: Challenging International Law: a Dilemma of Private Security Companies, in: Conflict, Security and Development, 5 (London 2005) 3, S. 269‑293, hier S. 273.
[88] An dieser Stelle relevant: Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen (III. Genfer Abkommen, im Folgenden GA III) vom 12.08.1949, AS 1951 228.
[89] Vgl. dazu exemplarisch die Ähnlichkeit der Formulierung des Art. 1 HLKO und Art. 4 A Nr. 2 GA III. Ähnlich wie in den Haager Abkommen wurde Söldnern, die Teil der regulären Streitkräfte waren, gemäß Art. 4 A GA III der gleiche Kriegsgefangenenstatus wie den Soldaten zuerkannt, wodurch sie nach Art. 85 i.V.m. 87 GA III auch deren Immunität vor der Verfolgung begangener regelkonformer Kriegsakte genossen.
[90] Zusätzlich hielt die aus der Geschichte bereits bekannte Praxis einzelner Staaten, eigene Streitkräfte im Ausland gegen Bezahlung anzubieten – quasi staatliches Söldnertum – in Afrika weiter an. So kämpften z.B. marokkanische Truppen in Zaire 1977, kubanische Truppen in Äthiopien und Angola 1978. Vgl. Shearer, Private Armies, S. 15f.
[91] Vgl. Bowett, Derek W.: United Nations Forces: A Legal Study of United Nations Practice, London 1964, S. 160.
[92] Dazu Sir David Stirling, Gründer der SAS und beteiligt an Operation Watchguard. „ The British government wanted a reliable organisation without any direct identification.” Zitiert nach: Bloch, Jonathan; Fitzgerald, Patrick: British Intelligence and Covert Action, London 1983, S. 48; vgl. auch Kinsey, Corporate Soldiers, S. 43–49; OHCHR, The Impact of Mercenary Activities, S. 5.
[93] Unter der Bezeichnung Les Affreux sind die Söldnerführer Mike Hoare aus Großbritannien, Bob Denard aus Frankreich und Jean Schramme aus Belgien bekannt. Vgl. Mockler, The New Mercenaries, S. 62; Cleaver, Garry: Subcontracting Military Power: The Privatisation of Security in Contemporary Sub-Saharan Africa, in: Crime, Law and Social Change, 33 (Dordrecht 2000) 1, S. 131–149, hier S. 134f. Zu den genaueren Ursachen dieser Renaissance vgl. allgemein die in Abschnitt 3.2.2 aufgeführten Gründe, die auch heute zur Nachfrage nach PMFs in schwachen Staaten führen.
[94] Diese Verbände waren außerdem immer wieder in versuchte Staatsstreiche (Komoren 1975, 1978; Benin 1977, 1995; Seychellen 1977, 1982) verwickelt, was dazu beitrug, dass die Söldner als illoyal, rassistisch und konkrete Gefahr für die Freiheit und Selbstbestimmung der Völker Afrikas erschienen. Vgl. Stinnett, Nathaniel: Regulating the Privatization of War: How to stop Private Military Firms from committing Human Rights Abuses, in: BCICLR, 28 (Newton 2005) 1, S. 211–223, hier S. 213.
[95] Cassese, Antonio: Mercenaries: Lawful Combatants or War Criminals?, in: ZaöRV, (Heidelberg 1980) 40, S. 1–30, hier S. 16.
[96] Vgl. zu den (im Verfahren nicht eindeutig nachzuweisenden) kriminellen Akten der Söldner unter Führung von Costas Giorgiou: Milliard, Overcoming Post-Colonial Myopia, S. 47–50.
[97] Außerdem konnte durch die Ankläger nicht der Beweis erbracht werden, dass alle später Verurteilten direkt an Kriegshandlungen beteiligt gewesen waren, was eine eklatante Verletzung fundamentaler Menschenrechte – z.B. das Recht auf einen fairen Prozess nach dem Prinzip nullum crime sine lege – darstellte. Vgl. Bothe, Michael: Völkerrechtliche Aspekte des Angola-Konflikts, in: ZaöRV, (Heidelberg 1977) 37, S. 572–603, hier S. 601; Maaß, Rainald: Der Söldner und seine kriegsvölkerrechtliche Rechtsstellung als Kombattant und Kriegsgefangener, Bochum 1990 (=Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum Humanitären Völkerrecht Nr. 2), S. 57f.
[98] Vgl. Rabus, Walter: Ist das Söldnerverbot des Artikels 47 des Ersten Zusatzprotokolls von 1977 noch zeitgemäß?, in: Hafner Gerhard (Hrsg.): Völkerrecht, Recht der Internationalen Organisationen, Weltwirtschaftsrecht. Liber Amicorum Prof. Ignaz-Seidl-Hohenveldern, Den Haag 1998, S. 511–540, hier S. 522f.
[99] Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind durch Art. 25 VN-Charta dazu verpflichtet, den Resolutionen des Sicherheitsrates in Übereinstimmung mir der VN-Charta zu folgen. Resolutionen der VN-Generalversammlung sind nicht direkt in internationales oder nationales Recht übersetzbar, aber da sie durch Abstimmung der Mitgliedstaaten angenommen wurden, „are [they] understood as representing the expressed wishes of the collective membership of the UN.“ Kinsey, Challenging International Law, S. 292; vgl. auch Maaß, Der Söldner, S. 53f; Maogoto, Contemporary Private Military Firms, S. 13. Als solches tragen sie ihren Teil zum Entstehen von Völkergewohnheitsrecht bei. Vgl. dazu Taulbee, James L.: Myths, Mercenaries, and Contemporary International Law, in: CWILJ, 15 (San Diego 1985) 2, S. 339–363, hier S. 346.
[100] Vgl. Maaß, Der Söldner, S. 189. Auch wenn bereits zu dieser Zeit Art. 2 IV VN-Charta das ehemals unangefochtene Recht eines jeden souveränen Staates, zur Wahrung seiner Interessen einen Krieg zu führen, einschränkte, konnte aus Art. 1 und 2 VN-Charta dennoch über das Recht auf Selbstbestimmung eine Berechtigung zum bewaffneten Widerstand gegen koloniale Unterdrückung abgeleitet werden, was 1966 durch Art. 1 UNGA Res. 2200 bestätigt wurde. Vgl. Behnsen, Alexander: The Status of Mercenaries and other illegal Combatants under International Humanitarian Law, in: GYIL, (Kiel 2003) 46, S. 494–535, hier S. 510; UNGA: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, UNGA Res. 2200, 21rd Session (16.12.1966), Supp. Nr. 16, UN Doc. A/6316.
[101] Vgl. UNSC: Question concerning the Democratic Republic of Congo, UNSC Res. 241, 1378th Meeting (15.11.1967).
[102] Vgl. UNGA: Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty, UNGA Res. 2131, 20th Session (21.12.1965), Supp. Nr. 14, UN Doc A/6014. Die in Art. 1 und 2 UNGA Res. 2131 artikulierte Formulierung beträfe also zum Beispiel Söldnerorganisationen, die im Auftrag eines Staates in einem Bürgerkrieg mit Hilfe militärischer Gewalt an einer Veränderung der politischen Verhältnisse mitwirken würden.
[103] Vgl. UNGA: Implementation of the Declaration on the granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, UNGA Res. 2465, 23rd Session (20.12.1968), Supp. Nr. 18, UN Doc. A/7218.
[104] Vgl. UNGA: Declaration of Principles of International Law concerning friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations, UNGA Res. 2625, 25th Session (24.10.1970), Supp. Nr. 28, UN Doc. A/8028.
[105] Die traditionelle Neutralitätsfeststellung führte immer wieder zu Schwierigkeiten. Vgl. z. B den Fall Tansania, Sambia vs. Biafra 1967 in: Beyani, Chaloka; Lilly, Damian: Regulating Private Military Companies: Options for the UK Government, London 2001 (=International Alert Nr. 8), S. 22.
[106] Vgl. explizit UNGA Res. 2625, 1. Prinzip, S. 123.
[107] Vgl. O’Meara, Private Military Firms, S. 334.
[108] Durch den Einsatz von Söldnern konnte auf andere Staaten Einfluss genommen werden, ohne dass man selbst in den Konflikt verwickelt wurde. Die Durchsetzung der Grundsätze der Resolutionen ist auf internationaler Ebene vor dem Internationalen Gerichtshof (ICJ) zwar möglich, aber schwierig, wie das Beispiel Nicaragua vs. United States of America von 1986 zeigt: Nicaragua warf der USA vor, ihre Souveränität durch die Unterstützung der bewaffneten Contra -Rebellen verletzt zu haben, die nach der Ausbildung durch die USA die Grenze übertreten hätten. Der ICJ stellte fest, dass die Duldung des Übertritts von bewaffneten Gruppen – in diesem Fall der Contra -Bewegung – über die Staatsgrenze in ein benachbartes Land nach den Grundsätzen der Resolution in jedem Fall die territoriale Souveränität des betroffenen Landes verletzt. Allerdings war die Unterstützung der Contra -Bewegung nach Ansicht des ICJ im konkreten Fall nicht so massiv, als dass von einer generellen Verantwortlichkeit oder Haftbarkeit der USA für die Handlungen der Contras auszugehen gewesen wäre. Für eine solche hätten sie als Stellvertreter der USA handeln müssen. Vgl. ICJ: Case concerning military and paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. United States of America), General List Nr. 70, 27.06.1986, S. 61–65. In diesem Zusammenhang sind auch folgende Resolutionen relevant, die den Begriff des Kriegszustandes in den Internationalen Beziehungen definieren bzw. die Prinzipien für den Status der Kombattanten in solchen Konflikten erörtern, auf die aber an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann: UNGA: Basic Principles of the legal Status of the Combatants struggling against Colonial and Alien Domination and Racist Régimes, UNGA Res. 3103, 28th Session (12.12.1973), UN Doc. 2197th plenary meeting; UNGA: Definition of Aggression, UNGA Res. 3314, 29th Session (14.02.1974), Supp. Nr. 19, UN Doc. A/9619 und Corr. 1; sowie ergänzend Behnsen, The Status of Mercenaries, S. 509; Abraham, Garth: The Contemporary Legal Environment, in: Mills, Greg; Stremlau, John (Hrsg.): The Privatization of Security in Africa, Johannesburg 1999, S. 81–106, hier S. 92. Zur Staatenverantwortlichkeit im heutigen Kontext vgl. Abschnitt 4.2.3.
[109] Vgl. OHCHR, The Impact of Mercenary Activities, S. 14. Dieses Prinzip spielt auch für die rechtliche Diskussion in Abschnitt 4.2.1 eine Rolle.
[110] Vgl. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I, im Folgenden ZP I) vom 08.06.1977, AS 1982 1362; International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries (VN-Söldnerkonvention, im Folgenden VN-Konvention) vom 04.12.1989, UNGA 72nd plenary meeting, UN Doc. A/RES/44/34. Eine Ausnahme bildet die OAU-Konvention, mit deren Implementierung eine Kriminalisierung des Söldners vorzunehmen versucht wurde: Vgl. Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa (OAU-Söldnerkonvention, im Folgenden OAU-Konvention) vom 05.06.1977, O.A.U. Doc. CM/433/Rev. L. Annex 1 (1972). Weil Art. 47 II ZP I aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums als wichtigste Söldnerdefinition angesehen wird und wegen der großen Parallelen zwischen den Definitionen wird an dieser Stelle nur deren Formulierung genauer betrachtet. Grundsätzliche Unterschiede zu den anderen Konventionen werden im Text angesprochen. Vgl. zur Bedeutung von Art. 47 ZP I auch Behnsen, The Status of Mercenaries, S. 497.
[111] Vgl. ausführlich zur Entstehungsgeschichte des Art. 47 ZP I: Maaß, Der Söldner, S. 83–105.
[112] Vgl. Wieczorek, Judith: Unrechtmäßige Kombattanten und humanitäres Völkerrecht, Berlin 2005 (=Veröffentlichungen des Walther-Schücking-Institus für Internationales Recht an der Universität Kiel Nr. 153), S. 57.
[113] Vgl. zur Argumentation der Westlichen Länder: 6th Committee (UNGA): Summary Record of the 23rd Meeting, UNGA 6.C, 38th Session (24.10.1983), UN Doc. A/C.6/38/SR.23 (Aussage Mr Saint-Martin (Kanada) und Mr DeStroop (Australien)); 6th Committee (UNGA): Summary Record of the 25th Meeting, UNGA 6.C, 38th Session (25.10.1983), UN Doc. A/C.6/38/SR.25 (Aussage Mr Font (Spanien)); ausführlich zur Argumentation beider Seiten: Rabus, Ist das Söldnerverbot, S. 523–525.
[114] Zwei weitere Gründe für die Einigung lassen sich finden: Zum Einen erhöhte der medienwirksame Angriff des Söldners Bob Denard auf die Hauptstadt von Benin im Januar 1977 den Druck auf die Konferenz, eine Einigung zu erzielen. Zum Anderen sollte für ähnlich gelagerte Fälle wie den, welcher Gegenstand des Luanda-Prozesses gewesen war, möglichst schnell eine rechtliche Basis geschaffen werden. Vgl. Sidos, François-Xavier: Mercenaire, Espèce en Voie de Disparition?, in: Défense Nationale, 59 (Paris 2003) 4, S. 129–138, hier S. 130; Maaß, Der Söldner, S. 83, 86.
[115] Vgl. Behnsen, The Status of Mercenaries, S. 507. Zu den Folgen eines Statusverlustes für die individuelle Rechtsposition im heutigen Sinne vgl. Abschnitt 4.2.2.
[116] Im Hinblick darauf werden Söldner auch als unrechtmäßige Kombattanten bezeichnet. Vgl. Wieczorek, Unrechtmäßige Kombattanten, S. 56; zum rechtlichen Hintergrund auch FN 391.
[117] Vgl. Rabus, Ist das Söldnerverbot, S. 511; Nossal, Global Governance, S. 468f; Green, Leslie C.: The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester, New York 1993, S. 114. Allerdings ist diese Aussage insofern zu relativieren, als dass es jedem Staat, der ZP I ratifiziert und damit auch Art. 47 anerkannt hat, trotzdem weiterhin möglich ist, dem Söldner diesen Kombattantenstatus zuzuerkennen und ihn dementsprechend zu behandeln – nur hat der Söldner darauf keinen garantierten Rechtsanspruch mehr.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836607537
- Dateigröße
- 4.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität der Bundeswehr München, Neubiberg – Internationale Politik, Sicherheitspolitik, Wehr- und Völkerrecht, Staats- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- private militärfirmen military contractors völkerrecht militär söldner
- Produktsicherheit
- Diplom.de