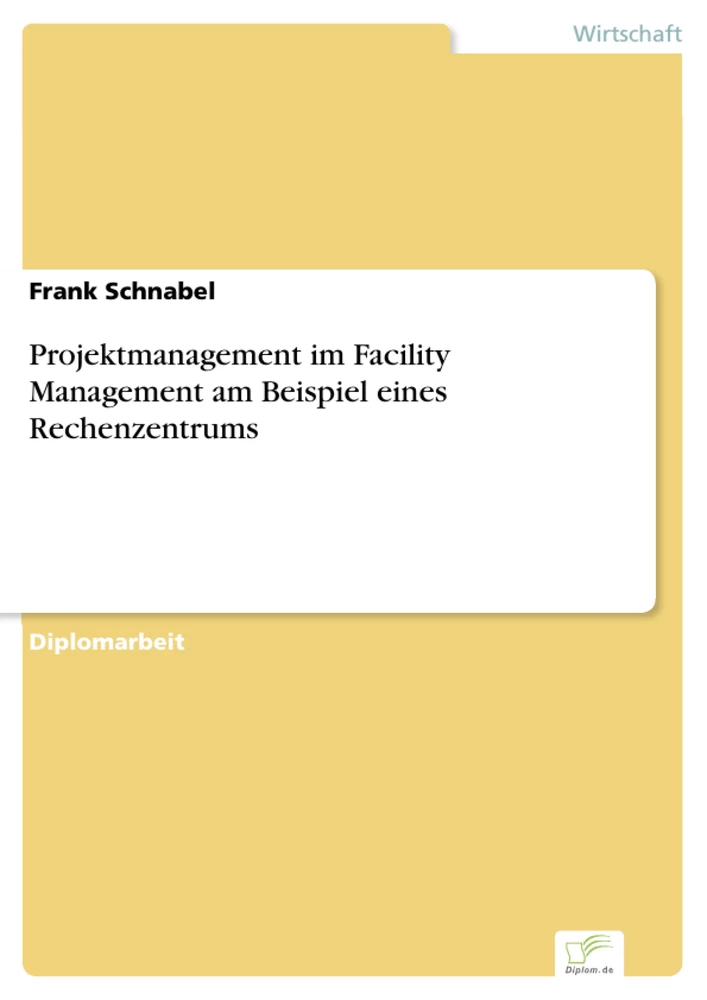Projektmanagement im Facility Management am Beispiel eines Rechenzentrums
©2005
Diplomarbeit
61 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Im Zuge der Globalisierung, in der die Wirtschaft immer mehr zusammenwächst, hat sich in den meisten Betrieben die Unternehmenspolitik verändert. Neben seinen Routinearbeiten fallen für den Angestellten nun auch immer mehr Projektarbeiten an aber was hat man sich genau unter einem Projekt vorzustellen? Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von unterschiedlicher Komplexität.
Zeitlich befristet bedeutet, dass das Projekt auf ein vorab definiertes Ziel ausgelegt ist und mit Erreichen dieses Ziels endet. Das Risiko eines Projektes ergibt sich zwangläufig aus der relativen Innovation, da bei Projektstart keiner der Beteiligten sagen kann, ob unerwartete Probleme auftreten und welcher Art sie sind. Projekte sind als ganzheitliche Aufgaben zu betrachten. Als solche sind sie komplex, was die Einschätzung ihrer Machbarkeit, Planung, Durchführung und ihrer wirtschaftlichen Folgen angeht. Daraus ergibt sich, dass eine Vielzahl von Faktoren und Wirkungszusammenhänge zu berücksichtigen sind.
Um diese Komplexität zu bewältigen, werden Teams gebildet, die sich aus Mitarbeiter verschiedener Abteilungen oder externen Auftragnehmer zusammensetzen. Es macht durchaus Sinn, dass je nach Projektart in einem solchen Projektteam Fachleute aus so grundverschiedenen Bereichen wie Einkauf, Marketing und Forschung zusammenarbeiten.
Für jedes Projekt muss ein Projektleiter oder Projektmanager ernannt werden, dessen Kompetenzen und Befugnisse jedoch unterschiedlich definiert werden können. Die Aufgaben des Projektleiters die Projektplanung, die Projektsteuerung und die Projektüberwachung werden zusammengefasst als Projektmanagement bezeichnet. Die Hauptaufgabe beim Projektmanagement liegt für den Manager in der Koordination der Zeit, der Ressourcen, des Personals und der Kommunikation.
Da in der Regel die Projekte nicht die einzige Hauptaufgabe der Mitarbeiter darstellen, sondern häufig neben der Routinearbeit erledigt werden müssen, ist diese Delegation oftmals schwierig. Für die Projektbeteiligte stellt sich die Frage, wessen Auftrag er zuerst erledigt: den des Projektmanagers oder den seines Abteilungsleiters.
In vielen Unternehmen herrscht das Problem, dass die einzelnen Abteilungen zuerst an die eigenen Aufgaben denken und die Projekte eher stiefmütterlich behandeln. Auch werden die Mitarbeiter oftmals nicht zu Teammeetings oder zu Geschäftsreisen freigestellt, weil die Abteilungsarbeit […]
Im Zuge der Globalisierung, in der die Wirtschaft immer mehr zusammenwächst, hat sich in den meisten Betrieben die Unternehmenspolitik verändert. Neben seinen Routinearbeiten fallen für den Angestellten nun auch immer mehr Projektarbeiten an aber was hat man sich genau unter einem Projekt vorzustellen? Ein Projekt ist eine zeitlich befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von unterschiedlicher Komplexität.
Zeitlich befristet bedeutet, dass das Projekt auf ein vorab definiertes Ziel ausgelegt ist und mit Erreichen dieses Ziels endet. Das Risiko eines Projektes ergibt sich zwangläufig aus der relativen Innovation, da bei Projektstart keiner der Beteiligten sagen kann, ob unerwartete Probleme auftreten und welcher Art sie sind. Projekte sind als ganzheitliche Aufgaben zu betrachten. Als solche sind sie komplex, was die Einschätzung ihrer Machbarkeit, Planung, Durchführung und ihrer wirtschaftlichen Folgen angeht. Daraus ergibt sich, dass eine Vielzahl von Faktoren und Wirkungszusammenhänge zu berücksichtigen sind.
Um diese Komplexität zu bewältigen, werden Teams gebildet, die sich aus Mitarbeiter verschiedener Abteilungen oder externen Auftragnehmer zusammensetzen. Es macht durchaus Sinn, dass je nach Projektart in einem solchen Projektteam Fachleute aus so grundverschiedenen Bereichen wie Einkauf, Marketing und Forschung zusammenarbeiten.
Für jedes Projekt muss ein Projektleiter oder Projektmanager ernannt werden, dessen Kompetenzen und Befugnisse jedoch unterschiedlich definiert werden können. Die Aufgaben des Projektleiters die Projektplanung, die Projektsteuerung und die Projektüberwachung werden zusammengefasst als Projektmanagement bezeichnet. Die Hauptaufgabe beim Projektmanagement liegt für den Manager in der Koordination der Zeit, der Ressourcen, des Personals und der Kommunikation.
Da in der Regel die Projekte nicht die einzige Hauptaufgabe der Mitarbeiter darstellen, sondern häufig neben der Routinearbeit erledigt werden müssen, ist diese Delegation oftmals schwierig. Für die Projektbeteiligte stellt sich die Frage, wessen Auftrag er zuerst erledigt: den des Projektmanagers oder den seines Abteilungsleiters.
In vielen Unternehmen herrscht das Problem, dass die einzelnen Abteilungen zuerst an die eigenen Aufgaben denken und die Projekte eher stiefmütterlich behandeln. Auch werden die Mitarbeiter oftmals nicht zu Teammeetings oder zu Geschäftsreisen freigestellt, weil die Abteilungsarbeit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Frank Schnabel
Projektmanagement im Facility Management am Beispiel eines Rechenzentrums
ISBN: 978-3-8366-0645-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Berlin, Berlin, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
- 2 -
Inhaltsverzeichnis
1
EINLEITUNG ... 5
2
GRUNDLAGEN DES PROJEKTES ... 7
2.1
Aufgaben Probleme - Handlungen ... 7
2.2
Definition Projekt... 9
2.3
Projektziele ... 10
2.4
Projektarten... 11
2.5
Projektaufbauorganisation ... 12
2.5.1
Lenkungsausschuss und Lenkungskreis... 13
2.5.2
Projektleiter... 14
2.5.3
Projektteam ... 16
2.5.4
Teambildungsprozess... 17
3
GRUNDLAGEN DES PROJEKTMANAGEMENTS... 19
3.1
Projektvorbereitung ... 21
3.1.1
Analyse der Ausgangslage ... 21
3.1.2
Projektumfeldanalyse... 21
3.1.3
Zieldefinition... 22
3.1.4
Risikoanalyse ... 23
3.1.5
Beteiligte ... 24
3.2
Projektplanung und ihre Instrumente ... 25
3.2.1
Projektstrukturierung ... 26
3.2.2
Meilensteine... 27
3.2.3
Aufwandschätzung... 28
3.2.4
Ablaufplanung... 28
3.2.5
Ressourcenplanung ... 29
3.2.6
Kostenplanung ... 30
3.2.7
Planoptimierung... 30
3.3
Realisierungsphase... 30
3.3.1
Teambildung und Mitarbeiterführung... 31
3.3.2
Projektcontrolling ... 31
3.3.3
Laufende Überwachung ... 33
3.3.4
Konfliktmanagement... 33
3.3.5
Projektrisiken ... 34
3.4
Projektabschluss ... 35
3.4.1
Dokumentation... 36
3.4.2
Projektabgabe... 38
4
AUFGABE EINES RECHENZENTRUMS... 39
5
AUFGABEN VOM FACILITY MANAGEMENT ... 41
- 3 -
6
PRAKTISCHER TEIL... 43
6.1
Projekt- und Facility Management in der Planungsverantwortung ... 43
6.2
Projektvorbereitung ... 44
6.2.1
Definition der Aufgabenstellung... 44
6.2.2
Bedarfsanalyse ... 44
6.3
Projektplanung... 47
6.3.1
Vorplanung ... 47
6.3.2
Entwurfs- und Genehmigungsplanung... 48
6.3.3
Ausführungsplanung ... 49
6.4
Realisierungsphase... 49
6.4.1
Vorarbeitung der Vergabe... 49
6.4.2
Mitwirkung bei der Vergabe ... 50
6.4.3
Ausführung/ Projektüerwachung ... 51
6.5
Projektabschluss ... 52
6.5.1
Inbetriebnahme ... 52
6.5.2
Dokumentation... 52
6.6
Nutzungsphase... 53
7
ZUSAMMENFASSUNG ... 55
8
LITERATURVERZEICHNIS... 58
- 4 -
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Handlung...8
Abbildung 2: Projektaufbauorganisation... 13
Abbildung 3: Kommunikationsschnittstellen... 15
Abbildung 4: Magisches Dreieck...23
Abbildung 5: Projektstrukturierung... 27
Abbildung 6: Balkendiagramm... 29
Abbildung 7: Facility Management... 41
- 5 -
1
Einleitung
Im Zuge der Globalisierung, in der die Wirtschaft immer mehr zusammenwächst, hat
sich in den meisten Betrieben die Unternehmenspolitik verändert. Neben seinen Routi-
nearbeiten fallen für den Angestellten nun auch immer mehr Projektarbeiten an aber
was hat man sich genau unter einem Projekt vorzustellen? Ein Projekt ist eine ,,zeitlich
befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von unterschiedlicher Kom-
plexität". Zeitlich befristet bedeutet, dass das Projekt auf ein vorab definiertes Ziel aus-
gelegt ist und mit Erreichen dieses Ziels endet. Das Risiko eines Projektes ergibt sich
zwangläufig aus der relativen Innovation, da bei Projektstart keiner der Beteiligten sa-
gen kann, ob unerwartete Probleme auftreten und welcher Art sie sind. Projekte sind als
ganzheitliche Aufgaben zu betrachten. ,,Als solche sind sie komplex, was die Einschät-
zung ihrer Machbarkeit, Planung, Durchführung und ihrer wirtschaftlichen Folgen an-
geht. Daraus ergibt sich, dass eine Vielzahl von Faktoren und Wirkungszusammenhän-
ge zu berücksichtigen sind."
Um diese Komplexität zu bewältigen, werden Teams gebildet, die sich aus Mitarbeiter
verschiedener Abteilungen oder externen Auftragnehmer zusammensetzen. Es macht
durchaus Sinn, dass je nach Projektart in einem solchen Projektteam Fachleute aus so
grundverschiedenen Bereichen wie Einkauf, Marketing und Forschung zusammenarbei-
ten. Für jedes Projekt muss ein Projektleiter oder Projektmanager ernannt werden, des-
sen Kompetenzen und Befugnisse jedoch unterschiedlich definiert werden können. Die
Aufgaben des Projektleiters die Projektplanung, die Projektsteuerung und die Projekt-
überwachung werden zusammengefasst als Projektmanagement bezeichnet. Die
Hauptaufgabe beim Projektmanagement liegt für den Manager in der Koordination der
Zeit, der Ressourcen, des Personals und der Kommunikation.
Da in der Regel die Projekte nicht die einzige Hauptaufgabe der Mitarbeiter darstellen,
sondern häufig neben der Routinearbeit erledigt werden müssen, ist diese Delegation
oftmals schwierig. Für die Projektbeteiligte stellt sich die Frage, wessen Auftrag er zu-
erst erledigt: den des Projektmanagers oder den seines Abteilungsleiters. In vielen Un-
ternehmen herrscht das Problem, dass die einzelnen Abteilungen zuerst an die eigenen
Aufgaben denken und die Projekte eher stiefmütterlich behandeln. Auch werden die
Mitarbeiter oftmals nicht zu Teammeetings oder zu Geschäftsreisen freigestellt, weil die
Abteilungsarbeit in der Zwischenzeit nicht erledigt wird. Diese Konflikte erschweren
- 6 -
dem Projektmanager die Arbeit und die planmäßige Erfüllung des Projektauftrages.
Daher ist es sehr wichtig, dass gleich zu Beginn eines Projektes, die genauen Kompe-
tenzen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Bereichen geregelt werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser die Grundlagen des Projektmanagements theoretisch
und anschließend an einem praktischen Beispiel zu erklären. Der Leser soll danach er-
fahren, wie das Projektmanagement aufgebaut ist und mit welchen Mitteln der Projekt-
leiter und sein Team ein Projekt von Anfang bis zum Abschluss zusammenarbeiten.
Um diese Zielsetzung zu erreichen, werden in den zwei folgenden Kapiteln die theoreti-
schen Grundlagen des Projektes und seines Managements vorgestellt. In den Kapiteln 4
und 5 werden die Aufgaben eines Rechenzentrum und des Facility Management erläu-
tert. Um die beschriebene Theorie zu veranschaulichen, wird im vorletzten Kapitel der
Ausbau eines Rechenzentrums praxisnah präsentiert. In der anschließenden Zusammen-
fassung wird noch einmal auf die zuvor beschriebenen Kapitel eingegangen, d.h. dem
Leser werden die wesentlichen Erkenntnisse dargestellt.
- 7 -
2
Grundlagen des Projektes
Projekte haben ihren Ursprung in der Lösung eines vorhandenen Problems oder Aufga-
be. Die Basis jeder Projektplanung liegt beim Erkennen des Problems und den sich dar-
aus resultierenden Anspruch einer Organisation an die Lösung des Problems. Um das
Problem als solches zu erkennen, ist eine Abgrenzung von Aufgabe, Problem und
Handlung erforderlich.
2.1
Aufgaben- Probleme- Handlungen
Die Lösung von Aufgaben und Problemen erfordert Handlungen. Probleme und Aufga-
ben lassen sich durch drei Komponenten strukturieren. Diese drei Komponenten werden
definiert als [1, S.8]
·
Ist, dem Anfangszustand,
·
Soll, dem Zielzustand (Endzustand) und
·
Transformation, der Weg vom Anfangszustand zum Zielzustand (die Lösung als
geistige Handlung).
Ist bei der Transformation des Ist-Zustandes in den Soll-Zustand produktives Denken
notwendig, so spricht man von einem Problem. Andernfalls handelt es sich um eine
Aufgabe. Die Umsetzung der Transformation, die Analyse aller Möglichkeiten, die von
einem gegebenen Anfangszustand in einen angestrebten Zielzustand führen können,
wird als Handlung bezeichnet (Abbildung 1). [1, S.9]
- 8 -
Die Auswahl von verschiedenen Handlungsmöglichkeiten vollzieht sich in einem geis-
tigen Arbeitsprozess, der als Problemlöse- und Entscheidungsprozess bezeichnet wird.
Dieser Prozess definiert die zu erbringende Leistung des Projektes. Die beiden Teilfunk-
tionen des Problemlöse- und Entscheidungsprozesses können folgendermaßen beschrie-
ben werden [1, S.9] :
Problemlösung
Diagnose: Identifikation der vorliegenden Situation
Auflisten von Handlungsalternativen
Prognose: Bestimmung möglicher Konsequenzen
Entscheidung
Informationsauswahl/-sammlung
Abschätzen der Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer bestimmten
Konsequenz
Festsetzen der Nutzererwartung für eine bestimmte Konsequenz
Wahl einer Transformation
- 9 -
Wird eine Organisation mit einem Problem konfrontiert, so ist die Anwendung der
Problemlöse- und Entscheidungsprozesse notwendig. Dazu sind die Ermittlung und
Analyse aller Möglichkeiten (Transformationen), die vom Ausgangszustand in den Ziel-
zustand führen, notwendig. Wurden alle möglichen Handlungsvarianten analysiert,
müssen deren Vor- und Nachteile erörtert und bewertet werden (Strategische Planung).
Die Auswahl der optimalen Möglichkeit, die den Zielzustand unter den gegebenen Be-
dingungen zugänglich macht, führt zur entsprechenden Entscheidung und damit zur
Lösung des Problems. Die Klärung folgender Fragen können dabei hilfreich sein: [2,
S.34]
Situationsanalyse: Was ist los?
Zielsetzung: Was soll erreicht werden?
Konzept: Welche Lösungen sind möglich?
Bewertung: Welche davon sind sinnvoll?
Entscheidung: Wie die Lösung realisieren?
Ressourcen: Welche Hilfsmittel werden benötigt?
Zur Lösungsermittlung werden Dienstleistungsunternehmen beauftragt, um vorhandene
Probleme des Auftraggebers zu analysieren, die technisch machbare Lösung anhand des
Problemlöse- und Entscheidungsprozess zu finden und dementsprechend die Leistung
zur Lösung des Problems anzubieten. Die vorhandenen Problemlöse- und Entschei-
dungsprozesse werden dabei mit Hilfe von Projektmanagement organisiert und koordi-
niert. Ergänzt wird diese Koordination und Organisation durch Kontroll- und Rege-
lungsaufgaben.
2.2
Definition Projekt
Ein Projekt ist ein ,,Vorhaben, das im wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedin-
gungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist". [3] Diese ein Projekt definierenden
Elemente werden geprägt durch unterschiedliche Merkmale.
- 10 -
Als eines der wichtigsten Merkmale ist die Neuartigkeit der Arbeit zu nennen. Darunter
versteht man eine Aufgabe, die ,,so noch nicht bearbeitet wurde und auch genau so vor-
aussichtlich nicht wieder auftreten wird". [4, S.14]
Die Projektmitarbeiter sind angehalten, sich bislang unbekannten Situationen zu stellen,
indem sie neue Ideen und systematische Vorgehensweisen entwickeln. Des weiteren ist
ein Projekt gekennzeichnet durch eine klare Zielvorgabe, die vor Projektbeginn eindeu-
tig definiert sein sollte, und die nach Projektabschluss auf ihre Erreichung hin überprüft
werden kann. Somit wird auch deutlich, dass ein Projekt immer eine zeitliche Befris-
tung beinhaltet, gekennzeichnet durch einen Anfangs- und Endtermin. Folglich handelt
es sich um temporäre Aufgaben, die mit der Erreichung eines vorab definierten Ziels
enden. [5, S.13] Weitere Begrenzungen können z.B. finanzieller, personeller und ande-
rer Art sein, mit denen sich Projektmitarbeiter in der Praxis auseinander zu setzen ha-
ben.
Neben diesen sind noch weitere Merkmale wie Komplexität, Teamarbeit, besondere
Bedeutung des Vorhabens, projektspezifische Organisation und die Abgrenzung gegen-
über anderen Vorhaben signifikant für die Abwicklung von Projekten.
2.3
Projektziele
Projekte zeichnen sich demnach u.a. durch eine klare Zielvorgabe aus. Bei der Formu-
lierung dieser Ziele ist es, gerade in Bezug auf die Projektdurchführung und der hinter-
her erfolgenden Projektkontrolle, von enormer Bedeutsamkeit, dass diese Ziele eindeu-
tig, verständlich und messbar formuliert werden. Jeder der an einem Projekt beteiligten
Personen muss die Ziele kennen, und sie müssen realistisch definiert sein, damit eine
Zielerreichung eingehalten werden kann. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu le-
gen, dass die Ziele widerspruchsfrei, d.h. in sich konsistent sind, damit Unklarheiten
ausgeschlossen werden können.
Eine vorgenommene Terminierung der Projektziele sowie die Möglichkeit, die Realisie-
rung durch aktives Mitgestalten zu beeinflussen, sollten bei der Formulierung sämtli-
cher Ziele berücksichtigt werden. Das Hauptziel fast jeden Projektes ist es, die ,,vertrag-
liche Erfüllung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Kunden oder
Auftraggeber unter Beachtung der übergeordneten Regeln und Auflagen" [7, S.12] zu
- 11 -
erreichen. Des weiteren verfolgt ein Unternehmen bei der Projektdurchführung das Ziel,
den wirtschaftlichen Erfolg durch möglichst geringe Projektkosten zu garantieren sowie
durch eine hohe Qualität der Leistungen in möglichst kurzer Zeit als Referenz und Emp-
fehlungen für weitere Aufträge zu überzeugen. [7, S.12 ] Diese verschiedenen Projekt-
ziele sind abhängig voneinander.
2.4
Projektarten
Es gibt verschiedene Faktoren, die für die Art eines Projektes verantwortlich sind. So
spielen z.B. die Komplexität eines Projektes, seine Größe oder auch seine Rahmenbe-
dingungen eine entscheidende Rolle für die Charakterisierung eines bestimmten Pro-
jekttyp. [6, S. 18] Sicherlich gibt es ähnlich viele Klassifizierungen von Projekten wie
Projekte selbst, [5, S.14] es lassen sich aber trotzdem drei Grundarten von Projekten
beschreiben:
Forschungsprojekte
Organisationsprojekte
Investitionsprojekte [8, S.14]
Bei Forschungsprojekten handelt es sich um Arbeiten, die meist in Zusammenhang mit
wissenschaftlichen Tätigkeiten stehen, und die versuchen, einen gegenwärtigen Kennt-
nisstand zu erweitern. Sie sind sicherlich die risikoreichsten Projekte, da zu Beginn des
Projektes ein möglicher Erfolg nur sehr schwer abzuschätzen ist. [9, S. 19] Die Pharma-
industrie führt z.B. Forschungsprojekte vor Einführung eines neuen Medikamentes
durch, um mögliche Nebenwirkungen ausschließen zu können.
Organisations- und Datenverarbeitungsprojekte (auch Managementprojekte genannt)
beschäftigen sich mit der Veränderung von Strukturen in Unternehmen, und dies hat zur
Folge, dass der Erfolg solcher Projekte sicherlich nicht immer sofort auf Anhieb ersicht-
lich ist. [9, S. 19] Als Beispiel kann die Umwandlung einer Projektorganisation in die
einer ,,Lernenden Organisation herangezogen" werden.
Investitionsprojekte als dritte Projektart handeln von der ,,Herstellung, Errichtung oder
- 12 -
individuellen Beschaffung von Sachanlagen" [6, S. 18]. Solch ein Projekt können z.B.
Projekte in Hoch- und Tiefbau, Bergbau und Tagbau oder auch Fertigungsprojekte sein,
also meist sehr kostenintensive Projekte. [ 9, S. 18]
Produktionsunternehmen haben es in der Praxis sicherlich eher mit Investitionsprojek-
ten zu tun, was bedeutet, dass sie sehr viel Wert auf eine genaue Planung der entstehen-
den Kosten legen sollten, damit diese kapitalintensiven Projekte nicht plötzlich wegen
mangelnder Finanzierbarkeit unterbrochen werden müssen. Dienstleistungsunternehmen
werden in der Praxis hingegen eher mit Organisations- und Forschungsprojekten kon-
frontiert, die es schwer machen, ein Projekt in seiner Gesamtheit gleich zu Beginn zu
erkennen.
Da sich die Grundprinzipien des Projektmanagements jedoch auf alle Arten von Projek-
ten anwenden lassen, lässt sich hier keine grundsätzliche Tendenz für ein unterschiedli-
ches Vorgehen von Projektmanagement in unterschiedlichen Unternehmensbranchen
ableiten. [5, S.14]
2.5
Projektaufbauorganisation
Die Projektaufbauorganisation eines Unternehmens beschreibt die Strukturen des Pro-
jektes. Sie umfasst das Organigramm, die Projektstruktur und gegebenenfalls auch
Schnittstellen zu verbundenen Projekten (Abbildung 2).
Dazu gehört die Definition von Rollen samt zugehöriger Kompetenzen und Verantwor-
tung, die Regeln des Informationsflusses und die Vereinbarung sonstiger Regeln der
Zusammenarbeit.
Im Interesse eines konfliktfreien Projektablaufes wird die Projektaufbauorganisation zu
Beginn des Projektes definiert. Zumindest Projektleitung, Lenkungsausschuss, die An-
bindung an die Betriebsorganisation und gegebenenfalls die Lokalisierung sollten hier-
bei definiert werden.
- 13 -
2.5.1
Lenkungsausschuss und Lenkungskreis
Als Steuerungsstelle im Projekt wird der Lenkungsausschuss eingerichtet. Der Len-
kungsausschuss trägt einen Teil der Projektverantwortung und hat folgende Aufgaben:
[1, S. 157 f]
Ausarbeitung des Projektauftrags mit Festlegung des Grobziels und den dazuge-
hörigen Randbedingungen,
Abgleich von Projektzielen mit übergeordneten strategischen Zielen,
Bereitstellung von Ressourcen aus den Fachbereichen, Ernennung des Projekt-
leiters, Festlegung der Projektorganisation, Abgrenzung der Entscheidungskom-
petenzen des Projektleiters gegenüber der Linienhierarchie im Unternehmen,
Betreuung der Projektphasen und Zustimmung beim Übergang von der einen
Phase zur nächsten,
Eingriff und Entscheidungsfindung bei starken Abweichungen gegenüber der
eigentlichen Planung,
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783836606455
- DOI
- 10.3239/9783836606455
- Dateigröße
- 559 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Berlin – Betriebswirtschaft, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2007 (November)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- rechenzentrum facility management projektmanagement projektphasen risikoanalyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de