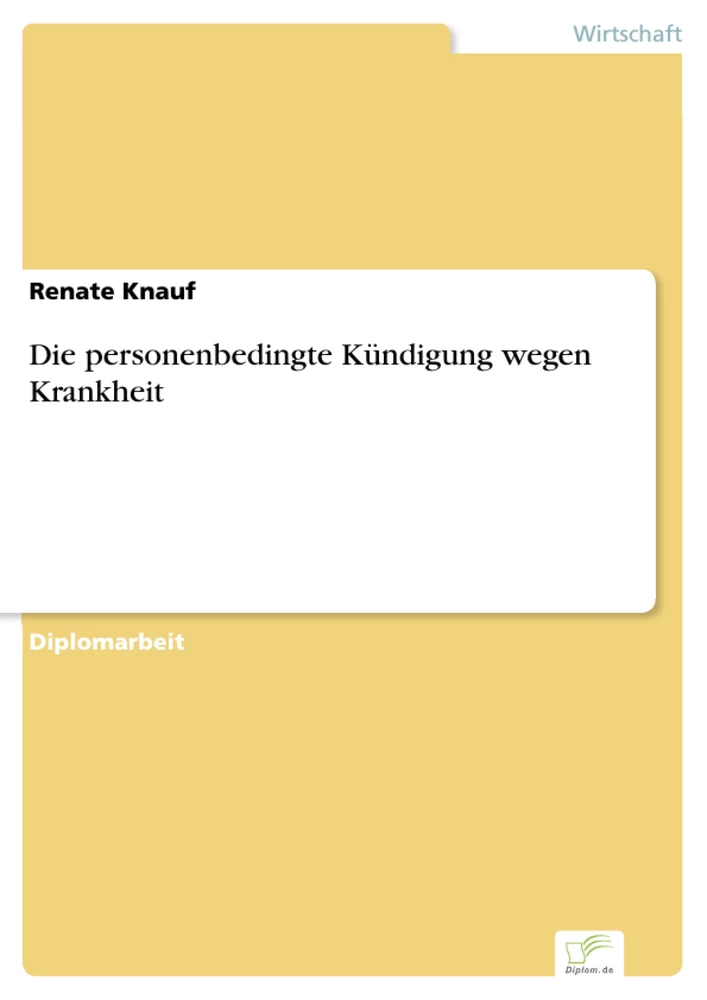Die personenbedingte Kündigung wegen Krankheit
©2006
Diplomarbeit
106 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Der praktisch bedeutsamste Fall der personenbedingten Kündigung ist die Kündigung wegen Krankheit. Zwar kann die Krankheit alleine eine Kündigung niemals rechtfertigen, jedoch ist sie auch kein Kündigungshindernis. Für den Arbeitnehmer treten neben der Belastung der Erkrankung noch die Gefahr des Verlustes der beruflichen Existenz auf, denn es kann auch während der bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine Kündigung wegen Krankheit ausgesprochen werden.
Die Rechtsprechung unterscheidet vier Fallgruppen der krankheitsbedingten Kündigung, deren Besonderheiten in der vorliegenden Arbeit anhand einiger Praxisfälle beleuchtet werden. Alle Fallgruppen der Kündigung wegen Krankheit werden auf ihre soziale Rechtfertigung hin mittels eines dreistufigen Schemas geprüft. Dieses Prüfungsschema ist für alle krankheitsbedingten Kündigungsgründe in gleicher Weise anzuwenden, jedoch werden im Verlauf dieser Arbeit einige Unterschiede, die bei den einzelnen Krankheitsarten auftreten, verdeutlicht.
Die krankheitsbedingte Kündigung erfasst alle Fallgestaltungen, bei denen die Krankheit und die daraus folgende Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers den Arbeitgeber zum Ausspruch einer Kündigung veranlassen. Die rechtlichen Probleme, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind vielfach nicht gesetzlich geregelt, sondern werden im Wesentlichen der Rechtsprechung überlassen. Daher soll der Schwerpunkt dieser Arbeit auf die Darstellung der zahlreichen gerichtlichen Entscheidungen gelegt werden. Auch wenn die Rechtsprechung in den letzten Jahren einige Grundsätze herausgearbeitet hat, so wird deutlich, dass trotzdem manches widersprüchlich erscheint. Die Rechtsprechung hat sich bei den Beurteilungsmaßstäben, die eine krankheitsbedingte Kündigung begründen, nicht festgelegt. Es gibt keinen Katalog, der aufzeigt, wie die einzelnen Aspekte, die bei dieser Kündigung berücksichtigt werden, zu bewerten sind. Es wird immer wieder betont, dass jede Wertung der einzelnen Gesichtspunkte, die im Rahmen der krankheitsbedingten Kündigung geprüft werden müssen, einzelfallabhängig ist und festgelegte Grenzwerte, die eine Kündigung rechtfertigen, nicht existieren. Für den Einzelfall lässt sich nur sehr schwer der Ausgang der Kündigung voraussagen, da von vornherein nicht feststeht, welchem der verschiedenen Abwägungspunkte das angerufene Gericht letzten Endes das entscheidende Gewicht beimisst.
Diese Unsicherheit stößt in der Literatur immer wieder auf Kritik. […]
Der praktisch bedeutsamste Fall der personenbedingten Kündigung ist die Kündigung wegen Krankheit. Zwar kann die Krankheit alleine eine Kündigung niemals rechtfertigen, jedoch ist sie auch kein Kündigungshindernis. Für den Arbeitnehmer treten neben der Belastung der Erkrankung noch die Gefahr des Verlustes der beruflichen Existenz auf, denn es kann auch während der bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine Kündigung wegen Krankheit ausgesprochen werden.
Die Rechtsprechung unterscheidet vier Fallgruppen der krankheitsbedingten Kündigung, deren Besonderheiten in der vorliegenden Arbeit anhand einiger Praxisfälle beleuchtet werden. Alle Fallgruppen der Kündigung wegen Krankheit werden auf ihre soziale Rechtfertigung hin mittels eines dreistufigen Schemas geprüft. Dieses Prüfungsschema ist für alle krankheitsbedingten Kündigungsgründe in gleicher Weise anzuwenden, jedoch werden im Verlauf dieser Arbeit einige Unterschiede, die bei den einzelnen Krankheitsarten auftreten, verdeutlicht.
Die krankheitsbedingte Kündigung erfasst alle Fallgestaltungen, bei denen die Krankheit und die daraus folgende Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers den Arbeitgeber zum Ausspruch einer Kündigung veranlassen. Die rechtlichen Probleme, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind vielfach nicht gesetzlich geregelt, sondern werden im Wesentlichen der Rechtsprechung überlassen. Daher soll der Schwerpunkt dieser Arbeit auf die Darstellung der zahlreichen gerichtlichen Entscheidungen gelegt werden. Auch wenn die Rechtsprechung in den letzten Jahren einige Grundsätze herausgearbeitet hat, so wird deutlich, dass trotzdem manches widersprüchlich erscheint. Die Rechtsprechung hat sich bei den Beurteilungsmaßstäben, die eine krankheitsbedingte Kündigung begründen, nicht festgelegt. Es gibt keinen Katalog, der aufzeigt, wie die einzelnen Aspekte, die bei dieser Kündigung berücksichtigt werden, zu bewerten sind. Es wird immer wieder betont, dass jede Wertung der einzelnen Gesichtspunkte, die im Rahmen der krankheitsbedingten Kündigung geprüft werden müssen, einzelfallabhängig ist und festgelegte Grenzwerte, die eine Kündigung rechtfertigen, nicht existieren. Für den Einzelfall lässt sich nur sehr schwer der Ausgang der Kündigung voraussagen, da von vornherein nicht feststeht, welchem der verschiedenen Abwägungspunkte das angerufene Gericht letzten Endes das entscheidende Gewicht beimisst.
Diese Unsicherheit stößt in der Literatur immer wieder auf Kritik. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 10617
Renate Knauf
Die personenbedingte Kündigung wegen Krankheit
ISBN: 978-3-8366-0617-2
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH), Aachen,
Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbeson-
dere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen
und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf ande-
ren Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur
auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von
Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestim-
mungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen
unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Feh-
ler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder Übersetzer
übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebe-
ne fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
ID 10617
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abkürzungsverzeichnis: ...IV
Literaturverzeichnis... VII
Rechtsprechungsverzeichnis ... XII
Abbildungsverzeichnis ...XVI
1. Einleitung ... 1
1.1. Begriff der Kündigung ... 3
1.2. Kündigungsarten ... 6
1.3. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall... 9
1.4. Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft... 13
2. Das Kündigungsschutzgesetz ... 17
2.1. Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes ... 18
2.2. Soziale Rechtfertigung der Kündigung ... 19
2.2.1. Kündigungsgründe ... 20
2.2.2. Prognoseprinzip... 21
2.2.3. Ultima-Ratio-Prinzip... 22
2.2.4. Interessenabwägung ... 23
3. Arbeitsunfähigkeit infolge einer Krankheit... 23
3.1. Krankheitsbegriff ... 23
3.2. Arbeitsunfähigkeitsbegriff ... 24
ID 10617
4. Die Fallgruppen der krankheitsbedingten Kündigung... 27
4.1. Langandauernde Erkrankung ... 28
4.1.1. Negative Gesundheitsprognose ... 29
4.1.2. Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen... 31
4.1.3. Interessenabwägung ... 34
4.2. Häufige Kurzerkrankungen ... 37
4.2.1. Negative Gesundheitsprognose ... 38
4.2.2. Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen... 40
4.2.3. Interessenabwägung ... 44
4.3. Krankheitsbedingte Leistungsunfähigkeit... 47
4.4. Krankheitsbedingte Leistungsminderung... 51
4.4.1. Negative Gesundheitsprognose ... 52
4.4.2. Erhebliche Beeinträchtigungen betrieblicher Interessen... 53
4.4.3. Interessenabwägung ... 55
5. Einzelfälle kündigungsrechtlich problematischer Krankheitslagen ... 55
5.1. Alkoholabhängigkeit ... 55
5.1.1. Negative Gesundheitsprognose ... 57
5.1.2. Erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen... 61
5.1.3. Interessenabwägung ... 62
5.2. Aids/ HIV-Infektion ... 65
5.3. Arbeitsunfall/ Berufskrankheit... 71
6. Fazit ... 74
Anhang ... XV
ID 10617
Abkürzungsverzeichnis:
Abs. Absatz
Aids
Acquired immune deficiency syndrome
AOK Allgemeine
Ortskrankenkasse
AP Arbeitsrechtliche
Praxis
ArbG Arbeitsgericht
ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
Ass. iur.
juristischer Assessor
Aufl. Auflage
BAG Bundesarbeitsgericht
BAT Bundes-Angestelltentarifvertrag
BB Betriebs-Berater
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz
BGB Bürgerliches
Gesetzbuch
BKV Berufskrankheiten-Verordnung
BMT-G
Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeind-
licher Verwaltungen und Betriebe
BSG Bundessozialgericht
bzgl. bezüglich
bzw. beziehungsweise
DB Der
Betrieb
d.h. das
heißt
DHS
deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren
Dr. Doktor
EFZG Entgeltfortzahlungsgesetz
ERFK
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
e.V. eingetragener
Verein
EzA
Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht
EzBAT
Entscheidungssammlung zum BAT
f. folgende
ID 10617
ff. fortfolgende
GewO Gewerbeordnung
ggf. gegebenenfalls
HIV
human immunodeficiency virus
Hrsg. Herausgeber
hrsg. herausgegeben
http
hyper text transfer protocol
i.S. im
Sinne
i.V.m. in
Verbindung
mit
KR Gemeinschaftskommentar
zum
Kündigungsschutzgesetz
KSchG Kündigungsschutzgesetz
LAG Landesarbeitsgericht
LohnFG Lohnfortzahlungsgesetz
Mio. Millionen
NJOZ
Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht
NZA-RR NZA-Rechtsprechungs-Report
Prof. Professor
Rn. Randnummer
RzK Rechtsprechung
zum
Kündigungsrecht
S. Seite
SGB Sozialgesetzbuch
SGG Sozialgerichtsgesetz
SozR Sozialrecht
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
u.a. unter
anderem
UNAIDS
United Nations Programme on HIV/AIDS
u.U. unter
Umständen
v. von
WHO
World Health Organization
www world
wide
web
ID 10617
z.B. zum
Beispiel
zit. Zitiert
zust zustimmend
ID 10617
Literaturverzeichnis
Angel, Erik, Probleme der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Dissertation Saarbrücken, 2000,
Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main.
(zit.: Angel, S.).
Ascheid, Reiner/Dieterich, Thomas/ Dörner, Hans-Jürgen/Eisemann, Hans-Friedrich/Kania,
Thomas/Koch, Ulrich/ Müller-Glöge, Rudi/Oetker, Hartmut/Preis, Ulrich/Rolfs, Christi-
an/Schaub, Günter/Schlachter, Monika/ Steinmeyer, Hans-Dietrich/Wank, Rolf/ Wissmann,
Hellmut, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 5. Aufl.2005, Verlag C. H. Beck, München.
(zit.: ERFK/Bearbeiter, § Rn.).
Bauer, Jobst-Hubertus/Röder, Gerhard/Lingemann, Stefan, Krankheit im Arbeitsverhältnis, 2.
Aufl. 1996, Verlag Recht und Wirtschaft, Heidelberg.
(zit.: Bauer/Röder/Lingemann, S.).
Becker, Friedrich/Etzel, Gerhard/Bader, Peter/Fischermeier, Ernst/Friedrich, Hans-
Wolf/Lipke, Gert-Albert/Pfeiffer, Thomas/Rost, Friedhelm/Spilger, Andreas Michael/Vogt,
Norbert/Weigand, Horst/Wolff, Ingeborg, KR Gemeinschaftskommentar zum Kündigungs-
schutzgesetz und zu sonstigen kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften, 7. Aufl. 2004,
Luchterhand, München/Unterschleißheim.
(zit.: KR/Bearbeiter, § Rn.).
Bengelsdorf, Peter, Alkoholkonsum und personenbedingte Kündigung, NZA-RR 2002, 57.
(zit.: Bengelsdorf, NZA-RR 2002, 57, Zitatseite.).
Bengelsdorf, Peter, Alkohol und Drogen im Betrieb, 2. Aufl. 2003, Sowka und Schiefer, Düs-
seldorf.
(zit.: Bengelsdorf, S.).
Berkowsky, Wilfried, Die personenbedingte Kündigung, NZA-RR 2001, 393.
(zit.: Berkowsky, NZA-RR 2001, 393, Zitatseite.).
Berkowsky, Wilfried, Die personen- und verhaltensbedingte Kündigung, 4. Aufl. 2005, Verlag
C. H. Beck, München.
(zit.: Berkowsky, § Rn.).
Bezani, Thomas, Die krankheitsbedingte Kündigung, Dissertation Köln, Band 115, 1994, Ver-
lag Josef Eul, Bergisch Gladbach/Köln.
(zit.: Bezani, S.).
Boemke, Burkhard, Studienbuch Arbeitsrecht, Band 155, 2. Aufl. 2004, Verlag C.H. Beck,
München.
(zit.: Boemke, § Rn.).
Brockhaus, Gesundheit, 6. Aufl. 2004, F. A. Brockhaus, Mannheim/Leipzig.
(zit.: Brockhaus, S.).
ID 10617
Budde, Berthold, Harenberg Aktuell 2005, 21. Jahrgang 2004, Meyers Lexikonverlag, Mann-
heim/Leipzig/Wien/Zürich.
(zit.: Budde, Harenberg Aktuell 2005, S.).
Bundesministerium für Gesundheit, abrufbar unter:
http://www.bmg.bund.de/nn_600110/SharedDocs/Download/DE/Datenbanken-
Statistiken/Statistiken-Gesundheit/Gesetzliche-
Krankenversiche-
rung/Geschaeftsergebnisse/Krankenstand1,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Kran
kenstand1.pdf.
(zit.: Bundesministerium für Gesundheit, Gesetzliche Krankenversicherung, Internetveröffent-
lichung, S. 7.).
Burtscheidt, Wilhelm, Integrative Verhaltenstherapie bei Alkoholabhängigkeit, 2001, Sprin-
ger-Verlag, Berlin/Heidelberg.
(zit.: Burtscheidt, S.).
Deutsche AIDS-Hilfe e.V., HIV-Arbeitskreis Südwest (Hrsg.), HIV und AIDS, 4. Aufl. 2001,
Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York.
(zit.: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., S.).
DHS-Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V., Substanzbezogene Störungen am
Arbeitsplatz, 2001, DHS, Hamm.
(zit.: DHS-Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren, S.).
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., abrufbar unter:
http://www.dhs.de/substanzen_alkohol.html .
(zit.: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., Internetveröffentlichung).
Dietze, Klaus, Alkohol und Arbeit, 1992, Orell Füssli Verlag, Zürich.
(zit.: Dietze, S.).
Donges, Juergen B./Eekhoff, Johann/Franz, Wolfgang/Möschel, Wernhard/Neumann, Man-
fred J.M., Flexibler Kündigungsschutz am Arbeitsmarkt, Schriftenreihe: Band 41, 2004, Ver-
lag Stiftung Marktwirtschaft, Berlin.
(zit.: Donges/Eekoff/Franz/Möschel/Neumann, S.).
Elsner, Susanne, Personenbedingte Kündigung, 2000, Bund-Verlag, Frankfurt am Main.
(zit.: Elsner, S.).
Fritze, Eugen/May, Burkard/Mehrhoff, Friedrich, Die ärztliche Begutachtung, 6. Aufl. 2001,
Steinkopff Verlag, Darmstadt.
(zit.: Fritze/May/Mehrhoff, S.).
Hallmaier, Roland, Alkohol im Betrieb, in: Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten, hrsg. v.
V. Singer, Manfred/Teyssen, Stephan, 2. Aufl. 2005, Springer Medizin Verlag, Heidelberg,
S. 521.
(zit.: Hallmaier, in: Singer/Teyssen (Hrsg.), S.).
ID 10617
Harth, Angela, Die Neuregelung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Dissertation Köln,
Band 26, 2000, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.
(zit.: Harth, S.).
Henssler, Martin/Willemsen, Heinz Josef/Kalb, Heinz-Jürgen (Hrsg.), Arbeitsrecht Kommen-
tar, 2004,Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.
(zit.: Henssler/Willemsen/Kalb/Bearbeiter, § Gesetz Rn.).
Hohmeister, Frank, Grundzüge des Arbeitsrechts, 2. Aufl. 2002, Schäffer-Poeschel Verlag,
Stuttgart.
(zit.: Hohmeister, S.).
Hoyningen-Huene, Gerrick/Linck, Rüdiger, Kündigungsschutzgesetz, 13. Aufl. 2002, Verlag
C. H. Beck, München.
(zit.: Hoyningen-Huene/Linck, § Rn.).
Hromadka, Wolfgang, Arbeitsrecht, Handbuch für Führungskräfte, 2. Aufl. 2004, Verlag
Recht und Wirtschaft, Heidelberg.
(zit.: Hromadka, § Rn.).
Hummel, Dieter, Krankheit und Kündigung, 2. Aufl. 2004, Bund-Verlag, Frankfurt am Main.
(zit.: Hummel, S.).
Hümmerich, Klaus, Kündigung von Arbeitsverhältnissen, 1999, Deutscher Anwalt Verlag,
Bonn.
(zit.: Hümmerich, § Rn.).
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, iwd Jg. 31, Nr. 9, März 2005, S. 1.
(zit.: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, iwd, S.).
Kasper, Franz, Die Kunst forensischer Prophetie als Darlegungs- und Beweismittel bei
krankheitsbedingten Kündigungen des Arbeitgebers - Ein Beitrag zur Auslegung des § 1 II 1,
4 KSchG 1969 durch den 2. Senat des BAG, NJW 1994, 2979.
(zit.: Kasper, NJW 1994, 2979, Zitatseite.).
Kittner, Michael/Zwanziger, Bertram, Arbeitsrecht, 3. Aufl. 2005, Bund-Verlag, Frankfurt am
Main.
(zit.: Kittner/Zwanziger/Bearbeiter, § Rn.).
Kossens, M./Kreizberg, K./Lenzing,D./Meyerhoff, H. J./Sigmonzik, R., Arbeitsrecht 2005,
2005, LexisNexis, Münster.
(zit.: Kossens/Kreizberg/Lenzing/Meyerhoff/Sigmonzik, S.).
Krause, Rüdiger, Arbeitsrecht, 2005, Nomos, Baden-Baden.
(zit.: Krause, § Rn.).
Kunz, Olaf/Wedde, Peter, EFZR Entgeltfortzahlungsrecht, Kommentar, 2000, Bund-Verlag,
Frankfurt am Main.
(zit.: Kunz/Wedde, § Gesetz Rn.).
ID 10617
Künzl, Reinhard, Suchtprobleme (insbesondere Alkohol) und Suchtkontrolle im Arbeitsver-
hältnis, in: Krankheit im Arbeitsverhältnis, hrsg. v. Rieder, Hans Dieter, 1994, Rieder-Verlag
für Recht und Kommunikation, Münster, S. 167.
(zit.: Künzl, in: Rieder (Hrsg.), S.).
Küttner, Wolfdieter, Personalbuch 2005, 12. Aufl. 2005, Verlag C. H. Beck, München.
(zit.: Küttner/Bearbeiter, Stichwort, Rn.).
Lepke, Achim, Kündigung bei Krankheit, 11. Aufl. 2003, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
(zit.: Lepke, Rn.).
Lipperheide, Jürgen Peter, Arbeitsrecht, 2005, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart.
(zit.: Lipperheide, S.).
Memento, Personalrecht für die Praxis 2005, 7. Aufl. 2005, Memento Verlag, Freiburg.
(zit.: Memento, Rn.).
Memento spezial, Die arbeitsrechtliche Kündigung für die Praxis, 2001, Memento Verlag,
Freiburg.
(zit.: Memento spezial, Rn.).
Olderog, Hans Hermann, Alkohol am Arbeitsplatz, in: Krankheit im Arbeitsverhältnis, hrsg.
v. Hromadka, Wolfgang, 1993, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, S. 63.
(zit.: Olderog, in: Hromadka (Hrsg.), S. 63, Zitatseite.).
Preis, Ulrich, Arbeitsrecht, 2. Aufl. 2003,Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.
(zit.: Preis, Arbeitsrecht, §.).
Preis, Ulrich, Die krankheitsbedingte Kündigung, in: Krankheit im Arbeitsverhältnis, hrsg. v.
Hromadka, Wolfgang, 1993, Schäfer-Poeschel Verlag, Stuttgart, S. 93.
(zit.: Preis, in: Hromadka (Hrsg.), S. 93, Zitatseite.).
Preis, Ulrich, Prinzipien des Kündigungsrechts bei Arbeitsverhältnissen, Band 53, 1987, Ver-
lag C. H. Beck, München.
(zit.: Preis, Prinzipien, S.).
Reinecke, Gerhard, Krankheit und Arbeitsunfähigkeit - die zentralen Begriffe des Rechts der
Entgeltfortzahlung, DB 1998, 130.
(zit.: Reinecke, DB 1998, 130, Zitatseite.).
Robert Koch-Institut, HIV/Aids in Deutschland-Eckdaten, abrufbar unter:
http://www.rki.de/cln_011/nn_334076/DE/Content/InfAZ/H/HIVAIDS/Epidemiologie/Daten
__und__Berichte/EckdatenDeutschland,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Eckdat
enDeutschland
(zit.: Robert Koch-Institut, Internetveröffentlichung, S.).
Schwede, Joachim, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 3. Aufl. 2002, Carl Heymanns Verlag,
Köln/Berlin/Bonn/München.
(zit.: Schwede, S.).
ID 10617
Schwerdtner, Peter, Unzumutbar hohe Lohnfortzahlungskosten und krankheitsbedingte Kün-
digung, DB 1990, 375.
(zit.: Schwerdtner, DB 1990, 375, Zitatseite.).
Stahlhacke, Eugen/Preis, Ulrich/Vossen, Reinhard, Kündigung und Kündigungsschutz im
Arbeitsverhältnis, 8. Aufl. 2002, Verlag C. H. Beck, München.
(zit.: Stahlhacke/Bearbeiter, Rn.).
Tschöpe, Ulrich, Die krankheitsbedingte Kündigung in der Rechtsprechung des BAG, DB
1987, 1042.
(zit.: Tschöpe, DB 1987, 1042, Zitatseite.).
UNAIDS/World Health Organisation, Die Aids Epidemie, Status Bericht: Dezember 2005,
abrufbar unter:
http://www.unaids.org/epi/2005/doc/EPIupdate2005_pdf_ge/epi-update2005_ge.pdf
(zit.: UNAIDS/World Health Organisation, Internetveröffentlichung, S.).
Vetter, Christian/Küsgens, Ingrid/Dold, Sascha, Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deut-
schen Wirtschaft im Jahr 2002, in: Fehlzeiten-Report 2003, hrsg. v. Badura, Bernhard/
Schellschmidt, Henner/Vetter, Christian, 2004, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, S. 263.
(zit.: Vetter/Küsgens/Dold, in: Badura/Schellschmidt/Vetter (Hrsg.), S. 263, Zitatseite.).
Vogelsang, Hinrich, Entgeltfortzahlung, 2003, Verlag C. H. Beck, München.
(zit.: Vogelsang, Rn.).
Weber, Ulrich/Kothe-Heggemann, Claudia, Kündigung und Kündigungsschutz, 1994, Wirt-
schaftsverlag Carl Ueberreuter, Wien.
(zit.: Weber/Kothe-Heggemann, S.).
Zok, Klaus, Einstellungen und Verhalten bei Krankheit im Arbeitsalltag, in: Fehlzeitenreport
2003, hrsg. v. Badura, Bernhard/Schellschmidt, Henner/Vetter, Christian, 2004, Springer-
Verlag, Berlin/Heidelberg, S. 243.
(zit.: Zok, in: Badura/Schellschmidt/Vetter (Hrsg.), S. 243, Zitatseite.).
ID 10617
Rechtsprechungsverzeichnis
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften:
EuGH 05.10.1994, Rs. C-404/92 P, NJW 1994, 3005.
Bundesarbeitsgericht:
BAG 08.08.1963, 5 AZR 395/62, NJW 1963, 2341.
BAG 20.03.1969, 2 AZR 283/68, AP GewO § 123 Nr. 27.
BAG 04.05.1971, 1 AZR 305/70, AP LohnFG § 1 Nr. 3.
BAG 05.08.1976, 3 AZR 110/75, DB 1976, 2307.
BAG 25.08.1977, 3 AZR 705/75, AP BMT-G II § 54 Nr. 1.
BAG 30.05.1978, 2 AZR 630/76, AP BGB § 626 Nr. 70.
BAG 28.02.1979, 5 AZR 611/77, AP LohnFG § 1 Nr. 44.
BAG 22.02.1980, 7 AZR 295/78, NJW 1981, 298.
BAG 25.06.1981, 6 AZR 940/78, AP BGB § 616 Nr. 52.
BAG 07.10.1981, 5 AZR 338/79, NJW 1982, 1014.
BAG 25.11.1982, 2 AZR 140/81, DB 1983, 1047.
BAG 01.06.1983, 5 AZR 536/80, NJW 1983, 2659.
BAG 23.06.1983, 2 AZR 15/82, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 10.
BAG 08.12.1983, 2 AZR 337/82, NZA 1984, 31.
BAG 15.02.1984, 2 AZR 573/82, NJW 1984, 2655.
BAG 29.02.1984, 5 AZR 455/81, AP BGB § 616 Nr. 64.
BAG 12.04.1984, 2 AZR 77/83, DB 1985, 873.
BAG 17.05.1984, 2 AZR 3/83, NJW 1985, 284.
BAG 15.08.1984, 7 AZR 536/82, BB 1985, 800.
BAG 07.11.1985, 2 AZR 657/84, NJW 1986, 2392.
BAG 15.01.1986, 5 AZR 237/84, NJW 1986, 2133.
BAG 30.01.1986, 2 AZR 668/84, NZA 1987, 555.
BAG 11.03.1987, 5 AZR 739/85, NZA 1987, 452.
BAG 09.04.1987, 2 AZR 210/86, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 18.
BAG 11.11.1987, 5 AZR 497/86, NJW 1988, 1546.
BAG 16.03.1988, 7 AZR 587/87, AP BGB § 130 Nr. 16.
BAG 30.03.1988, 5 AZR 42/87, AP LohnFG § 1 Nr. 77.
ID 10617
BAG 16.02.1989, 2 AZR 299/88, NZA 1989, 923.
BAG 02.03.1989, 2 AZR 275/88, NZA 1989, 635.
BAG 26.07.1989, 5 AZR 301/88, NZA 1990, 140.
BAG 06.09.1989, 2 AZR 19/89, BB 1990, 553.
BAG 06.09.1989, 2 AZR 224/89, NZA 1990, 434.
BAG 06.09.1989, 2 AZR 118/89, NZA 1990, 305.
BAG 07.02.1990, 2 AZR 359/89, DB 1990, 2373.
BAG 28.02.1990, 2 AZR 401/89, NZA 1990 727.
BAG 29.03.1990, 2 AZR 369/89, AP KSchG 1969 § 1 betriebsbedingte Kündigung Nr. 50.
BAG 05.07.1990, 2 AZR 154/90, NZA 1991, 185.
BAG 04.10.1990, 2 AZR 201/90, NZA 1991, 468.
BAG 13.12.1990, 2 AZR 336/90, EzA KSchG § 1 Krankheit Nr. 33.
BAG 07.02.1991, 2 AZR 205/90, NZA 1991, 806.
BAG 15.03.1991, 2 AZR 516/90, NZA 1992, 452
.
BAG 07.08.1991, 5 AZR 410/90, NZA 1992, 69.
BAG 26.09.1991, 2 AZR 132/91, NZA 1992, 1073.
BAG 21.05.1992, 2 AZR 399/91, NZA 1993, 497.
BAG 09.09.1992, 2 AZR 190/92, NZA 1993, 598.
BAG 14.01.1993, 2 AZR 343/92, NZA 1994, 309.
BAG 19.05.1993, 2 AZR 539/92, RzK I 5g Nr. 53.
BAG 19.05.1993, 2 AZR 598/92, RzK I 5g Nr. 54.
BAG 29.07.1993, 2 AZR 155/93, NZA 1994, 67.
BAG 11.08.1994, 2 AZR 9/94, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 31.
BAG 26.01.1995, 2 AZR 649/94, NZA 1995, 517.
BAG 12.07.1995, 2 AZR 762/94, AP BGB § 626 Krankheit Nr. 7.
BAG 31.01.1996, 2 AZR 68/95, NZA 1996, 819.
BAG 21.03.1996, 2 AZR 455/95, NZA 1996, 871.
BAG 21.11.1996, 2 AZR 357/95, NZA 1997, 487.
BAG 29.01.1997, 2 AZR 9/96, NZA 1997, 709.
BAG 05.02.1998, 2 AZR 227/97, NZA 1998, 771.
BAG 17.02.1998, 9 AZR 130/97, NZA 1999, 33.
BAG 06.05.1998, 5 AZR 612/97, NZA 1998, 939.
BAG 29.04.1999, 2 AZR 431/98, NZA 1999, 978.
BAG 17.06.1999, 2 AZR 639/98, NJW 2000, 2762.
ID 10617
BAG 16.09.1999, 2 AZR 123/99, AP BGB § 626 Nr. 159.
BAG 20.01.2000, 2 AZR 378/99, NZA 2000, 768.
BAG 18.10.2000, 2 AZR 627/99, AP BGB § 626 Krankheit Nr. 9.
BAG 18.01.2001, 2 AZR 616/99, DB 2002, 100.
BAG 21.02.2001, 2 AZR 558/99, NZA 2001, 1071.
BAG 15.03.2001, 2 AZR 705/99, BB 2001, 1960.
BAG 21.11.2001, 5 AZR 296/00, NZA 2002, 439.
BAG 12.12.2001, 5 AZR 253/00, NZA 2002, 787.
BAG 12.04.2002, 2 AZR 148/01, NZA 2002, 1081.
BAG 07.11.2002, 2 AZR 599/01, AP KSchG 1969 § 1 Krankheit Nr. 40.
BAG 26.02.2003, 5 AZR 162/02, NZA 2003, 992.
BAG 20.08.2003, 5 AZR 610/02, NZA 2004, 39.
BAG 27.11.2003, 2 AZR 601/02, NJOZ 2004, 3301.
BAG 11.12.2003, 2 AZR 667/02, NZA 2004, 784.
BAG 25.03.2004, 2 AZR 341/03, NJW 2004, 3508.
BAG 13.05.2004, 2 AZR 36/04, NZA 2004, 1271.
Landesarbeitsgerichte:
LAG Berlin 17.11.1980, 9 Sa 69/80, AP BGB § 626 Nr. 72.
LAG Düsseldorf 06.03.1986, 5 Sa 1224/85, NZA 1986, 431.
LAG Hamm 19.09.1986, 16 Sa 833/86, NZA 1987, 669.
LAG Hamm 31.01.1990, 2 Sa 1672/89, NZA 1990, 482.
LAG Brandenburg 21.03.1994, 4 (5/4) Sa 369/92, BB 1994, 2282.
LAG Köln 22.06.1995, 5 Sa 781/94, NZA-RR 1996, 170.
LAG Köln 25.08.1995, 13 Sa 440/95, NZA-RR 1996, 247.
LAG Köln, 19.12.1995, 13 Sa 928/95, NZA-RR 1996, 250.
LAG Köln 21.12.1995, 10 Sa 741/95, NZA-RR 1997, 51.
LAG Hessen 23.07.1997, 1 Sa 2416/96, DB 1998, 782.
LAG Hamm 15.01.1999, 10 Sa 1235/98, NZA 1999, 1221.
LAG Köln 26.02.1999, 11 Sa 1216/98, NZA-RR 2000, 25.
LAG Hamm 20.01.2000, 8 Sa 1420/99, NZA-RR 2000, 239.
LAG Hessen 13.03.2001, 2/9 Sa 1288/00, NZA-RR 2002, 21.
LAG Hamm 04.09.2001, 11 Sa 1918/00, EzBAT § 53 BAT Krankheit Nr. 38.
LAG Nürnberg 21.01.2003, 6(5) Sa 628/01, NZA-RR 2003, 413.
ID 10617
LAG Rheinland-Pfalz 30.08.2004, 7 Sa 447/04, NZA-RR 2005, 368.
Arbeitsgerichte:
ArbG Berlin 16.06.1987, 24 Ca 319/86, NZA 1987, 637.
Bundessozialgericht:
BSG 16.03.1972, 10 RV 594/70, SozR SGG § 149 Nr. 17.
BSG 13.02.1975, 3 RK 68/73, NJW 1975, 2267.
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abbildung 1:
Krankenstand 1980 bis 2004... 14
(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Gesetzliche Krankenversicherung,
Internetveröffentlichung, S. 7.)
Abbildung 2: Entwicklung der Arbeitsunfähigkeitstage nach Krankheitsarten... 15
(Quelle: Vetter/Küsgens/Dold, in: Badura/Schellschmidt/Vetter (Hrsg.), S. 296.)
Abbildung 3: Arbeitsunfähigkeitstage und -fälle nach der Dauer, Deutschland 2002... 17
(Quelle: Vetter/Küsgens/Dold, in: Badura/Schellschmidt/Vetter (Hrsg.), S. 274.)
1
1. Einleitung
Der praktisch bedeutsamste Fall der personenbedingten Kündigung ist die
Kündigung wegen Krankheit.
1
Zwar kann die Krankheit alleine eine Kündi-
gung niemals rechtfertigen, jedoch ist sie auch kein Kündigungshindernis. Für
den Arbeitnehmer treten neben der Belastung der Erkrankung noch die Gefahr
des Verlustes der beruflichen Existenz auf, denn es kann auch während der
bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine Kündigung wegen Krankheit ausgespro-
chen werden.
Die Rechtsprechung unterscheidet vier Fallgruppen der krankheitsbeding-
ten Kündigung, deren Besonderheiten in der vorliegenden Arbeit anhand eini-
ger Praxisfälle beleuchtet werden. Alle Fallgruppen der Kündigung wegen
Krankheit werden auf ihre soziale Rechtfertigung hin mittels eines dreistufi-
gen Schemas geprüft. Dieses Prüfungsschema ist für alle krankheitsbedingten
Kündigungsgründe in gleicher Weise anzuwenden, jedoch werden im Verlauf
dieser Arbeit einige Unterschiede, die bei den einzelnen Krankheitsarten auf-
treten, verdeutlicht.
Die krankheitsbedingte Kündigung erfasst alle Fallgestaltungen, bei denen die
Krankheit und die daraus folgende Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers den
Arbeitgeber zum Ausspruch einer Kündigung veranlassen. Die rechtlichen
Probleme, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind vielfach nicht ge-
setzlich geregelt, sondern werden im Wesentlichen der Rechtsprechung über-
lassen.
2
Daher soll der Schwerpunkt dieser Arbeit auf die Darstellung der zahl-
reichen gerichtlichen Entscheidungen gelegt werden. Auch wenn die Recht-
sprechung in den letzten Jahren einige Grundsätze herausgearbeitet hat, so wird
deutlich, dass trotzdem manches widersprüchlich erscheint. Die Rechtspre-
chung hat sich bei den Beurteilungsmaßstäben, die eine krankheitsbedingte
Kündigung begründen, nicht festgelegt. Es gibt keinen Katalog, der aufzeigt,
wie die einzelnen Aspekte, die bei dieser Kündigung berücksichtigt werden, zu
bewerten sind. Es wird immer wieder betont, dass jede Wertung der einzelnen
1
KR/Etzel, § 1 KSchG Rn. 319.
2
Hummel, S. 5.
2
Gesichtspunkte, die im Rahmen der krankheitsbedingten Kündigung geprüft
werden müssen, einzelfallabhängig ist und festgelegte Grenzwerte, die eine
Kündigung rechtfertigen, nicht existieren. Für den Einzelfall lässt sich nur
sehr schwer der Ausgang der Kündigung voraussagen, da von vornherein
nicht feststeht, welchem der verschiedenen Abwägungspunkte das angerufene
Gericht letzten Endes das entscheidende Gewicht beimisst.
Diese Unsicherheit stößt in der Literatur immer wieder auf Kritik. Bereits
Schwerdtner
3
führte aus: ,,Die Rechtsprognose (...) ist auf Null reduziert, der
Kündigungsvorgang zum Lotteriespiel geworden. Gerichtliche Erkenntnisse
werden eher zum Gottesurteil als zur rational nachvollziehbaren Entschei-
dung." Bengelsdorf
4
bezeichnet zudem das Kündigungsrecht als nicht mehr
berechenbar, also als ,,Zufall oder Schicksal". Für Kasper
5
ist die Rechtspre-
chung in diesem Bereich eine ,,Art von delphischem Orakel". Ziel dieser Arbeit
ist es, diese Unsicherheiten und die sich daraus ergebenden arbeitsrechtlichen
Probleme zu verdeutlichen.
In der vorliegenden Arbeit werden zu Beginn einige grundlegende Aspekte der
Kündigung erläutert. Anfangs wird auf den allgemeinen Begriff der Kündi-
gung eingegangen und es wird darlegt, welche Kündigungsarten existieren.
Da die Höhe der Entgeltfortzahlung im Rahmen der zu prüfenden wirtschaftli-
chen Belastung, die die krankheitsbedingte Fehlzeit des Arbeitnehmers verur-
sacht, von erheblicher Bedeutung ist, wird darauf folgend ein kurzer Über-
blick über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gegeben. Ferner wird,
auch anhand einiger Grafiken, verdeutlicht, welche wirtschaftlichen Auswir-
kungen die krankheitsbedingten Fehlzeiten auf die deutsche Wirtschaft
haben.
Im weiteren Verlauf wird auf das Kündigungsschutzgesetz eingegangen.
Hierbei soll verdeutlicht werden, was unter einer personenbedingten Kündi-
gung zu verstehen ist und wo dieser Kündigungsgrund einzuordnen ist. In die-
sem Rahmen werden der Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes
3
Schwerdtner, DB 1990, 375, 377.
4
Bengelsdorf, NZA-RR 2002, 57, 70.
5
Kasper, NJW 1994, 2979, 2980.
3
sowie die soziale Rechtfertigung, die in diesem Zusammenhang gegeben sein
muss, erläutert. Nach dem Kündigungsschutzgesetz ist eine Kündigung nur
dann gerechtfertigt, wenn diese entweder personen- oder verhaltensbedingt ist
oder durch betriebliche Bedingungen unumgänglich ist. Die krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit stellt, da sie nicht vom Arbeitnehmer selbständig veränder-
bar ist, einen personenbedingten Kündigungsgrund dar.
Aufgrund der Tatsache, dass lediglich die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitneh-
mers arbeitsrechtlich von Bedeutung ist und nicht die Krankheit als solche,
wird im folgenden Kapitel der Unterschied zwischen dem medizinischen
Krankheitsbegriff und der Arbeitsunfähigkeit verdeutlicht.
Im Hauptteil der Arbeit werden die vier von der Rechtsprechung unter-
schiedenen Fallgruppen der Krankheitsarten, die jeweils einen Kündi-
gungsgrund darstellen können, aufgezeigt. Bei jeder dieser Krankheitsarten
wird das dreistufige Prüfungsschema angewandt und die einzelnen Besonder-
heiten sowie die Unsicherheiten in der Rechtsprechung werden beleuchtet.
Des Weiteren werden einige Einzelfälle kündigungsrechtlich problemati-
scher Krankheitslagen dargestellt. Hierzu gehören die Kündigung des Arbeit-
nehmers aufgrund einer Alkoholabhängigkeit oder einer HIV-Infektion sowie
die krankheitsbedingte Kündigung, die aufgrund eines Arbeitsunfalls oder ei-
ner Berufskrankheit entstanden ist.
Das Fazit aus den gewonnenen Erkenntnissen wird dann im letzten Kapitel
zusammenfassend dargestellt und abschließend bewertet.
1.1. Begriff der Kündigung
Zunächst ist es für das Verständnis dieser Arbeit von Bedeutung, einige grund-
legende Begriffe, die im Zusammenhang mit der Kündigung stehen, zu erläu-
tern.
4
Die Kündigung wird definiert als eine einseitige empfangsbedürftige Wil-
lenserklärung, die das Arbeitsverhältnis nach dem Willen des Kündigenden
für die Zukunft sofort oder nach Ablauf einer Kündigungsfrist unmittelbar be-
endet.
6
Eine Kündigung ist nur dann wirksam, wenn sie der gesetzlich vorgegebenen
Schriftform entspricht (§ 623 BGB). Das Schriftformerfordernis gilt seit dem
01.05.2000 und kann weder durch einen Arbeitsvertrag oder durch eine Be-
triebsvereinbarung noch durch einen Tarifvertrag abgeändert werden. Das
Kündigungsschreiben muss vom Aussteller eigenhändig durch Namensunter-
schrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden
(§ 126 Abs. 1 BGB). Dabei ist die elektronische Form ausgeschlossen, d.h.
eine Kündigung per Telefax oder E-Mail ist nicht zulässig. Die Nichteinhal-
tung der Schriftform führt gemäß § 125 S. 1 BGB zur Nichtigkeit der Kündi-
gung.
Die Kündigungserklärung ist grundsätzlich bedingungsfeindlich. Demnach
kann die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht von einem unsicheren Er-
eignis abhängig gemacht werden. Wenn die Kündigung also unter einer auflö-
senden Bedingung ausgesprochen wird, ist sie unwirksam.
7
Die einseitige Rücknahme einer zugegangenen Kündigung ist nicht möglich.
Die Kündigungserklärung ist nur dann nicht wirksam, wenn zeitgleich oder vor
dem Zugang der Kündigung ein Widerruf zugeht (§ 130 Abs. 1 S. 2 BGB).
Nachdem eine Kündigung wirksam geworden ist, kann sie nur noch durch eine
Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien wieder aufgehoben werden.
8
Die Kündigungserklärung muss nach dem Empfängerhorizont deutlich und
zweifelsfrei ausgedrückt werden, wodurch der Gekündigte Klarheit über die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses erhält. Dafür muss allerdings das Wort
,,Kündigung" in der Kündigungserklärung nicht unbedingt vorkommen.
9
6
Preis, Arbeitsrecht, § 56 II.
7
BAG BB 2001, 1960; Boemke, § 13 Rn. 3.
8
Preis, Arbeitsrecht, § 56 II.
9
BAG NZA 1992, 452, 453; BB 2001, 1960; Lipperheide, S. 132; Stahlhacke/Preis, Rn. 159.
5
Die Wirksamkeit einer Kündigung ist grundsätzlich unabhängig von der An-
gabe eines Kündigungsgrundes. Eine Begründung der Kündigung muss nur
dann gegeben werden, wenn dies entweder gesetzlich, durch Tarifvertrag, Be-
triebsvereinbarung oder durch den Arbeitsvertrag vorgeschrieben wird.
10
Im
Falle einer außerordentlichen Kündigung müssen dem Arbeitnehmer jedoch
auf sein Verlangen hin unverzüglich die Kündigungsgründe schriftlich mitge-
teilt werden (§ 626 Abs. 2 S. 3 BGB). Die Gründe sind dann so zu benennen,
dass der Kündigungsempfänger deutlich erkennen kann, was ihm zur Last ge-
legt wird.
11
Die Kündigungserklärung kann sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeit-
nehmer ausgesprochen werden.
12
Allerdings ist trotz des höchstpersönlichen
Charakters der Kündigung eine Vertretung möglich, d.h. dass sich die Ver-
tragsparteien sowohl bei der Abgabe als auch beim Empfang einer Kündigung
vertreten lassen können (§ 164 Abs. 1, 3 BGB). Die Vollmachtserteilung be-
darf keiner bestimmten Form (§ 167 Abs. 2 BGB). Sie kann durch Erklärung
sowohl gegenüber dem Kündigungsempfänger als auch gegenüber dem Vertre-
ter abgegeben werden. Auch wenn die Erteilung einer Vollmacht ohne Form
gültig ist, so ist die Vollmachtsurkunde dennoch von außerordentlicher Be-
deutung. Die Kündigung ist nämlich nach § 174 S. 1 BGB unwirksam, wenn
ein bevollmächtigter Arbeitgebervertreter die Vollmachtsurkunde bei der Kün-
digung nicht vorlegt und der Kündigungsempfänger aus diesem Grunde die
Kündigung unverzüglich zurückweist. Der Arbeitnehmer hat jedoch kein Zu-
rückweisungsrecht, wenn der Arbeitgeber ihn zuvor von der Bevollmächtigung
in Kenntnis gesetzt hat (§ 174 S. 2 BGB).
Die Kündigungserklärung unter Abwesenden wird ebenso wie die Kündi-
gungserklärung unter Anwesenden gemäß § 130 Abs. 1 S. 1 BGB erst mit Zu-
gang beim Erklärungsempfänger wirksam. Unter Abwesenden gilt die Kündi-
gungserklärung daher als zugegangen, wenn der Gekündigte in verkehrsübli-
cher Weise die tatsächliche Verfügungsgewalt über das Kündigungsschreiben
10
Memento, Rn. 5523.
11
BAG AP BMT-G II § 54 Nr. 1; Memento spezial, Rn. 103.
12
Kossens/Kreizberg/Lenzing/Meyerhoff/Sigmonzik, S. 678.
6
erlangt und er unter gewöhnlichen Umständen die Möglichkeit hat, vom In-
halt des Schreibens Kenntnis zu nehmen. Wenn für den Kündigungsempfänger
diese Möglichkeit unter gewöhnlichen Umständen besteht, ist es nicht von Be-
deutung, wann er die Erklärung tatsächlich zur Kenntnis genommen hat oder
ob er durch andere Umstände (zeitweilige Ortsabwesenheit) daran gehindert
war.
13
Erreicht die Kündigungserklärung die Empfangseinrichtung des Kündi-
gungsempfängers (Hausbriefkasten, Postfach), so geht sie zu dem Zeitpunkt zu,
in dem mit der Leerung gerechnet werden kann.
14
Auch wenn dem Arbeitgeber
bekannt ist, dass der Arbeitnehmer urlaubsbedingt verreist ist, geht sein an die
Heimatanschrift gerichtetes Kündigungsschreiben wirksam zu.
15
1.2. Kündigungsarten
Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen der ordentlichen und der außer-
ordentlichen Kündigung. Die ordentliche Kündigung stellt die bedeutsamste
Form der Kündigung dar. Sie kann jedoch aufgrund eines Gesetzes oder einer
vertraglichen Regelung ausgeschlossen sein.
16
Der Ausspruch einer ordentlichen Kündigung bedarf grundsätzlich keines
Grundes. Die Angabe eines Kündigungsgrundes ist nur erforderlich, wenn der
Arbeitnehmer allgemeinen Kündigungsschutz genießt.
17
Die ordentliche Kündigung setzt jedoch die Einhaltung einer gesetzlichen
Kündigungsfrist voraus, welche dem Kündigungsempfänger ermöglichen soll,
sich auf die Beendigung des Arbeitsvertrages einzustellen.
18
Die Kündigungs-
frist bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Zugang der Kündigungserklärung
und dem Endtermin des Dauerschuldverhältnisses.
19
Nach § 622 Abs. 1 BGB
beträgt die Grundkündigungsfrist 4 Wochen und gilt für den Arbeitnehmer
und den Arbeitgeber gleichermaßen. Es kann entweder zum 15. oder zum Ende
13
BAG NZA 1989, 635, 636.
14
BAG NZA 1984, 31.
15
BAG NZA 1989, 635; AP BGB § 130 Nr. 16.
16
Memento, Rn. 5590.
17
Boemke, § 13 Rn. 62.
18
Krause, § 12 Rn. 7.
19
Memento, Rn. 5592.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836606172
- DOI
- 10.3239/9783836606172
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Oktober)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- personalwesen kündigung arbeitsunfähigkeit alkoholabhängigkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de