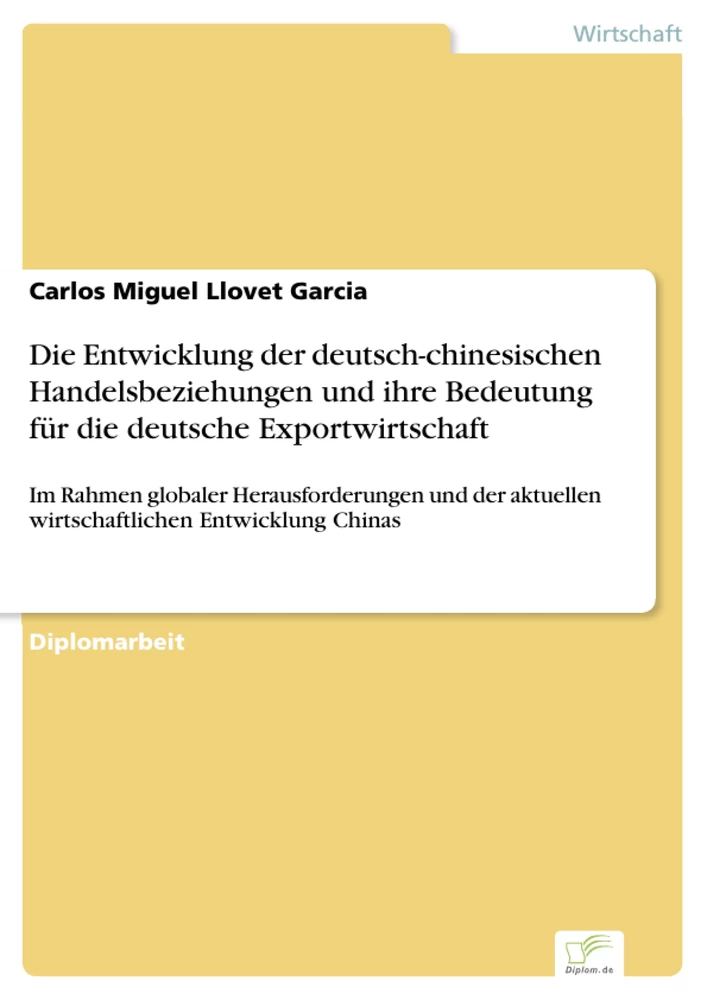Die Entwicklung der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen und ihre Bedeutung für die deutsche Exportwirtschaft
Im Rahmen globaler Herausforderungen und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas
©2007
Diplomarbeit
137 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen stehen im Zentrum dieser Arbeit. Nach einer Darstellung der Entwicklung der Handelsbeziehungen, wird detailliert auf den Warenstrom zwischen Deutschland und China seit 2001 eingegangen. Anschließend wird das Ergebnis der Analyse im Kontext des gesamten deutschen Außenhandels betrachtet. Damit soll beantwortet werden, welchen Einfluss der deutsch-chinesische Handel auf die deutsche Exportwirtschaft hat. Die Frage ist deshalb interessant, weil die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung Chinas einen wichtigen Einfluss für die deutsche Exportwirtschaft vermuten lässt.
Die Basis für die Betrachtung der Handelsbeziehungen bildet der erste Teil der Arbeit. Im ersten von zwei Abschnitten, wird mit der knappen Darstellung einiger wichtiger Aspekte des chinesischen Transformationsprozesses begonnen. Anschließend wird die aktuelle Lage der chinesischen Volkswirtschaft erläutert. Die Gegenüberstellung von Historie und Gegenwart verdeutlicht das enorme Ausmaß der Veränderungen, die China innerhalb der letzten Jahrzehnte erfahren hat. Im nächsten Kapitel wird die Einordnung Chinas in den aktuellen weltwirtschaftlichen Zusammenhang vorgenommen. Die chinesischen Wirtschaftsbeziehungen werden an einer Auswahl wichtiger globaler Regionen veranschaulicht. Die USA, Europa und Afrika spielen jeweils unterschiedliche, aber zentrale Rollen in Chinas Außenwirtschaftspolitik. Die Welthandelsorganisation ist ein übernationaler Akteur internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Ihre Bedeutung für den weltweiten Handel und insbesondere China, ist derart zentral, dass eine nähere Erläuterung nicht fehlen darf.
Der zweite Abschnitt des ersten Teils befasst sich mit Deutschland. Die Ausführungen zu Deutschland fallen kürzer aus, als zu China, weil auf eine historische Darstellung verzichtet wird. Analog zum ersten Abschnitt wird aber eine kurze Lagebetrachtung der deutschen Volkswirtschaft vorgenommen. Dazu schien es angebracht, eine kritische Beurteilung der deutschen Exportorientierung, als bedeutendes Merkmal der deutschen Volkswirtschaft, anzufügen. Damit schließt der Eingangsrahmen der Arbeit ab.
Danach folgt der Hauptteil (Teil Zwei). Darin wird die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China und die Bedeutung für Deutschland behandelt.
Der dritte Teil bildet den Ausgangsrahmen für die Arbeit. Er ist einerseits die Fortführung des Hauptteils, weil die Ergebnisse für eine weitere […]
Die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen stehen im Zentrum dieser Arbeit. Nach einer Darstellung der Entwicklung der Handelsbeziehungen, wird detailliert auf den Warenstrom zwischen Deutschland und China seit 2001 eingegangen. Anschließend wird das Ergebnis der Analyse im Kontext des gesamten deutschen Außenhandels betrachtet. Damit soll beantwortet werden, welchen Einfluss der deutsch-chinesische Handel auf die deutsche Exportwirtschaft hat. Die Frage ist deshalb interessant, weil die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung Chinas einen wichtigen Einfluss für die deutsche Exportwirtschaft vermuten lässt.
Die Basis für die Betrachtung der Handelsbeziehungen bildet der erste Teil der Arbeit. Im ersten von zwei Abschnitten, wird mit der knappen Darstellung einiger wichtiger Aspekte des chinesischen Transformationsprozesses begonnen. Anschließend wird die aktuelle Lage der chinesischen Volkswirtschaft erläutert. Die Gegenüberstellung von Historie und Gegenwart verdeutlicht das enorme Ausmaß der Veränderungen, die China innerhalb der letzten Jahrzehnte erfahren hat. Im nächsten Kapitel wird die Einordnung Chinas in den aktuellen weltwirtschaftlichen Zusammenhang vorgenommen. Die chinesischen Wirtschaftsbeziehungen werden an einer Auswahl wichtiger globaler Regionen veranschaulicht. Die USA, Europa und Afrika spielen jeweils unterschiedliche, aber zentrale Rollen in Chinas Außenwirtschaftspolitik. Die Welthandelsorganisation ist ein übernationaler Akteur internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Ihre Bedeutung für den weltweiten Handel und insbesondere China, ist derart zentral, dass eine nähere Erläuterung nicht fehlen darf.
Der zweite Abschnitt des ersten Teils befasst sich mit Deutschland. Die Ausführungen zu Deutschland fallen kürzer aus, als zu China, weil auf eine historische Darstellung verzichtet wird. Analog zum ersten Abschnitt wird aber eine kurze Lagebetrachtung der deutschen Volkswirtschaft vorgenommen. Dazu schien es angebracht, eine kritische Beurteilung der deutschen Exportorientierung, als bedeutendes Merkmal der deutschen Volkswirtschaft, anzufügen. Damit schließt der Eingangsrahmen der Arbeit ab.
Danach folgt der Hauptteil (Teil Zwei). Darin wird die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China und die Bedeutung für Deutschland behandelt.
Der dritte Teil bildet den Ausgangsrahmen für die Arbeit. Er ist einerseits die Fortführung des Hauptteils, weil die Ergebnisse für eine weitere […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Carlos Miguel Llovet Garcia
Die Entwicklung der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen und ihre Bedeutung für
die deutsche Exportwirtschaft
Im Rahmen globaler Herausforderungen und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung
Chinas
ISBN: 978-3-8366-0603-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. BiTS Business and Information Technology School, Iserlohn, Deutschland,
Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis... IV
Tabellenverzeichnis ... V
Abkürzungsverzeichnis... VIII
1
Einleitung... 1
2
Internationaler Handel Deutschlands und Chinas ... 4
2.1
Zur chinesischen Volkswirtschaft ... 4
2.1.1
Die Transformation der Wirtschaft ... 4
2.1.1.1
Kurze Darstellung der Entwicklungen von 1949 bis 1976 ... 4
2.1.1.2
Der Transformationsprozess durch Deng Xiaoping ... 4
2.1.1.2.1
Transformation der ländlichen Region und die Auswirkung
auf die Städte... 5
2.1.1.2.2
Reform der Staatsunternehmen... 7
2.1.1.2.3
Preisreform ... 7
2.1.2
Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung Chinas ... 9
2.1.3
Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen Chinas... 12
2.1.3.1
China und die USA ... 12
2.1.3.2
China und Europa ... 16
2.1.3.3
China und Afrika ... 23
2.1.4
China und die WTO ... 27
2.1.4.1
Die WTO als Institution ... 27
2.1.4.2
Chinas Weg zur WTO-Mitgliedschaft ... 29
2.1.4.3
Chinas Vorteil durch den Beitritt zu WTO... 32
II
2.2
Zur deutschen Volkswirtschaft ... 33
2.2.1
Die aktuelle Entwicklung der deutschen Wirtschaft ... 33
2.2.2
Export als Motor deutschen Wirtschaftswachstums... 35
3
Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China... 39
3.1
Die Entwicklung der Handelsbeziehungen... 39
3.1.1
Kurzer historischer Überblick... 39
3.1.2
Handel von 1978 bis 2000 ... 40
3.1.3
Deutschlands Wirtschaftspolitik zu China ... 46
3.2
Aktuelle Entwicklung des deutsch-chinesischen Warenhandels ... 47
3.2.1
Gesamtbetrachtung seit 2001... 47
3.2.2
Detailbetrachtung seit 2001 ... 49
3.3
Die Bedeutung des deutsch-chinesischen Handels für die deutsche
Exportwirtschaft... 52
4
2007: China im Wandel ... 57
4.1
China als Chance für deutsche Unternehmen... 57
4.1.1
Der Markt... 57
4.1.2
Einfluss ausländischer Direktinvestitionen auf den deutsch-
chinesischen Handel ... 61
4.2
Schwierigkeiten für ausländische Unternehmen ... 63
4.2.1
Schutz geistigen Eigentums ... 63
4.2.2
Technologie- und Wissenstransfer ... 65
4.2.2.1
Deutsche Hochtechnologie in China ... 67
4.2.2.2
Biotechnologie ... 70
4.3
Zwei Probleme Chinas ... 71
4.3.1
Umwelt... 71
III
4.3.2
Wirtschaftswachstum durch Konsum... 74
5
Eine gemeinsame Zukunft... 77
Literaturverzeichnis ... 82
Anhang... 96
Tabellen:... 96
CD-ROM: (nur in Prüfungsexemplar) ... 125
IV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Preisanstieg und Wirtschaftswachstum in China (1978-2006)... 10
Abb. 2: Warenhandel der EU-25 mit der Welt (1999-2005)... 20
Abb. 3: Warenhandel zwischen Europa und China (1999-2005)... 21
Abb. 4: Täglicher Ölverbrauch Chinas in Mio. Barrel ... 25
Abb. 5: Deutscher Warenhandel mit China (1971-2006)... 40
Abb. 6: Anteil Chinas an deutschen Ein- und Ausfuhren (1971-2006) ... 42
Abb. 7: Entwicklung der deutschen Ein- und Ausfuhren aus bzw. nach China
(2000-2006) ... 48
Abb. 8: Herkunft deutscher Einfuhren in Prozent der Gesamteinfuhren... 54
Abb. 9: Ziele deutscher Ausfuhren in Prozent der Gesamtausfuhren ... 55
Abb. 10: Anteil der Im- und Exporte ausländischer Unternehmen... 62
Anmerkungen zu den Abbildungen:
- Alle Abbildungen sind dem Anhang auf CD-ROM beigefügt.
- Alle Abbildungen sind eigene Darstellungen.
V
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Prognosen für Chinas Importnachfrage nach Rohstoffen bis 2020... 24
Tab. 2: Durchschnittliche Zollsätze Chinas ... 31
Tab. 3: Deutsche Einfuhren aus China bei Elektronik (2001 und 2006)... 49
Tab. 4: Deutsche Ausfuhren nach China bei Maschinen (2001-2006) ... 51
Tab. 5: Preisanstieg und Wirtschaftswachstum in China (1978-2006) ... 96
Tab. 6: EU-25 Gesamthandel... 97
Tab. 7: Warenhandel der EU-25 mit der Welt, den USA und der Schweiz von
1999 bis 2005 ... 98
Tab. 8: Warenhandel der EU-25 mit Russland, China und Japan von 1999-2005
... 99
Tab.9: Täglicher Öl-Verbrauch Chinas (1994-2004) ... 100
Tab. 10: Anteil Chinas an deutschen Ein- und Ausfuhren (1971-2006) ... 101
Tab. 11: Entwicklung der deutschen Ein- und Ausfuhren aus bzw. nach China
(1999-2006) ... 102
Tab. 12: Deutscher Handel mit China nach Warenklassen im Jahre 2001 ... 103
Tab. 13: Deutscher Handel mit China nach Warenklassen im Jahre 2002 ... 103
Tab. 14: Deutscher Handel mit China nach Warenklassen im Jahre 2003 ... 103
Tab. 15: Deutscher Handel mit China nach Warenklassen im Jahre 2004 ... 104
Tab. 16: Deutscher Handel mit China nach Warenklassen im Jahre 2005 ... 104
Tab. 17: Deutscher Handel mit China nach Warenklassen im Jahre 2006 ... 104
Tab. 18: Deutscher Handel mit China nach bestimmten Warenklassen im Jahre
2001... 106
Tab. 19: Deutscher Handel mit China nach bestimmten Warenklassen im Jahre
2002... 107
VI
Tab. 20: Deutscher Handel mit China nach bestimmten Warenklassen im Jahre
2003... 108
Tab. 21: Deutscher Handel mit China nach bestimmten Warenklassen im Jahre
2004... 109
Tab. 22: Deutscher Handel mit China nach bestimmten Warenklassen im Jahre
2005... 110
Tab. 23: Deutscher Handel mit China nach bestimmten Warenklassen im Jahre
2006... 111
Tab. 24: Wichtigste deutsche Importe aus China nach Warenklassen ... 112
Tab. 25: Deutsche Ausfuhren nach China in den wichtigsten Warenklassen der
Importe ... 113
Tab. 26: Wichtigste deutsche Exporte nach China in Warenklassen ... 114
Tab. 27: Deutsche Einfuhren aus China in den wichtigsten Warenklassen der
Exporte ... 115
Tab. 28: Einfuhren Deutschlands aus der EU-25 und EU ... 117
Tab. 29: Einfuhren Deutschlands aus der EWU und Asien... 117
Tab. 30: Einfuhren Deutschlands aus den USA und der Schweiz... 118
Tab. 31: Einfuhren Deutschlands aus China und Russland ... 118
Tab. 32: Ausfuhren Deutschlands in die EU-25 und EU ... 119
Tab. 33: Ausfuhren Deutschlands in die EWU und Asien ... 119
Tab. 34: Ausfuhren Deutschlands in die USA und die Schweiz ... 120
Tab. 35: Ausfuhren Deutschlands nach China und Russland ... 120
Tab. 36: Importe aus der EU von ausländischen Unternehmen in China... 121
Tab. 37: Exporte in die EU von ausländischen Unternehmen in China... 121
Tab. 38: Deutschlands Aus- und Einfuhren (1971-2006) ... 123
VII
Anmerkungen zu den Tabellen:
- Die Tabellen sind in komprimierter Form dem Anhang auf CD-Rom bei-
gefügt.
- Alle Tabellen sind eigene Darstellungen.
VIII
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
ASEM
Asia-Europe
Meeting
AU
ausländische
Unternehmen
AVIC
Aviation Industry Corporation
Bio.
Billionen
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BMBF
Bundesministerium
für Bildung und Forschung
BMWi
Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie
BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CAS
Chinese Academy of Sciences
d.h.
das
heißt
Destatis
Statistisches
Bundesamt
ECAN
EU-China Academic Network
EG
Europäische
Gemeinschaft
EGV
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EU
Europäische
Union
EU-15
Die 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
EU-25
Die 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
Eurostat
Statistisches
Amt
der Europäischen Gemeinschaften
IX
EWU
Europäische
Währungsunion
f
und folgende Seite
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FDI
Foreign Direct Investment
ff
und folgende Seiten
FOCAC
Forum On China-African Cooperation
GATS
General
Agreement on Trade in Services
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
GSP
Generalised
System of Preferences
GTZ
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
GmbH
Hg.
Herausgeber
ITO
International Trade Organisation
IWF
Internationaler
Währungsfonds
JV
Joint-Venture
k.A.
keine
Angaben
KPCh
Kommunistische Partei Chinas
MC
Ministerial
Conference
Mio.
Millionen
MOFCOM
Ministry of Commerc of the People´s Republic of China
Mrd.
Milliarden
NAFTA
North American Free Trade Agreement
Nr.
Nummer
RMB
Renminbi
S.
Seite
X
Tab.
Tabelle
TNC
Trade Negotiations Committee
TRIPS
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights
TVE
Township and Village Enterprise
u.a.
unter
anderem
UN
United
Nations
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
usw.
und so weiter
VDW
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken
vorl.
Vorläufig
VW
Volkswagen
WTO
World Trade Organisation
z.B.
zum
Beispiel
1 Einleitung
,,Das Überraschendste aber ist: von hier oben aus sieht man keine Grenzen",
schwärmte vor dreißig Jahren einer der ersten Astronauten im Weltall mit Blick
auf die aufgehende Erde.
Keine Grenzen mehr. Globalisierung: das ist im Grunde nichts anderes eine
Welt ohne Grenzen.
Künstliche Grenzen aufzuheben zumindest aber sie durchlässiger zu machen,
das ist das eigentliche Ziel der Globalisierung von heute. Noch nie in der Ge-
schichte der Menschheit wurde ein derart intensiver Austausch von Waren und
Werten zwischen den Nationen der Erde erreicht wie heute. Elektronik, Compu-
tertechnologie, das Internet haben dazu beigetragen, dass Geld, Güter, Ideen
und Informationen fast zeitgleich an verschiedenen Orten der Erde zugänglich
sind. Politische und wirtschaftliche Entscheidungen haben sich erheblich be-
schleunigt, ihre Konsequenzen laufen fast lichtschnell von Kontinent zu Konti-
nent. Raum und Zeit verlieren an Bedeutung und gewinnen eine neue. Ein
Grund ist die Vernetzung der Welt, der andere die zunehmende Liberalisierung
des internationalen Handels die Globalisierung.
Die großen Chancen der Globalisierung wecken aber auch Ängste. Möglicher-
weise sind es die Ängste von alten und satten Nationen vor neuen oder ebenso
alten, aber hungrigen Nationen.
Deutschland hat, neben anderen westlichen Staaten, erhebliche Schwierigkei-
ten, sich diesem Globalisierungstrend anzupassen. Die Schwerfälligkeit der Po-
litik und der scheinbar fehlende Wille zur Durchführung fundamentaler Refor-
men, haben die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland belastet.
Deutschland leidet konstant unter einer hohen Arbeitslosigkeit, die nicht kon-
junktureller, sondern struktureller Natur ist. Die Auswirkung auf die Finanzlage
des Staates ist fatal; die Zukunft des Sozialstaates steht auf dem Spiel.
2
Angesichts dieser Schwierigkeiten erscheinen dem Westen die fantastischen
Entwicklungen in Asien, und speziell in China, wie eine Bedrohung für die eige-
ne Position auf den Weltmärkten. China befindet sich seit fast 30 Jahren in ei-
ner Wachstumsdynamik von der westliche Nationen nur träumen können. Chi-
nas Wohlstand erhöht sich stetig. Im Westen steigt die Arbeitslosigkeit und da-
mit die Armut. Die Vorbehalte gegen China vergrößern sich. Dem Land wird die
Verantwortung für die heimischen Probleme zugeschrieben.
Die Zusammenhänge sind aber mitnichten so simpel, um China pauschal dafür
verantwortlich zu machen. Diese Diplomarbeit befasst sich mit einem kleinen
Ausschnitt dieses komplexen Gefüges. Die Analyse einiger Teilaspekte der
deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen, soll ein Anstoß zu einer differen-
zierteren Betrachtung des wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen Deutschland
und China sein.
Die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen stehen im Zentrum dieser Ar-
beit. Nach einer Darstellung der Entwicklung der Handelsbeziehungen, wird
detailliert auf den Warenstrom zwischen Deutschland und China seit 2001 ein-
gegangen. Anschließend wird das Ergebnis der Analyse im Kontext des gesam-
ten deutschen Außenhandels betrachtet. Damit soll beantwortet werden, wel-
chen Einfluss der deutsch-chinesische Handel auf die deutsche Exportwirt-
schaft hat. Die Frage ist deshalb interessant, weil die zunehmende wirtschaftli-
che Bedeutung Chinas einen wichtigen Einfluss für die deutsche Exportwirt-
schaft vermuten lässt.
Die Basis für die Betrachtung der Handelsbeziehungen bildet der erste Teil der
Arbeit. Im ersten von zwei Abschnitten, wird mit der knappen Darstellung eini-
ger wichtiger Aspekte des chinesischen Transformationsprozesses begonnen.
Anschließend wird die aktuelle Lage der chinesischen Volkswirtschaft erläutert.
Die Gegenüberstellung von Historie und Gegenwart verdeutlicht das enorme
Ausmaß der Veränderungen, die China innerhalb der letzten Jahrzehnte erfah-
ren hat. Im nächsten Kapitel wird die Einordnung Chinas in den aktuellen welt-
wirtschaftlichen Zusammenhang vorgenommen. Die chinesischen Wirtschafts-
3
beziehungen werden an einer Auswahl wichtiger globaler Regionen veran-
schaulicht. Die USA, Europa und Afrika spielen jeweils unterschiedliche, aber
zentrale Rollen in Chinas Außenwirtschaftspolitik. Die Welthandelsorganisation
ist ein übernationaler Akteur internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Ihre Be-
deutung für den weltweiten Handel und insbesondere China, ist derart zentral,
dass eine nähere Erläuterung nicht fehlen darf.
Der zweite Abschnitt des ersten Teils befasst sich mit Deutschland. Die Ausfüh-
rungen zu Deutschland fallen kürzer aus, als zu China, weil auf eine historische
Darstellung verzichtet wird.
1
Analog zum ersten Abschnitt wird aber eine kurze
Lagebetrachtung der deutschen Volkswirtschaft vorgenommen. Dazu schien es
angebracht, eine kritische Beurteilung der deutschen Exportorientierung, als
bedeutendes Merkmal der deutschen Volkswirtschaft, anzufügen. Damit
schließt der Eingangsrahmen der Arbeit ab.
Danach folgt der Hauptteil (Teil Zwei). Darin wird die Entwicklung der Handels-
beziehungen zwischen Deutschland und China und die Bedeutung für Deutsch-
land behandelt.
Der dritte Teil bildet den Ausgangsrahmen für die Arbeit. Er ist einerseits die
Fortführung des Hauptteils, weil die Ergebnisse für eine weitere Betrachtung
verwendet werden. Andererseits knüpft er an den Eingangsrahmen an, weil er
den aktuellen Wandel in China weiterverfolgt. Der Blick ist auf einige Aspekte
der aktuellen und kontroversen Diskussion zu China gerichtet. Diese Darstel-
lung ist unbedingt notwenig, damit ein ausgewogenes Bild von China gezeich-
net werden kann.
Den Abschluss der Arbeit bildet ein Kommentar, der die Ergebnisse der vorhe-
rigen Ausführungen zusammenfasst und einen Ausblick formuliert.
1
Es kann davon ausgegangen werden, dass dem deutschen Leser die Zusammenhänge be-
kannt sind.
4
2 Internationaler Handel Deutschlands und
Chinas
2.1 Zur chinesischen Volkswirtschaft
2.1.1 Die Transformation der Wirtschaft
2.1.1.1 Kurze Darstellung der Entwicklungen von 1949 bis 1976
Am 1. Oktober 1949 wurde die Volksrepublik China gegründet. Mao Zedong
wurde Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Er ordnete die
Enteignung der Grundbesitzer an und reformierte nach dem Vorbild der Sowjet-
union die Landwirtschaft
2
. Mit dem ,,Großen Sprung nach Vorn" (1958) führte
Mao die Planwirtschaft ein. Aber schon 1962 zeigte sich, dass die Reformen
gescheitert waren. Weder Bauern noch Unternehmen waren in der Lage, die
von der Partei festgesetzten Planziele zu erreichen. Zwischen 1958 und 1962
verhungerten 25 Millionen Chinesen.
Dieser verheerende Misserfolg schadete Maos Ansehen und politischem Ein-
fluss. Dennoch blieb er Vorsitzender der KPCh. Die wirtschaftliche und soziale
Not in China wuchs. Schließlich entwarf Premierminister Zhou Enlai das Kon-
zept der ,,Vier Modernisierungen".
3
Durch gezielte Reformen in Landwirtschaft,
Industrie, Technologie und Rüstung sollte die Lage verbessert werden. Der
Versuch scheiterte 1966 mit der erneuten Machtübernahme durch Mao und
dem Beginn der ,,Kulturellen Revolution"
4
.
2.1.1.2 Der Transformationsprozess durch Deng Xiaoping
Deng Xiaoping wurde 1954 Generalsekretär der KPCh und stellvertretender
Ministerpräsident. Ideologische Differenzen mit Mao führten dazu, dass er 1965
2
1949-1952: Bodenreform in China nach dem Vorbild der Sowjetunion.
3
Das Konzept der ,,Vier Modernisierungen" wird später von Deng Xiaoping aufgegriffen.
4
Vgl. Chow, G. (2002), S. 26ff.
5
seine Ämter verlor. 1974 wurde Deng Xiaoping, zwei Jahre vor Maos Tod, Mi-
nisterpräsident. Nun war er in der Lage, seine Machtposition auszubauen. 1978
leitete er Wirtschaftsreformen ein, die eine grundlegende Veränderung der wirt-
schaftlichen Strukturen Chinas bedeuteten. Es folgte eine Phase hohen Wirt-
schaftswachstums und steigenden Lebensstandards.
Die von Dogmatismus und Kollektivismus geprägte Phase Maos (1949-1976)
unterschied sich fundamental von der Deng Xiaopings (1978-1997). Deng de-
kollektivierte und betrieb die wirtschaftlichen und politischen Reformen pragma-
tisch.
5
Der von Deng Xiaoping eingeleitete Transformationsprozess, ,,Weiße Katze,
Schwarze Katze"
6
, kann grob in drei Phasen unterteilt werden. In der ersten
Phase (1979-1984) wurden Reformen auf dem Land durchgeführt. In der zwei-
ten Phase, die von 1984 bis 1991 dauerte, wurden die Reformen auf die Städte
ausgeweitet. Seit 1992 wurden die Reformen fortgesetzt.
7
2.1.1.2.1 Transformation der ländlichen Region und die Auswirkung auf
die Städte
Die ersten Impulse zur Veränderung des chinesischen Wirtschaftssystems gin-
gen nicht von der Regierung aus, sondern kamen aus dem Dorf Xiaogan in der
Provinz Anhui, westlich von Shanghai. Nach einer katastrophalen Jahrhundert-
dürre, begannen die Bauern die landwirtschaftlichen Flächen untereinander
aufzuteilen (,,Großes Vertragssystem"). Obwohl es zu dieser Zeit nur Kollektiv-
güter gab, wurden die Bauern nun selbstverantwortliche Eigentümer der Flä-
chen. Diese Veränderung wurde fast zeitgleich in verschiedenen Provinzen
5
Vgl. Xiong Zhang (2003), S. 201.
6
Deng Xiaoping äußerte seinen Pragmatismus in vielen Metaphern. Die bekannteste ist wohl
die Katzen-Doktrin: ,,Egal, ob die Katze grau oder schwarz ist, Hauptsache sie fängt Mäuse".
Bei Xiong Zhang (2003), S. 201, wurden weitere Aussprüche zusammengestellt: ,,Practice is
the only criterion to test truth", ,,Being poor is not socialism", ,,Science and technology are pro-
ductive forces", ,,Only development is the hard principle", ,,Crossing the river by touching sto-
nes", ,,Let a part of the population get rich first".
7
Vgl. Yang Qixian (2001), S. 9f.
6
durchgeführt. Das Zentralkomitee untersagte diese Reform
8
. Es kam zu einer
Grundsatzdiskussion innerhalb der KPCh, die im Mai 1980 von Deng Xiaoping
beendet wurde. Er lobte öffentlich die Erfolge der Umformung des landwirt-
schaftlichen Systems und erklärte ideologische Bedenken für unbegründet. Bis
1983 war das Große Vertragssystem von 95 Prozent der Bauern eingeführt.
9
Die Regierung unterstützte die Entwicklung, erhöhte die staatlichen Ankaufs-
preise landwirtschaftlicher Produkte und verringerte das Produktionssoll. Da-
durch verbesserte sich zum einen das Einkommen der Bauern, zum anderen
wurde die Möglichkeit geschaffen, die Überschussproduktion auf einem unregu-
lierten Markt zu veräußern. Dies motivierte die Bauern dazu, die Produktion zu
erhöhen.
10
Es war die Geburtsstunde kleiner und mittlerer Privatunternehmen, der ,,Towns-
hip and Village Enterprises" (TVEs).
11
Diese bildeten sich zuerst auf dem Lan-
de. Später kam es vermehrt zu Gründungen innerhalb der urbanen Regionen,
so dass der Reformprozess auf die Städte ausgeweitet wurde. Die TVEs waren
so erfolgreich, dass diese markwirtschaftlich orientierten Reformen breite Un-
terstützung bei der Bevölkerung fanden und die fundamentalen Veränderungen
der chinesischen Wirtschaftsstruktur beschleunigten.
12
Generalsekretär Jiang
Zemin hielt beim 14. Kongress des Zentralkomitees am 12. Oktober 1992 eine
zentrale Rede, die den eingeschlagenen Reformkurs bestätigte und unterstütz-
te.
13
8
Die beim Zentralkomitee auf einem einfachen Blatt Papier eingereichte Petition, ist heute im
Museum der Revolution in Peking als Symbol für den Beginn der Reformen ausgestellt. Der
Text lautet übersetzt: ,,We divide the land to the households, and every household signs and
stamps on the pledge. If we are allowed to do so, each household pledges to fulfil the anual
quota of delivering tax grain to the State; if not, the cadres are willing to be decapitated. All the
commune members pledge to raise our children until they are 18 years old". Siehe dazu:
Hangtang Qi (2004).
9
Vgl. Hangtang Qi (2004), S. 78ff.
10
Vgl. Chow, G. (1994), S. 10.
11
Vgl. Hantang Qi (2004), S. 80f.
12
Vgl. Hantang Qi (2004); S. 82.
13
Die Rede von Jiang Zemin, vom 12. Oktober 1992, ist von großer Bedeutung für China. Sie
trägt den übersetzten Titel: ,,Accelerating the Reform, the Opening to the Outside World and
the Drive for Modernization, so as to achieve Greater Success in Building Socialism With Chi-
nese Characteristics" (Abgedruckt in: Beijing Review (1992), Nr. 43, S. 9- 32).
7
2.1.1.2.2 Reform der Staatsunternehmen
Die Ineffizienz der chinesischen Staatsunternehmen erforderte Veränderungen.
Angetrieben von den Erfolgen der TVEs wurden Ende der 70er Jahre Reformen
eingeleitet, bei denen es um die Stärkung der Eigenverantwortung ging. Außer-
dem wurde das Besteuerungsverfahren verändert, um ökonomisches Handeln
zu motivieren. Der Erfolg beschränke sich jedoch nur auf den ländlichen Raum
und kleine Unternehmen. Die großen Staatsbetriebe erwiesen sich als zu unfle-
xibel, um Neuerungen durchzuführen.
Bis zum Ende der Ära Deng Xiaopings konnten keine endgültigen Lösungen
gefunden werden. Als hemmend stellte sich die intensive staatliche Kontrolle
heraus. Ferner verhinderte eine schwerfällige Administration den effizienten
Austausch von Informationen. Auch der Widerwille einiger Parteifunktionäre
blockierte den Veränderungsprozess. Entgegen den Regeln des Marktes, leg-
ten sie großes Gewicht auf die Gleichverteilung von Einkommen, wodurch sie
die Konkurrenz behinderten.
14
2.1.1.2.3 Preisreform
Die Preisreform von 1984 war ein erster Schritt zur Einführung der Marktwirt-
schaft in China. Maos Planwirtschaft legte alle Preise fest. Eine Selbstregulie-
rung des Marktes fand nicht statt.
Die Umstellung musste schrittweise erfolgen. Zum einen hätte eine plötzliche
Anpassung der Preise an die Nachfrage einen Wohlstandsverlust für die priva-
ten Haushalte bedeutet, weil die Preise in Wirklichkeit höher lagen. Zum ande-
ren wären die Unternehmen zusammengebrochen, da ihre Produktion nicht von
Angebot und Nachfrage abhängig war
15
. Zur Umstellung wurde deswegen ein
zweigleisiges System verwandt. Während einer Übergangszeit, die bis in die
90er Jahre andauerte, wurde ein Teil der Güter weiterhin zu festen Preisen vom
14
Vgl. Field, R. (1996), S. 88f.
15
Unternehmen kauften bisher Produktionsmittel zu festgelegten Mengen und Preisen ein und
verkauften ebenfalls zu festgelegten Mengen und Preisen. Dadurch wurde die Optimierung
des Produktionsprozesses verhindert.
8
Staat angekauft. Außerdem waren nach wie vor Quoten zu erfüllen. Wenn die
Unternehmen jedoch in der Lage waren, einen Überschuss zu produzieren,
konnten sie diesen über den freien Markt veräußern. Die Reform verlief in ei-
nem stufenweisen Prozess, in welchem die Plan- an die Marktpreise angepasst
wurden.
16
Dieses Preissystem funktionierte allerdings schlecht, da immer noch eine künst-
liche Regulierung des Marktes vorhanden war und dadurch der Wettbewerb
verfälscht wurde. Zu Beginn der Reform konnte nur ein kleiner Teil für den pri-
vatwirtschaftlichen Verkauf produziert werden. Der Preis für diesen Anteil über-
stieg die Staatspreise in Einzelfällen aber so stark, dass es zu einer Inflation
17
kam. Außerdem wurden Unternehmen unterschiedlich behandelt. Die großen
Staatsunternehmen hatten höhere Quoten zu erfüllen, als kleinere, was eine
profitable Produktion erschwerte.
Etliche Unternehmen versuchten, die Erfüllung der Quoten aufzuschieben, um
ihre Produkte am freien Markt abzusetzen. Ursache dafür waren die großen
Differenzen zwischen Markt- und Planpreisen. Es kam zu Lieferverzögerungen,
welche die weiterverarbeitende Industrie ihrerseits an der Erfüllung der Quoten
hinderte.
Auch die Korruption wurde durch das zweigleisige System gefördert. Unter-
nehmen, die auf knappe Vorprodukte angewiesen waren, konnten Güter zu
Marktpreisen kaufen, die ursprünglich für das Plansoll vorgesehene waren.
18
Das erklärt, dass eine schnelle Durchführung der Preisreform durch die Schwie-
rigkeiten bei den Unternehmensreformen nur bedingt möglich war.
19
16
Vgl. Chow, G. (2002), S. 51f.
17
1988-1989: Erste Inflation in China mit einer Preissteigerung von 17,8 Prozent. In einer zwei-
ten Inflationsphase erreichte der Preisindex 1994 den Höchststand von 24,2 Prozent.
18
Vgl. Wang Xiaoye (1993), S. 14.
19
Vgl. Wang Xiaove (1993), S. 16f.
9
2.1.2 Aktuelle wirtschaftliche Entwicklung Chinas
Chinas Wirtschaftswachstum (BIP) beschleunigte sich im Jahre 2006 um 10,7
Prozent, nachdem es schon 2005 um 10,4 Prozent gestiegen war.
20
Die Regie-
rung hatte für 2005 einen Wert von 8 bis 9 Prozent vorgesehen. Auch die letzte
Schätzung für 2006 in Höhe von 10,5 Prozent musste leicht korrigiert werden.
Die chinesische Wirtschaft ist somit das dritte Jahr in Folge um mehr als 10
Prozent gewachsen (2004: 10,4 Prozent). Die durchschnittliche Steigerung des
BIPs betrug in den letzten fünf Jahren 9,88 Prozent. Auf 10 Jahre bezogen, be-
trug das Wachstum 8,87 Prozent und seit Beginn der Reformen 9,62 Prozent.
Chinas Investitionen wuchsen im Jahr 2005 um 27,2 Prozent, 2006 um 24,5
Prozent. Dieses Wachstum wurde von Investitionen in den industriellen Sekto-
ren und im Immobilienmarkt getragen. Die Produktionskapazitäten und der Out-
put sind in Automobil-, Mobiltelefon-, Stahl-, Zement- und Aluminiumindustrie
stark gestiegen.
21
Im Dezember 2006 lag die Zunahme allerdings nur noch bei
13,8 Prozent. Sie blieb damit im Rahmen der Regierungsplanung, die eine ma-
ximale Ausweitung von 16 Prozent vorsah.
22
Aktuell wird das Wachstum zu einem Anteil von 40 Prozent vom Export getra-
gen. Die Ausfuhren wuchsen im Jahre 2005 um 28,4 Prozent und beliefen sich
auf 762 Mrd. US-Dollar.
23
2006 wurde eine Steigerung von 27,16 Prozent (Ge-
samt: 969 Mrd. US-Dollar) erzielt.
24
Für 2007 und 2008 wird von einer weiteren
Erhöhung um 25 bzw. 20 Prozent ausgegangen. 2008 wird China die Ausfuhren
Deutschlands übertreffen (China: 1,45 Bio. US-Dollar, Deutschland: 1,38 Bio.
US-Dollar).
25
Bemerkenswert ist der Anteil ausländischer Investitionen am chi-
nesischen Export, der bei 51 Prozent liegt.
26
20
Vgl. Mcgregor, R. (26.01.2007), S. 16.
21
Vgl. Schüller, M. (2006a), S. 128ff.
22
Vgl. Fricke, T. (29.01.2007), S. 16.
23
Vgl. Schüller, M. (2006b), S. 136.
24
Quelle: MOFCOM
25
Vgl. Die Welt (06.02.2007), S. 11 und Radomsky, S. (06.02.2007), S. 9.
26
Vgl. Fricke, T. (29.01.2007), S. 16.
10
An der ersten Stelle der wichtigsten Abnehmer chinesischer Waren lagen 2005
die USA mit einem Anteil von 21,4 Prozent der Gesamtexporte (fob: 761,95
Mrd. US-Dollar). Danach kamen die EU, Hong Kong und Japan mit jeweils 18,9,
16,3 bzw. 11,0 Prozent. Chinas Importe (cif: 660 Mrd. US-Dollar) stammten
zum größten Teil aus den ASEAN Staaten. So kamen 15,2 Prozent aus Japan,
11,6 Prozent aus Südkorea und 11,3 Prozent aus Taiwan. An vierter Stelle
stand die EU mit 11,2 Prozent. Insgesamt, Importe und Exporte zusammen, ist
die EU der wichtigste Handelspartner Chinas.
27
30,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
Jahre
Pr
oz
en
t
Preissteigerung in Prozent zum Vorjahr
Veränderung des BIP in Prozent zum Vorjarh
Abb. 1: Preisanstieg und Wirtschaftswachstum in China (1978-2006)
28
Im Vergleich zu diesem dynamischen Wachstum, blieben die Inflationsraten
moderat. Der Index lag 2005 durchschnittlich bei 1,8 Prozent und 2006 bei 1,5
Prozent. Allerdings hatte sich die Teuerung in Dezember auf 2,8 Prozent stark
erhöht.
29
Die zuletzt steigende Inflation, die starke Zunahme der Investitionen
und die Gefahr der Überkapazitätenbildung hat die Regierung schon im April
2006 dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um das Wachstum zu dros-
seln. So wurde der Reservesatz der Banken um 0,5 Prozent, auf nun acht Pro-
27
Quelle: Country Profiles (WTO): China. September 2006.
28
Quelle: China Statistical Yearbook 2005. Siehe Anhang: Tab. 5.
29
Vgl. Mcgregor, R. (26.01.2007), S. 16.
11
zent, erhöht und der Zinssatz für Kredite mit einer Laufzeit von einem Jahr auf
5,85 Prozent angehoben, um die Geldmenge zu reduzieren. Darüber hinaus
wurden die Banken angewiesen, Kredite unter strikteren Auflagen zu vergeben.
Da die Anhebung des Leitzinses ohne Einfluss auf das Investitionsverhalten
blieb, sollen nun die lokalen Regierungen geeignete Maßnahmen zur Verringe-
rung der Investitionen ergreifen.
30
Dagegen spricht, dass über 400 Mio. Chine-
sen immer noch mit einem Tageslohn von unter zwei US-Dollar auskommen
müssen.
31
Um den Konsum nachhaltig zu beleben, müsste aber gerade das
Einkommen in den ländlichen Regionen steigen.
32
Der Internationale Währungsfonds bemängelte, dass die chinesischen Staats-
betriebe bisher keine Gewinne ausgeschüttet hätten. Während der Reformen
wurde den Unternehmen der Gewinneinbehalt zugestanden, um die Motivation
zu steigern. Die eingehaltenen Gewinne seien somit Hauptgrund für die hohen
Anlageinvestitionen. Die Quote der Reinvestitionen lag bei 45 Prozent und war
in keinem Land höher. Eine Ausschüttung würde dem Staat als Eigentümer der
Unternehmen zu Gute kommen und sollte in den Aufbau sozialer Sicherungs-
systeme fließen. Aus einem größeren Sicherheitsempfinden heraus, würde sich
langfristig auch die Binnennachfrage steigern lassen.
33
Bei den ausländischen Direktinvestitionen in China wurde im Jahre 2006 erst-
malig ein Rückgang festgestellt. 2005 wurde noch ein Zufluss in Höhe von 72,4
Mrd. US-Dollar gemessen. Der Grund dafür lag in der Öffnung des Finanzsek-
tors für ausländische Unternehmen. Im letzten Jahr wurden insgesamt nur noch
69,47 Mrd. US-Dollar investiert, was einem Rückgang von 4,06 Prozent ent-
sprach. Das produzierende Gewerbe konnte allerdings zulegen. Hier erhöhten
sich die Investitionen um 4,47 Prozent auf 63,02 Mrd. US-Dollar. Die rückläufige
Entwicklung wird von Experten nicht negativ eingeschätzt. Die in 2006 realisier-
ten FDIs sind immer noch die höchsten, die einer einzelnen Volkswirtschaft zu-
30
Vgl. Schüller, M. (2006a), S. 128f.
31
Vgl. Dunkel, M. (19.02.2007), S. 14.
32
Vgl. Mcgregor, R. (26.01.2007), S. 16.
33
Vgl. Hardenberg, C. (02.11.2006), S. 16.
12
geflossen sind. China geht es jedoch darum, mehr Direktinvestitionen in den
Hochtechnologie- und Dienstleistungssektor fließen zu lassen. Bisher ging der
größte Teil der FDIs in Leichtindustriefabriken exportorientierter Unternehmen.
34
Chinas Währungsreserven in US-Dollar beliefen sich im Januar 2007 auf nun-
mehr 1,06 Bio. Dies entspricht ca. 80 Prozent der gesamten Währungsreser-
ristigen
Kapitalzuflüssen. Die Steigerung im Jahre 2006 von 30 Prozent basiert jedoch
lsüberschuss. Dieser stieg bis 2007 auf 177,5
r an den US-Dollar gekoppelt war. Durch die teilweise Freigabe des
2.1.3.1 China und die USA
Reise warb er für gegenseitiges Vertrauen und erklärte, dass die Angst vor Chi-
na unbegründet sei. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die wachsenden
Handelsstreitigkeiten, das Bilanzdefizit der USA, die Unterbewertung des RMB
ven. Der Grund für so hohe Reserven lag in der Vergangenheit in kurzf
auf dem immensen Außenhande
Mrd. US-Dollar. Der hohe Überschuss setzt den RMB unter Aufwertungsdruck.
China wird deshalb versuchen, den Überschuss zu verringern, indem es plant,
den Konsum zu fördern. Bis Juli 2005 kam es zu keiner Aufwertung des RMB,
weil diese
Kurses wertete der RMB leicht auf. Die Verteuerung sollte nach Angaben der
Regierung allerdings begrenzt bleiben, um das Wachstum in China nicht zu ge-
fährden. Kritiker behaupten, der niedrige Kurs des RMB sei ein Mittel der Regie-
rung den Export zu subventionieren.
35
2.1.3 Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen Chinas
In den USA nimmt die Zahl der Kritiker an Chinas wirtschaftlichem Einfluss zu.
China wird vorgeworfen, es würde den Kurs des RMB bewusst niedrig halten,
amerikanische Arbeitsplätze vernichten und sich nicht an die WTO-Vorschriften
halten.
36
Im April 2006 besuchte Chinas Präsident Hu Jintao die USA. Während dieser
34
Vgl. Kühl, C. (16.01.2007), S. 9.
35
Vgl. Sell, F. (29.11.2006), S. 30, Schrörs, M. (16.01.2007), S. 15 und Fricke, T. (29.01.2007),
S. 16.
36
Vgl. Hughes, N. (2005), S. 94.
13
und der Schutz geistigen Eigentums. Außerdem wurden Taiwan, Nordkorea
und der Iran thematisiert.
37
Die Angaben Chinas und der USA zur Höhe des Handelsdefizits unterscheiden
sich schon seit Jahren. Der Grund sind unterschiedliche Erhebungsmethoden.
Zwischen 1990 und 2003 berechneten die amerikanischen Behörden eine jähr-
liche Zunahme des Defizits von 20 Prozent, die Chinesen gaben 25 Prozent an.
Große Unterschiede lassen sich bei den absoluten Zahlen erkennen. 2003 er-
delsüberschuss nicht im Interesse Chinas liege. Dieser
gaben die Berechnungen der USA ein Defizit von 124 Mrd. US-Dollar. Die Chi-
nesen kamen hingegen auf 59 Mrd. US-Dollar
38
. Die USA weisen offiziell aber
immer noch einen höheren Wert aus.
39
Für 2006 gab China ein Handelsdefizit von 177,5 Mrd. US-Dollar bekannt (Er-
höhung von 74 Prozent zum Vorjahr).
40
Da die US-amerikanischen Angaben für
2005 schon bei 202 Mrd. US-Dollar lagen
41
, wird der reale Wert 2006 bei über
200 Mrd. US-Dollar liegen. Klarheit besteht über die beständige Zunahme des
Defizits.
Hu versprach auf seiner USA-Reise das Defizit zu verringern. Er erklärte, dass
ein großer Außenhan
ließe sich aber durch die unterschiedliche Spezialisierung der amerikanischen
und chinesischen Industrien kaum vermeiden. In China würden zu 90 Prozent
Produkte hergestellt, welche die USA nicht mehr produzierten. Hu kündigte sei-
ne Unterstützung zur Verringerung des Defizits an. Der chinesische Konsum
solle gefördert und Importbarrieren für amerikanische Produkte abgebaut wer-
37
Vgl. Chinadaily.com (17.04.2006).
38
Die USA, aber auch internationale Organisationen, wie die WTO, berechnen Exporte fob (free
on board) und Importe cif (cost insurance freight). Bei der Berechnung des Handelsdefizits
zwischen den USA und China kommt es daher zu einer Übergewichtung der Importe. Aber
auch nach der Korrektur dieses ,,Fehlers" bleibt eine Differenz. Diese entsteht durch den Wa-
renstrom über Hong Kong. Die ehemalige Kolonie wird von den USA immer noch gesondert
behandelt. Über Hong Kong wird ein großer Teil des chinesischen Warenhandels abgewi-
ckelt. ,,Re-Exporte" aus China in die USA erscheinen in den US-amerikanischen Statistiken,
als chinesische Exporte. Hingegen werden amerikanische Exporte nach China, die über
Hong Kong laufen, nicht als solche registriert. Dadurch kommt es zu einer Untergewichtung
der Exporte nach China.
39
Vgl. Tong, S. (2005), S. 132.
40
Vgl. Schrörs, M. (16.01.2007), S. 15.
41
Vgl. Lynch, D. (20.04.2006).
14
den. Er forderte aber auch von den USA Maßnahmen zur Unterstützung beim
Abbau des Handelsdefizits. So müssten Beschränkungen für Exporte nach Chi-
na abgebaut werden.
42
Die chinesischen Exporte in die USA wuchsen proportional zu den chinesischen
Gesamtimporten. Die Zunahme chinesischer Exporte in die USA lag im Rah-
men der Zunahme der chinesischen Gesamtexporte. Das Defizit ist gegenüber
lativ
s China.
44
allen Industriestaaten gestiegen. Dies liegt daran, dass China in seinem derzei-
tigen Entwicklungsstand eher auf Rohstoffe, als Hochtechnologiegüter ange-
wiesen ist. Die Industrienationen können die Rohstoffnachfrage aber nicht be-
dienen. Außerdem verlieren die USA schon seit Jahren weltweit Marktanteile.
Der Anteil Chinas am gesamten Defizit der USA hat seit 1991 zwar einen re
hohen Wert (zwischen 13 und 22 Prozent). Er ist aber unterproportional zur Ge-
samtzunahme des Defizits gewachsen. Das Defizit hat seinen Grund im unzu-
reichenden Sparverhalten der Amerikaner.
43
60 Prozent der amerikanischen Importe aus China im Jahre 2005 stammen von
amerikanischen Unternehmen. Sie profitierten von den niedrigen chinesischen
Lohnkosten. Damit ermöglichen sie dem amerikanischen Konsumenten niedrige
Preise und höhere Gewinne für die Unternehmen. Die Einzelhandelskette Wal-
Mart kaufte allein 2005 Waren im Wert von 18 Mrd. US-Dollar au
Als Zeichen des guten Willens hatte China schon vor dem Besuch Hus Kontrak-
te in Höhe von 16,2 Mrd. US-Dollar mit amerikanischen Unternehmen des
landwirtschaftlichen (Soja und Baumwolle) und industriellen Bereichs unter-
zeichnet. Boeing wird 80 Maschinen des Typs 737 im Wert von 4,6 Mrd. US-
Dollar an China liefern
45
Unabhängig davon nahmen die US-Exporte nach Chi-
na zwischen 2000 und 2005 von 16,3 Mrd. US-Dollar auf 41,8 Mrd. US-Dollar
42
Vgl. Xinhua (20.04.2006).
43
Vgl. Oxford Economics (2006), S. 7ff.
44
Vgl. Hughes, N. (2005), S. 94.
45
Vgl. Kühl, C. (20.04.2006), S. 14.
15
zu. Dies entspricht einer Steigerung von 157 Prozent. Vom chinesischen Bau-
boom profitierte z.B. der Baumaschinenhersteller Caterpillar.
46
Einige amerikanische Politiker behaupten, dass der Unterschied zwischen Im-
und Exporten durch den niedrigen Kurs des RMB zum US-Dollar gefördert wür-
de. Bei einem System flexibler Wechselkurse gilt ein konstantes Bilanzdefizit
als Zeichen einer Unterbewertung der Währung.
47
China hatte 2005, nachdem
es jahrlang unter starkem politischem Druck stand, die Kopplung an den US-
Dollar beendet. Dadurch wertete der RMB um 2,1 Prozent auf. Seit dem kann
der RMB kontrolliert um einen Währungskorb pendeln.
48
Europa hat Verständ-
nis dafür, dass China seinen Wechselkurs schrittweise freigibt. Für die USA und
den IWF geht die Anpassung aber nicht schnell genug.
49
Hu bestätigte, dass
eine im internationalen Vergleich angemessen bewertete Währung für China
wichtig sei. Dies sei nicht nur im Interesse der USA, sonder auch Chinas, weil
es Stabilität fördere.
50
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Hu,
B das Defizit verringere. Vielmehr, argumentiert
dass die chinesische Währungsreform wie geplant fortgesetzt würde.
51
Die
Vorwürfe, China würde seine Währung künstlich niedrig halten, um den Export
zu fördern, konnte vom amerikanischen Kongress nicht nachgewiesen wer-
den.
52
Außerdem bezweifeln Wirtschaftswissenschaftler wie Ronald McKinnon,
dass eine Aufwertung des RM
auch er, sei das Handelsdefizit die Folge der niedrigen amerikanischen Sparra-
te und der hohen Staatsausgaben. Sollte China den RMB aufwerten, könnten
sich auch andere asiatische Währungen und der Euro verteuern. Das Resultat
wäre eine Inflation in den USA.
53
In der aktuellen Diskussion zum Defizit gegenüber China fordern immer mehr
Politiker in den USA protektionistische Maßnahmen gegen Chinas Waren. Tre-
46
Vgl. Lynch, D. (20.04.2006).
47
Vgl. Jingtao Yi (2006), S. 304f.
48
Vgl. Jingtao Yi (2006), S. 302.
49
Vgl. Schieritz, M. (20.04.2006), S. 14.
50
Vgl. Xinhua (20.04.2006).
51
Vgl. The White House (20.04.2006).
52
Vgl. TREAS (10.05.2006).
53
Vgl. China.org (15.12.2006).
16
asury Secretary Henry Paulson erinnerte bei einer Rede im März 2007 daran,
dass Protektionismus negative Auswirkungen auf Wachstum und Konsum der
d seiner USA-Reise besuchte Hu das Softwareunternehmen Microsoft.
chutz geistigen Eigentums erörtert. Hu erklärte,
dass China Gesetze zum Schutze geistigen Eigentums erlassen hätte und wei-
große Mengen an Gütern, welche die Sowjetunion als einzelner Partner nicht
Vereinigten Staaten hätte.
54
Ein Problem sind auch die hohen Währungsreserven Chinas. Im Oktober waren
diese auf eine Bio. US-Dollar angewachsen. Analysten gehen davon aus, dass
diese bis 2010 sogar auf zwei Bio. US-Dollar ansteigen könnten, wenn der bis-
herige Zuwachs von jährlich ca. 200 Mrd. US-Dollar beibehalten würde. Exper-
ten verlangen eine schnelle Aufwertung des RMB, um das Wachstum der Re-
serven zu bremsen. Die chinesische Zentralbank hatte angekündigt, dass sie
die Reserven stärker differenzieren wolle.
55
Ein Teil wird für den Kauf von Roh-
stoffen eingesetzt.
56
Währen
Bei diesem Treffen wurde der S
tere plane. China wisse, dass es nicht nur darum ginge, verlässliche Rahmen-
bedingungen für ausländische Investoren zu schaffen, sondern auch die Inno-
vationskraft der eigenen Industrie zu schützen. Während des Besuchs hatte der
chinesische PC-Hersteller Lenovo bereits zugesagt, nur noch Computer mit
vorinstallierter Software zu vertreiben, um illegale Betriebssystemkopien zu re-
duzieren. Lenovo will dazu Windowslizenzen im Wert von 1,2 Mrd. US-Dollar
kaufen.
57
2.1.3.2 China und Europa
1953, nach dem Ende des Koreakrieges
58
, kam es zu einer langsamen Annä-
herung Chinas an den Westen. Chinas ehrgeizige Wirtschaftspläne verlangten
54
Vgl. AP/AFP (02.03.2007).
55
Vgl. Dunkel, M. (16.11.2006), S. 16.
56
Vgl. Marschall, B. (21.03.2007), S. 11.
57
Vgl. Chinadaily.com (19.04.2006).
58
Der Koreakrieg begann 1950 und endete am 27. Juli 1953 mit der Unterzeichnung eins Waf-
fenstillstandabkommens. China kämpfte auf der Seite Nordkoreas gegen Südkorea, welches
von der UN (insbesondere den USA) Unterstützung erhielt.
17
liefern konnte. Deshalb verstärkte China seine internationale Aktivität. Auf der
Genfer Konferenz über Korea und Indochina
59
im Jahre 1954 verbesserte sich
dSSR durch die Bildung einer starken ,,Zwischenzone"
zu verringern. Die Annäherung endete jedoch schlagartig mit der Kulturellen
vorfall
63
(1989) belastet. Zwar brach die EG den Kontakt auf
das politische Klima zwischen den europäischen Staaten und China. Davon
profitierten auch die Wirtschaftsbeziehungen. Zu einer Intensivierung kam es
1964. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen Frankreichs mit China ver-
deutlichte das angespannte Verhältnis der Volksrepublik zur Sowjetunion. Diese
Umorientierung war politisch motiviert. China verfolgte das Ziel, die Vormacht-
stellung von USA und U
Revolution.
60
Ende der 60iger Jahre wuchs die Bedrohung Chinas durch die Sowjetunion
61
.
Daraufhin trat China 1971 der UN bei. Dies war ein Wendepunkt in den sino-
europäischen Beziehungen. Wie schon in den 60iger Jahren verfolgte China
allerdings eher ideologische Ziele und trat deswegen mit Nachdruck für eine
multipolare Weltordnung
62
ein. Für Europa standen hingegen wirtschaftliche
Fragen im Mittelpunkt.
1975 wurden diplomatische Beziehungen zur Europäischen Gemeinschaft auf-
genommen. Das positive Verhältnis zwischen Europa und China wurde durch
den Tiananmen
hoher politischer Ebene ab und leitete ein Waffenembargo ein. In der Durchset-
zung weiterer Maßnahmen blieb die EG jedoch zurückhaltend. Ein Jahr später
hatten sich die Beziehungen wieder verbessert.
64
1994 wurde mit dem ,,neuen
politischen Dialog zwischen der EU und China" eine neue Ära begonnen. Das
59
Auch ,,Indochinakonferenz". Sie fand vom 8. Mai bis zum 21. Juni 1954 unter der Beteiligung
von China, Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion, den USA, Vietnam, Laos und Kam-
bodscha statt. Das erreichte ,,Genfer Indochinaabkommen" bedeutete das Ende der französi-
schen Kolonialherrschaft im damaligen Indochina.
60
Vgl. Oetzel, N. (2004), S. 9f.
61
1968 und 1969 kam es am Grenzfluss Ussuri zu schweren Gefechten zwischen Chinesen
und Sowjets. Der eigentliche Grenzkonflikt, der Zugehörigkeitsstatus einer Insel im Fluss, war
die Folge des Streites um die ideologische Vormachtstellung der kommunistischen Systeme
der Länder.
62
,,Drei-Welten-Theorie" von Deng Xiaoping.
63
Am 04. Juni 1989 wurden mehrere Monate andauernde Proteste auf dem Platz des Himmli-
schen Friedens (Tian'anmen-Platz) einer Demokratiebewegung blutig niedergeschlagen.
64
Vgl. Oetzel, N. (2004), S. 11ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836606035
- ISBN (Paperback)
- 9783836656030
- DOI
- 10.3239/9783836606035
- Dateigröße
- 906 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Business and Information Technology School - Die Unternehmer Hochschule Iserlohn – Volkswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Oktober)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- transformation direktinvestition technologietransfer wirtschaftsbeziehungen
- Produktsicherheit
- Diplom.de