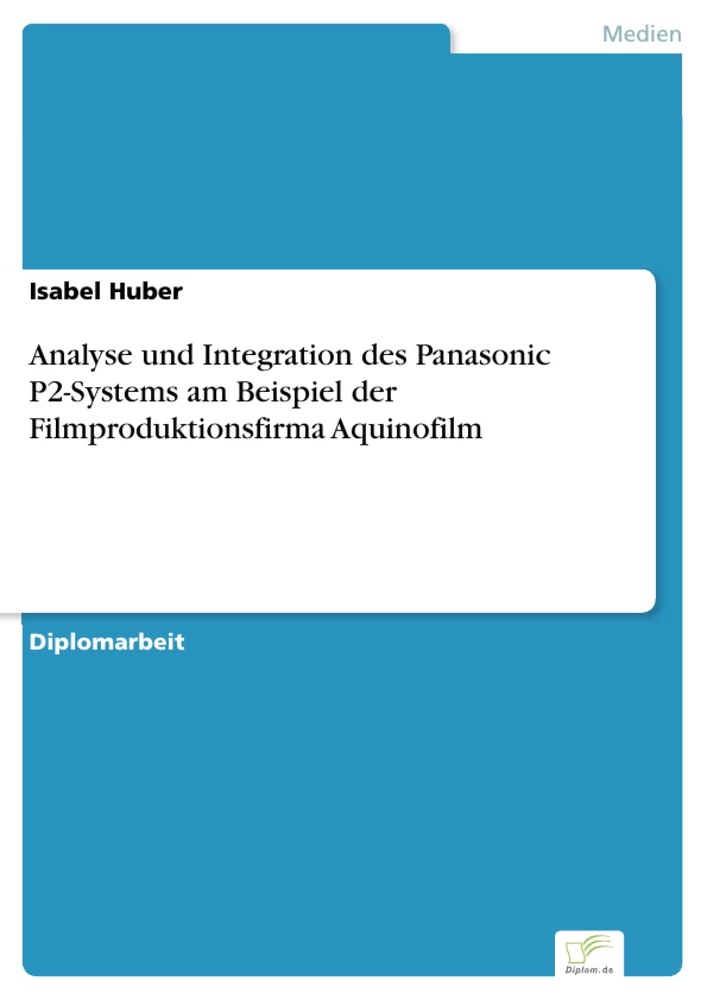Analyse und Integration des Panasonic P2-Systems am Beispiel der Filmproduktionsfirma Aquinofilm
©2007
Diplomarbeit
102 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Während sich die Ausstrahlung von HDTV bei den meisten Sendern noch in der Testphase befindet, hat sich die Herstellung von HD-Sendungen hingegen schon weitreichender etabliert. Insbesondere Dokumentationen und Sportereignisse, aber auch Serien und TV-Spielfilme werden zunehmend in HD produziert. Dies liegt zum großen Teil daran, dass eine internationale Verwertung von Produktionen fast nur noch in HD-Auflösung möglich ist. Länder wie Japan, USA, China, Brasilien und Australien sind fortgeschrittener in der Distribution von hochauflösenden Inhalten, weshalb diese kaum noch Produktionen in Standardauflösung ankaufen.
Abgesehen davon wollen hiesige Sender und Produktionsfirmen HD-Archive aufbauen, aus denen sie sich für kommende Ausstrahlungen bedienen können. Des Weiteren ist die Bildqualität eines hochauflösenden Videosignals, das auf SD konvertiert wurde, hochwertiger als die einer Aufnahme in niedrigerer Auflösung.
Neben der Migration nach HD geht die Tendenz bei Herstellern, Rundfunkanstalten und Produktionsfirmen mehr und mehr zur IT-gestützten, bandlosen Videoaufzeichnung und Weiterverarbeitung. So gibt es im Consumer-Bereich von allen namhaften Herstellern HD-Camcorder, die mit bandloser Aufnahme arbeiten. Entweder wird hier auf interne Festplatten, SD-Speicherkarten oder auf DVD aufgezeichnet. Im professionellen Broadcast-Bereich müssen größere Datenmengen in möglichst geringer Kompression aufgenommen werden. Für diesen Bereich stehen andere Speichermedien zur Verfügung. Bekannt sind - neben der Ausspielung auf externe Festplatten - das P2-System von Panasonic und die so genannte Professional Disk des Sony XDCAM HD Systems.
Als Vorteile einer bandlosen digitalen Produktion gelten die schnellere, effizientere Produktion und den Zugriff auf Daten über vernetzte Computer. Letzteres ist gerade in der aktuellen Berichterstattung von großer Bedeutung.
Mit dem Camcorder AG-HVX200 kam von Panasonic 2006 die erste Kamera des P2-Systems auf den Markt, die HD-Signale in Form von digitalen Daten auf eine Speicherkarte schreibt. Mit DVCPRO HD-Komprimierung und vielseitigen Aufnahmemöglichkeiten positioniert sie sich als Alternative zu HDV-Kameras in ihrer Preisklasse. Doch trotz ihrer Flexibilität ist die Kamera nicht für alle Produktionsweisen in gleichem Maße geeignet. Auch die Art der Aufzeichnung bringt eine Reihe verschiedener Arbeitsweisen und Fragestellungen hinsichtlich Datenübertragung und Nachbearbeitung mit sich, […]
Während sich die Ausstrahlung von HDTV bei den meisten Sendern noch in der Testphase befindet, hat sich die Herstellung von HD-Sendungen hingegen schon weitreichender etabliert. Insbesondere Dokumentationen und Sportereignisse, aber auch Serien und TV-Spielfilme werden zunehmend in HD produziert. Dies liegt zum großen Teil daran, dass eine internationale Verwertung von Produktionen fast nur noch in HD-Auflösung möglich ist. Länder wie Japan, USA, China, Brasilien und Australien sind fortgeschrittener in der Distribution von hochauflösenden Inhalten, weshalb diese kaum noch Produktionen in Standardauflösung ankaufen.
Abgesehen davon wollen hiesige Sender und Produktionsfirmen HD-Archive aufbauen, aus denen sie sich für kommende Ausstrahlungen bedienen können. Des Weiteren ist die Bildqualität eines hochauflösenden Videosignals, das auf SD konvertiert wurde, hochwertiger als die einer Aufnahme in niedrigerer Auflösung.
Neben der Migration nach HD geht die Tendenz bei Herstellern, Rundfunkanstalten und Produktionsfirmen mehr und mehr zur IT-gestützten, bandlosen Videoaufzeichnung und Weiterverarbeitung. So gibt es im Consumer-Bereich von allen namhaften Herstellern HD-Camcorder, die mit bandloser Aufnahme arbeiten. Entweder wird hier auf interne Festplatten, SD-Speicherkarten oder auf DVD aufgezeichnet. Im professionellen Broadcast-Bereich müssen größere Datenmengen in möglichst geringer Kompression aufgenommen werden. Für diesen Bereich stehen andere Speichermedien zur Verfügung. Bekannt sind - neben der Ausspielung auf externe Festplatten - das P2-System von Panasonic und die so genannte Professional Disk des Sony XDCAM HD Systems.
Als Vorteile einer bandlosen digitalen Produktion gelten die schnellere, effizientere Produktion und den Zugriff auf Daten über vernetzte Computer. Letzteres ist gerade in der aktuellen Berichterstattung von großer Bedeutung.
Mit dem Camcorder AG-HVX200 kam von Panasonic 2006 die erste Kamera des P2-Systems auf den Markt, die HD-Signale in Form von digitalen Daten auf eine Speicherkarte schreibt. Mit DVCPRO HD-Komprimierung und vielseitigen Aufnahmemöglichkeiten positioniert sie sich als Alternative zu HDV-Kameras in ihrer Preisklasse. Doch trotz ihrer Flexibilität ist die Kamera nicht für alle Produktionsweisen in gleichem Maße geeignet. Auch die Art der Aufzeichnung bringt eine Reihe verschiedener Arbeitsweisen und Fragestellungen hinsichtlich Datenübertragung und Nachbearbeitung mit sich, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Isabel Huber
Analyse und Integration des Panasonic P2-Systems am Beispiel der
Filmproduktionsfirma Aquinofilm
ISBN: 978-3-8366-0562-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Fachhochschule Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
Kurzzusammenfassung
Titel:
Analyse und Integration des Panasonic P2-Systems am Beispiel der
Filmproduktionsfirma Aquinofilm
Autorin:
Isabel Huber
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Franz Stollenwerk (FH Köln)
Prof. Dr. Willi Hönscheid (FH Köln)
Martin Hilbert (Geschäftsführer Aquinofilm)
Zusammenfassung: Um den bevorstehenden Anforderungen der Sender an HD-
Produktionen nachzukommen und um international verwertbare Sendungen herzustellen, will
die Firma Aquinofilm, die hauptsächlich dokumentarische Formate produziert, ihre
Produktionsumgebung auf ein geeignetes HD-Kamera- und Editingsystem umstellen. Es soll
in den Panasonic P2-Camcorder AG-HVX200 und zugehörige Komponenten investiert
werden, um zukünftig bandlos und hochauflösend produzieren zu können. In dieser
Diplomarbeit werden zunächst HD-Formatstandards erörtert, technische Grundlagen zur
Kamera AG-HVX200 dargelegt und das Produktionsumfeld von Aquinofilm erläutert. Im
Hauptteil wird die Kamera hinsichtlich Anforderungen der Firma untersucht. Hierbei werden
technische und finanzielle Kriterien sowie Aspekte der Dokumentarfilmproduktion betrachtet.
Weiter wird ein geeigneter Workflow für die Firma herausgestellt. Für die Integration der
Kamera und weiterer P2-Komponenten in das Produktionsumfeld wurden sämtliche
Möglichkeiten zur Aufnahme und Datenübertragung sowie der Import der Daten in das
Schnittsystem Final Cut Pro getestet.
Stichwörter: HDTV, Panasonic AG-HVX200, P2-System, HD Kamera, IT basierte
Produktion, Dokumentarfilmproduktion
Datum:
Juli 2007
Abstract
Title:
Analysis and Integration of the Panasonic P2-System by the example of the
production company Aquinofilm
Author:
Isabel Huber
Reviewers: Prof. Dr.-Ing. Franz Stollenwerk (FH Köln)
Dr.-Ing. Willi Hönscheid (FH Köln)
Martin Hilbert (Director Aquinofilm)
Abstract: In order to be able to meet the forthcoming requirements of broadcasting
stations for HDTV production and to produce TV programms of international standard,
Aquinofilm, a TV production company specializing in television documentaries, intends to
change its production environment based on an appropriate HD-camera and editing
system. The company plans the purchase of the Panasonic P2-Camcorder AG-HVX200
and the related P2-components for a tapeless and high-definition production.
The first part of this diploma thesis is concerned with providing an overview of HD-
standards, technical basics of the Panasonic AG-HVX200 camcorder and Aquinofilm's
production environment. The main part is concerned with the requirements analysis of
the camera and the P2-components. Here, technical, financial as well as documentary
film production aspects are considered. Further, this thesis proposes an applicable
workflow model for the company. In order to show how the camera and other P2-
components can be integrated into the production environment, all methods to capture,
transfer and import data into Final Cut Pro were testet.
Key-Words: HDTV, Panasonic AG-HVX200, P2-System, HD-camera, IT-based
production, documentary
Date:
July, 2007
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit
beigetragen haben.
Mein Dank gilt der Firma Aquinofilm, insbesondere Martin Hilbert, für die Ermöglichung
dieser Arbeit und die Beantwortung vieler Fragen.
Des Weiteren möchte ich mich bei Herrn Professor Franz Stollenwerk und Herrn Willi
Hönscheid für die Betreuung meiner Arbeit bedanken.
Außerdem danke ich den Kölner Filmgeräteverleihern Pille GmbH und Camcar OHG, die mir
für Testaufnahmen das nötige Equipment und die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
haben.
Ebenso gilt mein Dank der Firma AtelierBusche.Media in Stuttgart für die freundliche
Bereitstellung von Testmaterial, mit welchem die Ergebnisse der eigenen Vergleichtests
bestärkt werden konnten.
Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Freund Dominik Berg bedanken, der mich
fachlich wie auch emotional in der Fertigstellung dieser Arbeit unterstützt hat.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine Kommilitonin Laura Hahn, die sich sehr viel
Mühe gemacht hat, meine Arbeit inhaltlich Korrektur zu lesen. Ebenso danke ich Jens
Gerhards für die Rechtschreibkorrekturen, mit denen er dieser Arbeit den letzten Schliff
verpasst hat.
INHALTSVERZEICHNIS 6
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Zielsetzung und Verlauf der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
2 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 HDTV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Definition und Status Quo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Standardisierungsinstitute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 HDTV-Formate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Datenkompression und Videoformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Diskrete Cosinus Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Pulse Code Modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 DVCPRO HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 High Definition Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 MPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6 Material Exchange Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
13
14
17
17
18
19
21
22
23
3 Das Panasonic P2-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Die P2-Speicherkarte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Die P2-Produktfamilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Der AG-HVX200 Camcorder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Abbildungssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Signalverarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Datenaufzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 Schnittstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 Audiosignalverarbeitung und Aufzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.6 Sucher und Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
27
28
31
32
34
34
35
4 Die Filmproduktionsfirma Aquinofilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Profil der Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Gründe für die Migration nach HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Herkömmliche Arbeitsweise von Aquinofilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
38
39
5 Analyse der HVX200 hinsichtlich Anforderungen der Firma Aquinofilm . . . . .
5.1 Technische und qualitative Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Prüfung der HVX200 auf technische und qualitative Anforderungen . . .
5.2 Wirtschaftliche Aspekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Evaluierung der mit dem P2-System verbundenen Kosten . . . . . . . . . .
5.3 Alternativen zur HVX200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
46
47
49
INHALTSVERZEICHNIS 7
5.3.1 Vergleichstest: HVX200 und Z1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Weiterverarbeitung des aufgenommenen Materials . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Visuelle Beurteilung verschiedener HD-Aufnahmemodi der HVX200 . . . . . . . .
50
60
60
6 Workflow und Integration des P2-Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1 Aufnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Aufnahme auf P2-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Arbeit mit dem FireStore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 P2-Datenübertragung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 P2-Karte in Laptop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.2 P2-Karte in P2-Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.3 Kamera an Laptop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.4 Kamera an mobile Festplatte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.5 FireStore an Rechner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.6 Übersicht über die Übertragungszeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 P2-Software. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 P2-Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.2 P2-Log. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.3 P2-Genie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Nachbearbeitung mit Final Cut Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Kompatibilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Datenimport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Ausspielung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
65
65
69
70
71
74
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
82
82
7 Diskussion und Empfehlungen an Aquinofilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Eignung der Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Empfehlungen für den P2-Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
85
89
91
8 Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Anhang A: Technische Daten der AG-HVX200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhang B: DVD mit Testaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
99
Quellenangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1 EINFÜHRUNG
8
1 Einführung
Nachdem in den 1990er Jahren das HD-MAC-System scheiterte, ist seit einigen Jahren das
Thema HDTV in Europa wieder in aller Munde. Dabei hinkt Deutschland dem europäischen
Durchschnitt der technischen Entwicklung in Richtung HDTV noch hinterher. Seit der
Fussballweltmeisterschaft 2006, die in HD produziert wurde, findet jedoch verstärkt eine
sukzessive Migration zur HD-Produktion und -Ausstrahlung in deutschen Sendeanstalten
und Produktionsfirmen statt. Es scheint heute durchweg festzustehen, dass das
hochauflösende Fernsehen Einzug in unsere Wohnzimmer hält - lediglich das Wann und Wie
stehen noch offen.
Die Ausstrahlung von HDTV befindet sich bei den meisten Sendern noch in der Testphase
und auch Fragen hinsichtlich Übertragungstechnik und eines verbindlichen HD-Standards
sind noch nicht geklärt.
Die Herstellung von HD-Sendungen hat sich hingegen schon weitreichender etabliert.
Insbesondere Dokumentationen und Sportereignisse, aber auch Serien und TV-Spielfilme
werden zunehmend in HD produziert. Dies liegt zum großen Teil daran, dass eine
internationale Verwertung von Produktionen fast nur noch in HD-Auflösung möglich ist.
Länder wie Japan, USA, China, Brasilien und Australien sind fortgeschrittener in der
Distribution von hochauflösenden Inhalten, weshalb diese kaum noch Produktionen in
Standardauflösung ankaufen.
Abgesehen davon wollen hiesige Sender und Produktionsfirmen HD-Archive aufbauen, aus
denen sie sich für kommende Ausstrahlungen bedienen können. Des Weiteren ist die
Bildqualität eines hochauflösenden Videosignals, das auf SD konvertiert wurde, hochwertiger
als die einer Aufnahme in niedrigerer Auflösung.
Neben der Migration nach HD geht die Tendenz bei Herstellern, Rundfunkanstalten und
Produktionsfirmen mehr und mehr zur IT-gestützten, bandlosen Videoaufzeichnung und
Weiterverarbeitung. So gibt es im Consumer-Bereich von allen namhaften Herstellern HD-
Camcorder, die mit bandloser Aufnahme arbeiten. Entweder wird hier auf interne Festplatten,
SD-Speicherkarten oder auf DVD aufgezeichnet. Im professionellen Broadcast-Bereich
müssen größere Datenmengen in möglichst geringer Kompression aufgenommen werden.
Für diesen Bereich stehen andere Speichermedien zur Verfügung. Bekannt sind - neben der
Ausspielung auf externe Festplatten - das P2-System von Panasonic und die so genannte
Professional Disk des Sony XDCAM HD Systems.
1 EINFÜHRUNG
9
Als Vorteile einer bandlosen digitalen Produktion gelten die schnellere, effizientere
Produktion und den Zugriff auf Daten über vernetzte Computer. Letzteres ist gerade in der
aktuellen Berichterstattung von großer Bedeutung.
Mit dem Camcorder AG-HVX200 kam von Panasonic 2006 die erste Kamera des P2-
Systems auf den Markt, die HD-Signale in Form von digitalen Daten auf eine Speicherkarte
schreibt. Mit DVCPRO HD-Komprimierung und vielseitigen Aufnahmemöglichkeiten
positioniert sie sich als Alternative zu HDV-Kameras in ihrer Preisklasse. Doch trotz ihrer
Flexibilität ist die Kamera nicht für alle Produktionsweisen in gleichem Maße geeignet. Auch
die Art der Aufzeichnung bringt eine Reihe verschiedener Arbeitsweisen und
Fragestellungen hinsichtlich Datenübertragung und Nachbearbeitung mit sich, die individuell
ausgearbeitet werden müssen.
1.1 Zielsetzung und Verlauf dieser Arbeit
Im Zuge der Umstellung nach HD zieht die Kölner Produktionsfirma Aquinofilm in Betracht, in
die AG-HVX200 und zusätzliche P2-Systemkomponenten zu investieren. Ziel dieser Arbeit
ist es, das P2-System, insbesondere die Kamera, hinsichtlich der Anforderungen der
Produktionsfirma zu untersuchen und einen geeigneten P2-Workflow zu erarbeiten.
In Kapitel 2 werden zunächst HD-Formatstandards und relevante Videoformate erörtert.
Darauf folgt in Kapitel 3 die Vorstellung des Panasonic P2-Systems mit besonderem
Augenmerk auf technische Grundlagen des Panasonic AG-HVX200 Camcorders. Im darauf
folgenden Kapitel wird auf die Firma Aquinofilm und deren Produktionsumfeld eingegangen.
Kapitel 5 beinhaltet die Analyse der Kamera hinsichtlich der Anforderungen von Aquinofilm.
Hierbei werden technische und finanzielle Kriterien sowie Aspekte der
Dokumentarfilmproduktion betrachtet. Zusätzlich wurde ein Vergleich mit dem HDV-
Camcorder HVR-Z1 von Sony durchgeführt, um Unterschiede in Funktionalität, Handhabung
und Bildqualität der beiden Kameras herauszustellen. In Kapitel 6 folgen Untersuchungen
zum Workflow und zur Integration des P2-Systems bei Aquinofilm. Sämtliche Möglichkeiten
zur Aufnahme und Datenübertragung werden analysiert. Außerdem wird auf den Import der
Daten in das Schnittsystem Final Cut Pro eingegangen.
Die gesammelten Erkenntnisse aus diesen Kapiteln werden schließlich in der Diskussion in
Kapitel 7 besprochen. Darauf basierend wird die Eignung der HVX200 für Aquinofilm
diskutiert und eine Empfehlung ausgesprochen, wie die Kamera mit optimalem P2-Workflow
in die Produktionsumgebung integriert werden kann.
1 EINFÜHRUNG
10
Dieser Arbeit ist eine DVD beigelegt, welche die Testaufnahmen zur Analyse aus Kapitel 5
enthält. Da die Videosequenzen auf Grund der hohen Datenrate von HD auf SD
downkonvertiert werden mussten, können sie nicht als HD-Referenzmaterial genutzt werden.
Sie sollen lediglich als Anschauungsmaterial dienen, um die Testdurchführung
nachvollziehen zu können. Zusätzlich beinhaltet die DVD aus den Videos in HD-Auflösung
exportierte Standbilder im unkomprimierten TIFF-Dateiformat. Anhand dieser Bilder sind in
vergrößerter Ansicht Unterschiede in der Bildqualität beider miteinander verglichener
Kameras ersichtlich. Eine detaillierte Inhaltsangabe zu den Testaufnahmen auf der DVD
befindet sich in Anhang B.
Weiter ist der DVD diese Diplomarbeit als PDF-Dokument beigefügt. Während in der
Druckversion die angegebenen Quellen aus dem Internet auf die Hauptdomain einer Seite
verweisen, erreicht man mit dem Link auf der digitalen Version die genutzten Internetseiten
direkt.
2 GRUNDLAGEN 11
2 Grundlagen
In diesem Kapitel wird Grundlegendes zum Thema HDTV und zur Standardisierung von HD-
Formaten erläutert und auf gestalterische Aspekte bei HDTV eingegangen.
In Kapitel 2.2 werden die für diese Arbeit relevanten Datenkompressionsarten und
Videoformate erörtert.
2.1 Grundlagen HDTV
2.1.1 Definition und Status Quo
HD (High Definition) ist ein allgemeiner Ausdruck, um den Unterschied zum herkömmlichen
SD (Standard Definition) zu beschreiben. Der Begriff wird für hochauflösende Kameras,
Objektive, Rekorder, Postproduktionstechnik und Aufnahmeformate verwendet. Es gibt viele
verschiedene HD-Standards unterschiedlicher Hersteller, die sich in Auflösung, Bildrate und
Kompression unterscheiden.
HDTV steht für High Definition Television und ist ein Sammelbegriff, der eine ganze Reihe
von Fernsehnormen bezeichnet. Gegenüber dem Standard Television Fernsehen (SDTV)
unterscheidet sich HDTV durch eine erhöhte Zeilen- und Bildpunktzahl. Die hochaufgelöste
Darstellung im Format 16:9 bietet eine Steigerung der Qualität hinsichtlich der Darstellung
von Details, Farbwiedergabe und der natürlicheren Wahrnehmung.
Vorreiter in Sachen HDTV war und ist Japan. Bereits 1989 wurden dort HDTV-Programme
ausgestrahlt, damals noch auf analogem Wege via Satellit (MUSE-System). Mit Hilfe der
japanischen Regierung und der Geräteindustrie konnte sich auch das digitale
hochauflösende Fernsehen etablieren. Seit 2003 sind mehr als 6 Millionen Haushalte im
Stande, neben Kabel und Satellit, HDTV über digitales terrestrisches Netz zu konsumieren.
Sieben öffentlich-rechtliche und private Sender strahlen fast rund um die Uhr HDTV aus.
Neue Fernseh- und Produktionsstudios werden nur noch mit HD-Technik ausgestattet.
Japan setzt auf nur eine HDTV-Fernsehnorm: 1125 Zeilen und 60Hz im
Zeilensprungverfahren [Pall05].
Herausgefordert vom japanischen Fortschritt, entwickelte die USA ihr eigenes HDTV-
System. Anfang der 1990er wurde per Gesetz der Umstieg auf digitales Fernsehen und die
Abschaltung des analogen für das Jahr 2007 beschlossen, womit dem hochauflösenden
2 GRUNDLAGEN 12
Fernsehen der Weg geebnet war. Neben der Unterstützung durch die Regierung trug auch
die enorme sichtbare Qualitätsverbesserung von 486 aktiven Zeilen (NTSC) hin zu 720 bzw.
1080 Zeilen dazu bei, dass HDTV schnell auf breite Akzeptanz traf. Mittlerweile werden fast
alle Produktionen in HD hergestellt. Die meisten großen US-Sender bieten parallel zu SD,
überwiegend zu den Hauptsendezeiten, HDTV an, welches sowohl über Satellit als auch
Kabel und das digitale terrestrische Netz verbreitet wird. Zur Anwendung kommen hierbei
zwei HDTV-Formate. ABC strahlt beispielsweise in 720/60p, NBC und CBS in 1080/60i aus
[DTV07] [ARD07].
Bild 1: TV Formate - Bildauflösungen im Vergleich.
Seit dem Scheitern der analogen HDTV-Fernsehnorm (HD-MAC) in den 1990er Jahren hinkt
Europa, was das Vorankommen in Sachen HDTV betrifft, hinterher. Von den maßgeblichen
Sendern werden noch keine hochauflösenden Bilder ausgestrahlt. Lediglich Testprogramme
werden gesendet.
Mit dem Fortschritt der Digitalisierung des Fernsehens, der mittlerweile ausgereiften
Technologie der Empfangsgeräte sowie den Plänen der Sender hochauflösend zu
produzieren und in naher Zukunft auch ausstrahlen zu wollen, ändert sich jedoch die Lage.
In Europa begann der belgische Sender HD1 mit der Ausstrahlung von HDTV. Über zwei
Kanäle werden ausschließlich HD-Produktion, vornehmlich aus den USA und Japan gezeigt
[Pall05].
Deutschland steht noch hinter dem europäischen Durchschnitt. Bisher wird nur von einigen
privaten Fernsehanstalten (Pro7, Sat1) und Pay-TV Sendern (Premiere) teilweise HDTV
gesendet. Das ZDF sieht 2010 als möglichen Starttermin für eine erstmalige Ausstrahlung
2 GRUNDLAGEN 13
von TV-Signalen im HDTV-Standard an. Ebenso wurde eine Tendenz zum Format 720/50p
geäußert [ZDF07].
Bisher gibt es die Verbreitung von hochauflösenden Inhalten in Europa primär über Satellit
und nur in geringem Maße über Kabel. Das Ziel, dass bis 2010 alle Sender auf eine digitale
Distribution umgestellt haben sollen, bringt auch die Ausstrahlung von HDTV um ein
Beträchtliches voran. Denn anders als in Japan funktioniert HDTV in Europa nur digital. Das
bedeutet, dass von der Produktion über Sendestudios und Übertragungswege bis zum
Empfänger eine durchweg digitale Infrastruktur vorhanden sein muss. So sind HDTV-fähige
Bildschirme und auch HD-Settop-Boxen in den Haushalten Voraussetzung für den Empfang
der digitalen HD-Signale [Pall05] [DTV07].
2.1.2 Standardisierungsinstitute
Bei der Produktion von HDTV, der Gestaltung der Übertragungswege sowie der Herstellung
von Empfangsgeräten spielt die Frage nach einem festgelegten HDTV-Standard eine große
Rolle. Noch hat sich in Deutschland keine Präferenz auf ein System herauskristallisiert und
nachdem das Format 1080/50i längere Zeit in aller Munde war, hört man nunmehr häufiger
von den Vorteilen von 720/50p (siehe 2.1.3).
Wer legt diese Standards fest? Um die Entwicklung eines Systems voranzubringen, Fragen
der Technik zu klären und als Vermittler in der Welt der bewegten Bilder zu dienen, gibt es
mehrere Verbände und Zusammenschlüsse aus dem Broadcast-Bereich. Die wichtigsten
Institute, die den Fortschritt der Einführung von HDTV maßgeblich vorantreiben und in
regelmäßigen Abständen technische Empfehlungen zur Standardisierung aussprechen,
sollen hier kurz aufgeführt werden.
Die European Broadcasting Union (EBU) ist die weltweit größte Vereinigung öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten mit dem Sitz in der Schweiz. Vertreter Deutschlands sind ARD
und ZDF. Neben intereuropäischem Programmaustausch und Ko-Produktionen bietet die
EBU eine Reihe juristischer, technischer und betrieblicher Dienstleistungen [EBU07a]. Zur
Einführung und Standardisierung von HDTV wird unter anderem in der ,,Route Map to HD"
(EBU-Tech 3298) Stellung bezogen.
2 GRUNDLAGEN 14
Bei der International Telecommunication Union (ITU) handelt es sich um eine internationale
Organisation innerhalb der Vereinten Nationen. Arbeitsfeld sind globale Fragen der
Telekommunikation und des Broadcast-Bereichs.
In der Recommendation 709 hat sich die ITU bereits 1997 mit HDTV beschäftigt und sich auf
das so genannte Common Image Format (CIF) festgelegt, in dem man sich auf 1920 x 1080
als weltweites HD-Austauschformat geeinigt hat.
Zu den Mitgliedern der in den USA beheimateten ,,Society of Motion Picture and Television
Engineers" (SMPTE) zählen nahezu alle Herstellerfirmen im Bereich der Videotechnik. Die
SMPTE erarbeitet allgemein akzeptierte Standards für Film- und Fernsehen und gilt als
Dokumentationsinstanz.
Zuletzt sei noch das IRT (Institut für Rundfunktechnik) zu nennen. Dies ist das Forschungs-
und Entwicklungsinstitut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Das IRT beobachtet, untersucht und entwickelt neue
Techniken.
Wie man derzeit am Beispiel der Standardisierung und Einführung von HDTV erkennen
kann, fällt es nicht immer leicht, sich auf einen gemeinsamen Standard zu einigen. Oft
existieren zwei oder mehrere gleichbedeutende Standards oder die Institute empfehlen
verschiedene Systeme zur Implementierung [Schn07].
2.1.3 HDTV-Formate in Europa
Die analoge SDTV-Fernsehtechnik beruht in Europa auf den für Produktion und
Ausstrahlung einheitlichen Parametern von 625 Zeilen und 50 Hz (PAL, Secam). Auch die
digitalen Standards und Systeme richten sich nach diesen Basisgrößen. Im Gegensatz dazu
kann sich bei HDTV die Produktion von der Ausstrahlung unterscheiden. Es wurde jedoch
keine allgemeingültigen Standards ausgesprochen.
Die HD-Systeme werden in ihrer Zeilenzahl und der Bildwiederholrate unterschieden. Die
Zeilenzahl stellt die vertikale Bildauflösung dar, das Bild wird als Vollbild (progressiv, p) oder
im Zeilensprungverfahren (interlaced, i) aufgebaut. Die Bildwiederholrate gibt die Anzahl der
Bilder pro Sekunde, sie beträgt 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz oder 60Hz. In Europa sind aufgrund
hiesiger Stromnetzfrequenzen 25 und 50 Bilder pro Sekunde etabliert.
2 GRUNDLAGEN 15
In der Produktion kommt manchmal auch 24p zum Einsatz, ein Format, das von einigen
digitalen Filmkameras unterstützt wird. Es lässt sich zum Einen gut in das amerikanische 30p
konvertieren und eignet sich zum Anderen zur Ausspielung auf Filmmaterial, da ein
Filmprojektor ebenfalls 24 Vollbilder in der Sekunde abspielt.
Unser heutiger PAL-Standard beruht auf sukzessivem Bildaufbau. Zuerst werden alle Zeilen
mit einer geraden Zeilenzahl übertragen, im nächsten Bild alle Zeilen mit ungerader Zahl.
Diese Halbbilder werden zeitlich direkt hintereinander angezeigt, sodass sie in der
menschlichen Wahrnehmung zu einem Gesamtbild verschmelzen. Eingeführt wurde es zur
besseren Bewegungsauflösung bei gleicher Bandbreite. Bei diesem Verfahren kann es zu
Zeilen- bzw. Bildflimmern sowie zu Kantenflackern kommen. Darüber hinaus kann es bei
bewegten Objekten zu kammartigen Ausfransungen kommen, da das erste Halbbild zeitlich
vor dem zweiten abgetastet wird [Stoll05].
Der HDTV-Standard 1080/50i arbeitet zwar nach dem gleichen Halbbildverfahren wie der
PAL-Standard, erzeugt aber aufgrund der sehr viel höheren Auflösung (1080 statt 576
Zeilen) flimmerfreie Bilder. Dahingegen stellt 720/50p 50 Bilder in der Sekunde immer
komplett als Vollbild, also progressiv dar. Auch hierbei entstehen flimmerfreie Bilder.
Des Öfteren taucht in der Diskussion um HDTV-Standards die genrebedingte Formatwahl
auf. Am ,,filmnächsten" kommt demnach 1080/25p bzw. 24p. Für Sportsendungen wird
aufgrund schneller Bewegungen das Format 720/50p präferiert und für Studioproduktionen
sind beide, sowohl 1080/25p als auch 720/50p, im Gespräch. Mit dem Format 1080/50p
würden alle diese Genres abgedeckt [Hoff05].
HDTV Formate für die Produktion
Mit der Anmerkung, dass die Standards für Produktion und Ausstrahlung nicht zwangsläufig
identisch sein müssen, stellt die EBU in der Empfehlung ,,High Definition Image Formats for
Television Production Tech 3299" folgende vier HDTV-Systeme für die Produktion von
Fernsehbildern vor [EBU07b]:
System 1
720/50p
720 Zeilen, 50 Vollbilder pro Sekunde
System 2
1080/50i
1080 Zeilen, 50 Halbbilder pro Sekunde
System 3
1080/25p
1080 Zeilen, 25 Vollbilder pro Sekunde
System 4
1080/50p
1080 Zeilen, 50 Vollbilder pro Sekunde
Tabelle 1: HDTV Systeme nach EBU Tech 3299 (aus
[EBU07b])
.
2 GRUNDLAGEN 16
Diese Standards sind auch in den SMPTE Recommendations zu finden. Dabei spezifizieren
SMPTE 274M-2005 bzw. ITU-R BT.709 die 1080-Formate (sowohl interlaced als auch
progressiv) und SMPTE 296M-2001 das 720/50p-Format.
Das IRT argumentiert für zwei mögliche Standards nach vorher genannten genrebedingten
Überlegungen: 720/50p für Aufnahmen mit schnellen Bewegungen und 1080/25p für
szenische Aufnahmen [Hoff05] [Schn07].
HDTV Formate für die Ausstrahlung
Für die Emission hochauflösender Fernsehbilder in Europa empfiehlt die EBU den
progressiven Bildaufbau mit zunächst 720/50p und später 1080/50p. Einer der Gründe für
die sukzessive Einführung des 1080/50p Standards ist die nahezu doppelte Bandbreite im
Vergleich zum 720/50p Format, die heutzutage noch nicht bewältigt werden kann [EBU07c].
Die Argumente für die progressive Ausstrahlung ergeben sich aus folgenden technischen
Begebenheiten:
Auf Empfängerseite ist kein De-Interlacing (Konvertierung im Empfangssystem von
Zeilensprung auf Vollbild) aufgrund der weit verbreiteten HDTV-fähigen TFT- und Plasma-
Displays nötig, die grundsätzlich progressiv abbilden. Das De-Interlacing einer Produktion,
die im Zeilensprungverfahren aufgezeichnet wurde, kann auf einfachere und bessere Weise
im Sendestudio mit professioneller Ausstattung erfolgen. Des Weiteren lassen sich
progressive Signale effizienter komprimieren. Für die Übertragung wird dann eine geringere
Bandbreite benötigt.
Für die Wahl von 720p spricht außerdem, dass die Bildschirmdiagonale bei TV-Heimgeräten
meist nicht über 50 Zoll liegt. Eine Ausnutzung dieser Größe wäre mit einer Auflösung von
1280 x 720 Pixel durchaus ausreichend [EBU07c].
2 GRUNDLAGEN 17
2.2 Datenkompression und Videoformate
Sinn einer Datenkompression ist immer die Verringerung der Bandbreite zur
Datenübertragung und die Verkleinerung der Datenmenge, um Speicherplatz zu sparen.
Dies geschieht im besten Falle so, dass der einhergehende Qualitätsverlust möglichst gering
gehalten wird.
Es gibt mehrere Ansätze bei der Datenkompression. So können nur die Unterschiede
zwischen zwei aufeinander folgenden Datenblöcken codiert werden (Prediction) oder Teile
des Signals, die für das Ausgangssignal nicht von Bedeutung sind, werden selektiert und
gezielt weggelassen. Hier unterscheidet man zwischen der Redundanzreduktion, bei der
mehrfach vorhandene gleiche Information nicht mit übertragen wird und der
Irrelevanzreduktion, bei der unbedeutende Information, z.B. Töne im nicht hörbaren
Frequenzbereich, weggelassen werden. Dabei kann es zu verlustbehafteter oder nicht
verlustbehafteter Kompression kommen. Die Farbunterabtastung (auch Farbkodierung oder
Sub-Sampling genannt) ist ebenfalls eine Art der Kompression. Die Farbsignale werden
hierbei mit einer niedrigeren Rate abgetastet als das Helligkeitssignal [Holz00].
Die verschiedenen Videoformate unterscheiden sich in der Art ihrer Kompressionsverfahren
und darin, wie stark das Eingangssignal komprimiert wird.
In diesem Kapitel werden zunächst die Grundlagen der Kompressionsmethoden
beschrieben, die zur Codierung der für diese Arbeit relevanten Videoformate DVCPRO HD
und MPEG-2 dienen. Diese Videoformate sowie das Containerformat MXF werden im
Anschluss näher beleuchtet.
2.2.1 Diskrete Cosinus Transformation (DCT)
Laut Fourier kann jedes Signal aus einer Überlagerung einer Vielzahl von Cosinus- und
Sinuswellen betrachtet werden. Bei der DCT wird das eingehende Signal gespiegelt, was
dazu führt, dass nur noch Cosinus-Anteile im Signal enthalten sind [Thie05]. Diese
Bildsignale werden nun aus der zeitlichen Darstellung in eine Frequenzdarstellung überführt,
welche sich aus den Ortsfrequenzen in horizontaler und vertikaler Richtung zusammensetzt.
Das daraus entstandene Frequenzspektrum verhilft zu besseren Bearbeitungs- und
Kompressionsmöglichkeiten. Das Frequenzspektrum wird jedoch nicht von dem gesamten
Bild erstellt, sondern von 8 x 8 Pixel großen Blöcken des Bildes.
2 GRUNDLAGEN 18
Dabei wird jeder Pixel eines Blockes nach folgender Formel in einen
Transformationskoeffizenten umgewandelt:
Im transformierten 8 x 8 Block steht links oben der Gleichanteil (DC). Er repräsentiert den
mittleren Grauwert eines Blocks und ist von großer Bedeutung. Eine alleinige Übertragung
dieses Wertes würde schon das Originalbild in stark verkleinerter Auflösung ergeben.
Tiefe Ortsfrequenzen im transformierten Bild stehen für große Bildstrukturen, einheitliche
Flächen und langsame Helligkeitsübergänge, während hohe Frequenzen kleine Strukturen,
abrupte Übergänge und feine Farbauflösung widerspiegeln. In natürlichen Bildern kommen
grobe Strukturen sehr viel häufiger vor als feine.
Die horizontalen und vertikalen Frequenzen steigen nach links unten an. Weil diese
hochfrequenten AC-Anteile weniger stark vertreten sind und visuell weniger gut
wahrnehmbar sind, nehmen die Werte der Transformationskoeffizienten bei steigender
Frequenz ab, die Gewichtung der anteiligen Cosinusfrequenz sinkt also.
Die DCT ist bis hier verlustlos und vollständig reversibel. Um die transformierten Daten
effektiv zu reduzieren, werden sie nun quantisiert und dabei bewertet. Höherfrequente
Anteile können durch eine grobe Quantisierung auf Null gerundet und damit ganz
weggelassen werden.
In einem Bild mit einem großen Anteil hoher Frequenzen kann es vorkommen, dass in einem
Block mehrere Transformationskoeffizenten nicht zu Null werden, was zu einer höheren
Datenrate führt [Schm05].
2.2.2 Pulse Code Modulation
Die Pulse Code Modulation (PCM) wird sowohl im Video- als auch im Audiobereich genutzt
und stellt generell die Umwandlung analoger Signale in eine digitale Form dar.
Zunächst wird ein analoges Signal mit einer bestimmten Frequenz in zeitgleichen Abständen
abgetastet. Dabei werden die abgetasteten Amplitudenwerte in eine begrenzte Anzahl von
Quantisierungsstufen eingeteilt. Aus jedem quantisierten Wert wird ein Codewort berechnet,
2 GRUNDLAGEN 19
was die eindeutige Zuordnung der Daten garantiert und dem Fehlerschutz dient. Mit den
Zusatzdaten versehen, wird das Signal gespeichert oder übertragen.
Variationen der Datenreduktion ergeben sich dabei durch die gewählte Abtastrate und die
Quantisierungsstufen. Aus diesen Parametern resultieren auch die Datenrate und das
Quantisierungsrauschen des Signals.
Je nach Anwendung werden unterschiedliche Arten der PCM eingesetzt. So wird die lineare
PCM, bei der gleich große Quantisierungsschritte und eine hohe Auflösung angewandt
werden, bei der PCM-Audioaufzeichnung genutzt.
Die in der Videodatenkompression angewandte DPCM (Differential PCM) unterscheidet sich
von der herkömmlichen PCM dadurch, dass nicht der ganze binär codierte Wert gespeichert
wird, sondern nur die Differenz zum vorherigen. Dieses Vorgehen erlaubt weniger Bits und
damit eine höhere Kompression [Holz00].
2.2.3 DVCPRO HD
DVCPRO HD (auch D12 genannt) wurde von Panasonic zur Datenkompression für
professionelle Videoformate entwickelt. Mit diesem Standard hat Panasonic seine eigene
HD-Philosophie geschaffen und bewusst nicht beim von Canon, Sharp, Sony und JVC
entwickelten HDV mitgewirkt.
Grundlage dieser Kompressionsverfahren ist der DV-Standard, der 1994 zur Datenreduktion
für DV-Magnetbänder erarbeitet wurde und unter anderem die Formate DV, MiniDV,
DVCAM, Digital8, DVCPRO und DVCPRO HD umfasst.
Der DV-Algorithmus und somit auch DVCPRO HD arbeitet mit Intraframe-Codierung. Hierbei
wird jedes Bild einzeln codiert und bezieht sich nicht auf Nachbarbilder einer Sequenz. Die
Kompression der Einzelbilder wird mittels DCT mit anschließender Quantisierung erzielt.
Eine Redundanzreduktion erfolgt außerdem durch die Verfahren VLC (Variable Length
Coding variable Längencodierung) und RLE (Run-length Coding Lauflängencodierung)
[Schm05].
DVCPRO HD wird für die Datenreduktion von HD-Bildsignalen verwendet. Mit einer
Farbunterabtastung, die auf der 4:2:2 Struktur beruht, wird eine Komprimierungsrate von
1:6,7 erreicht.
2 GRUNDLAGEN 20
Bild 2: Farbkodierung DVCPRO HD (aus [Pana06]).
Hierbei wird das Helligkeitssignal (Y) mit 74,25 MHz und das Farbsignal (Cb/Cr) mit 37,125
MHz abgetastet. Gemäß 4:2:2-Farbabtastung wird jeder Abschnitt über vier Y-Abtastungen
mit je zwei Cb- und zwei Cr-Abtastungen verbunden [Pana06]. Dies entspricht bei der
Auflösung von 1920 x 1080 Pixel einem Verhältnis von Luminanz zu Farbdifferenzsignalen
von 1920:960:960. Wie folgt ergibt sich daraus mit einer Quantisierung von 10bit eine
Datenrate von:
74,25 MHz + (2 · 37,125 MHz) · 10bit = 1485 MHz/s = 1,485 Gbit/s
Bei diesem Signal handelt es sich um ein so genanntes HD-SDI-Signal. Für die
Aufzeichnung oder Ausgabe durchläuft das Signal bei einigen Kameras ein "Pre-Filtering",
entsprechend des aufzuzeichnenden HD-Formates [Ker07]. In Kapitel 3.3.2 wird unter
Signalverarbeitung der AG-HVX200 näher darauf eingegangen.
2 GRUNDLAGEN 21
2.2.4 HDV
Das Format HDV (High Definition Video) wurde 2003 von Sony, Canon, Sharp und JVC
entwickelt, um hochauflösende Videosignale auf herkömmliches DV-Band aufnehmen zu
können.
Um die HD-Signale - unterschieden wird zwischen den Signalen im Format 720p und 1080i -
auf DV-Bänder unterbringen zu können, wirkt eine starke Kompression im Verhältnis 1:18,
welche mit dem Verfahren MPEG-2 (siehe 2.2.5) erreicht wird. Für 720p ergibt sich eine
konstante Datenrate von 19Mbit/s, 1080i wird mit 25Mbit/s aufgezeichnet [HDV07].
Die Farbunterabtastung entspricht einer 4:2:0 Struktur. Hier ist die horizontale Auflösung
gleich der einer 4:2:2 Abtastung, die beiden Farbdifferenzsignale werden jedoch jeweils nur
in jeder zweiten Zeile digitalisiert. Durch diese Komprimierung sind die Möglichkeiten der
Bearbeitung des aufgezeichneten Signals, z.B. Farbkorrektur, eher eingeschränkt.
Bild 3: Farbkodierung HDV (aus [Pana06]).
2 GRUNDLAGEN 22
2.2.5 MPEG-2
Das Kürzel MPEG bedeutet Moving Picture Experts Group und steht für eine Gruppe von
Experten, die Standards für die Datenreduktion von Bewegtbildern erarbeiten. MPEG-
Standards gibt es in verschiedenen Stufen. MPEG-1 wurde hinsichtlich kleiner Datenraten
bis 1,5 Mbit/s entwickelt, MPEG-4 bezieht sich auf Interaktivität mit Bilddaten, bei MPEG-7
steht die Verwaltung von Videodaten im Vordergrund.
MPEG-2 stellt mit der Standardbezeichnung ISO/IEC 13818-1-3 die Weiterentwicklung von
MPEG-1 dar und gilt als Kompressionsstandard für Videosignale bis HDTV. Die folgenden
Erklärungen beziehen sich darum auf MPEG-2.
Die Codierung der audiovisuellen Daten beruht auf hybrider DCT. Hierbei handelt es sich um
eine Kombination von oben genannter DCT und DPCM, wobei sich erstere auf Ähnlichkeiten
innerhalb eines Bildes und die DPCM auf Ähnlichkeiten benachbarter Bilder beziehen.
Die weitere Komprimierung der Datenmenge geschieht durch die Farbunterabtastung.
MPEG-2 unterstützt dies in den Verhältnissen 4:2:0, 4:2:2 und 4:4:4.
Um verschiedenen Anwendungen und Anforderungen die beste Möglichkeit der
Datenkompression mittels MPEG-2 zu ermöglichen, gibt es eine Auswahl von so genannten
Profiles und Levels, die die Codierung skalierbar machen.
HDV arbeitet mit MP@H-14. Dabei werden wie in 2.2.4 aufgezeigt, Auflösungen von 1440 x
720 bzw. 1280 x 720 und ein Sub-Sampling im Verhältnis 4:2:0 verwendet.
XDCAM HD nutzt MPEG-2 MP@HL, von Sony MPEG HD genannt. Hier wird das Signal im
Verhältnis 4:2:0 abgetastet, mit 8 Bit quantisiert und durch Interframe-Codierung Long-GOP
komprimiert [Schm05].
Group of Pictures (GOP)
Während bei DV und DVCPRO HD alle Bilder eines Videostromes gleich codiert werden,
erlaubt MPEG zur Verarbeitung und Erzeugung kleinerer Datenmengen eine
Zusammenfassung einzelner Frames. Diese Reihe von Bildern nennt man GOP, wobei bei
MPEG-2 meist mit einer Anzahl von 12 Bildern gearbeitet wird (Long-GOP).
Der Einstieg einer GOP bildet das I-Frame (I = Intra), welches den gesamten Satz an
Bilddaten enthält und alleinstehend codiert wird. Darauf folgen P-Frames (P = Prediction) die
sich auf voranstehende I- oder P-Frames beziehen. Zwischen I- und P-Frames befinden sich
die B-Frames (B = Bi-directional). Sie beziehen sich sowohl auf ein vorhergehendes als auch
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (Paperback)
- 9783836605625
- ISBN (eBook)
- 9783956362880
- Dateigröße
- 2.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln – Medientechnik, Medien- und Phototechnik
- Erscheinungsdatum
- 2007 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- hdtv dokumentarfilm filmproduktion workflow panasonic
- Produktsicherheit
- Diplom.de