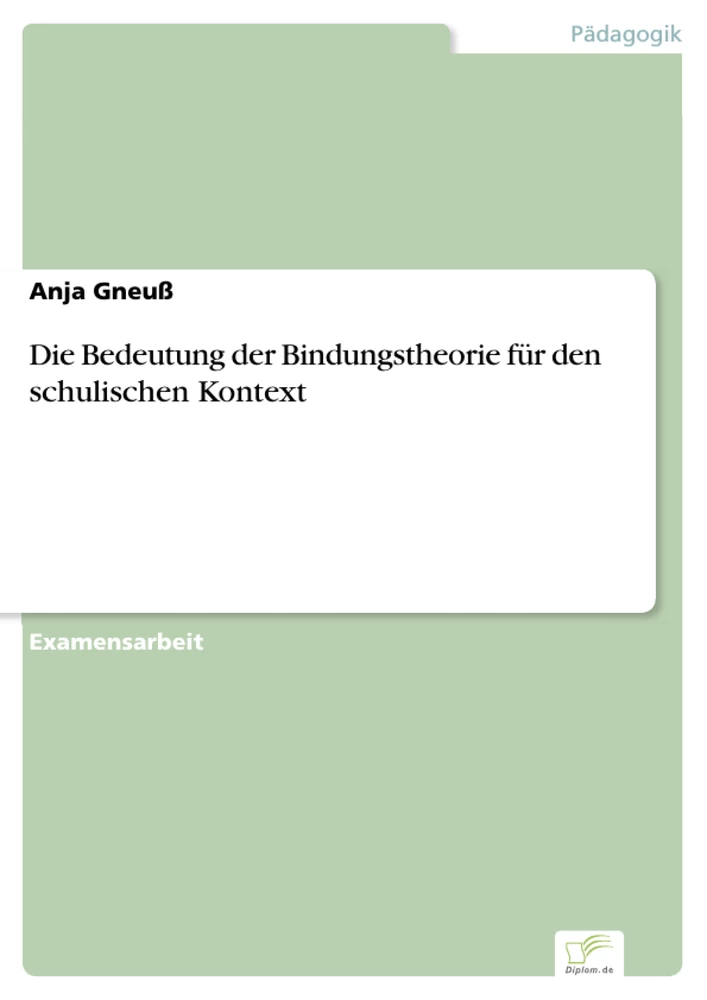Die Bedeutung der Bindungstheorie für den schulischen Kontext
Zusammenfassung
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der aktuellen Praxis und Forschung zeigen, dass sich Beziehungsstrukturen in den letzten 50 Jahren auf Grund einer veränderten Kindheit gewandelt haben. Populärwissenschaftler sprechen sogar von einem Beziehungsnotstand bzw. einer neuen Beziehungslosigkeit.
Wird der Blick auf die Medien gerichtet, so wird deutlich, dass vielfältige Erziehungsratgeber, Fernsehbeiträge und Theaterstücke wie z. B. die Supernanny, das Erziehungscamp oder das Hallenser Theaterarrangement Opferpopp Ausdruck dieser Beziehungslosigkeit sind.
Denn sie zeigen eine zunehmende Alltagsüberforderung und Erziehungsverunsicherung bei den Eltern auf. Sie veranschaulichen aber vor allem auch, dass Kinder und Jugendliche der heutigen Zeit häufig haltlos sind und stets nach Sicherheit, Liebe und nach ihrer eigenen Identität suchen. Sie fragen sich: Wer bin ich?, Wo gehöre ich hin?. Wer akzeptiert mich so wie ich bin?
Doch finden sie auf ihre Fragen oft keine Antworten, denn nur wenige oder gar keine Menschen fühlen sich für ihre Interessen, Probleme und Beziehungsbedürfnisse verantwortlich. Selbst Lehrer sind zunehmend hilflos und können mit den Problemen ihrer Schüler im sozialen und emotionalen Bereich nur schwer umgehen. Sie klagen über Disziplinprobleme und Gewalt in der Schule aber auch inneren Rückzug und Angst bei den Schülern. Nicht selten vermitteln sie auffällige Schüler schnell an den Schulpsychologen oder gar an eine andere Schule, an der der Schüler mit dem Stigma verhaltensauffällig bereits gekennzeichnet ist. Der Beziehungsaufbau gestaltet sich dann umso schwieriger, da von dem Schüler verlangt wird, dass er sich so schnell wie möglich an die neue Situation anpasst. Zudem soll er neue Beziehungen eingehen, obwohl er soeben erst einen oder mehrere Beziehungsabbrüche erfuhr.
Eigene Praxiserfahrungen bestätigen diese Ausführungen und bilden für mich den Grundstein dieser Arbeit. Denn sie zeigen eine persönliche Relevanz des Themas für meinen künftigen Beruf auf. Mehr denn je erscheint guter Unterricht von harmonischen Beziehungen zwischen allen Beteiligten der Institution Schule abhängig zu sein. Doch werden Lehrer nur ungenügend darauf vorbereitet, was es heißt, gute Beziehungen zu führen. An der Universität wird größtenteils nur eine Fachdidaktik angeboten. Wäre es aber nicht auch sinnvoll über eine Beziehungsdidaktik nachzudenken?
So belegen Ausführungen von Teuteberg die große Bedeutsamkeit einer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Problemlage: Die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen im 21. Jh. und deren Veränderung hinsichtlich bestimmter Beziehungsstrukturen
1.1 Beziehungen und Bindungen − Begriffliche Grundlagen
1.2 Fallbeispiel: Felix – „eine Kindheit zwischen den Stühlen“
1.3 Lebenswelt Familie
1.3.1 Die Bedeutung der Familie
1.3.2 Veränderungen im Familienbild
1.4 Lebenswelt Freizeit
1.5 Lebenswelt Peergruppe
1.5.1 Gleiche unter Gleichen – Begriffliche Grundlagen
1.5.2 Peerbeziehungen und deren Bedeutung
1.6 Zusammenfassung
1.7 Lebenswelt „Schule in den Antinomien der Moderne“ (Helsper 1990, S. 175)
1.7.1 „Pädagogik zwischen Autonomie und Zwang“ (ebd. 1995, S. 19)
1.7.2 „Pädagogisches Handeln in der Spannung von Organisation und Interaktion“ (ebd., S. 20)
1.7.3 Pädagogisches Handeln zwischen Nähe und Distanz
1.8 Zusammenfassung
2. Die Bindungstheorie
2.1 Theoretische Grundlagen
2.1.1 Grundlagen der Bindungstheorie
2.1.2 Die Entstehung einer Bindungsbeziehung und deren Entwicklung im Kindes- und Jugendalter
2.1.3 Innere Arbeitsmodelle
2.2 Konsolidierung der Bindungstheorie durch Mary Ainsworth et al.
2.2.1 Die „Fremde Situation“
2.2.2 Das Adult-Attachment-Interview (AAI)
2.2.3 Die Bindungstypen
2.2.3.1 Bindungssicheres Verhalten
2.2.3.2 Bindungsunsicheres Verhalten
2.3 Bindungstypen in der Schule zur Erziehungshilfe
2.4 Welche Faktoren üben Einfluss auf die Entwicklung unterschiedlicher Bindungstypen aus?
2.4.1 Feinfühligkeit der Bindungsperson
2.4.2 Das Temperament des Kindes
2.4.3 Kulturelle Einflüsse
2.4.4 Der Einfluss anderer Bezugspersonen
2.5 Stabilität und transgenerationale Weitergabe von Bindungstypen
2.6 Zusammenfassung
3.Gefühls- und Verhaltensstörungen als möglicher Ausdruck einer gestörten Bindungsbeziehung
3.1 Begriffliche Grundlagen
3.1.1 Zum Begriff der „Gefühls- und Verhaltensstörung“
3.1.2 Zum Begriff der „Bindungsstörung“
3.2 Typologie von Bindungsstörungen im Kindes- und Jugendalter
3.3 Konsequenzen von Bindungsunterschieden für die Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie für die Entwicklung der Emotionsregulation
3.4 Zusammenfassung
4.Bindungstheorie und „veränderte Kindheit“ – eine Herausforderung für Schule und Unterricht!?
4.1 Grundzüge einer Beziehungsdidaktik
4.2 „Die Schule als “Caring“-Community“ (Opp 1997, S. 146) − Aufgaben und Ziele der Schule (zur Erziehungshilfe) im Kontext der Bindungstheorie
4.3 Vom Ich und Du zum Wir als Team − Die Schulklasse als Lerngruppe und soziales Netzwerk
4.3.1 Lehrerinnen und Lehrer als Bezugspersonen und Beziehungsorganisatoren − Die Lehrer-Schüler-Beziehung aus bindungstheoretischer Sicht
4.3.1.1 Pädagogische Strategien für ambivalent gebundene Schüler
4.3.1.2 Pädagogische Strategien für vermeidend gebundene Schüler
4.3.2 Möglichkeiten des Beziehungslernens im Unterrichtsprozess
4.3.2.1 Alternative Lernformen
4.3.2.2 Regeln und Rituale
4.3.2.3 Pädagogisch-therapeutische Arbeitsformen
4.3.2.4 Peer-Education
4.4 Zusammenfassung
5. Schlussbetrachtungen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
Interviewausschnitte aus dem Separation Anxiety Test (SAT)
Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiel 3
Beispiel 4
Beispiel 5
Klassifikation von Bindungsstörungen im ICD-10
Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen (F91.1)
Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (F93.0)
Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters (F94.1)
Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung (F94.2)
Entspannungsgeschichte „Der Wüterich aus Knete“
Malspiel „Pinselkampf und Versöhnungsmalen“
Lied „Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand“
Eidesstattliche Erklärung
Einleitung
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der aktuellen Praxis und Forschung zeigen, dass sich Beziehungsstrukturen in den letzten 50 Jahren auf Grund einer „veränderten Kindheit“ gewandelt haben. Populärwissenschaftler[1] sprechen sogar von einem „Beziehungsnotstand“ bzw. einer neuen „Beziehungslosigkeit“ (vgl. Singerhoff 2000, S. 100).
Wird der Blick auf die Medien gerichtet, so wird deutlich, dass vielfältige Erziehungsratgeber, Fernsehbeiträge und Theaterstücke wie z. B. die ‚Supernanny’, das ‚Erziehungscamp’ oder das Hallenser Theaterarrangement ‚Opferpopp’ Ausdruck dieser „Beziehungslosigkeit“ sind. Denn sie zeigen eine zunehmende Alltagsüberforderung und Erziehungsverunsicherung bei den Eltern auf. Sie veranschaulichen aber vor allem auch, dass Kinder und Jugendliche der heutigen Zeit häufig haltlos sind und stets nach Sicherheit, Liebe und nach ihrer eigenen Identität suchen. Sie fragen sich: „Wer bin ich?“, „Wo gehöre ich hin?“ „Wer akzeptiert mich so wie ich bin?“ Doch finden sie auf ihre Fragen oft keine Antworten, denn nur wenige oder gar keine Menschen fühlen sich für ihre Interessen, Probleme und Beziehungsbedürfnisse verantwortlich. Selbst Lehrer sind zunehmend hilflos und können mit den Problemen ihrer Schüler im sozialen und emotionalen Bereich nur schwer umgehen. Sie klagen über Disziplinprobleme und Gewalt in der Schule aber auch inneren Rückzug und Angst bei den Schülern. Nicht selten vermitteln sie auffällige Schüler schnell an den Schulpsychologen oder gar an eine andere Schule, an der der Schüler mit dem Stigma „verhaltensauffällig“ bereits gekennzeichnet ist. Der Beziehungsaufbau gestaltet sich dann umso schwieriger, da von dem Schüler verlangt wird, dass er sich so schnell wie möglich an die neue Situation anpasst. Zudem soll er neue Beziehungen eingehen, obwohl er soeben erst einen oder mehrere Beziehungsabbrüche erfuhr.
Eigene Praxiserfahrungen bestätigen diese Ausführungen und bilden für mich den Grundstein dieser Arbeit. Denn sie zeigen eine persönliche Relevanz des Themas für meinen künftigen Beruf auf. Mehr denn je erscheint guter Unterricht von „harmonischen“ Beziehungen zwischen allen Beteiligten der Institution Schule abhängig zu sein. Doch werden Lehrer nur ungenügend darauf vorbereitet, was es heißt, gute Beziehungen zu führen. An der Universität wird größtenteils nur eine Fachdidaktik angeboten. Wäre es aber nicht auch sinnvoll über eine Beziehungsdidaktik nachzudenken?
So belegen Ausführungen von Teuteberg (1998) die große Bedeutsamkeit einer Beziehungsdidaktik. Denn seine Untersuchungen zeigen auf, dass jedes Individuum zuverlässige Bindungsbeziehungen benötigt, um sich gesund entwickeln zu können.
Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, war es notwendig, sich mit dem Konzept der Bindungstheorie von John Bowlby zu beschäftigen. Bowlby gehörte in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu den ersten, die auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit Waisenkindern und dem Hospitalismusphänomen[2] (Spitz 1945) erkannten, dass dem Säugling die Fähigkeit angeboren ist, sich auf soziale Beziehungen einzulassen. Ferner wies Bowlby konsequent darauf hin, dass ein Kleinkind das Bedürfnis hat, frühzeitig eine feste und sichere Bindung zu seiner Mutter aufzubauen. Kinder, die keine sichere Bindung aufbauen konnten, weil sie etwa von ihren Eltern getrennt waren, litten dagegen nicht weniger als Erwachsene unter intensiven psychischen Schmerzen wie Sehnsucht, Leid, Trauer, Apathie und Rückzug. Das Beschreiben der Folgen durch Deprivation[3] auf lange Sicht rundeten Bowlbys Forschungen schließlich ab. (vgl. Holmes 2002, S. 82; Julius 2001, S. 75; Seiffge-Krenke 2004, S. 56;)
Trotz großer Kritik seitens der Psychoanalytiker gelang es Mary Ainsworth in den folgenden Jahren die Thesen von Bowlby der empirischen Forschung zugänglich zu machen. Seitdem wuchs das Interesse an der Bindungsforschung und zahlreiche Studien wurden in der ganzen Welt eingeleitet. Wissenschaftler wie Main, Bretherton, Sroufe und Marris aus den USA, Parkes, Heard, Byng-Hall und Hinde aus Großbritannien sowie Spangler und die Grossmanns aus Deutschland haben die Bindungstheorie weiterentwickelt. (vgl. Holmes 2002, S. 15; Spangler 2002, S. 9)
Sie alle untersuchten oftmals mit eigenen Forschungsmethoden das Bindungsverhalten bzw. die Bindungsqualität sowie deren Ursachen und Auswirkungen in der entwicklungspsychologischen, frühpräventiven, therapeutischen und pädagogischen Praxis.
Die folgende Arbeit konzentriert sich primär auf Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen. Denn im pädagogischen Alltag zeigt sich, dass es diesen Schülern besonders schwer fällt, Beziehungen einzugehen und diese zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln.
Bezüglich dieser Thematik ergeben sich aus der Theorie und Praxis heraus folgende Fragestellungen:
1. Inwieweit können sich veränderte Lebenswelten und insbesondere frühkindliche Bindungserfahrungen auf das Beziehungsverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen auswirken?
2. Wie können Schule und Unterricht auf veränderte Beziehungsstrukturen, die aus den Lebenswelten resultieren, reagieren, und Bindungstypen[4] gegebenenfalls verändern? Geht doch die Theorie davon aus, dass Bindungstypen in ihrer Qualität über Generationen hinweg relativ konstant bleiben bzw. nur sehr schwer veränderbar sind. Mit welchen Problemen sieht sich Schule konfrontiert?
Daraus ableitend verfolgt die Arbeit das Ziel, die Ergebnisse der Bindungsforschung sowohl für Schüler als auch für Lehrer verwendbar zu machen. Ergebnis soll es sein, Möglichkeiten des Beziehungslernens im pädagogischen Alltag vorzustellen und zu diskutieren. Ferner sollen die Ausführungen dazu beitragen, dass Lehrer Bindungsunterschiede und deren mögliche Ursachen sowie Folgen für die Beziehungsgestaltung erkennen. Denn nur wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, können adäquate Interventionen entwickelt werden.
Das Einleitungskapitel stellt zunächst die Grundlage für diese Arbeit dar, denn es beschreibt die Bedeutung von Familien- und Peerbeziehungen sowie Chancen und Risiken des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in einer postmodernen Gesellschaft. Ziel soll es sein, anhand eines Fallbeispiels veränderte Beziehungsstrukturen und vor allem Grenzen des Beziehungsaufbaus in der Schule aufzuzeigen.
Im zweiten Kapitel stehen grundlegende Erkenntnisse der Bindungstheorie von Bowlby und Ainsworth im Mittelpunkt der Betrachtung. Auf der Grundlage von allgemeinen klassischen Methoden der Bindungsforschung und ihren Ergebnissen werden im Anschluss daran Bindungstypen von Schülern mit Gefühls- und Verhaltensstörungen reflektiert. Zudem werden Faktoren, die auf die Entwicklung einer sicheren bzw. unsicheren Bindungsbeziehung einen Einfluss ausüben genannt, sowie der Entwicklungsverlauf einer Bindungsbeziehung und deren Stabilität erläutert. Denn diese Kenntnisse sind notwendig für Pädagogen, die mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Anschließend wird im dritten Kapitel der Frage nachgegangen, welche Zusammenhänge zwischen einem unsicheren Bindungsmuster und einer Psychopathologie[5] bestehen. Die vorher angeführte Studie von Julius (2001) sowie eigene Beobachtungen, die aufzeigen, dass Schüler in der Schule zur Erziehungshilfe noch andere Bindungsmuster als die traditionellen nach Ainsworth zeigen, bilden den Ausgangspunkt. Infolgedessen wird der Blick auf verschiedene Bindungsstörungen gerichtet, bevor am Ende auf Konsequenzen unterschiedlicher Bindungsqualitäten für die Entwicklung aufmerksam gemacht wird. Vorrangig werden dabei Auswirkungen im sozialen Kompetenzbereich sowie in der Emotionsregulation beschrieben, da viele Schwierigkeiten bei Schülern mit Gefühls- und Verhaltensstörungen besonders in diesen Bereichen auftreten. Zudem stehen sie unmittelbar mit dem Beziehungsverhalten der Heranwachsenden in Verbindung.
Das abschließende Kapitel führt die Erkenntnisse der Bindungstheorie und -forschung sowie der „veränderten“ Lebenswelten zusammen. Entsprechend wird das Ziel verfolgt, auf der Grundlage einer Beziehungsdidaktik Aufgaben und Ziele einer Schule und ihrer Pädagogen im bindungstheoretischen Kontext zu beschreiben sowie beziehungsorientierte Interventionen im Hinblick auf Schule und Unterricht vorzustellen, zu entwickeln und zu hinterfragen.
1. Problemlage: Die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen im 21. Jh. und deren Veränderung hinsichtlich bestimmter Beziehungsstrukturen
Wird in der heutigen Zeit von veränderten Lebenswelten und Bedingungen des Heranwachsens gegenüber der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gesprochen, so wird häufig im Beziehungskontext auf das Aufwachsen in einer multikulturellen, modernisierten und individualisierten Gesellschaft verwiesen. (vgl. Gahrlichs/Bohleber 1999, S. 11)
Exemplarisch soll nach der begrifflichen Grundlegung ein Fallbeispiel aus der eigenen Praxis in die Thematik einführen und einige Veränderungen dieser Gesellschaft sowie ihre möglichen Folgen aufzeigen.
In den nachfolgenden Abschnitten des Kapitels erfolgt skizzenhaft eine entwicklungstheoretische Fundierung zusammenwirkender Sozialisationsinstanzen, die Beziehungsstrukturen verändert haben und immer noch verändern.
1.1 Beziehungen und Bindungen − Begriffliche Grundlagen
Der Terminus der Beziehung stellt in der Literatur einen Oberbegriff dar. Je nach Klassifikation wird auch von sozialen Beziehungen gesprochen.
Unter sozialen Beziehungen wird das Verhalten und Erleben verstanden, das zwischen zwei (oder mehreren) Personen stattfindet (vgl. Hofer 2002, S. 7). „Wichtige Merkmale von Beziehungen sind ein Minimum an Dauerhaftigkeit, Interaktionen, gegenseitige Erwartungen und Gefühle“ (vgl. ebd.).
Soziale Beziehungen werden u. a. wiederum unterteilt in soziale Interaktionen, funktionale Beziehungen und persönliche Beziehungen.
Von einer sozialen Interaktion wird gesprochen, wenn sich „zwei oder mehr Menschen in ihrem Handeln aufeinander beziehen, gleichgültig ob sie dabei eine Wirkung erzielen“ (Perrez, Huber/Geißler 2001, S. 359; zit. n. ebd.).
Funktionale Beziehungen bezeichnen dagegen Beziehungen, die sich aus wechselseitigen Rollenerwartungen ergeben. Auch Lehrer-Schüler-Beziehungen werden diesem Beziehungstyp zugeordnet. (vgl. Asendorpf/Banse 2000, S. 1)
Bei persönlichen Beziehungen spielen Rollenerwartungen dagegen eine geringere Rolle. Die Persönlichkeit sowie äußere Einflüsse bestimmen die Beziehung. (vgl. Asendorpf/Banse 2000, S. 8)
Bindung (attachment) wird von Bowlby dagegen verstanden als „[…] ein lang andauerndes affektives Band zu ganz bestimmten Personen, die nicht ohne weiteres auswechselbar sind, deren körperliche, psychische Nähe und Unterstützung gesucht wird, wenn z. B. Furcht, Trauer, Verunsicherung, Krankheit, Fremdheit usw. in einem Ausmaß erlebt werden, das nicht mehr selbständig regulierbar ist“ (Seiffge-Krenke 2004, S. 60).
Sie hat die Funktion, dem Menschen ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, wenn er unter emotionaler Belastung und bei erschöpften eigenen Ressourcen auf die Hilfe einer stärkeren und erfahreneren Person angewiesen ist. Nach Bowlby bleibt sie meistens ein ganzes Leben lang bestehen. (vgl. Bowlby 2003, S. 23; Grossmann/Grossmann 2003, S. 33)
Brisch führt weiter an, dass Bowlby die Interaktionspartner einer Beziehung − in Bowlbys Forschungsarbeiten geht es vorrangig um die Mutter und den Säugling − als Teilnehmer betrachtet, die sich in einem „wechselseitig bedingenden und selbstregulierenden System“ (Brisch 2003, S. 35) befinden. Innerhalb dieses Systems wird Bindung lediglich als ein Teil des komplexen Systems der Beziehung verstanden. (vgl. ebd.)
In der Konsequenz heißt das m. E., dass Bindungen ein Teil sozialer Beziehungen sein können aber nicht müssen. Zwei Arbeitskollegen haben beispielsweise eine kollegiale Beziehung zueinander. Sie müssen aber nicht aneinander gebunden sein.
Diese Unterscheidung wird in der Arbeit berücksichtigt. Die Termini „Bindung“ und „Bindungsbeziehung“ werden nur verwendet, wenn ausdrücklich Bindungen gemeint sind. Hingegen werden die Begriffe Bindungsperson und Bezugsperson synonym verwendet. Bezeichnet wird damit die Person, die mit dem Kind am häufigsten
sozial interagiert (vgl. Grossmann/Grossmann 2004, S. 71).
1.2 Fallbeispiel: Felix–„eine Kindheit zwischen den Stühlen“
In meinem Praktikum in der Schule zur Erziehungshilfe lernte ich Felix[6] − damals 7 Jahre alt − kennen. Bereits an der Schuleingangstür kam er mir am ersten Tag freundlich und lachend entgegen und umarmte mich sehr innig. Diese Begrüßung führte dazu,
dass ich mich von der Klasse und insbesondere von ihm sehr willkommen und angenommen fühlte. Doch sollte ich bald das Gegenteil erfahren. Der Unterricht war geprägt von zahlreichen und verzweifelten Versuchen des Schülers, eine Beziehung mit Hilfe von Unterrichtsstörungen und besonders über persönliche Provokationen aufzubauen. Sah ich in Felix einerseits einen sehr musikinteressierten, hilfsbereiten, freundlichen und lernwilligen Jungen mit einem besonders großen Bedürfnis nach Ruhe, Harmonie und emotionaler Zuwendung, begegnete er mir andererseits mit Wutanfällen, Beleidigungen, Regelverstößen sowie mit Fluchtverhalten (Gang zur Toilette während des Unterrichts, Rückzug unter den Tisch) und Autoaggressionen[7]. Im Extremfall schlug er seinen Kopf gegen die Wand. So zeigte sich im Verlauf ein sehr widersprüchliches und unvorhersehbares Verhalten, welches die Beziehung zu mir immer wieder auf die Probe stellte. Denn sie pendelte stets zwischen dem sehnsüchtigen Wunsch nach Nähe und Sicherheit einerseits und Ablehnung und Distanz andererseits. Auch zu seinen Mitschülern gestaltete sich die Beziehung schwierig. Seine Kommunikationsversuche beruhten häufig darauf, andere meist ohne ersichtlichen Grund zu ärgern. War er gewillt, in freundlicher Absicht Kontakte zu knüpfen, wurde er meistens abgelehnt. Diese Reaktion der Mitschüler führte wiederum dazu, dass Felix das Spiel der anderen störte bzw. zerstörte. Auswirkungen seines Verhaltens zeigten sich bei den Mitschülern dann in der Art und Weise, dass sie Felix zunehmend mieden und ihn zum Außenseiter machten. Äußerten sie ihm gegenüber Kritik, so konnte er nur schwer damit umgehen und wurde wütend auf die anderen oder auf sich selbst. Hatte er sich wieder beruhigt, suchte er die Geborgenheit bei den Erwachsenen, verleugnete den Konflikt und versuchte alles ungeschehen zu machen.
Doch warum handelte Felix so? Um ihn besser verstehen zu können, sprach ich sowohl mit ihm als auch mit den Lehrkräften und las die Schulakte. So ergab sich folgendes Bild von seiner Lebenswelt:
Felix war vier Jahre alt, als er das erste Mal zum stationären Aufenthalt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert wurde. Diagnostiziert wurden eine Hyperkinetisch-aggressive Gefühls- und Verhaltensstörung, eine seelische Behinderung sowie eine primäre Enuresis nocturna[8]. Zudem wurde sexueller Missbrauch vermutet.
Bisher wuchs Felix in einer Familie mit nur einem Elternteil auf. Der Vater, der laut Schulakte alkoholabhängig war, besaß kein Umgangsrecht und durfte seinen Sohn nicht besuchen. Seine Mutter war bereits während der Schwangerschaft mit der Pflege überfordert und suchte deshalb den Allgemeinen Sozialen Dienst auf und bat um Hilfe. Doch trotz der Hilfestellung war die Mutter nicht in der Lage, für Felix ausreichend zu sorgen. So kam Felix im Januar 2001 in eine Pflegefamilie und genoss dort eine sehr intensive Mutter-Kind-Beziehung. Zur Unterstützung der Familie sah das Jugendamt innerhalb des Hilfeplanes eine stationäre Therapie für Felix vor. Jedoch gingen die Pflegeeltern auf den „Therapievorschlag“ nicht ein, da sie anscheinend gut zu recht kamen. Doch im Herbst 2003 zeigte sich, dass auch sie mit der Betreuung und Pflege von Felix überfordert waren. Sie konnten mit dem Verhalten ihres Pflegesohnes nicht mehr umgehen, fühlten sich überlastet und hilflos. So wechselte Felix nach einem weiteren stationären Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erneut seine familiäre Umwelt und kam in ein Kinderheim. Einmal in 14 Tagen wurde er dort für ca. eine Stunde von seiner Pflegemutter besucht. Es zeigte sich jedoch, dass Felix sich nur zu Beginn des Besuches und besonders über Geschenke freute. Weiterhin erfolgte nach den ersten sechs Wochen in der ersten Klasse eine Umschulung in eine andere Grundschule. Seitdem lebt Felix in diesem Kinderheim und zeigt dort sowie in der Schule, die anlässlich mangelnder Stabilisation ein zweites Mal gewechselt wurde, aggressives wie auch autoaggressives Verhalten. So wirft er sich z. B. auf den Fußboden wenn sich seine Mitschüler streiten, verkrampft, hält sich die Ohren zu und beißt oder schlägt sich selbst. In diesen Situationen ist es dann sehr schwer, mit ihm in Kontakt zu treten. Auf direkte Ansprache sowie auf Körperkontakt reagiert er nicht mehr. Nur mit großem Krafteinsatz gelingt es dann den Pädagogen, ihn vor sich selbst zu schützen.
1.3 Lebenswelt Familie
Die Geschichte von Felix ist kein Einzelfall. Sowohl Beobachtungen in der Praxis als auch empirische Forschungsergebnisse (Julius 2001a) legen nahe, dass die meisten Schüler in der Schule zur Erziehungshilfe Probleme in der Beziehungsgestaltung haben. Zudem zeigt sich, dass diese Kinder in ihrer Kindheit oft unter Verlust-, Vernachlässigungs- sowie physischen und psychischen Gewalterfahrungen leiden (vgl. ebd.).
Nach den bisherigen Daten sind etwa zwei Drittel dieser Kinder Gewalt in Form von physischer Misshandlung oder sexuellen Übergriffen durch Familienangehörige ausgesetzt, ebenfalls etwa zwei Drittel werden von einem oder beiden Elternteilen durch Tod, Scheidung oder Heimeinweisung getrennt und annähernd 90% der Erziehungshilfeschüler werden von ihren primären Bezugspersonen emotional und/oder körperlich vernachlässigt (Julius 2001a).
Die Ergebnisse sind erschreckend und lösen Betroffenheit aus, denn sie zeigen, in welchem familiären Lebensumfeld sich Kinder und Jugendliche im 21. Jh. entwickeln. Spricht Wilk, angelehnt an Hurrelmann (1990) zunächst noch davon, dass es Kindern und Jugendlichen noch nie so gut ging wie heute (vgl. dies. 1994, S. 1), so lässt sich aus dieser Studie schlussfolgern, dass das soziale, körperliche und psychische Wohlbefinden keineswegs bei allen Kindern gewährleistet ist. In der Konsequenz führt Wilk, angelehnt an Hurrelmann (1990a) an, „[…] daß sich neuartige psychosoziale und somatische Krankheiten und Beschwerden feststellen lassen, die sich kaum mit der herkömmlichen medizinischen Klassifikation fassen lassen“ (dies. 1994, S. 1f.). Zudem zeigt sich, dass es nur einem Teil der Kinder und Jugendlichen gelingt, die Anforderungen des Lebensalltags in postmodernen Gesellschaften zu meistern (vgl. ebd., S. 2).
Manch Leser wird jetzt und in folgenden Ausführungen denken, dass die heutige Situation zu negativ, einseitig und pauschalisierend beschrieben wird. Dem möchte ich mich widersetzen und ausdrücklich darauf hinweisen, dass es ohne Zweifel viele Familien gibt, in denen sich Kinder und Jugendliche geliebt, angenommen, beschützt, versorgt und geborgen fühlen. In denen sichere Beziehungen und keine Gewalt eine Selbstverständlichkeit darstellen. Zudem gibt es viele Heranwachsende, die sich trotz einer unglücklichen Kindheit gut entwickeln und dem Leben gewachsen sind. Doch zeigen sich in der Praxis, sowie in der Studie von Julius (2001a) auch Lebenswelten, in denen Kinder und Jugendliche verzweifelt auf der Suche nach liebevollen und verlässlichen Beziehungen sind. Und genau diese Kinder und Jugendlichen stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Deshalb sei es mir verziehen, wenn positive Veränderungen und ihre Chancen gar nicht bzw. nur unzureichend erwähnt werden.
1.3.1 Die Bedeutung der Familie
Für viele Menschen stellt die Familie den bedeutsamsten Lebensbereich dar. Denn sie ist „[…] ein Ort, wo Beziehungen aufgebaut und gepflegt werden. Hier hört man sich zu, redet miteinander, sucht seinen Lebenssinn.“ (Hofer et al., 2002, S. 1) Sie bestimmt m. E. mehr als jeder andere Lebensbereich das Wohlbefinden des Individuums und entscheidet über dessen Entwicklung. Zudem wird ihr nach wie vor die Hauptverantwortlichkeit für die Sozialisation der in ihr lebenden Kinder und deren Bedürfnisbefriedigung zugeschrieben (vgl. Wilk/Beham 1994, S. 89). Sichtbar wird dies vor allem in der UN-Kinderrechtskonvention, wenn in der Präambel zum Ausdruck gebracht wird, „[…] daß das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen sollte“ (UN-Kinderrechtskonvention 1989). Die Familie ist demzufolge aufgefordert, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Weiterhin sollte sie einen adäquaten Raum während der verschiedenen Entwicklungsstadien des Kindes bereitstellen, in dem das Kind jene sozialen Kompetenzen erwerben kann, die es befähigen, zu einem autonomen Gesellschaftsmitglied zu werden. (vgl. Wilk/Beham 1994, S. 90)
Bedeutsam werden deshalb die Funktionen der familiären Bindungsbeziehungen, insbesondere die der Eltern-Kind-Beziehungen, der Geschwisterbeziehungen und der Verwandtschaftsbeziehungen.
Die erste Bindungsbeziehung, die ein Individuum in seinem Leben erfährt, ist die zur Mutter. In der Wissenschaft und besonders bei Bowlby stand sie lange Zeit im Mittelpunkt der Forschung. Heute wird dagegen auch die Bindungsbeziehung zwischen dem Vater und dem Kind näher beleuchtet und die Forschung kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder zu ihren Vätern ähnlich starke Bindungen aufbauen wie zu ihren Müttern (vgl. Schmidt-Denter/Spangler 2005, S. 435). Im Rahmen dieser Arbeit kann sie jedoch nicht näher betrachtet werden.
Die Bedeutung dieser Beziehungen liegt letztendlich darin, dass die Eltern die soziale Entwicklung ihres Kindes direkt aber auch indirekt beeinflussen, indem sie stärker als alle anderen Bezugspersonen eine Wächterfunktion ausüben. Gezielt können sie bestimmte Kontakte anbahnen aber auch verhindern. Weiterhin bestehen u. a. wesentliche Funktionen der Eltern-Kind-Beziehung neben der Bedürfnisbefriedigung darin, die Kinder in allen Lebenslagen zu unterstützen und zu beraten und auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes positiven Einfluss zu nehmen. (vgl. Hofer 2002, S. 11; Schmidt-Denter/Spangler 2005, S. 433)
Geschwisterbeziehungen werden in der Wissenschaft als besonders intensive und dauerhafte Erfahrungen beschrieben, in denen ebenso wie in Eltern-Kind-Beziehungen vielfältige soziale wie auch kognitive Kompetenzen erlernt werden. Demnach können Geschwisterbeziehungen u. a. ein Übungsfeld für Kontroll- und Regulationsmechanismen aggressiven Verhaltens sein. Anders als bei Eltern-Kind-Beziehungen oder Peerbeziehungen besteht hier aber nicht die Gefahr eines Beziehungsabbruchs. Geschwister können überdies eine Betreuungs- und Modellfunktion einnehmen sowie eine Koalition gegen die Eltern bilden, um ein stärkerer „Verhandlungspartner“ zu sein. Nicht zuletzt können sie unter bestimmten Bedingungen elterliche Defizite in der Betreuung und Bindung kompensieren und in Bezug auf Lebenskrisen der Heranwachsenden (z. B. bei der Scheidung der Eltern) protektiv[9] wirken, indem sie soziale Unterstützung bieten und einen Faktor innerfamiliärer Stabilität bilden. (vgl. ebd., S. 438f.)
Die Verwandtschaftsbeziehungen haben laut Schmidt-Denter Spangler dagegen eher eine emotionale als instrumentelle Funktion. Denn gegenüber Kindern nehmen sie nur selten die Erziehungsaufgabe wahr. Im Vordergrund steht vielmehr, besonders bei Paten, Onkel und Tanten, die keine Kinder haben, das Erfüllen kindlicher Wünsche, z. B. in Form von Geschenken oder Aktivitäten, die dem Kind ein Vergnügen bereiten. (vgl. ebd., S. 442)
Für Kinder sind diese familiären Beziehungserfahrungen besonders wichtig. Denn die Familie, so betont Wilk in Anlehn. an Schütz Luckmann (1975), ist „[…] die erste vorhandene faßbare Welt, die das Kind als solche wahrnimmt und internalisiert“ (dies. 1994, S. 89 in Anlehn. an Schütz Luckmann 1975).
1.3.2 Veränderungen im Familienbild
Die postmoderne Gesellschaft zeigt eine Pluralisierung von Lebensformen und Milieus auf. Besonders sichtbar wird dies in einer Vielzahl von familiären Lebensformen. Neben der klassischen vollständigen Kernfamilie mit Vater, Mutter und Kind, zeigen heute zunehmend Ein-Elternfamilien, Stieffamilien oder so genannte „Patchworkfamilien“, homosexuelle Elternfamilien und Wohngemeinschaften weitere Varianten von Familie auf. Inwieweit die Familienform jedoch einen Einfluss auf die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes hat, wird noch untersucht. Entscheidend scheint aber, laut Untersuchungen, besonders die Qualität der bestehenden Interaktionsbeziehungen zu sein. (vgl. Keupp 1996, S. 134; Wilk 1994, S. 6f.)
Doch scheint genau dort die Problematik zu liegen. Definierte sich die Familie früher noch als eine „[…] Gemeinschaft von Eltern und Kindern mit hoher Intimität und Exklusivität der Beziehungen und einem Spannungsfeld zwischen den Generationen“ (Seiffge-Krenke 2004, S. 156), so wird heute die Familie „[…] als eine sich ständig wandelnde und entwickelnde Einheit von Menschen verstanden, in der sich jeder Einzelne und die Familie als System immer neu an die Veränderungen einzelner, […] anzupassen haben“ (Tschöpe-Scheffler 1999, S. 113).
Hintergrund dieser Veränderung des Begriffs bildet der soziale Wandel, der sich in einem fortschreitenden Individualisierungsprozess zeigt (vgl. Seiffge-Krenke 2004 S. 156). War um 1800 der Mann für die Versorgung der Familie und die Frau für den Haushalt und die Kinder zuständig, gehört heute die Erwerbstätigkeit der Frau ebenso zum familiären Lebensalltag (vgl. Wilk/Beham 1994, S. 97). Die populärwissenschaftliche Literatur spricht in diesem Zusammenhang des Individualisierungsprozesses sogar von einer „Singularisierung“ oder von einer „Selbstverwirklichungssucht“ (vgl. Singerhoff 2000, S. 85). Das bedeutet, dass der Wunsch besteht, sein Leben so zu gestalten, wie man es sich persönlich vorstellt. Beziehungen bestehen in der Folge nur solange, wie der Partner bereit ist, die Interessen zu teilen und ihnen zu folgen. Werden dagegen eigene Wünsche dagegengesetzt und kommt es zu Konflikten, kann es schnell passieren, dass die Beziehung beendet wird. Beziehungen gelten demnach nur so lange als bewahrenswert, wie sie dem individuellen Wohl dienen. (vgl. ebd., S. 85f.)
Die Konsequenzen zeigen sich in einer zunehmenden Scheidungsrate. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben sich 201693 Paare im Jahr 2005 scheiden lassen, wo-raus 156 389 Scheidungskinder resultierten. Im Gegensatz dazu waren es z. B. 1991 nur 136 317 Scheidungen mit 99 268 Scheidungskindern. (vgl. Statistisches Bundesamt 2006) Die Folgen können für die Heranwachsenden sehr verheerend sein, denn sie müssen die Konsequenzen (mit)tragen. So stehen erhöhte Scheidungsraten eng im Zusammenhang mit der Auflösung von sozialen Beziehungen. Infolgedessen durchlebt der Heranwachsende oft eine Phase mit nur einem Elternteil, die von Leid, Traumatisierung und dem Gefühl, zwischen den Eltern hin und her gerissen zu sein, geprägt sein kann. Entsprechend leidet das Kind verständlicherweise unter dem Verlust des weggezogenen Elternteils aber auch unter der berufsbedingten oder emotionalen Abwesenheit des Elternteils, bei dem es nach der Scheidung lebt. Hinzukommen kann, dass sich die Familiensituation nochmals verändert, wenn ein neuer Stiefvater, eine neue Stiefmutter und eventuelle Stiefgeschwister in die Familie kommen. Erwartet wird dann, dass das Kind oder der Jugendliche bereit und fähig ist, sich an neue Familienstrukturen anzupassen und neue Beziehungen einzugehen. Vergessen wird dabei oft, dass das Kind oder der Jugendliche soeben eine wichtige Bezugsperson verloren hat. Hinzuweisen sei auch auf den Wohnungswechsel, der mit einer Scheidung meistens verbunden ist. Neben dem intakten Elternhaus verlieren Kinder und Jugendliche oft gleichzeitig ihr gewohntes Umfeld und ihre Freunde. (vgl. Pieper/Hurrelmann; http://www.cef.ev.de/ 27.4.2007)
In Anbetracht dieser Ausführungen ist es m. E. nachvollziehbar, dass Scheidungen bei Heranwachsenden zahlreiche Konsequenzen bewirken können. In der Literatur werden Beeinträchtigungen des psychischen und physischen Wohlbefindens, Existenzängste, zunehmende Orientierungs- und Haltlosigkeit, externalisierende[10] und internalisierende[11] Gefühls- und Verhaltensstörungen sowie Schul- und Leistungsprobleme und eine geringere Sozialkompetenz genannt. (vgl. Schneewind 1996, S. 166f.)
Bezüglich der Bindungsentwicklung im Lebenslauf ist hervorzuheben, dass das Scheidungsrisiko der Scheidungskinder extrem ansteigt. Als Ursache wird in der Literatur angeführt, dass sie vielfach Verhaltensweisen entwickeln, die im Erwachsenenalter eine Trennung begünstigen. So scheinen sie schneller feste Bindungsbeziehungen einzugehen. Gleichzeitig schrecken sie aber vor Faktoren zurück, die die Bindungsbeziehung stabilisieren könnten. Die Angst vor zuviel Nähe ist einfach zu groß, denn die Gefahr erhöht sich, erneut verletzt zu werden. (vgl. Singerhoff 2000, S. 88)
Weitere Konsequenzen einer Scheidung zeigen sich darin, dass die finanzielle und erzieherische Belastung für den allein erziehenden Elternteil höher wird, was wiederum bewirkt, dass sich Kinder und Jugendliche in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit einschränken müssen (vgl. ebd.). Damit eng verbunden ist das Leben in Armut. Demgemäß leben nach Pieper und Hurrelmann ca. ein Drittel der Familien mit nur einem Elternteil an oder unter der Armutsgrenze (vgl. dies.).
Hinzu können − unabhängig von einer Scheidung − Krankheit, Arbeitslosigkeit oder auch Suchtverhalten der Eltern kommen, welches oftmals dazu führt, dass Eltern selbst nach Halt und Orientierung suchen (vgl. Opp/Unger 2006, S. 28f.). Eigene Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass Eltern in solchen Situationen häufig so mit sich beschäftigt sind, dass sie immer weniger wissen, was ihre Kinder wirklich beschäftigt. Dabei wäre es m. E. so wichtig, besonders in schweren Krisenzeiten aber auch in jeglichen anderen Situationen lebendige Beziehungen zu gestalten, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen.
Lebendige Beziehungen zu gestalten heißt dabei vor allem, miteinander zu sprechen. Denn Sprache, so Watzlawick (1971) ermöglicht in der Familie Kooperation. Durch sie werden Beziehungsverhältnisse, Zuneigung und Ablehnung, Zusammengehörigkeit und Nähe ausgedrückt. Darüber hinaus konstruiert Sprache die Wirklichkeit mit, denn Erlebniswelten werden im Gespräch miteinander organisiert, kommuniziert und formuliert und die familiäre Wirklichkeit wird so zu einer gemeinsamen Wirklichkeit aller Familienmitglieder. (vgl. Wilk/Beham 1994, S. 113)
Doch anstatt mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen, sie mit einzubeziehen und nach ihren Gefühlen zu fragen, leiden sie stillschweigend unter den Lebensverhältnissen der Eltern mit. Sie werden mit ihren Problemen allein gelassen und sollen selbst die Verantwortung für ihr Leben tragen. (vgl. Singerhoff 2000, S. 101)
Besonders wichtig scheint in diesem Zusammenhang auch die psychologische Veränderung der Kinderrolle zu sein. So spricht Richter bereits 1963 in seinem Buch „Eltern-Kind-Neurose“ von typischen Rollen, zu denen Heranwachsende benutzt und gedrängt werden. Entsprechend kümmern sich z. B. die Kinder um ihre Eltern und nicht umgedreht, wie es eigentlich sein sollte. Allzu oft stellen sie aber auch den Ersatz für den fehlenden Ehepartner dar oder werden als Sündenbock oder ideales Selbst der Eltern gesehen. Die Folgen sind vielfältig und können sich in Entwicklungsbehinderungen und körperlichen sowie psychischen Symptomen zeigen. (vgl. Seiffge-Krenke 2004, S. 158)
Weitere Veränderungen spiegeln sich im Erziehungsprozess der Kinder bzw. im Erziehungsstil wieder. Aufgrund der wachsenden Anzahl erwerbstätiger Frauen, spielt der Vater zunehmend eine wichtige Rolle bei der Kindeserziehung und damit bei Interaktionsprozessen. Arbeiten beide Elternteile, so sind „Ersatzeltern“ wie z. B. die Tagesmutter oder die Kindergärtnerin weitere wichtige Bezugspersonen. Im Bezug dazu ist bedeutsam, das Wilk in Anlehn. an Rülcker (1990) darauf hinweist, dass Rollenveränderungen zu einer permanenten Gefährdung führen, was die Stabilität der Bezugsgruppe betrifft (vgl. Wilk 1994, S. 16).
Bezüglich des Erziehungsstils zeigt sich, dass dieser liberaler und offener geworden ist. Begründet wird dies in der Literatur oft mit den Erfahrungen der Eltern, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind und viel Strenge erfahren haben (vgl. Fölling-Albers 1992, S. 13).
Ein liberaler Erziehungsstil ist demnach m. E. eigentlich ein Fortschritt. Doch zeigt sich auch, dass Erziehungsnormen wie z. B. diszipliniert zu sein oder leise sein zu können heute in den Hintergrund rücken. Eher stehen Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit und Kreativität im Mittelpunkt der Erziehung. (vgl. ebd., S.13) Fölling-Albers hat in Anlehn. an Fend (1988) Büchner (1983) diese Entwicklung auf den Punkt gebracht, denn sie beschreibt den Wandel als einen Prozess „von der Erziehung zur Beziehung“ (dies. S. 14) bzw. als einen Prozess, der sich vom Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln vollzieht (vgl. ebd.). Meines Erachtens ein guter aber überdenkenswerter Ansatz, denn bei Gesprächen mit Eltern und Schülern zeigen sich die Folgen der großen Liberalität häufig in einem nachgiebigen Erziehungsstil, in dem oftmals nicht die Eltern ihre Kinder sondern die Kinder ihre Eltern erziehen. Zunehmend scheinen die Eltern überfordert und unsicher zu sein und im Alltagskampf zu resignieren. So zeigen eigene Beobachtungen auch, dass z. B. Rituale, welche dabei helfen können, den Familienalltag zu strukturieren, etwa durch Zeitmangel, Unfähigkeit oder fehlendem Interesse nicht aufrechterhalten werden können bzw. wollen. Infolge entwickeln sich Machtkämpfe.
In diesem Zusammenhang steht das Setzen von Grenzen in der Kindererziehung. Die Wissenschaft sowie die Praxis deuten darauf hin, dass es Eltern zunehmend schwerer fällt, Grenzen zu setzen und konsequent zu sein. Doch brauchen Kinder diese Grenzen damit der Weg in die Selbständigkeit gelingen kann. Tschöpe-Scheffler betont, dass Eltern jedoch zu schnell aufgeben, weil sie von den trotzigen und aggressiven Gegenreaktionen des Kindes genervt sind. Dabei sollte Trotz und Aggression ihrer Auffassung nach positiv verstanden werden, denn sie helfen dem Kind aus der vorherigen Bindungsphase heraus. Nur mit ihrer Hilfe können die Kinder lernen, sich durchzusetzen, Standpunkte zu verteidigen und auf Neues zuzugehen. Wird dagegen dem Kind grenzenlose Freiheit gewährt, so ist es mit der Orientierung in seiner Welt hilflos überfordert. (vgl. Tschöpe-Scheffler 1999, S. 89f.)
Neben dem nachgiebigen Erziehungsstil zeigt sich häufig auch ein vernachlässigender Erziehungsstil, bei dem emotionales Desinteresse am Kind und wenig Lenkung kombiniert werden. In jeder Hinsicht haben sich die Eltern bei diesem Erziehungsstil von ihrer Erziehungsaufgabe abgewandt. Demzufolge erfahren Kinder u. a. ein Mangel an Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit. Diese Erfahrungen wirken sich meistens lebenslang aus und beeinflussen, wie sich zeigen wird, das Bindungs-, Leistungs-, Beziehungs- und Sozialverhalten. (vgl. Singerhoff 2000, S. 63; s. Kap. 3.3)
Hingewiesen werden soll auch auf den autoritären Erziehungsstil, der m. E. trotz des Wandels zur größeren Liberalität immer noch eine bedeutsame Rolle spielt. Dementsprechend ist die Erziehung gekennzeichnet durch den Einsatz von Disziplinierungsmaßnahmen bzw. Machtmitteln (Drohung, Strafe, Zwang) mit denen Eltern ihre Vorstellungen durchsetzen wollen (vgl. Hofer 2002, S. 185).
Im Gegensatz zu angeführten Erziehungsstilen steht das überbehütende Erziehungsverhalten. Es bezeichnet „[…] eine übertriebene Zuwendung der Eltern zu ihrem Kind, die weit über das normale Maß hinausreicht (Ortner/Ortner 2000, S. 233). Unterschieden werden in der Literatur zwei Typen der Überbehütung, denen unterschiedliche Ursachen zu Grunde liegen. Bei der echten Überbesorgtheit stehen biologisch-hormonelle Faktoren der Mutter im Vordergrund. Bei dem zweiten Typ, der kompensierenden Überbehütung, versuchen die Eltern verdeckte bis ablehnende, bisweilen sogar feindliche Gefühle dem Kind gegenüber durch extreme Zuwendung und Besorgnis zu kompensieren. (vgl. ebd.) Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist oftmals die Verwöhnung des Kindes. In jeglicher Hinsicht werden die Aufgaben des Kindes, die es eigentlich schon selbst erledigen könnte, von den Eltern übernommen. Zudem erfolgt eine sofortige Triebbefriedigung. Das heißt, jegliche Wünsche werden erfüllt, bevor sie überhaupt ausgesprochen wurden. Die Kinder müssen sich nicht anstrengen. Triebverzicht und Triebaufschub können aber so nicht gelernt werden. Die Konsequenzen von Überbehütung und Verwöhnung können sich dann darin zeigen, dass der Heranwachsende ungewöhnlich hohe Ansprüche an seine Umwelt stellt (er verlangt immerzu Aufmerksamkeit und Hilfe), keine Entscheidungen treffen kann, weder Eigeninitiative noch Verantwortungsbewusstsein zeigt, eine geringe Frustrationstoleranz und ein mangelndes Selbstvertrauen ausbildet sowie ein unterwürfiges, passives und abhängiges Verhalten zeigt. Außerdem wird das Kind keinen Leistungsehrgeiz entwickeln, da es daran gewöhnt ist zu empfangen, ohne etwas dafür tun zu müssen. (vgl. ebd., S. 233f.; Singerhoff 2000, S. 9)
Ferner weist die Wissenschaft übereinstimmend darauf hin, dass sich Beziehungsnot auch in geringen Familiengrößen ausdrückt. Bedingt ist sie durch niedrige Geburtenzahlen, welche sich wiederum auch auf die Verwandtschaftsstruktur auswirken. (vgl. Schmidt-Denter/Spangler 2005, S. 442) So stellen Schmidt-Denter Spangler, angelehnt an Lange Lauterbach (1997) fest, dass Kinder in der heutigen Zeit weniger Tanten, Cousinen etc. haben als früher (vgl. ebd.). Auch die Anzahl der Geschwister ist weniger geworden. So ist in den letzten Jahren die Zahl der Familien mit drei oder vier Kindern zurückgegangen, während die Zahl der kinderlosen Paare zunahm. Demzufolge ist die Ein-Kind-Familie zur häufigsten Familienform geworden, was bedeutet, dass jedes zweite Kind ohne Geschwister aufwächst. (vgl. Hofer et al., 2002, S. 74ff.)
Vergegenwärtigt man sich die Bedeutung dieser Beziehungen (s. Kap. 1.3.1), so kann daraus m. E. geschlussfolgert werden, dass Heranwachsenden mögliche Beziehungen und deren Chancen sich gesund zu entwickeln, vorenthalten werden. Zudem fällt ein wesentlicher Teil des sozialen Unterstützungssystems weg, das Kindern und Jugendlichen besonders in Lebenskrisen Sicherheit und Geborgenheit geben kann.
Werden die Merkmale, die nur einen Ausschnitt der familiären Lebenswelt darstellen können, zusammengefasst, so kann von einer Krise der Familie gesprochen werden. Folglich stimme ich Opp zu, wenn er sagt, dass die Widersprüche, die zwischen partnerschaftlichen und erzieherischen Eigenansprüchen, aber auch beruflichen Erwartungen, entstehen, zu groß sind. (vgl. Opp/Unger 2006, S. 28)
Und zu gering bzw. auch zu ungleichmäßig verteilt ist oft die soziale Unterstützung, auf die sich die Familie bei der Bewältigung der Aufgabe für „[…] ihre Kinder all das zusammenzuhalten, was ‚in der Gesellschaft’ auseinander zu fallen droht“ (Krappmann 1999, S. 336; zit. n. ebd.) verlassen kann. Dementsprechend verfügen allzu häufig die Familien mit den größten Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung über die geringsten Ressourcen, um Herausforderungen lösen zu können. (vgl. ebd., S. 28f.)
1.4 Lebenswelt Freizeit
Begründet im familiären und gesellschaftlichen Wandel werden auch Veränderungen in der Wohnumwelt der Kinder sichtbar. Jene verlagerte sich in den letzten Jahren zunehmend in verkehrsgerechte städtische Regionen, was letztendlich zu Veränderungen im Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen führte. Trafen sich Kinder früher spontan nach der Schule auf der Straße, im Wald oder auf öffentlichen Plätzen um mit verschiedenen Kindern aus der Nachbarschaft zu spielen und um bestimmte Aktivitäten zu planen und auszuführen, so findet diese Form zumindest bei Kindern in städtischen Regionen kaum noch statt. Dementsprechend treffen sich Kinder und Jugendliche heute meistens an einem bestimmten Ort und mit bestimmten Personen, mit denen sie sich vorher in der Schule oder über Telefon verabredet haben. (vgl. Fölling-Albers 1992, S. 12)
Im Folgenden reflektiere ich diese Wandlung in meinem Umfeld. Es zeigt sich hinsichtlich veränderter Beziehungsstrukturen, dass sich Kinder und Jugendliche ihre Freunde heute stärker selbst auswählen können. Vor allem geschieht dies in institutionalisierten Freizeitaktivitäten, welche mit dem Wandel ebenso einhergehen. So findet man Kinder beispielsweise im Ballettunterricht, beim Volleyballtraining, im Flötenkurs, beim Bastelnachmittag oder beim Kochkurs. Ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche sind besonders der Jugendtreff oder die Diskothek. Auf den ersten Blick sieht dieser Wandel m. E. positiv aus, denn Kindern und Jugendlichen werden zahlreiche Möglichkeiten geboten, ihre Freizeit und damit auch ihre Beziehungen zu gestalten. Jedoch zeigen eigene Beobachtungen und wissenschaftliche Erkenntnisse (Fölling-Albers 1992) auch, dass viele Kinder bereits im Grundschulalter einen überfüllten Terminkalender und damit nur noch wenig Zeit für sich haben. Auch werden Freizeitaktivitäten oft zu anspruchsvollen Tätigkeiten, die einen hohen Leistungsanspruch an das Kind stellen. Stress ist oftmals die Folge, denn den Heranwachsenden fehlt die Zeit zum Abschalten, Träumen und Spielen. In der Konsequenz werden diese Kompetenzen dann auch häufig verlernt (vgl. ebd.; Singerhoff 2000, S. 67).
Hurrelmann und Pieper fügen bezüglich veränderter Beziehungsstrukturen hinzu, dass institutionalisierte Freizeitangebote dazu führen, dass Freundschaften an eine bestimmte Funktion geknüpft sind. Dementsprechend bilden sich nur oberflächliche Bekanntschaften, da Freizeitaktivitäten häufig an verschiedenen Orten stattfinden und zeitlich begrenzt sind. Besteht das Bedürfnis, jemanden näher kennen zu lernen, so müssen Kinder und Jugendliche großes Interesse zeigen und sie müssen bereit sein, viel Zeit für die Beziehungspflege zu opfern. Kann diese Beziehungsarbeit nicht geleistet werden, was u. a. auch abhängig ist von den sozialen Kompetenzen der Kontaktpflege, bleiben die Bekanntschaften unverbindlich und können beliebig ersetzt werden. (vgl. dies.)
Fölling-Albers führt weiter an, dass sich Auswirkungen dieses Massenangebots an Freizeitaktivitäten auch in der Schule zeigen können. So vergrößern die Kinder ihre Lern- und Beziehungserfahrungen, wenn sie vielfältige Freizeitangebote wahrnehmen. Schüler, deren Eltern beispielsweise weniger Geld haben, müssen dagegen auf soziale Kontakte, welche Freizeitangebote bieten können, verzichten. Die Konsequenz, so führt Fölling-Albers an, dürfte die Ausweitung der ‚Entwicklungsschere’ sein. (vgl. Fölling-Albers 1992, S. 12)
Bezüglich des Freizeitverhaltens soll in Bezug auf soziale Beziehungen auch kurz auf die Vielzahl von Medien hingewiesen werden, die Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen und dazu führen können, dass soziale Beziehungen eine immer unwichtigere Rolle spielen. Entsprechend führen Computer, Fernseher, Spielkonsolen etc. dazu, dass Kinder und Jugendliche sich auch mit sich allein beschäftigen können. Auf Spielpartner oder auf eigene Spielinitiativen sind sie infolgedessen nicht mehr angewiesen. (vgl. ebd., S. 12f.) Das Zurückziehen in die eigene Welt kann meiner Vermutung nach dadurch begünstigt und vorangetrieben werden und führt möglicherweise dazu, dass sich Schüler immer mehr zurückziehen und verschließen.
1.5 Lebenswelt Peergruppe
„Nur durch die gegenseitige Wirkung der Menschen aufeinander erneuern sich die Gefühle und die Gedanken, weitet sich das Herz und entfaltet sich der Geist des Menschen“ (Alexis de Tocqueville (1987); zit. n. Opp/Unger 2006, S. 17).
1.5.1 Gleiche unter Gleichen – Begriffliche Grundlagen
In der deutschsprachigen Literatur wird der Begriff „Peers“ häufig mit dem Begriff der Gleichaltrigen übersetzt. Dies ist jedoch nur annähernd richtig, denn der Terminus „peer“ leitet sich ursprünglich von dem lat. Wort „par“ bzw. „paris“ ab und wird übersetzt mit „gleich“, „Gleichrangige“ oder „Ebenbürtige“ (vgl. ebd., S. 13). Demgemäß sind nach Opp Unger die Peers diejenigen, denen sich Kinder und Jugendliche zugehörig fühlen und in deren Gemeinschaft sie gleichrangig sind, wobei Zugehörigkeit nicht zwingend bedeutet, in der Gruppe Fürsorglichkeit zu erfahren. Vielmehr besteht eine zentrale Aufgabe der Heranwachsenden darin, die eigene persönliche Identität erst zu entwickeln und enge Beziehungen zu Peers zu knüpfen. (vgl. ebd.)
Im Hinblick dessen wird in dieser Arbeit der Begriff der „Peers“ benutzt. Er schließt Gleichaltrige mit ein, geht aber auch darüber hinaus.
1.5.2 Peerbeziehungen und deren Bedeutung
Trotz der angeführten Begriffsklärung ist es m. E. dennoch schwer, die Beziehung zwischen Peers genau zu definieren. Denn sie schließt ein weites Spektrum von Beziehungsformen ein, die nach Intensität und Kontinuität sowie nach der Anzahl der Personen variieren kann.
Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Aussagen und besonders in Bezug auf die Schulklasse werden die Klassifikationen von Oswald (1993) Oerter (1995a) kurz angeführt.
Unterschieden werden Beziehungen jeweils auf drei Ebenen, wobei Oswald Typen von sozialen Beziehungen im Kindesalter und Oerter Formationen im Jugendalter beschreibt. Gleich ist allen Ebenen, dass sie auf Freiwilligkeit beruhen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Ebenen von sozialen Peerbeziehungen im Kindes- und Jugendalter
Die folgenden Darstellungen konzentrieren sich auf Peerbeziehungen, welche in den ersten zwei Ebenen angesiedelt sind. Wird von Peers als Freunden gesprochen, so sind Beziehungen unterschiedlicher Nähe gemeint. Sie schließen demnach Bekannte mit ein. Wird im Kontext der Schule von der Schulklasse als Peergruppe gesprochen, so ist zu bedenken, dass sie im strengen Sinn keine Peergruppe darstellt. So führt Oswald an, dass die Schulklasse, im Gegensatz zur „echten“ Peergruppe, keinen freiwilligen Zusammenschluss bildet, unter der Leitung eines Erwachsenen steht und durch Notengebung eine Hierarchie erzeugt. Anders als in freiwilligen Gruppen kann auch die Zugehörigkeit nicht gekündigt werden. Dennoch besitzt sie nach Oswald Gruppencharakter. Denn Schüler sprechen häufig über Peerprobleme, von denen Lehrer meist nur wenig wissen und bei deren Lösung sie auch nicht um Hilfe gebeten werden. (vgl. Oswald 2006, S. 235) Infolgedessen soll die Schulklasse als Peergruppe betrachtet werden.
Im Kapitel 1.3.1 wurden bereits Funktionen von familiären Beziehungen beschrieben. Ebenso können Peerbeziehungen vielfältige positive Funktionen besitzen, die sich weitestgehend drei zusammenhängenden Bereichen zuordnen lassen:
1. Peerbeziehungen tragen zu einem psychischen Wohlbefinden bei. „So profitieren Menschen verschiedener Altersgruppen in ihrem Selbstwertgefühl und der Lebenszufriedenheit von dem Gefühl, in einer Freundschaft emotional geborgen zu sein und verstanden zu werden, von dem Schutz, den eine Clique bieten kann, und von der Anerkennung durch die anderen Mitglieder“ (Noack 2002, S. 146).
2. Peerbeziehungen haben eine Unterstützungsfunktion. Demgemäß können sie bei der Bewältigung von Problemen und Belastungen hilfreich sein, indem sie dem Betroffenen auf freiwilliger Basis die Möglichkeit geben, sich auszusprechen. Emotionaler Zuspruch kann so gewährt werden, weil man z. B. als Freund für den anderen da ist, zuhört und das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. Aber auch finanzielle oder materielle Hilfen etc. können eine Form der Unterstützung darstellen. (vgl. ebd., S. 147)
3. Peerbeziehungen haben eine Bedeutung für die Entwicklungsförderung des Menschen. Entsprechend bieten sie ein Übungsfeld, auf dem gelernt werden kann, Beziehungen herzustellen und aufrechtzuerhalten, Rollen auszuhandeln und ungleiche Interessen zu balancieren. (vgl. ebd.) Des Weiteren tragen sie zur Entwicklung sozialer Identität bei, haben Normen sozialen Verhaltens gemeinsam und bilden soziale Strukturen (vgl. Petermann et al., 1998, S. 162).
Peerbeziehungen können aber auch eine Quelle von Stress sein, sowie eine Gefahr darstellen. In Bezug auf die Peerbeziehung als Stressquelle kann in der Praxis reflektiert werden, dass Heranwachsende unterschiedliche soziale Rollen einnehmen. Demgemäß gibt es beispielsweise in jeder Klasse meistens einen Klassenclown, einen Streber, einen Angeber, einen Narzissten, einen Star, einen Außenseiter, einen Lehrerliebling etc. Entsprechend gibt es beliebte Kinder, aber auch Kinder, die weniger gemocht oder gar ganz abgelehnt werden. In den Klassen der Schule zur Erziehungshilfe wird in Beobachtungen ganz oft Ablehnung sichtbar, die in offener Zurückweisung oder Vernachlässigung bzw. Ignoranz auch auf Seiten der Lehrer zum Ausdruck kommt. Infolgedessen machen die Kinder und Jugendlichen auf sich aufmerksam. So verhalten sich vernachlässigte Schüler schüchtern, ängstlich und häufig hypersensibel, wogegen Schüler wie Felix streitsüchtiges und aggressives Verhalten zeigen und massiv den Unterricht stören, weil sie meinen, Zuwendung nicht anders erreichen zu können.
Eine Erklärung für derartiges Verhalten liefert die Bindungstheorie (s. Kap. 2), die im Sinne Bowlbys und Ainsworths davon ausgeht, dass abweichendes Verhalten durch fehlende Feinfühligkeit seitens der Bezugspersonen entstehen kann (s. Kap 2.4.1).
Unverkennbar ist jedoch, dass Ablehnung einsam und unzufrieden macht und dazu führen kann, dass Kinder und Jugendliche resignieren. Und leider bestätigt dies auch zunehmend die Realität. Kinder und Jugendliche geben sich auf. Sie hängen gelangweilt auf der Straße herum, sehen für sich keine Zukunftsperspektive, betrinken sich und versuchen mit dem, was sie haben irgendwie zurechtzukommen. Und sie werden „hart“ gegenüber sich selbst und der Welt. (vgl. Opp/Unger 2006, S. 37)
So entgegnete mir erst vor kurzem ein Schüler, als ich ihn fragte, welche Bedeutung Freunde für ihn haben: „Ich habe und ich brauche keine Freunde. In meinem ganzen Leben musste ich allein klar kommen. Keiner hat mir geholfen. Wozu sollte ich jetzt Freunde brauchen?“ (Fabian, 8. Klasse, Schule für Erziehungshilfe) Für viele ist eine derartige Aussage sicher unverständlich, denn die meisten Menschen können sich ein Leben ohne Freunde kaum vorstellen. Und ich behaupte auch, dass sich dieser Schüler ebenso Freunde wünscht. Nur besteht wahrscheinlich auf Grund mangelnder Beziehungserfahrungen die Unfähigkeit, Freundschaften zu knüpfen bzw. besteht die Angst erneut abgelehnt zu werden. Infolgedessen wird das Bedürfnis nach Nähe abgewertet und als nicht so wichtig angesehen. Die Kinder und Jugendlichen sagen sich und der Umwelt, dass sie mit ihrem Leben ‚klar’ kommen und das sie es schon irgendwie bewältigen werden Doch kommen sie oft verständlicherweise mit ihrem Leben nicht zurecht. Die Bindungsforschung hat es zahlreich belegt: Menschen brauchen zuverlässige Bindungen um sich gesund entwickeln zu können. Und so passiert es häufig, dass diese Kinder und Jugendlichen ihre Bindungsbedürfnisse in Peergruppen befriedigen, die eine Gefahr für die weitere Entwicklung darstellen. Opp bezeichnet diese Gruppen auch als „Schicksalsgemeinschaften“, die sich aus Ausgrenzungserfahrungen in anderen Lebensbereichen ergeben (Opp/Unger 2006, S. 36f.). Sie stellen für die Kinder und Jugendlichen eine Art Ersatzfamilie dar, denn sie bietet Geborgenheit, Zuwendung und Anerkennung (vgl. ebd., S. 37).
Doch lernt man „[…] von den Gleichaltrigen […] nicht nur Gutes. Peerbeziehungen und Peergroups bilden auch Kontexte abweichenden Verhaltens. Der meiste Unfug und auch ernste Normübertretungen von Kindern und Jugendlichen geschehen in Gruppenzusammenhängen“ (Oswald 2005, S. 236).
Besonders riskant werden diese Beziehungen, wenn Drogen oder gewalttätige und delinquente Aktivitäten im Mittelpunkt stehen (vgl. Opp/Unger 2006, S. 36). Meiner Schlussfolgerung nach entstehen Anerkennung und positive Selbstaufwertung demnach nur, wenn das Peermitglied beispielsweise Mutproben im Sinne von Diebstahl, Vandalismus etc. erfolgreich bewältigt.
Oswald (1992) vermutet, dass sich besonders dann Heranwachsende negativen Peergruppen anschließen, wenn gestörte Eltern-Kind-Beziehungen vorliegen. Mit dieser Vermutung kann erneut ein Zusammenhang zur Bindungstheorie hergestellt werden. Denn im Sinne von Bowlby vermutet die Forschung, dass es sich bei gestörten Eltern-Kind-Beziehungen um Bindungsprobleme handeln könnte, die bis in die frühe Kindheit zurückreichen. (vgl. dies. 2005, S. 237; s. Kap. 2)
1.6 Zusammenfassung
Ohne Zweifel zeigen vorangegangene Ausführungen, dass Kinder und Jugendliche zum Erwachsenwerden nahe und vertraute Bindungsbeziehungen benötigen. Sie brauchen Menschen, die sich Zeit für sie nehmen, ihre Bedürfnisse beachten und ihnen durch Verlässlichkeit Sicherheit bieten.
[...]
[1] Für eine einfachere Lesbarkeit des Textes wird durchgängig in der männlichen Form von Lehrern, Schülern, Pädagogen, etc. gesprochen. Selbstverständlich sind damit auch weibliche Personen, also Lehrerinnen, Schülerinnen, Pädagoginnen, etc. gemeint.
[2] Hospitalismus : Zusammenfassende Bez. für alle durch bzw. während eines Krankenhaus- oder Heimaufenthalts auftretenden Schädigungen; z. B. durch Pflege- oder Ernährungsfehler, sekundäre Infektionen oder psychische Einwirkungen; Formen: infektiöser Hospitalismus (Bezeichnung für alle in Krankenhäusern, Arztpraxen und anderen Behandlungseinrichtungen erworbenen Infektionen) und psychischer Hospitalismus (psychische Schädigung, die infolge fehlender affektiver Zuwendung auftritt → s. Deprivation. Symptome: Angst, Apathie, Kontaktstörungen, erhöhte Infektanfälligkeit und Mortalität (Sterblichkeit) (vgl. Pschyrembel 1994, S. 661; 992)
[3] Deprivation : 1. allg. Bez. für Entbehrung oder Mangel (im Text: Mangel an mütterlicher Zuwendung); 2. (psychol.) Bez. für fehlende oder unzureichende körperliche bzw. affektive Zuwendung, die v. a. in den ersten Lj. zu anaklitischer Depression (depressives Syndrom, das bei Säuglingen infolge von Trennung durch die Bezugsperson auftritt [Spitz]), psychomotorischer Retardierung (allg. Bez. für Verzögerung oder Verlangsamung einer Bewegung oder Entwicklung) oder zu psychischem Hospitalismus (s. Hospitalismus) führen kann. (vgl. ebd., S. 311f.; 1322)
[4] Die Begriffe „Bindungstypen“ und „Bindungsmuster“ werden in der Arbeit synonym gebraucht.
[5] Psychopathologie: Lehre von den psychischen Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten des Menschen, sofern diese als abweichend oder pathologisch (krankhaft) angesehen werden; sie umfasst die Beschreibung, Klassifikation und sinnhafte Bewertung der Störungen von Bewusstsein, Denken, Orientierung, Affekt, Ich-Erleben, Wahrnehmung, Antrieb, Persönlichkeit und Verhalten unter der Berücksichtigung des somatischen Befundes und des kulturellen und sozialen Kontexts. (vgl. Pschyrembel 1994, S. 1264)
[6] Alle Namen wurden geändert.
[7] Autoaggression: Gegen das Individuum selbst gerichtete Aggression mit selbstzerstörendem Charakter (vgl. Pschyrembel 1994, S. 142).
[8] primäre Enuresis nocturna : Bettnässen; überwiegend nachts (E. nocturna); nicht nur sporadisch auftretende unwillkürliche Blasenentleerung nach dem vollendetem vierten Lj.; eine primäre E. ist gegeben, wenn das Kind nie „trocken“ war; Ursache: oft psychische (Überforderungs-) Reaktion z. B. bei Milieuwechsel, nach der Geburt von Geschwistern, Ehescheidung der Eltern; bei primärer Enuresis auch organische Erkrankung möglich. (vgl. ebd., S. 410)
[9] protektiv: schützend, begünstigend
[10] externalisierende Störungen : „nach außen gerichtete, störende Verhaltensweisen, z. B. Aggressionen“ (Hillenbrand 2006, S. 225).
[11] i nternalisierende Störungen : „nach innen gerichtete, störende Verhaltensweisen, z. B. Angst“ (ebd., S. 226)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836605380
- DOI
- 10.3239/9783836605380
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – Erziehungswissenschaften, Institut für Rehabilitationspädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2007 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- bindung lebenswelten verhaltensstörung lehrer-schüler-beziehung beziehungslernen
- Produktsicherheit
- Diplom.de