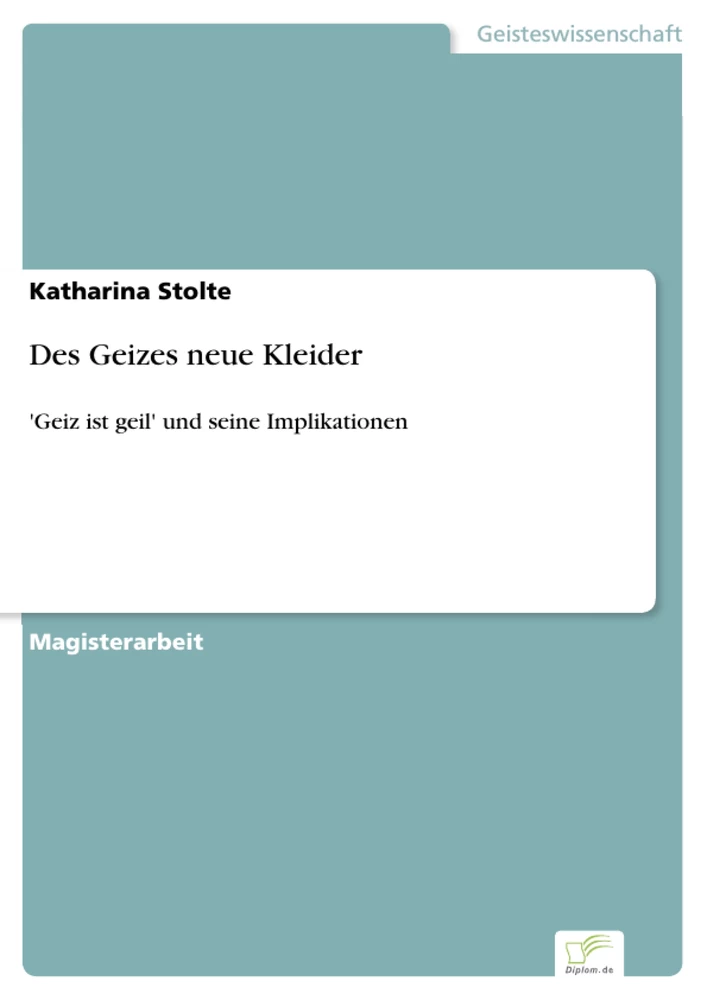Des Geizes neue Kleider
'Geiz ist geil' und seine Implikationen
©2006
Magisterarbeit
105 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Werbeagentur Jung von Matt hat für die Saturngruppe einen neuen Slogan kreiert, der binnen kürzester Zeit in aller Munde war: Geiz ist geil.
Geiz ist geil hört und liest man fast überall. Einerseits hat der Werbespruch einen ungeheuren Erfolg. Andere Unternehmen springen auf den Geiz-Zug mit auf. Es eröffnen Billigkaufhäuser mit Namen wie beispielsweise Mäc-Geiz in vielen Städten und Geiz wird im Kontext von Wirtschaft und Werbung plötzlich zu einem häufig gebrauchten Begriff. Andererseits ist er ein Ärgernis. Die Feuilletons aller namhaften Zeitungen sind voll der moralischen Entrüstung darüber, wie man die Untugend Geiz zu solch Ehren gelangen lassen konnte.
In dieser Arbeit wird zunächst der Frage nachgegangen, was denn Geiz eigentlich ist, was ihn zum Beispiel von der Sparsamkeit unterscheidet. Anschließend wird geklärt, welche Folgen der Geiz in persönlicher sowie in sozialer Hinsicht hat und was das moralisch Verwerfliche an ihm ist, worauf sich die Kritik an der Werbekampagne stützt.
Auf der persönlichen Ebene ist zu fragen, was den Einzelnen zum Geiz führt und zu was der Geiz beim Einzelnen führt. Das Interessante an der Werbekampagne ist ja der Mut der Werbefachleute, sich ohne Scheu eines negativ belegten Begriffes zu bedienen und ihn mit einem Modewort wie geil zu kombinieren. Die Aussage Geiz ist geil hat nichts mit den beworbenen Produkten zu tun. Sie zielt auf das Preisbewusstsein des Kunden ab sowie auf dessen Wunsch, sich in seinem Kaufverhalten von anderen, nicht so cleveren Käufern abzugrenzen. Hier wird der Kunde in seinem Selbstverständnis angesprochen. Im Bemühen, sich in der Masse als Individuum zu definieren, scheinen ungewöhnliche Werbebotschaften oft besonders gut angenommen zu werden. Die Bereitschaft für Geiz muss demnach in der Person des Individuums bzw. in seiner Selbstwahrnehmung liegen.
Auf der sozialen Ebene geht es um die Sozialverträglichkeit von Geiz und also auch um die soziale Bewertung selbigen. Die Bereitschaft, sich selbst dazu als geizig zu bezeichnen, erschreckt ethisch betrachtet doch nicht unerheblich. Es scheint, als gelten dem Konsumenten in dieser Situation die Vorteile für seine eigene Person mehr als die Interessen der Gemeinschaft bzw. seine Verantwortung für die Gemeinschaft.
Schließlich stellt sich die Frage, warum eine Kampagne mit einem solchen Titel so erfolgreich sein kann, warum das Motto dieser Kampagne so weit reichend aufgenommen wird, […]
Die Werbeagentur Jung von Matt hat für die Saturngruppe einen neuen Slogan kreiert, der binnen kürzester Zeit in aller Munde war: Geiz ist geil.
Geiz ist geil hört und liest man fast überall. Einerseits hat der Werbespruch einen ungeheuren Erfolg. Andere Unternehmen springen auf den Geiz-Zug mit auf. Es eröffnen Billigkaufhäuser mit Namen wie beispielsweise Mäc-Geiz in vielen Städten und Geiz wird im Kontext von Wirtschaft und Werbung plötzlich zu einem häufig gebrauchten Begriff. Andererseits ist er ein Ärgernis. Die Feuilletons aller namhaften Zeitungen sind voll der moralischen Entrüstung darüber, wie man die Untugend Geiz zu solch Ehren gelangen lassen konnte.
In dieser Arbeit wird zunächst der Frage nachgegangen, was denn Geiz eigentlich ist, was ihn zum Beispiel von der Sparsamkeit unterscheidet. Anschließend wird geklärt, welche Folgen der Geiz in persönlicher sowie in sozialer Hinsicht hat und was das moralisch Verwerfliche an ihm ist, worauf sich die Kritik an der Werbekampagne stützt.
Auf der persönlichen Ebene ist zu fragen, was den Einzelnen zum Geiz führt und zu was der Geiz beim Einzelnen führt. Das Interessante an der Werbekampagne ist ja der Mut der Werbefachleute, sich ohne Scheu eines negativ belegten Begriffes zu bedienen und ihn mit einem Modewort wie geil zu kombinieren. Die Aussage Geiz ist geil hat nichts mit den beworbenen Produkten zu tun. Sie zielt auf das Preisbewusstsein des Kunden ab sowie auf dessen Wunsch, sich in seinem Kaufverhalten von anderen, nicht so cleveren Käufern abzugrenzen. Hier wird der Kunde in seinem Selbstverständnis angesprochen. Im Bemühen, sich in der Masse als Individuum zu definieren, scheinen ungewöhnliche Werbebotschaften oft besonders gut angenommen zu werden. Die Bereitschaft für Geiz muss demnach in der Person des Individuums bzw. in seiner Selbstwahrnehmung liegen.
Auf der sozialen Ebene geht es um die Sozialverträglichkeit von Geiz und also auch um die soziale Bewertung selbigen. Die Bereitschaft, sich selbst dazu als geizig zu bezeichnen, erschreckt ethisch betrachtet doch nicht unerheblich. Es scheint, als gelten dem Konsumenten in dieser Situation die Vorteile für seine eigene Person mehr als die Interessen der Gemeinschaft bzw. seine Verantwortung für die Gemeinschaft.
Schließlich stellt sich die Frage, warum eine Kampagne mit einem solchen Titel so erfolgreich sein kann, warum das Motto dieser Kampagne so weit reichend aufgenommen wird, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Katharina Stolte
Des Geizes neue Kleider
'Geiz ist geil' und seine Implikationen
ISBN: 978-3-8366-0512-0
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Universität Bayreuth, Bayreuth, Deutschland, Magisterarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
3
Inhaltsverzeichnis
1 Des Geizes neue Kleider...3
2 Eine Annäherung an den Geiz ...5
2.1 Geiz im Spiegel der Sprache...5
2.1.1 Etymologie und Bedeutungswandel von Geiz ...5
2.1.2 Begriffseingrenzungen...6
2.1.3 Was Geiz ist: Ein erster Versuch...10
2.2 Die Bewertung von Geiz im Wandel der Zeit...11
2.2.1 Geiz in der Antike ...11
2.2.2 Geiz im Mittelalter...15
2.2.3 Geiz in der Neuzeit...18
2.2.4 Geiz in der Moderne...22
2.3 Das Erbe der Todsünde: weshalb der Geiz ungelitten ist...25
2.3.1 Die soziale Bewertung von Geiz ...26
2.3.2 Was Geiz ist: zweiter Versuch ...29
2.4 Zusammenfassung...30
3 Der Geiz und das Ich...33
3.1 Was das Ich ist...34
3.2 Das Ich in der Welt des Konsums...40
3.2.1 Dem Ich nützlicher Geiz und dem Geiz zuträgliches Ich...43
3.2.2 Dem Ich schädlicher Geiz und dem Geiz abträgliches Ich...45
3.3 Von der Macht der Bedürfnisse...48
3.3.1 Bedürfnisse und Geiz ...51
3.4 Zusammenfassung...53
4 Der Geiz und die Gemeinschaft...56
4.1 Geiz auf der Ebene der sozialen Gruppen...57
4.2 Geiz auf der Ebene der Gesellschaft ...59
4.3 Geiz und Verantwortung...62
4.3.1 Zum Prinzip der Verantwortung...62
4.3.2 Geiz versus Verantwortung ...67
4
4.4 Zusammenfassung...70
5 Betrachtung der "Geiz ist geil"Kampagne...73
5.1 Ist Geiz ein Klischee?...74
5.2 Das Teilhabeversprechen...76
5.3 Die Geister die der Slogan rief...82
5.3.1 ,,Geiz ist geil" als Rache des kleinen Mannes...83
5.3.2 Leben auf Pump...85
5.4 Des Geizes neue Kleider?...89
5.5 Zusammenfassung...90
6 Des Geizes neue Kleider doch nur Lumpen...92
7 Bibliographie...97
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Materielle Dimensionen der Begriffsfamilie um Geiz (Entwurf: K.
Stolte)...8
Abbildung 2: Soziale Dimensionen persönlicher Eigenschaften (Entwurf: K.
Stolte)...28
Abbildung 3: Beispiel geschachtelte Identitäten (nach K. Stolte)...37
Abbildung 4: Beispiel nebenläufige Identitäten (nach K. Stolte)...38
Abbildung 5: Funktionsbereiche des Einkaufs...42
Abbildung 6: Geizistgeil Werbung der Metrotochter Saturn...73
Abbildung 7: GeileralsGeiz Werbung von mobilcom...76
Abbildung 8: IchundmeinBier Werbung von Norma...80
Abbildung 9: Schuldenstand private Haushalte der kreisfreien Stadt Bayreuth.
Quelle: www.schufa.de...87
Abbildung 10: Schuldenstand nach Altersgruppe in der kreisfreien Stadt Bayreuth.
Quelle: www.schufa.de...88
D
ES
G
EIZES
NEUE
K
LEIDER
5
1 Des Geizes neue Kleider
Die Werbeagentur Jung von Matt hat für die Saturngruppe einen neuen Slogan
kreiert, der binnen kürzester Zeit in aller Munde war: "Geiz ist geil".
,,Geiz ist geil" hört und liest man fast überall. Einerseits hat der Werbespruch
einen ungeheuren Erfolg. Andere Unternehmen springen auf den GeizZug mit
auf. Es eröffnen Billigkaufhäuser mit Namen wie beispielsweise MäcGeiz in
vielen Städten und Geiz wird im Kontext von Wirtschaft und Werbung plötzlich
zu einem häufig gebrauchten Begriff. Andererseits ist er ein Ärgernis. Die Feuille
tons aller namhaften Zeitungen sind voll der moralischen Entrüstung darüber, wie
man die Untugend Geiz zu solch Ehren gelangen lassen konnte.
In dieser Arbeit wird zunächst der Frage nachgegangen, was denn Geiz
eigentlich ist, was ihn zum Beispiel von der Sparsamkeit unterscheidet. Anschlie
ßend wird geklärt, welche Folgen der Geiz in persönlicher sowie in sozialer Hin
sicht hat und was das moralisch Verwerfliche an ihm ist, worauf sich die Kritik an
der Werbekampagne stützt.
Auf der persönlichen Ebene ist zu fragen, was den Einzelnen zum Geiz führt
und zu was der Geiz beim Einzelnen führt. Das Interessante an der Werbe
kampagne ist ja der Mut der Werbefachleute, sich ohne Scheu eines negativ
belegten Begriffes zu bedienen und ihn mit einem Modewort wie ,,geil" zu kom
binieren. Die Aussage ,,Geiz ist geil" hat nichts mit den beworbenen Produkten zu
tun. Sie zielt auf das Preisbewusstsein des Kunden ab sowie auf dessen Wunsch,
sich in seinem Kaufverhalten von anderen, nicht so ,,cleveren" Käufern abzugren
zen. Hier wird der Kunde in seinem Selbstverständnis angesprochen. Im Be
mühen, sich in der Masse als Individuum zu definieren, scheinen ungewöhnliche
Werbebotschaften oft besonders gut angenommen zu werden. Die Bereitschaft für
Geiz muss demnach in der Person des Individuums bzw. in seiner Selbstwahr
nehmung liegen.
Auf der sozialen Ebene geht es um die Sozialverträglichkeit von Geiz und also
auch um die soziale Bewertung selbigen. Die Bereitschaft, sich selbst dazu als gei
D
ES
G
EIZES
NEUE
K
LEIDER
6
zig zu bezeichnen, erschreckt ethisch betrachtet doch nicht unerheblich. Es
scheint, als gelten dem Konsumenten in dieser Situation die Vorteile für seine
eigene Person mehr als die Interessen der Gemeinschaft bzw. seine Verantwortung
für die Gemeinschaft.
Schließlich stellt sich die Frage, warum eine Kampagne mit einem solchen
Titel so erfolgreich sein kann, warum das Motto dieser Kampagne so weit rei
chend aufgenommen wird, obwohl Geiz im privaten Bereich abgelehnt wird.
Daher ist auch eine kurze Betrachtung der rationalen und irrationalen Kaufent
scheidung notwendig. Rational versucht der Konsument für ein Produkt nur
dessen tatsächlichen Geldwert zu bezahlen. Ein solches Geschäft entspricht dem
altertümlichen Tauschhandel: das eigene Gut geben und etwas gleichwertiges, das
ein wichtiges Bedürfnis deckt, dafür erhalten. Irrational ist der Konsument jedoch
beständig auf so genannte ,,Schnäppchen" aus, die ihm das Gefühl geben, weniger
für ein Produkt bezahlt zu haben, als dieses tatsächlich wert ist. Der Kunde möch
te den Hersteller, der seiner Meinung nach ,,ohnehin genug verdient", zu seinen
eigenen Gunsten übervorteilen. Das irrationale Kaufverhalten schmeichelt dem
Selbstverständnis des Konsumenten. Ein Slogan wie ,,Geiz ist geil" spricht den
Konsumenten auf seiner irrationalen Ebene an und versucht, das vermeintlich po
sitive ,,Schnäppchenerlebnis" schon im Vorfeld zu festigen. In diesem Feld der ra
tionalen und irrationalen Kaufentscheidung stoßen Individualismus und Gemein
schaftsverantwortung aufeinander. Geiz ist der Ausdruck zunehmender Eigen
orientierung des Individuums, eventuell auf Kosten der Gemeinschaft.
Was Geiz noch alles ist und wohin er führen kann wird im folgenden erläutert.
E
INE
A
NNÄHERUNG
AN
DEN
G
EIZ
7
2 Eine Annäherung an den Geiz
2.1
Geiz im Spiegel der Sprache
Warum ist die Sprache in Hinblick auf die Bewertung oder Wahrnehmung von
Geiz innerhalb einer Gesellschaft wichtig? ,,Die Wörter einer Sprache sind [...]
Träger und Vermittler [der] in einer soziokulturellen Gemeinschaft vorherr
schenden Vorstellung von positiv bzw. negativ bewerteten Eigenschaften, Einstel
lungen und Handlungen. Ältere und neuere Auffassungen von richtigem und
falschem sozialen Verhalten spiegeln sich im Wortschatz [...] einer Sprache, am
deutlichsten wohl in Sprichwörtern oder Schimpfwörtern."
1
Anhand der Sprache
lässt sich demnach gut die veränderte Wertung einer Eigenschaft ablesen.
2.1.1
Etymologie und Bedeutungswandel von Geiz
Unser Substantiv Geiz lässt sich zurückführen auf das althochdeutsche Substantiv
gît
2
(Habsucht, Gier), das zum ersten Mal im 9. Jahrhundert schriftlich belegt
wurde. Das mittelhochdeutsche Verb gtesen bzw. gtsen ist eine Ableitung von
diesem Substantiv.
3
Die Form des Wortes mit z statt mit t am Ende zeigt sich
gegen Ende des 13. Jahrhunderts, wobei einige Zeit lang beide Formen parallel zu
finden sind. So verwendet noch Luther anfangs geitig und gittig neben geizig.
4
Geiz bezeichnet eigentlich die sinnliche Gier, also die aufs Essen gerichtete
Lust. Daher verwendete man auch im 15. Jahrhundert den Begriff geiz medi
zinisch für heiszhunger.
5
Diese ursprüngliche Vorstellung von geiz als Hunger ist
in den metaphorischen Verwendungen der damaligen Zeit deutlich zu erkennen,
etwa in geizhals und geizkragen.
Des weiteren bedeutete geiz Gier im allgemeinen, d.h. auch im guten Sinne.
Dies zeigt sich heute noch im eher positiv besetzten Begriff Ehrgeiz, im 17. Jahr
hundert auch noch amtsgeiz oder lobgeiz und lustgeiz genannt. Selbst die Gier
nach Macht bezeichnete man mit Hilfe des Wortes geiz, nämlich weltgeizigkeit
1 Malmquist, 2000, S. 9
2 vgl. Lexer, 1992, S. 73 und Schützeichel, 1989, S. 129
3 Kluge, 1995, S. 308
4 vgl. Grimm, 1984, S. 2811f
5 vgl. Grimm, 1984, S. 2813
G
EIZ
IM
S
PIEGEL
DER
S
PRACHE
8
oder weltgeiz (Gier nach Weltherrschaft). Andere Formen der Gier finden sich in
liebesgeiz und kaufgeiz.
6
Im Laufe der Zeit schränkte sich der Begriff geiz jedoch immer stärker auf die
Gier nach Geld und Gut ein, während Gier allgemein blieb. Dabei wurde er
zunehmend negativ besetzt. Es fand also eine fundamentale Bedeutungsverschie
bung von der ursprünglichen Gier nach etwas bzw. dem ,,heftig verlangen, streben
nach"
7
statt, bis hin zu der heutigen: ,,Scheu vor Geldausgaben, ängstliches oder
gieriges Festhalten des Gewonnenen."
8
2.1.2
Begriffseingrenzungen
Lexika des 20. Jahrhunderts definieren den Begriff Geiz folgendermaßen: ,,Eng
herziges Festhalten am Besitz, auch auf Kosten der Befriedigung eigener Bedürf
nisse" (DTV Lexikon 1967), ,,Bis zur Sucht übertriebenes Bestreben, Besitz nicht
zu veräußern, übertriebene Sparsamkeit, Habsucht, Knauserei." (Ullstein Lexikon
1969), ,,übertriebene Sparsamkeit" (Duden 1996).
9
Folgende Begriffe tauchen im
Zusammenhang mit Geiz oder dessen Definition immer wieder auf: Vermehrung
und Erhaltung von Besitz, übertriebene Sparsamkeit, Habsucht, Habgier, Knause
rei und nichthergebenwollen. Es ist daher notwendig, den Begriff im Rahmen
dieser Arbeit einzugrenzen, um zu einer größeren Begriffsklarheit zu gelangen.
Geiz scheint ein zu viel vom Einen und ein zu wenig vom Anderen zu sein.
Nennen wir das eine Nehmen und das andere Geben. Geiz ist also zu viel Nehmen
und zu wenig Geben. Um dem Wesen des Geizes noch näher zu kommen, ist es
wichtig, zwei Arten von Nehmen und Geben zu unterscheiden: das materialis
tische Nehmen und Geben sowie das soziale Nehmen und Geben.
Materialistisches Geben steht für bezahlen und etwas dafür bekommen. Mate
rialistisches Nehmen steht für etwas bekommen und dafür bezahlen. Beides
beschreibt eine ökonomische Austauschbeziehung der Personen zueinander. Es
sagt wenig bis gar nichts über die emotionale oder die soziale Beziehung der
6 vgl. Grimm, 1984, S. 2813f
7 Malmqusit, 2000, S. 84
8 Grimm, 1984, S. 2815
9 zitiert nach Malmquist, 2000, S. 62
G
EIZ
IM
S
PIEGEL
DER
S
PRACHE
9
Personen zueinander aus. In diese Kategorie des materialistischen Geben und
Nehmens gehören Begriffe wie Habsucht, Habgier, Sparsamkeit, Verschwendung,
Bescheidenheit, Geiz. Sie alle verdeutlichen eine bestimmte ökonomische Ver
haltensweise des Individuums nach außen.
Im Gegensatz dazu bedeutet soziales Geben das Abgeben eines Gutes oder
einer Geldsumme ohne eine unmittelbare Gegenleistung. Hier wären Begriffe wie
Großzügigkeit, Mildtätigkeit oder Großmut einzuordnen. Unter sozialem Nehmen
ist z.B. das Erbitten einer Hilfeleistung, Bedürftigkeit, Rat oder ein offenes Ohr
suchen, das Ausleihen von Gegenständen oder Geld zu verstehen. Das soziale Ge
ben oder Nehmen definiert die Beziehung der Beteiligten zueinander und macht
damit auch eine Aussage über die emotionale oder soziale Beziehung der Personen
zueinander.
Im Definitionsrahmen einer ökonomischen Austauschbeziehung zwischen Per
sonen beruht die Beziehung auf dem Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen.
Dieses Wechselspiel soll die nachfolgende Grafik (siehe Abbildung 1) verdeutli
chen.
In einem Koordinatensystem, dessen Mittelpunkt eine neutrale Position der
Personen (Zufriedenheitszustand) ist, gibt es eine Nehmen und eine Gebenachse.
Beide Achsen sind Verlaufsachsen, d.h. sie bezeichnen den jeweiligen Akt des
Gebens oder Nehmens in Richtung eines (zu) viel und eines (zu) wenig. In diesem
Koordinatensystem von Geben und Nehmen lässt sich jeder der oben genannten
Begriff spezifisch positionieren. Der Zufriedenheitszustand beschreibt dabei den
harmonischen Ausgleich von Nehmen und Geben.
In der Abbildung wird versucht, die materialistisch orientierten Begriffe Hab
gier bzw. Habsucht, Kaufsucht, Verschwendung, Geiz, Sparsamkeit, übertriebene
Sparsamkeit und Bescheidenheit in dem Koordinatensystem gemäß ihrer gesell
schaftlichen Wahrnehmung zu platzieren. Die soziale Dimension der Eigenschaft
Geiz bildet die Darstellung nicht ab. Diese wird an späterer Stelle untersucht
werden.
G
EIZ
IM
S
PIEGEL
DER
S
PRACHE
10
Die schematische Darstellung soll nachfolgende Begriffe zueinander in Bezug
setzen und wird folgendermaßen erläutert: Das Koordinatensystem verdeutlicht
die gesellschaftliche Wahrnehmung der materiell orientierten Eigenschaften eines
Individuums innerhalb der Verlaufsachsen von Geben und Nehmen.
Im oberen linken Quadrat finden wir die Kaufsucht. Sie liegt auf einer gedach
ten Achse von (zu) viel Nehmen und (zu) viel Geben. Die Kaufsucht ist weniger
am Haben als vielmehr am beständigen Nehmen interessiert. Es geht um den Akt
des Kaufens, wofür das Geben in Kauf genommen wird. Daher nimmt der
Kaufsüchtige ungefähr genau so viel wie er gibt, dies jedoch ohne Maß und ohne
tatsächliche Befriedigung. Die Bedürfnisse sind gänzlich austauschbar. Die
Kaufsucht kommt dem Zufriedenheitszustand mit keiner Neuerwerbung näher.
Im rechten oberen Quadrat liegt auf der (zu) viel NehmenAchse sehr weit
oben die Habgier / Habsucht. Die Habgier ist nur am Nehmen interessiert. Der
Aspekt des Gebens wird ignoriert. Es geht ausschließlich um die Vermehrung ma
teriellen Gutes.
Ebenfalls im oberen rechten Quadrat, allerdings sehr weit rechts auf der (zu)
wenig GebenAchse finden wir den Geiz. Der Geiz ist primär am Festhalten des
Abbildung 1: Materielle Dimensionen der Begriffsfamilie um Geiz (Entwurf: K. Stolte)
neutral
(zu) wenig GEBEN
(zu) viel NEHMEN
(zu) viel GEBEN
(zu) wenig NEHMEN
Habgier
/
Habsucht
Geiz
Verschwendung
Kaufsucht
Bescheidenheit
Sparsamkeit
übertriebene
Sparsamkeit
G
EIZ
IM
S
PIEGEL
DER
S
PRACHE
11
Besitzes interessiert. Möglichst wenig zu geben ist die oberste Prämisse. Das
Nehmen ist dem Geiz gar nicht so wichtig, Hauptsache ist es, nichts geben zu
müssen. Damit ist der Geiz durchaus statisch, ja sogar ängstlich geprägt. Die
Angst vor Armut oder vor Verlust allgemein prägt das Handeln des Geizigen.
Im rechten unteren Quadrat, relativ in der Mitte einer gedachten Achse zwi
schen (zu) wenig Geben und (zu) wenig Nehmen, ist die Sparsamkeit zu finden.
Die Sparsamkeit will nicht viel geben und beschränkt dafür das Nehmen. Mehr zu
bekommen als zu geben erfreut die Sparsamkeit. Die Motivation für Sparsamkeit
kann materiell (Haushalten, Wohlergehen erhalten und vermehren) oder karitativ
bzw. sozial (Verzicht zugunsten anderer) begründet sein.
Im selben Quadrat, doch wesentlich näher an der (zu) wenig Nehmen Achse
liegt die Bescheidenheit. Die Bescheidenheit will nicht viel nehmen und muss da
her auch nicht viel geben. Ein Ausgleich zwischen Nehmen und Geben wird ange
strebt und jedes empfundene Bedürfnis gründlich überdacht.
Die übertriebene Sparsamkeit, ebenfalls im unteren rechten Quadrat, hat Angst
vor dem Geben, weswegen sie auf ein Nehmen zugunsten des NichtGebens
verzichtet. Haben möchte sie schon, doch am liebsten ohne Gegenleistung. Über
triebene Sparsamkeit ist fast immer materiell begründet, selten sozial. Sie ist dem
Geiz nahe, doch nicht so statisch.
Im unteren linken Quadrat, also zwischen (zu) viel Geben und (zu) wenig
Nehmen siedelt sich die Verschwendung an. Die Verschwendung liebt es üppig. Es
geht mehr um das Geben als um das Nehmen, denn im Geben liegt mehr
gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Ähnlich wie die Kaufsucht ist die Verschwen
dung nicht am Besitz interessiert, sondern lediglich am Akt des Kaufens. Von der
Kaufsucht unterscheidet sie aber die Motivation: der Verschwendung geht es beim
Kaufen um das Gefühl von Unbeschränktheit und gesellschaftlicher
Aufmerksamkeit. Das Nehmen ist dabei weniger wichtig.
2.1.3
Was Geiz ist: Ein erster Versuch
Materiell betrachtet ist der Geiz am Nehmen bzw. am Bewahren orientiert. An
dieser Stelle kann schon einmal fest gehalten werden, dass ,,Geiz [...] eine Charak
G
EIZ
IM
S
PIEGEL
DER
S
PRACHE
12
tereigenschaft [bezeichnet], hinter der ein Handlungskonzept steht. Eine Person ist
geizig, wenn sie nicht im positiven Sinne sparsam ist, sondern Materielles zurück
hält, obwohl sie dies nicht müsste (und solches Verhalten anderen zum Nachteil
gerät)."
10
Geiz ist in den Augen der Psychoanalyse ein Synonym für Festhalten.
11
Der Geizige hat Angst vor Verlust und in gewisser Weise auch vor Bewegung. Die
Beziehungen zwischen Menschen sind jedoch im Normalfall geprägt von be
ständiger Bewegung, weswegen der Geizige in seinem Verharren und Beharren
auch immer statisch wirkt.
Der oben erwähnte Aspekt des «Nachteils für andere» ist sehr wichtig, um zu
verstehen, weshalb Geiz im Laufe der Jahrhunderte immer wieder eher negativ be
wertet oder lächerlich gemacht wurde. Das Handlungskonzept eines Geizigen ist
egozentrisch geprägt: ,,Das ist das Erschütternde beim Geiz, dass hier nicht nur
[...] Egoismus zu verzeichnen ist, sondern dass zu diesem Egoismus eine Habsucht
kommt, die das, was man begehrt, ganz auf sich gewendet sieht. [Der Geizige] hat
keinen Blick mehr für den anderen."
12
Es geht ihm ausschließlich um das
Vermehren oder Bewahren seiner materiellen Güter. In Zeiten großer Not, wie
etwa im Mittelalter, wurde der Geiz daher schwer geächtet. War die wirtschaftli
che Lage der Gemeinschaft dagegen weniger angespannt oder sogar gut, wie z.B.
in der Neuzeit, wurde der Geizige lediglich als eine lächerliche Figur dargestellt.
Mehr zur historischen Bewertung von Geiz im Anschluss.
Im Geiz manifestiert sich also in gewisser Weise eine große Verlust bzw.
Lebensangst, die durch beständige Kontrolle über Materielles auszugleichen ver
sucht wird. Geiz ist Kontrolle.
2.2
Die Bewertung von Geiz im Wandel der Zeit
Die moralische Bewertung von Geiz unterliegt im Laufe der Zeit immer wieder
einem leichten Wandel. Geiz wird vom Individuum immer positiver bewertet, als
die Gesellschaft dies im allgemeinen tut. Hier begründet sich eventuell die
10 Gerbig / Buchtmann, 2003, S. 99
11 vgl. Schönberger, 2004, S. 31
12 Schönberger, 2004, S. 32
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
13
Trennung in Privatmoral und Gesellschaftsmoral, obgleich doch gesellschaftlich
die gleiche Verpflichtung gelten sollte wie im privaten sozialen Umfeld. Dennoch
ist auffällig, dass Menschen im Privaten anders handeln und anderes erwarten, als
sie dies in einem größeren Zusammenhang tun. Beispielsweise empfindet ein
Mensch es als schrecklich gemein, wenn ihm sein Fahrrad gestohlen wird. Der
gleiche Mensch hat aber keine Hemmungen, in einem Kaufhaus ein oder zwei
Artikel zu stehlen, ,,weil es denen ja nicht weh tut". Mit ,,denen" ist eine anony
misierte Institution gemeint, die es böswillig auf das Geld des Menschen
abgesehen hat. Diese objektiv betrachtet als schizophren zu bezeichnende
Unterscheidung in Privat und Gesellschaftsmoral ist ein Faktum menschlichen
Zusammenlebens. Jeder ist sich selbst erst einmal der Nächste. Beim Geiz tritt
dieses Verhalten verstärkt zutage.
2.2.1
Geiz in der Antike
Der nachfolgende kurze Abriss durch die Meinungswelt der antiken Philosophie
macht deutlich, dass Geiz nicht zu den positiven Eigenschaften des Menschen
zählte. Als gut und sinnvoll für das menschliche Handeln wurde damals die Mitte
zwischen allen möglichen Extremen erkannt, in diesem Fall die gesunde Sparsam
keit zwischen Verschwendung und Geiz. Das angestrebte Ideal der antiken Phi
losophie war der Zustand, der in Abbildung 1 als neutraler Zufriedenheitszustand
bezeichnet wird. Dieser neutrale Zufriedenheitszustand sollte nicht nur hinsicht
lich des persönlichen Glücksempfindens, sondern auch wegen seiner positiven
Folgen für das Miteinander der Individuen angestrebt werden. Da der Zufrieden
heitszustand aber nur für die Wenigstens zu erreichen war, sollte der Einzelne den
Mittelweg wählen. Nicht Geiz und nicht Verschwendungssucht bergen Glück oder
gar Glückseligkeit in sich. Dies gilt vielmehr für das Maßhalten und zwar in den
Bedürfnissen genauso wie im letztlichen Handeln. Den Ausgleich von Geben und
Nehmen anzustreben, galt als wünschenswert. Geiz jedoch schafft keinen Aus
gleich und damit einen permanenten Unzufriedenheitszustand, der weder für das
Individuum, noch für die Gemeinschaft dienlich ist.
Geiz wird in der antiken Literatur im Großen und Ganzen sehr negativ konno
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
14
tiert. Im Geiz steckt, wie bereits erläutert, keine Bewegung. Der Geizige wird
schon damals beschrieben als jemand, der sich von der Gemeinschaft in allem ab
sondert. Er ist lediglich an der Erfüllung seiner ureigensten Interessen und Bedürf
nisse orientiert und damit hat der Geiz, laut dem Urteil vieler antiker Philosophen,
weder einen Nutzen für die Gemeinschaft noch einen für das Subjekt selbst. Der
Geiz bremst das Subjekt in seiner Vervollkommung. Das Verhalten des Geizigen
gilt als von niederen Motiven bestimmt und damit als gemeinschaftsfeindlich.
Schon im antiken Griechenland gab es den Geiz und damit auch moralische
Urteile über geizige Menschen. Epikur (341 271 v.Chr.) bezeichnet Geiz als un
anständige Eigenschaft. Für ihn ist ,,der größte Reichtum [...] die Selbstgenügsam
keit."
13
Theophrast (371 322 v.Chr.) unterscheidet bereits zwischen drei Formen
des Geizes: Der erste ist jener Geizige, der durch übertriebene Sparsamkeit in
Geldangelegenheiten auffällt, von ihm als ,,Heuchler", ,,Schmeichler", ,,Großtuer",
,,Miesmacher" und ,,Schwätzer" bezeichnet.
14
Als zweiten beschreibt er den
Knickrigen, der ,,einen Mangel an Ehrgefühl im Geldausgeben" zeigt und als
dritten beschreibt er den Knausrigen, dessen ,,Streben nach schmählichem
Gewinn" ihn zu einem unangenehmen Zeitgenossen macht.
15
Platon und Aristoteles gehen beide im Gegensatz zu beispielsweise den So
phisten vom Individuum aus. Der Ursprung einer tugendhaften Lebensführung,
wozu der Geiz definitiv nicht gehört, liegt bei ihnen in der ,,Ausbildung einer
vortrefflichen Persönlichkeit, die durch Verantwortung für sich selbst und die Mit
menschen die höchste Form von Freude und Glück" bringen würde.
16
Aristoteles (384 322 v.Chr.), dessen philosophische Maxime ohnehin der
heute so genannte goldene Mittelweg war, kann mit dem Geiz als einseitig über
triebener Eigenschaft wenig anfangen: ,,In Geldsachen, im Geben wie im Nehmen,
ist die Mitte Freigiebigkeit, das Übermaß und der Mangel Verschwendung und
Geiz, und zwar so, dass beide Fehler beide Extreme aufweisen, jedoch umgekehrt
13 zitiert nach: Deutscher Sparkassenverband, 1958, S. 11
14 vgl. Busch, 2004, S. 391
15 ebd.
16 vgl. Malmquist. 2000, S. 33
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
15
zueinander. [...] der Geizige dagegen nimmt zu viel und gibt zu wenig."
17
Zwar
gehört etwas, das er ,,Reichtum" nennt, für ihn zur Glückseligkeit des Menschen,
jedoch nicht als Mittel zum reinen Selbstzweck, sondern als Werkzeug des Guten:
,,Der Besitz eines Eigentums ist auch an sich schon unbeschreiblich angenehm.
Nicht ohne Ursache ist uns allen die Selbstliebe eingepflanzt worden. Sie ist
natürlich, und nur die Selbstsucht ist sträflich. Denn diese besteht nicht darin, dass
sich jemand selbst liebe, sondern sie besteht in dem Übermaß dieser Liebe: Und
ebenso ist es mit der Liebe zum Reichtum; denn wer liebt ihn nicht. [Aristoteles
Ethik]"
18
Im Gegensatz zu Platon sieht Aristoteles in den Kardinaltugenden
Tapferkeit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Weisheit keine im Menschen angelegten
Verhaltensmuster. Er geht vielmehr davon aus, dass diese Tugenden auf Erfahrung
und Vernunft basieren und sie jeder für sich selbst entwickeln muss: ,,Es ist mithin
die Tugend ein Habitus des Wählens, der die nach uns bemessene Mitte hält und
durch die Vernunft bestimmt wird [...]."
19
Auch das Verhalten gegenüber Besitz
muss ein Mensch entwickeln. Weder Geiz noch Verschwendungssucht würden das
Wohlwollen von Aristoteles finden: ,,In allem, was kontinuierlich und was teilbar
ist, lässt sich ein Mehr, ein Weniger und ein Gleiches antreffen, und zwar entweder
mit Rücksicht auf die Sache selbst oder mit Rücksicht auf uns. Das Gleiche aber
ist ein Mittleres zwischen Übermaß und Mangel."
20
Er sieht in der Mitte den Weg
zu einem glücklichen Leben. Aristoteles und Platon betonen beide also das
asoziale und ehrlose Element, dass eine Eigenschaft wie Geiz mit sich bringt. In
dieser Ehrlosigkeit des Geizes wirkt das asoziale Element auf den Geizigen
zurück. Geiz wird als Dysbalance im Streben nach innerer und äußerer Balance
identifiziert und eine Dysbalance führt meist zu persönlichem Unglück. Bei
Diogenes von Sinope (ca. 400325 v.Chr.) heißt es kurz und knapp: ,,Der Geiz ist
die Mutterstadt aller Übel."
21
Weiter führt er aus: ,,Der Geizige ist wie der
Wassersüchtige; denn auch er will, wenn er voll von Geld ist, noch mehr: beide zu
17 Aristoteles, Kap. VII. 1995, S. 37
18 vgl. Deutscher Sparkassenverband, 1958, S. 10
19 Aristoteles, Kap. VI. 1995, S. 36
20 Aristoteles, Kap. V. 1995, S. 34
21 Höffe, 1998, S. 80
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
16
ihrem Schaden. Denn die Leidenschaften wachsen um so mehr, je mehr man ihre
Begierden befriedigt."
22
Geiz, als Sucht verstanden, kann nie befriedigt werden.
Daher ist das ,,unglücklich sein" eine zwangsläufige Folge.
Zusammengefasst kann man wohl behaupten, dass keiner der hier zitierten
Autoren am Geiz etwas Positives finden konnte. Der Geiz gehörte nicht nur für
Aristoteles zu den Extremen des menschlichen Verhaltens. Und dass im Extremen
niemand die Glückseligkeit finden könne, darin waren sich alle Vertreter der ge
mäßigten Philosophie einig.
Dass Sparsamkeit durchaus eine Tugend, Geiz jedoch eine ungesunde Über
treibung ist, sahen auch viele Autoren im alten Rom so. Während Cicero einerseits
schreibt: ,,Sparsamkeit ist eine gute Einnahme"
23
[Paradoxa], führt er in De officiis
(2. Buch, 24. Kap.) weiter aus: ,,Das Vermögen aber soll durch Mittel erworben
werden, die von Unsittlichkeit frei sind. [...]"
24
. Seneca (4 v.Chr. 65 n.Chr.), der
zu den Stoikern gehört, schreibt, dass ein Leben nur dann glücklich zu nennen ist,
wenn der Mensch sich im Einklang mit der eigenen Natur befindet. Dazu gehört
auch, sich frei zu machen von Bedürfnissen, die den Geist versklaven, indem man
sich von deren Befriedigung abhängig macht.
25
Er erkennt: ,,Nicht wer wenig hat,
sondern wer viel wünscht ist arm."
26
Ähnlich sieht es auch Plutarch (46 120
n.Chr.) in seiner Moralia: ,,Wer wenig bedarf, der kommt nicht in die Lage, auf
vieles verzichten zu müssen."
27
Auch Plotin (204 270 n.Chr.) sieht in der
Mäßigung den richtigen Weg: ,,Die bürgerlichen Tugenden nun, [...] indem sie den
Begierden und überhaupt den Affekten Grenze und Maß setzen und das falsche
Meinen beseitigen, formen die Menschen wahrhaft und machen sie besser [...]".
28
2.2.2
Geiz im Mittelalter
Im stark kirchlich geprägten Leben des Mittelalters ,,[...] waren die denkenden
Menschen von tiefer Verzweiflung über die irdischen Dinge erfüllt, die sich nur in
22 Höffe, 1998, S. 80
23 zitiert nach: Deutscher Sparkassenverband, 1958, S. 11
24 ebd. S. 11
25 vgl. Höffe, 1998, S. 111
26 zitiert nach: Deutscher Sparkassenverband, 1958, S. 12
27 ebd. S. 13
28 Höffe, 1998, S. 119
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
17
der Hoffnung auf ein späteres, besseres Jenseits ertragen ließen. Schuld an diesem
inneren Elend waren die Ereignisse in Westeuropa. [In einer] Epoche der Kata
strophen sank das Niveau des allgemeinen Wohlergehens plötzlich stark ab [...]"
29
.
So erklärt sich auch, weshalb das Verhalten des Menschen in den Mittelpunkt der
Beurteilung gerückt und jegliches Streben nach weltlichen Gütern verdammt wird.
Sein Fehlverhalten ist nicht länger Schicksal, sondern Sünde und damit ein
schuldhaftes Vergehen wider Gott. Es wird ein Tugendkatalog entworfen, be
stehend aus Liebe, Hoffnung, Demut, Erbarmen, Geduld, Glaube und Keuschheit,
an den der Mensch sich zu halten hat, sofern er Vergebung von Gott und damit das
bessere Leben im Jenseits erlangen möchte.
30
Die Untugenden oder Todsünden
dagegen, wie etwa der Geiz, führen in ein noch schrecklicheres Leben nach dem
Tod. Die Einordnung des Geizes als eine der sieben Todsünden war aus Sicht der
damaligen Zeit gemeinschaftsnotwendig.
Die Einstellung zu Tugenden und Untugenden ist im Mittelalter stark geprägt
von der Lehre der römischkatholischen Kirche und wie bereits erwähnt der
allgemeinen wirtschaftlichen Situation. ,,Im Alten Testament werden Geiz und
Habgier noch als Torheiten bezeichnet. Das Neue Testament geht einen Schritt
weiter und verurteilt den Geiz als Götzendienst und die Habgier als gemein
schaftsschädigende, egoistische Entgleisung mit Tendenz zur Gewalttätigkeit."
31
Das Verständnis des menschlichen Handelns ist im Mittelalter bestimmt vom
Glauben an die Sünde. Dieser Glaube an die Sündhaftigkeit und die Schuld des
Menschen ist bis dato in diesem Ausmaß noch nicht da gewesen. ,,Im Daseinsver
ständnis der griechischen Tragödie ist die Schuld nicht moralisch und theologisch
verstanden, sondern als schicksalhafte Notwendigkeit in der Existenz des Men
schen begründet."
32
Determinismus, Fatalismus und der Dualismus der antiken
Philosophie verhinderten ein Aufkommen eines ähnlichen Bewusstseins für Sünde
und Schuld, wie es die Kirche im Mittelalter verbreitete.
Unter Sünde versteht man das ,,Handeln (wollen) ohne Gott bzw. gegen Gottes
29 Russel, 1999, S. 320
30 vgl. Malmquist, 2000, S. 43
31 Schönberger, 2004, S. 27
32 Fries, 1963, S. 597
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
18
Gebote".
33
Die klassische Sündenlehre wie wir sie heute größtenteils kennen,
entwickelte erst Augustinus und später Thomas von Aquin.
34
In der Scholastik
wurde dann die Unterscheidung in Todsünde und lässliche Sünde getroffen. Die
Todsünde ist eine den Menschen aus dem Gnadenstand ausschließende, d.h. zum
geistigen Tod führende, Sünde.
35
Es gibt in der katholischen Lehre (speziell in der
Dogmatik) sieben Todsünden: Stolz (Superbia), Geiz (Avaritia), Neid (Invidia),
Zorn (Ira), Wollust (Luxuria), Völlerei (Gula) und Faulheit (Acedia).
36
Der Geiz wird hier also sehr klar negativ gewertet. Derart deutlich steht dies in
der Bibel nicht, wenngleich das Abfallen vom Glauben bzw. das zu starke Hin
wenden an weltliche Güter Strafandrohungen nach sich zieht. Im Brief des Paulus
an die Römer heißt es beispielsweise: ,,Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her
offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen [...]"
37
.
Im ersten Brief des Paulus an die Korinther steht zu lesen: ,,[...] Ihr sollt nichts mit
einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger
oder ein Geiziger oder ein Götzendiener [...]; mit so einem sollt ihr auch nicht
essen."
38
Vor den Irrlehren, zu denen auch die Liebe zum Geld gezählt wurde,
warnt Paulus in seinem zweiten Brief an Petrus: ,,[...] und aus Habsucht werden
sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. [...]"
39
. Folgendes ist im
MatthäusEvangelium (Neues Testament) zum Verhältnis Glauben und Habgut zu
lesen: ,,Niemand kann zwei Herren dienen: entweder wird er den einen hassen und
den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten.
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon."
40
Geld wird hier als Konkurrenz
zu Gott bzw. zum Glauben verstanden. Jede Konkurrenz birgt eine Entscheidungs
möglichkeit für das eine oder das andere in sich. Der Inhalt der Bibel bestimmte
das mittelalterliche Leben maßgeblich. So konnte auch die potentielle Entschei
33 Hauck / Schwinge, 2002, S. 189
34 Fries, 1963, S. 601
35 Hauck / Schwinge, 2002, S. 189
36 Wikipedia 2005/2006: Todsünden
37 Bibel, Neues Testament: Römer 1,18
38 Bibel, Neues Testament: 1 Korinther 5,11
39 Bibel, Neues Testament: 2 Petrus 2,3
40 Bibel, Neues Testament: Matthäus 6,24
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
19
dung für das Materielle für den Gläubigen über die Sündenlehre unattraktiv ge
macht werden. Im ersten Brief des Paulus an Timotheus wird die übertriebene
Orientierung am Weltlichen ebenfalls erwähnt: ,,Denn Geldgier [Geiz] ist eine
Wurzel allen Übels; danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt
und machen sich selbst viel Schmerzen."
41
Dieses Bibelzitat erinnert wohl nicht
von ungefähr an den Satz von Diogenes ,,Der Geiz ist die Mutterstadt allen
Übels", der bereits unter 2.2.1 zitiert wurde. Auf diesen Ausspruch jedenfalls geht
das allseits bekannte Sprichwort ,,Geiz ist die Mutter aller Übel" zurück. Auf die
Mutter wird sich wegen der weiblichen Fähigkeit des Gebärens bezogen. Geiz ge
biert also Übel. Für den Gläubigen darf es immer nur ein entweder / oder geben:
entweder er glaubt an Gott oder er glaubt an das Geld. Dies erscheint sehr bizarr,
kann man doch an Gott glauben und dennoch Geld verdienen oder sparen. Es ist
jedoch anzunehmen, dass sich diese Verteufelung von weltlichen Gütern aus den
damaligen Notsituationen erklärt. Wenn die Menschen damals kaum genug zu
essen hatten, war jemand der ihren (also kein Adeliger), der sich hauptsächlich um
die Vermehrung seines Besitzes kümmerte und nichts abgab, eine Gefahr für die
leidende Gemeinschaft. Das soziale Geben war sehr wichtig für das Überleben
vieler. So wird auch verständlicher, weswegen der Geiz im römischkatholischen
Glauben damals zu einer Todsünde stigmatisiert wurde. In einer Zeit, in der es
wichtig war, dass die Gemeinschaft zusammenhielt, konnte das Ausscheren
Vereinzelter durchaus gefährlich für alle sein.
42
Im höfischen Rittertum des Mittelalters dann schloss der Tugendkodex den
Geiz als gänzlich unsittlich aus. Ein vollkommener Ritter hatte sich durch seine
innere Haltung, sein ästhetisches Äußeres sowie durch Tapferkeit und Selbstlosig
keit auszuzeichnen.
43
Übertriebenes Besitzstreben oder Festhalten am Besitz hätte
den Ritter gemäß der christlich geprägten Tugenden der höfischen Zeit unwürdig
gemacht. Geiz bei einem Ritter wurde als Verrat am ,,höheren Ziel", nämlich Gott
und der Gemeinschaft, angesehen.
41 Bibel, Neues Testament: 1. Timotheus 6,10
42 Über die Zustände im Mittelalter und den Einfluss der Kirche interessant nachzulesen bei Rus
sel, 1999, S. 317ff
43 vgl. Malmquist, 2000, S.45
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
20
2.2.3
Geiz in der Neuzeit
In der Neuzeit wird Geiz nicht mehr als Todsünde verstanden. Die Bewertung
dieser Eigenschaft hat sich im Zuge einer neuen Lebensauffassung, sichererer
Lebensumstände und gelinderter wirtschaftlicher Not gemildert. Wie revolutionär
die neue Auffassung von Arbeit ist, zeigt sich in einem deutlichen Wandel der
Werte. ,,Seit jeher und seit der Antike sogar philosophisch begründet hatte gegol
ten, dass nicht die Arbeit, sondern die Kultivierung der Muse zum wahren Men
schen führt. Jetzt kehrt sich das Verhältnis um [...].
44
In der Arbeit wird der neue
Sinn des Lebens und die Aufgabe eines jeden Individuums gesehen. Mit dieser
Einstellung ändert sich aber auch das Verhältnis der Menschen zum Geld. Die Be
lohnung für ein arbeitsreiches Leben mag ja im Jenseits auf jeden warten, viel nä
her ist sie den Menschen allerdings in Form von geldwerter Bezahlung im Dies
seits.
Zwar gilt Geiz noch immer als ein Laster, doch beschäftigt man sich offener
mit den wirtschaftlichen Vor und Nachteilen von Geiz. Die sozialen Nachteile des
Geizes geraten etwas aus dem Fokus der Betrachtung. Durch das Aufkommen des
Kapitalismus als Wirtschaftsordnung gewinnt das Geld nicht nur als Zah
lungsmittel zunehmend an Bedeutung. Die gesellschaftlichen Strukturen weichen
etwas auf. Nicht die Geburt alleine bestimmt nunmehr das Schicksal eines Men
schen. Über Bildung und Fleiß können sich die Individuen nach oben arbeiten.
Ansehen genießt nun immer mehr, wer über ausreichende finanzielle Mittel
verfügt, selbst wenn seine sozialen Fähigkeiten bestenfalls minimal sind. Diese
Orientierung an wirtschaftlichen Gesichtspunkten fördert eine mildere
Beurteilung von Geiz, versucht doch der Geizige immerhin, seinen Besitz zu
wahren oder gar zu vergrößern. Trotzdem wird die zu heftige Ausprägung von
Geiz weiterhin negativ aufgenommen, da der Geiz letztendlich
kapitalismusfeindlich ist: Dort, wo nichts gegeben wird, kann nichts genommen
werden. Geiz ist also nach wie vor keine Tugend.
,,Die Einheit des Reiches, der Kirche und der ständischen Feudalgesellschaft
44 Krockow von, 1989, S. 17
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
21
konnte [...] im ausgehenden Mittelalter nicht mehr aufrecht erhalten werden. Die
Einheit der abendländischen Kirche zerbricht durch die Reformation endgültig.
Damit hört auch die Identität des Christentums mit der einen, gesellschaftlich
verfassten Kirche im abendländischen Kulturraum auf."
45
Mit diesem Zusammen
bruch der kirchlichen Werteordnung und dem wirtschaftlichen Erstarken der
Länder ist Raum für neue Einflüsse und eine Umorientierung in der Bewertung
vieler Eigenschaften, so auch des Geizes.
Als nachhaltig beeinflussend erweist sich die Umwertung von Arbeit als reiner
Berufstätigkeit zur inneren Berufung. Leistung statt Luxus lautet ab sofort die De
vise, die im Puritanismus so weit getrieben wird, dass es außer Arbeit und Gebet
überhaupt nichts mehr geben soll.
46
Baruch Spinoza (1632 1677) sieht im Geiz
eine Spielart der Liebe.
47
Das mag seltsam klingen, ist aber gar nicht so abwegig,
wenn man bedenkt, was Menschen alles zu lieben glauben. Spinoza spielt auf die
Liebe zum Geld an, die, wie auch die Liebe zu einem Menschen, krankhafte Züge
annehmen kann. Dieser übertriebenen Liebe zum Geld oder auch zum Besitz
gegenüber ist der geizige Mensch ohnmächtig. Im Grunde argumentiert Spinoza
hier schon auf dem Gleise der modernen Psychologie. Dennoch entschuldigt er
Geiz nicht als Krankheit. Ein solches Verständnis von Spinoza würde zu weit füh
ren. Geiz ist für ihn ein Affekt, ebenso wie die Verschwendung, und beide sind
bedenkliche Extreme des menschlichen Verhaltens.
Immanuel Kant (1724 1804) hat sich ebenfalls mit dem Geiz beschäftigt.
Ähnlich wie Theophrast unterscheidet er drei Formen des Geizes: den hab
süchtigen, den kargen und den gegen sich selbst gerichteten Geiz.
48
Unter dem
habsüchtigen Geiz versteht Kant die Erweiterung der Mittel zum Wohlleben, je
doch über die Schranken der wahren Bedürfnisse hinaus. Der habsüchtige Mensch
verstößt damit gegen die Pflicht der Wohltätigkeit gegen andere. Der karg Geizige,
oder auch knickrige Mensch, macht sich einer Vernachlässigung seiner
Liebespflicht nicht nur gegen andere sondern auch gegen sich selbst schuldig, in
45 Coreth; Schöndorf, 1983, S. 14
46 vgl. Krockow von, 1989, S. 16
47 vgl. Busch, 2004, S. 390 und Höffe, 1998, S. 206
48 Kant, 1998a, S. 565 ff.
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
22
dem er mehr nimmt als er gibt. Der Geiz gegen sich selbst ist als das Absenken
des eigenen Genusses unter das wahre Maß der eigenen Bedürfnisse zu verstehen,
womit der Geizige wieder gegen die Liebespflicht gegen sich selbst verstößt.
49
In
der ,,Anthropologie in pragmatischer Hinsicht" schreibt Kant zu diesem Thema:
,,[Das Geld] hat eine Habsucht hervorgebracht, die zuletzt auch ohne Genuss in
dem blossen Besitze, selbst mit Verzichtuung (des Geizigen) auf allen Gebrauch
eine Macht erhält, von der man glaubt, dass sie den Mangel jeder anderen zu
ersetzen hinreichend sei."
50
Für Kant ist Geiz zwar nicht immer moralisch
verwerflich
51
, dennoch sieht er in ihm einen klaren Verstoß gegen die Pflichten,
die ein Mensch gegenüber sich selbst und der Gemeinschaft hat. Er beruft sich
hierbei u.a. auch auf die Tugendlehre des Aristoteles. Im Gegensatz zu der
Gewichtung von Geiz als eine der sieben Todsünden im Mittelalter, nimmt Kant,
als einer der Vertreter der Neuzeit, das Laster ganz offensichtlich etwas leichter.
Dies erklärt sich dadurch, dass sich seit dem 16. Jahrhundert die Beurteilung von
Geld grundlegend geändert hat.
52
Dies hing mit dem aufkeimenden Kapitalismus
als neuer Wirtschaftsordnung zusammen. ,,Durch das Heraustreten aus den alten
Gemeinschaften wurden künstliche und kunstvolle Beziehungen in neuer Form ge
schaffen. Die zunehmende Entpersönlichung und Entkonkretisierung, das heißt
die fortschreitende Versachlichung oder Vergeistigung aller Lebensformen, die
Verflüchtigung aller wirtschaftlichen Vorgänge gestalteten das Leben verwickel
ter, unübersichtlicher, schwieriger."
53
Francis Bacon (1561 1654) plädierte beispielsweise 1597 mit einem Essay
noch für die Beibehaltung des Wuchers, als konstituierende Bedingung für den
Kapitalismus.
54
Doch auch wenn er über den Geiz selbst nichts sagt, schreibt er:
,,Eigennützigkeit ist in all ihren Spielarten etwas niederträchtiges."
55
Bei aller
Begeisterung für den Kapitalismus geht auch Bacon offensichtlich nicht so weit,
49 vgl. ebd. S. 566
50 Kant, 1983, S. 220
51 vgl. Kant, 1983, S. 220: Altersgeiz als Ausgleich körperlichen Unvermögens
52 vgl. hierzu auch Sombart, 2003, S. 85 ff sowie S. 97 ff
53 Sombart, 2003., S. 98
54 vgl. Busch, 2004, S. 395
55 Höffe, 1998, S. 186
D
IE
B
EWERTUNG
VON
G
EIZ
IM
W
ANDEL
DER
Z
EIT
23
den Geiz tatsächlich als Tugend und nicht als Laster zu bezeichnen.
JeanJacques Rousseau (1712 1778) beschreibt den Preis der Aufbruchstim
mung in der Neuzeit folgendermaßen: ,,In dem Maß, in dem unsere Wissen
schaften und Künste zur Vollkommenheit fortschritten, sind unsere Seelen
verderbt geworden."
56
Ähnlich sieht es Voltaire wenn er schreibt: ,,[...] denn in der
Gesellschaft nehmen die Mängel zu, und die guten Eigenschaften vermindern
sich."
57
Nicht fehlen darf an dieser Stelle natürlich Molières Darstellung eines Gei
zigen in seiner Prosakomödie ,,Der Geizige". Am Beispiel des alten Harpagon
zeigt Molière die bösen Folgen des Geizes, der bei dem Protagonisten alle natürli
chen Empfindungen und Reaktionen ausgelöscht hat. Der Inhalt seiner Geld
kassette bedeutet ihm mehr als das Glück seiner eigenen beiden Kinder. Seine
Tochter Elise verspricht er einem alten Mann, weil dieser bereit ist, auf die übliche
Mitgift zu verzichten. Sein Sohn soll eine berüchtigte Witwe heiraten, die über ein
gewisses Vermögen verfügt. Während er all dies in die Wege leitet, hat Harpagon
beständig panische Angst davor, bestohlen zu werden.
58
Diese Angst beherrscht
fast sein gesamten Denken, den Rest verwendet er darauf, mit allerlei nicht immer
legalen Geschäften sein Vermögen zu vermehren. Harpagon verwendet seine ge
samte Energie darauf, Besitz zu halten und am Besten auch zu vermehren, seine
Pflichten als Vater ebenso wie die als Mitglied der Gemeinschaft vernachlässigt er
sehr stark. Schlimmer noch: er erkennt sie nicht einmal. Am Ende der tragisch
komischen Handlung siegt die Liebe über den Geiz, also das Soziale über das An
tisoziale. Sohn und Tochter wählen jeweils einen Partner, den sie lieben, und Har
pagon bleibt mit seiner Geldkassette alleine zurück.
2.2.4
Geiz in der Moderne
Nachdem der Geiz nun also erst etwas eher Lächerliches (Antike), dann eine Tod
sünde (Mittelalter), dann wieder eine hinzunehmende Schrulligkeit (Neuzeit) war,
56 Höffe, 1998, S. 222
57 Schleichert, 1998, S. 111
58 vgl. Molière, 1987, S. 13: Harpagon beschuldigt den unschuldig wartenden La Flèche, ihn
bestohlen zu haben und erdreistet sich, ihn zu durchsuchen.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836605120
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bayreuth – Philosophie, Sozialphilosophie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- philosophie gesellschaft konsum identität verantwortung
- Produktsicherheit
- Diplom.de