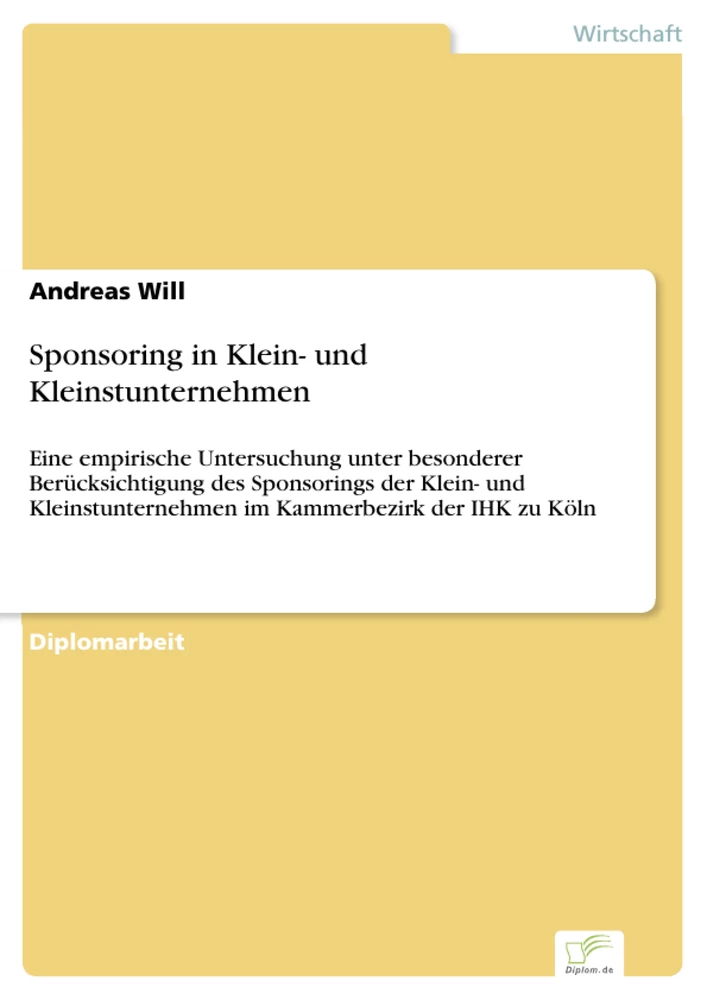Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Sponsorings der Klein- und Kleinstunternehmen im Kammerbezirk der IHK zu Köln
©2006
Diplomarbeit
117 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Sponsoring boomt. Insbesondere im Jahr 2006 rollte mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland eine wahre Flut von Sponsoringbotschaften über die Deutsche Bevölkerung hinweg. Das Sponsoringvolumen erreichte mit geschätzten 4,7 Mrd. Euro einen historischen Wert .
Seit Mitte der achtziger Jahre sind jährlich zweistellige Zuwachsraten bei den Sponsoringaufwendungen zu beobachten . Während die Unternehmen im Jahr 1985 umgerechnet ca. 120 Mio. Euro in Sponsoring investierten , prognostizierte die Studie Sponsor-Visions 2006 für das Jahr 2007 ein Sponsoringvolumen von 3,9 Mrd. Euro in Deutschland mit steigender Tendenz. Der Sponsoringmarkt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. In Deutschland nutzten mit 76,8% noch nie so viele der umsatzstärksten Betriebe und Dienstleistungsunternehmen Sponsoring im Rahmen ihres Kommunikationsmixes . Auch der Anteil des Kommunikationsbudgets, der in das Sponsoring fließt, hat mit 15,6% einen Rekordwert erreicht . Sponsoring ist zu einem festen Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation geworden und aus der Welt des Marketing nicht mehr wegzudenken. Und auch in Zukunft sieht die Sponsoringbranche rosigen Zeiten entgegen: Sponsoring ist das Instrument der Zukunft was die Markenkommunikation angeht.
Betrachtet man diese Aussage in Zusammenhang mit bisher durchgeführten empirischen Studien, muss man allerdings feststellen, dass diese nur für große Unternehmen Gültigkeit besitzen kann. Die wichtigsten Studien Sponsoring Trends 2000 - 2006, Sponsor-Visions 2005 bzw. Sponsor-Visions 2006 beschränken sich nämlich bei ihren Untersuchungen lediglich auf die umsatzstärksten Unternehmen, obwohl diese Unternehmensgruppe in Deutschland nur einen Anteil von gerade einmal 0,4% an der Gesamtheit der Unternehmen bildet . Es lässt sich daher keine Aussage darüber machen, ob und wie Sponsoring in kleineren Unternehmen, speziell in der Gruppe der Klein- und Kleinstunternehmen, betrieben wird.
In Deutschland gibt es über drei Mio. Klein- und Kleinstunternehmen . Die hohe Anzahl dieser Unternehmen ist dabei besonders für das Sponsoring interessant. Jedes dieser Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, ist ein potentieller Sponsor. MAAß/CLEMENS fanden in ihrer Studie Corporate Citizenship Das Unternehmen als guter Bürger heraus, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen eine hohe Bereitschaft besitzen, sich als Sponsoren zu engagieren oder für das […]
Sponsoring boomt. Insbesondere im Jahr 2006 rollte mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland eine wahre Flut von Sponsoringbotschaften über die Deutsche Bevölkerung hinweg. Das Sponsoringvolumen erreichte mit geschätzten 4,7 Mrd. Euro einen historischen Wert .
Seit Mitte der achtziger Jahre sind jährlich zweistellige Zuwachsraten bei den Sponsoringaufwendungen zu beobachten . Während die Unternehmen im Jahr 1985 umgerechnet ca. 120 Mio. Euro in Sponsoring investierten , prognostizierte die Studie Sponsor-Visions 2006 für das Jahr 2007 ein Sponsoringvolumen von 3,9 Mrd. Euro in Deutschland mit steigender Tendenz. Der Sponsoringmarkt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. In Deutschland nutzten mit 76,8% noch nie so viele der umsatzstärksten Betriebe und Dienstleistungsunternehmen Sponsoring im Rahmen ihres Kommunikationsmixes . Auch der Anteil des Kommunikationsbudgets, der in das Sponsoring fließt, hat mit 15,6% einen Rekordwert erreicht . Sponsoring ist zu einem festen Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation geworden und aus der Welt des Marketing nicht mehr wegzudenken. Und auch in Zukunft sieht die Sponsoringbranche rosigen Zeiten entgegen: Sponsoring ist das Instrument der Zukunft was die Markenkommunikation angeht.
Betrachtet man diese Aussage in Zusammenhang mit bisher durchgeführten empirischen Studien, muss man allerdings feststellen, dass diese nur für große Unternehmen Gültigkeit besitzen kann. Die wichtigsten Studien Sponsoring Trends 2000 - 2006, Sponsor-Visions 2005 bzw. Sponsor-Visions 2006 beschränken sich nämlich bei ihren Untersuchungen lediglich auf die umsatzstärksten Unternehmen, obwohl diese Unternehmensgruppe in Deutschland nur einen Anteil von gerade einmal 0,4% an der Gesamtheit der Unternehmen bildet . Es lässt sich daher keine Aussage darüber machen, ob und wie Sponsoring in kleineren Unternehmen, speziell in der Gruppe der Klein- und Kleinstunternehmen, betrieben wird.
In Deutschland gibt es über drei Mio. Klein- und Kleinstunternehmen . Die hohe Anzahl dieser Unternehmen ist dabei besonders für das Sponsoring interessant. Jedes dieser Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, ist ein potentieller Sponsor. MAAß/CLEMENS fanden in ihrer Studie Corporate Citizenship Das Unternehmen als guter Bürger heraus, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen eine hohe Bereitschaft besitzen, sich als Sponsoren zu engagieren oder für das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Andreas Will
Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
Eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Sponsorings der
Klein- und Kleinstunternehmen im Kammerbezirk der IHK zu Köln
ISBN: 978-3-8366-0491-8
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Deutsche Sporthochschule Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
II
II
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis...II
Abkürzungsverzeichnis... III
Anhangsverzeichnis ...IV
Abbildungsverzeichnis... V
Tabellenverzeichnis ...VI
1
Einleitung ... 1
2
Fragestellung und Ziele ... 5
3
Theoretische Grundlagen... 6
3.1
Sponsoring ... 6
3.2
Definition Sponsoring ... 6
3.2.1
Erscheinungsformen des Sponsoring... 9
3.2.2
Sponsoring als Teil der Unternehmenskommunikation... 10
3.2.3
Professionelle Durchführung von Sponsoring... 12
3.2.4
Grundregeln des Sponsorings ... 13
3.3
Klein- und Kleinstunternehmen ... 15
3.3.1
Definitionen ... 15
3.3.2
Bedeutung von kleinen Unternehmen in Deutschland... 18
4
Methodik ... 20
4.1
Konzeption ... 20
4.1.1
Sponsoringaktivität ... 20
4.1.2
Sponsoringprofessionalität ... 26
4.1.3
Sponsoringerfolg ... 34
4.2
Methode ... 38
4.2.1
Onlinebefragung... 38
4.2.2
Fragebogendesign ... 40
4.2.3
Untersuchungseinheiten... 42
4.2.4
Pretest... 42
4.2.5
Datenerhebung ... 43
4.3
Methodenkritik ... 44
4.3.1
Kritik an der Stichprobe ... 44
4.3.2
Kritik am Fragebogen... 45
5
Darstellung der Ergebnisse ... 48
5.1
Rücklaufdokumentation ... 48
5.2
Datenbereinigung... 49
5.3
Teilnehmende Unternehmen ... 50
5.3.1
Unternehmensgröße ... 50
5.3.2
Wirtschaftsbereich ... 51
5.3.3
Marketingbudget ... 52
5.4
Sponsernde Unternehmen ... 53
5.5
Sponsoringprofessionalität ... 59
5.6
Sponsoringqualifikation... 61
5.7
Erfolgseinschätzung ... 63
6
Datenanalyse und Interpretation... 66
6.1
Sponsoringaktivität der Unternehmen... 66
6.1.1
Unternehmensgröße ... 67
6.1.2
Wirtschaftszweig ... 68
Inhaltsverzeichnis
II
III
6.1.3
Abnehmerkreis ... 69
6.1.4
Güter und Dienstleistungen ... 70
6.1.5
Marketingbudget ... 70
6.2
Sponsoringprofessionalität der Unternehmen ... 71
6.2.1
Budget... 72
6.2.2
Sponsoringqualifikation ... 73
6.3
Sponsoringerfolg ... 73
6.3.1
Sponsoringbudget ... 74
6.3.2
Sponsoringplanung ... 75
6.3.3
Sponsoringziele ... 75
6.3.4
Mitarbeiterqualifikation ... 75
6.3.5
Sponsoringprofessionalität ... 77
7
Schlussbetrachtung... 78
8
Ausblick ... 83
Literaturverzeichnis ... 85
Anhang... 91
Abkürzungsverzeichnis
II
III
Abkürzungsverzeichnis
ADM
Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
ARD
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland
DSF
Deutsches Sport-Fernsehen
Ebd.
Ebenda
e.V.
eingetragener Verein
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HTML Hypertext Markup Language
http
Hypertext Transfer Protocol
IHK
Industrie- und Handelskammer
IP
Internet Protocol
Mio.
Million(en)
Mrd.
Milliarde(n)
N
Anzahl der Teilnehmer
pdf
Portable Document Format
PHP
Hypertext Preprocessor
www
World Wide Web
ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
Anhangsverzeichnis
IV
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Erstes Anschreiben ... 91
Anhang 2: Zweites Anschreiben... 91
Anhang 3: Anleitung Fragebogen... 92
Anhang 4: Fragebogen (Fragen 1-4)... 92
Anhang 5: Fragebogen (Fragen 5-8)... 93
Anhang 6: Fragebogen (Fragen 9-13) ... 93
Anhang 7: Fragebogen (Fragen 14-18) ... 94
Anhang 8: Fragebogen (Frage 19-22) ... 94
Anhang 9 (Fragen 23-27)... 95
Anhang 10: Sponsoringaktivität und Hauptkundenbereich Gastgewerbe... 96
Anhang 11: Sponsoringaktivität und Hauptkundenbereich private
Endverbraucher... 97
Anhang 12: Sponsoringaktivität und Marketingbudget (Kreuztabelle und
Korrelationen) ... 98
Anhang 13: Sponsoringaktivität und Marketingbudget (Korrelationen und
Diagramm)... 99
Anhang 14: Sponsoringprofessionalität und Sponsoringqualifikation
(Kreuztabelle, Korrelationen)...100
Anhang 15: Sponsoringprofessionalität und Sponsoringqualifikation
(Korrelationen, Diagramm)...101
Anhang 16: Erfolgseinschätzung und Planung (Kreuztabelle, Korrelationen)
...102
Anhang 17: Erfolgseinschätzung und Planung (Diagramm und Korrelationen)
...103
Anhang 18: Erfolgseinschätzung und Ziele (Kreutztabelle und Korrelationen)
...104
Anhang 19: Erfolgseinschätzung und Ziele (Diagramm, Korrelationen)...105
Anhang 20: Erfolgseinschätzung und Auswahl von Agenturen (Kreuztabelle
und Korrelationen)...106
Anhang 21: Erfolgseinschätzung und Auswahl von Agenturen (Diagramm und
Korrelationen) ...107
Abbildungsverzeichnis
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Erscheinungsformen des Sponsoring ... 10
Abbildung 2: Instrumente der Unternehmenskommunikation ... 11
Abbildung 3: Planungsprozess des Sponsoring aus Unternehmenssicht.
Quelle: Bruhn (2003) S. 34 ... 15
Abbildung 4: Aufteilung der deutschen Unternehmen nach
Unternehmensgrößen 2002 ... 19
Abbildung 5: Mögliche strukturelle Einflussgrößen auf die Sponsoringaktivität
von Klein- und Kleinstunternehmen ... 21
Abbildung 6: Mögliche Einflussfaktoren auf die Sponsoring-Professionalität
von Klein- und Kleinstunternehmen ... 27
Abbildung 7: Mögliche Einflussfaktoren auf die Erfolgseinschätzung bezüglich
der Marketingziele ... 35
Abbildung 8: Rücklauf im Befragungszeitraum... 48
Abbildung 9: Teilnehmende Unternehmen nach Größe (N=495; antwortende
Unternehmen gesamt) ... 51
Abbildung 10: Teilnehmende Unternehmen nach Wirtschaftsbereichen
(N=495; antwortende Unternehmen gesamt)... 52
Abbildung 11: Marketingbudgets (alle befragten Unternehmen; N=495) ... 53
Abbildung 12: Sponsoringaktivität (N=495; antwortende Unternehmen
gesamt) ... 54
Abbildung 13: sponsernder Unternehmen (nur sponsernde Unternehmen;
N=25) ... 55
Abbildung 14: Eingesetzte Sponsoringarten (nur sponsernde Unternehmen;
N=71; Mehrfachnennungen möglich)... 56
Abbildung 15: Sponsoringaktivität nach Wirtschaftsbereichen (N=495;
antwortende Unternehmen gesamt) ... 57
Abbildung 16: Sponsoringaktivität und Kundenkreis (N=495; antwortende
Unternehmen gesamt) ... 58
Abbildung 17: Sponsoringaktivität und Art der Güter und
Dienstleistungen(N=495; antwortende Unternehmen gesamt) ... 59
Abbildung 18: Planung von Sponsoring (nur sponsernde Unternehmen;
N=71) ... 60
Abbildung 19: Operationalisierbarkeit der Sponsoringziele (nur sponsernde
Unternehmen; N=71) ... 60
Abbildung 20: Sponsoringprofessionalität (nur sponsernde Unternehmen;
N=71) ... 61
Abbildung 21: Sponsoringqualifikation der Mitarbeiter (nur sponsernde
Unternehmen; N=71) ... 62
Abbildung 22: Einsatz von Agenturen (nur sponsernde Unternehmen; N=71)
... 63
Abbildung 23: Durchführung einer Erfolgskontrolle ... 64
Abbildung 24: Erfolgseinschätzung in Bezug auf die Erreichung der
Marketingziele (nur sponsernde Unternehmen; N=71) ... 64
Abbildungsverzeichnis
VI
Abbildung 25: Gründe für Sponsoring (nur sponsernde Unternehmen; N=66;
Mehrfachnennungen möglich) ... 65
Tabellenverzeichnis
VI
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Größenklassifizierung der europäischen Unternehmen nach
Mitarbeitern, Jahresumsatz und Jahresbilanzsumme ... 17
Tabelle 2: Unternehmen 2002 nach Beschäftigten- und Umsatzgrößenklassen
... 18
Tabelle 3: Klassifizierung der Wirtschaftsgliederungen ... 23
Tabelle 4: Anteil von Gewerbe und privaten Haushalten in Deutschland... 24
Tabelle 5: Überprüfung der Definition von Sponsoring ... 28
Tabelle 6: Gewichtung der Antworten zur Definition von Sponsoring... 28
Tabelle 7: Bewertung der Dauer von Sponsoring ... 29
Tabelle 8: Bewertung der Vorgehensweise bei der Planung von Sponsoring 30
Tabelle 9: Bewertung der Planung von Sponsoring ... 30
Tabelle 10: Bewertung konzeptionelles Vorgehen beim Sponsoring... 31
Tabelle 11: Bewertung der Erfolgskontrolle ... 32
Tabelle 12: Bewertung Sponsoringprofessionalität ... 32
Tabelle 13: Bewertung Sponsoringerfahrung ... 33
Tabelle 14: Bewertung Sponsoringausbildung ... 34
Tabelle 15: Bewertung Sponsoringqualifikation... 34
Tabelle 16: Übersicht Korrelationen mit Sponsoringaktivität ... 67
Tabelle 17: Übersicht Korrelationen mit Sponsoringprofessionalität... 72
Tabelle 18: Übersicht Korrelationen mit Erfolgseinschätzung ... 74
Einleitung
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
1
1
Einleitung
Sponsoring boomt. Insbesondere im Jahr 2006 rollte mit der Fußball-
Weltmeisterschaft in Deutschland eine wahre Flut von Sponsoringbotschaften
über die Deutsche Bevölkerung hinweg. Das Sponsoringvolumen erreichte
mit geschätzten 4,7 Mrd. Euro
1
einen historischen Wert
2
.
Seit Mitte der achtziger Jahre sind jährlich zweistellige Zuwachsraten bei den
Sponsoringaufwendungen zu beobachten
3
. Während die Unternehmen im
Jahr 1985 umgerechnet ca. 120 Mio. Euro in Sponsoring investierten
4
,
prognostizierte die Studie ,,Sponsor-Visions 2006" für das Jahr 2007 ein
Sponsoringvolumen von 3,9 Mrd. Euro in Deutschland mit steigender
Tendenz.
5
Der Sponsoringmarkt hat sich in den vergangenen drei
Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. In Deutschland nutzten mit 76,8%
noch
nie
so
viele
der
umsatzstärksten
Betriebe
und
Dienstleistungsunternehmen
Sponsoring
im
Rahmen
ihres
Kommunikationsmixes
6
. Auch der Anteil des Kommunikationsbudgets, der in
das Sponsoring fließt, hat mit 15,6% einen Rekordwert erreicht
7
. Sponsoring
ist zu einem festen Bestandteil moderner Unternehmenskommunikation
geworden und aus der Welt des Marketing nicht mehr wegzudenken. Und
auch in Zukunft sieht die Sponsoringbranche rosigen Zeiten entgegen:
Sponsoring ist das Instrument der Zukunft was die Markenkommunikation
angeht.
8
Betrachtet man diese Aussage in Zusammenhang mit bisher durchgeführten
empirischen Studien, muss man allerdings feststellen, dass diese nur für
große Unternehmen Gültigkeit besitzen kann. Die wichtigsten Studien
1
K
LOTZ
,
P. (2005): Konsolidierung nach WM-Euphorie in: SPONSOR
S
10, (2005) 2 S. 24f
2
Bedingt durch die Fußball Weltmeisterschaft
3
B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring, S. 24
4
ebd. S. 24
5
H
OHENAUER
,
R..
(2006): Fußball-WM pusht Sponsoringvolumen in: SPONSOR
S
11, (2006) 2 S. 18-
19.
6
H
ERMANNS
,
A. (2006): Sponsoring Trends 2006 S. 35
7
ebd. S. 36
8
K
LOTZ
,
P. (2005): Konsolidierung nach WM-Euphorie in: SPONSOR
S
10, (2005) 2 S. 24
Einleitung
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
2
,,Sponsoring Trends 2000 - 2006", ,,Sponsor-Visions 2005" bzw. ,,Sponsor-
Visions 2006" beschränken sich nämlich bei ihren Untersuchungen lediglich
auf die umsatzstärksten Unternehmen, obwohl diese Unternehmensgruppe in
Deutschland nur einen Anteil von gerade einmal 0,4% an der Gesamtheit der
Unternehmen bildet
9
. Es lässt sich daher keine Aussage darüber machen, ob
und wie Sponsoring in kleineren Unternehmen, speziell in der Gruppe der
Klein- und Kleinstunternehmen, betrieben wird.
In Deutschland gibt es über drei Mio. Klein- und Kleinstunternehmen
10
. Die
hohe Anzahl dieser Unternehmen ist dabei besonders für das Sponsoring
interessant. Jedes dieser Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, ist ein
potentieller Sponsor. M
AAß
/C
LEMENS
(2002)
fanden in ihrer Studie
Corporate
Citizenship Das Unternehmen als ,,guter Bürger"
heraus, dass insbesondere
kleine und mittlere Unternehmen eine hohe Bereitschaft besitzen, sich als
Sponsoren zu engagieren
11
oder für das Gemeinwohl einzusetzen
12
. Dies ist
zum einen ein Hinweis darauf, dass ein Interesse daran bestehen kann,
Sponsoring auch in kleinen Unternehmen professionell zu gestalten, zum
anderen bietet diese Bereitschaft der kleinen Unternehmen zum Engagement
speziell für Non-Profit Organisationen, wie z.B. Sportvereinen, neue
Finanzierungsquellen.
Auch in der Fachliteratur trifft das Themengebiet Sponsoring auf reges
Interesse. Der SPONSOR
S
Literatur-Report 2004 verweist auf 75 Quellen zum
Thema Sponsoring
13
, rund die Hälfte davon wurden erst im Jahre 2000 oder
später herausgegeben, was die Aktualität der Thematik unterstreicht. Dazu
kommen zahlreiche Fachartikel und Studien. Leider sucht man bisher
vergeblich nach Literaturquellen, die sich mit Sponsoring speziell in kleineren
Unternehmen
beschäftigen.
Lediglich
M
AAß
/C
LEMENS
(2002)
liefern
9
vgl. Kapitel 3.3.2
10
N
AHM
/P
HILIPP
(2005):
Strukturdaten aus dem Unternehmensregister und Aspekte der
Unternehmensdemografie in: W
IRTSCHAFT UND
S
TATISTIK
9, (2005) S. 941
11
M
AAß
/C
LEMENS
(2002): Corporate Citizenship S. 29
12
ebd. S.113
13
K
LEWENHAGEN
,
M. (2004): SPONSOR
S
Literatur-Report S. 39-49
Einleitung
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
3
Ansatzpunkte bezüglich Sponsoring in kleineren Unternehmen.
Standardwerke zum Thema Marketing und Sportmarketing (z.B. M
EFFERT
(2000): Marketing; F
REYER
(2003): Sportmarketing, sowie die gängige
Literatur zum Thema Sponsoring und Sportsponsoring (B
RUHN
(2003):
Sponsoring; H
ERMANNS
(1997): Sponsoring; R
OTH
(1990): Sportsponsoring;
D
REES
(1992): Sportsponsoring.) geben zwar einen guten Überblick über
Sponsoring allgemein und waren auch für diese Arbeit hilfreiche Quellen,
dennoch sind diese Werke zu wenig spezifisch um die Besonderheiten von
Sponsoring in kleinen Unternehmen hervorzuheben.
Auch die meisten wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit Sponsoring
beschäftigen sind zu fallspezifisch und geben keinen guten Überblick über
Sponsoring in kleinen Unternehmen oder sind nur auf große Unternehmen
zugeschnitten, wie etwa die Sponsoringstudien
,,Sponsoring Trends"
oder
,,Sponsor Visions"
. Speziell die beiden letztgenannten beschäftigen sich fast
ausschließlich mit den größten deutschen Unternehmen und sind daher nicht
repräsentativ für alle Unternehmensgrößen.
Zwar gibt es eine Vielzahl von Arbeiten, die sich mit dem Thema Sponsoring
allgemein, oder Sponsoring in großen Unternehmen befassen, aber kaum
eine Quelle gibt Hinweise darauf ob und wie Sponsoring in kleinen
Unternehmen betrieben wird.
Da die eben genannten Literaturquellen ungeeignet sind, um Sponsoring in
kleinen Unternehmen zu beschreiben, soll nicht näher auf sie eingegangen
werden. Vielmehr wurden aus diesen Quellen Anregungen gewonnen, die in
diese Arbeit mit eingeflossen sind und im weiteren Verlauf der Arbeit
dargestellt werden.
Aufgrund der in der Fachliteratur bestehenden Forschungslücke, welche die
Relevanz einer wissenschaftlichen Arbeit begründet, beschäftigt sich diese
Arbeit näher mit dem Themenfeld ,,Sponsoring in kleinen Unternehmen". Im
Fokus des Interesses steht hierbei die Gruppe der Klein- und
Einleitung
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
4
Kleinstunternehmen als die in Deutschland zahlenmäßig am stärksten
vertretene Unternehmensgruppe
14
.
Zum allgemeinen Verständnis wird in den folgenden Kapiteln näher auf
zentrale Begriffe wie ,,Sponsoring" und ,,Klein- und Kleinstunternehmen"
eingegangen. Ziel dieser Arbeit war es zu zeigen in welchem Umfang, mit
welcher Professionalität und mit welchem Erfolg kleine Unternehmen
Sponsoring betreiben.
Um den Umfang der Untersuchung einzugrenzen beschränkte sich diese
Arbeit auf die Klein- und Kleinstunternehmen des IHK-Bezirks Köln. Als
Methode wurde eine empirische Erhebung anhand eines Onlinefragebogens
gewählt. Um die Sponsoringprofessionalität und Sponsoringqualifikation der
Mitarbeiter
der
befragten
Unternehmen
anhand
der
gewählten
Befragungsmethode bewerten zu können, wurde zuvor ein Instrument
entwickelt,
mit
welchem
es
möglich
war
sowohl
die
Sponsoringprofessionalität
als
auch
die
Mitarbeiterqualifikation
zu
operationalisieren und messbar zu machen. Die Datenerhebung erfolgte im
Juli/August 2006 und die gewonnenen Daten wurden mittels des
Statistikprogrammes ,,SPSS für Windows" in der Version 11.5.1. ausgewertet.
14
vgl. Kapitel 3.3.2
Fragestellung und Ziele
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
5
2
Fragestellung und Ziele
Wie bereits erwähnt, ließ die geringe Zahl an bisher vorliegenden
Forschungsergebnissen nur bedingt Aussagen zum Thema ,,Sponsoring in
kleinen
Unternehmen"
zu.
Offensichtlich
findet
das
Kommunikationsinstrument Sponsoring aber auch in kleinen Unternehmen
Anwendung. Im Rahmen dieser Arbeit stellten sich daher folgende zentrale
Fragen:
1.
Welche Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass Sponsoring in
Klein- und Kleinstunternehmen betrieben wird? (Sponsoringaktivität)
2.
Wie professionell wird Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
betrieben,
und
welche
Faktoren
sind
dafür
maßgeblich?
(Sponsoringprofessionalität)
3.
Wie
wird
der
Erfolg
von
Sponsoring
von
Klein-
und
Kleinstunternehmen
eingeschätzt,
und
wodurch
wird
diese
Erfolgseinschätzung beeinflusst? (Sponsoring-Erfolg)
Eine Grundüberlegung dieser Arbeit war, dass bestimmte Faktoren
entscheidend dafür sein könnten, dass Sponsoring in kleinen Unternehmen
betrieben wird und dass bestimmte Faktoren auch dafür verantwortlich sein
könnten, dass Sponsoring selbst in kleinen Unternehmen professionell und
erfolgreich betrieben wird. Sponsoren sollte aufgezeigt werden wie
Sponsoring professioneller und erfolgreicher gestaltet werden kann und
Sponsornehmern sollten Informationen darüber bekommen, welche
Unternehmen sich verstärkt im Sponsoring engagieren um diese Erkenntnisse
bei ihrer Sponsorenaquise berücksichtigen zu können.
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
6
3
Theoretische Grundlagen
3.1
Sponsoring
Zum allgemeinen Verständnis dieser Arbeit ist es notwendig, die Bedeutung
und Einordnung des Kommunikationsinstrumentes Sponsoring in den
Kommunikationsmix sowie den Begriff Sponsoring genau zu definieren.
Obwohl sich diese Arbeit nicht nur an Fachleute aus dem Bereich Marketing
und Sponsoring richtet, sondern auch für Laien im Bereich Marketing oder
Sponsorsuchende interessant sein dürfte, soll kurz an die Materie
,,Sponsoring" herangeführt werden. Zur weiteren Vertiefung empfiehlt es sich
aber, einen Blick in die Fachliteratur zu werfen. Standardwerke zum Thema
Marketing und Sportmarketing (z.B. M
EFFERT
(2000): Marketing; F
REYER
(2003): Sportmarketing), sowie die gängige Literatur zum Thema Sponsoring
und Sportsponsoring (B
RUHN
(2003): Sponsoring; H
ERMANNS
(1997):
Sponsoring; R
OTH
(1990): Sportsponsoring; D
REES
(1992): Sportsponsoring.)
sind hierzu hilfreiche Quellen. Tiefergehende Literatur ist dem
Literaturverzeichnis zu entnehmen.
3.2
Definition Sponsoring
Sponsoring wird häufig mit dem Spendenwesen oder dem Mäzenatentum
gleichgesetzt. Spendenwesen oder Mäzenatentum stellen für Unternehmen
zwar auch eine Möglichkeit dar, Kultur, Sport oder Sozialwesen zu fördern,
allerdings liegen hier eher altruistische Gründe vor. Während der Mäzen
15
seine Leistung aus (meist) völlig uneigennützigen Gründen erbringt, kann
beim Spendenwesen aufgrund möglicher steuerrechtlicher Vorteile durchaus
ein Eigennutzen erkannt werden. In beiden Fällen wird in der Regel aber
keine Gegenleistung vom Geförderten erwartet. Aus diesem Grund sind auch
keine vertraglichen Vereinbarungen notwendig und der Spender oder Mäzen
hat die Möglichkeit, seine Förderung jederzeit wieder einzustellen. Aus diesen
15
Der Begriff Mäzenatentum bzw. Mäzen geht auf den Römer Gaius Clinius Maecenas (70-8 v. Chr.)
zurück, welcher unter Kaiser Augustus die bedeutendsten Dichter seiner Zeit unterstütze. (vgl.
B
ABIN
,
J.-U. (1995): Perspektiven des Sportsponsoring S. 2 ff.)
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
7
Gründen unterscheiden sich diese Förderungsformen sehr deutlich vom
Sponsoring
16
. Sponsoring wird bei D
REES
(1992) wie folgt definiert
17
:
Das kommerzielle Sponsoring beinhaltet die systematische Förderung von Personen,
Organisationen oder Veranstaltungen im sportlichen, kulturellen oder sozialen
beziehungsweise ökologischen Bereich durch Geld-, Sach- oder Dienstleistungen zur
Erreichung von Marketing- und Kommunikationszielen. (D
REES
1992, S. 113)
Die Definition von D
REES
(1992) stellt ganz besonders den systematischen
Förderungscharakter des Sponsorings in den Vordergrund, wobei auch ein
Eigeninteresse
darin
besteht,
die
eigenen
Marketing-
und
Kommunikationsziele zu erreichen. Eine weitere Definition von Sponsoring
findet sich bei B
RUHN
(1987)
18
:
Sponsoring bedeutet die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle
sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln,
Dienstleistungen oder Know-how durch Unternehmen und Institutionen zur Förderung
von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales,
Umwelt und/oder den Medien verbunden sind, und damit gleichzeitig Ziele der
Unternehmenskommunikation zu erreichen. (Bruhn 1987, S. 190)
B
RUHN
(1987) spezifiziert den Begriff ,,systematische Planung" und erweitert
die Sponsoringbereiche mit der Förderung der Medien. Die wohl
ausführlichste Definition des Begriffes ,,Sponsoring" findet sich bei H
ERMANNS
(1993)
19
:
16
vgl. hierzu B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring S. 3 ff.
17
D
REES
,
N.
(1992): Sportsponsoring, S.13 ff
18
B
RUHN
,
M. (1987): Sponsoring als Instrument der Markenartikelwerbung, in: Markenartikel, 49 Jg.,
Nr. 5, S. 190
19
H
ERMANNS
,
A. (1993): Charakterisierung und Arten des Sponsorings in: B
ERNDT
,
R./H
ERMANNS
,
A.
(Hrsg.), Handbuch Marketing-Kommunikation S. 630
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
8
[Sponsoring ist] die Zuwendung von Finanz-, Sach- und / oder Dienstleistungen von
einem Unternehmen (Sponsor) an eine Einzelperson, eine Gruppe von Personen oder
eine Organisation bzw. Institution aus dem gesellschaftlichen Umfeld des
Unternehmens (Gesponserter) gegen die Gewährung von Rechten zur
kommunikativen Nutzung von Person bzw. Institution und / oder Aktivitäten des
Gesponserten auf der Basis einer vertraglichen Vereinbarung (H
ERMANNS
(1993), S.
630.).
H
ERMANNS
(1993)
unterstreicht damit das Prinzip von Leistung und
Gegenleistung durch die vertragliche Basis, ohne auf die Erscheinungsformen
des Sponsorings näher einzugehen.
Laut den oben aufgeführten Definitionen ist Sponsoring somit ein
systematischer
Planungs-
und
Entscheidungsprozess
20
(Planung,
Organisation, Durchführung Kontrolle), der auf dem Prinzip von Leistung und
Gegenleistung
21
(Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder
Know-how)
beruht. Hierbei erwartet der Sponsor für den Einsatz seiner
Leistung im Gegenzug die Verbreitung einer Werbebotschaft, welche
möglichst
vertraglich
festgesetzt
wurde,
um
die
Ziele
seiner
Unternehmenskommunikation zu erreichen. Diese kann sich z.B. in der
werbewirksamen Verwendung eines bestimmten Logos, eines Produkt-
und/oder Markennamens durch den Gesponserten äußern. Außerdem
zeichnet sich Sponsoring dadurch aus, dass der Fördercharakter
22
im
Vordergrund steht. Der Sponsor fördert den Gesponserten hierbei nicht nur
finanziell, sondern auch ideell und identifiziert sich mit dessen Aktivitäten,
20
H
ERMANNS
/R
IEDMÜLLER
(2001) bezeichnen diesen Prozess auch als Sponsoring-Management-
Prozess (vgl.: H
ERMANNS
,
A.
/
R
IEDMÜLLER
,
F.
(2001): Management-Handbuch Sport-Marketing,
S. 396)
21
vgl. hierzu auch: B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring, S.7; F
REYER
,
W. (2003): Sport-Marketing, S. 499
ff; B
AUER
,
U.
/
J
ANA
R
OTHMEIER
(1999): Marketing für Sportverbände und- vereine, S.88;
M
EFFERT
,
H.
(2000): Marketing, S. 732 ff; H
ERMANNS
,
A. (2001): Entwicklung und Perspektiven
des Sportsponsorings in: Management-Handbuch Sport-Marketing S. 392
22
B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring S.7; H
ERMANNS
,
A. /
R
IEDMÜLLER
,
F. (2001): Management-
Handbuch Sport-Marketing S. 394
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
9
wodurch er die Möglichkeit hat, sein Ansehen und sein Image positiv zu
gestalten,
was
mit
den
herkömmlichen
Formen
der
Unternehmenskommunikation nur sehr schwer zu bzw. gar nicht zu erreichen
ist.
3.2.1
Erscheinungsformen des Sponsoring
Wie bereits in den Definitionen von B
RUHN
(1987) und D
REES
(1992) erwähnt
gibt es unterschiedliche Möglichkeiten des Sponsorings. Die Arten des
Sponsoring
23
wurden
in
der
Vergangenheit
mit
den
Begriffen
Sportsponsoring,
Kunst-/Kultursponsoring,
Sozio-/Umweltsponsoring,
Programm-/Mediensponsoring und Wissenschaftssponsoring
24
erfasst.
Da sich seit einigen Jahren auch das Internetsponsoring immer größerer
Beliebtheit erfreut
25
, differenzieren H
ERMANNS
/R
IEDMÜLLER
(2000)
26
zwischen
den Begriffen ,,Programm/Mediensponsoring" und dem ,,Internetsponsoring".
B
RUHN
(2003) fasst das Programmsponsoring und das Internetsponsoring
unter dem Oberbegriff ,,Mediensponsoring"
27
zusammen. Diese Begrifflichkeit
wird zwischenzeitlich auch von H
ERMANNS
(2002) verwendet
28
. Folglich
ergeben sich die in Abbildung 1 dargestellten Erscheinungsformen des
Sponsorings.
23
vgl. u.A. B
RUHN
,
M. (1998): Sponsoring. S. 50 ff.; H
ERMANNS
,
A. (1997): Sponsoring. S. 71ff.;
M
EFFERT
,
H.:
Marketing. S. 731 f.; G
LOGGER
,
A. (1999): Imagetransfer im Sponsoring, S. 39.
24
H
ERMANNS
führt das Wissenschaftssponsoring zwar unter den Erscheinungsformen des Sponsorings
auf geht aber nicht spezifischer im Sinne einer Sponsoringart ein (vgl.: H
ERMANNS
,
A. (1997):
Sponsoring. S. 98 ff). Aufgrund der allgemeinen Zuordnung des Wissenschaftssponsorings bei
B
RUHN
(vgl.:
B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring, S. 251) zum Sozio-Sponsoring soll aus
Vereinfachungsgründen im weiteren Verlauf der Arbeit die Kategorisierung nach B
RUHN
verwendet
werden.
25
vgl. B
RUHN
,
M. (1998): Sponsoring, S. 337.
26
H
ERMANNS
,
A./R
IEDMÜLLER
,
F.
(2000): Sponsoring Trends 2000. S. 26.
27
B
RUHN
,
M.
(2003): Sponsoring. S. 295.
28
vgl. H
ERMANNS
,
A. (2002): Sponsoring Trends 2002. S. 9.
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
10
Abbildung 1: Erscheinungsformen des Sponsoring
Da sich diese Arbeit hauptsächlich mit der professionellen Durchführung von
Sponsoringengagements
beschäftigt,
soll
auf
die
einzelnen
Erscheinungsformen des Sponsorings nicht näher eingegangen werden.
Weiterführende Literatur ist dem Literaturverzeichnis zu entnehmen.
3.2.2
Sponsoring als Teil der
Unternehmenskommunikation
Heutzutage hat die klassische Werbung zunehmend mit dem Problem zu
kämpfen,
dass
sich
immer
mehr
Menschen
aufgrund
der
Informationsüberlastung, zum Beispiel durch ,,Zapping" oder durch
,,Überblättern" von Anzeigenwerbung, entziehen
29
. Dieses Problem kann
umgangen werden, indem der Konsument in nicht-kommerziellen
Situationen, wie etwa bei einem Sportereignis, einer Kunstausstellung o. ä.
angesprochen wird
30
.
Sponsoring ist zwischenzeitlich ein fester und bedeutender Bestandteil in der
Unternehmenskommunikation deutscher Unternehmen. Die Verbreitung des
Sponsorings unter den 2.500 umsatzstärksten Unternehmen liegt laut
,,Sponsoring Trends 2004" bei 73,6%
31
. Sponsoring scheint also für große
Unternehmen ein Erfolg versprechendes Kommunikationsinstrument zu sein
und könnte somit möglicherweise auch für kleine Unternehmen interessant
sein.
Einem Unternehmen stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, seine
Marken, Produkte oder Dienstleistungen an potentielle Kunden zu
29
B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring S.14
30
vgl.: D
REES
,
N. (2003): Bedeutung und Erscheinungsformen des Sportsponsorings S. 49
31
vgl.: H
ERMANNS
,
A. (2004): SPONSORING TRENDS 2004 S. 8
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
11
kommunizieren.
Der
Einsatz
dieser
operativen
Mittel
wird
als
Kommunikations-Mix bezeichnet. Neben dem Sponsoring gehören hierzu die
klassische Werbung
(Insertionsmedien, elektronische Medien), die
Verkaufsförderung
,
Public Relation
oder
Öffentlichkeitsarbeit
,
Event-
Marketing
,
Messen und Ausstellungen
,
Direktkommunikation, interne
Kommunikation
und die
Multimedia-Kommunikation
32
(vgl. Abb. 1).
Abbildung 2: Instrumente der Unternehmenskommunikation
Beim Einsatz der verschiedenen Bausteine der Unternehmenskommunikation
ist auf eine Verknüpfung der Instrumente zu achten um zu erreichen, dass
sich die Instrumente gegenseitig ergänzen und so eine synergetische
Gesamtwirkung der Unternehmenskommunikation erreicht wird33. M
EFFERT
(2000) bezeichnet diese Vorgehensweise als den ,,integrierten Marketing-
Mix"34. Dieser Grundsatz gilt in besonderem Maße für das Sponsoring.
Anderen Kommunikationsinstrumente können auch ohne Abstimmung
aufeinander erfolgreich umgesetzt werden, um die Kommunikationsziele
eines Unternehmens zu erreichen. Dies gilt für das Sponsoring nicht. G
LOGGER
(1999) schreibt hierzu
,,In Wissenschaft und Praxis ist man einhellig der
Meinung, dass gerade das Sponsoring erst über die Vernetzung mit anderen
Instrumenten seine gesamte kommunikative Leistungsfähigkeit freisetzt"
35
.
Sponsoring hat im Vergleich zu den anderen Kommunikationsinstrumenten,
wie etwa der klassischen Werbung, nicht die Möglichkeit komplexe
32
vgl. M
EFFERT
,
H.: Marketing S. 684f.; B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring S. 29.: W
ÜNSCHMANN
,
S./L
EUTERITZ
,
A./J
OHNE
,
U.: (2004): Erfolgsfaktoren des Sponsoring, S. 78.
33
B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring S. 29.
34
M
EFFERT
,
H. (2000): Marketing, S. 1109.
35
G
LOGGER
,
A.
(1999): Imagetransfer im Sponsoring, S. 43
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
12
Werbebotschaften
zu
transportieren
36
,
um
somit
kurzfristig
eine
Umsatzsteigerung zu erreichen. Vielmehr ist dieses Instrument dazu
geeignet, kognitive bzw. psychologische Ziele zu erreichen, wie z.B.
Bekanntheitssteigerung,
Imageveränderung,
komparativer
Wettbewerbsvorteil, Kontaktpflege/Kunden- und Mitarbeiterbindung, welche
sich dann langfristig auf Umsatz und Gewinn auswirken können
37
.
Sponsoring kann ,,
[...] als übergreifendes, multiples, aber lediglich
komplementäres Instrument der Kommunikationspolitik [...]."
38
bezeichnet
werden und sollte daher nie isoliert sondern immer verknüpft mit anderen
Instrumenten der Unternehmenskommunikation eingesetzt werden. Eine
Studie im Auftrag des DSF, welche die Vernetzung des Sponsorings mit
anderen Kommunikationsinstrumenten untersucht, unterstreicht diese
Forderung
39
.
Diese
kurze
Einführung
zu
Sponsoring
als
Instrument
der
Unternehmenskommunikation zeigt, dass für den Einsatz von Sponsoring
innerhalb der Unternehmenskommunikation bestimmte Voraussetzungen
gegeben sein müssen. So ist es absolut notwendig, dass innerhalb des
sponsernden Unternehmens ein gewisses Marketingverständnis vorhanden
ist. Des Weiteren sollte das Engagement langfristig angelegt sein und das
Sponsoring in Verbindung mit weiteren Kommunikationsinstrumenten
verknüpft sein, um den Wirkungserfolg zu maximieren.
3.2.3
Professionelle Durchführung von Sponsoring
Professionelles Sponsoring kann nur dort stattfinden, wo es auch im Rahmen
eines
entsprechend
professionellen
Sponsoring-Management-Konzepts
eingesetzt wird und ein ausreichend hohes Budget zur Verfügung steht. Wie
bereits angesprochen, sollte Sponsoring als ergänzendes Instrument
innerhalb des Kommunikationsmix eingesetzt
werden. Dies setzt
36
vgl. H
ERMANNS
,
A.
(2001): Entwicklung und Perspektiven des Sportsponsorings S.393
37
vgl. B
RUHN
,
M. (2003): Sponsoring S. 69
38
O
.V. in: D
ILLER
,
H. (Hrsg.) (1992): Vahlens Großes Marketinglexikon S. 1085
39
o.V. (1989): Konsequente Vernetzung zahlt sich aus in: SPONSOR
S
3, (1998) 3 S. 26-27.
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
13
entsprechende
Marketingkenntnisse
voraus.
Allerdings
sind
diese
Marketingkenntnisse speziell in den kleinsten Unternehmenseinheiten nur
selten
umzusetzen
40
vorzufinden
sind.
Fehlende
Marketing-
und
Sponsoringkenntnisse wirken sich zwangsläufig auf die Professionalität von
Sponsoring aus.
Bei der Überprüfung der professionellen Vorgehensweise des Sponsorings
sollen daher insbesondere die theoretischen Sponsoringkenntnisse im
Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Hierbei sollen aber auch Faktoren, wie
etwa die Qualifikation der Sponsoringverantwortlichen berücksichtigt werden,
die sich sowohl auf die Professionalität, aber eventuell auch auf den Erfolg
von Sponsoring auswirken können.
3.2.4
Grundregeln des Sponsorings
Sowohl F
REYER
(2003)
41
als auch B
RUHN
(2003)
42
stellen Grundsätze bzw.
Merkmale für Sponsoring heraus, die es bei der Durchführung zu beachten
gilt, und die in dieser Arbeit als Grundlage für die Untersuchung der
professionellen Vorgehensweise beim Sponsoring dienen sollen. Diese
Grundregeln sollen im weiteren Verlauf kurz erläutert werden.
Eine wichtige Voraussetzung, um professionelles Sponsoring betreiben zu
können, stellt die richtige Einordnung und die Abgrenzung des Begriffes
,,Sponsoring"
vom
Mäzenatentum
dar.
Ist
es
dem
Sponsoringverantwortlichen nicht möglich, den Begriff richtig zu definieren,
wird es sehr schwer, Sponsoring auf professioneller Ebene zu praktizieren.
Um diese Grundregeln zu beachten und somit professionelles Sponsoring
auszuüben, müssen Sponsoren in der Lage sein, folgende Aussagen richtig
wiedergeben zu können:
40
vgl. hierzu die Ausführungen von
WÖRWAG
,
S.
(1996):
Entwicklung und Umsetzung von
Servicestrategien in Klein- und Mittelunternehmen, S. 244-253
41
F
REYER
,
W.
(2003): Sport-Marketing, S. 499 f.
42
B
RUHN
,
M.
(2003): Sponsoring, S.34
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
14
·
Sponsoring ist die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle sämtlicher
Sponsoringaktivitäten
·
Sponsoring beruht auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung
·
Sponsoring sind Finanz-, Sach-, und/oder Dienstleistung durch ein Unternehmen
·
Sponsoring muss immer vertraglich fixiert sein
Die oben aufgeführten Aussagen lehnen sich an die Begriffsbestimmung von
H
ERMANNS
(1993) an. Da die von H
ERMANNS
(1993) verwendete Definition den
Begriff ,,Sponsoring" wohl am präzisesten und ausführlichsten beschreibt, soll
sie für diese Arbeit angewendet werden
F
REYER
(2003)
43
als auch B
RUHN
(2003)
44
sind der Ansicht, dass insbesondere
Engagements im Sportsponsoring langfristig angelegt sein sollten. Daher
sollte Sponsoring auf Grundlage langfristiger
Sponsoringengagements
erfolgen, um zu gewährleisten, dass von der angesprochenen Zielgruppe
eine Verbindung zwischen Sponsoringobjekt und Sponsor hergestellt wird
45
.
Eine konzeptionelle Vorgehensweise, wie sie bei F
REYER
(2003) dargestellt
wird
46
, sollte Hauptbestandteil eines jeden professionell gestalteten
Sponsoringengagements sein. Ein professioneller Planungsprozess beim
Sponsoring mit einer entsprechend konzeptionellen Vorgehensweise stellt
sich nach B
RUHN
(2003) folgendermaßen dar
47
:
43
vgl.
F
REYER
,
W. (2003): Sport-Marketing, S. 499
44
vgl. B
RUHN
,
M.
(2003): Sponsoring, S. 66f, 137ff
45
vgl.
F
REYER
,
W. (2003): Sport-Marketing, S. 499
46
ebd. S. 500
47
Nach B
RUHN
,
M.
(2003): Sponsoring, S.34
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
15
Situationsanalyse
Festlegung der Ziele
des Sponsorings
Identifizierung der Zielgruppe
des Sponsorings
Festlegung der Sponsoringstrategie
und -philosophie
Erfolgskontrolle des Sponsorings
Kalkulation des
Sponsoringbudgets
Auswahl von Sponsorships
Entwicklung von
Einzelmaßnahmen
Integration
des
Sponsoring
in den
Kommuni-
kationsmix
Abbildung 3: Planungsprozess des Sponsoring aus Unternehmenssicht. Quelle:
Bruhn (2003) S. 34
Wie aus der Abbildung 3 zu erkennen ist, handelt es sich beim
Planungspozess des Sponsorings um ein sehr komplexes Gebilde. Um bei
Planung, Durchführung und Kontrolle nicht die Übersicht zu verlieren, ist es
unbedingt notwendig diesen Prozess schriftlich festzuhalten, um professionell
arbeiten zu können. Des Weiteren ist der Planungsprozess Schritt für Schritt
zu durchlaufen.
3.3
Klein- und Kleinstunternehmen
Da sich diese Arbeit ausschließlich mit kleinen Unternehmen, genauer mit
Klein- und Kleinstunternehmen beschäftigt, war es für das allgemeine
Verständnis notwendig, eine einheitliche Definition von kleinen Unternehmen
zugrunde zu legen.
3.3.1
Definitionen
Um Verwechslungen der Begriffe ,,Unternehmen" und ,,Betrieb" vorzubeugen,
Theoretische Grundlagen
Diplomarbeit von Will, Andreas: Sponsoring in Klein- und Kleinstunternehmen
16
sollen im weiteren Verlauf folgende Definitionen Anwendung finden
48
:
Ein Unternehmen wird in der amtlichen Statistik als kleinste rechtlich
selbständige Einheit definiert, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen
Gründen Bücher führt und eine jährliche Feststellung des
Vermögensbestandes bzw. des Erfolgs der wirtschaftlichen Tätigkeit
vornehmen muss. Das Unternehmen umfasst alle zugehörigen
Betriebe. Auch freiberuflich Tätige werden als eigenständige
Unternehmen registriert.
49
Ein Betrieb ist eine Niederlassung an einem bestimmten Ort. Zu dem
Betrieb zählen zusätzlich örtlich und organisatorisch angegliederte
Betriebsteile. Es muss mindestens ein Beschäftigter im Auftrag des
Unternehmens arbeiten. Betriebe werden nach ihrer Zugehörigkeit zu
Mehrbetriebsunternehmen
bzw.
Mehrländerunternehmen
unterschieden
50
.
Gegenstand dieser Arbeit sind Unternehmen, also auch die dem
Unternehmen angegliederten Betriebe. Die einzelnen Betriebe eines
Unternehmens sollen daher keine Berücksichtigung finden.
Nach Artikel 2 der neuen Empfehlung 2003/361/EG der Europäischen
Kommission vom 06.05.2003 zur Definition von Kleinstunternehmen sowie
der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gilt folgende Klassifizierung
51
:
48
Da die Ausführungen zu den Unternehmenszahlen in diesem Kapitel auf Angaben des Statistischen
Bundesamtes beruhen, wurde es als zweckmäßig erachtet die Definitionen der Begriffe
,,Unternehmen" und ,,Betrieb" vom Statistischen Bundesamt zu übernehmen.
49
Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Methodische Grundlagen, Definitionen und Qualität
des statistischen Unternehmensregisters. Quelle: http://www.statistik-portal.de/Statistik-
Portal/de_entMethDef.asp (28.06.2006)
50
ebd.
51
European Commission (Hrsg.): Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the
definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003)
1422) In: Official Journal of the European Union (2003) L124, 39. Quelle: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520en00360041.pdf (19.05.2004)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (Paperback)
- 9783836604918
- ISBN (eBook)
- 9783956362699
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln – Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2007 (August)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- sponsoring sponsoringaktivität sponsoringerfolg sponsoringqualifikation kleinunternehmen
- Produktsicherheit
- Diplom.de