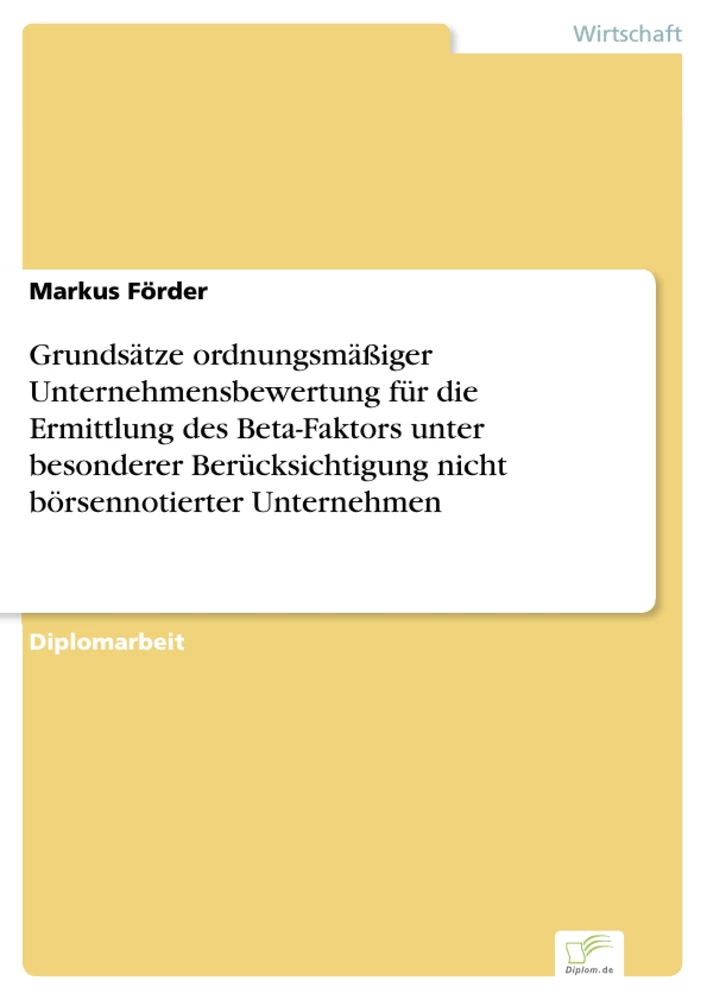Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung für die Ermittlung des Beta-Faktors unter besonderer Berücksichtigung nicht börsennotierter Unternehmen
©2006
Diplomarbeit
104 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Die Suche nach Betafaktoren hat die Literatur geprägt. Die Unternehmensbewertung erfordert einen zweckadäquaten Vergleich mit einer alternativen Anlageform. Bei Verwendung der Risikozuschlagsmethode wird die Unsicherheit im Kapitalkostensatz berücksichtigt, der zur Abzinsung der Ertrags- und Zahlungsströme verwendet wird.
Der Beta-Faktor nimmt bei der Diskussion um die marktgestützte Bestimmung der Kapitalkosten eine besondere Stellung ein, da sich bei der Bestimmung von Beta-Faktoren erhebliche Ermessensspielräume ergeben. Empirische Ergebnisse zeigen außerdem, dass ex post ermittelte Beta-Faktoren nicht stabil sind. Mit statistischen Methoden werden Stichproben und Messfehler von Renditen analysiert, wodurch der wahre Beta-Faktor nicht bestimmbar ist. Unterschiedliche Beta-Faktoren ergeben sich durch die Verwendung unterschiedlicher Renditeintervalle, Beobachtungszeiträume oder Indizes als Ersatz für das Marktportefeuille.
Allgemein gültige Verfahrensweisen, die theoretisch begründet und empirisch nachprüfbar sind, wären im Rahmen der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung wichtig.
Einleitung:
Herleitung des Kapitalisierungszinssatzes mit Beta-Faktoren:
Theoretischer Ausgangspunkt des Beta-Faktors ist das CAPM, das wiederum auf der von Markowitz entwickelten Portfolio-Theorie und dem Separationstheorem von Tobin aufbaut. Die Portfolio-Theorie erläutert die Konstruktion der Kapitalmarktlinie, die keine Informationen über das Risiko eines individuellen Wertpapiers eines Portefeuilles liefern kann. Es kann allerdings mathematisch nachgewiesen werden, dass die Steigung eines beliebigen Wertpapiers gegen die Steigung der Kapitalmarktlinie strebt. Diese Gleichgewichtsannahme führte durch die Arbeiten von Sharpe, Lintner, Mossin zur Entwicklung des CAPM.
Obwohl alle Komponenten und Annahmen der CAPM-Gleichung bereits mehrfach kritisch analysiert wurden, besitzt das Beta-Konzept zur Messung des systematischen Risikos eine dominante Stellung innerhalb der Diskussion um das CAPM. Dies liegt zum größten Teil an den verschiedenen Möglichkeiten der Schätzung von Beta-Faktoren.
Mithilfe des CAPM wird die erwartete Rendite eines riskanten Wertpapiers im Marktgleichgewicht bestimmt. Dabei erfolgt die Risikoadjustierung bei der
Kapitalstrukturadaption:
Steiner/Beiker/Bauer ermittelten für Deutschland keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verschuldung und dem Beta-Faktor eines Unternehmens. Da […]
Die Suche nach Betafaktoren hat die Literatur geprägt. Die Unternehmensbewertung erfordert einen zweckadäquaten Vergleich mit einer alternativen Anlageform. Bei Verwendung der Risikozuschlagsmethode wird die Unsicherheit im Kapitalkostensatz berücksichtigt, der zur Abzinsung der Ertrags- und Zahlungsströme verwendet wird.
Der Beta-Faktor nimmt bei der Diskussion um die marktgestützte Bestimmung der Kapitalkosten eine besondere Stellung ein, da sich bei der Bestimmung von Beta-Faktoren erhebliche Ermessensspielräume ergeben. Empirische Ergebnisse zeigen außerdem, dass ex post ermittelte Beta-Faktoren nicht stabil sind. Mit statistischen Methoden werden Stichproben und Messfehler von Renditen analysiert, wodurch der wahre Beta-Faktor nicht bestimmbar ist. Unterschiedliche Beta-Faktoren ergeben sich durch die Verwendung unterschiedlicher Renditeintervalle, Beobachtungszeiträume oder Indizes als Ersatz für das Marktportefeuille.
Allgemein gültige Verfahrensweisen, die theoretisch begründet und empirisch nachprüfbar sind, wären im Rahmen der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung wichtig.
Einleitung:
Herleitung des Kapitalisierungszinssatzes mit Beta-Faktoren:
Theoretischer Ausgangspunkt des Beta-Faktors ist das CAPM, das wiederum auf der von Markowitz entwickelten Portfolio-Theorie und dem Separationstheorem von Tobin aufbaut. Die Portfolio-Theorie erläutert die Konstruktion der Kapitalmarktlinie, die keine Informationen über das Risiko eines individuellen Wertpapiers eines Portefeuilles liefern kann. Es kann allerdings mathematisch nachgewiesen werden, dass die Steigung eines beliebigen Wertpapiers gegen die Steigung der Kapitalmarktlinie strebt. Diese Gleichgewichtsannahme führte durch die Arbeiten von Sharpe, Lintner, Mossin zur Entwicklung des CAPM.
Obwohl alle Komponenten und Annahmen der CAPM-Gleichung bereits mehrfach kritisch analysiert wurden, besitzt das Beta-Konzept zur Messung des systematischen Risikos eine dominante Stellung innerhalb der Diskussion um das CAPM. Dies liegt zum größten Teil an den verschiedenen Möglichkeiten der Schätzung von Beta-Faktoren.
Mithilfe des CAPM wird die erwartete Rendite eines riskanten Wertpapiers im Marktgleichgewicht bestimmt. Dabei erfolgt die Risikoadjustierung bei der
Kapitalstrukturadaption:
Steiner/Beiker/Bauer ermittelten für Deutschland keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verschuldung und dem Beta-Faktor eines Unternehmens. Da […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Markus Förder
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung für die Ermittlung des Beta-
Faktors unter besonderer Berücksichtigung nicht börsennotierter Unternehmen
ISBN: 978-3-8366-0468-0
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Universität Mannheim, Mannheim, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Inhaltsverzeichnis ...I
Abkürzungsverzeichnis...III
I. Problemstellung ...1
II. Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung...3
1. Normsystem und Quellen...3
2. Unternehmensbewertungszwecke ...5
III. Betriebswirtschaftliche Grundlagen zur Herleitung von Grundsätzen
ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung für die Ermittlung des Beta-
Faktors ...7
1. Herleitung des Kapitalisierungszinssatzes mit Beta-Faktoren ...7
2. Empirische Ableitung der Beta-Faktoren aus Vergangenheitsdaten...11
a) Historische Kapitalmarktregression zur Schätzung von Beta-
Faktoren...11
aa) Parameterschätzung mittels des Kleinste-Quadrate-Verfahrens ...11
bb) Annahmen der linearen Regression...13
cc) Beurteilungsgrößen der Schätzung...14
dd) Schätzprobleme von Beta-Faktoren...16
b) Instabilität von Beta-Faktoren als zentrales Problem historischer
Kapitalmarktregression ...17
c) Darstellung des Literaturstreits in Einzelfragen...19
aa) Intervalllänge der Renditeberechnung...19
bb) Historische Zeitspanne ...23
cc) Vergleichsindizes als Marktportefeuille ...23
dd) Markteffizienz ...28
aaa) Informations- und Allokationseffizienz ...28
bbb) Liquidität und Handelsvolumina...29
ccc) Friktionen ...30
ee) Produktlebenszyklus und Strategieevolution...32
3. Ergebnisanpassung der historischen Daten ...34
a) Das Blume-Anpassungsverfahren ...34
b) Das Verfahren von Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ...36
c) Das Bloomberg-Anpassungsverfahren...38
d) Das Bayes-Vasicek- und James-Stein-Anpassungsverfahren ...38
e) Ergebnisse der empirischen Analyse von Anpassungsverfahren...40
II
4. Würdigung der historischen Kapitalmarktregression und Grundsätze
ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung für die Ermittlung des
Beta-Faktors ...41
IV. Besondere Probleme bei der Herleitung des Beta-Faktors für nicht
börsennotierte Unternehmen...44
1. Analogieansätze für Surrogat-Beta-Faktoren...44
a) Branchenbetaermittlung ...44
b) Beta-Faktorermittlung anhand einer Referenzgruppe ...47
c) Referenzunternehmensermittlung ...48
d) Kapitalstrukturadaption...50
e) Theoretische Grundlagen für die Verwendung von ausländischen
Vergleichsunternehmen...53
2. Analyseansätze für Beta-Faktoren...54
a) Statistische Analyseverfahren ...54
b) Zusammenhang von Ausschüttungsverhalten und Beta-Faktor...56
c) Diversifikationsgrad und Unternehmensgröße ...57
d) Fundamentale Beta-Faktoren von Beratungsgesellschaften ...58
e) Qualitative Verfahren...60
3. Würdigung der Verfahren für nicht börsennotierte Unternehmen ...61
V. Thesenförmige Zusammenfassung ...66
Literaturverzeichnis ...V
Rechtsprechungsverzeichnis... XXXIII
III
Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.
am angegebenen Ort
AG
Die Aktiengesellschaft (Zeitschrift)
a. M.
am Main
Aufl.
Auflage
BB
Betriebsberater (Zeitschrift)
BFuP
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeitschrift)
CAPM
Capital Asset Pricing Model
DAX
Deutscher Aktienindex
DB
Der Betrieb (Zeitschrift)
DBW
Die Betriebswirtschaft (Zeitschrift)
d. h.
das heißt
Diss.
Dissertation
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
f.
folgende
FB
Finanz Betrieb (Zeitschrift)
Fn.
Fußnote
GARCH
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
hrsg.
herausgegeben
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
JFQA
Journal of Financial and Quantitative Analysis (Zeitschrift)
JoBaF
Journal of Banking and Finance (Zeitschrift)
JoF
Journal of Finance (Zeitschrift)
JoFE
Journal of Financial Economics
JoPM
Journal of Portfolio Management (Zeitschrift)
Jg.
Jahrgang
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Quotations
NYSE
New York Stock Exchange
OLG
Oberlandesgericht
OLS
Ordinary Least Squares (Kleinste-Quadrate-Methode)
IV
S.
Seite
sbr
Schmalenbach Business Review (Zeitschrift)
Sp.
Spalte
u. a.
unter anderem
v.
von
vgl.
vergleiche
Vol.
Volume (Band)
WPg
Die Wirtschaftsprüfung (Zeitschrift)
z. B.
zum Beispiel
ZfB
Zeitschrift für Betriebswirtschaft
zfbf
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
ZGR
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
1
I.
Problemstellung
,,Die Suche nach Betafaktoren ... hat die Literatur geprägt."
1
Die Unterneh-
mensbewertung erfordert einen zweckadäquaten Vergleich mit einer alternativen
Anlageform.
2
Bei Verwendung der Risikozuschlagsmethode wird die Unsicherheit
im Kapitalkostensatz berücksichtigt, der zur Abzinsung der Ertrags- und Zahlungs-
ströme verwendet wird.
3
Der Beta-Faktor nimmt bei der Diskussion um die marktgestützte Bestimmung
der Kapitalkosten eine besondere Stellung ein, da sich bei der Bestimmung von Beta-
Faktoren erhebliche Ermessensspielräume ergeben.
4
Empirische Ergebnisse zeigen
außerdem, dass ex post ermittelte Beta-Faktoren nicht stabil sind.
5
Mit statistischen
Methoden werden Stichproben und Messfehler von Renditen analysiert, wodurch der
,,wahre" Beta-Faktor nicht bestimmbar ist.
6
Unterschiedliche Beta-Faktoren ergeben
sich durch die Verwendung unterschiedlicher Renditeintervalle, Beobachtungszeit-
räume oder Indizes als Ersatz für das Marktportefeuille.
7
Allgemein gültige Verfahrensweisen, die theoretisch begründet und empirisch
nachprüfbar sind, wären im Rahmen der Grundsätze ordnungsmäßiger Unterneh-
mensbewertung wichtig.
8
Beta-Faktoren unterschiedlicher Finanzdienstleister kön-
nen an einem identischen Stichtag eine Bandbreite von 0,75 aufweisen, was für die
Bewertung beachtliche Konsequenzen hat.
9
Mit diesen historisch ermittelten Beta-
1
Ballwieser, Wolfgang: Die Ermittlung impliziter Eigenkapitalkosten aus Gewinnschätzungen und
Aktienkursen: Ansatz und Probleme, in: Kritisches zu Rechnungslegung und Unternehmensbesteu-
erung, Feschschrift für Theodor Siegel, hrsg. v. Dieter Schneider u. a., Berlin 2005, S. 321-337, hier
S. 321.
2
Vgl. Weber, Martin/Wüstemann, Jens: Bedeutung des Börsenkurs im Rahmen der Unternehmens-
bewertung, Ergebnispapier zum Symposium vom 29.1.2004, Sonderforschungsbereich 504 Wor-
king Paper Series 04-25, Mannheim 2004, hier S. 1.
3
Vgl. Kratz, Norbert/Wangler, Clemens: Unternehmensbewertung bei nicht kapitalmarktorientierten
Unternehmen, in: FB, 7. Jg. (2005), S. 169-176, hier S. 171
4
Vgl. Nowak, Karsten: Marktorientierte Unternehmensbewertung, 2., aktualisierte Aufl., Wiesbaden
2003, hier S. 93.
5
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Alternative Verfahren zur Ermittlung und zum Einsatz
von Betafaktoren, in: Handbuch Portfoliomanagement, hrsg. v. Jochen M. Kleeberg u. a., Bad So-
den/Taunus 1998, S. 435-458, hier S. 445.
6
Vgl. Rosenberg, Barr: Prediction of Common Stock Betas, in: JoPM, Vol. 11 (1985), Issue 2, S. 5-
14, hier S. 6.
7
Vgl. Berner, Christian/Rojahn, Joachim/Kiel, Olaf/Dreimann, Michael: Die Berücksichtigung des
unternehmensindividuellen Risikos in der Unternehmensbewertung, in: FB, 7. Jg. (2005), S. 711-
718, hier S. 712.
8
Vgl. Nowak, Karsten: Marktorientierte Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 226.
9
Vgl. Daske, Holger/Gebhardt, Günther: Zukunftsorientierte Bestimmung von Risikoprämien und
Eigenkapitalkosten für die Unternehmensbewertung, in: zfbf, 58. Jg. (2006), S. 530-551, hier
S. 535.
2
Faktoren werden zukünftige Zahlungsströme mehrerer Perioden abgezinst, wodurch
Beta-Faktoren fälschlicherweise als stationär angesehen werden.
10
Aufgrund der Instabilität von Beta-Faktoren wurden in der Literatur verschie-
dene Anpassungsverfahren entwickelt, die den Beta-Faktor zu einem durchschnittli-
chen Mittelwert konvergieren lassen.
11
Diese Vorgehensweise ist im Rahmen der
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung für die Ermittlung des Beta-
Faktors zu würdigen.
Das CAPM und somit die Beta-Faktoren beruhen auf mehreren Annahmen im
Modellkontext, die teilweise realitätsfern sind.
12
Wichtigste Voraussetzung, damit
die Anwendung von Beta-Faktoren nicht zu verzerrten Ergebnissen führt, ist die
Markteffizienz des Kapitalmarktes.
13
Traditionell wurde das Beta-Konzept in Deutschland für nicht verwendbar
gehalten, da der deutsche Kapitalmarkt nicht stark ausgeprägt war oder die Anzahl
der notierten Unternehmen als zu gering erachtet wurde.
14
Besaß der Beta-Faktor
Mitte der neunziger Jahre kaum Bedeutung in der Bewertungspraxis
15
, wird er aktu-
ell im Rahmen der Unternehmensbewertung vermehrt angewendet, da beispielsweise
das IDW seinem Berufsstand die Möglichkeit der marktgestützten Berechnung des
Risikozuschlags mit dem CAPM empfiehlt.
16
Dadurch ist der Beta-Faktor in der
Rechtsprechung zunehmend relevant und wird als Komponente des Risikozuschlags
bereits anerkannt.
17
10
Vgl. Timmreck, Christian: -Faktoren Anwendungsprobleme und Lösungsansätze, in: FB, 4. Jg.
(2002), S. 300-307, hier S. 305.
11
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, Bad Soden/Taunus 1997, hier
S. 241.
12
Vgl. Timmreck, Christian: -Faktoren Anwendungsprobleme und Lösungsansätze, a.a.O., hier
S. 302.
13
Vgl. Nowak, Karsten: Marktorientierte Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 225.
14
Vgl. Ballwieser, Wolfgang: Adolf Moxter und der Shareholder Value-Ansatz, in: Bilanzrecht und
Kapitalmarkt, Festschrift für Adolf Moxter, hrsg. v. Wolfgang Ballwieser u. a., Düsseldorf 1994,
S. 1379-1405, hier S. 1398.
15
Vgl. Peemöller, Volker H./Meyer-Pries, Lars: Unternehmensbewertung in Deutschland, in: DStR,
33. Jg. (1995), S. 1202-1208, hier S. 1207.
16
Vgl. IDW: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1), in: WPg,
58. Jg. (2005), S. 1303-1321, hier S. 1312; Hüttemann, Rainer: Rechtsfragen der Unternehmens-
bewertung, in: Unternehmen bewerten, hrsg. v. Markus Heintzen und Lutz Kruschwitz, Berlin
2003, S. 151-173, hier S. 163.
17
Vgl. Wilts, Rainer/Schaldt, Klaus/Nottmeier, Andreas/Klasen, Bernadette: Rechtsprechung zur
Unternehmensbewertung, in: FB, 6. Jg. (2004), S. 508-514, hier S. 511; Gleißner, Werner: Gründe
für zu niedrige Wertansätze in Bewertungsgutachten bei Squeeze-out, in: AG Report, 51. Jg.
(2006), S. R256-R260, hier S. R257; Urteil des OLG Düsseldorf vom 31.01.2003 19 W 9/00, in:
AG, 51. Jg. (2006), S. 329-334, hier S. 333.
3
Im Jahre 1999 hatten 76,9% aller Unternehmen in Deutschland die Rechtsform
einer GmbH und nur 0,8% aller Unternehmen die Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft.
18
Die Bestimmung des marktgestützten Risikozuschlags ist ebenfalls für nicht
börsennotierte Unternehmen relevant, da die Grundsätze ordnungsmäßiger Unter-
nehmensbewertung für alle Unternehmen gelten.
19
Will man aber Beta-Faktoren für nicht börsennotierte Unternehmen ermitteln,
stellt sich das Problem, dass keine ,,Marktinformation zur Bestimmung systemati-
scher Risikomaße"
20
existiert und die Bestimmung ohne Kapitalmarktdaten nur indi-
rekt erfolgen kann.
Die möglichen Verfahren untergliedern sich in Analogieverfahren und Analy-
severfahren.
21
Analogieverfahren verwenden Surrogat-Beta-Faktoren von börsenno-
tierten Gesellschaften, Analyseverfahren untersuchen Unternehmens- und Marktda-
ten, um relevante Faktoren und deren Wirkungen zu ermitteln.
22
II.
Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung
1.
Normsystem und Quellen
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung verstehen sich als
Prinzipien, die ein allgemeines und widerspruchsfreies Normsystem für die Unter-
nehmensbewertung darstellen sollen.
23
Die Grundsätze sollen als übergeordnete Ver-
haltensnormen fungieren und das Verhalten der Adressaten steuern.
24
Dabei ergeben
sich die Normen nicht nur aus der sprachlichen Formulierung, sondern auch aus dem
Kontext, der einen Systemcharakter besitzt.
25
Ein Normsystem definiert sich in der
Systemtheorie anhand seiner Elemente und den Beziehungen zwischen diesen Ele-
18
Vgl. Deutsches Aktieninstitut: DAI-Factbook 2005, hrsg. v. Deutsches Aktieninstitut e.V., Frank-
furt a. M. 2005, hier Blatt 01-2-a.
19
Vgl. Peemöller, Volker H.: Bewertung von Klein- und Mittelbetrieben, in: BB, BB Special Nr. 7,
60. Jg. (2005), Heft 30, S. 31-35, hier S. 30.
20
Freygang, Winfried: Kapitalallokation in diversifizierten Unternehmen, Wiesbaden 1993, hier
S. 250.
21
Vgl. Nowak, Karsten: Marktorientierte Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 99.
22
Vgl. Freygang, Winfried: Kapitalallokation in diversifizierten Unternehmen, a.a.O., hier S. 251.
23
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, Wiesbaden 2005, hier S. 617;
Kuhner, Christoph: Unternehmensbewertung, Berlin u. a. 2006, hier S. 62.
24
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 618.
25
Vgl. Fischer-Winkelmann, Wolf F.: IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unterneh-
mensbewertungen (IDW S 1) In Aere Aedificatus!, in: MC Management-Consulting & Control-
ling, hrsg. v. Wolf F. Fischer-Winkelmann, Hamburg 2003, S. 79-162, hier S. 84.
4
menten.
26
Allgemeine oder spezielle Fach- und Rechtsnormen können die System-
elemente sein.
27
Die Normen sind in abstrakter und genereller Form gehalten, um
ihre Gültigkeit nicht nur auf den Einzelfall zu beschränken.
28
Moxter beschreibt die
Grundsätze als einen dynamischen Prozess, der kein geschlossenes System darstellt,
da die Dynamik zumeist neue Probleme entstehen lässt.
29
Wenn durch die Grundsät-
ze eine Ordnung ableitbar ist, dann vertreten Matschke/Brösel die Ansicht, dass im
Hinblick auf die Bewertungsfunktion der Begriff Grundsätze funktionsgemäßer Un-
ternehmensbewertung zu verwenden ist.
30
Als Quellen der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung sind
die Rechtsprechung, Standardisierungsausschüsse von Berufsständen sowie die Wis-
senschaft und Forschung zu nennen.
31
Dem Gesetzgeber obliegt die Normgebung,
während die wirksame Durchsetzung durch die Rechtsprechung erfolgt.
32
Standardisierungsausschüsse, insbesondere das Institut der Wirtschaftsprüfer,
versuchen die Handlungen ihrer Mitglieder zu vereinheitlichen.
33
Aus ,,anzuerken-
nenden Regeln werden anerkannte Regeln"
34
für den Berufsstand. Die aktuell gülti-
gen Regelungen sind im IDW S1 Standard verfasst.
35
Sie sind ,,keinesfalls als bin-
dender Rechtsmaßstab anzusehen"
36
. Den Standardisierungsausschüssen obliegt es
nicht, für Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu sorgen, da ihr Handeln nicht frei
von Interessen sein kann.
37
Zusätzlich darf aufgrund bestimmter Gefahren wie z. B.
eine systematische Benachteiligung einzelner Interessen die Herleitung bestimmter
Grundsätze auch nicht allein dem Berufstand obliegen.
38
Nach Moxter ,,ist ein insti-
26
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 618.
27
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 618.
28
Vgl. Pooten, Holger: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, Büren 1999, hier
S. 8.
29
Vgl. Moxter, Adolf: Die Bedeutung der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, in:
zfbf, 32. Jg. (1980), S. 454-459, hier S. 454.
30
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 621.
31
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 627.
32
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 627.
33
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 628.
34
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 628.
35
Vgl. IDW: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1), a.a.O., hier
S. 1304.
36
Vgl. Weber, Martin/Wüstemann, Jens: Bedeutung des Börsenkurs im Rahmen der Unternehmens-
bewertung, a.a.O., hier S. 2.
37
Vgl. Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung Bedeutung und
Quellen, in: BB, 31. Jg. (1976), S. 989-991, hier S. 990.
38
Vgl. Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung Bedeutung und
Quellen, a.a.O., hier S. 990.
5
tutionalisierender Interessenausgleich erforderlich"
39
, da der Berufsstand ,,die Norm
nicht allein konstituieren"
40
darf. Das ordnungsgemäße Verhalten der Bewerter ist
demnach über der tatsächlichen Handlung anzusiedeln.
41
Wissenschaft und Forschung sollten ihre Aufgabe darin sehen, theoriegestützte,
dem jeweiligen Zweck entsprechende Normsysteme herzuleiten.
42
Sie können der
Rechsprechung sowohl ,,de lege lata als auch de lege ferenda nützlich sein"
43
. Ob-
wohl die Wissenschaft nicht frei von Fehlern ist, liegt ihre Stärke in der Unabhän-
gigkeit.
44
Moxter
gliedert sein Normsystem der Grundsätze ordnungsmäßiger Unterneh-
mensbewertung in fünf Teile: Allgemeine Bewertungsgrundsätze, Unternehmenser-
tragsprinzipien, Prinzipien der Ertragsermittlungstechnik, Prinzip grundlegender
Bewertungskriterien und den Äquivalenzgrundsätzen.
45
Die zentralen Grundsätze
ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung für den Beta-Faktor sind das Vergleichs-
prinzip
46
, das Zukunftsbezogenheitsprinzip
47
und die Äquivalenzgrundsätze, insbe-
sondere das Stichtagsprinzip
48
.
2.
Unternehmensbewertungszwecke
Es ist allgemein anerkannt, dass es nicht den einen richtigen Unternehmens-
wert gibt, sondern dieser maßgeblich durch den Bewertungszweck bestimmt sein
kann.
49
39
Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung Bedeutung und Quellen,
a.a.O., hier S. 990.
40
Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung Bedeutung und Quellen,
a.a.O., hier S. 990.
41
Vgl. Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung Bedeutung und
Quellen, a.a.O., hier S. 990.
42
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 629.
43
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 629.
44
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 629.
45
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 633.
46
Vgl. Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, 2., vollständig umge-
arbeitete Aufl., Nachdruck, Wiesbaden 1991, hier S. 123.
47
Vgl. Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, hier S. 116.
48
Vgl. Moxter, Adolf: Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, hier S. 168.
49
Vgl. Coenenberg, Adolf G./Schultze, Wolfgang: Unternehmensbewertung: Konzeptionen und Per-
spektiven, in: DBW, 62. Jg. (2002), S. 597-621, hier S. 597; Timmreck, Christian: Kapitalmarkt-
orientierte Sicherheitsäquivalente, Wiesbaden 2006, hier S. 14.
6
Matsche/Brösel
nennen als Zwecke der Grundsätze funktionsgemäßer Unter-
nehmensbewertung den Kommunikationsunterstützungszweck, den Informations-
zweck, den ternären Schutzzweck und den Komplexitätsreduktionszweck.
50
Abgeleitet werden diese Zwecke aus der Tatsache, dass in der Unternehmens-
bewertung ,,schlecht strukturierte Probleme"
51
anzutreffen sind, die Ursache be-
stimmter ,,Defekte"
52
wie beispielsweise die Unsicherheit über zukünftige Zinssätze
oder Synergieeffekte sind. Die Vielzahl der realen Entscheidungen soll mit dem
Komplexitätsreduktionszweck eingeschränkt werden, damit möglichst wertneutral
eine Vereinfachung der Probleme vorgenommen werden kann, ohne bestimmte Inte-
ressengruppen zu benachteiligen.
53
Der dreifache, ternäre Schutzzweck resultiert aus der Trennung der Interessen
von Bewerter, Bewertungsadressat und der möglichen Trennung aus Eigentum und
Unternehmenskontrolle.
54
Die Schutzbedürftigkeit des Bewerters leitet sich aus den
Konsequenzen eigener Fehler oder Irrtümer ab.
55
Die Grundsätze helfen dem Bewer-
ter, bestimmte ,,schwerwiegende und ganz systematische" Fehler nicht zu verursa-
chen.
56
Der Unternehmenseigner soll demgegenüber vor Fehlern geschützt werden,
die ihm einen Wert zuschreiben, der nicht seiner Leistung entspricht.
57
Diese zweite
Ausprägung des Schutzzweckes beinhaltet das Principal-Agent-Problem, das zusätz-
lich Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung mit sich bringt.
58
Die drit-
te Ausprägung berücksichtigt die Schutzbedürftigkeit der Unternehmensleitung vor
Ansprüchen der Eigentümer aufgrund einer fehlerhaften Bewertung, die möglicher-
weise zu anderen Entscheidungen geführt hat.
59
50
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 622.
51
Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 622.
52
Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 623.
53
Vgl. Moxter, Adolf: Die Bedeutung der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, in:
zfbf, 32. Jg. (1980), S. 454-459, hier S. 454.
54
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 623.
55
Vgl. Moxter, Adolf: Die Bedeutung der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung, in:
Unternehmensakquisition und Unternehmensbewertung, hrsg. v. Walter Busse von Colbe und
Adolf G. Coenenberg, Stuttgart 1992, S. 47-54, hier S. 50.
56
Vgl. Moxter, Adolf: Die Bedeutung der Grundsätze ordnungsmäßiger Unternehmensbewertung,
a.a.O., hier S. 455.
57
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 624.
58
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 624.
59
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 624.
7
Jacobs/Scheffler
betonen, dass der Zweck grundsätzlich die Funktionen einer
Unternehmensbewertung bestimmt.
60
Sie unterscheiden die Beratungs-, Vermitt-
lungs-, Argumentations- und Kommunikations- oder Bilanzfunktion.
61
Der Informationszweck hat die Aufgabe, Informationsdefizite bei allen Adres-
saten der Bewertung zu minimieren. Dem Bewerter soll dadurch zusätzlich die Mög-
lichkeit gegeben werden, seine Bewertung zielorientiert und sachgerecht durchzufüh-
ren.
62
Der Bewertungsadressat nutzt die Grundsätze außerdem zur Kontrolle über die
Qualität und Art der ihm übermittelten Informationen und seiner persönlichen Erwar-
tungen.
63
Der Kommunikationsunterstützungszweck gewährleistet, dass alle Adressaten
die Grundsätze und Resultate von allen Adressaten gleich interpretieren.
64
Daraus
leiten sich Grundsätze ab, die ,,möglichst lückenlos, überschneidungsfrei und wider-
spruchsfrei sowie zudem klar und eindeutig formuliert"
65
sind.
III.
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zur Herleitung von Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Unternehmensbewertung für die Ermittlung des Beta-
Faktors
1.
Herleitung des Kapitalisierungszinssatzes mit Beta-Faktoren
Theoretischer Ausgangspunkt des Beta-Faktors ist das CAPM, das wiederum
auf der von Markowitz
66
entwickelten Portfolio-Theorie und dem Separationstheo-
rem von Tobin
67
aufbaut. Die Portfolio-Theorie erläutert die Konstruktion der Kapi-
talmarktlinie, die keine Informationen über das Risiko eines individuellen Wertpa-
piers eines Portefeuilles liefern kann.
68
Es kann allerdings mathematisch nachgewie-
sen werden, dass die Steigung eines beliebigen Wertpapiers gegen die Steigung der
60
Vgl. Jacobs, Otto H./Scheffler, Wolfram: Unternehmensbewertung, in: Handwörterbuch des Rech-
nungswesens, hrsg. v. Klaus Chmielewicz und Marcell Schweitzer, Stuttgart 1993, Sp. 1977-1988,
hier Sp. 1978.
61
Vgl. Jacobs, Otto H./Scheffler, Wolfram: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier Sp. 1978 f.
62
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 626.
63
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 626.
64
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 626.
65
Vgl. Matschke, Manfred J./Brösel, Gerrit: Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 626.
66
Vgl. Markowitz, Harry M.: Portfolio Selection, in: JoF, Vol. 7 (1952), S. 77-91, hier S. 77.
67
Vgl. Tobin, James: Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk, in: Review of Economic
Studies, Vol. 24 (1957), S. 65-86, hier S. 65.
68
Vgl. Ulschmid, Christoph: Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen, Frankfurt a. M.
1994, hier S. 53.
8
Kapitalmarktlinie strebt.
69
Diese Gleichgewichtsannahme führte durch die Arbeiten
von Sharpe
70
, Lintner
71
, Mossin
72
zur Entwicklung des CAPM.
Obwohl alle Komponenten und Annahmen
73
der CAPM-Gleichung bereits
mehrfach kritisch analysiert wurden, besitzt das Beta-Konzept zur Messung des sys-
tematischen Risikos eine dominante Stellung innerhalb der Diskussion um das
CAPM.
74
Dies liegt zum größten Teil an den verschiedenen Möglichkeiten der
Schätzung von Beta-Faktoren.
75
Mithilfe des CAPM wird die erwartete Rendite eines riskanten Wertpapiers im
Marktgleichgewicht bestimmt.
76
Dabei erfolgt die Risikoadjustierung bei der Unter-
nehmensbewertung mit dem CAPM, indem zum risikolosen Zinssatz
77
ein adäquater
Risikozuschlag ermittelt wird.
78
Der Risikozuschlag errechnet sich dabei durch Mul-
tiplikation der Marktrisikoprämie mit dem übernommenen Maß an systematischem
Risiko des Wertpapiers.
79
Das systematische Risiko wird quantifiziert durch den Be-
ta-Faktor.
80
Die Marktrisikoprämie resultiert aus der Differenz der erwarteten Rendi-
69
Vgl. Weber, Martin: Risikoentscheidungskalküle in der Finanzierungstheorie, Stuttgart 1990, hier
S. 73 f.
70
Vgl. Sharpe, William F.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions
of Risk, in: JoF, Vol. 19 (1964), S. 425-442, hier S. 431.
71
Vgl. Lintner, John: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock
Portfolio and Capital Budgets, in: Review of Economics & Statistics, Vol. 47 (1965), S. 13-37, hier
S. 34.
72
Vgl. Mossin, Jan: Equilibrium in a Capital Asset Market, in: Econometrica, Vol. 34 (1966), S. 768-
783, hier S. 769.
73
Eine Aufzählung der Annahmen beschreibt u. a. Hachmeister. Vgl. Hachmeister, Dirk: Der Dis-
counted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung, 4., durchgesehene Aufl., Frankfurt
a. M. u. a. 2000, hier S. 160.
74
Vgl. Weizsäcker, Robert K./Krempel, Katja: Risikoadäquate Bewertung nicht-börsennotierter Un-
ternehmen ein alternatives Konzept, in: FB, 6. Jg. (2004), S. 808-814, hier S. 810.
75
Vgl. Großfeld, Bernhard/Stöver, Rüdiger: Ermittlung des Betafaktors in der Unternehmensbewer-
tung: Anleitung zum ,,Do it yourself", in: BB, 59. Jg. (2004), S. 2799-2809, hier S. 2803.
76
Vgl. Berner, Christian/Rojahn, Joachim/Kiel, Olaf/Dreimann, Michael: Die Berücksichtigung des
unternehmensindividuellen Risikos in der Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 711.
77
Zur Diskussion über die Höhe des risikolosen Zinssatz vgl. Ballwieser, Wolfgang: Zum risikolosen
Zins für die Unternehmensbewertung, in: Kapitalgeberansprüche, Marktwertorientierung und Un-
ternehmenswert, Festschrift für Jochen Drukarczyk, hrsg. v. Frank Richter u. a., München 2003,
S. 21-35, hier S. 23; Daske, Holger/Gebhardt, Günther: Kapitalmarktorientierte Bestimmung von
risikofreien Zinssätzen für die Unternehmensbewertung, in: WPg, 58. Jg. (2005), S. 649-655, hier
S. 650.
78
Vgl. Timmreck, Christian: -Faktoren Anwendungsprobleme und Lösungsansätze, a.a.O., hier
S. 300.
79
Vgl. Timmreck, Christian: -Faktoren Anwendungsprobleme und Lösungsansätze, a.a.O., hier
S. 301.
80
Vgl. Kratz, Norbert/Wangler, Clemens: Unternehmensbewertung bei nicht kapitalmarktorientierten
Unternehmen, a.a.O., hier S. 171.
9
te des Marktportefeuilles und dem bereits bekannten risikolosen Zinssatz.
81
Auf der
Wertpapiermarktlinie können grafisch die verschiedenen Kombinationen von Beta-
Faktor und Rendite dargestellt werden.
82
Da die Marktrisikoprämie und der risikolose Zins als gegeben angesehen wer-
den, verändert nur der Beta-Faktor die Renditeerwartung des Investors.
83
Nur im
Beta-Faktor wird das spezifische Risiko des Unternehmens berücksichtigt.
84
Der
Beta-Faktor entspricht dem Quotienten aus der Kovarianz von Wertpapier- und
Marktrendite und der Varianz der Marktrendite.
85
Er stellt wie die Standardabweichung oder Varianz ein individuelles, im Ge-
gensatz zu diesen aber relatives Risikokriterium dar.
86
Das unsystematische Risiko
besitzt keine Relevanz innerhalb des CAPM, da es durch Diversifikation seitens der
Investoren auf null gesenkt werden kann.
87
Investoren, die eine höhere Rendite er-
warten, müssen ein höheres systematisches Risiko übernehmen.
88
Das Modell postu-
liert einen festen Rendite-Risiko-Zusammenhang.
89
Da das CAPM gemäß den Annahmen nur für eine Periode definiert ist, sind bei
der Anwendung für längere Zeiträume weitere Bedingungen notwendig.
90
Erstens
dürfen sich der risikolose Zinssatz und der Marktpreis des Risikos im Zeitablauf
81
Vgl. Dück-Rath, Marijke: Unternehmensbewertung mit Hilfe von DCF-Methoden und ausgewähl-
ten Realoptionsansätzen, Frankfurt a. M. 2004, hier S. 68. In der Literatur gibt es keine eindeutige
Meinung über die Höhe und Ermittlungstechnik der Marktrisikoprämie. Einen Überblick über die
Diskussion liefert Wenger. Vgl. Wenger, Ekkehard: Verzinsungsparameter in der Unternehmens-
bewertung, in: AG, 50. Jg. (2005), Sonderheft, S. 9-22, insbesondere S. 18.
82
Vgl. Maier, David A.: Der Betafaktor in der Unternehmensbewertung, in: FB, 3. Jg. (2001), S. 298-
302, hier S. 299.
83
Vgl. Arbeitskreis ,,Finanzierung" der Schmalenbach-Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Be-
triebswirtschaft e.V.: Wertorientierte Unternehmenssteuerung mit differenzierten Kapitalkosten, in:
zfbf, 48. Jg. (1996), S. 543-578, hier S. 548.
84
Vgl. Timmreck, Christian: -Faktoren Anwendungsprobleme und Lösungsansätze, a.a.O., hier
S. 301.
85
Vgl. Ballwieser, Wolfgang: Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Verfahren, in:
WPg, 51. Jg. (1998), S. 81-92, hier S. 82.
86
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 66.
87
Vgl. Steiner, Manfred/Beiker, Hartmut/Bauer, Christoph: Theoretische Erklärungen unterschiedli-
cher Aktienrisiken und empirische Überprüfungen, in: Empirische Kapitalmarktforschung, zfbf
Sonderheft 31, hrsg. v. Wolfgang Bühler, Frankfurt a. M. 1993, S. 99-129, hier S. 101.
88
Vgl. Böcking, Hans-Joachim/Nowak, Karsten: Der Beitrag der Discounted Cash Flow-Verfahren
zur Lösung der Typisierungsproblematik bei Unternehmensbewertungen, in: DB, 51. Jg. (1998),
S. 685-690, hier S. 689.
89
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Alternative Verfahren zur Ermittlung und zum Einsatz
von Betafaktoren, a.a.O., hier S. 437.
90
Vgl. Haley, Charles W.: The Theory of Financial Decisions, New York u. a.: McGraw-Hill, 1979,
hier S. 201.
10
nicht ändern.
91
Zweitens darf es keine Veränderung des systematischen Risikos ge-
ben oder ,,eine veränderte projektspezifische Risikohöhe wird durch ein verändertes
Kapitalmarktrisiko ausgeglichen"
92
. Diese weiteren Annahmen wären nicht erforder-
lich, wenn ein vollkommener Sekundärmarkt für Investitionsprojekte in der Realität
existieren würde, der einen Verzicht auf mehrperiodige Planungsrechnungen ermög-
lichen würde.
93
Der Beta-Faktor des Marktportefeuilles entspricht einem Wert von eins. Beta-
Faktoren größer als eins bedeuten, dass sich die Volatilität der Aktienrenditen im
Vergleich zum Gesamtmarkt höher sind.
94
Bei einem Beta-Faktor kleiner eins ist die
Reaktion schwächer.
95
Theoretisch kann ein Beta-Faktor von null oder kleiner null
existieren, wodurch die Renditeforderung dem risikolosen Zinssatz entspricht bezie-
hungsweise korreliert ist.
96
Wird von stabilen Erwartungen bezüglich der linearen
Komponenten der CAPM-Gleichung ausgegangen, so kann der Beta-Faktor auf
Grundlage der historischen Kapitalmarktdaten ermittelt werden.
97
Der Rendite-Risiko-Zusammenhang wird durch Verwendung des Marktmo-
dells statistisch abgebildet.
98
Somit sind das CAPM und das Marktmodell nicht iden-
tisch, da das Marktmodell einen Renditegenerierungsprozess abbildet, der nicht theo-
riegestützt ist und auch kein Gleichgewichtsmodell darstellt.
99
Das Risiko-Rendite-Kriterium ist allerdings nicht unumstritten, da für be-
stimmte Unternehmen hohe Renditen bei geringem Risiko empirisch ermittelt wur-
91
Vgl. Fama, Eugene F.: Risk-Adjusted Discount Rates and Capital Budgeting under Uncertainty, in:
Journal of Financial Economics, Vol. 5 (1977), S. 3-24, hier S. 16.
92
Hachmeister, Dirk: Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung, a.a.O.,
hier S. 164.
93
Vgl. Bogue, Marcus C./Roll, Richard: Capital Budgeting of Risky Projects with ,,Imperfect" Mar-
kets for Physical Capital, in: JoF, Vol. 29 (1974), S. 601-613, hier S. 606.
94
Vgl. Timmreck, Christian: -Faktoren Anwendungsprobleme und Lösungsansätze, a.a.O., hier
S. 301.
95
Vgl. Pratt, Shannon P./ Reilly, Robert F./Schweihs, Robert P.: Valuing a Business, 4. Aufl., New
York: McGraw-Hill, 2000, hier S. 164.
96
Vgl. Gorny Christian/Rosenbaum, Dirk: Zur Verwendung kapitalmarktbasierter Risikozuschläge in
phasenorientierten Unternehmensbewertungsmodellen, in: FB, 4. Jg. (2002), S. 486-489, hier
S. 487.
97
Vgl. Arbeitskreis ,,Finanzierung" der Schmalenbach-Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Be-
triebswirtschaft e.V.: Wertorientierte Unternehmenssteuerung mit differenzierten Kapitalkosten,
a.a.O., hier S. 549.
98
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
2., erweiterte Aufl., Bad Soden/Taunus 2001, hier S. 257.
99
Vgl. Frantzmann, Hans-Jörg: Der Risikobegriff im Investmentmanagement, in: Handbuch Portfo-
liomanagement, hrsg. v. Jochen M. Kleeberg u. a., 2., vollkommen neu konzipierte Aufl., Bad So-
den/Taunus 2002, S. 46-61, hier S. 56.
11
den.
100
Fama/French kritisieren die Aussagekraft des Beta-Faktors und stellen für
ihren Beobachtungszeitraum einen negativen Zusammenhang zwischen der Markt-
kapitalisierung einer börsennotierter Gesellschaft und ihrer Rendite sowie einen posi-
tiven Zusammenhang zwischen dem relativen Buchwert und der Rendite des glei-
chen Unternehmens fest.
101
2.
Empirische Ableitung der Beta-Faktoren aus Vergangenheitsdaten
a)
Historische Kapitalmarktregression zur Schätzung von Beta-Faktoren
aa)
Parameterschätzung mittels des Kleinste-Quadrate-Verfahrens
Empirische Beta-Faktoren werden aufgrund der Annahme im Marktmodell, ei-
nem Regressionskoeffizienten zu entsprechen, durch die Methode der kleinsten
Quadrate oder Ordinary-Least-Squares-Verfahren bestimmt.
102
Das Verfahren ist
allerdings an eine Vielzahl von Annahmen geknüpft.
103
Werden die Annahmen nicht
erfüllt, so ergeben aufgrund von Schätzproblemen ineffiziente oder verzerrte Beta-
Faktoren.
104
Des Weiteren müssen vor der Durchführung der Regressionsanalyse
verschiedene Größen festgelegt werden, die das Ergebnis nicht unerheblich beein-
flussen.
105
Das Kleinste-Quadrate-Verfahren beruht auf der Annahme, dass eine abhängi-
ge Variable, der Regressand, in der jeweiligen Periode von den gleichzeitigen Beo-
bachtungen einer oder mehrerer unabhängigen Variablen, den Regressoren, linear
100
Vgl. Wiemann, Volker/Mellewigt, Thomas: Das Risiko-Rendite Paradoxon. Stand der Forschung
und Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in: zfbf, 50. Jg. (1998), S. 551-572, hier S. 551.
101
Vgl. Fama, Eugene F./French, Kenneth R.: The Cross-section of Expected Stock Returns, in: JoF,
Vol. 47 (1992), S. 427-465, hier S. 449; Kleeberg, Jochen M.: Der Einsatz von fundamentalen Be-
tas im modernen Portfoliomanagement, in: Die Bank, 32. Jg. (1992), S. 474-478, hier S. 475.
Keppler, Michael: ,,Beta"-Faktoren und CAPM ein Nachruf, in: Die Bank, 32. Jg. (1992),
S. 268-269, hier S. 268; Hawawini, Gabriel/Keim, Donald B.: Beta, Size and Price/Book: three
Risk Measures or one?, in: Mastering Finance, hrsg. v. Financial Times u. a., London: Pitman
1998, S. 36-43, hier S. 37. Der Quotient aus bilanziellem Eigenkapital und Marktkapitalisierung
einer Gesellschaft bezeichnet den relativen Buchwert.
102
Vgl. Berner, Christian/Rojahn, Joachim/Kiel, Olaf/Dreimann, Michael: Die Berücksichtigung des
unternehmensindividuellen Risikos in der Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 712; Maier,
David A.: Der Betafaktor in der Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 300.
103
Vgl. Hansen, Gerd: Quantitative Wirtschaftsforschung, München 1993, hier S. 61.
104
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 61.
105
Vgl. Daske, Holger/Gebhardt, Günther: Zukunftsorientierte Bestimmung von Risikoprämien und
Eigenkapitalkosten für die Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 534.
12
abhängig ist.
106
Zusätzlich fließt eine stochastische Zufallsgröße additiv in die Glei-
chung ein, die Überlagerungen aufgrund von Störeinflüssen darstellt.
107
In dieser
Größe sind alle Bestimmungsfaktoren der abhängigen Variablen, die nicht in Form
eines Regressors in die Regressionsgleichung einwirken, zusammengefasst.
108
Inner-
halb des Kleinste-Quadrate-Verfahrens wird ein Vektor der geschätzten Regressi-
onskoeffizienten für den unbekannten Parameter des Modells so bestimmt, dass die
Summe der Quadrate der Residuen minimal wird.
109
Bezogen auf das Single-Index-
Modell erhält man eine lineare Einfachregression
110
mit zwei unabhängigen Variab-
len.
111
Der Stichprobenumfang ergibt sich aus den empirisch beobachtbaren Zeitrei-
hen mit den Renditen der betrachteten Aktien und dem Marktindex.
112
Auf Basis
dieser Schätzperiode wird angenommen, dass aus vergangenen Renditen Informatio-
nen über zukünftige Renditen enthalten sind.
113
Das Kleinste-Quadrate-Verfahren reagiert empfindlich auf Regressionsausrei-
ßer in den zugrunde liegenden Daten von Aktien- und Indexrenditen.
114
Diese resul-
tieren aus Messfehlern wie Nullrenditen, d. h. Tage ohne Handelsumsätze, oder auch
firmenspezifischen Ereignissen.
115
Der Kurs einer Aktie bewegt sich dadurch kurz-
fristig stärker oder schwächer als die allgemeine Marktentwicklung.
116
Bei diesen
nicht marktbezogenen Kursbewegungen handelt es nicht um das systematische Risi-
106
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 201.
107
Vgl. Patterson, Cleveland S.: The Cost of Capital, Westport, Connecticut: Quorum Books, 1995,
hier S. 118.
108
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 202.
109
Vgl. Schneeweiß, Hans: Ökonometrie, 4., überarbeitete Aufl., Heidelberg 1990, hier S. 95.
110
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 203. Modelle mit nur einer erklärenden Variablen werden in Abgrenzung zur mul-
tiplen Regression als Einfachregression bezeichnet.
111
Vgl. Hansen, Gerd: Quantitative Wirtschaftsforschung, a.a.O., hier S. 52.
112
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 98; Hach-
meister, Dirk: Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung, a.a.O., hier
S. 181. Als Standard werden mindestens zehn Stichproben pro Regressionskoeffizient empfohlen,
was 20 Stichproben beim CAPM entspräche. Allerdings entspricht der Umfang meistens 60 oder
mehr Stichproben.
113
Vgl. Maier, David A.: Der Betafaktor in der Unternehmensbewertung, a.a.O., hier S. 300.
114
Vgl. Ulschmid, Christoph: Empirische Validierung von Kapitalmarktmodellen, a.a.O., hier S. 225.
115
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Alternative Verfahren zur Ermittlung und zum Einsatz
von Betafaktoren, a.a.O., hier S. 444.
116
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Alternative Verfahren zur Ermittlung und zum Einsatz
von Betafaktoren, a.a.O., hier S. 444.
13
ko, was durch die Beta-Faktoren abgebildet wird.
117
Allerdings beeinflussen diese
titelspezifischen Marktbewegungen die Größe der Beta-Faktoren bei einer Schätzung
mit ex post beobachteten Renditen.
118
bb)
Annahmen der linearen Regression
Für aussagefähige Schätzergebnisse unterstellt das Kleinste-Quadrate-Ver-
fahren bestimmte Annahmen.
119
Erstens muss der Erwartungswert der Störgrößen
gleich null sein.
120
Dies bedeutet, dass der gesamte systematische Einfluss durch die
Regressoren erklärt wird.
121
Zweitens muss die Varianz des Störterms einen beliebigen, aber konstanten
Wert besitzen.
122
Diese Eigenschaft wird als Homoskedastizität benannt. Heteroske-
dastizität bezeichnet eine sich verändernde Varianz, die empirisch häufig beobachtet
wurde.
123
Die zweite Annahme wird durch die Heteroskedastizität verletzt, da sich
die Varianz der Störgrößen im Zeitablauf beziehungsweise in Abhängigkeit der er-
klärenden Variable ändert.
124
Ursache für die Heteroskedastizität ist eine Fehlspezi-
fikation des zugrunde liegenden Regressionsmodells aufgrund eines nichtlinearen
Zusammenhangs, der trotzdem linearisiert wurde oder eine bedeutende erklärende
Variable wurde nicht in die Modellgleichung integriert.
125
Außerdem können starke
zeitliche Trends in den beobachteten Daten der abhängigen und unabhängigen Vari-
ablen zu einer Heteroskedastie führen.
126
Drittens muss der Zufallsprozess, der die Störgröße erzeugt, unabhängig vom
Prozess der unabhängigen Variablen sein.
127
Dies ist der Fall, wenn die Kovarianz
117
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Alternative Verfahren zur Ermittlung und zum Einsatz
von Betafaktoren, a.a.O., hier S. 444.
118
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 159.
119
Vgl. Greene, William H.: Econometric Analysis, 5. Aufl., Upper Saddle River, New Jersey: Pren-
tice Hall 2003, hier S. 10.
120
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 204.
121
Vgl. Möller, Hans Peter: Bilanzkennzahlen und Ertragsrisiken des Kapitalmarktes, Stuttgart 1986,
hier S. 58.
122
Vgl. Hachmeister, Dirk: Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung,
a.a.O., hier S. 183.
123
Vgl. Greene, William H.: Econometric Analysis, a.a.O., hier S. 215.
124
Vgl. Winkelmann, Michael: Aktienbewertung in Deutschland, Königstein/Taunus 1984, hier S. 68.
125
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 63.
126
Vgl. Schneeweiß, Hans: Ökonometrie, a.a.O., hier S. 192.
127
Vgl. Möller, Hans Peter: Bilanzkennzahlen und Ertragsrisiken des Kapitalmarktes, a.a.O., hier
S. 60.
14
dieser beiden null und somit der Regressor nicht endogen ist. Besteht trotzdem eine
lineare Abhängigkeit, so wird dies Autokorrelation genannt und verletzt die Annah-
men. Ex post sollte anhand ökonometrischer Tests überprüft werden, ob die Annah-
men erfüllt sind.
128
Die erste Annahme ist hinsichtlich der Residuen immer formal
erfüllt, da beim Kleinste-Quadrate-Verfahren die Summe der Residuen so geschätzt
werden, dass sie null ergeben.
129
cc)
Beurteilungsgrößen der Schätzung
Um einen Anhaltspunkt über die Schätzgenauigkeit zu erhalten, kann der Stan-
dardschätzfehler der Regressionskoeffizienten ermittelt werden.
130
Bei einem gerin-
geren Standardfehler ist das Konfidenzintervall schmaler und die Zuverlässigkeit des
Schätzers ist höher.
131
Die Zuverlässigkeit der Schätzung nimmt annahmegemäß mit
ansteigendem Stichprobenumfang zu.
132
In der Literatur hat sich die mittlere quadra-
tische Abweichung als Abweichungsmaß zur Beurteilung des Schätzfehlers durchge-
setzt.
133
Im Rahmen einer Querschnittsbetrachtung beziehungsweise -prognose zeigt
das Verfahren die Abweichung der Beta-Faktoren.
134
Die mittlere quadratische Ab-
weichung kann bei der Berechnung in die Komponenten Verzerrung beziehungswei-
se Bias, Ineffizienz und Zufallsfehler aufgespaltet und dadurch die Ursachen der In-
stabilität analysiert werden.
135
Eine Verzerrung entsteht durch unterschiedliche Quer-
schnittsmittelwerte der geschätzten zu den prognostizierten Beta-Faktoren.
136
Die
Ineffizienzkomponente gibt an, ob eine Tendenz existiert, d. h. niedrige Beta-Fakto-
ren in der Prognose überschätzt und hohe Beta-Faktoren unterschätzt werden.
137
Der
128
Vgl. Hansen, Gerd: Quantitative Wirtschaftsforschung, a.a.O., hier S. 91.
129
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 257.
130
Vgl. Steiner, Peter/Uhlir, Helmut: Wertpapieranalyse, 4., vollständig überarbeitete und erweiterte
Aufl., Heidelberg 2001, hier S. 179.
131
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 69.
132
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Alternative Verfahren zur Ermittlung und zum Einsatz
von Betafaktoren, a.a.O., hier S. 440.
133
Vgl. Klemkosky, Robert C./Martin, John D.: The Adjustment of Beta Forecasts, in: JoF, Vol. 30
(1975), S. 1123-1128, hier S. 1123; Bauer, Christoph: Das Risiko von Aktienanlagen, Köln 1992,
hier S. 144.
134
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 74.
135
Vgl. Bauer, Christoph: Das Risiko von Aktienanlagen, a.a.O., hier S. 145.
136
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 75.
137
Vgl. Bauer, Christoph: Das Risiko von Aktienanlagen, a.a.O., hier S. 145.
15
Zufallsfehler beschreibt den Anteil der nicht erklärten Varianz der prognostizierten
Beta-Faktoren.
138
Empirische Studien messen anhand des statistischen Schätzfehlers die Auswir-
kungen unterschiedlicher Intervall- und Schätzperiodenlänge sowie Portefeuillegrö-
ßen.
139
Dabei wurde beobachtet, dass die Verzerrung durchschnittlich den geringsten
Anteil ausmacht.
140
Die beiden anderen Komponenten, Zufallsfehler und Ineffizienz,
sind für einen deutlich höheren Anteil der mittleren quadratischen Abweichung ver-
antwortlich.
141
Der größte Anteil resultiert aus dem Zufallsfehler.
142
Das Bestimmtheitsmaß verdeutlicht anschaulich, welcher Anteil an der Ge-
samtschwankung durch das Regressionsmodell erklärt wird.
143
Je größer das Be-
stimmtheitsmaß ist, desto höher ist die Güte des Modells.
144
Allerdings nimmt das
Bestimmtheitsmaß mit steigendem Stichprobenumfang zu.
145
Bei Anwendung des
korrigierten Bestimmtheitsmaßes erfolgt eine Korrektur des Effekts.
146
Nimmt man eine Normalverteilung der Störgrößen an, so können auf Basis des
Standardfehlers Signifikanztests und Konfidenzintervalle errechnet werden.
147
Empi-
rische Studien für den deutschen Kapitalmarkt zeigen, dass die Annahme einer Nor-
malverteilung für längerfristige Renditeintervalle nicht verworfen werden kann.
148
Mit Hilfe des t-Tests wird in der Regel bei empirischen Forschungen überprüft, wie
signifikant die Betafaktoren von einem vorgegebenen kritischen Wert abweichen.
149
138
Vgl. Bauer, Christoph: Das Risiko von Aktienanlagen, a.a.O., hier S. 146.
139
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 228.
140
Vgl. Rudolph, Bernd/Zimmermann, Peter: Estimation and Prediction of Systematic Risk with
Market-Based and Accounting-Based Data for German Shares, in: Empirical Research on the
German Capital Market, hrsg. v. Wolfgang Bühler, Heidelberg 1999, S. 187-206, hier S. 200.
141
Vgl. Pfennig, Michael: Zur fundamentalen Erklärung der Beta-Faktoren am deutschen Kapital-
markt, Working Paper, Beiträge zur Theorie der Finanzmärkte, Nummer 5, hrsg. v. Institut für Ka-
pitalmarktforschung der J.W. Goethe-Universität Frankfurt a. M. 1993, hier S. XI.
142
Vgl. Bauer, Christoph: Das Risiko von Aktienanlagen, a.a.O., hier S. 150.
143
Vgl. Hansen, Gerd: Quantitative Wirtschaftsforschung, a.a.O., hier S. 61.
144
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 243.
145
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 68.
146
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 250.
147
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 68.
148
Vgl. Möller, Hans Peter: Bilanzkennzahlen und Ertragsrisiken des Kapitalmarktes, a.a.O., hier
S. 74.
149
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 70.
16
dd)
Schätzprobleme von Beta-Faktoren
Werden die Annahmen innerhalb der Schätzung nicht eingehalten, besitzen die
geschätzten Beta-Faktoren nicht mehr die notwendigen statistischen Eigenschaf-
ten.
150
Eine Autokorrelation der Störgröße verletzt die zweite getroffene Annahme
und führt zu nicht mehr zufälligen Abweichungen von der Regressionslinie.
151
Aus-
schlaggebend dafür kann sein, dass eine sich systematisch entwickelnde Einflussgrö-
ße in der Regressionsbeziehung nicht beachtet oder die unterstellte Beziehung nicht
linear ist.
152
Ebenso kann ein geringes Handelsvolumen von Aktien oder Nullrendi-
ten zu autokorrelierten Residuen führen.
153
Durch das Vorliegen von Autokorrelation wird der Standardfehler bezie-
hungsweise die Varianz der Regressionskoeffizienten fehlerhaft geschätzt und die
Berechnung von Konfidenzintervallen und die Durchführung von Signifikanztests
sind nicht mehr zuverlässig.
154
Im Marktmodell wird unterstellt, dass die Störgrößen
verschiedener Aktien nicht miteinander korrelieren und somit die Kursbewegungen
nur aus systematischen Einflussfaktoren resultieren.
155
Sind die Störgrößen allerdings
doch signifikant korreliert, so deutet dies auf weitere systematische Einflussfaktoren
hin.
156
Diese nicht berücksichtigten Faktoren können beispielsweise Brancheneffekte
sein, die durch gleichläufige oder gegenläufige Kursbewegungen einer größeren An-
zahl von Aktien entstehen.
157
Die geschätzten Beta-Faktoren sind bei Vorliegen von Heteroskedastizität und
Autokorrelation linear, erwartungstreu und konsistent, aber nicht mehr effizient.
158
Die Eigenschaft der Effizienz muss ebenfalls abgelehnt werden, wenn die zur Schät-
zung verwendeten Renditen selbst autokorreliert sind oder die Residuen mit der In-
150
Vgl. Nowak, Thomas: Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie, Köln 1994, hier S. 178.
151
Vgl. Backhaus, Klaus/Erichson, Bernd/Plinke, Wulff/Weiber, Rolf: Multivariate Analysemetho-
den, 11., überarbeitete Aufl., Heidelberg u. a. 2006, hier S. 88.
152
Vgl. Schneeweiß, Hans: Ökonometrie, a.a.O., hier S. 189.
153
Vgl. Scholes, Myron/Williams, Joseph: Estimating Betas from Nonsynchronous Data, in: Journal
of Financial Economics, Vol. 5 (1977), S. 309-327, hier S. 314.
154
Vgl. Scholes, Myron/Williams, Joseph: Estimating Betas from Nonsynchronous Data, a.a.O., hier
S. 314.
155
Vgl. Schneeweiß, Hans: Ökonometrie, a.a.O., hier S. 163.
156
Vgl. Schneeweiß, Hans: Ökonometrie, a.a.O., hier S. 163.
157
Vgl. Cohen, Kalman J./Pogue, Jerry: An Empirical Evaluation of Alternative Portfolio Selection
Models, in: Journal of Business, Vol. 46 (1967), S. 166-193, hier S. 177. Residuenkorrelationen,
die als Brancheneffekte gedeutet werden können, wurden bereits wenige Jahre nach Vorstellung
des CAPM von Cohen/Pogue beobachtet.
158
Vgl. Poddig, Thorsten/Dichtl, Hubert/Petersmeier, Kerstin: Statistik, Ökonometrie, Optimierung,
a.a.O., hier S. 295. Zusätzlich sind auch t-Test und F-Test Statistiken nicht mehr gültig.
17
dexrendite korrelieren.
159
Dann muss zudem die dritte Annahme, das Vorliegen exo-
gener Regressoren, als nicht mehr gegeben angesehen werden.
160
Die Schätzung wird
verzerrt und inkonsistent.
161
Dieses Problem wird beispielsweise bei breit aufgestell-
ten Aktienindizes aufgrund der geringen Gewichtung einer einzelnen Aktie mini-
miert.
162
Bei kleinen Aktienindizes kann die Indexrendite abhängig von Kursent-
wicklungen einzelner Aktien sein.
163
b)
Instabilität von Beta-Faktoren als zentrales Problem historischer Kapi-
talmarktregression
Im Rahmen der Ermittlung von Beta-Faktoren wird unterstellt, dass diese innerhalb
der Schätzperiode stabil sind.
164
Ist dies nicht der Fall, so führen die Schätzverfahren
zu verzerrten Ergebnissen.
165
Des Weiteren kann die naive oder historische Progno-
se, die historische Beta-Faktoren auf zukünftige Prognosen überträgt, nicht verwen-
det werden.
166
Im Rahmen von empirischen Untersuchungen wird die Stabilität der
Beta-Faktoren zumeist anhand des mittleren quadratischen Schätzfehlers über-
prüft.
167
Eine Vielzahl an empirischen Studien kommt zu dem Ergebnis, dass die
Annahme der Stabilität abgelehnt werden muss.
168
Eine Untersuchung zeigt, dass
Beta-Faktoren von amerikanischen Nebenwerten und Value-Aktien wertmäßig in der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts um etwa 75% gefallen sind.
169
Außerdem
wurde gezeigt, dass sich Beta-Faktoren aufeinander folgender Tage trotz konstant
gehaltener Berechnungsparameter erheblich unterscheiden können.
170
159
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 63.
160
Vgl. Poddig: Statistik, Ökonometrie, Optimierung, a.a.O., hier S. 205.
161
Vgl. Baltagi, Badi H.: Econometrics, 3. Aufl., Heidelberg u. a. 2002, hier S. 101.
162
Vgl. Hachmeister, Dirk: Der Discounted Cash Flow als Maß der Unternehmenswertsteigerung,
a.a.O., hier S. 191.
163
Vgl. Möller, Hans Peter: Bilanzkennzahlen und Ertragsrisiken des Kapitalmarktes, a.a.O., hier
S. 72.
164
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 209.
165
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 209.
166
Vgl. Beaver, William H./Kettler, Paul/Scholes, Myron: The Association between Market Deter-
mined and Accounting Determined Risk Measures, in: The Accounting Review, Vol. 45 (1970),
S. 654-682, hier S. 671.
167
Vgl. Zimmermann, Peter: Schätzung und Prognose von Betawerten, a.a.O., hier S. 73.
168
Vgl. Bauer, Christoph: Das Risiko von Aktienanlagen, a.a.O., hier S. 99.
169
Vgl. Franzoni, Francesco: Where is beta going?, Working Paper, HEC School of Management,
Nummer 829, hrsg. v. Les Cahiers de Recherché-Groupe HEC, Paris 2006, hier S. 45 f..
170
Vgl. Fernández, Pablo: Are Calculated Betas Good for Anything?, Working Paper, IESE Business
School University of Navarra, Nummer 555, hrsg. v. CIIF International Center for Financial
Research, Madrid 2004, hier S. 3.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836604680
- ISBN (Paperback)
- 9783836654685
- DOI
- 10.3239/9783836604680
- Dateigröße
- 777 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Mannheim – Betriebswirtschaft, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsprüfung
- Erscheinungsdatum
- 2007 (August)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- beta-faktor capm unternehmensbewertung kapitalmarkttheorie kapitalkosten
- Produktsicherheit
- Diplom.de