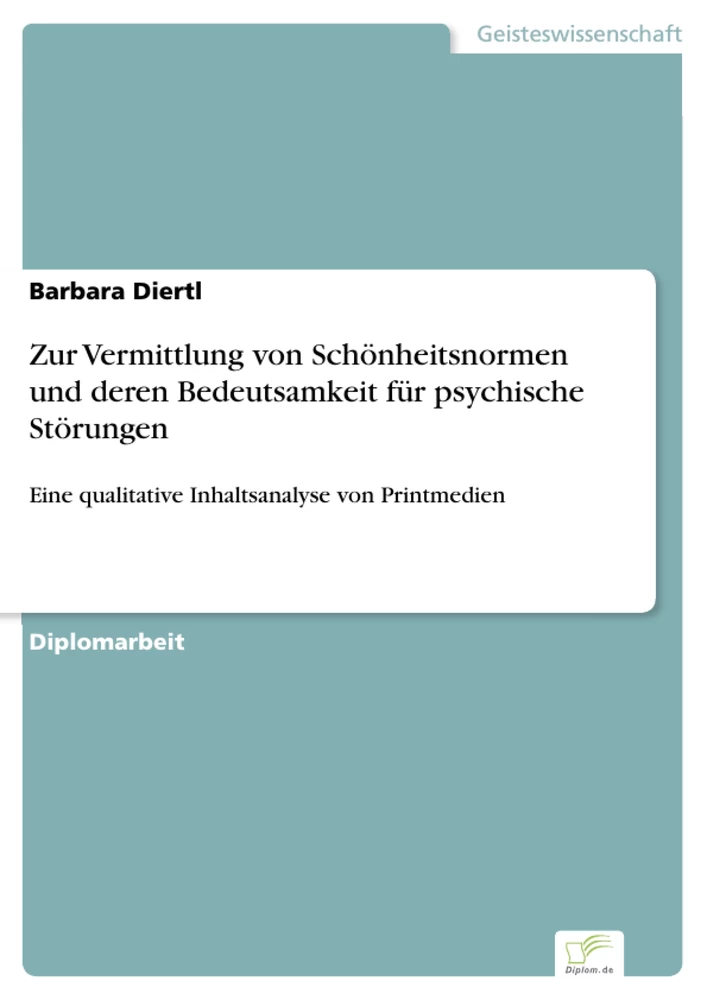Zur Vermittlung von Schönheitsnormen und deren Bedeutsamkeit für psychische Störungen
Eine qualitative Inhaltsanalyse von Printmedien
Zusammenfassung
Zentrales Anliegen der vorliegenden Diplomarbeit ist die Erfassung und Analyse von Inhalten zum Bereich Schönheit bzw. Attraktivität, wie sie durch die Medien vermittelt werden. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei die gesellschaftlichen Schönheitsideale, deren Bedeutung und Erreichbarkeit.
Den theoretischen Hintergrund bilden die psychischen Störungen Anorexia und Bulimia nervosa sowie die Körperdysmorphe Störung: Ätiologiemodelle zählen die soziokulturell vermittelten Schönheitsideale zu den prädisponierenden Merkmalen dieser Störungsbilder.
Zur Untersuchung konkreter Botschaften, die von den Medien an die Rezipienten übermittelt werden, werden aus dem Bereich der Printmedien Zeitschriften der Publikumspresse für die Zielgruppen Frauen, Männer sowie Frauen & Männer herangezogen. Die zugrunde liegende empirische Methode stellt eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) dar. Darin werden die mediale inhaltliche Vermittlung von Schönheitsnormen, die Vermittlung der Bedeutung, die diesen Schönheitsnormen zugemessen wird, und die Vermittlung von Methoden, mit deren Hilfe diese Schönheitsnormen erreicht werden sollen, untersucht.
Durch exploratives, materialgeleitetes Vorgehen wurden drei Kategoriensysteme entwickelt, die die Aspekte Normen, Bedeutung und Erreichbarkeit erfassen.
Zwei Beobachter kodierten das Material unabhängig voneinander, die Interraterreliabilität beträgt .83.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich über die Printmedien vermittelte Schönheitsnormen in erster Linie auf einen schlanken und makellosen Körper sowie auf einen modischen Kleidungsstil beziehen. Die Bedeutung von Attraktivität wird sowohl in Zusammenhang mit positiven Aspekten als auch unter Aspekten der Fragwürdigkeit dargestellt. Methoden zur Erreichbarkeit von Schönheitsnormen betreffen vorwiegend die Bereiche Kosmetik, Ernährung und Sport.
Die Ergebnisse werfen vor dem Hintergrund der genannten Störungsbilder Implikationen für den Bereich der Klinischen Psychologie hinsichtlich Gesundheitsförderung und Prävention auf. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
ZUSAMMENFASSUNG1
1.EINLEITUNG2
2.BEGRIFFSBESTIMMUNG5
2.1DEFINITION DES BEGRIFFS SCHÖNHEIT5
2.2SCHÖNHEITSKOMPONENTEN: NATÜRLICH VERSUS MODISCH6
2.3SCHÖNHEITSSTANDARDS: UNIVERSELL VERSUS SOZIOKULTURELL7
3.THEORETISCHER HINTERGRUND10
3.1PSYCHISCHE STÖRUNGEN MIT BEZUG ZU SOZIOKULTURELL VERMITTELTEN SCHÖNHEITSNORMEN10
3.1.1ESSSTÖRUNGEN: ANOREXIA […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0 Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmung
2.1 Definition des Begriffs Schönheit
2.2 Schönheitskomponenten: Natürlich versus Modisch
2.3 Schönheitsstandards: Universell versus Soziokulturell
3 Theoretischer Hintergrund
3.1 Psychische Störungen mit Bezug zu soziokulturell vermittelten Schönheitsnormen
3.1.1 Essstörungen: Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
3.1.1.1 Beschreibung und Klassifikation
3.1.1.2 Epidemiologie und Verlauf
3.1.1.3 Ätiologie
3.1.1.4 Interventionsansätze
3.1.2 Körperdysmorphe Störung
3.1.2.1 Beschreibung und Klassifikation
3.1.2.2 Epidemiologie und Verlauf
3.1.2.3 Ätiologie
3.1.2.4 Interventionsansätze
3.2 Prädisponierendes Merkmal: Soziokultureller Faktor Schönheitsnorm
3.2.1 Das weibliche Schlankheitsideal
3.2.2 Das hypermaskuline Ideal
3.3 Wirkung der medialen Darstellung von Schönheitsnormen?
3.3.1 Forschungsergebnisse zur Wirkung auf Frauen
3.3.2 Forschungsergebnisse zur Wirkung auf Männer
4 Fragestellungen
5 Methodisches Vorgehen
5.1 Stichprobe
5.1.1 Printmedien: Publikumszeitschriften
5.1.2 Stichprobenauswahl
5.1.2.1 Vorgehen
5.1.2.2 Auswahlkriterien
5.1.3 Beschreibung der Stichprobe
5.1.3.1 Zielgruppe Frauen
5.1.3.2 Zielgruppe Männer
5.1.3.3 Zielgruppe Frauen & Männer
5.1.4 Artikelauswahl innerhalb der Stichprobe
5.1.4.1 Auswahlkriterien
5.1.4.2 Ausschlusskriterien
5.2 Qualitative Inhaltsanalyse
5.2.1 Allgemeine Grundsätze nach Mayring (2003)
5.2.2 Begründung der Anwendung der Qualitativen Inhaltsanalyse
5.2.3 Konkretes inhaltsanalytisches Vorgehen
5.2.3.1 Bestimmung der Analyseeinheiten
5.2.3.2 Festlegung der Strukturierungsdimensionen
5.2.3.3 Entwicklung der Kategoriensysteme
5.3 Kategoriensysteme
5.3.1 Allgemeine Erläuterungen
5.3.2 Beschreibung der Kategoriensysteme
5.3.2.1 Kategoriensystem 1: Normen
5.3.2.2 Kategoriensystem 2: Bedeutung
5.3.2.3 Kategoriensystem 3: Erreichbarkeit
5.3.3 Modifikation von Kategorien
5.3.4 Kategorienzuordnung
5.3.4.1 Ergänzende Anmerkungen
5.3.4.2 Beschreibung der schriftlichen Dokumentation
5.4 Beobachterübereinstimmung
5.4.1 Material
5.4.2 Zweitkodierer
5.4.3 Berechnung des Übereinstimmungskoeffizienten
6 Ergebnisse
6.1 Allgemeine Ergebnisse
6.2 Kategoriensysteme
6.2.1 Kategoriensystem 1: Normen
6.2.2 Kategoriensystem 2: Bedeutung
6.2.3 Kategoriensystem 3: Erreichbarkeit
6.2.4 Restkategorien
6.3 Zeitschriftengruppen
6.3.1 Kategoriensystem 1: Normen
6.3.2 Kategoriensystem 2: Bedeutung
6.3.3 Kategoriensystem 3: Erreichbarkeit
6.4 Gesonderte Betrachtung der Kategorie Ästhetische Medizin
7 Diskussion
7.1 Überblick
7.2 Beantwortung der Fragestellungen
7.2.1 Normen: Was ist Attraktivität? Wie definieren die Medien Attraktivität?
7.2.2 Bedeutung: Wie wichtig ist Attraktivität? Wofür ist sie wichtig?
7.2.2.1 Wird ein Zusammenhang zwischen Attraktivität und Attributen wie erfolgreich, gesund, selbstbewusst, glücklich dargestellt?
7.2.2.2 Wird ein Zusammenhang zwischen dem Streben nach Attraktivität und negativen Auswirkungen dargestellt?
7.2.2.3 Sind auch kritische Stellungnahmen hinsichtlich der Bedeutung von Attraktivität zu finden?
7.2.3 Erreichbarkeit: Wie sollen die definierten Attraktivitätsnormen erreicht werden? Welche Wege werden aufgezeigt, welche Methoden vorgeschlagen?
7.2.3.1 Wie häufig werden sehr invasive Methoden wie chirurgische Eingriffe genannt?
7.3 Zeitschriftengruppen
7.4 Zusammenfassende Betrachtung
7.5 Implikationen für den Bereich der Klinischen Psychologie
7.6 Kritische Betrachtung des methodischen Vorgehens
7.6.1 Stichprobe
7.6.2 Kategoriensysteme
7.6.3 Abschließendes Fazit
7.7 Ausblick
8 Literaturverzeichnis
ANHANG: LISTE DER ZEITSCHRIFTEN FÜR DIE STICHPROBENAUSWAHL
0 Zusammenfassung
Zentrales Anliegen der vorliegenden Diplomarbeit ist die Erfassung und Analyse von Inhalten zum Bereich Schönheit bzw. Attraktivität, wie sie durch die Medien vermittelt werden. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei die gesellschaftlichen Schönheitsideale, deren Bedeutung und Erreichbarkeit.
Den theoretischen Hintergrund bilden die psychischen Störungen Anorexia und Bulimia nervosa sowie die Körperdysmorphe Störung: Ätiologiemodelle zählen die soziokulturell vermittelten Schönheitsideale zu den prädisponierenden Merkmalen dieser Störungsbilder.
Zur Untersuchung konkreter „Botschaften“, die von den Medien an die Rezipienten übermittelt werden, werden aus dem Bereich der Printmedien Zeitschriften der Publikumspresse für die Zielgruppen Frauen, Männer sowie Frauen & Männer herangezogen. Die zugrunde liegende empirische Methode stellt eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2003) dar. Darin werden die mediale inhaltliche Vermittlung von Schönheitsnormen, die Vermittlung der Bedeutung, die diesen Schönheitsnormen zugemessen wird, und die Vermittlung von Methoden, mit deren Hilfe diese Schönheitsnormen erreicht werden sollen, untersucht.
Durch exploratives, materialgeleitetes Vorgehen wurden drei Kategoriensysteme entwickelt, die die Aspekte Normen, Bedeutung und Erreichbarkeit erfassen.
Zwei Beobachter kodierten das Material unabhängig voneinander, die Interraterreliabilität beträgt .83.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich über die Printmedien vermittelte Schönheitsnormen in erster Linie auf einen schlanken und makellosen Körper sowie auf einen modischen Kleidungsstil beziehen. Die Bedeutung von Attraktivität wird sowohl in Zusammenhang mit positiven Aspekten als auch unter Aspekten der Fragwürdigkeit dargestellt. Methoden zur Erreichbarkeit von Schönheitsnormen betreffen vorwiegend die Bereiche Kosmetik, Ernährung und Sport.
Die Ergebnisse werfen vor dem Hintergrund der genannten Störungsbilder Implikationen für den Bereich der Klinischen Psychologie hinsichtlich Gesundheitsförderung und Prävention auf.
Eine Fee gewährt einer Frau einen Wunsch.
Dünne Oberschenkel, antwortet sie.
Die Fee ist empört: „Sieh dir an, in welchem Zustand die Welt ist – und du willst für dich dünne Oberschenkel?“
Die Frau kleinlaut: „Du hast recht. Bitte dünne Oberschenkel für alle.“
(aus: Ebba D. Drolshagen (1995). Des Körpers neue Kleider – Die Herstellung weiblicher Schönheit)
1 Einleitung
„Dünn“, „jung“, „schön“ – Attribute wie diese sind in unserer heutigen mediengeprägten Gesellschaft allgegenwärtig. Models in Zeitschriften, Moderatoren, Popstars und Schauspieler verkörpern mit ihrem Äußeren das Ideal körperlicher Schönheit und dienen vielen Frauen und auch immer mehr Männern als Rollenvorbild, an dem sie sich orientieren und nach dem sie streben. „Schönheit und Attraktivität, Termini, die uns ständig in den Medien begegnen, sind Ausdruck eines neuen Körperbewusstseins, einer verstärkten Körperaufmerksamkeit, die in den letzten Jahrzehnten stetig zunahmen“ (Kluge, 1999, S. 11).
Studien zufolge ist die Mehrheit der Frauen jedoch unzufrieden mit ihrem Aussehen und Gewicht, und auch bei Männern nimmt die kritische Beschäftigung mit dem eigenen Äußeren stetig zu (Groesz, Levine & Murnen, 2001; Law & Labre, 2002). Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist so weit verbreitet, dass sie von Owen und Laurel-Seller (2000) bereits als „normative“ (S. 980) bezeichnet wird.
Den Medien kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zu:
„Durch das Fernsehen wird massenweise perfekte, unerreichbare Schönheit in Umlauf gesetzt. Im Vergleich dazu verblaßt jede wirkliche Schönheit, muß jede reale Erscheinung als mangelhaft erscheinen. Durch die Macht der Television, ... , erleben wir die Verallgemeinerung körperlicher Mängel, eine Demokratisierung des Defekts“ (Penz, 1995, S. 22). Neben dem Fernsehen bietet auch der Zeitschriftenmarkt ein riesiges Angebot an Magazinen, die in nahezu jeder Ausgabe auf die gängigen Schönheitsideale und auf damit in Zusammenhang stehende körperliche Unzulänglichkeiten oder Alterserscheinungen aufmerksam machen und gleichzeitig eine Fülle von Empfehlungen zu deren Behebung liefern.
Die Beauty- & Lifestyle-Presse besteht allein in Deutschland aus knapp hundert Titeln mit einer jährlichen Gesamtauflage von 150 Millionen. Dazu kommen jedes Jahr Hunderte von Ratgebern in Buchform und Diät-, Fitness- und OP-Shows auf allen privaten Sendekanälen. Die Themen gehen dabei nicht so schnell aus: Kosmetik, Workout, Diät, Anti-Aging, Botox, chemisches Peeling, Laserabrasion, Liposuction und ... die „richtige“ OP. (Renz, 2006, S. 279)
Angesichts der zunehmenden Fokussierung der Medien auf das äußere Erscheinungsbild und die Bedeutung von Körper und Schönheit sprechen Pope, Phillips und Olivardia (2001) bereits von einem „Schönheitswahn“, zu dem sich auch Legenbauer und Vocks (2005) kritisch äußern: „Models in den Zeitschriften haben heutzutage ein Körpergewicht, das in den Bereich der Magersucht fällt. Unmöglich, dass dieses ohne Manipulationen wie Diäten oder extremen Sport erreicht und aufrechterhalten wird. Doch genau das wird vorgegaukelt“ (S. 38).
Die Botschaft, die die Medien vermitteln, lautet stets: „Wer nur wirklich will, kann seinen ‚Traumbody‘ ... bekommen, und das im Handumdrehen sowie auf denkbar sanfte und ‚natürliche‘ Weise“ (Renz, 2006, S. 279).
So trainieren Männer ihre Muskeln als körperliche Attribute der Männlichkeit und Frauen arbeiten an ihren so genannten „Problemzonen“ Bauch, Gesäß und Beine (Penz, 1995, S. 30). Auch Schönheitsoperationen gewinnen zunehmend an Akzeptanz und werden immer selbstverständlicher. Sie sind laut Penz mittlerweile ein „zeitgemäßer Modus der Schönheitspflege“ (S. 48).
Diesem Trend gegenüber steht wiederum eine verstärkte Aufmerksamkeit und Berichterstattung von Seiten der Medien über mit dem „Schönheitswahn“ in Zusammenhang stehende psychische Störungen wie die überwiegend bei Frauen auftretenden Essstörungen Anorexie und Bulimie (Laessle, 2003) sowie die überwiegend bei Männern diagnostizierte Muskeldysmorphie, eine Variante der Körperdysmorphen Störung (Pope et al., 2001). Vor allem kritische Berichte über prominente Betroffene, zumeist an Magersucht leidende Stars (BUNTE Nr. 32/06 & Nr. 15/07; GALA Nr. 39/06), führen zu einer stetigen Zunahme des öffentlichen Interesses an diesen Krankheiten. An den daraus resultierenden Diskussionen über das medienvermittelte Schönheitsideal beteiligen sich auch Fachkreise wie Ärzte, Psychologen und Politiker. Da soziokulturell vermittelte Schönheitsnormen die Entstehung der genannten Störungen begünstigen können (Legenbauer & Vocks, 2005), wird immer wieder an die Medien appelliert, „auf die Propagierung fragwürdiger Schönheitsideale zu verzichten“ (BUNTE Nr. 7/06).
Im Rahmen dieser öffentlichen Diskussionen wurde das wissenschaftliche Interesse an gesellschaftlichen Schönheitsnormen und deren Vermittlung motiviert. So möchte sich die vorliegende Studie diesem Thema widmen und medial vermittelte Aussagen hinsichtlich Schönheitsnormen vor dem theoretischen Hintergrund klinischer Störungsbilder wie Essstörungen und Körperdysmorpher Störung näher untersuchen.
Diese Diplomarbeit gliedert sich wie folgt:
Nach einer Begriffsbestimmung in Kapitel 2 wird in Kapitel 3 zunächst der theoretische Hintergrund erläutert, indem ein Überblick über die für diese Studie relevanten psychischen Störungen Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Körperdysmorphe Störung gegeben sowie auf die soziokulturell vermittelten Schönheitsnormen und deren mögliche Wirkungen eingegangen wird.
Daran schließen sich die Fragestellungen dieser Arbeit an, die in Kapitel 4 dargestellt werden und zum empirischen Teil der Arbeit überleiten.
In Kapitel 5 wird die dieser Untersuchung zugrunde liegende Stichprobe von Publikumszeitschriften sowie das methodische Vorgehen an Hand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring beschrieben. Die entwickelten Kategoriensysteme werden vorgestellt und erläutert sowie deren Reliabilitätsprüfung dargestellt.
In Kapitel 6 folgt die Präsentation der Untersuchungsergebnisse, die in Kapitel 7 diskutiert und im Hinblick auf die Fragestellungen dieser Arbeit interpretiert werden.
Nach Darstellung der Implikationen, die die Ergebnisse für den Bereich der Klinischen Psychologie aufwerfen, und der kritischen Betrachtung des methodischen Vorgehens wird abschließend ein Ausblick auf weitere sinnvolle Forschungsvorhaben auf dem untersuchten Gebiet gegeben.
2 Begriffsbestimmung
Das Konzept der Schönheit nimmt in dieser Diplomarbeit eine zentrale Rolle ein. An Hand der folgenden Begriffsbestimmung soll geklärt werden, was unter „Schönheit“ bzw. ihrem wissenschaftlichen Begriff „Physische Attraktivität“ (Renz, 2006) konkret zu verstehen ist.
2.1 Definition des Begriffs Schönheit
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen spielte und spielt das Aussehen des Menschen eine bedeutende Rolle (Henss, 1992).
Menschen suchen Schönheit bei anderen, und offensichtlich streben sie danach, selbst schön zu sein, auf ihre Mitmenschen attraktiv zu wirken. Zur Erreichung dieses Ziels wenden sie eine beträchtliche Menge an Zeit und Geld auf, und häufig scheuen sie nicht davor zurück, auch körperliche Unannehmlichkeiten und Schmerzen in Kauf zu nehmen, um diesem Ziel zumindest ein Stück näher zu kommen. (Henss, 1992, S. 1)
Der Begriff Schönheit wird in der vorliegenden Arbeit im Sinne der physischen Attraktivität verwendet. Vagt (2000) definiert physische Attraktivität als „das Ausmaß, in dem die äußere Erscheinung eines Menschen auf eine beobachtende Person wirkt“ (S. 597). Physische Attraktivität setzt somit einen wertenden Beobachter voraus. Die äußere Erscheinung definiert Vagt als „Gesamtheit der körperlichen und mit dem Körper verbundenen oder ihm hinzugefügten Merkmale, die für einen Beobachter von außen wahrnehmbar sind“ (S. 597), z.B. Körperbau, Geruch, Haarfarbe, Bekleidung. Die physische Attraktivität ist variabel, d.h. kann sich von Beobachter zu Beobachter verändern.
Trotz zahlreicher Forschungsarbeiten gibt es bislang keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, welche Merkmale die physische Attraktivität eines Menschen im Einzelnen bestimmen (Vagt, 2000). Nach Henss (1992) weist eine Reihe an Untersuchungen darauf hin, dass keine universellen Schönheitsstandards existieren, jedoch innerhalb einer Kultur ein deutlicher Konsens zu beobachten ist, welche Personen attraktiv aussehen (vgl. S. 176).
2.2 Schönheitskomponenten: Natürlich versus Modisch
Henss selbst unterscheidet zwei Aspekte von Schönheit: Die Selbstdarstellung, worunter er das versteht, „was der Einzelne ‚aus sich macht‘“, und die zugrunde liegende morphologische Struktur, worunter er das versteht, „was jemand ‚mitbringt‘“ (S. 183).
Ein erster Unterschied betrifft den Grad der Manipulierbarkeit. Während die verschiedenen Verschönerungstechniken geradezu auf Veränderung abzielen, kann die morphologische Struktur nur in einem sehr eng umschriebenen Rahmen verändert werden. Davon nicht ganz unabhängig ist ein zweiter Punkt: Mögen die Meinungen über die „richtige“ Verschönerungstechnik auch weit auseinandergehen – wenn es um die morphologische Struktur geht, dann ist mit einer sehr viel höheren Übereinstimmung zu rechnen. (Henss, 1992, S. 183)
Renz (2006) nimmt eine ähnliche Unterscheidung vor: Er legt Schönheit zwei Prinzipien zugrunde,
nämlich natürliche Schönheit, also die Schönheit des Körpers, wie Gott ihn erschaffen hat ... , und das Gesamtkunstwerk, das wir tagtäglich aus diesem Körper machen, um dem Diktat der Mode Genüge zu tun. Mode ist eine Symbolsprache, deren Zeichen von der jeweiligen Gesellschaft, Epoche, Kultur oder Subkultur entwickelt und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Sie werden von den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe – und nur von ihnen – verstanden und als attraktiv empfunden. (S. 40f.)
Die modische Schönheit unterliegt einem ständigen Wandel und beinhaltet das, was Henss (1992) Selbstdarstellung nennt, die Selbstdefinition des Menschen innerhalb seiner Gemeinschaft. Zentral ist dabei nicht der Körper selbst, sondern seine Veränderung durch Kleidung, Frisur, Schmuck, Tätowierung, Piercing etc. (vgl. Renz, 2006, S. 41).
Mode ist Teil des komplexen Signalsystems, das jede Gesellschaft zusammenhält, ein Code, der auf Konventionen beruht, deren sich der Einzelne meist gar nicht bewusst ist, die aber dennoch zutiefst in unser ästhetisches Empfinden eingeprägt sind. Die Merkmale des Körpers oder seiner Ausschmückung, die diesen Konventionen entsprechen, nehmen wir als attraktiv wahr. (Renz, S. 41)
Laut Renz sind die beiden Komponenten der Schönheit, natürliche und modische Schönheit, trotz ihrer Unterschiedlichkeit nicht voneinander zu trennen, da sie ineinander übergehen und sich ergänzen (S. 42).
2.3 Schönheitsstandards: Universell versus Soziokulturell
Über das von der jeweiligen Gesellschaft bestimmte Schönheitsempfinden hinaus konstatiert Renz (2006) durchaus gewisse universell gültige Standards. „Aber unter diesem kulturellen Firnis liegt ein gemeinsamer Kern. Unser Schönheitssinn beruht auf festen Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten und verbindlichen Regeln, die immer und überall gültig sind“ (S. 43). Diese Auffassung teilt auch Henss (1991, zitiert nach Vagt, 2000), der vermutet, dass „bei genauerem Hinsehen ... trotz aller Variabilität allgemeine Prinzipien zum Vorschein treten und daß es offenbar doch Kriterien der Schönheit gibt, die über Zeit und Raum Bestand haben“ (S. 609).
Diese Kriterien, die sich als objektive Schönheitsmerkmale klassifizieren lassen (vgl. Legenbauer & Vocks, 2005), beziehen sich vor allem auf das Gesicht, das sich in erster Linie durch makellose Haut, Symmetrie und arttypisches Aussehen im Sinne durchschnittlicher Abmessungen, die dem Populationsmittel entsprechen, auszeichnet (vgl. Renz, 2006 und Vagt, 2000).
Merkmale des „idealen“ Frauengesichts stellen nach Cunningham (1986, zitiert nach Vagt, 2000, und Renz, 2006) hohe Backenknochen und schmale Wangen, große Augen, eine kleine Nase, relativ hohe Augenbrauen und ein schmales Kinn dar, während ein Männergesicht hervorstehende Wangenknochen, schmale Wangen und ein kräftiges Kinn attraktiv machen (vgl. Renz, S. 58). Zu den Attraktivitätsfaktoren hinsichtlich des Körpers gehören Jugendlichkeit, harmonische Proportionen sowie geschlechtstypisches Aussehen. Bei Frauen ist das eine möglichst schlanke Taille, große Brüste und schmale Schultern, bei Männern ein breiter Oberkörper, schmale Hüften, ein flacher Bauch und Muskeln (vgl. Vagt, 2000 und Renz, 2006).
Als weiterer Attraktivitätsfaktor sind Merkmale zu nennen, die einen hohen gesellschaftlichen Status implizieren. Dazu zählen überwiegend nicht-körperliche Merkmale wie Kleidung und Gepflegtheit, aber auch spezifische morphologische Körper- und Gesichtsmerkmale, die für eine bestimmte Gesellschaft und eine bestimmte Zeit bestimmend sind, „z.B. zeigt in der Gegenwart bei uns eher Schlankheit einen hohen Status an, während in der Nachkriegszeit dies eher eine erhebliche Leibesfülle getan hat“ (Vagt, 2000, S. 610f.).
Die diese objektiven Schönheitsmerkmale ergänzenden soziokulturellen Attraktivitätsstandards - von Renz (2006) als modische Schönheit definiert – sind in der heutigen Zeit von besonderer Bedeutung, da sie über die Massenmedien stark verbreitet werden und einen hohen Grad an Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie auch Penz (1995) bemerkt: „Mit der Geburt neuer Massenmedien im 20. Jahrhundert – Film, Fernsehen, Video – verschärft sich nicht zuletzt der Schönheitswettbewerb, d.h. die Attraktivität der Erscheinung bemißt sich hinfort weniger an realen Personen als vielmehr an virtuellen und zusehends globalen Idealen“ (S. 22).
Dem heutigen Ideal entsprechen in erster Linie eine schlanke Figur und straffe, schöne, faltenlose Haut: „Die an der Haut ablesbare Jugendlichkeit ist heute zu einem Hauptkriterium für Schönheit geworden“ (Penz, S. 36). Darüber hinaus soll die Haut gebräunt und glatt, d.h. frei von jeglicher Körperbehaarung, sein. „Kurzum, die Schönheit gegen Ende unseres Jahrhunderts repräsentiert der jugendlich schlanke, muskulöse, straffe bzw. (im doppelten Sinn) glatte Körper, die stromlinienförmige Figur letztendlich beider Geschlechter - ... “ (Penz, S. 36).
So geht es bei der modischen Schönheit nicht mehr nur um die Veränderung des Körpers durch Kleidung oder Ähnliches, sondern der Körper selbst rückt immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit und hat mittlerweile eine noch nie da gewesene Bedeutung erlangt (Renz, 2006, S. 279). „Es gibt kein Modediktat für Kleider mehr. Das Modediktat betrifft den Körper“, so Drolshagen (1995, S. 116f.). Laut Renz ist das sogenannte „Bodystyling“ „nichts als die Fortsetzung der Mode mit anderen Mitteln“ (S. 279).
Obgleich das Aussehen, wie eingangs erwähnt, seit jeher eine tragende Rolle spielt, sieht Renz (2006) in der heutigen Zeit einen deutlichen Unterschied zu vorhergehenden Epochen:
„Zum ersten Mal ist die Beschäftigung mit Schönheit und Schönheitsverbesserung nicht einer kleinen Schicht von Müßiggängern vorbehalten, sondern hat buchstäblich alle Schichten erfasst“ (S. 287). Darüber hinaus ist „Schönheit durch den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt in einem Maße machbar geworden ... , wie das zu keiner Zeit vorher auch nur denkbar gewesen wäre“ (S. 287).
Die vorliegende Studie legt ihr Augenmerk vorwiegend auf den Aspekt der oben erläuterten modischen, soziokulturell beeinflussten Schönheit bzw. deren Standards, berücksichtigt aber auch Aspekte der natürlichen Schönheit, da sich beide Bereiche, wie bereits angeführt, überschneiden und ergänzen.
3 Theoretischer Hintergrund
3.1 Psychische Störungen mit Bezug zu soziokulturell vermittelten Schönheitsnormen
Wie bereits in der Einleitung dargelegt, gibt es psychische Erkrankungen, die einen Bezug zu soziokulturell vermittelten Schönheitsnormen aufweisen und damit für die vorliegende Studie relevant sind. Hierunter sind in erster Linie die Essstörungen zu nennen: Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. Auch die erst seit relativ kurzer Zeit im Fokus der Forschung stehende Körperdysmorphe Störung (engl. „Body Dysmorphic Disorder“) wird vor dem Hintergrund soziokultureller Schönheitsnormen diskutiert (siehe „3.1.2.3 Ätiologie“).
Im Folgenden werden die genannten Störungsbilder vorgestellt und kurz erläutert.
3.1.1 Essstörungen: Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
Das englischsprachige Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen (DSM-IV, APA, 1994) fasst unter der Kategorie Essstörungen drei Krankheitsbilder zusammen: Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und die Restkategorie „Nicht näher bezeichnete Essstörungen“ (Laessle, 2003, S. 358). Nachfolgend wird ein Überblick über die beiden Störungsbilder Anorexia nervosa und Bulimia nervosa gegeben.
Da die Krankheit vorrangig Mädchen und Frauen betrifft, wird für die Betroffenen die weibliche Form verwendet.
3.1.1.1 Beschreibung und Klassifikation
- Anorexia nervosa
Anorexia nervosa, oft auch als Pubertäts-Magersucht bezeichnet, ist gekennzeichnet durch Gewichtsabnahme und die teilweise panikartige Angst, zuzunehmen und zu dick zu sein (Gewichtsphobie). Die Störung äußert sich in einer Änderung des Essverhaltens mit dem Ziel der Gewichtsreduktion oder Beibehaltung eines bereits sehr niedrigen Gewichts.
Auffälligstes Merkmal ist der gravierende Gewichtsverlust, der meist über 25% des Ausgangsgewichts beträgt (Ebert, 2003, S. 286), häufig auch 50% des Ausgangsgewichts überschreitet und bis zur lebensbedrohlichen Unterernährung reichen kann (Laessle, 2003, S. 359).
Im Zentrum der Störung steht die ständige Beschäftigung mit Körpergewicht und Figur sowie die Kontrolle von Gewicht und Aussehen. Die Betroffenen legen für sich selbst eine sehr niedrige Gewichtsschwelle fest (Ebert, S. 287).
Die Krankheit äußert sich zunächst darin, dass die Patientinnen Kalorien zählen, Diätpläne einhalten, nur noch bestimmte Speisen essen oder bestimmte Speisen (wie z.B. Fleisch) nicht mehr essen und ihr Gewicht ständig kontrollieren. Schließlich werden Mahlzeiten vollständig ausgelassen oder extrem auf nahezu kalorienfreie Bestandteile reduziert (wie z.B. Salatblätter). Diese Verhaltensweisen können sich bis hin zu einem halben Brötchen täglich oder tagelangem Fasten steigern. Daneben treiben die Betroffenen exzessiv Sport und achten auf hohe körperliche Aktivität, um den Kalorienverbrauch zu steigern. In einigen Fällen tritt auch Missbrauch von Laxantien (Abführmitteln), Diuretika (Entwässerungstabletten) und Appetitzüglern zur Unterstützung der Gewichtsreduktion auf.
Entgegen der Behauptung der Betroffenen, keinen Appetit zu haben, handelt es sich bei Anorexia nervosa nicht um eine Appetitstörung, da zumindest zu Beginn der Erkrankung ein Hungergefühl empfunden wird. Das Aushalten des Hungers wirkt jedoch selbstbestätigend und euphorisierend und im Hinblick auf eine befürchtete Gewichtszunahme entsprechend spannungsreduzierend (Ebert, S. 287).
Im Verlauf der Erkrankung sind sekundäre körperliche Veränderungen wie Hypothermie (verminderte Körpertemperatur), Bradykardie (verlangsamte Herzfrequenz), Lanugo-Behaarung (Flaumhaarbildung) und weitere metabolische und neuroendokrine Veränderungen wie Amenorrhoe (Ausbleiben der Menstruation) und bei jungen Mädchen verzögerte sexuelle Entwicklung zu beobachten (Laessle, 2003; Ebert, 2003).
Bei etwa 80% der anorektischen Patientinnen treten morphologische Veränderungen des Gehirns auf, die als Pseudoatrophie bezeichnet werden (Laessle, 2003).
Der Überzeugung der Patientinnen, trotz ihres abgemagerten Zustands zu dick zu sein, liegt eine verzerrte Wahrnehmung des Körperschemas zugrunde. Darunter leidet auch der Selbstwert, denn den meisten Patientinnen ist die dysfunktionale Grundannahme „Nur wenn ich schlank bin, bin ich etwas wert“ gemeinsam (Laessle, S. 359).
In Abbildung 3.1 sind die Diagnosekriterien für das Störungsbild Anorexia nervosa aufgeführt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.1 Diagnosekriterien der Anorexia nervosa nach DSM-IV (APA, 1994)
(Laessle, 2003, S. 360)
- Bulimia nervosa
Bulimia nervosa ist gekennzeichnet durch Heißhungeranfälle („binge eating“) mit anschließenden gewichtsreduzierenden Maßnahmen („purging behaviour“) wie selbstinduziertes Erbrechen, Fasten, Missbrauch von Laxantien, Appetitzüglern und Diuretika (Franke, 2001, S. 363).
Die Patientinnen verlieren in regelmäßigen Abständen, erst episodisch, später immer häufiger, die Kontrolle über ihre Nahrungsaufnahme und verschlingen in kürzester Zeit große Nahrungsmengen, bevorzugt fetthaltige, süße, hochkalorische Lebensmittel. Im Anschluss daran kommt es zum Erleben von Schuldgefühlen und Furcht vor Gewichtszunahme, worauf Erbrechen induziert wird oder andere Maßnahmen zur Vermeidung einer Gewichtszunahme ergriffen werden (siehe oben). Die Essattacken werden meist verheimlicht. Zwischen den Essattacken liegen oft restriktive Diäten (vgl. Ebert, 2003; Laessle, 2003).
Die Anfälle können mehrmals pro Woche bis hin zu mehrmals täglich auftreten. Nach kurzfristiger Erleichterung, durch Erbrechen eine Gewichtszunahme verhindert zu haben, leiden die Patientinnen unter Schamgefühlen, Selbstvorwürfen, Schuldgefühlen und Selbstverachtung, was sich bis zur Suizidalität steigern kann (Ebert, 2003).
Die Betroffenen weisen eine extreme Besorgnis um Figur und Gewicht auf. Das körperliche Aussehen ist für ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit von entscheidender Bedeutung (Laessle, S. 361).
Abbildung 3.2 gibt die Diagnostischen Kriterien für Bulimia nervosa an.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.2 Diagnosekriterien der Bulimia nervosa nach DSM-IV (APA, 1994)
(Laessle, 2003, S. 362)
Während das Störungsbild der Anorexia nervosa durch starkes Untergewicht der Patientinnen gekennzeichnet ist, ist das Gewicht von Bulimikerinnen meistens unauffällig: Die Patientinnen haben Normalgewicht, befinden sich aber - bedingt durch stark gezügeltes Essverhalten zwischen den Essattacken - häufig in einem Zustand der Mangelernährung (Laessle, S. 361).
Körperliche Folgeschäden betreffen besonders das gastrointestinale, das endokrine und das Elektrolyt-System, dessen Störung mit der Gefahr von Herzrhythmusstörungen einhergeht. Durch das häufige Erbrechen können Entzündungen oder Schwellungen der Speicheldrüsen auftreten. Darüber hinaus entstehen durch den ständigen Kontakt mit der Magensäure massive Zahnschäden (Franke, 2003, S. 365; Laessle, 2003).
Bei etwa 50% der bulimischen Patientinnen treten morphologische Veränderungen des Gehirns auf, die als Pseudoatrophie bezeichnet werden (Laessle, 2003).
Bedingt durch das Einkaufen der großen Nahrungsmengen und die Essanfälle erfordert die Krankheit einen hohen Zeit- und Geldaufwand. Viele Betroffene geraten in soziale Isolation sowie in berufliche und finanzielle Schwierigkeiten (Laessle, S. 361).
3.1.1.2 Epidemiologie und Verlauf
- Anorexia nervosa
Anorexia nervosa tritt mit einem Anteil von 95% bei Frauen und mit einem Anteil von nur 5% bei Männern auf.
Laessle (2003) gibt eine Prävalenzrate von 0,3% für Frauen bis zum 30. Lebensjahr an,
Franke (2001) 0,5-1% für Frauen.
Das Durchschnittsalter bei Erkrankungsbeginn liegt nach Laessle (2003) bei 16 Jahren bzw. nach Ebert (2003) und Franke (2001) bei 17 Jahren mit zwei Häufigkeitsgipfeln bei 14 und 18 Jahren. Ein Beginn vor der Pubertät oder nach dem 40. Lebensjahr ist selten. Am Beginn der Erkrankung steht meist ein belastendes Lebensereignis.
Ebert beschreibt den Verlauf als variabel, von einzelnen Episoden mit vollständiger Remission über eine fluktuierende Symptomatik bis hin zu chronischen Verläufen.
Etwa ein Drittel wird gesund, bei einem Drittel normalisiert sich das Gewicht, Körperschemastörungen bleiben aber bestehen und gelegentliche Rückfälle sind möglich. Der Rest der Betroffenen entwickelt eine schwere chronische Störung (Ebert, 2003, S. 289), Mortalitätsraten liegen bei etwa 6% (Laessle, 2003).
- Bulimia nervosa
Frauen sind weit häufiger von Bulimia nervosa betroffen, nur ca. 5-15% der Erkrankten sind Männer (Laessle, 2003). Franke (2001) gibt einen Frauenanteil von ca. 90% an.
Die Prävalenzrate liegt nach Laessle bei 1-3% für Frauen zwischen 18 und 35 Jahren, nach Franke bei 2-4% für die Gesamtbevölkerung.
Nach Ebert (2003) sind einzelne bulimische Episoden und Essattacken, ohne dass eine Bulimie entsteht, viel häufiger und liegen bei geschätzten 20-30%.
Die Krankheit beginnt in der Adoleszenz oder dem frühen Erwachsenenalter, häufig nach einer Diät.
Nach Laessle und Franke ist zum Verlauf der Bulimia nervosa noch wenig bekannt. Klinische Stichproben weisen auf eine mittlere Krankheitsdauer von mehr als fünf Jahren hin, bevor eine Behandlung begonnen wird. Laut Ebert verläuft die Krankheit ohne Behandlung oft chronisch oder intermittierend mit Perioden der Remission, die mit bulimischen Episoden abwechseln. Bei Behandlung gibt Ebert eine günstigere Prognose (60% gut, 30% mittel, 10% schlecht) an. Die Mortalitätsrate liegt bei 0,3% (Laessle, 2003).
Die Annahme, dass sowohl Bulimia als auch Anorexia nervosa gehäuft in der Mittel- und Oberschicht auftreten, hat sich als empirisch nicht haltbar herausgestellt (Laessle, S. 363). Entgegen verschiedener Berichte in den Medien ist auch in den letzten Jahren für beide Störungsbilder kein Anstieg der Prävalenz zu verzeichnen (Laessle, 2003). Allerdings hat die Behandlungsinzidenz beider Krankheiten in den letzten Jahren zugenommen, was die verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit für Anorexia und Bulimia nervosa erklären könnte.
3.1.1.3 Ätiologie
Hinsichtlich der Entstehung beider Störungen wird eine Interaktion multipler prädisponierender Faktoren mit spezifischen auslösenden Faktoren angenommen (Laessle, 2003, S. 365). Darüber hinaus trägt eine Reihe weiterer Faktoren zur Aufrechterhaltung der Störungen bei.
Zu den prädisponierenden Faktoren zählen neben Lernerfahrungen, Bedingungen in der Familie, biologischen und kognitiven Faktoren das soziokulturell vorgegebene Schlankheits- und Schönheitsideal und die daraus resultierende intensive Beschäftigung mit Körperform und Aussehen. Als auslösende Faktoren sind kritische Lebensereignisse („Life Events“) zu nennen, als aufrechterhaltende Faktoren eine Reihe biologischer und psychologischer Veränderungen (vgl. Laessle, 2003).
Abbildung 3.3 bietet einen zusammenfassenden Überblick der ätiologischen Faktoren für Anorexia und Bulimia nervosa.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.3 Zusammenfassendes Störungsmodell für Anorexia und Bulimia nervosa
(Laessle, 2003, S. 368)
Auf Pathogenese und Ätiologie der Essstörungen soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden; eine umfassende Beschreibung ist bei Laessle (2003) zu finden.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll ein spezifischer prädisponierender Faktor, die soziokulturell vorgegebenen Schönheitsnormen, detailliert betrachtet werden (siehe „3.2 Prädisponierendes Merkmal: Soziokultureller Faktor Schönheitsnorm“).
3.1.1.4 Interventionsansätze
Die beiden Störungsbilder der Anorexia und Bulimia nervosa überlappen einander (vgl. Laessle, 2003). Für beide Störungen müssen sowohl kurzfristige als auch langfristige Strategien zur Intervention herangezogen werden.
Kurzfristiges Ziel ist eine Modifikation des Körpergewichts bei Anorexia nervosa bzw. des Essverhaltens bei beiden Störungsbildern. Langfristig geht es um die Modifikation der psychologischen und psychosozialen Bedingungen, die einen funktionalen Zusammenhang mit dem gestörten Essverhalten aufweisen (Laessle, S. 371). Dies erfolgt im Rahmen verhaltenstherapeutischer Programme. Eventuell wird eine zusätzliche psychopharmakologische Behandlung mit einbezogen (vgl. Ebert, 2003).
Eine über diesen Überblick hinausgehende weiterführende Beschreibung und ausführliche Erläuterung der beiden Störungsbilder findet sich bei Laessle (2003).
3.1.2 Körperdysmorphe Störung
3.1.2.1 Beschreibung und Klassifikation
Die Körperdysmorphe Störung (griech.: dysmorphia = die Häßlichkeit insbesondere des Gesichts) ist wissenschaftlich noch wenig erforscht. Die Bezeichnung wurde erst 1987 eingeführt und ist nach Stangier (2002, S. 3) der älteren Bezeichnung „Dysmorphophobie“ vorzuziehen, da ein phobisches Vermeidungsverhalten nicht im Vordergrund der Störung steht. Die Krankheit ist auch als „eingebildete Häßlichkeit“ bekannt, da sie bei Personen diagnostiziert wird, die sich durch einen äußeren Mangel entstellt fühlen, der jedoch nicht objektivierbar ist (Stangier, S. 3).
Im Internationalen Klassifikationssystem ICD-10 wird die Körperdysmorphe Störung bzw. „Dysmorphophobie“ unter den somatoformen Störungen als eine Unterkategorie der hypochondrischen Störung genannt und als „anhaltende Beschäftigung mit der eigenen körperlichen Erscheinung“ definiert (Dilling, Mombour und Schmidt, 1991, zitiert nach Stangier, 2002, S. 10).
Das DSM-IV ordnet die Körperdysmorphe Störung ebenfalls in eine eigene Kategorie unter die somatoformen Störungen ein und definiert sie durch die in Abbildung 3.4 aufgeführten Kriterien:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abbildung 3.4 Diagnosekriterien der Körperdysmorphen Störung nach DSM-IV (Saß et al., 1998) (Stangier, 2002, S. 11)
Die Beschwerden konzentrieren sich vorwiegend auf Veränderungen des Gesichts, die subjektiv als entstellend bzw. „häßlich“ erlebt werden. Neben der Größe oder Asymmetrie von Körperteilen stehen in der Mehrheit der Fälle die Haut, teilweise auch die Haare, im Vordergrund. Andere Beispiele sind die Größe oder Krümmung der Nase, der Augenabstand, ein unsymmetrisches Gesicht, bei Frauen die Größe von Brüsten und bei Männern ein schmächtiger Körperbau. Es besteht die Überzeugung, dass die Anormalität anderen offensichtlich ist. (Stangier, 2002, S. 11)
Die übermäßige Beschäftigung mit dem eingebildeten Makel zeigt sich in ausgedehnten, regelmäßigen, zumeist ritualisierten Kontrollen. Der vermeintliche Defekt wird z.B. stundenlang vor dem Spiegel überprüft. Ebenfalls charakteristisch sind Verhaltensweisen wie Verbergen des Makels durch Make-up, Kleidung etc., exzessive Körperpflege oder Manipulationen an der Haut. Oft werden Situationen, in denen der Makel von anderen entdeckt werden könnte, gänzlich vermieden. Die Betroffenen zeigen die Tendenz zur Rückversicherung bei anderen Personen, dass das Aussehen „normal“ ist. Viele sehen in kosmetischen Operationen die einzige Lösung zur Behebung ihres Defekts und suchen Hilfe bei plastischen Chirurgen (vgl. Stangier, S. 11).
Die Störung geht mit starken beruflichen und sozialen Beeinträchtigungen einher, die bis zur Suizidalität führen können. Häufig finden sich ein niedriges Selbstwertgefühl, Schuldgefühle sowie depressive Symptome (vgl. Stangier, S. 12). Objektiv lassen sich keine oder nur minimale körperliche Veränderungen feststellen. Das subjektive Erleben steht in keinem Verhältnis zum tatsächlichen körperlichen Befund.
- Subtyp: Muskeldysmorphie
Pope, Phillips und Olivardia (2001) berichten von einer spezifischen Form der Körperdysmorphen Störung und prägten dafür den Begriff Muskeldysmorphie, die in der Regel Männer betrifft. Die übersteigerte Beschäftigung mit Aspekten des Aussehens konzentriert sich hierbei auf den Muskelumfang.
Die Muskeldysmorphie kann als „eingebildete Schwächlichkeit“ umschrieben werden (Pope et al., 2001) und geht mit einer Verzerrung des Körperbildes einher: Muskeldysmorphie-Patienten sind vorrangig in Fitnessstudios zu finden, wo sie exzessives Bodybuilding betreiben. Die Betroffenen schämen sich, weil sie der Meinung sind, zu mager, zu schmächtig, zu mickrig auszusehen, während sie tatsächlich muskulös sind (Pope et al., 2001). Oft werden alle anderen Lebensbereiche dem Training untergeordnet und das Risiko körperlicher Selbstzerstörung eingegangen. Die Betroffenen trainieren trotz Verletzungen und Schmerzen zwanghaft weiter, ernähren sich extrem fettarm und proteinreich und nehmen häufig potentiell gefährliche Anabolika und andere Pharmazeutika zum Muskelaufbau ein (Pope et al., S. 24).
Studien zu dieser Variante der Körperdysmorphen Störung konzentrieren sich bislang fast ausschließlich auf den amerikanischen Raum.
3.1.2.2 Epidemiologie und Verlauf
Stangier (2002) gibt für die Körperdysmorphe Störung eine geschätzte Prävalenzrate von 1-2% der Bevölkerung an, vermutet aber, dass die Störung häufiger als bisher erwartet vorkommt. „Möglicherweise ist auch ein tatsächlicher Anstieg der Prävalenz zu verzeichnen, der, ähnlich wie bei den Essstörungen, durch soziokulturelle Faktoren verursacht sein könnte“ (Stangier, S. 15).
Eine deutsche Studie von Rief, Buhlmann, Wilhelm, Borkenhagen und Brähler (2006) gibt die Prävalenz mit 1,7 % an, mit etwas höheren Raten für Frauen (Männer 1,4%, Frauen 1,9%).
Uzun et al. (2003) vermuten, dass die wahre Prävalenz viel größer sein könnte, da die Patienten dazu neigen, ihre Beschwerden zu verheimlichen und viele nie bei einem Psychiater vorstellig werden. Vielmehr werden Internisten, Plastische Chirurgen oder Hautärzte konsultiert.
Hinsichtlich klinischer Stichproben werden von Stangier (2002) deutlich erhöhte Prävalenzraten angegeben: Unter dermatologischen Patienten zeigten 8,7% Hinweise auf eine Körperdysmorphe Störung, unter plastisch-chirurgischen Patienten 7%.
„So dürfte ein beträchtlicher, zumeist unentdeckter Anteil der Patienten, die kosmetisch relevante Behandlungsmethoden wie operative (Dermabrasion, Peeling, Liposuktion/
-plastik) und physikalische Therapieansätze (Laser) fordern, eine Körperdysmorphe Störung aufweisen“ (Stangier, S. 36).
Über den Verlauf der Störung ist bisher wenig bekannt. Der Beginn liegt in der Adoleszenz bzw. Pubertät bei durchschnittlich 16 ± 7 Jahren. Die Störung nimmt in der Regel einen chronischen Verlauf, die durchschnittliche Dauer liegt bei ca. 18 Jahren (Stangier, S. 16f.).
3.1.2.3 Ätiologie
Auch zur Entstehung der Störung gibt es bislang nur wenig Erklärungsansätze.
Nach Stangier (2002) werden neben neurobiologischen Störungen eine erhöhte „Ästhetikalität“, d.h. erhöhte Sensibilität für ästhetische Proportionen sowie ein übersteigertes Bedürfnis nach Symmetrie, Größe oder Proportionalität bestimmter Körperteile angenommen. Weitere Faktoren sind fehlerhafte Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse hinsichtlich des eigenen Aussehens bzw. die Überbewertung des Aussehens, die auf dysfunktionalen Grundüberzeugungen basiert („Nur wenn ich makellos aussehe, bin ich akzeptabel“).
Zu den prädisponierenden Faktoren zählt Stangier die Erfahrung negativer Kommentare und Hänseleien bezüglich Aussehen und soziokulturelle Faktoren wie gesellschaftliche Schönheitsideale, die durch Zeitschriften, Mode und Fernsehen vermittelt werden (S. 32).
Abbildung 3.5 bietet einen zusammenfassenden Überblick der ätiologischen Faktoren für die Körperdysmorphe Störung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.5 Modell zur Entstehung der Körperdysmorphen Störung (Stangier, 2002, S. 33)
Auf Pathogenese und Ätiologie der Körperdysmorphen Störung wird - wie auch bei den Essstörungen - an dieser Stelle nicht näher eingegangen; eine umfassende Beschreibung ist bei Stangier (2002) nachzulesen. Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf den spezifischen prädisponierenden Faktor der soziokulturell vorgegebenen Schönheitsnormen (siehe „3.2 Prädisponierendes Merkmal: Soziokultureller Faktor Schönheitsnorm“).
3.1.2.4 Interventionsansätze
Die Intervention hinsichtlich der Körperdysmorphen Störung besteht in einer störungsspezifischen kognitiv-behavioralen Behandlung im Einzel- und/oder Gruppensetting, in der Exposition, Kognitive Umstrukturierung und die Bearbeitung von Grundüberzeugungen im Mittelpunkt stehen (Stangier, 2002, S. 75).
Es sollte hervorgehoben werden, daß insbesondere bei der Körperdysmorphen Störung, ... , eine dermatologische Behandlung in erster Linie nicht indiziert ist. Als kontraindiziert gelten Maßnahmen der kosmetischen Chirurgie oder eine differentielle dermatologische Behandlung, wenn eine ausgeprägte Fixierung auf die vermeintliche Entstellung besteht und gleichzeitig kein Defekt objektivierbar ist. (Stangier, S. 36)
Die notwendige Veränderung der Sichtweise der Patienten weg von den körperlichen Aspekten auf eher psychologische Aspekte hin gilt als besonders schwierig, da Patienten mit Körperdysmorpher Störung sehr stark auf eine körpermedizinische Lösung ihrer Probleme fixiert sind und in Operationen meist die einzig erfolgversprechende Behandlungsmethode sehen (Stangier, S. 50).
Für eine über diesen Überblick hinausgehende weiterführende Beschreibung und ausführliche Erläuterung der Körperdysmorphen Störung sei auf Stangier (2002) verwiesen.
3.2 Prädisponierendes Merkmal: Soziokultureller Faktor Schönheitsnorm
Wie bereits dargelegt (vgl. „3.1.1.3/3.1.2.3 Ätiologie“), gelten soziokulturelle Faktoren als prädisponierendes Merkmal für Anorexia und Bulimia nervosa sowie die Körperdysmorphe Störung. Einer dieser soziokulturellen Faktoren, die gesellschaftlichen Schönheitsideale, sollen im Folgenden einer detaillierten Betrachtung unterzogen werden.
Die gesellschaftlichen Schönheitsnormen repräsentieren das Konzept, das Renz (2006) unter der modischen Schönheit versteht (vgl. „2.2 Schönheitskomponenten: Natürlich versus Modisch“). Der wahrscheinlich stärkste Vermittler dieser Normen sind die Massenmedien aufgrund ihrer Reichweite und ihres Einflusses (Willinge, Touyz und Charles, 2006). Nach Petersen (2005) werden die gesellschaftlichen Ideale durch die Massenmedien jedoch nicht nur transportiert, sondern von diesen auch in hohem Maße reproduziert und verstärkt.
Rossmann und Brosius (2005) ziehen aus den Ergebnissen zahlreicher Studien, die verschiedene Mediengattungen im Hinblick auf das propagierte Schönheitsideal untersuchten, die Schlussfolgerung, dass die Bedeutung von Schönheit und schönheitsbezogenen Themen in allen Medien zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Der Zeitschriftenmarkt weist zahlreiche Titel auf, die vorwiegend dem Thema Schönheit gewidmet sind, und auch das Fernsehen untermauert die Bedeutung von Attraktivität, indem es Protagonisten zeigt, die sich „bezüglich ihrer Attraktivität deutlich von einem wie auch immer gearteten Bevölkerungsdurchschnitt [unterscheiden]. Sie sind in der Regel jünger und attraktiver. Dies gilt vor allem für Frauen“ (S. 511).
3.2.1 Das weibliche Schlankheitsideal
Die vorherrschende Schönheitsnorm unserer Zeit ist das Schlankheitsideal, das Franke (2001) als prädisponierenden Faktor für die Essstörungen äußerst kritisch betrachtet:
Einen wichtigen Risikofaktor stellt die große Bedeutung dar, die dem Schlankheitsideal in unserer westlichen Industriekultur beigemessen wird. Körperumfang und Körperfülle unterliegen gesellschaftlichen Werten und Normen. Während in früheren Zeiten ... dicke Menschen, vor allem Männer, Wohlstand, Macht, Gelassenheit und Güte verkörpern, unterliegen die modernen Menschen industrialisierter Gesellschaften zunehmend einem Schlankheitsdiktat, das geradezu zu einem Schlankheitswahn als kollektiver Neurose geführt hat. (S. 368)
Das heutige Schlankheitsideal trifft auf beide Geschlechter zu, wobei Frauen in ganz besonderem Maße davon betroffen sind.
Doch während die Frauen der Renaissance zumindest die Chance hatten, die Venusgestalten als romantische und glorifizierte Darstellungen zu erkennen, verwischen die heutigen Möglichkeiten der Grafik und Werbetechnik die Grenzen zwischen Phantasie und Realität und spiegeln Frauen optische Illusionen vor, die viele von ihnen für bare Münze nehmen. (S. 368)
Darüber hinaus geht es nach Franke (2001) nicht nur um das Schlankheitsideal an sich, sondern um „mehrere sich widersprechende Idealvorstellungen: Frauen sollen superschlank und vollbusig sein oder athletisch mit weiblichen Hüften“ (S. 368).
Die Massenmedien, insbesondere visuelle Medien wie Zeitschriften und Fernsehen, sind die aggressivsten Kolporteure dieses Ideals (Groesz, Levine und Murnen, 2002). Sie konstruieren hohe Standards, die Schlankheit und Gewichtsverlust glorifizieren, indem sie Bilder von „perfekter“ weiblicher Schönheit präsentieren (Groesz et al). Diese Bilder in Form ultraschlanker Models sind gepaart mit der Botschaft, Gewicht verlieren und dem gegenwärtigen Schlankheitsideal für Frauen entsprechen zu müssen (Stice, Maxfield und Wells, 2003). Laut Legenbauer und Vocks (2005) ist dieses Ideal für
90% der Frauen unerreichbar.
Owen und Laurel-Seller (2000) berichten von einem bereits zwischen 1960 und 1980 beobachteten Trend zu einem immer schlankeren Ideal, der sich bis in die 90er Jahre hinein weiter verstärkte. Sie verglichen „Playboy“-Models aus den 60er und 70er Jahren mit „Playboy“-Models aus den Jahren 1985 bis 1997: Die Brüste wurden kleiner, die Taillen schlanker, die Hüften schmaler. Nahezu alle Models dieser Studie wiesen ein Gewicht unterhalb des Normbereichs auf, ein beträchtlicher Teil erfüllte hinsichtlich des Körpergewichts Kriterien für Anorexia nervosa und eine beträchtliche Minderheit erfüllte Kriterien für Unterernährung und chronischen Energiemangel. Owen und Laurel-Seller folgern daraus, dass für Frauen, die solch einem Ideal entsprechen wollen, Schlankheit im Bereich der Unterernährung erforderlich ist (S. 987).
Untersuchungen des Mediums Fernsehen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis: „Im Zeitverlauf lässt sich feststellen, dass das Schönheitsideal, das im Fernsehen propagiert wird, zunehmend ‚schlanker‘ wird“ (Rossmann & Brosius, 2005, S. 511). „Gewichtskontrolle ist zu einem generellen Lebensprinzip bzw. zur permanenten Lebensaufgabe geworden“, bemerkt auch Penz (1995, S. 27).
Sowohl Schönheit als auch Moral werden gleichgesetzt mit extremer Schlankheit, d.h. eine Frau muss dünn sein und bleiben und ihr Verlangen kontrollieren. Dieser Druck wird durch Vorurteile gegen Fettleibigkeit noch verstärkt (Groesz et al., 2002).
Schlanksein hat viel mit Leistungsfähigkeit zu tun. Es gilt nicht nur als Erfolgskriterium für Hungerkontrolle und Körperbeherrschung, sondern wird als Synonym und Voraussetzung für Erfolg und Anerkennung propagiert und für Leistungsbereitschaft und Selbstkontrolle in sämtlichen Bereichen des Lebens. Schlanksein ist der sichere Beweis dafür, dass jemand sich in der Hand hat, sich und sein Leben in den Griff bekommt und weiß, wo´s langgeht. (Franke, 2001, S. 369)
Darüber hinaus weisen laut Geissner und Schary (2005) Untersuchungen daraufhin, dass Schlankheit in Zusammenhang mit Attraktivität und Lebensfreude gebracht wird.
Auch Owen und Laurel-Seller (2000) stellen fest, dass die Medien einen engen Zusammenhang zwischen der Idealfigur und Werten wie Schönheit, Erfolg und Gesundheit zu suggerieren scheinen. So wird Schlankheit mittlerweile als eine Art Statussymbol des modernen Menschen vermittelt: Wer schlank ist, ist auch diszipliniert, gesund, erfolgreich, selbstbewusst und glücklich (Owen & Laurel-Seller, 2000).
Laessle (2003) sieht in dem soziokulturellen Faktor der Schönheitsnorm eine Erklärung für die im Verhältnis zu Männern weitaus größere Häufigkeit von Essstörungen bei Frauen (vgl. „3.1.1.2 Epidemiologie und Verlauf“), da der Schlankheitsdruck für Männer in sehr viel geringerem Ausmaß vorhanden ist (S. 366).
3.2.2 Das hypermaskuline Ideal
Allerdings sind immer mehr auch Männer einer rasant ansteigenden Flut von Idealbildern über die Massenmedien ausgesetzt. Während das weibliche Schönheitsideal Gegenstand zahlreicher Studien (zumindest im amerikanischen Raum) ist, beginnt die Forschung sich erst seit ein paar Jahren für das männliche Körperideal der Medien zu interessieren (Law & Labre, 2002).
In den achtziger und neunziger Jahren wurden mittels der Medien Bilder von schlanken und muskulösen Männerkörpern kolportiert. Der Markt für Fitnesszeitschriften hat sich in den letzten Jahren drastisch vergrößert. Obwohl die Zeitschriften Schlagwörter wie Gesundheit und Fitness im Titel tragen (z.B. „Men´s Health“), steht das Aussehen von Männern im Vordergrund (Pope et al., 2001).
Das bemerkt auch Renz (2006): „Zunehmend erfasst die Schönheitswelle auch den Mann. ... Mit dem ‚Waschbrettbauch‘ hat er inzwischen sogar sein eigenes Schönheitssymbol“ (S. 298).
Law und Labre untersuchten die Entwicklung der soziokulturellen Attraktivitätsnorm für Männer über den Zeitraum von 1967-97 in amerikanischen Männermagazinen. Es stellte sich heraus, dass die männlichen Körper über die Jahre zunehmend sehniger, muskulöser und V-förmiger (breiter Oberkörper, schmale Taille) präsentiert wurden (S. 697). Die soziokulturellen Standards für Männer betonen Kraft und Muskulatur, der mesomorphe Typ (gut proportioniert, durchschnittlich gebaut) wird dem ektomorphen (dünn) oder endomorphen (dick) vorgezogen und ist durch eine gut entwickelte Brust- und Armmuskulatur, breite Schultern und eine schmale Taille charakterisiert (S. 697). Durch die wachsende Verbreitung idealisierter Männerkörper in den Medien scheint auch für Männer eine neue Schönheitsnorm entstanden zu sein: Das hypermaskuline Ideal, ein muskulöser, durchtrainierter Körper mit extrem niedrigem Körperfettgehalt (Law & Labre, 2002). Ähnlich wie Frauenmagazine sind nun auch Männermagazine voll von Artikeln, die sich auf die Probleme und Unzulänglichkeiten der Leser beziehen. Law und Labre berichten von einer 1992 von Andersen und DiDomenico durchgeführten Studie, in deren Rahmen der Durchschnitt von Diätartikeln in Frauenzeitschriften im Verhältnis zu Männerzeitschriften fast exakt mit dem Verhältnis von essgestörten Frauen und Männern korreliert, sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch in Behandlungszentren.
Pope et al. (2001) untersuchten die Maße männlicher Models der Zeitschrift „Playgirl“ während eines Zeitraums von 25 Jahren und kamen zu dem Ergebnis, dass das durchschnittliche männliche „Playgirl“-Model im Laufe von 25 Jahren etwa fünfeinhalb Kilo Fett verloren und etwa zwölf Kilo Muskelmasse zugenommen hat (S. 71f.).
„Darüber hinaus scheint es kaum zweifelhaft, dass unsere Kultur im Laufe der letzten Generation wachsenden Wert auf das männliche Körperbild legte – wie sich an Spielzeug, Comics, Zeitschriften, Zeitungen, Film und Fernsehen sowie Werbung aller Art zeigen läßt“ (Pope et al., S. 85).
Auch Law und Labre (2002) stellen fest, dass Männer einer wachsenden Anzahl von Medienberichten ausgesetzt sind, die ihnen vermitteln, wie sie ihre Form verbessern, ihre Muskeln definieren und ihre Essgewohnheiten ändern sollen. So könnte auch für Männer physische Attraktivität immer wichtiger werden. „Heute ist ein junger Mann, während er aufwächst, Abertausenden dieser Supermanbilder ausgesetzt. Jedes dieser Bilder verknüpft Aussehen mit Erfolg – gesellschaftlichem, finanziellem und sexuellem“ (Pope et al., S. 27).
Dabei ist das männliche Ideal für Männer ebenso schwer zu erreichen wie das weibliche Ideal für Frauen (Law & Labre, 2002, S. 706).
Dies erzeugt eine Diskrepanz zwischen den vermittelten Schönheitsnormen und dem eigenen wahrgenommenen Körperbild. Diese Diskrepanz und deren mögliche Auswirkungen sollen im folgenden Kapitel näher betrachtet werden.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836607247
- DOI
- 10.3239/9783836607247
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-Friedrich-Universität Bamberg – Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Klinische Psychologie und Psychotherapie
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Dezember)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- klinische psychologie anorexie bulimie printmedien schönheitsideal
- Produktsicherheit
- Diplom.de