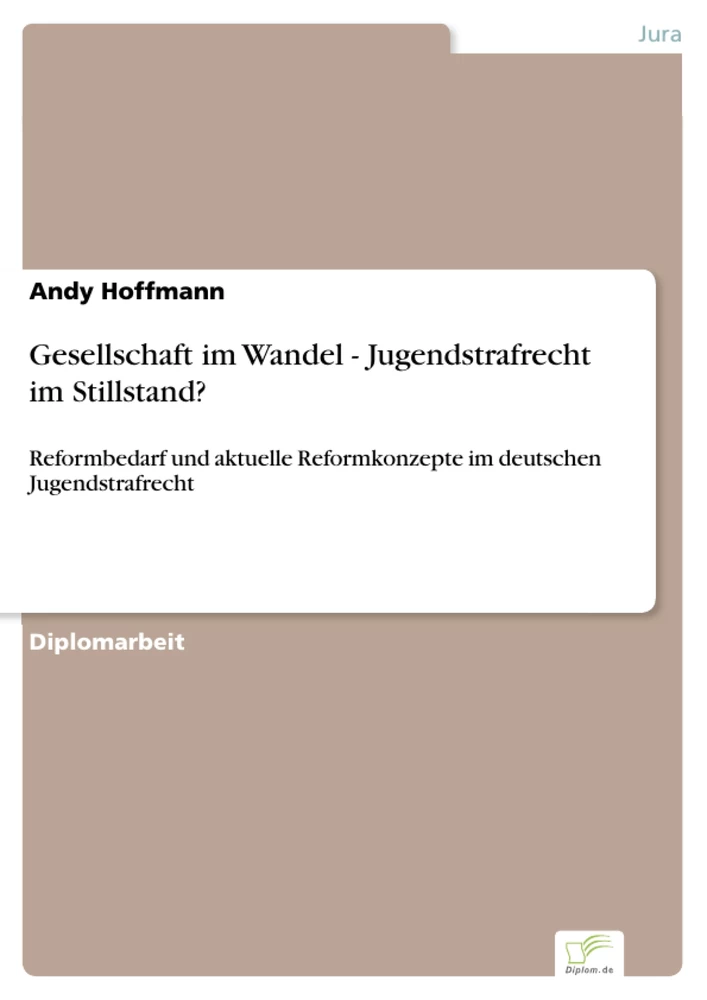Gesellschaft im Wandel - Jugendstrafrecht im Stillstand?
Reformbedarf und aktuelle Reformkonzepte im deutschen Jugendstrafrecht
Zusammenfassung
Das deutsche Jugendstrafrecht wurde zuletzt 1990 mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes reformiert. Seitdem sind 15 Jahre ohne weitere Reform vergangen. Dabei wurde bereits mit Verabschiedung dieses Gesetzes in einer parlamentarischen Entschließung auf weiteren Reformbedarf hingewiesen. Der Ruf nach weiteren Reformen wurde seitdem aus verschiedensten Richtungen ungebrochen wiederholt.
Im Jahr 2002 wurden von Hans-Jörg Albrecht und der 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) zwei Konzepte veröffentlicht, die sich sehr ausführlich mit dem Reformbedarf im deutschen Jugendstrafrecht auseinandergesetzt haben. Ich selbst wurde auf die Thematik aufmerksam, als ich mich 2003 auf die mündlichen Diplomprüfungen in Erziehungswissenschaften vorbereitet habe. Seitdem verfolge ich das Thema mit großer Aufmerksamkeit und habe mir bereits damals vorgenommen mich im Rahmen der Diplomarbeit mit dem Thema Jugendstrafrechtsreform auseinanderzusetzen.
In den letzten beiden Jahren ist die Diskussion um eine Jugendstrafrechtsreform in den einschlägigen Fachzeitschriften zwar wieder etwas leiser geworden, schon bald dürfte sie aber wieder lauter werden. Denn die Politik hat dieses Thema wieder verstärkt aufgegriffen. Nachdem die nun scheidende Bundesregierung bereits einen Referentenentwurf für ein 2. JGGÄndG vorgelegt hat und die unionsregierten Bundesländer in regelmäßigen Abständen sich ähnelnde Reformkonzepte wiederholt in den Bundesrat eingebracht haben, hat die Union für die kommende Legislaturperiode eine Reform des Jugendstrafrechts angekündigt.
So möchte sie das Höchstmaß der Jugendstrafe von zehn auf 15 Jahre erhöhen, Änderungen im Hinblick auf die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden vornehmen und den Warnschußarrest für junge Rückfalltäter einführen. Damit ist das Thema Jugendstrafrechtsreform wieder auf der politischen Agenda angekommen, nachdem davon im vergangenen Wahlkampf nichts zu hören war.
Gang der Untersuchung:
Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse werde ich verschiedene Reformkonzepte diskutieren. Wie hat sich Kinder- und Jugendkriminalität seit der letzten Reform des Jugendstrafrechts entwickelt? Besteht denn tatsächlich dringender Reformbedarf im Jugendstrafrecht? Welchen Anforderungen muss sich ein zeitgemäßes Jugendstrafrecht stellen?
Bei Beantwortung dieser Fragen setzt mir der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
A. Drei Fragen – Eine Einleitung
I. Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden?
II. Was möchte ich in dieser Arbeit herausarbeiten?
III. Wie werde ich bei der Darstellung vorgehen?
B. (Jugend-)Kriminalität – Was ist das eigentlich?
C. Jugendkriminalität – Zum Ausmaß eines Problems
I. Zum Verhältnis von Kriminalstatistik und Kriminalitätswirklichkeit
1. Zur Konstanz der Einflußgrößen auf die registrierte Kriminalität
2. Wie repräsentativ ist das registrierte Hellfeld?
II. Umfang und Bedeutung der Jugendkriminalität
1. Einige Behauptungen über Jugendkriminalität im Lichte der Hellfelddaten
a) Behauptung: Das Ausmaß der Jugendkriminalität steigt bzw stagniert auf einem hohen Niveau
b) Behauptung: Die jugendliche Gewaltkriminalität steigt in besonderem Maße
c) Behauptung: Die Straftäter werden immer jünger und schlimmer
d) Zwischenfazit
2. Jugendkriminalität – normal, ubiquitär und episodenhaft
3. Mehrfach- und Intensivtäter
4. Fazit
D. Einige Blicke ins Gesetz: Grundlagen und -züge des JGG
I. Strafrechtliche Verantwortung und soziale Entwicklung
II. Das jugendstrafrechtliche Sanktionssystem
III. Das Absehen von einer formalen Strafe – die Diversion
IV. Besonderheiten im Jugendstrafverfahren
V. Das Rechtsmittelverfahren
VI. Vollstreckung und Vollzug
E. Die Geschichte des Jugendstrafrechts in Deutschland
I. Auf der Suche nach einem Anfang
1. Die Entdeckung der eigenständigen Lebensphasen Kindheit und Jugend
2. Die Begründung der „modernen Schule“ des Strafrechts
3. Die Jugendgerichtsbewegung
II. Das RJGG von 1923
III. Das RJGG von 1943
IV. Das JGG von 1953
V. Das JGG von 1990
VI. Die Entwicklung nach 1990
F. Zwischenfazit
G. Reformbedarf und Reformkonzepte im
Jugendstrafrecht
I. Der Erziehungsgedanke
1. Ausführungen zu einem vermeintlich eindeutigem Begriff
a) Die „Erziehung“
b) Die „Strafe“
c) Zum Verhältnis der Begriffe „Erziehung“ und „Strafe“
2. Der Erziehungsgedanke als Strafzweck
a) Allgemeine Strafzwecke
aa) Die absoluten Straftheorien
bb) Die relativen Straftheorien
b) Der Strafzweck der Erziehung
c) Kritik am Strafzweck „Erziehung“
aa) Der Strafzweck „Erziehung“ im Lichte kriminologischer
Erkenntnisse
bb) Verfassungsrechtliche Bedenken
3. Die Auswirkungen des Erziehungsgedankens auf das JGG
4. Zwischenfazit und weiterer Ausblick
II. Die Altersgrenzen der strafrechtlichen Verantwortung
1. Beginn der Strafmündigkeit
a) Bestehende Gesetzeslage
b) Diskussion: Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze auf
zwölf Jahre
aa) Entwicklung der Kinderkriminalität
bb) Kindliche Reifungsprozesse
cc) Sinn und Zweck einer Absenkung der
Strafmündigkeitsgrenze
dd) Fazit
c) Die Ausweitung der familiengerichtlichen Kompetenzen –
eine sinnvolle Alternative?
aa) Gesetzesvorschlag
bb) Kritik
2. Die Jugendlichen – Flexibilisierung des § 3
a) Bestehende Gesetzeslage und Praxis
b) Reformdiskussion
3. Die Heranwachsenden - § 105
a) Bestehende Gesetzeslage
b) § 105 in der gerichtlichen Praxis
c) Reformdiskussion
aa) Erwachsenenstrafrecht als Regelfall/ Jugendstrafrecht als Ausnahme
bb) Ausnahmslose Anwendung von Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht
d) Fazit
4. Die Jungerwachsenen
5. Zusammenfassung
III. Reformbedarf im Ermittlungsverfahren
1. Die Diversion, §§ 45,47
a) Zum Begriff der Diversion
b) Rechtliche Einordnung der Diversion
c) Kurzer Überblick zur Geschichte der Diversion
d) Praktische Bedeutung der Diversion
e) Probleme der Diversionsentscheidungen
f) Reformdiskussion zu den §§ 45, 47
h) Stellungnahme
i) Exkurs: Die Polizeidiversion
2. Der Umfang der Ermittlungen, § 43
a) gegenwärtige Gesetzeslage
b) Reformdiskussion
3. Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvermdeidung
a) Gesetzliche Lage
b) Die Untersuchungshaftregelungen in der Praxis
c) Besondere Probleme bei der Anordnung von U-Haft
bei Jugendlichen
d) Reformdiskussion
e) Sonderproblem: § 52a – Nichtanrechnung der U-Haft
IV. Reformbedarf in der Hauptverhandlung
1. Grundsatz der Öffentlichkeit und Schutz des Persönlichkeitsrechts
2. Ausschluß des Angeklagten und der Erziehungsberechtigten
V. Das Sanktionensystem im JGG
1. Das dreigeteilte Sanktionensystem
a) gegenwärtige Rechtslage
b) Reformdiskussion
2. Die Abschaffung des § 12
3. Der Ausbau ambulanter Maßnahmen
4. Die Verbindung verschiedener Rechtsfolgen
5. Die Einführung neuer Sanktionsmittel
a) Die Meldepflicht
b) Das Fahrverbot als selbstständige Sanktion
c) Zusammenfassung
6. Der Jugendarrest
7. Der Ungehorsamsarrest
8. Der Warnschußarrest
9. Die Jugendstrafe
a) Bestehende Gesetzeslage
aa) Voraussetzungen der Jugendstrafe
bb) Bemessung der Jugendstrafe
b) Die Auswirkungen der Jugendstrafe auf den Betroffenen
c) Reformdiskussionen
aa) Bezüglich der Voraussetzungen der Jugendstrafe
bb) Exkurs: Bezüglich der Sicherungsverwahrung
cc) Bezüglich der Dauer der Jugendstrafe
dd) Bezüglich einer Sonderbehandlung der 14/15jährigen
ee) Bezüglich der Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen
10. Aussetzung der Verhängung und Vollstreckung von Jugendstrafe
a) Die Strafaussetzung zur Bewährung
b) Die Bewährung vor der Jugendstrafe
c) Die Vorbewährung
d) Die Strafrestaussetzung
11. Zusammenfassung: Reformbedarf im Sanktionensystem
VI. Besondere Verfahrensarten
1. Das Strafbefehlsverfahren
2. Das beschleunigte Verfahren
3. Die Stellung des Verletzten im Verfahren
a) Zur Berücksichtigung von Opferbelangen im Strafverfahren
b) Stärkung der Informations- und Mitwirkungsrechte
c) Die Nebenklage
d) Die Privatklage
e) Das Adhäsionsverfahren
4. Das Rechtsmittelverfahren
5. Zusammenfassung: Besondere Verfahrensarten
VII. Die Beteiligten am Jugendstrafverfahren
1. Der Jugendrichter
a) Gegenwärtige Rechtslage
b) Reformdiskussion
2. Die Jugendstaatsanwälte
3. Die Jugendschöffen
4. Die Strafverteidigung
5. Die Jugendgerichtshilfe
a) Ein ganz kurzer Überblick über die Entwicklung der JGH
b) Die Praxis der Jugendgerichtshilfe
c) Das Reformkonzept der 2. DVJJ-Kommission
aa) Zum Verhältnis von Justiz und Jugendhilfe
bb) Zum Rollenkonflikt der JGH
cc) Informationsaustausch, Auskunftsanspruch und
Verpflichtung zur Zusammenarbeit
dd) Zur Mitwirkung in U-Haftsachen
ee) Zur Mitwirkung in der Hauptverhandlung
ff) Zur Ausführung der ambulanten Maßnahmen
gg) Ergebnis
VIII. Zurück zum Anfang – Der Erziehungsgedanke 2. Teil
G. Fazit und Ausblick: Ein zeitgemäßes Jugendstrafrecht
Anhang I: Literaturverzeichnis
Anhang II: Abkürzungsverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
A. Drei Fragen – Eine Einleitung
„Die Frage eines zeitgemäßen Jugendstrafrechts ist selbstverständlich zuallererst vor dem Hintergrund der Entwicklungen von Kinder- und Jugendkriminalität zu beantworten und damit vor der Folie des Problems, auf das ein zeitgemäßes Jugendstrafrecht wohl immer nur ausgerichtet werden soll.“[1]
I. Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden?
Das deutsche Jugendstrafrecht wurde zuletzt 1990 mit dem ersten Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1.JGGÄndG) reformiert. Seitdem sind 15 Jahre ohne weitere Reform vergangen. Dabei wurde bereits mit Verabschiedung dieses Gesetzes in einer parlamentarischen Entschließung auf weiteren Reformbedarf hingewiesen[2]. Der Ruf nach weiteren Reformen wurde seitdem aus verschiedensten Richtungen ungebrochen wiederholt. Im Jahr 2002 wurden von Hans-Jörg Albrecht und der 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) zwei Konzepte veröffentlicht, die sich sehr ausführlich mit dem Reformbedarf im deutschen Jugendstrafrecht auseinandergesetzt haben. Ich selbst wurde auf die Thematik aufmerksam als ich mich 2003 auf die mündlichen Diplomprüfungen in Erziehungswissenschaften vorbereitet habe. Seitdem verfolge ich das Thema mit großer Aufmerksamkeit und habe mir bereits damals vorgenommen mich im Rahmen der Diplomarbeit mit dem Thema „Jugendstrafrechtsreform“ auseinanderzusetzen.
In den letzten beiden Jahren ist die Diskussion um eine Jugendstrafrechtsreform in den einschlägigen Fachzeitschriften zwar wieder etwas leiser geworden, schon bald dürfte sie aber wieder lauter werden. Denn die Politik hat dieses Thema wieder verstärkt aufgegriffen. Nachdem die nun scheidende Bundesregierung bereits einen Referentenentwurf für ein 2. JGGÄndG vorgelegt hat und die unionsregierten Bundesländer in regelmäßigen Abständen sich ähnelnde Reformkonzepte wiederholt in den Bundesrat eingebracht haben, hat die Union für die kommende Legislaturperiode eine Reform des Jugendstrafrechts angekündigt. So möchte sie das Höchstmaß der Jugendstrafe von zehn auf 15 Jahre erhöhen, Änderungen im Hinblick auf die strafrechtliche Behandlung der Heranwachsenden vornehmen und den Warnschußarrest für junge Rückfalltäter einführen[3]. Damit ist das Thema „Jugendstrafrechtsreform“ wieder auf der politischen Agenda angekommen, nachdem davon im vergangenen Wahlkampf nichts zu hören war.
Begonnen habe ich mit dem Studium der Erziehungswissenschaften im WS 97/98. Schon bald bildete sich im Rahmen dieses Studiums mein Interessenschwerpunkt rund um die Themen, „Jugend, Subkulturen und Gewalt“ heraus. Im Wintersemester 2000/2001 entschloß ich mich zudem das Studium der Rechtswissenschaften aufzunehmen. Hier waren es vor allem die Vorlesungen zu Strafrecht und Kriminologie die meine besondere Aufmerksamkeit weckten. Obwohl zwischen den beiden Studiengängen von Arbeitsweise, Lerninhalten und Anforderungen enorme Unterschiede bestehen, so war damit für mich von Beginn an eine innere Verbindung hergestellt. Diese Verbindung wurde im Laufe der Semester immer stärker. Gerade mit den Angeboten im Hauptstudium der Erziehungswissenschaften und den Nebenfächern in Rechtswissenschaften konnte ich die Lehrveranstaltungen immer besser aufeinander abstimmen. Die so unterschiedlichen Studiengänge ergänzten sich mehr und mehr.
Und auch wenn ich schon 2003 den Wunsch hatte meinen Studienweg mit dieser Arbeit abzurunden, so ist mir gerade beim Schreiben dieser Arbeit noch einmal deutlich geworden, wie stark sich diese beiden Studiengänge nun angenähert haben. Diese Arbeit stellt den Abschluß meines Jura und Pädagogik-Studiums dar.
II. Was möchte ich in dieser Arbeit herausarbeiten?
Das einleitende Zitat von Hans-Jörg Albrecht verdeutlicht, was ich dem Leser auf den folgenden Seiten vermitteln möchte. Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse werde ich verschiedene Reformkonzepte diskutieren. Wie hat sich Kinder- und Jugendkriminalität seit der letzten Reform des Jugendstrafrechts entwickelt? Besteht denn tatsächlich dringender Reformbedarf im Jugendstrafrecht? Welchen Anforderungen muß sich ein zeitgemäßes Jugendstrafrecht stellen?
Bei Beantwortung dieser Fragen setzt mir der zeitliche und räumliche Umfang einer Diplomarbeit Grenzen. Ich kann nicht alle relevanten Fragestellungen in dieser Arbeit abhandeln. So werden beispielsweise spezielle Themenkomplexe wie Ausländerkriminalität, Rechtsextremismus oder geschlechtsspezifische Unterschiede nicht von mir bearbeitet. Und auch die behandelten Themenkomplexe können oftmals nicht in der Tiefe behandelt werden, die vielleicht nötig wäre. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage zukommen, wie das Verhältnis von Erziehung und Strafe ausgestaltet ist und welchen Stellenwert der Erziehungsgedanke im deutschen Jugendstrafrecht hat. Doch wurde bereits vor Einführung des Reichsjugendgerichtsgesetzes von 1923 (RJGG1923) und bis heute dermaßen intensiv über diese Fragestellung diskutiert, daß sich problemlos mehrere Bücher zu diesem Thema füllen ließen.
Diese Arbeit ist nicht mit dem Anspruch auf eine vollständige Darstellung der Thematik geschrieben, sondern auf das meines Erachtens Wesentliche beschränkt. Diese Diplom-Arbeit kann also nur eine Einführung in die Thematik „Jugendstrafrechtsreform“ sein – ergänzt um meine persönliche Einschätzung.
III. Wie werde ich bei der Darstellung vorgehen?
Ich werde zuerst mit einer Einführung in das Phänomen Jugendkriminalität beginnen. Worüber reden wir, wenn wir von Jugendkriminalität sprechen? Hierfür werde ich den Begriff der Jugendkriminalität definieren (B.) und anschließend versuchen das Ausmaß dieses gesellschaftlichen Phänomens darzustellen (C.).
Im nächsten Abschnitt soll ein Überblick über das JGG zeigen, wie der deutsche Gesetzgeber gegenwärtig auf Jugendkriminalität reagiert (D.).
Wie es zu dieser Gesetzeslage überhaupt kam, soll dann das folgende Kapitel zeigen. Einen kurzer Überblick über das gegenwärtige deutsche Jugendstrafrecht gibt also Kapitel (E.).
In Kapitel (F.) werde ich dann ein kurzes Zwischenfazit ziehen, bevor ich mich dann im Kapitel (G.) den Reformdiskussionen zuwende. Abschließen wird diese Arbeit dann ein Fazit in Kapitel (H.).
Der Lesbarkeit zuliebe habe ich mich entschieden darauf zu verzichten beide Geschlechtsformen zu verwenden. Liebe/r Leser/in stellen Sie sich bitte ab jetzt einfach den entsprechenden Zusatz vor. Ich hoffe beide Geschlechter fühlen sich gleichermaßen angesprochen, auch wenn ich im folgenden nur die männliche Geschlechtsform verwenden werde.
Ein letzter Hinweis noch. In dieser Arbeit werde ich einige Abkürzungen verwenden – gerade im Hinblick auf die verschiedenen Gesetze und verwendeten Fachzeitschriften. Hinter dem Literaturverzeichnis findet sich am ganz am Ende ein ausführliches Abkürzungsverzeichnis um diesen Umstand Rechnung zu tragen.
Und nun wünsche Ihnen und Euch viel Spaß beim Lesen.
Andy Hoffmann im Sommer und Herbst 2005
B. (Jugend-)Kriminalität – Was ist das eigentlich?
„Kriminalität“ beziehungsweise „kriminelles Verhalten“ – das sind doch auf den ersten Blick eindeutig besetzte Begriffe. Doch sind diese Begriffe wirklich nicht erklärungsbedürftig? Dann müßte es ein Verhalten geben, welches von Natur aus als kriminell einzustufen wäre.
Wie wäre es mit homosexuellem Verhalten?
Noch bis zum Jahre 1994 standen sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Mittlerweile können Homosexuelle mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft eine eheähnliche Verbindung eingehen. Ist (war) nun Homosexualität unter Männern ein naturgemäß kriminelles Verhalten?
Wie ist der Genuß von Rauschmitteln strafrechtlich einzuschätzen?
Alkohol ist eine anerkannte Gesellschaftsdroge. Der Besitz, Konsum und der Handel mit anderen Rauschmitteln steht nach dem Betäubungsmittelgesetz hingegen unter Strafe.
Ist Vielleicht Sterbehilfe kriminell?
Ob Sterbehilfe strafbar ist, hängt derzeit davon ab, ob sie aktiv oder passiv „geleistet“ wird. Wo verläuft die Grenze zwischen diesen beiden Formen der Sterbehilfe? Kann sich an der unterschiedlichen strafrechtlichen Beurteilung dieser beiden Arten der Sterbehilfe wieder etwas ändern?
Ja! Man muß nur das Gesetz ändern oder das Gesetz anders auslegen.
Als ich gerade begann diese Arbeit zu schreiben hat der Bundesrat den Weg für eine Gesetzesänderung frei gemacht, wonach künftig Jugendliche unter bestimmten Voraussetzungen bereits im Alter von 17 Jahren einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führen dürfen[4]. Am 18. August ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Bis zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) drohte den 17jährigen bei Mißachtung der Voraussetzungen des § 21 StVG eine Gefängnisstrafe. Nach dem Erlaß von Rechtsverordnungen der Bundesländer können 17jährige in Begleitung nun mit einem Pkw am Straßenverkehr teilnehmen. Hält der 17jährige sich an die Voraussetzungen ist sein Verhalten nicht mehr strafbar. Entkriminalisierung ist die Bezeichnung für diesen Vorgang. Aus strafbarem Verhalten wird legales. Abweichendes Verhalten wird zur Normalität.
Aber was ist mit Totschlag, Mord, Raub, Betrug, Erpressung und wie all die anderen klassischen Delikte noch heißen mögen? Sind dies nicht eindeutig kriminelle Verhaltensweisen?
Selbst bei diesen Delikten ergeben sich Schwierigkeiten bei der rechtlichen Einordnung. Welche objektiven und subjektiven Voraussetzungen müssen von dem Täter erfüllt werden, damit beispielsweise der Tatbestand des Totschlags als verwirklicht angesehen wird? Wann wird aus einem „einfachen“ Totschlag mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren ein Mord, der nur ein Strafmaß kennt: die lebenslange Freiheitsstrafe. Das Gesetz nennt verschiedene Mordmerkmale: Grausam ist zum Beispiel ein solches. Doch wann ist eine Tötung grausam, wann liegt sie noch im „üblichen“ Rahmen?
Doch damit ist noch nicht genug. Denn unter bestimmten Vorsaussetzungen ist selbst ein grausamer Mord gerechtfertigt oder entschuldigt. Und trotz tatbestandsmäßiger Handlung ist der Täter dann straffrei zu sprechen. Welche Voraussetzungen sind dies?
All diese Fragen lassen sich beantworten. Freilich nur mit Hilfe einer verbindlichen Rechtsordnung und durch Auslegung der entsprechenden Normen.
Diese Beispiele machen deutlich: Kriminalität ist was der Staat mit Hilfe des Strafrechts als solche definiert. Und diese Definitionen - wie auch das Strafmaß - unterliegen dem zeitlichen und gesellschaftlichen Wandel. Was heute hier noch strafrechtlich verboten ist, kann morgen erlaubt sein. In einem anderen Rechtssystem ist es dies vielleicht schon heute[5]. Kriminalität muß somit immer „ vor dem Hintergrund des jeweiligen strafrechtlichen Normenbestandes gesehen werden, sei es im zeitlichen Längsschnitt, sei es hinsichtlich der in den Vergleich einbezogenen Gesellschaften. “[6]
Und nicht nur der bestehende Normenbestand ist für diese Zuschreibung entscheidend, sondern auch die Entdeckung der Straftat. Ein Verhalten, daß überhaupt nicht wahrgenommen wird, kann auch nicht als „kriminelles Verhalten“ identifiziert werden. Dem „Täter“ kann somit nicht das Stigma des Kriminellen angeheftet werden. So lebt möglicherweise der Mörder, der nicht entdeckt wird, weiter unter uns. Er mag sich vielleicht selbst nun als Mörder fühlen. Doch die Gesellschaft erkennt ihn nicht als solchen und kann ihn nicht als Kriminellen bezeichnen.
Zusammenfassend läßt sich Kriminalität nun damit dahingehend bestimmen, „ daß sie die Gesamtheit jener Handlungen umfaßt, die in der Summe der Deliktstatbestände einer Strafrechtsordnung als strafbar benannt sind und die von den Instanzen strafrechtlicher Sozialkontrolle als solche identifiziert werden. “[7]
Als strafbare Handlungen gelten in der deutschen Strafrechtsordnung die Deliktstatbestände im Strafgesetzbuch (StGB) und seinen Nebengesetzen. Nur Handlungen, die sich unter diese Tatbestände subsumieren lassen, können - sofern sie auch als solche identifiziert werden - als kriminelle Verhaltensweisen gewertet werden und letztendlich zu einer Verurteilung eines Menschen zu einem Kriminellen führen.
Voraussetzung sind hierfür drei Dinge: Der Rechtsbrecher muß den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht haben und dabei rechtswidrig und schuldhaft gehandelt haben. „ Schuld setzt voraus, dass der Täter das Unrecht seines Tuns erkennen kann und fähig ist, nach dieser Erkenntnis zu handeln. “[8] Dabei geht unser Strafrecht von der unbewiesen Annahme aus, daß jeder nicht geisteskranke erwachsene Mensch über diese beiden Fähigkeiten verfügt[9].
Die soeben benannten Fähigkeiten sind dem Menschen jedoch nicht angeboren; er muß sie erst in einem langwierigen Sozialisationsprozeß erlernen[10]. Ausgehend von dieser Erkenntnis hat der deutsche Gesetzgeber das Jugendgerichtsgesetz (JGG) entwickelt. So werden dem jungen Menschen vom Gesetzgeber gemäß §§ 1 JGG[11], 19 StGB 14 Jahre zugebilligt, in denen ihm kein strafrechtlicher Schuldvorwurf seitens des Staates gemacht werden kann.
Mit Eintritt des 14. Lebensjahres gelten nun die materiellen Strafnormen des StGB uneingeschränkt. Doch wird sowohl den Jugendlichen, als auch den Heranwachsenden, nach dem JGG eine Übergangsfrist zugebilligt, in welcher bei der Beurteilung der strafrechtlichen Verantwortung und der Auswahl der staatlichen Reaktion die persönliche Entwicklung des Verdächtigen eine Rolle spielt. Es greift das besondere Sanktionensystem des JGG ein. Dies ist bei Jugendlichen unter den Voraussetzungen des § 3 der Fall, bei Heranwachsenden unter den Voraussetzungen des § 105.
Mit Eintritt des 21. Lebensjahres endet diese Schonzeit nach unserer Rechtsordnung nun endgültig. Das Erwachsenenstrafrecht greift in voller Konsequenz. Das JGG findet keine Anwendung mehr.
Und damit nun zur Antwort auf die eröffnende Frage: Jugendkriminalität ist die Summe der nach den allgemeinen Gesetzen mit Strafe bedrohten rechtswidrigen und schuldhaften Taten von Jugendlichen oder Heranwachsenden, soweit bei letzteren die Voraussetzungen des § 105 erfüllt sind. Vorausgesetzt diese Taten werden von den staatlichen Kontrollinstanzen als solche identifiziert. Jugendkriminalität ist somit kein Naturphänomen, sondern ein rechtliches Konstrukt und unterliegt damit dem Wandel der gesellschaftlichen Definitions- und Wahrnehmungsprozesse.
C. Jugendkriminalität – Zum Ausmaß des Problems
„Seit Beginn der neunziger Jahre ist ein stetiger Anstieg der Jugendkriminalität – insbesondere der Gewaltkriminalität – in der Bundesrepublik Deutschland zu verzeichnen.“[12]
Immer wieder sind derartige Äußerungen aus den Medien, der Politik oder Wissenschaft zu vernehmen. Gestützt werden solche Aussagen meist auf die Daten der amtlichen Kriminalstatistiken, insbesondere die der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Diese Statistik gibt die von der Polizei registrierten Straftaten und Täter wieder. Das eingangs angeführte Zitat spricht aber von einem Anstieg der Jugendkriminalität. Gemeint ist damit die Gesamtheit der Straftaten und Täter, ganz gleich, ob diese entdeckt oder unentdeckt blieben. Diese Gesamtheit der entdeckten und nichtentdeckten Straftaten wird auch oft als Kriminalitätswirklichkeit bezeichnet. Angesichts der im vorangegangenen Kapitel genannten Definition ist dies keine unproblematische Bezeichnung. Denn nicht wahrgenommene Delikte und ihre Täter werden eben nicht als kriminelle Verhaltensweisen identifiziert. Aber der Begriff der Kriminalitätswirklichkeit hat sich durchgesetzt und so werde auch ich ihn benutzen. Welche Probleme und Risiken damit jedoch verbunden sind, wenn von den Daten der registrierten Kriminalität auf die Kriminalitätswirklichkeit geschlossen wird, soll auf den folgenden Seiten deutlich gemacht werden.
I. Zum Verhältnis von Kriminalstatistik und Kriminalitätswirklichkeit
Nun ist Wesensmerkmal der amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken, daß sie nur über einen Teil der Kriminalitätswirklichkeit informieren. Sie geben „ in erster Linie Aufschluss über die in den einzelnen Abschnitten des Strafverfahrens stattfindenden Registrierungs-, Definitions- und Ausfilterungsprozesse. “[13]
Gemessen werden die jeweils erledigten Verfahren, die registrierte Taten beziehungsweise Personen. Die Kriminalitätswirklichkeit in ihrer Gesamtheit wird hingegen nicht gemessen. Ein Teil der Straftaten wird nicht entdeckt oder als nicht strafbares Verhalten bewertet. Und nur ein Teil der wahrgenommenen und als kriminell bewerteten Lebenssachverhalte wird auch angezeigt. Von den bekannt gewordenen Fällen wird wiederum nur ein Teil aufgeklärt, hiervon wiederum nur ein Teil angeklagt. Und auch von den angeklagten Taten ist letztlich nur ein geringer Teil Gegenstand einer Verurteilung[14].
Ein beträchtlicher Teil der Straftaten und Straftäter wird von den Strafverfolgungsbehörden gar nicht registriert, sie verbleiben im sogenannten Dunkelfeld. Nun wäre dies nicht weiter tragisch, wenn das registrierte Hellfeld einen repräsentativen und über die Zeit hinweg konstant großen Ausschnitt der Kriminalitätswirklichkeit darstellen würde. Denn dann könnte man bei einem Anstieg der registrierten Kriminalität ohne weiteres auf einen Anstieg der Kriminalitätswirklichkeit schließen. Entscheidende Voraussetzung für einen solchen Rückschluß wäre freilich, daß sämtliche Einflußgrößen auf die registrierte Kriminalität im Vergleichszeitraum konstant geblieben sind[15].
1. Zur Konstanz der Einflußgrößen auf die registrierte Kriminalität
Als besonders bedeutende Einflußgröße auf die registrierte Kriminalität gilt das Anzeigeverhalten der Bevölkerung. So werden fast alle in der PKS registrierten Sachverhalte der Polizei durch Anzeige bekannt. Insbesondere die polizeilichen Kenntnisse über Eigentums- und Vermögenskriminalität gehen zu über 90% auf Anzeigen Privater zurück[16]. Damit hängen Umfang, Struktur und Entwicklung registrierter Kriminalität unmittelbar von dem Anzeigeverhalten der Bevölkerung ab. Und dieses Anzeigeverhalten unterliegt in hohem Maße dem sozialen Wandel. So gibt es eine Fülle von Hinweisen, daß sich das Anzeigeverhalten – und zwar deliktsspezifisch unterschiedlich – verändert; wobei jedoch unklar bleibt, in welchem Ausmaß[17]. Die Spielräume für Verschiebungen sind bei durchschnittlichen Anzeigeraten von 10% - 50% (abhängig vom erlittenen Delikt) jedenfalls reichlich groß[18].
Dabei ist das Anzeigeverhalten nicht die einzige Einflußgröße, die zu Verzerrungen des sichtbaren Kriminalitätsbildes führt. Veränderungen bei der Wahrnehmung der registrierten Kriminalität können auch darauf beruhen, daß sich die „ Verfolgungsintensität, die Verdachtsstrategien bzw. die Erledigungspraxis der Träger informeller wie formeller Sozialkontrolle, Gesetzgebung oder Rechtssprechung, die Erfassungsgrundsätze für die Statistiken oder das Registrierverhalten der statistikführenden Stellen geändert haben. “[19]
Insbesondere die polizeilichen Daten sind mit Vorsicht zu genießen, denn deren Aufbereitung ist auch von dem Interesse der Polizei geleitet, möglichst viele und besser dotierte Stellen zu erhalten. Aus diesem Grund werden oftmals vorhandene Beurteilungsspielräume im Sinne einer eindrucksvolleren Dramatik genutzt[20]. Und so handelt es sich bei der PKS um eine Verdachtsstatistik, in der die Tendenz zur Überbewertung besteht, die bei Korrektur im weiteren Verfahren nicht mehr zurückgenommen wird[21].
Schaubild 1:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[22]
Festzuhalten bleibt damit, daß von einer Konstanz der Einflußgrößen auf die registrierte Kriminalität nicht ausgegangen werden kann. Und damit bleibt bei der isolierten Betrachtung der amtlichen Kriminalstatistiken im zeitlichen Vergleich unklar, ob sich die Kriminalitätswirklichkeit verändert, oder sich lediglich die Grenzen zwischen Hell- und Dunkelfeld verschieben[23]. Das folgende Schaubild verdeutlicht, daß sich Hell- und Dunkelfeldkriminalität über einen längeren Zeitraum gegenläufig entwickeln können. Somit kann bei einem Anstieg der registrierten Kriminalität keineswegs ohne weiteres auf einen Anstieg der Kriminalitätswirklichkeit geschlossen werden[24].
Schaubild 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[25]
2. Wie repräsentativ ist das registrierte Hellfeld ?
Bereits ansatzweise beantwortet wurde soeben die Frage, ob die registrierte Kriminalität wenigstens einen repräsentativen Ausschnitt der Kriminalitätswirklichkeit darstellt. Eine – nach Delikt unterschiedlich hohe – Anzeigerate zwischen 10-50% weist darauf hin, daß bestimmte Delikte häufiger anzeigt werden als andere und somit in den amtlichen Statistiken überrepräsentiert sind. Sogar innerhalb einer Deliktsgruppe, wie zum Beispiel bei den Diebstahlsdelikten sind Unterschiede im Anzeigeverhalten festzustellen[26]. So steigt generell bei allen Eigentumsdelikten die Anzeigebereitschaft mit der Höhe des Schadens. Ausschlaggebend sind des weiteren Versicherungsschutz und -bedingungen, die Täter-Opfer-Konstellationen, sowie die subjektiv eingeschätzte Schadensschwere mit der Folge, daß sich die registrierte Kriminalität zu den schweren Deliktsformen verschiebt[27].
Gerade für der Bereich der Jugendkriminalität gilt zudem eine Besonderheit, die ich hier bereits erwähne: Damit ein Delikt überhaupt angezeigt werden kann, muß es zunächst einmal von einer anzeigebereiten Person entdeckt werden. Doch nicht allen Delikten wohnt die gleiche Entdeckungswahrscheinlichkeit inne: Delikte wie zum Beispiel Gewalt in der Familie, Betrug, Steuerhinterziehung, Wirtschaftsstraftaten, Umwelt- und Organisierte Kriminalität spielen sich gewöhnlich „hinter verschlossen Türen“ ab. Demzufolge werden sie seltener wahrgenommen, aufgedeckt und damit auch seltener registriert. Hierbei handelt es sich vornehmlich um Delikte, die von Erwachsenen begangen werden. Jugendliche Straftäter hingegen begehen überwiegend spontane und einfach strukturierte Straftaten. Viele ihrer Straftaten werden im öffentlichen Raum und zudem gemeinschaftlich verübt, was die Entdeckungswahrscheinlichkeit und Nachweisbarkeit erheblich erhöht[28]. Dies hat zur Folge, daß Jugendliche gegenüber den Erwachsenen in den Kriminalstatistiken deutlich überrepräsentiert sind.
Und somit bleibt festzuhalten: Das registrierte Hellfeld der amtlichen Kriminalstatistiken ist kein repräsentativer Ausschnitt der „Kriminalitätswirklichkeit“. Veränderungen im Hellfeld lassen keinen direkten Rückschluß auf Veränderungen in der Kriminalitätswirklichkeit zu.
II. Umfang und Bedeutung der Jugendkriminalität
Allein mit den Daten der PKS läßt sich damit ein besorgniserregender Anstieg der Jugendkriminalität nicht belegen. Hinzuziehen sind vielmehr auch die Ergebnisse der sogenannten Dunkelfeldforschung. Insbesondere durch Täter- oder Opferbefragungen ist es möglich, die nicht registrierte Kriminalität zumindest für Teilbereiche begrenzt aufzuhellen. Im Idealfall werden bei Täter- und Opferbefragungen repräsentative Stichproben der Bevölkerung befragt, ob sie während eines bestimmten Zeitraums ein bestimmtes Delikt begangen haben oder Opfer eines solchen wurden. Gemessen wird auch in den Dunkelfeldforschungen damit nicht die Kriminalitätswirklichkeit, sondern allein die Selbstbeurteilung und Selbstauskunft der Befragten in einer vorstrukturierten Befragungssituation[29]. Es „ wird erfasst, wie Befragte bestimmte Handlungen definieren, bewerten, kategorisieren, sich daran erinnern und bereit sind, darüber Auskunft zu geben. “[30]
Ein Dunkelfeld besteht zunächst hinsichtlich der den Behörden nicht bekanntgewordenen Taten. Hierzu gesellt sich allerdings noch das Dunkelfeld der nicht ermittelten Täter. Damit einem in der PKS registrierten Fall ein Tatverdächtiger zugeordnet werden kann, bedarf es der Aufklärung. Besteht bereits durch die Unterschiede in der Anzeigeerstattung eine Verzerrung der registrierten Kriminalität, so ändert eine hohe Aufklärungsrate hieran nichts. Wenn zum Beispiel nur 5% der Ladendiebstähle der Polizei bekannt werden, dann wird auch bei einer über 95% liegende Aufklärungsquote nur eine Aussage über die Tatverdächtigen dieser 5% möglich sein. Aussagen über Tatverdächtige oder Verurteilte, sind damit in der Regel Aussagen über in hohem und unterschiedlichem Maße selektierte Gruppen. Verzerrungen des Kriminalitätsbildes entstehen durch deliktsspezifisch unterschiedliche Anzeige- und Aufklärungswahrscheinlichkeiten und werden darüber hinaus von der Handlungskompetenz und Verteidigungsmacht des Verdächtigen beeinflußt. So finden zum Beispiel Jugendliche zu den schwer aufklärbaren Delikten der Betrugs- und Wirtschaftskriminalität kaum Zugang und sind regelmäßig eher zu einem Geständnis zu bewegen als Erwachsene[31].
Auch mit Hilfe der Dunkelfeldforschung kann also kein exaktes Bild der Kriminalitätswirklichkeit nachgezeichnet werden. Aber mittels des Zusammenspiels von Hell- und Dunkelfelddaten können im folgenden einige kritische Behauptungen näher überprüft werden.
1. Einige Behauptungen über Jugendkriminalität im Lichte der Hellfelddaten
a) Behauptung: Das Ausmaß der Jugendkriminalität steigt bzw. stagniert auf einem hohen Niveau
Bereits seit Einführung einer ersten amtlichen Kriminalstatistik in Deutschland im Jahre 1882 ist die Altersverteilung der Verurteilten durch eine ausgeprägte[32] „Linksschiefe“ gekennzeichnet[33]. Schaubild 3 verdeutlicht diese Linksschiefe ab dem Jahr 1960.
Schaubild 3: Verurteiltenzahlen nach dem Alter
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[34]
Jüngere Straftäter sind also seit jeher in den amtlichen Kriminalstatistiken im Vergleich zu den Vollerwachsenen überrepräsentiert. Dieser Befund wird auch durch Täterbe-fragungen in der Dunkelfeldforschung bestätigt[35]. Einige Gründe für diese Linksschiefe wurden bereits genannte: die höhere Entdeckungswahrscheinlichkeit der Straftaten von Kindern und Jugendlichen, sowie die gegenüber Erwachsenen erhöhte Aussage- und Geständnisbereitschaft junger Menschen[36].
Nun werden viele Aussagen über die Entwicklung von Kriminalität auf den Anstieg der absoluten Zahlen der amtlichen Kriminalstatistiken gestützt. Angesichts der demo-graphischen Veränderungen, der massiven Wanderbewegungen - insbesondere durch Flüchtlinge und Asylbewerber - und den Einbezug der neuen Bundesländer in die PKS sind diese Zahlen absolut ungeeignet für eine Aussage über Veränderungen der Krimi-nalitätsbelastung. Statt die absoluten Zahlen zu betrachten ist es notwendig die Häufig-keitszahlen (HZ) zu berechnen. Hierbei wird die Anzahl der polizeilich registrierten Fälle aller oder einzelner Deliktsgruppen auf 100.000 Einwohner verteilt. Dies setzt voraus, daß die Bezugsgröße, die jeweilige Bevölkerungszahl, hinreichend bekannt ist. Zu Pro-blemen bei der Berechnung führen vor allem die nicht gemeldeten Personen, allen voran die Nichtdeutschen, die - zum Beispiel als Durchreisende, Touristen oder sich illegal Aufhaltende - nicht in der Bevölkerungsstatistik auftauchen. Valide Belastungszahlen lassen sich damit lediglich für die Gruppe der deutschen Tatverdächtigen (TVBZ) und Verurteilten (VBZ) berechnen[37].
Doch auch wenn man die relativen Zahlen betrachtet, so ist ein deutlicher Anstieg der TVBZ für deutsche Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Jungerwachsene zwischen 1984 und 2001 zu verzeichnen. Bei den Vollerwachsenen ist hingegen eine weitgehende Konstanz der TVBZ festzustellen[38]. Hierzu folgende Übersicht:
Übersicht: Veränderungen der Belastungszahlen (TVBZ, VBZ)
Straftaten insgesamt (ohne Strassenverkehr) 1984-2001 Bundesrepublik Deutschland, alte Länder (seit 1991 mit Gesamtberlin); deutsche Tatverdächtige und Verurteilte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[39]
Doch hier können allein die Anstiegsraten ein bedrohliches Gefühl erwecken. Der Umfang jedenfalls nicht. Eine TVBZ von 7.015,5 bedeutet nämlich, daß in einem Jahr 7,0 von 100 deutschen Jugendlichen polizeilich als tatverdächtig registriert worden sind. Verurteilt wurden im Jahr 2001 letztlich nur 1,4 von 100 deutschen Jugendlichen.
Und was das quantitative Ausmaß des Problems der Jugendkriminalität angeht, so kann hier auch eine erste Entwarnung gegeben werden. Jugendliche und Heranwachsende begehen vornehmlich Bagatelldelikte. Sowohl nach der PKS als auch nach der Strafverfolgungsstatistik (StVStat) überwiegen bei Jugendlichen die leichteren Eigentums- und Vermögensdelikte. Es sind die Taten der Erwachsenen, die in der Regel einen weitaus höheren wirtschaftlichen Schaden bewirken als die der Jugendlichen[40]. Die Erwachsenen sind die typischen Täter der Wirtschaftskriminalität, des Drogen- und Menschenhandels, der Umweltkriminalität, der Korruption und Bestechlichkeit, von Gewalt in der Familie, von Versicherungsbetrug und Steuerhinterziehung[41].
b) Behauptung: Die jugendliche Gewaltkriminalität steigt in besorgniserregendem Maße
Das Schaubild 4 über die steigende Entwicklung der Gewaltkriminalität[42] aller Altersgruppen[43] läßt auf den ersten Blick befürchten, daß ein erheblicher Zuwachs im Bereich der Gewaltkriminalität stattgefunden hat.
Schaubild 4:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[44]
Doch trotz großer Zuwachszahlen gilt nach wie vor, daß Gewaltkriminalität in Deutschland kein quantitatives, sondern mehr ein qualitatives Problem ist. Statistisch zählt ein Mord nun mal ebenso viel wie ein Ladendiebstahl[45].
So sind im Jahr 2004 44,6 % aller registrierten Fälle den Diebstahlsdelikten zuzuordnen[46]. Auf die als Gewaltkriminalität definierten Taten entfallen hingegen lediglich 3,2% aller in der BRD polizeilich registrierten Fälle[47]. Der seit 2002 zu verzeichnende Anstieg wird bereits seitens des Bundesministeriums des Inneren (BMI) auf eine erhöhte Anzeigebereitschaft und intensivere Ermittlungen der Polizei zurückgeführt und damit nicht mit einem Anstieg der Kriminalitätswirklichkeit in Verbindung gebracht[48]. Relativiert wird der Anstieg der Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ) zudem durch die Hellfeldstatistik der Verurteiltenbelastungszahlen (VBZ). Nur ein geringer Teil der Tatverdächtigen wird letztlich verurteilt und der zeitliche Längsschnittvergleich zeigt, daß die Relation zwischen Tatverdächtigem und einem Verurteilten immer größer wird[49]. Damit scheinen es zumindest nicht die schweren Gewalttaten zu sein, auf welche der Zuwachs im Hellfeld zurückzuführen ist, sondern im wesentlichen die Delikte minder schwerer Form, die keine Verurteilung nach sich ziehen[50]. So weit zur Entwicklung der Gewaltkriminalität im allgemeinen. Nun aber zu der Gewaltkriminalität Jugendlicher und Heranwachsender im speziellen.
Unterteilt man die TVBZ nach Delikt- und Altersgruppen, wie das folgende Schaubild, so stellt man fest, daß gerade junge Straftäter im Bereich der Gewaltkriminalität einen überproportionalen Anteil der Tatverdächtigen stellen.
Schaubild 5:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[51]
Bei diesen Gewaltdelikten junger Menschen handelt es sich bei jedoch bei ¾ der Taten um „gefährliche Körperverletzungen“ gemäß § 224 StGB. Der Wortlaut läßt vermuten, daß mit diesem Delikt notwendigerweise schwere Verletzungen einhergehen. Dem ist jedoch nicht so, denn neben der Begehung „mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs“ umfaßt § 224 StGB vor allem auch die „gemeinschaftliche Begehung“ – eine Tatbestandsvariante, die gerade bei den oftmals in Gruppen agierenden Jugendlichen zutrifft[52]. Ganz überwiegend sind schwere Verletzungen bei den Gewalttaten Jugendlicher eher selten[53]. Auf 100.000 Kinder kommen in den letzten drei Jahrzehnten im Schnitt 0,1 – 0,5 Tötungsdelikte pro Jahr - bei Jugendlichen sind es zwischen drei und vier - und hierzu zählen wohlgemerkt auch die „lediglich“ versuchten Tötungsdelikte[54].
Hinzu kommt, daß es im Fall von Gewaltdelikten unter Jugendlichen zu erheblichen Überlappungen von Täter- und Opferrollen kommt. Nach einer neueren Studie sind ca. 2/3 der als Gewaltopfer junger Menschen bekannt gewordenen Jugendliche bereits selbst als Tatverdächtige aufgefallen. Bereits seit den siebziger Jahren haben solche Erkenntnisse zu der Überlegung geführt hat, daß das erhöhte Risiko der Täterschaft und des Opferwerdens mit den altersabhängigen Lebensbedingungen und Verhaltensmustern zusammenhängt[55]. Die Gewaltkriminalität junger Menschen soll mit der Feststellung das Jugendliche Gewalt vornehmlich unter ihresgleichen anwenden, nicht verharmlost werden. Aber gerade auch vor dem Hintergrund, daß es eher selten zu schweren Verletzungen kommt, gilt es doch herauszustellen, daß das Phänomen jugendliche Gewaltkriminalität keine gesamtgesellschaftliche Bedrohung darstellt, wie so mancher Gesetzesentwurf, so manch mediale Berichterstattung vermuten läßt.
c) Behauptung: Die Straftäter werden immer jünger und schlimmer
Bereits ein unkommentierter Blick auf die absoluten Zahlen der aktuellen PKS lassen doch starke Zweifel an dieser Annahme aufkommen. So ist der Anteil von Kindern an allen registrierten Tatverdächtigen seit 1999 rückläufig. Und so wurden im Jahr 2004 8,4% weniger Kinder als Tatverdächtige ermittelt als im Vorjahr[56][57].
Zwar haben die relativen TVBZ von Kindern im Altern von 8-14 Jahren zwischen 1987 und 2002 um 68% zugenommen; eine differenzierte Analyse zeigt jedoch, daß die Anstiegsraten vor allem mit dem zunehmenden Alter der Tatverdächtigen steigen, so daß sich die hohen Zuwachsraten vor allem auf die 12-13jährigen beziehen[58].
Die Unterschiede zwischen absoluten Zahlen und den TVBZ lassen zudem vermuten, daß die demographischen Veränderungen einen Grund für die Zuwachsraten bei den relativen Daten sein können. Auf einen jugendlichen Rechtsbrecher kommen im Jahr 2002 im Vergleich zu 1987 nämlich weitaus weniger Nicht-Auffällige[59]. Die Behauptung, daß die Straftäter immer jünger werden, läßt sich damit folglich nicht belegen.
Um auch im Rahmen der Kinderkriminalität auf die Qualität des Problems sprechen zu kommen: 2004 wurden mit 43,5% fast die Hälfte der Tatverdächtigen im Kindesalter wegen Ladendiebstahls registriert[60]. Und auch bei den anderen Fällen der Kinderkriminalität handelt es sich ganz überwiegend Bagatellen, die zumeist äußerst unprofessionell ausgeführt wurden und somit leicht zu überführen sind. Damit ist die gerade die Entdeckung der Kinderkriminalität ganz besonders von der Kontrolldichte abhängig[61]. Und so können in „ Anbetracht des niedrigen Ausgangsniveaus kindlicher Delinquenz (...) bereits geringe Zunahmen des Aufdeckungsrisikos oder der Anzeigehäufigkeit starke Anstiegsquoten auslösen, ohne dass dem entsprechenden Veränderungen in der Wirklichkeit des Delinquenzgeschehens zugrunde liegen müssen. “[62]
Auch für die naheliegende Annahme, es handele sich bei den von Kindern verübten Diebstählen um eine Art Einstiegskriminalität, die im späteren Lebensverlauf zu schwereren Delikten hinführen wird, finden sich keinerlei Anhaltspunkte in der kriminologischen Forschung. Eine Münchner Kohortenstudie stellte heraus, daß ca. 2/3 der nur einmal polizeilich registrierten Jugendlichen wegen eines einfachen Diebstahls registriert wurden. Um so mehr Delikte pro Tatverdächtigem registriert wurden, um so weniger handelte es sich bei deren ersten Delikt um einen einfachen Diebstahl[63].
Und auch hinsichtlich der Gewaltkriminalität von Kindern ist nicht von einer besorgniserregenden Entwicklung auszugehen. Gewaltkriminalität von Kindern richtet sich ganz überwiegend gegen andere gleichaltrige Kinder. Vorsätzliche und/oder ernsthafte Verletzungen werden nur ausnahmsweise verursacht. Waffen oder gefährliche Werkzeuge werden äußerst selten eingesetzt, und wenn doch, so geschieht dies doch meist zum Drohen oder Imponieren[64]. Und so bleibt auch das Vorurteil, die Straftäter würden immer jünger und schlimmer unbestätigt.
d) Zwischenfazit
Mit einem Zitat von Wolfgang Heinz aus dem Jahr 1998 kann auch sieben Jahre später ein treffendes Zwischenfazit gezogen werden: „ Die Annahmen zur Entwicklung der Kriminalität bzw. zur Gewaltkriminalität werden in dieser Allgemeinheit durch die Datenlage nicht gestützt. Die diese Annahmen vertretenden Teile der Politik und der Medien überfolgern die statistischen Daten, sie überschätzen insbesondere deren Aussagekraft. Weder die Komplexität noch die Entstehungsbedingungen der kriminalstatistischen Daten werden hinreichend zur Kenntnis genommen. Durch die Fokussierung auf extreme Einzelfälle und durch die Konzentration auf jugendliche Gewaltkriminalität, durch die lediglich eine Minderheit jugendlicher Straffälliger auffällt, wird Jugendkriminalität dramatisiert, werden die Größenordnungen verfälscht und unnötig Ängste geschürt. “[65]
2. Jugendkriminalität – normal, ubiquitär und episodenhaft
Eine dramatische Entwicklung im Bereich der registrierten Jugendkriminalität ist also nicht festzustellen. Doch wie ist das Phänomen Jugendkriminalität überhaupt - ganz unabhängig von seiner Entwicklung - einzuschätzen?
Nach den Ergebnissen der Dunkelfeldforschung ist zumindest bezogen auf männliche Jugendliche Kriminalität statistisch gesehen normal. Im Durchschnitt geben in Täterbefragungen 80% aller und 90% der männlichen Befragten an, mindestens einmal in ihrem bisherigen Leben, oftmals jedoch auch wiederholt, Handlungen begangen zu haben, die unter eine Norm des StGB oder seiner Nebengesetze subsumiert werden kann[66]. Statistisch gesehen ist es also ganz „normal“ in der Lebensphase Jugend im Bereich der Massen- und Bagatellkriminalität straffällig zu werden. Straffälligkeit im Jugendalter ist also kein Minderheitenphänomen problembelasteter Randgruppen, sondern ubiquitär - durch alle Schichten - verteilt. Jugendkriminalität ist demnach kein Ausdruck von schwerwiegenden Erziehungs- oder Sozialisationsdefiziten, sondern ein alters- und entwicklungsspezifisches Phänomen, welches offenbar in dem konfliktbehafteten Hineinwachsen in die Sozial- und Rechtsordnung der Erwachsenenwelt begründet zu sein scheint[67].
Aus dem Vergleich von registrierten Hellfelddaten und Dunkelfeldbefragungen läßt sich eine weitere Erkenntnis ableiten: Der überwiegende Teil der Jugendkriminalität verbleibt im Dunkelfeld. So normal es im statistischen Sinne ist, als Jugendlicher kriminelle Handlungen zu begehen, so „anormal“ ist es erwischt zu werden. Neuere Untersuchungen gehen davon aus, daß wahrscheinlich nicht mehr als 10% der begangenen Straftaten polizeilich registriert werden[68]. In diesen Fällen kommt es zu keinerlei staatlichen Reaktionen. Und dennoch - vielleicht aber auch gerade deshalb - schlagen die meisten Jugendlichen im weiteren Lebensverlauf keine kriminelle Karriere ein. Sie hören von selbst wieder auf Straftaten zu begehen. Jugendtypische Verfehlungen sind im Lebenslängsschnitt eines Jugendlichen in der Regel ein seltenes, episodenhaftes oder allenfalls in einem zeitlich begrenzten Lebensabschnitt gehäuft auftretendes Ereignis im Rahmen ihres Reifungs- und Anpassungsprozesses[69].
Und so wurde schon im Regierungsentwurf zum 1.JGGÄndG festgehalten: „ Neuere kriminologische Forschungen haben erwiesen, daß Kriminalität im Jugendalter meist nicht ein Indiz für ein erzieherisches Defizit ist, sondern überwiegend als entwicklungsbedingte Auffälligkeit mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter abklingt und sich nicht wiederholt .“[70]
3. Mehrfach- und Intensivtäter
Aber es gibt auch die Mehrfach- und Intensivtäter, die sich dadurch auszeichnen, daß sie über einen längeren Zeitraum und/oder mit mehrfachen Delikten auffallen. Doch handelt es sich bei dieser Tätergruppe keineswegs um eine neuartige Erscheinung - etwa als Folge einer zu laschen Kriminalpolitik in den letzten Jahren. Bereits seit den 70er Jahren genießen sie kriminologisch und kriminalpolitisch besondere Aufmerksamkeit, ohne daß bei dieser Tätergruppe in den letzten Jahrzehnten deutliche Zuwachsraten zu verzeichnen sind[71]. Eine Freiburger Kohortenstudie aus den 70er und 80er Jahren zeigte auf, daß die Zunahme der registrierten Kriminalität nicht auf Zuwächse bei den häufig registrierten Tatverdächtigen zurückzuführen ist, sondern ausschließlich auf die der lediglich einmal oder gelegentlich registrierten Verdächtigen[72]. Bei den sogenannten Mehrfach- und Intensivtätern handelt es sich nach wie vor um eine relativ kleine Minderheit. Ausländische Kohortenstudien stellten fest, daß zwischen 6-10% der registrierten Täter für rund 40-60% aller Taten verantwortlich sind, die für die jeweilige Altersgruppe registriert werden[73]. Nun ließe sich das Problem „Jugendkriminalität“ einfach lösen oder zumindest verringern, wenn diese Tätergruppe frühzeitig zu identifizieren wäre. Denn dann könnte sich die Justiz auf diese Tätergruppe konzentrieren. Und tatsächlich scheint eine Prognose auf den ersten Blick möglich zu sein, denn bei diesen Tätergruppen ist eine starke Problemhäufung, namentlich „Frühauffälligkeit, Herkunft aus sozioökonomisch belasteter Familie, gestörte Erziehungsverhältnisse, Schulstörungen, Lehrabbruch usw.“[74] festzustellen. Den-noch läßt sich eine kriminelle Karriere nicht prognostizieren, denn solche Belastungs-merkmale finden sich auch in beachtlichem Maße bei gering oder überhaupt nicht straf-rechtlich auffälligen Jugendlichen. Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand der Pro-gnoseforschung beträgt der Anteil derjenigen Jugendlichen, denen aufgrund der auf sie zutreffenden Belastungsmerkmale eine „kriminelle Karriere“ vorherzusagen wäre, die eine solche tatsächlich aber gar nicht einschlagen, 50-60%[75]. Damit würde sich mindestens jede zweite Prognose im Hinblick auf eine kriminelle Karriere als falsch erweisen.
Zudem bilden auch die Mehrfach- und Intensivtäter keine homogene Gruppe. Auch Karrieretäter treten zum großen Teil nur während einer begrenzten Altersphase polizeilich in Erscheinung - oft nicht über ein Intervall von zwei bis drei Jahren hinaus[76]. Nur eine kleine Minderheit fällt über fünf oder mehrere Jahre hinaus auf. Karrieren, die sogar das 30. Lebensjahr überdauern, sind äußerst selten vorzufinden. Relativ gehäuft treten sie vor allem bei den Tätern auf, „ die schwerer verurteilt wurden und mehrfach freiheitsentziehende Strafen verbüsst haben. “[77]
Welche äußeren Bedingungen einen Ausstieg aus der kriminellen Karriere begünstigen können, ist nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung nicht ersichtlich. Eine bedeutende Auswirkung auf Entstehung beziehungsweise Fortsetzung einer kriminelle Karriere scheint aber den strafrechtlichen Sanktion zuzukommen. Gerade bei Karrieretätern dürften sich vorsichtige, vernünftige und zurückhaltende Sanktionen noch am ehesten auswirken, „i ndem nämlich Entstehungs- und Stabilisierungsprozesse nicht zusätzlich gefördert werden. “[78]
4. Fazit
Es ist an der Zeit für ein Fazit. Jugendkriminalität ist nicht die große Bedrohung unserer Gesellschaft, wie dies von einigen Vertretern aus Medien, Politik und auch aus den Reihen der Wissenschaft suggeriert wird. Die Grundstrukturen der Jugendkriminalität sind weitestgehend stabil geblieben. Mit diesen Erkenntnissen können wir uns langsam und beruhigt den Reformfragen nähern.
Nun aber einen zunächst einen Blick in das Gesetz. Auf welche Weise reagiert das gegenwärtige JGG eigentlich auf das Phänomen Jugendkriminalität?
D. Einige Blicke ins Gesetz: Grundlagen und -züge des JGG
In diesem Kapitel soll das deutsche Jugendstrafrecht unter besonderer Berücksichtigung seiner wesentlichen Unterschiede zum Erwachsenenstrafrecht dargestellt werden. Es erfolgt ein erster Gesamtüberblick, damit sich die Leser im weiteren Verlauf der Arbeit besser zurechtfinden können. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die einzelnen Regelungen dann vertieft dargestellt.
I. Strafrechtliche Verantwortung und soziale Entwicklung
Erst wenn der Mensch nach seiner Entwicklung reif genug ist, das Unrecht seines Handelns einzusehen (Einsichtsfähigkeit) und fähig ist normgemäß zu handeln (Handlungsfähigkeit), soll er nach unserer Rechtsordnung zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen werden. Strafrechtlich verantwortlich ist ein Täter somit erst dann, wenn er sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich rechtmäßig verhalten, sich für das Recht hätte entscheiden können[79]. „ Die meisten entwicklungspsychologischen Theorien gehen von der Annahme aus, dass diese kognitiven, motivationalen und handlungsexekutiven Vorraussetzungen im frühen Lebensalters noch nicht verfügbar sind. “[80] Der deutsche Gesetzgeber versucht diesen Theorien durch folgende Regelungen zu entsprechen:
- Bis zum Alter von 14 Jahren genießt das Kind absolute Straffreiheit, § 19 StGB.
- Bei Jugendlichen (14-17 Jahren) ist nach § 3 I durch den Richter in jedem Einzelfall zu prüfen, ob der Jugendliche gemäß seiner Entwicklung über die nötige Einsichts- und Handlungsfähigkeit verfügt.
- Da nach Auffassung des Gesetzgebers der Entwicklungsprozeß nicht automatisch mit dem Eintritt der Volljährigkeit endet, sieht das JGG mit § 105 I Nr.1 und Nr.2 zudem eine Öffnungsklausel für Heranwachsende (18-21 Jahre) vor: Stellt der Richter fest, daß eine erhebliche Reifeverzögerung vorliegt, oder es sich bei der Tat des Heranwachsenden um eine typische Jugendverfehlung handelt, so ist auch für ihn das Jugendstrafrecht - allerdings mit einigen Einschränkungen - anzuwenden.
II. Das jugendstrafrechtliche Sanktionssystem
In Deutschland gibt es kein eigenständiges materielles Jugendstrafrecht. Statt dessen gelten auch gegenüber den Jugendlichen und Heranwachsenden die Straftatbestände des StGB. Wesentliche Unterschiede zum allgemeinen Strafrecht bestehen allerdings auf der Rechtsfolgenseite - bei den Sanktionen[81]. Statt dem starren Sanktionssystem des StGB gilt im Jugendstrafrecht das flexible, dreigliedrige Rechtsfolgensystem aus Erziehungsmaßregeln, Zuchtmitteln und Jugendstrafe, § 5 I.
Die Erziehungsmaßregeln (§ 5 I in Verbindung mit §§ 9ff.) werden vom Jugendrichter aus Anlaß der Straftat angeordnet. Ihr Zweck dient allerdings nicht der Ahndung der Tat, sondern der Erziehung des Täters. Dieser soll Verhaltensweisen erlernen, die ihm künftig ein konformes Verhalten ermöglichen. Gemäß § 9 unterteilen sich die Erziehungsmaßregeln in Weisungen und die Anordnung Hilfen zur Erziehung nach dem Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) anzunehmen. In der Praxis überwiegen die Weisungen nach § 10. Die in dieser Vorschrift aufgezählten Weisungen haben nur Beispielscharakter. Damit ist dem Jugendrichter die Möglichkeit eröffnet auf individuelle Erziehungsbedürfnisse zu reagieren.
Zuchtmittel sind nicht etwa die härteren Erziehungsmaßregeln, wie der Wortlaut des § 5 II vermuten läßt; sie verfolgen einen gänzlich anderen Zweck. Zuchtmittel dienen der Ahnung der Tat und sollen dem Täter das Unrecht der Tat und die damit verbundenen Folgen vor Augen führen, § 13 I. Nach § 13 II lassen sich die Zuchtmittel in Verwarnungen, Auflagen und den Jugendarrest unterteilen. Mit dem Jugendarrest nach § 16 erhalten die Zuchtmittel schon eine (kurzfristige) stationäre Maßnahme mit einer Höchstdauer von vier Wochen. Er kann als Dauerarrest, Freizeit- oder Kurzarrest verhängt werden. Der Arrest soll primär Ausgleich für begangenes Unrecht sein. Durch die erzieherische Ausgestaltung des Vollzugs aber auch der Besserung des Jugendlichen dienen, § 90.
Die Jugendstrafe gemäß § 17 ist die schärfste Sanktion des Jugendstrafrechts und damit letztes Mittel - ultima ratio. Sie ist entweder wegen denen in der Tat hervorgetretenen „schädlichen Neigungen des Jugendlichen“ oder „wegen der Schwere der Schuld“ zu verhängen. Im Gegensatz zu den verschiedenen Strafrahmen des allgemeinen Strafrechts, gilt im Jugendstrafrecht ein einheitlicher, deliktsunabhängiger Strafrahmen (§ 18).
Das Jugendstrafrecht gewährt dem Richter sowohl die ganze Strafe (§ 21) als auch einen Strafrest (§ 88) zur Bewährung auszusetzen. Zusätzlich kennt das JGG das besondere Institut der Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe (§ 57ff.).
III. Das Absehen von einer formalen Strafe – die Diversion
Gerade im Jugendstrafrecht wird allerdings oft auf eine formale Strafe verzichtet. Vor allem bei Ersttätern und geringfügigen Verstößen wird in großem Ausmaß Nachsicht mit dem Täter geübt[82]. Die sogenannte Diversion (Einstellungsmöglichkeiten gemäß §§ 45, 47) hat im JGG eine, gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht, herausgehobene Stellung. Vor allem in den letzten Jahren hat die Diversion erheblich an Bedeutung gewonnen, so daß heute der überwiegende Teil der jugendstrafrechtlichen Verfahren gemäß §§ 45, 47 außerhalb einer Hauptverhandlung erledigt wird[83].
IV. Besonderheiten im Jugendstrafverfahren
Das Jugendstrafverfahren orientiert sich an der für die Erwachsenen geltenden Strafprozeßordnung (StPO). Das JGG sieht aber eine ganze Reihe besonderer Verfahrensregelungen für Jugendliche vor.
- Durch die Einrichtung von Jugendgerichten (§ 33) mit besonderen Spruchkörpern wird die erzieherische Kompetenz der Justiz gestärkt.
- Im Jugendstrafverfahren haben der Erziehungsberechtigte und der gesetzliche Vertreter eine eigenständige Verfahrensposition neben dem Jugendlichen (§ 67). Das Jugendstrafrecht geht davon aus, daß den Eltern häufig eine Mitverantwortung für die jugendlichen Straftaten zukommt, so daß diese zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung verpflichtet werden können (§ 50 II).
- Der jugendliche Straftäter wird im Verfahren als besonders hilfebedürftig angesehen. Zur besonderen Unterstützung des Jugendlichen im Verfahren sind die Eltern beziehungsweise die Erziehungsberechtigten sowie die Jugendgerichtshilfe aufgefordert.
- Die Öffentlichkeit ist in der Regel von der jugendstrafrechtlichen Hauptverhandlung ausgeschlossen (§ 48 I).
- In der Urteilsbegründung müssen die Persönlichkeit des Angeklagten, seine Entwicklung und sein soziales Umfeld umfassend gewürdigt werden (§ 54 I).
- Die Hauptverhandlung kann durch die Wahl des „vereinfachten Jugendstrafverfahrens“ abgekürzt werden, wo der Richter von einigen prozessualen Förmlichkeiten freigestellt ist (§§ 76-78).
V. Das Rechtsmittelverfahren
Im vermeintlichen Interesse der Erziehung wird im Rechtsmittelverfahren ganz auf das Beschleunigungsprinzip gesetzt. So können Urteile, in denen lediglich Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel angeordnet sind, nicht mit der Begründung angefochten werden, es seien andere Sanktionen angebracht gewesen. Darüber hinaus ist abweichend vom Strafverfahren gegen Erwachsene im Verfahren nach dem JGG nur ein Rechtsmittel – Berufung oder Revision – möglich (§ 55).
VI. Vollstreckung und Vollzug
Besonderheiten bestehen schließlich auch im Bereich der Vollstreckung und des Vollzuges der jugendstrafrechtlichen Sanktionen. So werden die Sanktionen nur sehr begrenzt in das Bundeszentralregister (BZRG) aufgenommen und es bestehen Auskunftsbeschränkungen, um Stigmatisierungen zu vermeiden. Der Jugendstrafvollzug ist getrennt vom Erwachsenenstrafvollzug durchzuführen und erzieherisch auszugestalten (§§ 91 ff.).
E. Die Geschichte des Jugendstrafrechts in Deutschland
Wie ist es zu diesen Besonderheiten im Jugendstrafrecht überhaupt gekommen? Seit wann besteht überhaupt ein eigenständiges Jugendstrafrechts in Deutschland? Und wie hat es sich im Laufe der Jahre verändert? Und warum hat es sich verändert?
Ein historischer Überblick über die Geschichte des deutschen Jugendstrafrechts soll diese Fragen beantworten. Grundlagenwissen, daß im weiteren Verlauf der Arbeit den Lesern hoffentlich dabei helfen wird, Sinn und Zweck der einzelnen Regelungen besser zu verstehen.
I. Auf der Suche nach einem Anfang
Wie bereits erläutert hat der deutsche Gesetzgeber mit dem JGG ein Gesetz erlassen, daß den besonderen Umständen der Lebensphase Jugend im strafrechtlichen Kontext Rechnung tragen soll. Ein eigenständiges Sonderstrafrecht für Kinder- und Jugendliche trat in Deutschland erstmals mit dem RJGG am 16.02.1923 in Kraft. Der Gesetzgeber reagierte damit auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse und gesellschaftlichen Umbrüche der Jahrhundertwende. In der Praxis erfolgte diese Reaktion schon viel eher[84] :
Schon am 1. Januar 1908 wurde in Frankfurt im Wege der Geschäftsverteilung ein Schöffengericht ausschließlich mit Jugendsachen befaßt. Diesem ersten Jugendgericht nach amerikanischem Vorbild, dem Cook County Juvenile Court in Chicago, folgten bis 1912 mehr als 200 weitere Jugendgerichte im Deutschen Reich[85]. Neben der strafrechtlichen Aburteilung der Täter wurden diesen neuen Spruchkörpern auch die vormundschaftlichen Erziehungsaufgaben anvertraut[86].
1912 wurde dann in Wittlich das erste deutsche Jugendgefängnis errichtet, um einen „jugendgemäßen Erziehungsstrafvollzug“ zu ermöglichen[87].
Grund für diese fast zeitgleiche Entstehung von Jugendgerichten und -gefängnissen fernab einer gesetzlichen Grundlage waren vor allem zwei gesellschaftliche Strömungen, die ihren Ursprung bereits im späteren 19. Jahrhundert hatten: Die Entdeckung der selbstständigen Lebensphase Jugend und Kindheit und die Begründung der „modernen Schule“ des Strafrechts.
1. Die Entdeckung der eigenständigen Lebensphasen Kindheit und Jugend
Schon die „Peinliche Gerichtsordnung“ von 1532 ging von der Annahme aus, daß junge Straftäter geringer verantwortlich als Erwachsene und dementsprechend auch milder als diese zu bestrafen sind. Kinder und Jugendliche wurden nach der Überwindung einer ersten unmündigen Phase als „kleine“ oder „halbe“ Erwachsene angesehen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein findet sich diese Auffassung in verschiedenen Gesetzen in Form von Strafmilderungen immer wieder[88]. Und so enthielt noch das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 lediglich Bestimmungen zur Strafmündigkeit und zur Strafmilderung bei Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren. Dann jedoch begann ein gesellschaftlicher Prozeß des Umdenkens in dessen Verlauf sich mehr und mehr eine differenzierte Wahrnehmung über die Lebensphase Kindheit und Jugend herausbildete. Die Jugend wurde dabei zunehmend als eigenständige Statuspassage zwischen Kindheit und Erwachsensein wahrgenommen. Es entstand das soziale Konstrukt Jugend und mit ihm wurde ein Entwicklungs- und Schonraum errichtet, in welchem die Jugendlichen die Normen der Erwachsenenwelt allmählich durch sorgfältige Erziehung erlernen sollten[89]. Hiermit ging allerdings auch die Ausbreitung eines neuen Systems sozialer Kontrolle einher[90]. Neben dem Ausbau und der Ausdifferenzierung des staatlichen Schulsystems wurden zahlreiche Jugendschutzgesetze erlassen, Arbeitsvermittlungen und Wohlfahrtseinrichtungen eröffnet. Es folgte ein stetiger Wachstum von Jugendorganisationen, die das Ziel verfolgten, den Jugendlichen außerhalb von Schule und Arbeit zu erreichen[91]. Die Errichtung von Jugendgerichten und Jugendgefängnissen ist somit lediglich als ein Baustein dieser Gesamtentwicklung anzusehen.
2. Die Begründung der „modernen Schule“ des Strafrechts
Die für die Entstehung des RJGG zweite bedeutende Entwicklung Ende des 19. Jahrhunderts war die Entstehung der „modernen Schule“ des Strafrechts. 1882 veröffentlichte Franz von List sein „Marburger Programm“ und wand sich hierin entschieden von der absoluten Straftheorie der reinen Tatvergeltung ab. Ausgehend von der damaligen kriminologischen Ursachenforschung über die Störfaktoren des Normlernens konzentrierte von List seinen Blick auf den Täter und damit auch auf sein (jugendliches) Alter[92]. Die Frage der „richtigen“ Behandlung des Täters und dessen (Re-)Sozialisierung gewann nun zunehmend an Bedeutung. Dies insbesondere bei der Gruppe der Jugendlichen, die für eine erzieherische (Re-)Sozialisierung als besonders geeignet erschienen[93].
3. Die Jugendgerichtsbewegung
Während also diese Veränderungen im gesellschaftlichen Denken stattfinden, trat um das Jahr 1890 die sogenannte Jugendgerichtsbewegung in Deutschland auf. Insbesondere unter dem Eindruck positiver Erfahrungen aus einer Verbindung strafender und erzieherischer Maßnahmen in den USA und England verlangte die Jugendgerichtsbewegung nun ausdrücklich eine rechtliche Sonderbehandlung jugendlicher Täter[94]. Mit Erfolg, denn wie beschrieben wurden ab 1908 die ersten Jugendgerichte und Jugendgefängnisse in Deutschland errichtet und ab 1909 fanden dann regelmäßig Jugendgerichtstage der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe statt, wobei erste Entwürfe für ein eigenständiges Jugendkriminalrecht entstanden[95].
II. Das RJGG von 1923
Nachdem 1922 bereits das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) erlassen wurde, reagierte am 16.02.1923 der Gesetzgeber nun auch im strafrechtlichen Bereich auf die beschriebenen Entwicklungen und erließ das RJGG. Mit der Trennung von RJWG und RJGG hat sich der historische Gesetzgeber für ein „duales System“ aus Jugendhilfe- und Jugendstrafrecht und gegen ein einheitliches Jugendkonfliktrecht entschieden. Die wichtigsten Regelungen des RJGG1923 sind[96] :
- die Anhebung der absoluten Strafmündigkeitgrenze von 12 auf 14 Jahre,
- die Einführung der relativen Strafmündigkeit für die Altersgruppe der 14-18jährigen,
- die Anbindung an den Straftatenkatalog des allgemeinen Strafrechts aber die Möglichkeit der Strafmilderung gemäß § 9 RJGG,
- die Einführung der Strafaussetzung zur Bewährung,
- den Einbezug der Jugendgerichtshilfe in das Strafverfahren,
- die Einführung eines besonderen Strafverfahrens, bei dem Einschränkungen des Legalitätsgrundsatzes sowie der Ausschluß der Öffentlichkeit jugendspezifische Bedürfnisse erfüllen sollen,
- die Einführung der Erziehungsmaßregeln.
[...]
[1] Albrecht, Gutachten, S. 16.
[2] BT-Drs. 11/7421, S.3.
[3] Käppner, S.2.
[4] Zellner, Seite 6.
[5] Kunz, § 1 Rn.9f.
[6] Heinz, KIK, S.9.
[7] Kunz, § 5 Rn.3.
[8] Böhm/Feuerhelm, S.1.
[9] Böhm/Feuerhelm, S.1.
[10] Böhm/Feuerhelm, S.2.
[11] folgende §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des JGG.
[12] BR-Drs. 312/03, S.1.
[13] Heinz, KIK, S.12.
[14] Heinz, KIK, S.13.
[15] Heinz, KIK, S.19.
[16] Schwind/Fetchenhauer/Ahlborn/Weiß, S. 158.
[17] Schwind/Fetchenhauer/Ahlborn/Weiß, S. 140.
[18] Heinz, KIK, S.16, vgl. auch Schaubild auf Seite 10.
[19] Heinz, KIK, S.20.
[20] Walter, DVJJ 4/1996, S. 337.
[21] Heinz, MschrKrim 6/1998, S.406.
[22] Heinz, KIK2002, Schaubild 2.
[23] Heinz, KIK, S.18.
[24] Heinz, KIK, S.18.
[25] Heinz, KIK2002, Schaubild 3.
[26] vgl. oben: Schaubild 1, S.10.
[27] Heinz, KIK, S.16f.
[28] Heinz, KIK, S.16.
[29] Heinz, KIK, S.13ff.
[30] Heinz, KIK, S.15.
[31] Heinz, DVJJ 3/2002, S. 278.
[32] BR-Drs. 312/03, S.1; Wagner, S.206.
[33] Heinz, KIK, S.33.
[34] Heinz, KIK20002, Schaubild 8.
[35] Heinz, KIK, S.33.
[36] vgl. oben S.12 und S.13.
[37] Heinz, KIK, S.31f.
[38] Heinz, KIK, S.39.
[39] Heinz, KIK, S.39.
[40] Heinz, KIK, S.38.
[41] Heinz, KIK, S.37.
[42] BR-Drs. 312/03, S.1; Wagner, S.206.
[43] Unter dem Gewaltbegriff der PKS werden zusammengefaßt: Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Kindestötung, Vergewaltigung, Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung mit tödlichem Ausgang, gefährliche und schwere Körperverletzung sowie Vergiftung, erpresserischer Menschenraub, Geiselnahme, Angriff auf den Luftverkehr.
[44] Heinz, KIK2002, Schaubild 18.
[45] Heinz, MschrKrim 6/1998, S.404.
[46] BMI, PKS 2004, S.5.
[47] BMI, PKS 2004, S.31.
[48] BMI, PKS 2004, S.31.
[49] Heinz, KIK, S.50.
[50] Heinz, KIK, S.52.
[51] Heinz, KIK2002, Schaubild 10.
[52] Heinz, KIK, S.50.
[53] Heinz, KIK, S.48.
[54] Albrecht, Gutachten, S.27.
[55] Albrecht, Gutachten, S.30.
[56] z.B.: Hinz, ZRP 3/2000, S.108.
[57] BMI, PKS 2004, S.14.
[58] Heinz, KIK, S.68
[59] Heinz, KIK, S.68.
[60] BMI, PKS 2004, S.55.
[61] Heinz, MschrKrim 6/1998, S.407.
[62] BMI/BMJ, Sicherheitsbericht, S. 517.
[63] Elsner, Steffen, Stern, S.120.
[64] Heinz, MschrKrim 6/1998, S.408.
[65] Heinz, MschrKrim 6/1998, S.412f. .
[66] Überblick zu verschiedenen Studien bei Heinz, KIK, S.70.
[67] Heinz, KIK, S.71.
[68] Sutterer/Karger, S.163.
[69] Heinz, KIK, S.71.
[70] BT-Drs.11/5829, S.1.
[71] Albrecht, Gutachten, S.32f.
[72] hierzu: Albrecht, Gutachten, S.33.
[73] Überblick zu verschiedenen Studien bei Heinz, KIK, S.77.
[74] Heinz, KIK, S.80; siehe auch: Löhr, S.281.
[75] Heinz, KIK, S.81.
[76] Löhr, S.282.
[77] Heinz, KIK, S.79.
[78] Albrecht, Gutachten, S.34.
[79] BGHSt 2, 194 (200).
[80] Weinert, S.151.
[81] Rössner -MRS, § 1 Rn.22.
[82] Ostendorf, ZJJ 1/2004, S.9.
[83] Albrecht, Gutachten, S.13.
[84] Rössner -MRS, § 2 Rn. 6f..
[85] Schüler-Springorum, S.826.
[86] Schlüchter, S. 16.
[87] Schüler-Springorum, S.826.
[88] Böhm/Feuerhelm, S.3.
[89] Rössner -MRS, § 2 Rn.6.
[90] v. Trotha, S.258.
[91] v. Trotha, S.260.
[92] Rössner -MRS, § 2 Rn.6.
[93] Schlüchter, S.8.
[94] Schlüchter, S.10.
[95] Rössner -MRS, § 2 Rn.6.
[96] nach Rössner -MRS, § 2 Rn.7ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (Paperback)
- 9783836600903
- ISBN (eBook)
- 9783956361487
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – 6, Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften, Studiengang Erziehungswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2007 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- jugendstrafrecht sozialpädagogik strafrecht jugendkriminalität kriminologie
- Produktsicherheit
- Diplom.de