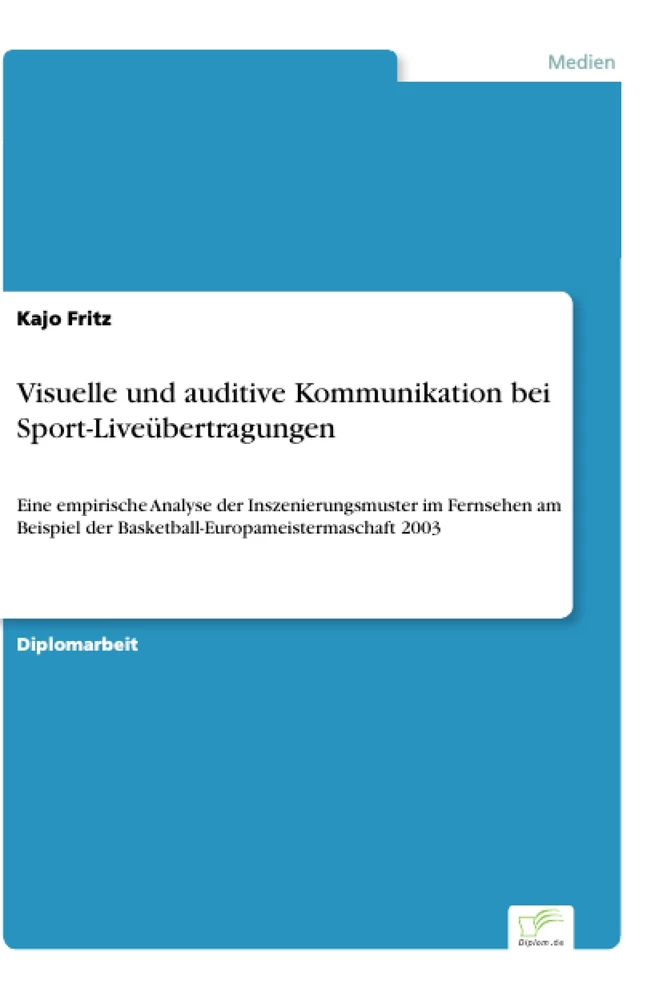Visuelle und auditive Kommunikation bei Sport-Liveübertragungen
Eine empirische Analyse der Inszenierungsmuster im Fernsehen am Beispiel der Basketball-Europameistermaschaft 2003
©2005
Diplomarbeit
125 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die grundsätzliche Intention dieser Arbeit besteht in der Beantwortung der Frage, auf welche produktionstechnische Weise die Inszenierung der Sportart Basketball im deutschen Fernsehen umgesetzt wird. Zu klären gilt, wie bei Direktübertragungen eine Randsportart audiovisuell abgebildet wird. Um diesem Punkt zu genügen, wird eine Analyse des Medienreizes (TV-Signal) unternommen, wobei dieser in den analogen Reiz (Bild) und den digitalen Reiz (verbalisierter Text/Kommentar) ausdifferenziert wird. Dies ist der Ansatz, um den jeweiligen Inszenierungsgrad der so destillierten Reize vergleichend gegenüberzustellen. Zu analysierende Gegenstände der medialen Inszenierung sind in dieser Untersuchung die Ästhetisierung, die Dramatisierung/Emotionalisierung und die Personalisierung.
Geklärt werden soll, inwiefern diese drei Inszenierungs-Faktoren zur möglichen Profilbildung und Produktqualitätsverbesserungen mittels der visuellen und auditiven Kommunikation eingesetzt werden und - in diesem Zusammenhang besonders interessant - ob diese durch die beiden Untersuchungsfelder harmonisch umgesetzt werden. Analysiert wird hierzu die Basketball-Europameisterschaft 2003 der Männer in Schweden. Beim journalistischen Stilmittel der Personalisierung wird ausschließlich der deutsche Basketball-Nationalspieler Dirk Nowitzki bei diesem Turnier eingehend betrachtet.
Der audiovisuelle Reiz, der über das TV-Signal den Zuschauern eines Fernsehprogramms geboten wird, kann sowohl aus der Perspektive der visuellen und wie auch der auditiven Kommunikation gesehen werden. Dabei haben das Bild und der Kommentar (auf den sich in dieser Betrachtung der digitalen Kommunikation ausschließlich bezogen wird) medienpsychologisch und physiologisch grundsätzlich unterschiedliche Funktionen. Thomas Schierl beschreibt in seinem Buch Text und Bild in der Werbung die unterschiedlichen Wirkungen des analogen (visuellen) und digitalen (in diesem Fall auditiven) Codes auf den Rezipienten. Im folgendem klärt der Autor, inwieweit a) sich Bild und Text in ihrem Wesen und in ihren Kommunikationsmöglichkeiten unterscheiden, b) das eine zum anderen eher Komplement als Konkurrent ist und c) es ganz bestimmte Interdependenzen zwischen Text und Bild gibt. Diese theoretischen Grundlage zum Muster wird nun die Live-Berichterstattung beim Basketball untersucht.
Mittels dieses wissenschaftlichen Untersuchungsblickwinkels sollen nun die Inszenierungs-Bestrebungen der […]
Die grundsätzliche Intention dieser Arbeit besteht in der Beantwortung der Frage, auf welche produktionstechnische Weise die Inszenierung der Sportart Basketball im deutschen Fernsehen umgesetzt wird. Zu klären gilt, wie bei Direktübertragungen eine Randsportart audiovisuell abgebildet wird. Um diesem Punkt zu genügen, wird eine Analyse des Medienreizes (TV-Signal) unternommen, wobei dieser in den analogen Reiz (Bild) und den digitalen Reiz (verbalisierter Text/Kommentar) ausdifferenziert wird. Dies ist der Ansatz, um den jeweiligen Inszenierungsgrad der so destillierten Reize vergleichend gegenüberzustellen. Zu analysierende Gegenstände der medialen Inszenierung sind in dieser Untersuchung die Ästhetisierung, die Dramatisierung/Emotionalisierung und die Personalisierung.
Geklärt werden soll, inwiefern diese drei Inszenierungs-Faktoren zur möglichen Profilbildung und Produktqualitätsverbesserungen mittels der visuellen und auditiven Kommunikation eingesetzt werden und - in diesem Zusammenhang besonders interessant - ob diese durch die beiden Untersuchungsfelder harmonisch umgesetzt werden. Analysiert wird hierzu die Basketball-Europameisterschaft 2003 der Männer in Schweden. Beim journalistischen Stilmittel der Personalisierung wird ausschließlich der deutsche Basketball-Nationalspieler Dirk Nowitzki bei diesem Turnier eingehend betrachtet.
Der audiovisuelle Reiz, der über das TV-Signal den Zuschauern eines Fernsehprogramms geboten wird, kann sowohl aus der Perspektive der visuellen und wie auch der auditiven Kommunikation gesehen werden. Dabei haben das Bild und der Kommentar (auf den sich in dieser Betrachtung der digitalen Kommunikation ausschließlich bezogen wird) medienpsychologisch und physiologisch grundsätzlich unterschiedliche Funktionen. Thomas Schierl beschreibt in seinem Buch Text und Bild in der Werbung die unterschiedlichen Wirkungen des analogen (visuellen) und digitalen (in diesem Fall auditiven) Codes auf den Rezipienten. Im folgendem klärt der Autor, inwieweit a) sich Bild und Text in ihrem Wesen und in ihren Kommunikationsmöglichkeiten unterscheiden, b) das eine zum anderen eher Komplement als Konkurrent ist und c) es ganz bestimmte Interdependenzen zwischen Text und Bild gibt. Diese theoretischen Grundlage zum Muster wird nun die Live-Berichterstattung beim Basketball untersucht.
Mittels dieses wissenschaftlichen Untersuchungsblickwinkels sollen nun die Inszenierungs-Bestrebungen der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kajo Fritz
Visuelle und auditive Kommunikation bei Sport-Liveübertragungen
Eine empirische Analyse der Inszenierungsmuster im Fernsehen am Beispiel der
Basketball-Europameistermaschaft 2003
ISBN: 978-3-8366-0088-0
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Deutsche Sporthochschule Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
Abkürzungsverzeichnis
1
Einleitung ... 1
1.1
Zielsetzung und Aufbau... 2
2
Bild und Text... 8
2.1
Der analoge Code ... 9
2.2
Der digitale Code... 15
2.3
Interaktion des analogen und digitalen Codes... 17
3
Der audiovisuelle Medienreiz... 20
3.1
Sport und Fernsehen... 26
3.2
Sportsprache ... 29
3.3
Der Kommentar ... 32
4
Darstellungsformen des Sports im Fernsehen... 36
4.1
Die Liveübertragung ... 37
4.2
Die Bildführung ... 38
5
Mediale Inszenierung von Sportereignissen ... 42
5.1
Ästhetisierung beim Fernsehsport ... 46
5.2
Dramatisierung beim Fernsehsport ... 49
5.3
Personalisierung beim Fernsehsport ... 51
6
Dirk Nowitzki ... 54
7
Hypothesen ... 56
8
Untersuchung ... 61
8.1
Design und Methode ... 61
8.2
Kategoriensystem... 65
8.3
Untersuchungsgegenstand... 72
8.4
Auswertungsverfahren... 74
9
Hypothesendiskussion... 76
9.1
Zusammenfassung ... 89
10
Interpretation der Ergebnisse ... 92
11
Fazit ... 97
12
Literaturverzeichnis ... 101
13
Abbildungsverzeichnis ... 113
14
Tabellenverzeichnis ... 114
15
Anhang... 116
15.1 Ergebnisübersicht... 116
Abkürzungsverzeichnis
A
Abb.
Abbildung
ARD
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland
B
bzw.
beziehungsweise
bes.
besonders
Bsp.:
Beispiel:
C
ca.
circa
D
d.h.
das
heißt
E
ebd.
ebendort
Einst.
Einstellung
etc.
et
cetera
F
f. folgende
Seite
ff. fortfolgende
Seiten
G
ggf.
gegebenenfalls
H
Hrsg.
Herausgeber
I
IT-Ton
International
Sound,
d.h. Außengeräusche und Stadionansage
K
Kap.
Kapitel
K.F.
Kajo
Fritz
N
NBA
National Basketball Association
Nr.
Nummer
S
S.
Seite
s. siehe
Sek.
Sekunde
Sp.
Spiel
T
TV
Television
V
vgl.
vergleiche
Z
z.B.
zum Beispiel
ZLW
Zeitlupenwiederholungen
1
E
I N L E I T U N G
1 Einleitung
,,Fernsehen ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Fernsehen",
pointierte einst Sportjournalist Rudi Michel (1989: 81) das mediale
Wirkgefüge. Auch im neuen Jahrtausend hat sich am Sinngehalt des
Bonmots vom ehemaligen Sport-Chef des Südwestfunks nichts
geändert. Die publizistische Hackordnung sieht das Fernsehen an
exponierter Stelle. Dies ist allbekannt, auch an Sportlern
1
und der
Sportorganisation ist dieses Wissen nicht vorüber gegangen. Ohne TV-
Zuspruch ist es unmöglich, sich am Sportmedien-Markt zu behaupten.
Das Fernsehen schürt Interesse, generiert Zuschauer und spült
Werbe- und TV-Gelder in die Kassen. Ein Sport, der medial nicht
transportiert wird, ,,hat für die Öffentlichkeit gar nicht stattgefunden"
(B
INNEWIES
1983b: 121). Im Schatten der Fernsehkameras
unbeleuchtet transzendiert ein Sportereignis nach Hoffmann-Riem
,,zum Nichtereignis" (1988: 12). Demgegenüber lockt der Sport das
Fernsehen; einzigartig die mediale Konstellation mit der Offenheit des
Ausgangs, der genuinen Attraktivität des Spiels und dessen
Protagonisten. Nicht zu vergessen die grundsätzlich überschaubaren
Produktionskosten (Gelder für den Erwerb z.B. an Fußball-Rechten
sind hierbei explizit ausgeklammert). Der Sport bietet ein
schichtenübergreifendes Verständigungsmuster, das als
Medienphänomen seinesgleichen sucht. Obwohl zigmal gesehen:
Sport im TV ist immer eine Uraufführung.
Inwiefern Massenkommunikationsmittel wie das Fernsehen die
Wirklichkeit verzerren respektive entfremden ist eine der
heißdiskutierten Fragen der Kommunikationswissenschaft. Dies gilt mit
Sicherheit auch für den Bereich der Sportpublizistik. Mediale
Überhöhung liefert den Rezipienten vor den Bildschirmen eine
inszenierte Realität.
Angespornt von einem Leben zwischen praktischem Spiel,
theoretischem Wissen, journalistischer Aufarbeitung und
1
Nachfolgend wird aufgrund besserer Lesbarkeit und Schreibökonomie auf die nötige feminine
Form verzichtet.
2
E
I N L E I T U N G
wissenschaftlicher Erkenntnisse ist es nur folgerichtig, dass sich der
Autor bei seiner Abschlussarbeit dieses Themas annimmt: Der
medialen Inszenierung des Basketballs in Deutschland.
Doch das Feld scheint schwierig zu bestellen: ,,[...] es gibt nur wenig
Untersuchungen zur visuellen Darstellung des Sports in den Medien.
Das mag u.a. auch damit zusammenhängen, dass die Forschung im
Bereich der Bildkommunikation generell nur höchst rudimentär
ausgebildet und durch starke Defizite gekennzeichnet ist" (S
CHIERL
2004a: 7f.). Im Bereich der Sprache wiederum stößt man auf das
Problem einer Theorienvielfalt, die keinen übergeordneten Konsens in
der Sprachwissenschaft erkennen lässt (vgl. M
UCKENHAUPT
1986: 4ff.).
Dementsprechend generell stehen Untersuchungen zur Text-Bild-
Kommunikation wissenschaftlich noch am Anfang. Manfred
Muckenhaupt betont gar den ,,Wagemut zu übergreifenden
Vergleichen" (1986: 4). Aber dieser Versuch scheint lohnenswert.
Die vorliegende Arbeit soll mittels intensiver, kritischer Betrachtung der
Liveübertragungen einer ,,Randsportart" im Massenmedium Fernsehen
näher kommen. Die Intention besteht in der Beantwortung der Frage,
auf welche produktionstechnische Weise die Inszenierung der Sportart
Basketball im deutschen Fernsehen geschieht. Um diesem Punkt zu
genügen, wird eine Analyse des Medienreizes TV-Signal
unternommen, wobei dieser in den visuellen Reiz (Bild) und den
auditiven Reiz (Kommentar) ausdifferenziert wird. Dies ist der Ansatz,
um die destillierten Reize in ihrem Streben nach Inszenierung
vergleichend gegenüberzustellen. Untersucht werden hierzu die Spiele
der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Herren bei der
Europameisterschaft 2003.
1.1
Zielsetzung und Aufbau
Der audiovisuelle Reiz, der über das TV-Signal den Zuschauern eines
Fernsehprogramms geboten wird, kann sowohl aus der Perspektive
der visuellen als auch der auditiven Kommunikation gesehen werden.
Dabei haben das Bild (analoger Code) und der Kommentar (digitaler
3
E
I N L E I T U N G
Code) grundsätzlich unterschiedliche Funktionen. Dieser Grundlage
zum Muster wird anhand eines Beispiels die Live-Berichterstattung
beim Basketball untersucht. Mittels dieses Untersuchungsblickwinkels
sollen die Inszenierungs-Bestrebungen der übertragenden Sender
innerhalb der Einzelreize Text und Bild aufgeschlüsselt werden. Folgen
angewandter filmischer Inszenierungen kann Profilbildung in Form
einer Ausdifferenzierung gegenüber anderen Sportarten und/oder eine
Produktqualitätsverbesserung sein.
Die Inszenierung wird in die Bereiche a) Ästhetisierung, b)
Dramatisierung und c) Personalisierung segmentiert.
2
Zu a): Thomas Schierl liefert in seinem Aufsatz ,,Ästhetisierung
als produktpolitisches Instrument medial vermittelten Sports" (vgl.
2004b) die theoretische Basis dieser Betrachtung. Von den drei
Ästhetisierungsbereichen der Mikroebene (Sportakteure), Mesoebene
(Veranstalter, Sportklubs) und Makroebene (Mediensport) wird aus der
Untersuchungslogik dieser Diplomarbeit heraus nur auf die
letztgenannte eingegangen.
Der Autor beschreibt die exogene Ästhetisierung auf der Makroebene
durch die Gestaltungskriterien Bild, Graphik, Sound und Kommentar
(vgl. Kap. 5.1). Der Sound (u.a. IT) wird in der vorliegenden Arbeit
indes aus Gründen des technischen Realisation ausgeklammert.
Determiniert wird die Ästhetisierung auf der Seite des analogen Codes
anhand entsprechender Bildgestaltung. Es gilt, dass durch
regietechnische Umsetzungen in Form von Großeinstellungen (Close
Ups) und Zeitlupenwiederholungen (Slow Motions)
3
einer
Ästhetisierung Vorschub geleistet werden soll. Diese
Bildmanipulationen sind gestalterische Mittel zur Ästhetisierung. Hinzu
kommen graphische Elemente wie Informationstafeln und
Insertierungen. ,,Vordergründig wird graphischen Elementen bei der
Übertragung von Sportereignissen die Aufgabe zugewiesen, die
Decodierung des Bildes und das Verständnis für das Geschehene zu
2
Eine detaillierte Erläuterung dieser drei Teilbereiche ist den entsprechenden Kapiteln zu
entnehmen, die jeweils angegeben worden sind.
3
Slow Motions werden generell in Form von Close Ups aufbereitet.
4
E
I N L E I T U N G
erleichtern [...]. Auf der anderen Seite verfügen solche visuellen
Overlays - ebenso wie eingesuperte Logos, Maskottchen oder
Spielstände auf dreidimensional animierten Graphikboards - durchaus
über einen gewissen ästhetischen Reiz" (S
CHIERL
2004b: 146).
Auf der Seite der auditiven Kommunikation ist eine Ästhetisierung
durch den Kommentator bei positiver Bewertungen des
Spielgeschehens, besonderer Intonation oder etwa Onomatopöie
(Lautmalerei) gegeben.
Zu b): Die Dramatisierung wird in dieser Arbeit als Sonderform
der Ästhetisierung verstanden und begründet (vgl. Kap. 5.2). Hierbei ist
die bildliche Umsetzung durch die Regie wie unter Punkt a) zu
verstehen, als Thema der Zeitlupenwiederholungen spielen hier aber
ausschließlich Gewalt und aggressive Handlungen mit ein. Schierl
spricht in diesem Zusammenhang von Gewalt, die ,,ästhetisch
überhöht" (2004b: 139) wird. Gewalt wird deswegen als Benefit für den
Rezipienten verstanden, weil ihr ein starkes Unterhaltungspotenzial zu
Eigen ist. Der Gewalt-,,Genuss" ist im Menschen genuin verankert,
wodurch dieser ein Medienprodukt als affektiv ansprechend
konsumiert. In dieses Spektrum der Stilisierung von Gewalt fallen all
jene sportimmanenten Handlungen, die nicht dem Regelwerk konform
sind (Fouls) oder den Zwei-,,Kampf"-Charakter hervorheben.
Als verbalisiertes Pendant der Dramatisierung wird untersucht,
inwiefern das aggressive Moment des genuin unaggressiven
Sportspiels Basketball durch Zusatzinformationen des Kommentators
(,,Die Erzfeinde treffen aufeinander") und/oder durch aktuelle Eindrücke
des Spielverlaufs (,,Ein brutales Foul") forciert wird.
Zu c): Als ein Diktum der Nachrichtenwerte wird die
Personalisierung genannt (vgl. Kap. 5.3). Verengt man die Schilderung
einer sportlichen Gesamtsituation auf einen Handlungsträger oder
fokussiert man inhaltlich auf einen Sportler etwa durch Informationen
aus seinem privaten Umfeld, verlässt dieser Spieler die Ebene des
Sportlers hin zu einer öffentlichen Person, über die man Erkenntnisse
fern des originären Sporttreibens gewonnen hat. Ein Umstand, der im
Sinne des gleichnamigen Nachrichtenfaktors gewollt ist.
5
E
I N L E I T U N G
Jede Kameraeinstellung, die über die sogenannte ,,Totale" hinaus den
Blick auf eine Person verengt, entfremdet die Möglichkeiten des
menschlichen Auges. Der Blick wird intentional gelenkt. Im Falle einer
Fokussierung auf einen einzelnen Sportler wird dem Fernseh-
Zuschauer eine szenische Überhöhung einer einzelnen Person
geboten. Es erfolgt somit eine bildliche Personalisierung.
Diesem Phänomen auf der Seite der digitalen Codierung wird immer
dann genüge getan, wenn der Kommentator sportendogene (,,Sein
bestes Spiel seit zwei Jahren") und/oder -exogene (,,Er ist gestern
Vater geworden") Informationen über einen einzelnen Teilnehmer
vermittelt. Hierbei wird der deutsche Basketball-Nationalspieler Dirk
Nowitzki bei diesem Turnier eingehend betrachtet. Als
Vergleichsobjekte werden der deutsche Aufbauspieler Mithat Demirel
und die Schiedsrichter mit in Betracht gezogen.
Bei der praktischen Umsetzung wird von den drei zu untersuchenden
Liveübertragungen jede einzelne Einstellung analysiert. Dazu wird die
Szene thematisch beschrieben, zeitlich fixiert, die Kameraeinstellung
festgestellt, Insertierungen festgehalten und spezielle
Bildaufbereitungen berücksichtigt. Pro Direktübertragungen sind rund
700 unterschiedliche Einstellungen (,,Schnitte") anzunehmen, so dass
letztlich an die 2000 verschiedene Szenen codiert werden müssen.
Dies geschieht an einem digitalen TV-Sichtplatz. Hinzu wird der Spiel-
Kommentar komplett dokumentiert, da erst so der Vergleich des
analogen und digitalen Codes möglich ist.
Grundsätzlich soll mit dieser Vorgehensweise zuvorderst eine
Betrachtung der visuellen und der auditiven Inszenierung im
Fernsehen bei Liveübertragungen stehen. Später soll wie erwähnt der
Versuch unternommen werden, diese zu vergleichen.
Inszenierungsbestrebungen der übertragenden Sendeanstalten sind
unschwer zu erkennen durch die technisch immer ausgefeiltere
Aufarbeitung der Bilder (erhöhtes visuelles Wertschöpfungsstreben).
Inwiefern dies durch die Sprache (auditives Wertschöpfungsstreben)
geschieht, gilt es zu analysieren und zu werten. Eine grundsätzliche
Beurteilung scheint aber schwer, gerade weil der Kommentar bei
6
E
I N L E I T U N G
Sportübertragungen immer im Rahmen der individuellen Vorlieben der
Rezipienten gesehen werden muss.
Wichtig zu betonen bleibt auch, dass die folgenden theoretischen
Quintessenzen und die empirische Untersuchung keineswegs
mögliche Wirkungen beim Rezipienten erörtern wollen. Dennoch erfolgt
im theoretischen Teil ein kurzer Ausflug hinaus in die
Medienwirkungsforschung, der allein dazu dienlich ist, einen
grundsätzlichen Blick auf die Materie werfen zu können. Bis auf diesen
abrundenden Einschub ist die Theorie stark nach Relevanz für die
Empirie ausgerichtet. Zuerst folgt eine Erläuterung der kleinsten
Einheiten der Audiovision das Bild und der Text. Nachfolgend liegt
der Fokus auf dem audiovisuellen Medienreiz, der auf den
Charakteristika des zuvor thematisierten analogen und digitalen Codes
gründet. Dennoch ist das Phänotypische des TV-Signals speziell. Die
Sichtweise intensiviert sich fortdauernd hin zum Thema der
Liveübertragung im Fernsehen. Die Bildführung und der Kommentar
dürfen somit nicht fehlen.
Die Grundlage der vorliegenden Untersuchung wird durch Kapitel 5
gelegt. Hier werden die zuvor grob skizzierten Inszenierungsmuster
Ästhetisierung, Dramatisierung und Personalisierung näher beleuchtet
und im Sinne der folgenden Analyse im empirischen Teil eingeführt.
Unablässig bleibt als Abschluss der Blick auf Dirk Nowitzki, dem als
Protagonisten bei der Untersuchung zur Personalisierung eine wichtige
Funktion zufällt.
Zur weiteren Vertiefung einzelner Rand-Themen ist an entsprechender
Stelle in der Fußnote weiterführende Literatur angezeigt.
Zur Betonung: Die Medienwirkungsforschung ist für diese Arbeit nicht
relevant und bedürfte eines anderweitigen Forschungsdesigns. Der
Theorieteil (ab Kap. 2) ist mit der Absicht der rekursiven Vernetzung
aufbereitet worden, so dass die einzelnen Inhalte nicht nur aufeinander
aufbauen, sondern sich der forschungsleitenden Fragestellung immer
exakter annähern. Sie dienen als Grundlage für die sieben formulierten
Hypothesen, auf die der empirische Teil (ab Kap. 7) eingeht.
7
E
I N L E I T U N G
Nachfolgend ist das Forschungsmodell in eine graphische Darstellung
überführt worden.
Forschungsmodell:
Abbildung 1-1: Forschungsmodell zur Analyse der Inszenierungsfaktoren Ästhetisierung,
Dramatisierung und Personalisierung bei einem audiovisuellen Medienreiz.
8
T
E X T U N D
B
I L D
Theoretischer Teil
2
Bild und Text
Ziel dieses Abschnittes ist es aufzuzeigen, inwiefern sich Bild und Text
als Medienreiz unterscheiden, sich überschneiden, sich verstärken
und/oder abschwächen.
4
Marion G. Müller fasst dieses Phänomen wie
folgt zusammen: ,,Die Logik der Bilder ist eine andere als die Logik der
Texte [...], wobei sich Bild- und Textkommunikation nicht selten
wechselseitig durchdringen oder zumindest überlagern. Dabei können
sich Bild und Text ergänzen. Sie können sich aber auch
widersprechen" (2003: 14).
Der Bereich der Werbeindustrie illustriert anwendungsnah, wie
emotional die Debatte um die unterschiedliche Charakteristik von Text
und Bild geführt wird. ,,Die Diskussion für oder gegen das eine bzw.
das andere degeneriert hier mehr zu einem Glaubenskampf, als daß
sie auf wirklich fundierten oder gar empirischen Fakten basieren
würde" (S
CHIERL
2001: 213). Speziell das Fach der visuellen
Kommunikation ist gefühlsgeleitet. ,,Mehr aus dem Bauch als aus dem
Kopf kommt die Argumentation" (M
ÜLLER
2003: 9). Zwar mangele es
nicht an unterschiedlichen Meinungen, es gebe ,,aber nur wenig
wissenschaftlich Fundiertes" (ebd.). Hauptsächlich bleiben die
divergierenden Argumentationslinien im persönlichen Geschmack des
Einzelnen verhaftet.
Grund hierfür sind unter anderem die mannigfaltigen Möglichkeiten des
Einstiegs in das Thema
5
, die die Interdisziplinarität dieses Feldes
4
für weiterführende Literatur vgl. M
UCKENHAUPT
1986; B
INDER
, H.: Zum Verhältnis von visueller
und verbaler Kommunikation in Werbebildern. In: Linguistik und Didaktik, Nr. 22, 1975, S. 85-
102; F
AUST
, M.: Sprachliches Zeichen und bildliche Darstellung. In: B
RUNNER
, H. u.a. (Hrsg.):
Wort und Bild. München 1979, S. 263-274; S
CHUSTER
, M.; H. P. W
OSCHEK
: Bildhafte und
verbale Kommunikation. In: S
CHUSTER
, M.; H. P. W
OSCHEK
(Hrsg.): Nonverbale Kommunikation
durch Bilder. Stuttgart 1989, S. 3-22; Z
IMMER
, H. D.: Sprache und Bildwahrnehmung. Frankfurt
am Main 1983
5
Unterschieden wird unter anderem in die geistes-, sozial- und naturwissenschaftliche
Perspektive.
9
T
E X T U N D
B
I L D
verdeutlichen. Wissenschaftlich determiniert und empirisch belegt kann
aber fächerübergreifend festgehalten werden, dass Text und Bild
heterogene Qualitäten besitzen (vgl. M
UCKENHAUPT
1986, M
ÜLLER
2003, S
CHIERL
2001, Z
IMMER
1983). ,,Visuelle Eindrücke werden von
dem menschlichen Sinnesapparat anders verarbeitet als Informationen
in Textform" (M
ÜLLER
2003: 13). Fern der Auswirkung eines möglichen
Zusammenspiels besitzen diese beiden Informationsträger Spezifika,
die sich trennscharf unterscheiden lassen.
Bild und Text werden als analoger und digitaler Code verstanden.
Diese funktionelle Unterscheidung wird damit begründet, ,,daß
sprachliche Symbole und Bilder in der Kommunikation zwar beide als
Substitute für andere Dinge fungieren, die jeweilige Beziehung zu den
substituierten Dingen allerdings bei beiden eine grundsätzlich andere
ist" (S
CHIERL
2001: 214). Nachfolgend liegt das Hauptaugenmerk auf
dem analogen Code und der Interaktion der beiden Reize zum einen,
weil für die spätere Analyse im empirischen Teil dieser Arbeit
grundlegend, zum anderen, weil die Kap. 3.2 und 4.3 sich intensiv mit
dem digitalen Code anwendungsspezifisch befassen.
Loslösen muss man sich bei der Betrachtung des analogen und
digitalen Codes von der allgemein technisch geprägten Vorstellung der
Begriffe. An anderer Stelle werden sie als ikonisch/nicht-ikonisch,
ikonisch/symbolisch oder imitativ/abstrakt beschrieben (S
CHIERL
2001:
214, Fußnote 98).
2.1
Der analoge Code
Die Kommunikation, die über den visuellen Kanal fließt, wird als der
analoge Code verstanden. Dieser Terminus beinhaltet eine spezielle
Charakteristik, die dem Bild analytisch anhaftet. ,,Der analoge Code [...]
steht in einer direkten Beziehung zur visuellen Erscheinung des
Bezeichneten. Oder anders ausgedrückt: Signifikans (Bezeichnendes)
und Signifikandum (Bezeichnetes) weisen eine erkennbare optische
Ähnlichkeit auf" (S
CHIERL
2001: 214). Dies betont knapper auch
10
T
E X T U N D
B
I L D
Manfred Muckenhaupt: ,,Natürlich sagen Bilder nichts, sie stellen dar"
(1986: XV).
Ein Bild vermag dementsprechend lediglich das wiederzugeben, was
es wiederzugeben in der Lage ist, nämlich das abgebildete Objekt.
Dem Bild, ,,eine zum Zweck der Betrachtung oder Verständigung
hergestellte visuelle Konfiguration" (D
OELKER
1999: 187), fehlt es an
einer komplexen Syntax. Und somit kann davon ausgegangen werden,
dass ein ,,Zwischen-den-Zeilen-Lesen", also das gewollte oder
ungewollte Mitschwingen von zusätzlichen Informationen und
Intentionen, beim Bild im Gegensatz zum Text (vgl. Kap. 3.2) nicht
möglich ist.
Die Frage, wie ein Bild beim Betrachter ,,ankommt" also rezipiert und
verstanden wird ist von mehreren Faktoren abhängig. ,,Wenn zwei
Menschen dasselbe Bild betrachten, bedeutet das nicht automatisch,
dass sie dasselbe sehen" (M
ÜLLER
2003: 18). Aber warum ist das so?
Der Sprachwissenschaftler W. J. T. Mitchell spricht von einem
,,Verständnis der Bildlichkeit", die ,,in sozialen und kulturellen Praktiken
verankert ist" (1990: 18). Angeführt werden hier Unterschiede
basierend auf ,,zeitlichen, kulturellen, sozialen und individuellen
Wahrnehmungsdifferenzen" (M
ÜLLER
2003: 18). Durch individuelle oder
gesellschaftsimmanente Prädisposition werden Bilder (wie natürlich
auch Texte) unterschiedlich verstanden. ,,Visuelle Kommunikation folgt
einer eigenen, nicht rational-argumentativen Logik. Das Prinzip dieser
Logik ist die Assoziation. Assoziationen sind nicht rational erklärbar, sie
beruhen aber auf Vorbildern, deren Bedeutungen analytisch
dechiffrierbar und damit interpretierbar sind" (M
ÜLLER
2003: 22).
Bevor nun auf weitere Fähigkeiten und Grenzen des analogen Codes
eingegangen wird, soll zunächst der Begriff ,,Bild" einleitend erläutert
werden:
Eine Bilddefinition kann nur komplex erfolgen. Die Problematik
erschließt sich in der Diskussion, ob die visuelle
Kommunikationsforschung auch immaterielle, ,,geistige" (vgl. M
ITCHELL
)
Bilder beispielsweise die des ,,inneren Auges" in den
Definitionskanon mit aufnehmen muss. Wenn nein, so schlussfolgert
11
T
E X T U N D
B
I L D
Müller, ,,reduziert sie sich zur reinen Materialkunde" (2003: 18). Wenn
ja, verweist die Autorin auf die Gefahr des allzu Unpräzisen. Es ist der
,,Zielkonflikt zwischen enger und weiter Begriffsdefinition" (ebd.: 19).
Christian Doelker versucht dieser Situation Herr zu werden, indem er
die drei Ebenen Wahrnehmungsinhalt, Original/Unikat und
Kommunikat einführt. Dabei versteht der Autor die Ebene eins als
inneres Bild, Ebene zwei als ,,Abbild" in wiederum drei
Ausprägungsformen (,,Nachbildung einer Wirklichkeit", ,,eigene
Wirklichkeit" und ,,Übernahme der bestehenden Wirklichkeit") und die
letzte Ebene als technische Wiedergabe des Unikats (vgl. D
OELKER
1999). Aber auch Doelker vermag es nicht, die immateriellen
Bestandteile definitorisch eindeutig zu integrieren. Maßgeblich für die
vorliegende Arbeit ist der letzte Punkt, das Kommunikat.
Aby Moritz Warburg lieferte schon vor dem 2. Weltkrieg ein
theoretisches Modell, das den Abbild- und den Denkbildcharakter von
Bildern beschreibt. Diese sind laut dem Hamburger Kunsthistoriker und
Kulturwissenschaftler untrennbar miteinander verbunden.
6
Er stellte
1912 seine Methode der Ikonologie einer breiten Öffentlichkeit vor, die
ab diesem Zeitpunkt Einzug in die Bilderforschung fand und als
eigenständige Disziplin etabliert wurde. Diese kunstwissenschaftliche
Konzept beschreibt einen Ansatz, der das umfassende
Gesamtgeschehen eines Bildes erkennen und deuten soll (vgl.
K
ULTERMANN
1991). Mit diesem Ansatz legte Warburg die Basis für
eine neue, umfassende Kulturwissenschaft, in dem er nahezu den
ganzen Komplex der Geisteswissenschaften interdisziplinär zu einer
neuen ,,Zusammenschau" (ebd.: 91) und zu einer ,,methodologischen
Quintessenz" (W
UTTKE
1991: 47) zusammenführte.
6
für weiterführende Literatur zum Leben und Werk von Aby Warburg vgl. B
AUERLE
, D.:
Gespenstergeschichten für ganz Erwachsene. Ein Kommentar zu Aby Warburgs Bilderatlas
Mnemosyne. Münster 1988; H
EISE
, C. G.: Persönliche Erinnerungen an Aby Warburg.
Hamburg 1966; K
ULTERMANN
, U.: Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer
Wissenschaft. Wien 1968; R
OECK
, B.: Der junge Aby Warburg. München 1997 und besonders
G
OMBRICH
, E. H.: Aby Warburg. Eine intellektuelle Biografie. Frankfurt am Main 1984
12
T
E X T U N D
B
I L D
Auch die heutige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Bildanalyse fußt zu großen Teilen auf der Warburg´schen Sichtweise.
,,Die Bilder materialisieren Denkvorgänge. Abbilder sind komplexe
Quellen für die Rekonstruktion der Denkbilder. [...] Dies bedeutet, dass
es zu jedem Abbild auch Denkbilder gibt, umgekehrt jedoch nicht jedes
Denkbild auch Abbilder hervorbringt. Für den
kommunikationswissenschaftlichen Bildbegriff ist der Abbildcharakter
unabdingbar. Geistige Bilder [...] gehören nicht in den Objektbereich
der visuellen Kommunikation" (M
ÜLLER
2003: 20). Trotz der nun
determinierten Unabdingbarkeit der ,,mental images" und ,,material
images" (ebd.) kann bei der wissenschaftlichen Betrachtung singulär
ein Schwerpunkt gesetzt werden. Für diese Arbeit sind ausschließlich
die ,,Abbilder" (materielle Bilder) relevant. Ebenfalls unabdingbar ist es,
den Begriff ,,Bild" weitläufig zu verstehen. Im materiellen Sinne kann
ein Bild ein Gemälde im Museum oder ein Zeitungsbild sein, aber eben
auch ein Fernsehbild. ,,[...] Film und Fernsehen werden als
audiovisuelle Medien unter den Bildbegriff subsumiert, insofern es sich
bei ihnen um moving pictures bewegte Bilder handelt" (M
ÜLLER
2003: 13).
Zurück zum analogen Code.
7
Die anzunehmende Eindimensionalität
im Gegensatz zum Text wurde bereits abgesteckt, obwohl Bilder
trotzdem ,,grundsätzlich viele Bedeutungs- und Sinnschichten" (M
ÜLLER
2003: 34) haben können. An die Qualität von Texten reichen diese
indes nicht heran. Gombrich erklärt hierzu, ,,daß ein Bild niemals eine
Aussage in diesem logischen Sinn sein kann. Es kann daher so wenig
wahr oder falsch sein, wie eine Aussage rot oder grün sein kann"
(1978: 89f.). Der Sinnspruch ,,Ein Bild sagt mehr als tausend Worte"
wird obsolet, wie Schierl (2001: 219) betont und begründet: ,,Eine
Aussage (durch das Bild, K.F.) kann sich erst im Zusammenhang
7 für weiterführende Literatur vgl. auch A
RNHEIM
, R.: Abbilder als Mitteilung. In: S
CHUSTER
, M;
H. P. W
OSCHEK
(Hrsg.): Nonverbale Kommunikation durch Bilder. Stuttgart 1989, S. 23-31;
F
REY
, S.: Die Macht des Bildes. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle 1999; G
OMBRICH
, E. H.: Bild
und Auge. Neue Studien zur Psychologie der bildlichen Darstellung. Stuttgart 1984
13
T
E X T U N D
B
I L D
ergeben." Es braucht eine textliche Rahmung, denn ,,Bilder sind
vieldeutig und offen, ihr Gebrauch geht nicht aus ihnen selbst hervor"
(S
CHIERL
2001: 227). Aber: ,,[...] Bilder sind perspektivisch und
aspekthaft, soll heißen, dass sie immer nur aus einer bestimmten
Perspektive oder unter einem bestimmten Aspekt gemacht werden"
(S
CHMALRIEDE
2004: 19).
Es bestehen eingeschränkt Mittel, einem Bild allein durch die
Bildbearbeitung eine Intention beizumengen. So ist es möglich, durch
Verknappung und Reduktion diese ,,eindeutiger" (S
CHIERL
2001: 220)
zu machen. ,,Der Fachmann [...] weiß, daß in der Konzentration auf das
Wesentliche das Geheimnis der Gestaltung liegt. In der vermeintlichen
Einengung des Blickwinkels liegt die Freiheit, nur das zu zeigen, was
man wirklich aussagen möchte. Durch diese [...] Ausschließlichkeit des
Raumausschnitts hat man die Chance, sich der gewünschten Aussage
anzunähern" (K
ERSTAN
1990: 25). Am Beispiel der Fernsehübertragung
ist dieser Fall bei jeder Einstellung gegeben, die das Bild über die
Totale hinaus verknappt, etwa wie es bei Nah-, Groß- oder in den
extremen Detail-Einstellungen gegeben ist (s. Kap. 4.2). Und trotzdem,
,,[...] selbst die einfachsten (informationsreduzierten) optischen Kürzel
brauchen einen durch vorherige, auf der Tradition beruhende
Erwartungen gestützten Zusammenhang, um eindeutig zu sein"
(S
CHIERL
2001: 220f.).
Die Vorzüge des Bildes sind ebenso umfangreich wie dessen
Einschränkungen. ,,Als Phantasie bringt die Bildkraft die Welt dem
Menschen zur Erscheinung, d.h. sie transportiert sie ins Bild. Erst als
Bild ist die Welt dem Menschen zugänglich und verfügbar" (W
ULF
2003:
19). Die optische Kommunikation verfügt ,,über ein reichhaltiges
semantisches Potential" (S
CHIERL
2001: 222). An späterer Stelle
bezeichnet der Autor dieses Potenzial als ,,praktisch unbeschränkt"
(2001: 226). Die involvierende Funktion eines Bildes bei seiner
Betrachtung, respektive einer Bilderfolge wie beim Fernsehen
8
, kann
durch Text in diesem Maße nicht hergestellt werden. ,,Mit Hilfe von
8
Eine TV-Sekunde besteht aus 24 Bildern, sogenannten ,,Frames".
14
T
E X T U N D
B
I L D
Bildern läßt sich sehr viel leichter als mit einem Text die Gefühlslage
bzw. Stimmung des Betrachters beeinflussen" (S
CHIERL
2001: 230).
Die werbende Industrie sieht im Bild gar das ,,emotionale Eingangstor"
(ebd.: 247).
Ein weiterer Vorzug des Bildes ist in der Tatsache begründet, dass
dessen Rezeption als leicht und schnell beschrieben wird. Deswegen
werden Bilder ,,selbstverständlicher hingenommen und wirken somit
auch glaubwürdiger als der Text" (S
EYFFERT
1966: 674ff.). Für die
Bildabfolge, wie sie uns das Fernsehen liefert, gilt dies im besonderen
Maße. ,,Ein Foto stellt einen kleinen Ausschnitt aus einem
Handlungsverlauf dar. [...] Tatsächlich verleitet der Ausschnitt aus der
realen Gesamtraumzeit zu einer Interpretation, die den Erfahrungen
und Assoziationsmöglichkeiten des Betrachters entspricht; er vollendet
eine im Foto begonnene Handlung in seiner Vorstellung und entwickelt
Voraussetzungen und Konsequenzen. So wird das Foto zum
Repräsentanten der realen Gesamtraumzeit. Erreicht schon das Foto
einen solchen Denkvorgang, so muß eine diachronische Aufnahme,
die also nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche Ausdehnung
aufzeichnet, diesen Prozeß verstärken. In diesem starken,
realitätsnahen Eindruck liegt die ungeheure Glaubwürdigkeit, die Film-
und Fernsehaufnahmen vermitteln" (K
ERSTAN
1990: 33f.).
Auf dieser Begründung beruht die Unmittelbarkeit des Fernsehens
gegenüber anderen Medien. Ein Vorteil, der zumindest für Radio und
Presse als Medienmarktteilnehmer unüberbrückbar ist. Diese TV-
Gläubigkeit hat Folgen: ,,Die Dokumentation von Fakten im Sinne von
Wer, Was, Wann, Wo des journalistischen Pflichtprogramms ist
langweilig gegenüber einer gefühlten Wahrheit" (M
ORITZ
1998: 17), wie
sie durch die Betrachtung eines TV-Bildes erwirkt werden kann. Der
visuelle Reiz einer Fernsehübertragung birgt durch dessen Abbild
nahezu eine Primärerfahrung. Sozusagen eine mögliche
Primärerfahrung vom Wohnzimmersessel aus hinaus in die weite
unbekannte Welt. Für eine Sportübertragung im TV heißt das, dass
man z.B. den Schweiß des Athleten tropfen und seine Zornesader auf
15
T
E X T U N D
B
I L D
der Stirn bildschirmhoch anschwellen sieht. Ganz so, als stünde man
daneben.
2.2
Der digitale Code
Es ist bereits angedeutet worden, ,,daß Bilder bis zu einem gewissen
Grad wie sprachliche Ausdrücke als Mittel der Kommunikation
verwendet werden können" (M
UCKENHAUPT
1986: 124). Laut
Muckenhaupt ist das kommunikative Vermögen des digitalen Codes
also an der Stelle noch nicht erschöpft, wo das Bild seine Grenzen
besitzt.
Unsere Sprache
9
beruht auf einem historisch begründeten,
gesellschaftsspezifischen Sinngerüst. Und nur auf diesen Sprossen
kann die verbale Kommunikation verlaufen, soll der Aussageinhalt bei
Adressant und Adressat identisch bleiben und es zu keinerlei
Missverständnissen kommen. ,,Im digitalen Code müssen konkrete wie
abstrakte Objekte und Zustände in digitale, der Erscheinungsform des
Bezeichneten nicht verwandte Begriffe umgesetzt werden, die per
Konvention seitens der Kommunikationsteilnehmer akzeptiert bzw.
gekannt werden müssen" (S
CHIERL
2001: 214). Dies ist der
grundsätzliche Konsens, der der Sprache zugrunde liegen muss. Diese
Übereinkunft zwischen Sender und Empfänger ist bindend. ,,Die
Umwandlung der Mitteilung in Signale aufseiten des Kommunikators
wird als Enkodierung bezeichnet, die Rückübersetzung der
empfangenen Signale aufseiten der Rezipienten als Dekodierung"
(S
CHULZ
2002: 158).
9
Im Folgenden wird Text und Sprache deckungsgleich verwandt, weil auch in der
entsprechenden Literatur keine definitorische Unterscheidung nötig scheint (vgl. B
RINKER
2001). Dies beruht darauf, dass die Verwendung des Wortes ,,Text" nicht einheitlich ist. ,,Es
lassen sich mehrere Bedeutungen des Wortes feststellen wie `geschriebenes sprachliches
Gebilde von einer gewissen Ausdehnung´, `Wortlaut´, `sprachliche Erläuterung bzw.
erklärende Beschriftung´ (`Unterschrift zu einer Illustration´), `Bibelstelle´, `sprachlicher Teil
eines musikalischen Werkes´. Als Kernbedeutung kann aber zweifellos gelten: `Text´ ist eine
(schriftlich) fixierte sprachliche Einheit, die in der Regel mehr als einen Satz umfaßt´" (B
RINKER
2001: 11f.).
16
T
E X T U N D
B
I L D
Die linguistische Textanalyse ist ein weites Feld, insofern nur ein
kurzer Überblick erfolgen kann zumal ein tieferes Eintauchen in die
Materie für die nachfolgende Untersuchung ohne Relevanz wäre.
Brinker (2001: 17) formuliert eine ganzheitliche Definition, die den
sprachsystematischen und den kommunikationsorientierten Ansatz der
Textlinguistik vereint: ,,Der Terminus `Text´ bezeichnet eine begrenzte
Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich kohärent ist und die als
Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert."
Die wichtigste Struktureinheit des Textes ist der Satz. Wichtiger als
diese auf einen schriftkonstituierten, monologischen Text den Fokus
setzende Sichtweise ist die Analyse des digitalen Codes im Sinne der
Rhetorik (,,ars bene dicendi" - die Kunst vom schönen Reden). Hier
wird die Sprache aus der Sicht der Alltagskommunikation untersucht,
und es werden Techniken und Methoden der Textproduktion formuliert.
,,So erlangt sie (die Sprache, K.F.) nicht nur eine sprachliche, sondern
auch eine allgemeine mediale Relevanz" (P
LETT
2001: 1). Den
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde eine genauere, singuläre
Analyse des digitalen Codes des Untersuchungsgegenstandes (s. Kap.
8.1), so dass dieser zwar für sich allein stehend analysiert wurde, die
Quintessenz dessen erfolgte aber im Abgleich mit dem analogen Code.
Demzufolge interessant ist hier die Beleuchtung des Textes in Relation
zum Bild.
Möglich ist nämlich, dass der digitale Code den Blick auf den analogen
Code in eine bestimmte Richtung fokussiert und somit beeinflusst. ,,Mit
Sprache lassen sich [...] bestimmte Einzelaspekte eines Gesamten
heraustrennen und je nach Belieben, mehr oder weniger genau und
ausführlich, beleuchten" (S
CHIERL
2001: 238). Dies begründet der
Autor wie folgt: ,,Durch seine, im Vergleich zum Bild, weniger starke
Offenheit, ist der Text »gerichtet«, d.h. der Blickwinkel ist auf einen
engeren Punkt fixiert und kann somit stärker durch den Kommunikator
gelenkt werden" (ebd.).
Schlussfolgernd kann Sprache in Relation zum Bild als aktiver
beschrieben werden. ,,Während das Bild nur passiv abbildet, kann der
Text also aktiv werden und versuchen, den Betrachter [...] zu einer
17
T
E X T U N D
B
I L D
Handlungsweise zu aktivieren" (S
CHIERL
2001: 237). In diesem
Zusammenhang kann die Handlungsweise wie der Kauf eines
beworbenen Produktes durch eine vertextlichte Werbebotschaft (,,Das
müssen Sie haben!") verstanden werden. Aber auch eine emotionale
Beeinflussung, zum Beispiel bei Sport-Liveübertragungen, ist möglich.
Auf diesen Aspekt geht das Kapitel 5.3 intensiver ein.
2.3
Interaktion des analogen und digitalen Codes
Nachfolgend ein tabellarischer Überblick der gewonnenen
Erkenntnisse zum digitalen und analogen Code:
Vorteil Bild:
Vorteil Text:
-
semantisches Potenzial
-
leichte und schnelle Rezeption
-
glaubwürdig
-
affektiv-involvierend
-
aussagegerichtet
-
selbstständig-aktiv
Nachteil Bild:
Nachteil Text:
-
keine oder wenig Aussage
-
vieldeutig
-
unselbstständig-passiv
-
bedingt gesells. Konvention
Tabelle 2-1: Vor- und Nachteile des analogen und digitalen Codes.
Aus den beiden vorausgegangenen Kapiteln ist ersichtlich geworden,
dass Bild und Text unterschiedlichen Charakteristiken zugeteilt werden
müssen. ,,Wenn wir Bilder als Mittel der Kommunikation betrachten,
fällt zuerst auf, daß es sich hier um ein Mittel handelt, die uns nicht wie
unsere Sprache gleichsam gegeben sind, sondern um Mittel, die je
nach Bedarf erst hergestellt werden müssen. Die Verfügbarkeit über
Bilder ist daher weit eingeschränkter als die Verfügbarkeit über unsere
Sprache" (M
UCKENHAUPT
1986: 156). Niklas Luhmann spricht von
,,sprachlicher und bildlicher Realitätserzeugung" (1995: 34). Die
Eingeschränktheit der bildlichen Kommunikation gegenüber der
18
T
E X T U N D
B
I L D
textlichen ist belegt worden. Angesprochen wurden innerhalb der
Einzelauflistungen die Möglichkeiten bei Symbiose der beiden
Kommunikationselemente für intendierende Aussagen mit hoher
Präsenz. Diese Aussage gilt es jetzt intensiver zu beleuchten.
,,Eine gemeinsame Verwendung von Text und Bild [...], die beide
Codes komplementär zu nutzen sucht, bedeutet eine Erweiterung der
Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten, da sie die
kommunikativen Begrenzungen, die aus der ausschließlichen Nutzung
rein textlicher oder rein bildlicher Aussagen entstehen, überwinden"
(S
CHIERL
2001: 239). Text und Bild können sich also lohnend
ergänzen. ,,Analoge und digitale Kommunikation können in einer
aufeinander abgestimmten Verwendungsweise die
Übertragungsfähigkeit und Darstellungstreue eines Kommunikates
verbessern" (S
CHIERL
2001: 239). Doch auch bei komplementärer
Verwendung sind Grundsätzlichkeiten vonnöten. ,,Dabei ist [...] zu
beachten, daß eine Bildaussage, aufgrund ihrer bedeutungsmäßigen
Offenheit, mit Sicherheit immer textabhängiger sein wird, als eine
Textaussage bildabhängig ist" (ebd.).
Hier wird deutlich: Ohne Kontext mittels des digitalen Codes verläuft
analoge Kommunikation ungezielt! Eine Aussage, die für die folgende
Untersuchung entscheidend ist, insofern aus wissenschaftlicher Sicht
eine Harmonie zwischen Text und Bild abverlangt werden kann, wenn
das audiovisuelle Kommunikat einen bestimmten Sinn erfüllen soll. Der
digitale Code kann die Rezeption von Bildern nachweislich und
hochintensiv steuern und dem Bild einen speziellen ,,Drive" versetzen.
Man kann eine Verstärkerfunktion des Bildes durch die Sprache
feststellen.
Das Bild hat also als ,,Eyecatcher", als Schlüsselreiz, seine
grundsätzliche Funktion für den audiovisuellen Medienreiz. Doch um
die Botschaft auch punktgenau zu setzen, sind verbalisierte
Zusatzinformationen unerlässlich. In einem anderen Zusammenhang
wird ,,dem Text die Rolle des eigentlichen »Verkäufers« in der
werblichen Kommunikation zugewiesen" (S
CHIERL
2001: 237). Eine
Verbesserung des Kommunikats durch die gegenseitige Beeinflussung
19
T
E X T U N D
B
I L D
von Bild und Text ist auch und gerade für die audiovisuelle
Kommunikation anzunehmen.
Trotz der eben skizzierten vermeintlichen Dominanz des digitalen über
den analogen Reiz muss auch die Funktion des Bildes unterstrichen
werden. Nicht nur, dass Sprache, wie bereits erwähnt, keineswegs
über das semantische Potenzial des Bildes verfügt. Es wirkt emotional
involvierend und somit ist es häufig dem Bild geschuldet, Interesse zu
schüren und Rezipienten in die Materie einzuführen.
Dennoch muss bei der Beantwortung der Frage nach der optimalen
Umsetzung einer medialen Information situativ über dessen Form
entschieden werden. ,,Die Wahl, ob eine Botschaft textlich oder bildlich
kommuniziert werden soll, allgemein zu treffen, erscheint unsinnig, da
sie von der speziellen zu übermittelnden Botschaft selber abhängt"
(S
CHIERL
2001: 227). ,,In vielen Fällen ist man durch das Wort oder
durch das Bild allein nur unzulänglich orientiert; beides
zusammengenommen ergibt erst die plastische Darstellung, eine
vollständige und sinnfällige Information" (P
RAKKE
1963: 18).
Als mögliche Beeinflussungen des Bildes durch den Text nennt Schierl
drei Differenzierungen (vgl. 2001: 240ff.): Der ,,kommentierende
Aspekt" verleiht dem Gesehenen ,,(Be)-Deutung" und wirkt somit
thematisch involvierend. Je nach Position des Betrachters gewinnt das
Bild durch den Kontext eine Gewichtung. Der ,,selegierende Aspekt"
der Bildbeeinflussung durch die Sprache beschreibt eine Form der
Lenkung des Rezipienten. ,,Durch den »gerichteten« Text ist es
möglich, einen Ausschnitt aus der visuellen Botschaft zu bestimmen,
auf den sich der Betrachter konzentrieren soll bzw. auf den er sein
Hauptaugenmerk lenken soll" (ebd.: 241). Der letzte beschriebene
Punkt ist der ,,strukturierende Aspekt", der beim Betrachter ,,einen
Aufmerksamkeitsfokus" setzt. Reizdetails, auf die fokussiert wird und
die ein Rezipienten-Benefit begründen, werden bei der Wahrnehmung
überprüft. ,,Die Benennung (Hypothesendarbietung) eines
Wahrnehmungsgegenstandes beeinflußt somit die Wahrnehmung
dieses Gegenstandes" (ebd.: 243).
20
D
E R A U D I O V I S U E L L E
M
E D I E N R E I Z
Auch in der täglichen Fernseh-Praxis ist das Dekret des notwendigen
Zusammenspiels von Bild und Wort angekommen. ,,Dabei hat ein
Grundsatz Priorität: Bild und Text müssen eine Einheit bilden. [...] Viele
Beiträge in der täglichen Berichterstattung präsentieren sich mit einer
Bild / Text-Schere, das heißt, auf die gezeigten Bilder wird ein
,,Textteppich" gelegt, der zwar die Fakten des Ergebnisses
berücksichtigt, aber den jeweiligen Bildbezug vermissen lässt"
(B
RAUNLEDER
1994: 293), denn: ,,Mit der Text-Information ergänzt der
Fernsehjournalist die Bild-Information" (S
CHULT
1990: 127).
3
Der audiovisuelle Medienreiz
,,So I have heard, and do in part believe it."
(Hamlet)
Der Herleitung des digitalen und analogen Codes mit den
Wesensmerkmalen des Abbildes und Denkbildes erfolgte im letzten
Kapitel. Aufbauend auf diesem Wissen wird nun der audiovisuelle
Medienreiz näher beleuchtet. Bevor auf die Merkmale der Audiovision
eingegangen wird, ist die kommunikationswissenschaftliche Verortung
des Begriffs Massenkommunikation unumgänglich. Dies deswegen,
weil sich der audiovisuelle Reiz in die Prämissen der
Massenkommunikation
10
einreiht.
,,Massenkommunikation im herkömmlichen Sinne (Zeitung, Zeitschrift,
Radio, Fernsehen) ist eine Form öffentlicher, indirekter und einseitiger
Kommunikation. [...] Massenkommunikation stellt Inhalte für
weiterführende persönliche Kommunikation bereit, hat also
kommunikationsstiftenden Charakter" (P
ÜRER
2003: 73). Der
Kommunikationsprozess innerhalb der Massenkommunikation
11
kann
10
Aus dem Englischen ,,mass communication".
11
,,In einem engeren Sinne versteht man unter Massenkommunikation von professionellen
Kommunikatoren (also von Journalisten, Moderatoren, Kommentatoren, Entertainern etc.)
öffentlich, indirekt, über technische Medien (Presse, Radio, Fernsehen) und weitestgehend
einseitig an eine Vielzahl von Menschen gerichtete Aussagen (informierender, bildender,
überredender oder unterhaltender Natur), die von ihrem Empfänger entschlüsselt sowie mit
Sinn verbunden und mit Bedeutung versehen werden" (P
ÜRER
2003: 75).
21
D
E R A U D I O V I S U E L L E
M
E D I E N R E I Z
auf drei Bestandteile heruntergebrochen werden: Sender, Nachricht,
Empfänger. Auf diese Weise folgt die mediale Nabelschau auf die
Welt. ,,Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir
leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien" (L
UHMANN
1995:
5). Niklas Luhmann bekräftigt die exponierte Stellung der
Massenmedien in Deutschland: ,,Was wir über die Stratosphäre
wissen, gleicht dem, was Platon über Atlantis weiß: man hat davon
gehört" (ebd.). Die Realität erliegt also über die Massenmedien einem
Konstruktivismus, einem Medienrealitäts-Konzept. Durch Selektions-,
Interpretations- und Präsentationsmechanismen wird aus Mangel an
Primärerfahrungen ein spezielles Realitätskonstrukt geschaffen.
Aber: Die Medien bieten der Gesellschaft eine Informationsquelle. Sie
machen es möglich, dass jeder Einzelne die von Ihnen durch
Selektion, Aufbereitung und Übermittlung bearbeitete Informationen
erhalten kann. Diese Aufgabe ist u.a. für den Sportinteressierten von
besonderem Interesse, da der Zugang zu Sportereignissen aus
räumlichen, zeitlichen und ökonomischen Gründen nur sehr
eingeschränkt möglich ist.
Diesen Eigenschaften der Medien steht gegenüber, dass auf Seiten
der Rezipienten zumeist nur eine ungenügende oder auch gar keine
Reflexion der Informationen möglich ist. Innerhalb der Massenmedien
besteht kaum eine Nachfragemöglichkeit. Fragen und Unklarheiten
bleiben bestehen. Wir erfahren die Welt nicht mehr unmittelbar,
sondern über die Medien. Und dieses Abbild der Welt erscheint
hauptsächlich durch die Linse des Fernsehens. Ein zwangsweise
verfälschender Blick. Denn so wenig wie es eine Landkarte geben
kann, die im Sinne einer umfassenden Detailbeschreibung des
Landstrichs optimal genau ist, so wenig können die Massenmedien
wahr sein.
Auf diese Tatsache wird bei der engeren Sicht auf den audiovisuellen
Medienreiz und dessen Spezifik noch näher einzugehen sein. Was
aber ist Fernsehen? ,,[...] ein flüchtiges Medium, zumal das Tempo der
Informationsaufnahme durch die Programmabfolge vorgegeben ist, der
Zuschauer keinen Überblick über den Text bzw. die unmittelbare
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (Paperback)
- 9783836600880
- ISBN (eBook)
- 9783956361463
- Dateigröße
- 989 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln – Kommunikation und Medien, Sportpublizistik
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- medienberichterstattung sportwissenschaften kommunikation liveübertragung medien
- Produktsicherheit
- Diplom.de