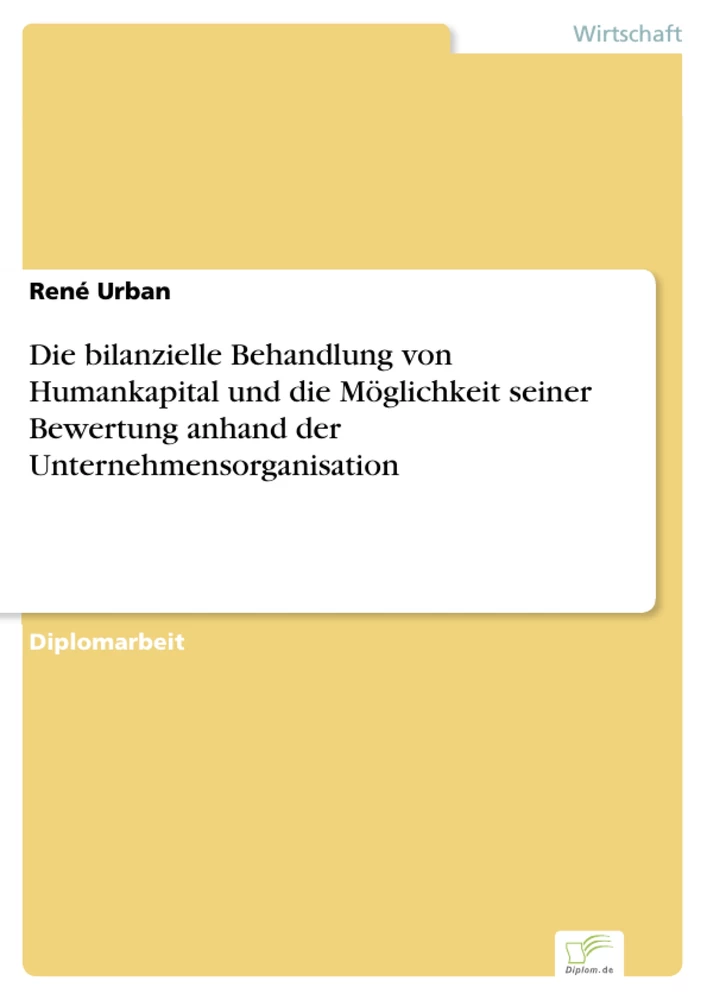Die bilanzielle Behandlung von Humankapital und die Möglichkeit seiner Bewertung anhand der Unternehmensorganisation
©2006
Diplomarbeit
99 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestellung nach der bilanziellen Behandlung des menschlichen Potentials privatwirtschaftlicher Unternehmen: dem Humankapital.
Dabei beginnt die Problemstellung bereits bei der unumgänglichen Auseinandersetzung mit dem Bilanzbegriff. Kann zum Beispiel die Fokussierung auf gesetzlich normierte Rechnungslegungsstandards dem Beobachtenden ein vollständiges Abbild der Unternehmenssituation liefern? Welche Aussagekraft in Bezug auf das Kriterium der vollständigen Darstellung der ökonomischen Realität von Unternehmen haben externe Bilanzen, die nach den wichtigsten kodifizierten Rechnungslegungsstandards aufgestellt sind?
Eine unternehmerische Bilanzierung muss, wenn sie als vollständig gelten soll, umfassend alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte, d.h. auch das Humankapital, eines Unternehmens repräsentieren. Dieser Anspruch wird von keiner externen Unternehmensbilanz, als eine stark reglementierte Ausprägung möglicher bilanzieller Modellvariationen, erfüllt. Regelmäßig bewerten Wirtschaftssubjekte, wie der Aktienmarkt exemplarisch zeigt, Unternehmen anders, als es durch Geschäftsberichte und Jahrsabschlüsse dokumentiert wird. Die Divergenz zwischen beiden Wertaussagen über Unternehmen ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Begründung dessen wird grundsätzlich mit der fehlenden unternehmerischen Bewertungsmöglichkeit der wichtigsten immateriellen Vermögenswerte geführt. Wobei das Humankapital in diesem Zusammenhang als eine Hauptkomponente diskutiert wird.
Die zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einsetzende Transformation der industrialisierten Volkswirtschaften zu Informations- und Wissensgesellschaften ist in dieser Beziehung jedoch nicht der Grund, warum es überhaupt notwendig ist, sich über das in Unternehmen existierende Humankapital und die Möglichkeiten seiner Bewertung Gedanken zu machen. Es lässt sich durch Modellannahmen realitätsnaher Prämissen herleiten, dass es wirtschaftstheoretisch nicht begründbar ist, Humankapital nicht zu bilanzieren. Es war schon immer erforderlich, aber erst in Folge der unübersehbaren Entwicklung der zunehmenden divergenten Aussagen zwischen Bilanz- und Marktbewertung in den zurückliegenden 20 Jahren wurde es besonders offenkundig.
Für die wissenschaftliche Diskussion ergibt sich bei der Zielsetzung, das intangible asset Humankapital zu erfassen, zu messen und […]
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestellung nach der bilanziellen Behandlung des menschlichen Potentials privatwirtschaftlicher Unternehmen: dem Humankapital.
Dabei beginnt die Problemstellung bereits bei der unumgänglichen Auseinandersetzung mit dem Bilanzbegriff. Kann zum Beispiel die Fokussierung auf gesetzlich normierte Rechnungslegungsstandards dem Beobachtenden ein vollständiges Abbild der Unternehmenssituation liefern? Welche Aussagekraft in Bezug auf das Kriterium der vollständigen Darstellung der ökonomischen Realität von Unternehmen haben externe Bilanzen, die nach den wichtigsten kodifizierten Rechnungslegungsstandards aufgestellt sind?
Eine unternehmerische Bilanzierung muss, wenn sie als vollständig gelten soll, umfassend alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte, d.h. auch das Humankapital, eines Unternehmens repräsentieren. Dieser Anspruch wird von keiner externen Unternehmensbilanz, als eine stark reglementierte Ausprägung möglicher bilanzieller Modellvariationen, erfüllt. Regelmäßig bewerten Wirtschaftssubjekte, wie der Aktienmarkt exemplarisch zeigt, Unternehmen anders, als es durch Geschäftsberichte und Jahrsabschlüsse dokumentiert wird. Die Divergenz zwischen beiden Wertaussagen über Unternehmen ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Begründung dessen wird grundsätzlich mit der fehlenden unternehmerischen Bewertungsmöglichkeit der wichtigsten immateriellen Vermögenswerte geführt. Wobei das Humankapital in diesem Zusammenhang als eine Hauptkomponente diskutiert wird.
Die zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einsetzende Transformation der industrialisierten Volkswirtschaften zu Informations- und Wissensgesellschaften ist in dieser Beziehung jedoch nicht der Grund, warum es überhaupt notwendig ist, sich über das in Unternehmen existierende Humankapital und die Möglichkeiten seiner Bewertung Gedanken zu machen. Es lässt sich durch Modellannahmen realitätsnaher Prämissen herleiten, dass es wirtschaftstheoretisch nicht begründbar ist, Humankapital nicht zu bilanzieren. Es war schon immer erforderlich, aber erst in Folge der unübersehbaren Entwicklung der zunehmenden divergenten Aussagen zwischen Bilanz- und Marktbewertung in den zurückliegenden 20 Jahren wurde es besonders offenkundig.
Für die wissenschaftliche Diskussion ergibt sich bei der Zielsetzung, das intangible asset Humankapital zu erfassen, zu messen und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
René Urban
Die bilanzielle Behandlung von Humankapital und die Möglichkeit seiner Bewertung
anhand der Unternehmensorganisation
ISBN-13: 978-3-8366-0040-8
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Fachhochschule Lausitz, Senftenberg, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
VORWORT
Den nachfolgenden Ausführungen möchte ich gern einige Worte voranstellen.
Zunächst danke ich besonders meiner Familie für die wohl wollende Unterstützung
während meiner Studienjahre.
Meinen fachlichen Dank richte ich in erster Linie an Herrn Prof. Dr. Schmid
Schönbein. Bereits im Verlauf des Studiums habe ich viel aus seinem enormen
Fundus ökonomischen Wissens gelernt und konnte dank seiner Lehre meinen
Horizont erweitern.
Die Zusammenarbeit im Rahmen der Diplomandentätigkeit war ebenfalls ein großer
Zugewinn für mich.
Seinen Hinweisen und Anregungen bin ich sehr dankbar, da sie mir halfen, mich dem
schwierigem Thema des unternehmerischen Humankapitals umfassend und aus
verschiedenen Perspektiven zu nähern.
Herrn Prof. Dr. Schröder danke ich, dass er sofort gern bereit war mir als
Zweitgutachter zur Verfügung zu stehen und für seine interessanten Vorlesungen,
die ich sehr gern besucht habe.
Einen weiteren großen Dank möchte ich Herrn Dipl. Kfm. / MBA Fiebes aussprechen,
der sich neben seiner Managertätigkeit die Zeit nahm, mich zu unterstützen und mir
immer ein sehr guter Ratgeber war.
Sowohl bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zum Thema Humankapital, als
auch bei formalen Angelegenheiten profitierte ich von seinen reichhaltigen
Erfahrungen und umfangreichen Kenntnissen.
I
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I
Inhaltsverzeichnis
II
Abbildungsverzeichnis
IV
Tabellenverzeichnis
V
Abkürzungsverzeichnis VI
1 Einführung
1.1 Die Problemstellung und das Ziel der Arbeit
1
1.2
Gang
der
Untersuchung
3
2 Empirische Relevanz und theoretische Einordnung des Humankapitals
2.1
Unternehmerischer
Erkenntnisbedarf
4
2.2 Das bilanzielle Humankapital im Kontext des Aktienmarktes
6
2.2.1
Die
Modelldivergenz
der
Bilanz
6
2.2.2 Die Bewertung des Aktienmarktes als Effizienzkriterium
9
2.2.3 Das Modell Bilanz
10
2.2.4 Das immaterielle Vermögen als Erklärung der Divergenz
12
2.3 Die Evolution der betriebswirtschaftlichen Humankapitaltheorie
15
2.4
Die
Spezifizierung
des
Humankapitals
18
2.4.1
Humankapitaldefinitionen
18
2.4.2
Kategorisierungen
des
Humankapitals
20
2.5 Die Problemkonstellation der Humankapitalbewertung
22
2.5.1
Die
Grundrestriktion 22
2.5.2
Die
Identifizierbarkeit
23
2.5.3 Die Übertragbarkeit und die wirtschaftliche Verfügungsmacht
26
2.5.4 Das Humankapital als organisationsinhärenter Wert
27
2.6
Modellklassifizierungen
28
2.6.1 Möglichkeiten und Grenzen der Modellklassifizierungen
28
2.6.2 Die Modellklassifizierung nach der Ergebnisformulierung
30
2.6.2.1 Modelle mit expliziter Betrachtung des Humankapitals
30
2.6.2.2 Modelle mit impliziter Betrachtung des Humankapitals
31
II
3 Modellanalysen und die Untersuchung der Auswirkung determinierender
Prämissensetzung
3.1
Modellanalysen
32
3.1.1 Das Human Resource Accounting Konzept
32
3.1.1.1 Die Bewertung auf Basis zukünftiger Einkünfte
37
3.1.1.2 Die Methode der zukünftigen Leistungsbeiträge
39
3.1.2 Modelle zur Wertbestimmung des kumulierten Humankapitals
42
3.1.2.1
Der
Skandia
Navigator
42
3.1.2.2
Die
Saarbrücker
Formel 46
3.1.3 Modelle zur Wertbestimmung des individuellen Humankapitals
50
3.1.3.1
Der
Human
Economic
Value
Added
50
3.1.3.2 Das Human Capital Pricing Model
53
3.2
Die
Grundzüge
der
Modelllandschaft
56
3.3
Mögliche
Schlussfolgerungen
57
3.4
Die
Irrelevanz
des
Humankapitals 59
3.4.1
Das
Fisher
Separationstheorem
59
3.4.2 Konsequenzen aus den Modellprämissen
60
3.5 Die Aufhebung der Irrelevanz des Humankapitals
63
3.5.1 Die Umwandlung Modell determinierender Prämissen
63
4 Die mögliche Anwendung der Neuen Institutionenökonomie zur
Bewertung von Humankapital anhand der Unternehmensorganisation
4.1 Die Eignung der NIÖ Theorien als Folge der Prämissenumwandlung
64
4.2 Die Theorien der Neuen Institutionenökonomie
66
4.2.1 Die Theorie der Verfügungsrechte
66
4.2.2 Die Theorie der Prinzipal Agent - Beziehung
67
4.2.3 Die Theorie der Transaktionskosten
69
4.3 Konzeptionelle Grundüberlegungen am Beispiel des Vorschlagwesens
71
4.3.1
Begründung
71
4.3.2 Das Transaktionskostenmodell nach Williamson
73
4.3.3 Absolute und relative Humankapitalbewertung
74
4.4
Kritische
Würdigung 77
5
Zusammenfassung
wesentlicher
Erkenntnisse
79
Quellenverzeichnis
X
Anhang
XII
III
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1
4
Abbildung 2
5
Abbildung 3
6
Abbildung 4
8
Abbildung 5
10
Abbildung 6
13
Abbildung 7
20
Abbildung 8
21
Abbildung 9
22
Abbildung 10
24
Abbildung 11
27
Abbildung 12
28
Abbildung 13
33
Abbildung 14
34
Abbildung 15
35
Abbildung 16
42
Abbildung 17
43
Abbildung 18
54
Abbildung 19
57
Abbildung 20
58
Abbildung 21
60
Abbildung 22
73
Abbildung 23
74
Abbildung 24
76
IV
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1
7
Tabelle 2
17
Tabelle 3
25
Tabelle 4
28
Tabelle 5
30
Tabelle 6
31
Tabelle 7
36
Tabelle 8
38
Tabelle 9
51
Tabelle 10
64
V
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
A
Anhang
Abb.
Abbildung
a.E.
andere
Einheiten
B2B
Business
to
Business
ca.
circa
CAPM
Capital
Asset
Pricing
Model
c.p.
ceteris
paribus
DAX
Deutscher
Aktien
Index
DGFP e.V.
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
d.h.
das
heißt
DJIA
Dow Jones Industrial Average
DRS
Deutsche
Rechnungslegungsstandards
EG
Europäische
Gemeinschaft
EVA
Economic
Value
Added
Euro
ff.
fortfolgend
GE
Geldeinheiten
gebr. Abk.
gebräuchliche Abkürzungen
HCPM
Human Capital Pricing Model
HEVA
Human Economic Value Added
HGB
Handelsgesetzbuch
HK
Humankapital
HRA
Human
Resource
Accounting
HVR
Humanvermögensrechnung
I Interaktion
IAS
International
Accounting
Standards
i.d.R.
in
der
Regel
IFRS
International
Financial
Reporting
Standards
i.w.S.
im
weitesten
Sinn
KZ
Kennzahl
M&A
Mergers
and
Acquisitions
m.D.
mit
Dimension
ME
Motivationseffekt
Mio.
Million
NIÖ
Neue
Institutionenökonomie
o.D.
ohne
Dimension
ÖPWZ Österreichisches
Produktivitäts- u. Wirtschaftlichkeitszentrum
resp.
respektive
ROI
Return
on
Investment
SAV
Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft
f.
Verbesserungsprozesse
SE
Selektionseffekt
Tab.
Tabelle
TK
Transaktionskosten
u.a.
unter
anderem
US-GAAP
United StatesGenerally Accepted Accounting Principles
v.a.
vor
allem
VV
Verbesserungsvorschlag
VW
Vorschlagwesen
z.B.
zum
Beispiel
VI
1
1 Einführung
1.1
Die Problemstellung und das Ziel der Arbeit
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestellung nach
der bilanziellen Behandlung des menschlichen Potentials privatwirtschaftlicher Unternehmen:
dem Humankapital.
Dabei beginnt die Problemstellung bereits bei der unumgänglichen Auseinandersetzung mit dem
Bilanzbegriff. Kann zum Beispiel die Fokussierung auf gesetzlich normierte
Rechnungslegungsstandards dem Beobachtenden ein vollständiges Abbild der
Unternehmenssituation liefern? Welche Aussagekraft in Bezug auf das Kriterium der vollständigen
Darstellung der ökonomischen Realität von Unternehmen haben externe Bilanzen, die nach den
wichtigsten kodifizierten Rechnungslegungsstandards aufgestellt sind?
Eine unternehmerische Bilanzierung muss, wenn sie als vollständig gelten soll, umfassend alle
materiellen und immateriellen Vermögenswerte, d.h. auch das Humankapital, eines Unternehmens
repräsentieren. Dieser Anspruch wird von keiner externen Unternehmensbilanz, als eine stark
reglementierte Ausprägung möglicher bilanzieller Modellvariationen, erfüllt. Regelmäßig bewerten
Wirtschaftssubjekte, wie der Aktienmarkt exemplarisch zeigt, Unternehmen anders, als es durch
Geschäftsberichte und Jahrsabschlüsse dokumentiert wird. Die Divergenz zwischen beiden
Wertaussagen über Unternehmen ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Begründung dessen wird
grundsätzlich mit der fehlenden unternehmerischen Bewertungsmöglichkeit der wichtigsten
immateriellen Vermögenswerte geführt. Wobei das Humankapital in diesem Zusammenhang als eine
Hauptkomponente diskutiert wird.
Die zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts einsetzende Transformation der
industrialisierten Volkswirtschaften zu Informations- und Wissensgesellschaften ist in dieser
Beziehung jedoch nicht der Grund, warum es überhaupt notwendig ist, sich über das in Unternehmen
existierende Humankapital und die Möglichkeiten seiner Bewertung Gedanken zu machen. Es lässt
sich durch Modellannahmen realitätsnaher Prämissen herleiten, dass es wirtschaftstheoretisch nicht
begründbar ist, Humankapital nicht zu bilanzieren. Es war schon immer erforderlich, aber erst in
Folge der unübersehbaren Entwicklung der zunehmenden divergenten Aussagen zwischen Bilanz-
und Marktbewertung in den zurückliegenden 20 Jahren wurde es besonders offenkundig.
Für die wissenschaftliche Diskussion ergibt sich bei der Zielsetzung, das intangible asset
Humankapital zu erfassen, zu messen und entsprechend zu bewerten eine besondere
Herausforderung. Bis heute gibt es kein weitgehend anerkanntes Modell oder Verfahren, welches die
unternehmerischen Fragestellungen einer intersubjektiv nachvollziehbaren und monetären
Humankapitalbewertung beantwortet.
2
Die betriebswirtschaftlichen Instrumentarien, welche für die Unternehmensbilanzierung von Real- und
Finanzkapital entwickelt wurden, und sich bis in die Gegenwart für diese assets bewährt haben,
greifen für das immaterielle Humankapital nicht.
Die betriebswirtschaftliche Literatur zu dem Thema und Stellungnahmen der Wirtschaftspraxis
belegen die Probleme, welche schon entstehen, wenn es darum geht zu klären was eigentlich
Humankapital ist. Wie kann es umfassend spezifiziert werden? Welche Attribute beschreiben es
vollständig? In welcher Form kann es abgegrenzt und schließlich bewertet werden? In deren Folge
stellt sich die Problematik, ob diese Fragen überhaupt objektiv beantwortet werden können.
Humankapital ist unter ökonomischen Überlegungen wirkliches Kapital. Mindestens seit Gery S.
Becker kann dieser Terminus fundiert auf humanes Leistungsvermögen angewendet werden.
Im Unterschied zu Realkapital folgt das Humankapital, unabhängig was konkret darunter subsumiert
wird, anderen Gesetzmäßigkeiten. Auch auf Gery S. Becker geht die grundlegende Erkenntnis
zurück, dass ein durch hard facts, wie etwa Wissen, Erfahrung oder Kompetenz, beschreibbares
menschliches Produktions- bzw. Leistungspotential, nicht vom individuellen Humankapitalträger ohne
Verlust an Aussagekraft völlig abstrahiert werden kann. Jene Grundrestriktion verursacht, neben der
Tatsache, dass Unternehmen als komplexe Organisationen von vertraglich kooperierenden
Wirtschaftssubjekten definiert werden können, die Humankapital spezifische Problemkonstellation.
Mit den Themen der Identifizierbarkeit, der freiwilligen Übertragung des eigenen Potentials durch den
Humankapitalträger und der Humankapitalwert determinierenden Unternehmensorganisation, die das
spezifische Humankapital immer zu einem organisationsinhärent Wert macht, manifestieren sich die
Eigentümlichkeiten des Human- gegenüber dem Real- und Finanzkapital.
Unter diesen Gesichtspunkten werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit einige relevante
Humankapitalbewertungsmodelle präsentiert, um an ihnen zu zeigen, inwieweit der Stand der
Diskussion Modellaussagen zur Beantwortung des Problemkomplexes liefert.
Zur möglichen Bewertung des Humankapitals anhand der Unternehmensorganisation wird durch die
Untersuchung des Unternehmens als ,,Nexus von Verträgen" herangeführt. Die Argumentation wird
hier über die Darlegung Modell determinierender Prämissen geleitet, mit dem Ziel aufzuzeigen, ob die
Theorien aus der Neuen Institutionenökonomie hilfreich sein könnten, die Aufmerksamkeit abseits der
direkten bilanziellen Behandlung und Bewertung der Humankapitalträger, hin zur Bewertung ihrer
Kontrakt basierten Interaktionen zu lenken. Folgt man der These, dass sich Humankapitalträger in
Unternehmensorganisationen hierarchisch untereinander vertraglich binden, d. h. Unternehmen sind
Orte der Kooperation von unterschiedlich informierten, begrenzt rational und opportunistisch
handelnden Wirtschaftssubjekten zum Austausch von Leistung und Gegenleistung, so soll ein
weiteres Ziel der Arbeit sein, die Möglichkeit zu begründen, Humankapital an jenen Interaktionen
absolut und relativ zu bewerten. Am betrieblichen Vorschlagwesen, als ein Korrektiv zur Behebung
der Herausforderung unvollständiger Arbeitsverträge, werden konzeptionelle Grundüberlegungen
skizziert und die hierbei auftretenden Probleme kurz gewürdigt.
3
1.2
Gang der Untersuchung
Zu Beginn der Arbeit wird einführend der allgemeine unternehmerische Erkenntnisbedarf bezüglich
einer Humankapitalbewertung, und danach in Sonderheit im Kontext des Aktienmarktes, verifiziert.
Um der Divergenzaussage zwischen dem Modell externer Bilanzen und der Marktbewertung
betriebswirtschaftlichen Inhalt zu geben, werden beide Wertaussagen gesondert untersucht. Weil nur
so in der Konsequenz das immaterielle Vermögen, und damit das Humankapital, zur Erklärung der
Divergenz plausibilisiert werden kann.
Nach einer Kurzdarstellung der Evolution der betriebswirtschaftlichen Humankapitaltheorie geschieht
die Beschäftigung mit der Spezifizierung des Humankapitals, d. h. die Erläuterung der Art und Weise
wie dieses intangible asset in der Literatur definiert und kategorisiert wird. Im nächsten Schritt wird die
Basis der Modellanalyse gelegt, in dem die Problemkonstellation der bilanziellen Behandlung und
Bewertung von Humankapital vorgestellt wird.
Die Untersuchung der hier präsentierten sechs Modelle strukturiert sich durchgängig mit der
Einleitung durch ein Verfasser statement, des Nennens der Zielsetzung, einer kurzen
Evolutionsdarstellung, der Operationalisierung des Modells, einem Anwendung Beispiel mit der
Interpretation der Modellaussagen und schließlich der kritischen Würdigung, die sich vor allem an der
zuvor charakterisierten Problemkonstellation orientiert. Zuerst wird das Human Resource Accounting
Konzept und zwei seiner Vertreter, die Bewertung auf Basis zukünftiger Einkünfte und die Methode
der zukünftigen Leistungsbeiträge, präsentiert. Darüber hinaus werden für die Bewertung des
kumulierten Humankapitals der Skandia Navigator und die Saarbrücker Formel, und für die
Bewertung des individuellen Humankapitals der Human Economic Value Added und das Human
Capital Pricing Model vorgestellt.
Nachdem die Modellanalyse abgeschlossen ist, erfolgen kurze Ausführungen zur Modelllandschaft.
Als Konsequenz der diskutierten Problemkonstellation und der Modellanalyse, werden im weiteren
Verlauf denkbare Schlussfolgerungen für eine mögliche Humankapitalbewertung anhand der
Unternehmensorganisation gezogen. Die Argumentation wird mit Hilfe der Untersuchung Modell
determinierender Prämissen und den Auswirkungen ihrer Umwandlung geführt. Nur damit war es
möglich zu begründen, weshalb die Verwendung von Theorien aus der Neuen Institutionenökonomie
zur Problemlösung beitragen könnte.
Die drei Theorierichtungen der Neuen Institutionenökonomie, die Theorie der Verfügungsrechte, die
Theorie der Prinzipal - Agent Beziehung und die Theorie der Transaktionskosten werden kurz
skizziert. Mit der Erkenntnis, dass der Transaktionskostenansatz in besonderem Maße geeignet zu
sein scheint, die Kontrakt basierten Interaktionen von Humankapitalträgern innerhalb der
Unternehmensorganisation zu bewerten, werden diesbezüglich konzeptionelle Grundüberlegungen
am Beispiel des Vorschlagwesens erläutert und diskutiert.
Der letzte Abschnitt fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit kurz zusammen.
4
2
Empirische Relevanz und theoretische Einordnung des Humankapitals
2.1
Unternehmerischer Erkenntnisbedarf
In Geschäfts- und Jahresberichten finden sich vermehrt Stellungnahmen zu den verschiedensten
Aspekten des unternehmerischen Humankapitals. Als Beispiel sei an dieser Stelle aus dem
Jahresbericht 2004 des Automobilzulieferers- und Produzenten KARMANN zitiert:
,,Bei KARMANN sind Mitarbeiter mehr als Produktions- und Kostenfaktoren, ihre Leistungsbereitschaft
und ihr Know - How sind die Basis für die Wettbewerbsfähigkeit und stehen im Mittelpunkt der
Unternehmens- und Personalpolitik. Dabei wird dem individuellen und dem dynamischen
Humankapital gleicher Wert beigemessen. Das individuelle Humankapital beschreibt die Fertigkeiten
und Fähigkeiten, das Wissen, die Erfahrung und Motivation sowie die Innovationsfähigkeit jedes
Einzelnen und ist deshalb bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter unabhängig vom späteren
Einsatzgebiet entscheidend. Das dynamische Humankapital setzt einen Personalprozess voraus, der
die unterschiedlichen Anforderungsprofile und Potentiale der Mitarbeiter berücksichtigt. Persönliche
Leistungen, Stärken und Erfolge müssen honoriert und Schwächen durch geeignete Maßnahmen
dauerhaft behoben werden."
1
Im Kontext von Investitionsentscheidungen lässt sich der Erkenntnisbedarf an Modellen zur
Humankapitalbewertung besser veranschaulichen. Die Ergebnisse einer bei vornehmlich
schweizerischen Investoren durchgeführten Befragung aus dem Jahr 1997 zeigen folgendes Bild:
Relevanz des Humankapitals bei der Bewertung von
Dienstleistungsunternehmen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
sehr wichtig
wichtig
relativ
unwichtig
unwichtig
keine Antwort
Abb.1 Relevanz des Humankapitals bei der Bewertung von
Dienstleistungsunternehmen
2
1
http://www.karmann.de , Zugriff am 30.10.2005
2
Huber, Bewertung von Dienstleistungsunternehmen, Dissertation Universität Zürich, 1998, S.103
5
Ein Resultat, der für die Schweiz repräsentativen Umfrage, ist, dass 56% der Investoren es als ,,sehr
wichtig" einstufen, das Humankapital in die Gesamtunternehmensbewertung einfließen zu lassen.
,,Relativ unwichtig" und ,,unwichtig" sind Relevanzzuordnungen, die mit 7% bzw. 2,5% einen sehr
geringen Anteil haben.
Die Dringlichkeit einer intersubjektiv überprüfbaren, vergleichbaren und aussagefähigen Erfassung,
Messung und Bewertung von Humankapital ist empirisch verifizierbar. Sie beruht im Kern darauf,
dass Unternehmensinformationen, welche zum Beispiel durch Bilanzen zur Verfügung gestellt werden
nicht ausreichend sind. Da etwa das Humankapital aufgrund fehlender Modelllösungen nicht erfasst
resp. bilanziert wird.
Misst man die Qualität publizierter Humankapitalbewertungsmodelle an ihrer Anwendung, die noch
keine bilanzielle Dokumentation einschließt, so muss konstatiert werden, dass der Bedarf an
geeigneten Instrumentarien nicht gedeckt wird. Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V.
führt seit 2004 eine Befragung ihrer ordentlichen Mitgliedsunternehmen zur Professionalisierung des
Personalmanagements durch. Ihre zweite Erhebung fand im April 2005 statt
3
. Die Frage, ob der
ökonomische Wert der Belegschaft ermittelt wird beantworteten die Teilnehmer überwiegend mit nein:
Wird der ökonomische Wert der Belegschaft ermittelt?
83,1%
15,8%
1,1%
Nein
Ja, mit quantitativen
und/oder qualitativen
Indikatoren
Ja, mit einer
Humanvermögensrechnung
Abb. 2 Wird der ökonomische Wert der Belegschaft ermittelt?
4
Da Befragungen statistisch zwar als repräsentativ qualifiziert werden können, sie aber dennoch einen
gewissen Interpretationsspielraum lassen, ist es erforderlich einen weiteren Beleg für die empirische
Relevanz aufzuzeigen. Insbesondere der Aktienmarkt scheint hierfür ein geeignetes
Betrachtungsobjekt zu sein, der es zugleich erlaubt anhand der externen Bilanzpraxis für das
immaterielle Vermögen, dessen Besonderheiten aufzuzeigen. Und im Weiteren zu erklären, welches
komplexe Problemfeld entsteht unternehmerisches Humankapital Bilanz fähig zu erfassen. Gilt sie
doch als das Standardmodell zur Abbildung der Unternehmenssituation.
3
Weitere Daten der Erhebung durch die DGFP e.V. befinden sich im Anhang (A1).
4
http://www.dgfp.com, Zugriff vom 30.10.2005
6
2.2
Das bilanzielle Humankapital im Kontext des Aktienmarktes
2.2.1
Die Modelldivergenz der Bilanz
Die Leistungsfähigkeit börsennotierter Unternehmen lässt sich durch deren Marktwert beschreiben.
Wird dieser Bewertung der Bilanzwert gegenübergestellt, erhält man damit eine Vergleichsmöglichkeit
zwischen einem betriebswirtschaftlichem Modell, der Bilanz als Abbildung der
Unternehmenssituation, und einer realökonomischen Beurteilung.
D.h. die Divergenz zwischen beiden Wertangaben ist ein adäquates Maß zur Beurteilung der
Aussagequalität des Modells Bilanz:
DJIA Price to Book Ratio
0
1
2
3
4
5
6
1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Abb. 3 Markt Buchwert-Relation der im Dow Jones Industrial Average (DJIA)
gelisteten Firmen mit Darstellung des Trends im Betrachtungszeitraum 1935 bis 2000
5
Im Zeitablauf ist die zurückgehende Aussagequalität des Modells Bilanz an der zunehmenden
Divergenz abzulesen. Der Abstand zwischen bilanzieller Abbildung und dem Wert den die
Wirtschaftssubjekte am Markt dokumentieren, wird in der Literatur u. a. durch den originären Goodwill
beschrieben, der ,,sich während der Geschäftstätigkeit aufgrund von Vorteilen hinsichtlich
Organisation, Know - How, Kundenstamm, Qualität des Managements (...) gebildet hat."
6
Nach den
Rechnungslegungsstandards HGB, IAS / IFRS und US GAAP besteht für dieses selbst geschaffene
immateriellen Vermögen ein Aktivierungsverbot. Aktivierungsfähig wird erst der derivative, d. h. bei
Übernahmen entgeltlich erworbene, Goodwill in den drei Rechnungslegungsstandards. Nach
deutschem Handelsrecht
7
darf der Unterschiedsbetrag zwischen dem Zeitwert der Aktiva abzüglich
der Schulden und der Gegenleistung im Zuge eines asset deals angesetzt werden.
,,Bei IFRS (IFRS 3.51) und US-GAAP (FAS 141.43) muss er bilanziert werden."
8
5
Schäfer/Lindenmayer, Externe Rechnungslegung u. Bewertung v. Humankapital, Böckler Stiftung, 2004, S.36
6
Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Schäffer-Poeschel, 2005, S.149
7
HGB § 255 (4)
8
Vgl. Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Schäffer-Poeschel, 2005, S.149 ff.
7
Im Ergebnis dessen findet eine ,,Internalisierung des immateriellen Vermögens nur durch Fusionen
statt, die dessen bilanzielle Würdigung erlauben."
9
Bedingt durch eine Vielzahl von M&A Aktivitäten
ist immaterielles Vermögen, und damit implizit Humankapital, als derivativer Goodwill ein
bedeutendes bilanzielles Aktivum geworden:
Aktiva
Goodwill /
Goodwill /
(Total)
Eigenkapital
Aktiva
PREUSSAG
5.183
2.961
17.863
175,0%
29,0%
EPCOS
657
561
1.031
117,1%
50,5%
METRO
4.036
3.452
18.909
116,9%
21,3%
ADIDAS-SALOMON
709
638
3.587
111,1%
19,8%
DEUTSCHE TELEKOM
35.754
36.537
123.767
97,9%
28,9%
LINDE
3.387
3.947
11.667
85,8%
29,0%
HENKEL
2.602
3.066
11.085
84,9%
23,5%
THYSSEN-KRUPP
4.269
7.685
35.888
55,5%
11,9%
BASF
4.538
12.599
37.287
36,0%
12,2%
DEUTSCHE BANK
8.553
26.708
940.033
32,0%
0,9%
BAYER
4.843
15.118
36.038
32,0%
13,4%
ALLIANZ
10.394
35.235
411.520
29,5%
2,5%
SIEMENS
6.367
23.228
76.901
27,4%
8,3%
E.ON
3.399
13.754
52.384
24,7%
6,5%
RWE
1.421
5.843
58.103
24,3%
2,4%
SCHERING
454
1.933
4.629
23,5%
9,8%
DEGUSSA
522
2.281
19.158
22,9%
2,7%
BAYER.HYPO-UND VBK.
3.862
19.139
716.514
20,2%
0,5%
MÜNCHNER RÜCK
3.468
23.381
183.401
14,8%
1,9%
MAN
337
2.499
11.193
13,5%
3,0%
COMMERZBANK
1.517
12.004
459.685
12,6%
0,3%
VOLKSWAGEN
965
10.981
81.593
8,8%
1,2%
DAIMLERCHRYSLER
3.113
40.051
199.274
7,8%
1,6%
SAP
116
2.894
5.281
4,0%
2,2%
BMW
103
4.623
35.334
2,2%
0,3%
LUFTHANSA
0
3.885
14.792
0,0%
0,0%
INFINEON TECHNOLOGIES
0
5.399
8.853
0,0%
0,0%
FRESENIUS MED. CARE
1
1.559
1.868
0,0%
0,0%
Eigenkapital
Goodwill
Unternehmen
Tab. 1 Die Bedeutung von Goodwill für die Kapitalstruktur ausgewählter Unternehmen
des DAX 30 (in Mio. )
10
Aus den Bilanzkennzahlen darf aber nicht gefolgert werden, dass immaterielles Vermögen durch eine
Aktivierung des derivativen Goodwill ausreichend berücksichtigt wird. Vielmehr wird der Widerspruch
deutlich. Da diese Rangfolge letztendlich darauf beruht, in welchem Umfang M&A Aktivitäten getätigt
wurden, wird eben nicht das selbst geschaffene immaterielle Vermögen klar. So ist die niedrige
Rangposition von SAP im Verhältnis zu PREUSSAG unkompatibel mit der Überlegung, dass
wissensintensive Branchen durch einen höheren Anteil immateriellen gegenüber materiellen
Vermögens gekennzeichnet sind.
9
Schäfer/Lindenmayer, Externe Rechnungslegung u. Bewertung v. Humankapital, Böckler Stiftung, 2004, S.36
10
Schäfer/Lindenmayer, Externe Rechnungslegung u. Bewertung v. Humankapital, Böckler Stiftung, 2004, S.37
8
Dieses ist zwar nicht in der Bilanz zu sehen, vergleicht man die 5,3 Mio. SAP - Aktiva mit den 17,9
Mio. PREUSSAG - Aktiva, und trotzdem vom Markt bewertet. ,,SAP hatte im Jahr 1999 eine
Marktkapitalisierung, die das bilanzielle Eigenkapital um rund das 20fache überstieg."
11
Das Problem der Divergenz sollte demnach bei Unternehmen aus den Bereichen der
Informationstechnologie, der Dienstleistungen, also Branchen mit einer tendenziell geringen
Ausstattung an Realkapital besonders gut beobachtbar sein.
Entwicklung von Markt- und Buchwerten
0
2
4
6
8
10
12
14
1960
1970
1980
1990
2000
V
er
h
äl
tn
is
M
ar
kt- z
u
B
u
ch
wer
t
Wissensbasierte Unternehmen
Durchschnitt
Abb. 4 Der höhere Anteil immaterieller Werte in Wissen basierten Unternehmen führt
zu einer größeren Differenz zwischen Markt- und Buchwert, als bei traditionellen
Unternehmen
12
Es lässt sich anhand der Beobachtung Wissen basierter Unternehmen bekräftigen, dass
immaterielles Vermögen in die Bewertung der Märkte eingeht, dieses jedoch nicht hinreichend durch
Buchwerte in den externen Bilanzen dokumentiert wird.
Mit den Ausführungen zur Modelldivergenz kann das Problem der bilanziellen Behandlung und der
Bewertung von immateriellen Werten wie dem Humankapital nicht hinreichend charakterisiert werden.
An dieser Stelle bedarf es einer kurzen Betrachtung beider Werte, Aktienmarktbewertung und Bilanz-
Modell. Nur auf diesem Weg ist es möglich der Divergenz Aussage betriebswirtschaftlichen Inhalt zu
geben. Um darauf aufbauend die Schwierigkeiten der bilanziellen bzw. unternehmerischen
Behandlung und Bewertung des Humankapitals, als Teil des immateriellen Vermögens, analysieren
zu können.
11
Schäfer/Lindenmayer, Externe Rechnungslegung u. Bewertung v. Humankapital, Böckler Stiftung,2004, S.35
12
Hasebrook/Zawacki-Richter, Personalwirtschaft, November 2004, S.34
9
2.2.2
Die Bewertung des Aktienmarktes als Effizienzkriterium
Aktienbesitzer sind Investoren mit dem Status von Eigenkapitalgebern. Der Börsenhandel unterzieht
diese Vermögenstitel einer permanenten Bewertung. Da diese Bewertung ein Marktergebnis ist, kann
man sie, der ,,Hypothese der Markteffizienz" folgend, als ökonomisch effiziente Bewertung gelten
lassen.
13
Entscheidend ist dabei wie die Marktteilnehmer Aktien bewerten.
,,Der Preis einer Aktie stellt den Gegenwartswert eines Stromes an Dividenden dar, den die Leute von
der Gesellschaft erwarten. Der gesamte Wert eines Unternehmens am Aktienmarkt stellt den
Gegenwartswert der Gewinne dar, den man von der Gesellschaft erwartet."
14
Dieser Argumentation
folgend, lässt sich der Aktienkurs ,,formal durch seinen Fundamentalwert beschreiben. Im Ergebnis
wird dann unter realer Betrachtung der Aktienkurs nur noch durch die Abdiskontierung der erwarteten
zukünftigen Erträge, ohne Berücksichtigung künftiger Kurse, gebildet. Eine Abweichung vom
Fundamentalwert des Aktienkurses kann unter anderem mit Phänomenen wie Noise-trader und mit
Spekulationsblasen diskutiert werden."
15
Häufig fokussiert sich die Kritik an den Kapitalmärkten auf kurzzeitige Entwicklungen. Diese können
aber das Effizienzkriterium nicht fundamental falsifizieren. Essentiell ist die Beachtung der
langfristigen Tendenzen. Diese lassen sich an erwarteten Entwicklungen der wichtigsten
Geschäftsfelder fest machen. Für SAP zum Beispiel gilt ,,das Geschäft mit neuen Softwarelizenzen in
der Branche als entscheidender Gradmesser für künftige Gewinne und wird deshalb besonders
beachtet."
16
Das Effizienzkriterium des Aktienmarktes unterstellt dem Markt ein Wissen über die Zukunft, welches
sich aufgrund bestehender Daten bildet. Wobei unter Daten nicht nur die veröffentlichten
Geschäftszahlen bzw. das stark reglementierte Instrument der Bilanz zu verstehen sind. Darüber
hinaus bewerten vor allem professionelle Anleger die Unternehmensstrategien sowie die Fähigkeiten
des Managements diese zu implementieren. Der Informationsstand über die Datenlage der
Unternehmen ist aufgrund der IT Lösungen und der Regeln zu Informationspflicht, wie die ad hoc
Mitteilungspflicht
17
, kostengünstig und zeitnah. Es wäre nutzlos für Anleger Daten über die Bilanz
hinaus zu erheben, wenn die Abbildung eines Unternehmens durch sie vollständig wäre.
Unbeschadet einer möglichen Kritik an der Effizienz von Aktienmärkten, ist es akzeptabel, deren
Urteilskraft zu vertrauen. Während die Erwartung eines einzelnen Individuums über die zukünftigen
Erträge eines Unternehmens in Zweifel gezogen werden können, ist die Markterwartung ein objektiver
Maßstab.
Die ,,Hypothese der Markteffizienz" erlaubt daher die Beurteilung von Modellen, wie das der Bilanz,
welche eine Wertaussage über Unternehmen zum Ziel haben.
13
Vgl. Burda /Wyplosz, Makroökonomie, Vahlen, 2001, S.587
14
Varian, Grundzüge der Mikroökonomik, Oldenbourg, 2001, S.318
15
Vgl. Burda/Wyplosz, Makroökonomie, Vahlen, 2001, S.584
16
Kagermann, Börsen-Zeitung, Frankfurt / Main, vom 11.Januar 2006
17
§ 15 WpHG
10
2.2.3
Das Modell Bilanz
Als Resultat der doppelten Buchführung, die in der Ökonomiegeschichte dem italienischen Mönch
Lucia Pacioli (1445-1514) zugeschrieben wird, sollen in der Bilanz alle Vermögens- und
Schuldenpositionen in Kontoform dargestellt werden. Dabei ist die Aktivseite als Mittelverwendung
und die Passivseite als Mittelherkunft charakterisiert. Oberflächlich betrachtet, scheint das ein trivialer
Sachverhalt zu sein. Gleichwohl zeigen u.a. die komplizierten Rechtsbestimmungen der
Unternehmensbilanzierung und die angestrebte Harmonisierung zwischen kontinentaleuropäischer
und anglo - amerikanischer Rechnungslegung die Komplexität des Problems.
Alle Bilanzrichtlinien beruhen auf Bilanz theoretischen Auffassungen ,,was in der Bilanz als Vermögen
und was als Schulden anzusetzen ist. Kennzeichen der Bilanztheorien ist, dass sie unabhängig von
rechtlichen Regelungen versuchen, aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen, den Sinn und Zweck
des Jahresabschlusses, dessen Konzeption und dessen Ausgestaltung herzuleiten."
18
Wobei ,,für die
in der Praxis geltenden rechtsverbindlichen Rechnungslegungssysteme Bilanztheoriepluralität gilt."
19
Bilanz theoretische Auffassungen können wie folgt zusammengefasst werden:
Ausprägungen
Dynamische
Organische
Kapitaler-
Zukunfts-
Anti-
An einer Ver-
Bilanz-
Bilanz-
haltungs-
orientierte
Bilanz-
besserung d.
auffassung
auffassung
orientierte
Bilanz-
konep-
Handelsbilanz
ältere
neuere
Bilanz-
konep-
tionen
orientierte
konzep-
tionen
Konep-
tionen
tionen
Hauptvertreter
vorwiegend
Nicklisch,
Schmalen-
F. Schmidt,
K. Hax,
Käfer, Honko,
Moxter,
Stützel,
Juristen (z.B.
Le Coutre,
bach,Walb,
Hasenack
Feuerbaum
Seicht,Albach
Busse von
Engels,Koch,
Simon)
Rieger
Sommerfeld,
Colbe, Leffson,
Kosiol
D.Schneider
Schweitzer
Bilanzauffassungen
Klassische Konzeptionen
Neuere Ansätze
Statische Bilanzauffassung
Abb. 5 Bilanzauffassungen und ihre Hauptvertreter
20
Widmet man sich den externen Rechnungslegungsvorschriften ,,und damit dem Jahresabschluss im
Rechtssinne lässt sich der Einfluss verschiedener Bilanzauffassungen erkennen und vor allem wird
deutlich, dass die Zwecke des handelsrechtlichen Jahresabschlusses Bezüge zu verschiedenen
theoretischen Auffassungen haben."
21
Deren kontinental-europäische oder anglo - amerikanische
Herkunft hat dabei Grundsatzcharakter.
Die deutsche externe Rechnungslegung ,,orientiert sich am Gläubigerschutz Prinzip und der
Kapitalerhaltung, während die angelsächsische Rechnungslegung traditionell Kapitalmarkt orientiert
ist, d. h. die Sicht des Investors im Mittelpunkt steht."
22
18
Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, IDW, 2005, S.12
19
Schäfer/Lindenmayer,Externe Rechnungslegung u. Bewertung v. Humankapital, Böckler Stiftung, 2004, S.19
20
Schierenbeck, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Oldenbourg, 2000, S.516
21
Baetge/Kirsch/Thiele, Bilanzen, IDW, 2005, S.12
22
Meyer, Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, nwb, 2005, S.315
11
Das deutsche Handelsrecht interpretiert zum Beispiel die Aktivseite überwiegend im Sinne ,,einer
Zusammenstellung von einzelnen Haftungsgegenständen"
23
und folgt damit besonders der
Zerschlagungsstatik als ein zentrales Charakteristikum der klassischen Konzeptionen.
Andere grundsätzliche Charakteristika klassischer Auffassungen sind die ,,periodengerechte
Gewinnermittlung unter in Kaufnahme einer verzerrten Vermögensdarstellung innerhalb der
dynamischen Bilanzauffassung oder das Ziel, die leistungswirtschaftliche Substanz eines
Unternehmens aufzuzeigen, was unter Berücksichtigung Inflation bedingter Scheingewinne geschieht
und einer organischen Bilanzauffassung zu zuordnen ist."
24
Die Schlussfolgerung ist, dass jeder Vermögensausweis, wie eine externe Bilanz, aufgestellt nach
den geltenden Rechtsbestimmungen, lediglich eine spezifische Ausprägung der Vielzahl bilanzieller
Modellvariationen ist. Für die ökonomische Betrachtung der Unternehmenssituation, wie es oben
empirisch bestätigt wurde, genügt daher nicht der Blick in die externe Bilanzierung, die durch
kodifizierte Anordnungen eine stark reglementierte Version ist. Die Vielzahl der Bilanzarten,
Handelsbilanz, Steuerbilanz, Sozialbilanz u. a.
25
, deutet darauf hin, dass eine
Unternehmensabbildung sehr verschieden möglich ist und eine alleinige Fokussierung auf die externe
Rechnungslegung ein unzureichendes Bild ergeben kann. Weil hierbei im Besonderen die
Zielsetzungen des Gesetzgebers berücksichtigt werden müssen. Deswegen muss das, was unter
einer Unternehmensbilanzierung verstanden wird, immer vor dem Hintergrund Bilanz theoretischer
Grundüberlegungen gesehen werden. Denn die ,,Diskussion unter der Bezeichnung Bilanztheorien
über Inhalt und Ausgestaltung des Jahresabschlusses (...) hat in der Betriebswirtschaftslehre eine
lange Tradition. Dementsprechend liegt allein im deutschsprachigen Schrifttum eine kaum noch
überschaubare Fülle von Monographien und sonstigen Beiträgen über bilanztheoretische
Fragestellungen vor."
26
D. h. wenn man von bilanzieller Behandlung spricht, kann und sollte man sich
von einer Vorstellung lösen, die sich allein an gesetzlichen Rechnungslegungsstandards orientiert.
Viel mehr scheint es sinnvoll, zu überlegen ,,was in der Bilanz als Vermögen und was als Schulden
anzusetzen ist", wenn die Unternehmensbilanzierung umfassender die materiellen und die
immateriellen Werte sichtbar machen soll. In diesem Sinn kann dann eine ökonomisch basierte, aber
nicht zwingend rechtlich, fundierte Diskussion um die Erfassung und Bewertung von Humankapital
geführt werden.
In Bezug auf die zuvor dargestellte Divergenz, welche mit dem Vorhandensein immateriellen
Vermögens im Allgemeinen und Humankapital im Besonderen erklärt wird, soll nun kurz deren
bilanzielle Behandlung im Rahmen der externen Rechnungslegung gewürdigt werden.
23
Moxter, Grundsätze ordnungsgemäßer Rechnungslegung, IDW, 2003, S.64
24
Vgl. Nikolaus, Bilanzen, 4. Auflage, WRW Verlag, 2002, S.16
25
Vgl. Schierenbeck, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, Oldenbourg, 2000, S.512
26
Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Schäffer-Poeschel, 2005, S.1.161
12
2.2.4
Das immaterielle Vermögen als Erklärung der Divergenz
Eine Generalnorm des Dritten Buches des Deutschen Handelsgesetzbuches ist der § 238 (1). Darin
wird jeder Kaufmann verpflichtet seine Bücher nach den ,,Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung" so zu führen, dass ,,die Lage des Unternehmens" vermittelt werden kann.
Wie oben gezeigt, weicht die externe Bilanz Sichtweise über die ,, Lage eines Unternehmens" von der
Marktbeurteilung ab. In der Makroökonomie wird dieses Phänomen zum Beispiel anhand des
Tobinschen q erklärt. ,,Dabei wird der Marktwert des installierten Kapitals zu den
Wiederbeschaffungskosten des installierten Kapitals ins Verhältnis gesetzt. Zur Begründung werden
die Existenz immateriellen Vermögens und der Verbrauch von Zeit und Ressourcen zum Aufbau einer
neuen Unternehmung angeführt."
27
Generell wird das immaterielle Vermögen, oder das Intellectual Capital, als Erklärung der
Performance Messung eines Unternehmens über die Bilanzabbildung hinaus akzeptiert. Die
Problematik des Umgangs damit, nicht nur im Kontext der externen Bilanzierung, beginnt bereits mit
der definitorischen Erklärung: ,,Sowohl im deutschen als auch im angloamerikanischen Schrifttum ist
eine negative Abgrenzung des immateriellen Wertes durchaus üblich. So zeichnen sich Intangibles
durch fehlende physische Substanz und fehlenden monetären Wert aus. ( . . . ) Stewart führt
dementsprechend aus: ,,Intellectual Capital is something that you cannot touch, but still makes you
rich."
28
Speziell im deutschen Handelsrecht dürfen nach § 248 Abs. 2 HGB immaterielle, nicht entgeltlich
erworbene Vermögensgegenstände nicht bilanziert werden. Über den § 266 HGB hinaus, der als
immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanzgliederung Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte, Lizenzen, Goodwill (derivativ) und geleistete Anzahlungen auf diese Werte definiert,
existiert keine handelsrechtliche Legaldefinition immateriellen Vermögens. I. d. R. umfasst immateriell
nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards ,,alle Vermögensgegenstände, die nicht körperlich
erfasst werden können und somit weder beweglich noch unbeweglich sind, aber identifizierbar sind
und in der Verfügungsmacht des Unternehmens stehen (DRS 12.7)."
29
Intangible assets werden
durch IFRS (nach IAS 38.8) und US-GAAP (nach FAS 142, Appendix F) auf ähnliche Weise
abgegrenzt. Eine ,,abstrakte Aktivierungsfähigkeit erhalten intangible assets nach IFRS wenn sie nicht
monetär und körperlos sind. Weiterhin konstituierend sind die drei Eigenschaften Identifizierbarkeit
(identifiability), Kontrolle durch das bilanzierende Unternehmen (control) und Existenz eines
zukünftigen wirtschaftlichen Nutzens (future economic benefit)."
30
Diese Problematik immaterieller Vermögenswerte kumuliert sich besonders im Humankapital.
27
Vgl., Burda / Wyplosz, Makroökonomie, Vahlen, 2001, S.171
28
Schäfer/Lindenmayer,Externe Rechnungslegung u. Bewertung v. Humankapital, Böckler Stiftung, 2004, S.11
29
Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Schäffer-Poeschel, 2005, S.144
30
Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Schäffer-Poeschel, 2005, S.144
13
Die externe Bilanzierung unternehmerischen Humankapitals ist nach allen drei
Rechnungslegungssystemen ausgeschlossen.
Denn die Kriterien der Identifizierbarkeit und der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, die im Rahmen
der deutschen GoBs auch unter dem Greifbarkeitsprinzip und dem Einzelbewertbarkeits- und
Veräußerungsfähigkeitsprinzip diskutiert werden
31
treffen nach Bilanz rechtlicher Auffassung nicht zu.
Hinzu kommt im deutschen Handelsrecht das zwingend vorgeschriebene Kriterium des entgeltlichen
Erwerbs, ,,welches dem Bestreben einer Wertobjektivierung beim Ansatz immaterieller
Vermögensgegenstände in der Bilanz geschuldet ist. Im Gegensatz dazu ist nach IFRS und US-
GAAP ein entgeltlicher Erwerb immateriellen Vermögens nicht zwingend notwendig, es muss aber
immer identifizierbar, von begrenzter Nutzungsdauer sein und vom Unternehmen getrennt werden
können (FAS 142.10)"
32
Im Grunde wird die Vorgabe einer ökonomischen Objektivität durch die Bilanzierungsvorschriften
alltäglich im Rahmen der Bewertung börsennotierter Unternehmen, aber nicht nur dort, widerlegt.
Denn im Endeffekt muss sich diese beabsichtigte handelsrechtliche Objektivität, welche dadurch
definiert ist, dass es für Vermögenswerte einen Markt gibt, aus dem ein Preis ermittelt werden kann
33
,
was bei den vielen immateriellen Werten schwer möglich ist, an ihrer Marktakzeptanz messen lassen.
In der betriebswirtschaftlichen Literatur werden die demnach in der externen Bilanz nicht
ausgewiesenen Vermögenswerte entweder separat oder als Bilanzverlängerung dargestellt. Konsens
ist aber, dass die unzureichende Vermögensdarstellung einer zumindest auf der externen
Rechnungslegung basierenden Bilanz einer erweiterten Darstellung bedarf.
Eine mögliche Form immaterielles Vermögen separat zu visualisieren liefert Sveiby:
Sichtbares
Eigenkapital
Externe Struktur
Interne Struktur
Kompetenz der
(Eigenkapitalwert)
Mitarbeiter
Organisation:
Materielle Ver-
- Marken
- Rechtsform
- Ausbildung
mögenswerte
- Kundenbeziehungen
- Management
- Erfahrung
abzüglich
- Lieferantenbeziehungen
- Systeme
sichtbarer Ver-
- Unternehmenskultur
bindlichkeiten
- F & E
- Software
Immaterielle Vermögenswerte
(Überschuss des Börsenkurswertes über das ausgewiesene Eigenkapital)
Abb. 6 Börsenkurs- oder Marktwert eines Unternehmens: sichtbares Eigenkapital plus
drei Arten von immateriellen Vermögenswerten
34
31
Moxter, Grundsätze ordnungsgemäßer Rechnungslegung, IDW, 2003, S.63 ff.
32
Coenenberg, Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, Schäffer-Poeschel, 2005, S.147
33
Implizit enthalten die Einzelbewertbarkeit und das Veräußerungsfähigkeitsprinzip diese Bedingung.
34
Sveiby, Wissenskapital Das unentdeckte Vermögen, Moderne Industrie, 1998, S.31
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (Paperback)
- 9783836600408
- ISBN (eBook)
- 9783956361081
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Lausitz – Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Dezember)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- humankapital bilanzierung human capital pricing model börse aktie
- Produktsicherheit
- Diplom.de