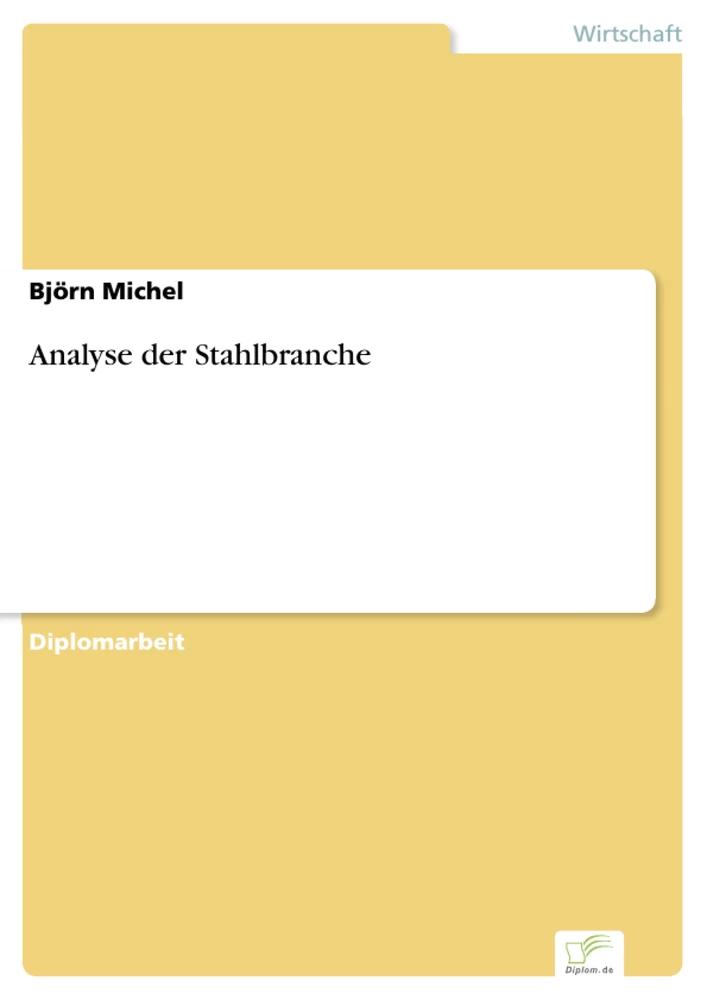Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Nachfrage nach Stahl ist ungebrochen, die Werke sind ausgelastet und die Preise steigen wieder kurz gesagt, die Stahlbranche kocht. Oder kocht sie sogar schon wieder über?
Stahl war lange Zeit alles andere als eine Industrie, die die Fantasie von Anlegern beflügelte. Früher hätten wir für Stahl eher einen Malus bekommen, zurzeit würden wir einen Bonus kriegen, und in drei Jahren wird das alles wieder ganz anders aussehen. Diese Aussage des Stahlunternehmers Jürgen Großmann als Antwort auf die Frage nach einem eventuellen Börsengang im März dieses Jahres macht auf die Zyklen der Branche, aber auch auf deren Rohstoffabhängigkeit aufmerksam.
Die Problematik der Stahlbranche besteht aber auch darin, dass sie im Gegensatz zu ihren Rohstofflieferanten und ihren Kunden noch sehr zersplittert ist. Das nun mit Abstand größte Stahlunternehmen der Welt, welches nach einem erbitterten, monatelangen Kampf durch den Zusammenschluss der Unternehmen Mittal und Arcelor hervorgeht, wird die Konsolidierung laut Branchenexperten aber eher noch weiter anfachen, statt diese zu beenden, da das neue Unternehmen ArcelorMittal nun fast viermal so groß ist wie die nachfolgenden Konkurrenten, die dadurch in Zugzwang geraten.
Gang der Untersuchung:
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob eine weitere Konsolidierung, und damit eine geringere Schwankungsanfälligkeit und Rohstoffabhängigkeit, unumgänglich für die Stahlbranche sein wird. Die Zielsetzung dieser Arbeit beinhaltet auch die Frage, ob die Branche auf der einen Seite aus großen Big Playern und auf der anderen Seite aus kleinen Nischenanbieter bestehen wird, die den Markt bestimmen und dadurch auch erfolgreicher agieren, als dies Stahlunternehmen mit einer nur mittleren Größe tun.
Nach einem einleitenden Überblick über die Stahlbranche in Kapitel 2 werden im nachfolgenden Kapitel 3 zuerst verschiedene Einflussfaktoren der Umwelt, welche die Stahlbranche tangieren, behandelt.
Danach wird in Kapitel 4 die Stahlbranche im Hinblick auf ihre Wettbewerbskräfte untersucht, wobei das Hauptaugenmerk auf die vorhandenen Wettbewerber gerichtet ist.
Im sich daran anschließenden Kapitel 5 werden verschiedene Wettbewerbsstrategien vorgestellt und auf die Stahlbranche übertragen.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick in Kapitel 6.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis
1.Problemstellung1
2.Die Stahlindustrie im […]
Die Nachfrage nach Stahl ist ungebrochen, die Werke sind ausgelastet und die Preise steigen wieder kurz gesagt, die Stahlbranche kocht. Oder kocht sie sogar schon wieder über?
Stahl war lange Zeit alles andere als eine Industrie, die die Fantasie von Anlegern beflügelte. Früher hätten wir für Stahl eher einen Malus bekommen, zurzeit würden wir einen Bonus kriegen, und in drei Jahren wird das alles wieder ganz anders aussehen. Diese Aussage des Stahlunternehmers Jürgen Großmann als Antwort auf die Frage nach einem eventuellen Börsengang im März dieses Jahres macht auf die Zyklen der Branche, aber auch auf deren Rohstoffabhängigkeit aufmerksam.
Die Problematik der Stahlbranche besteht aber auch darin, dass sie im Gegensatz zu ihren Rohstofflieferanten und ihren Kunden noch sehr zersplittert ist. Das nun mit Abstand größte Stahlunternehmen der Welt, welches nach einem erbitterten, monatelangen Kampf durch den Zusammenschluss der Unternehmen Mittal und Arcelor hervorgeht, wird die Konsolidierung laut Branchenexperten aber eher noch weiter anfachen, statt diese zu beenden, da das neue Unternehmen ArcelorMittal nun fast viermal so groß ist wie die nachfolgenden Konkurrenten, die dadurch in Zugzwang geraten.
Gang der Untersuchung:
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob eine weitere Konsolidierung, und damit eine geringere Schwankungsanfälligkeit und Rohstoffabhängigkeit, unumgänglich für die Stahlbranche sein wird. Die Zielsetzung dieser Arbeit beinhaltet auch die Frage, ob die Branche auf der einen Seite aus großen Big Playern und auf der anderen Seite aus kleinen Nischenanbieter bestehen wird, die den Markt bestimmen und dadurch auch erfolgreicher agieren, als dies Stahlunternehmen mit einer nur mittleren Größe tun.
Nach einem einleitenden Überblick über die Stahlbranche in Kapitel 2 werden im nachfolgenden Kapitel 3 zuerst verschiedene Einflussfaktoren der Umwelt, welche die Stahlbranche tangieren, behandelt.
Danach wird in Kapitel 4 die Stahlbranche im Hinblick auf ihre Wettbewerbskräfte untersucht, wobei das Hauptaugenmerk auf die vorhandenen Wettbewerber gerichtet ist.
Im sich daran anschließenden Kapitel 5 werden verschiedene Wettbewerbsstrategien vorgestellt und auf die Stahlbranche übertragen.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick in Kapitel 6.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis
1.Problemstellung1
2.Die Stahlindustrie im […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Björn Michel
Analyse der Stahlbranche
ISBN-13: 978-3-8366-0039-2
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen, Deutschland, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
III
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ...IV
Abbildungsverzeichnis ...VII
1
Problemstellung... - 1 -
2
Die Stahlindustrie im Überblick... - 2 -
2.1
Herstellung, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Stahl... - 2 -
2.2
Entwicklungen auf dem globalen Stahlmarkt... - 4 -
3
Analyse der Umwelt der Stahlindustrie ... - 9 -
3.1
Theoretische Grundlagen... - 9 -
3.2
Einflussfaktoren auf den Stahlmarkt ... - 12 -
4
Analyse der Branche ... - 16 -
4.1
Theoretische Grundlagen... - 16 -
4.2
Struktur und Dynamik der Stahlbranche ... - 20 -
4.3
Abnehmer und Zulieferer ... - 23 -
4.4
Vorhandene Wettbewerber ... - 26 -
4.5
Potenzielle Konkurrenten und Ersatzprodukte ... - 33 -
4.6
Wettbewerbskräfte im abschließenden Überblick ... - 35 -
5
Wettbewerbsstrategien und Rendite... - 36 -
5.1
Theoretische Grundlagen... - 36 -
5.2
Strategische Gruppen... - 40 -
5.3
Ergebnisse für die Stahlbranche ... - 45 -
6
Schlussbetrachtung und Ausblick ... - 49 -
Literaturverzeichnis... - 51 -
IV
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
AG
Aktiengesellschaft
Aufl.
Auflage
bearb.
bearbeitete
BES
Brandenburger
Elektrostahlwerke
BH
Bosnia-Herzegovina
BIP
Bruttoinlandsprodukt
BRIC
Brasilien, Russland, Indien und China
Bsp.
Beispiel
bspw.
beispielsweise
bvdep
Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH
BWL
Betriebswirtschaftslehre
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
°C Grad
Celsius
ca.
circa
CO
2
Kohlenstoffdioxid
CSN
Companhia Siderúrgica Nacional
CVRD
Companhia Vale do Rio Doce
D Deutschland
DBW
Die Betriebswirtschaft (Zeitschrift)
EKO
Eisenhüttenkombinat
Ost
et al.
et alii / et alibi
EU
Europäische
Union
f. folgende
FAZ
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
FC
Fußballclub
Fe
Symbol für Eisen (das chemische Element)
ff. fortfolgende
Fn.
Fußnote
F&E
Forschung und Entwicklung
V
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV
Gewinn- und Verlustrechnung
HES
Hennigsdorfer Elektrostahlwerke
Hrsg.
Herausgeber
HV
Hauptversammlung
IFRS
International Financial Reporting Standards
IISI
International Iron and Steel Institute
JFE
Japan Steel Fe Engineering
Jg.
Jahrgang
Kfz
Kraftfahrzeug
KMU
Kleine und mittlere Unternehmen
M&A
Mergers and Acquisitions
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
NAFTA
North American Free Trade Area
Nkw
Nutzkraftwagen
Nr.
Nummer
NRW
Nordrhein-Westfalen
o. oder
o. Jg.
ohne Jahrgang
o. V.
ohne Verfasser
p. page
p. a.
per anno
PEB
Pre-engineered
buildings
Pkw
Personenkraftwagen
RWI
Rheinisch-Westfälisches
Institut für Wirtschaftsforschung
S. Seite
sog.
sogenannte
SSAB
Svenskt Stål AB
Stahlw. Stahlwerke
t Tonne
TK
ThyssenKrupp
u. und
UBS
Union Bank of Switzerland
VI
U. S.
United States
USA
United States of America
US GAAP
United States Generally Accepted Accounting Principles
VDA
Verband der deutschen Automobilindustrie
VDEh
Verein Deutscher Eisenhüttenleute
vers.
verschiedene
Vgl.
Vergleiche
Vol.
Volume
WBS
Wettbewerbsstrategien
WiSt
Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Zeitschrift)
www.
world wide web
z. B.
zum Beispiel
z. T.
zum Teil
ZEW
Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung GmbH
ZfB
Zeitschrift für Betriebswirtschaft
VII
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Rohstahlproduktion seit 1950 in Mio. t. ...- 6 -
Abbildung 2: Externe Einflüsse auf die Unternehmen einer Branche...- 10 -
Abbildung 3: Die Triebkräfte des Branchenwettbewerbs nach Porter. ...- 17 -
Abbildung 4: Der Branchenzyklus und der Konzentrationsgrad...- 21 -
Abbildung 5: Marktanteile der größten Zulieferer, Stahlhersteller und Abnehmer. ..- 25 -
Abbildung 6: Weltweiter Konzentrationsprozess in der Stahlbranche seit 1990. ...- 27 -
Abbildung 7: Die größten Stahlhersteller der Welt. ...- 31 -
Abbildung 8: Einfluss der Wettbewerbskräfte auf die Stahlbranche. ...- 35 -
Abbildung 9: Wettbewerbsstrategien nach Porter. ...- 37 -
Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Rentabilität und Marktanteil nach Porter.- 39 -
Abbildung 11: Rentabilitätsverlauf in der Stahlbranche. ...- 46 -
Abbildung 12: U-Kurve und strategische Gruppen in der Stahlbranche...- 47 -
- 1 -
1 Problemstellung
Die Nachfrage nach Stahl ist ungebrochen, die Werke sind ausgelastet und die Preise
steigen wieder kurz gesagt, die Stahlbranche kocht.
1
Oder kocht sie sogar schon wie-
der über?
2
,,Stahl war lange Zeit alles andere als eine Industrie, die die Fantasie von Anlegern be-
flügelte. Früher hätten wir für Stahl eher einen Malus bekommen, zurzeit würden wir
einen Bonus kriegen, und in drei Jahren wird das alles wieder ganz anders aussehen."
3
Diese Aussage des Stahlunternehmers Jürgen Großmann als Antwort auf die Frage nach
einem eventuellen Börsengang im März dieses Jahres macht auf die Zyklen der Bran-
che, aber auch auf deren Rohstoffabhängigkeit aufmerksam.
Die Problematik der Stahlbranche besteht aber auch darin, dass sie im Gegensatz zu
ihren Rohstofflieferanten und ihren Kunden noch sehr zersplittert ist. Das nun mit Ab-
stand größte Stahlunternehmen der Welt, welches nach einem erbitterten, monatelangen
Kampf durch den Zusammenschluss der Unternehmen Mittal und Arcelor hervorgeht,
wird die Konsolidierung laut Branchenexperten aber eher noch weiter anfachen, statt
diese zu beenden, da das neue Unternehmen ArcelorMittal nun fast viermal so groß ist
wie die nachfolgenden Konkurrenten, die dadurch in Zugzwang geraten.
4
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob eine weitere Konsolidierung, und damit
eine geringere Schwankungsanfälligkeit und Rohstoffabhängigkeit, unumgänglich für
die Stahlbranche sein wird. Die Zielsetzung dieser Arbeit beinhaltet auch die Frage, ob
die Branche auf der einen Seite aus großen Big Playern und auf der anderen Seite aus
kleinen Nischenanbieter bestehen wird, die den Markt bestimmen und dadurch auch
erfolgreicher agieren, als dies Stahlunternehmen mit einer nur mittleren Größe tun.
Nach einem einleitenden Überblick über die Stahlbranche in Kapitel 2 werden im nach-
folgenden Kapitel 3 zuerst verschiedene Einflussfaktoren der Umwelt, welche die
Stahlbranche tangieren, behandelt. Danach wird in Kapitel 4 die Stahlbranche im Hin-
blick auf ihre Wettbewerbskräfte untersucht, wobei das Hauptaugenmerk auf die vor-
handenen Wettbewerber gerichtet ist. Im sich daran anschließenden Kapitel 5 werden
verschiedene Wettbewerbsstrategien vorgestellt und auf die Stahlbranche übertragen.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick in Kapitel 6.
1
Vgl. Bloed, P. (2006), S. 16. Zur Euphorie in der Stahlbranche vgl. auch Leese, W. (2006), S. 22.
2
Vgl. o. V. (2006f), S. 17.
3
Großmann, J. (2006), S. 71.
4
Vgl. o. V. (2006k), S. 14. Vgl. auch Ameling, D. (2006f), S. B1. Vgl. auch Hennes, M. (2006e), S. B1.
- 2 -
2 Die Stahlindustrie im Überblick
2.1 Herstellung, Eigenschaften und Verwendungsmöglichkei-
ten von Stahl
Zur Roheisen- und Stahlerzeugung werden Eisenträger (Eisenerze, Schrott), Brennstoffe
und Reduktionsmittel (Koks, Kohle, Öl, Gas) sowie Zuschläge (Kalk, Legierungsmittel)
benötigt. Die Eisenerze sind dabei die wichtigsten Ausgangsstoffe für die Herstellung
von Eisen und Stahl.
5
Roheisen ist im allgemeinen Sinne eine Legierung aus Eisen und mehr als 2 % Kohlen-
stoff, in der aber oft noch andere Elemente enthalten sind. Alle Eisenwerkstoffe mit
einem geringeren Anteil als 2 % Kohlenstoff werden als Stahl bezeichnet.
6
Stahl kann nach unterschiedlichen Methoden erschmolzen werden. Je nach Rohstoffein-
satz können die Verfahren danach unterteilt werden, ob sie Eisenerz oder Schrott als
Ausgangsmaterial verwenden. Ein weiterer Unterschied liegt darin, ob mit Koks oder
Kohle gearbeitet wird.
7
Die klassische Route der Stahlherstellung ist die über den Hochofen, in dem Eisenerz zu
flüssigem Roheisen umgeformt und danach im Konverter durch Einblasen von Sauer-
stoff zu Rohstahl ,,gefrischt" wird.
8
Im Hochofen wird das Erz mit Hilfe von Koks und
anderen Reduktionsmitteln zu Eisen reduziert. Da Koks als Reduktionsmittel teuer ist,
wird immer häufiger Kohle als Primärreduktionsmittel eingesetzt. Durch das Verbren-
nen mit Sauerstoff werden die unliebsamen Begleitstoffe entfernt.
9
Über diesen Weg des Hochofens und des Sauerstoffblas-Verfahrens werden rund zwei
Drittel der Weltrohstahlproduktion hergestellt. Ein anderer wichtiger Einsatzstoff für die
Stahlherstellung ist Schrott. Er dient als Rohstoff für das Elektrolichtbogenofen-
Verfahren, über das knapp ein Drittel der Stahlmenge weltweit hergestellt wird. Auf die
restlichen Prozente entfallen ältere Verfahren wie etwa das Siemens-Martin-
Verfahren.
10
5
Vgl. Stahlfibel (1999), S. 15.
6
Vgl. Stahl Lexikon (2004), S. 220 u. S. 264. Es gibt jedoch einige chromreiche Stähle, die einen höheren
Anteil als 2% Kohlenstoff haben. Vgl. dazu Stahlfibel (1999), S. 4.
7
Vgl. Stahl Lexikon (2004), S. 267.
8
Vgl. ebenda, S. 267, S. 132 u. S. 231 f.
9
Vgl. Stahlfibel (1999), S. 26 f.
10
Vgl. ebenda, S. 50. Vgl. auch das statistisch Jahrbuch der Stahlindustrie (2005/2006), S. 451. Zu den
technischen Gegebenheiten vgl. auch Kapitel 3.2. Da es sich bei dieser Arbeit aber nicht um eine tech-
nische, sondern um eine betriebswirtschaftliche Analyse handelt, werden die aktuellen Verfahren zur
Stahlherstellung, aber auch die älteren Verfahren, nicht näher behandelt.
- 3 -
Nach dem Einschmelzen wird der flüssige Stahl in Brammen, Kokillen (Blockgussver-
fahren) oder in einen `endlosen´ Strang gegossen (Sranggussverfahren), der dann in die
gewünschten Größen unterteilt wird. Danach folgt die Weiterverarbeitung, wobei das
Walzen das Hauptverfahren darstellt.
11
Der erzeugte Rohstahl ist ein relativ homogenes Produkt, welches durch Zusätze ver-
edelt werden kann und so den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird, wobei
die Produktpalette von einfachen Stahlsorten, über Qualitäts- und Edelstähle bis hin zu
Spezialstählen reicht.
12
Stahl ist damit der wohl wichtigste, vielseitigste und anpas-
sungsfähigste Werkstoff überhaupt.
13
Er gilt als ein wichtiger Grundstoff der modernen
Industrieproduktion und als Ausgangsmaterial für die Herstellung vieler Produkte.
14
Zu diesen Produkten gehören in erster Linie Autos, die heute zum Großteil aus Stahl
bestehen und deren ultraleichte Karosserien durch innovativen Stahl und neue Ferti-
gungstechniken ein Viertel weniger gegenüber älteren Karosserien wiegen.
15
Diese ,,in-
telligenten" Stähle sind besonders leicht verformbar, gewinnen bei der Endfertigung an
Festigkeit und verlieren dafür paradoxerweise Gewicht. Diese ,,tailored blanks", die
ohne Schweißnähte zu Autoteilen geformt werden können, sind durch ihre Form und
nicht durch ihre Masse härter und stabiler.
16
Tragende Konstruktionen von Gebäuden sind ein weiteres Anwendungsgebiet für Stahl,
denn durch vorgefertigte Stahl- und Stahlverbundbauteile lassen sich moderne Bauten
schnell und wirtschaftlich errichten.
17
Für die Baubranche, neben der Automobilindust-
rie die wichtigste Abnehmergruppe, werden dabei insbesondere Langprodukte benötigt,
während die Automobil- und Haushaltsgeräteindustrie und der Maschinen- und Anla-
genbau, ebenfalls wichtige Kundengruppen, eher Flachprodukte nachfragen. Der
Verbrauch hält sich dabei die Waage, wobei sich die Tendenz der stetigen Zunahme von
Flachprodukten bestätigt.
18
Das hängt auch damit zusammen, dass die entwickelten Volkswirtschaften bereits über
gut ausgebaute Infrastrukturen verfügen und andere Industrien wichtiger sind.
19
11
Andere Verfahren sind das Schmieden, Pressen, Ziehen und Beschichten (Vgl. Kerz, S. (1990), S. 5).
Eine Abbildung ,,Vom Erz zum Stahl" befindet sich im Einband des Stahl Lexikons (2004).
12
Vgl. Gieseck, A. (1995), S. 24 f.
13
Vgl. Stahlfibel (1999), S. 2.
14
Vgl. Kriwet, H. (1989), S. 46.
15
Vgl. Brockmann, B. (2006), S. 54. Zur Gewichtsreduktion vgl. auch Schamari, U. (2004), S. 173.
16
Vgl. Reckmann, J. (2006b), S. 35. Vgl. zu den ,,tailored blanks" auch die Stahlfibel (1999), S. 146 f.
17
Vgl. Stahl-Online (2006), http://www.stahl-online.de/bildung_und_beruf/faszination_stahl/faszination
_stahl.htm
18
Vgl. Hufen, B. (2006), S. 49 f. Zur Übersicht der Stahlprodukte siehe Stahlfibel (1999), S. 92.
19
Vgl. Perlitz, U. (2005), S. 3.
- 4 -
2.2 Entwicklungen auf dem globalen Stahlmarkt
Auf die Frage im Frühjahr 2006, wo er die europäische Stahlindustrie in zehn bis fünf-
zehn Jahren sehen würde, antwortete der Chef von Arcelor, Guy Dollé, dass es Platz für
ein oder zwei europäische Unternehmen gäbe, welche global in der ersten Liga mitspie-
len könnten. Das solle man immer vor dem Hintergrund der vergangenen Zeit sehen, in
der die Branche in einem Desaster steckte.
20
Bevor in der Arbeit näher auf die aktuellen Entwicklungen eingegangen wird, werden
die vergangenen Geschehnisse dargestellt, um die heutige Situation besser einschätzen
und verstehen zu können.
In den fünfziger Jahren wuchs der Stahlverbrauch, getragen durch das wieder aufzubau-
ende Europa, weltweit stark an. Auch in den sechziger Jahren stieg der Stahlverbrauch
stetig, wobei sich die Konzentration nun nach Japan verlagerte, wo sich der Zuwachs
des Verbrauchs verdreifachte. Diese Phase als Folge der expandierenden Schiffbauin-
dustrie und deren Rückwirkung auf andere Industrien, kennzeichnete eine stetig wach-
sende Rohstahlproduktion. Die Kapazitäten wurden weiterhin aufgestockt, obwohl
schon Tendenzen zu erkennen waren, die auf eine sinkende Nachfrage aufmerksam
machten.
21
Mit den Erfahrungen der Vergangenheit, wonach jedem Abschwung eine Erholung über
den vorangegangenen Hochpunkt folgen würde, erarbeiteten fast alle Unternehmen aus
der Stahlindustrie ehrgeizige Ausbaupläne. Gefestigt wurden diese Pläne noch durch
eine Langzeitstudie des IISI, deren Schätzungen sich im Nachhinein als völlig überzo-
gen herausstellten.
22
Auch als die Weltwirtschaft 1973 und 1974 durch die drastisch
gestiegenen Ölpreise an Schwung verlor, wurde das nur von wenigen Stahlunternehmen
richtig eingeschätzt, da zunächst kaum etwas von einer sich anbahnenden Strukturkrise
zu verspüren war. Die Erklärung war aus der Sicht der Unternehmen auch einleuchtend,
da man durch den Ölpreisschock mit stahlintensiven Investitionen im Bereich der Ge-
winnung und Einsparung von Energie rechnete. Im vierten Quartal 1974 brach die
Stahlnachfrage dann endgültig ein. Nach einem weltweiten Rückgang der Rohstahler-
zeugung von einem Zehntel im Jahre 1975, wobei sie in den USA und in Europa sogar
20
Vgl. Dollé, G. (2006), S. 100.
21
Vgl. Eckart, K./ Kortus, B. (1995), S. 16 ff.; Vgl. auch Wienert, H. (1989), S. 248.
22
Das International Iron and Steel Institut (IISI) ging im Jahre 1972 von einer Produktion für 1985 von
1,14 Mrd. t Rohstahl aus. Tatsächlich belief sich die Produktion 1985 auf 720 Mio. t.
- 5 -
um ein Fünftel zurückging, brachen auch die Preise ein. Die erheblichen Kosten für die
verminderte Auslastung der Kapazitäten verstärkten die Krise zusätzlich.
23
Die Ölkrise verteuerte also die Transport- und Energiekosten erheblich, und so wurden
Aufträge aus der Schiffbau-, Automobil- und Baubranche reihenweise storniert. Die
stagnierende Nachfrage seitens der Industrienationen führte so zu einer Rezessionsphase
in den Jahren 1975-1979.
24
In dieser Zeit wurde auch deutlich, dass die Volkswirtschaften den Konjunktureinbruch
nach dem Boom nicht so schnell verarbeiten konnten wie erhofft. Damit einhergehend
verloren auch die Stahl verbrauchenden Branchen als Wachstumsmotor der Industrie-
länder an Gewicht. Hinzu kamen die Bemühungen um einen effizienteren Einsatz von
Stahl und die Suche nach anderen Werkstoffen, die der Branche zu schaffen machten.
Die Diskussionen über die Grenzen des Wachstums und die ins Bewusstsein rückende
Belastung der Umwelt gerieten dadurch noch verstärkt in den Vordergrund. Die kon-
junkturellen Schwankungen der Stahlbranche waren aber auch Folge des Verhaltens von
Händlern und Verbrauchern. Diese bauten nämlich, wie bei anderen Grundstoffen auch,
in Zeiten guter Konjunktur zusätzliche Lagervorräte auf, da sie steigende Stahlpreise
befürchteten. Bei umgekehrten konjunkturellen Vorzeichen trieben sie das Spiel in die
andere Richtung und reduzierten ihre Lager drastisch.
25
Nach den Krisenjahren setzte 1987 wieder ein Aufschwung ein, der die Stahlunterneh-
men dank ausgelasteter Kapazitäten und hoher Stahlpreise in eine deutlich verbesserte
Ertragslage brachte. Als Grund wurde hier eine expansive Gesamtwirtschaft, einherge-
hend mit gestiegenen Investitionen und wachsendem Welthandel, angeführt.
26
Allerdings hielt dieser Aufschwung nicht lange an, denn ab 1990 zeigte die konjunktu-
relle Entwicklung wieder nach unten, wobei der Schwerpunkt regional in den USA lag,
in denen insbesondere der Rückgang der Automobilindustrie dafür verantwortlich
war.
27
Keine fünf Jahre später sprang der Stahlmarkt jedoch wieder an. Insbesondere die
Verbrauchszunahme in vielen `jungen´ Stahlländern in Asien und auch in Südamerika
war hierfür verantwortlich.
28
Die Tendenz, dass Entwicklungsländer ihre Expansion bei der Stahlerzeugung und des-
sen Verbrauch fortsetzen und die Industrieländer hingegen einem Bruch des Wachstums
23
Vgl. Vondran, R. (1989), S. 10 f.
24
Vgl. Eckart, K./ Kortus, B. (1995) ,S. 185.
25
Vgl. Vondran, R. (1989), S. 9 ff. Die angesprochenen Faktoren werden in den nachfolgenden Kapiteln
eingehend bearbeitet.
26
Vgl. Wienert, H./ Starke, H.-K. (1989), S. 79.
27
Vgl. Wienert, H. (1991), S. 177 ff.
28
Vgl. Wienert, H. (1995), S. 69.
- 6 -
gegenüberstehen würden, war schon früher zu erkennen und wurde durch die Verlang-
samung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums der Industrieländer deutlich.
29
Gerade in jüngster Vergangenheit bestätigt sich diese Tendenz. Die aufstrebenden asia-
tischen Länder weisen einen enormen Stahlhunger auf und waren für über die Hälfte des
weltweiten Stahlverbrauchs im Jahre 2005 verantwortlich. Allein auf China entfiel ein
Drittel des weltweiten Rohstahls, während es fünf Jahre zuvor gerade einmal 15 Prozent
waren. Sowohl die Produktion als auch der Verbrauch von China stiegen damit im Jahr
2005 auf knapp 350 Mio. t. Das ist annähernd eine Verdreifachung und verdeutlicht die
einflussreiche Entwicklung Chinas im Weltstahlgeschäft.
30
Um diese Entwicklung greifbar darzustellen, muss man die Stahlentwicklung der Ver-
gangenheit, wie eingangs beschrieben, hinzuziehen. So hat sich die weltweite Stahlpro-
duktion zwar in den zwanzig Jahren von 1950 bis 1970 von 189 Mio. t auf 595 Mio. t
mehr als verdreifacht, aber in den folgenden 25 Jahren bis 1995 stieg sie lediglich auf
752 Mio. t oder um ein Viertel. Die nachfolgende Dekade prägte ein neuerliches
Wachstum auf den Rekordstand von 1132 Mio. t Rohstahl, der im Jahre 2005 erreicht
wurde. Die folgende Abbildung verdeutlicht diese Phasen, aber auch den Einfluss Chi-
nas in letzter Zeit, der laut Prognosen auch in Zukunft Bestand haben wird.
Rohstahlproduktion in Mio. t
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
2015
Rohstahlproduktion in Mio. t
davon China
Prognose
Abbildung 1: Rohstahlproduktion seit 1950 in Mio. t.
31
29
Vgl. Kerz, S. (1990), S. 21; Vgl. Eckart, K./ Kortus, B. (1995) ,S. 16.
30
Vgl. IISI (2006), S. 10; Vgl. bspw. auch Martens, P. N. (2006), S. 83 oder Hufen, B. (2006), S. 48.
31
Quelle: Eigene Berechnungen und Darstellung, aufbauend auf den Zahlen des IISI (2006), S. 1. Zur
Prognose vgl. bspw. Deutsche Bank Research (Perlitz, U. (2006), S. 1).
- 7 -
Nach einer langen Stahlflaute ist es also vor allem Asien zu verdanken, dass Stahl wie-
der zu einem gefragten Gut geworden ist.
32
Die Entwicklung im aufstrebenden China
hat erst dazu geführt, dass für den in alten Industrienationen totgesagten Werkstoff ein
zweiter Frühling angebrochen ist.
33
Was die Nutzung von Stahl nach Regionen anbelangt, so folgt auf Asien mit 54 %
(China 31%, Japan 8%, Andere 15%) Europa mit 19%, der nordamerikanische Markt
(NAFTA) mit 13%, Russland mit 4% und danach Andere (Afrika, Mittlerer Osten, Mit-
tel- und Südamerika sowie Australien und Neuseeland) mit 10%. Bei der Produktion ist
die Situation fast identisch, außer dass das übrige Asien als auch der NAFTA-Bereich
einen geringeren Anteil (beide 11%) haben und Russland (10%) dafür einen höheren.
34
Nach der beschriebenen Expansions- und Rezessionsphase bestimmte bereits seit 1980
die Konzentrationsphase, die als das Ergebnis des Angebotsüberhangs, des Produktions-
rückgangs und des Preisverfalls von damals zu erklären ist, das Geschehen.
35
Schon
früh wurde ersichtlich, dass alleine Kooperationen und der Trend zur Spezialisierung in
der Stahlbranche, in der es insgesamt zu drastischen Veränderungen kommen würde,
das Überleben sichern würde.
36
Allerdings soll hier nicht auf den Konzentrationsprozess
des letzten Jahrhunderts eingegangen werden, sondern vielmehr auf die Geschehnisse
des letzten Jahrzehnts, in dem sich die Konsolidierung beschleunigte und die Fusions-
und Übernahmeaktivitäten weltweit zugenommen haben.
37
Die beiden beschriebenen Themen der aufstrebenden Entwicklungsländer und der Kon-
solidierung finden sich in der Geschichte des Stahlunternehmens Mittal sehr gut wieder,
denn als der Inder Lakshmi Mittal 1997, damals mit seinem Unternehmen noch auf
Platz 62 der Welt, vorgab, in zehn Jahren der größte Stahlunternehmer der Welt zu sein,
wurde er nur belächelt.
38
Doch schon vorher hatte er Erfolg, als er 1989 ein marodes
Stahlwerk in Trinidad kaufte und es mit Erfolg sanierte. Es folgten Erfolgsgeschichten
in Osteuropa, doch belächelt wurde er wegen seiner Sammlung noch immer.
39
Zuerst
verging im Jahr 2004 den Amerikanern das Lachen, als Mittal ihren größten Stahlgigan-
ten International Steel inklusive des Traditionskonzerns Bethlehem Steel kaufte.
40
32
Vgl. o. V. (2006d), S. 31. Vgl. auch Hufen, B. (2006), S. 47.
33
Vgl. Sturbeck, W. (2006), S. 11.
34
Vgl. IISI (2006), S. 10. Zu Russland wird in dieser Aufzählung auch die Ukraine hinzugerechnet.
35
Vgl. Eckart, K./ Kortus, B. (1995) ,S. 185.
36
Vgl. ebenda, S. 366.
37
Zur Historie ab 1851 vgl. Oberender, P./ Rüter, G. (1989), S. 39 f. u. S. 48 f. Vgl. zu den Fusionsakti-
vitäten der letzten Jahre bspw. Kleinert, J./ Klodt, H. (2002), S.10 ff. u. Siedenberg, A. (2002), S. 21 f.
38
Vgl. David, F. (2006), http://www.cicero.de/97.php?ress_id=6&item=1055.
39
Vgl. Heilmann, D.-H. (2006), S. 10.
40
Vgl. David, F. (2006), http://www.cicero.de/97.php?ress_id=6&item=1055.
- 8 -
Die Strategie von Mittal, die darauf beruhte, dass sich die Branche konsolidieren und
globalisieren muss, wurde durch diesen Schritt Wirklichkeit.
41
Als Mittal im Januar 2006 auch noch Arcelor übernehmen wollte, waren dessen Vor-
stände entsetzt und der Vorsitzende Dollé fühlte sich sogar persönlich angegriffen.
42
Er
verglich Arcelor in einem Interview mit Parfüm und Mittal mit Kölnisch Wasser.
43
Ar-
celor überführte seine Tochter Dofasco in eine Stiftung, um sie vor einem Verkauf zu
schützen. Mittal wollte Dofasco an ThyssenKrupp weiterverkaufen, um den Deal mit
Arcelor zu finanzieren.
44
Zuvor kam ThyssenKrupp beim kanadischen Stahlhersteller
Dofasco nicht zum Zug, da das deutsche Stahlunternehmen den Übernahmepreis, den
Arcelor Dofasco bot, nicht überbieten wollte.
45
Da Arcelor die Übernahme partout nicht
akzeptieren wollte, lehnte es erneut ein verbessertes Kaufangebot unbeeindruckt ab und
wollte sogar ein Viertel seiner Aktien zurückkaufen, um sich vor dem feindlichen An-
gebot zu schützen.
46
Zu guter Letzt präsentierte Arcelor mit dem russischen Stahlkon-
zern Severstal einen ,,weißen Ritter", mit dem man fusionieren und damit Mittal abblo-
cken wollte.
47
Doch schließlich ging Mittal auch bei diesem Kampf als Sieger hervor.
Er ist zwar von einer vollständigen Übernahme abgerückt, wird am neu fusionierten
Konzern ArcelorMittal aber einen Anteil von 43% halten und damit die klare Kontrolle
innehaben.
48
Der japanische Branchenführer Nippon Steel hatte unterdessen mit zwei weiteren Stahl-
herstellern aus Japan, Kobe Steel und Sumitomo Metal, einen Verteidigungswall gegen
feindliche Übernahmen errichtet. Bei einem ausländischen Übernahmeangebot für eines
der drei Unternehmen soll ein höheres Gegenangebot aus den eigenen Reihen helfen,
den Angriff abzuwehren.
49
Insgesamt zeichnet sich die Entwicklung der Stahlbranche neben den Großtransaktionen
auch durch eine Vielzahl kleinerer Transaktionen aus. Die derzeitige Neuordnung des
Stahlmarktes wird auch dadurch untermauert, dass in den letzten fünf Jahren knapp 800
Stahlunternehmen den Besitzer wechselten, davon alleine 190 im Jahre 2005.
50
41
Vgl. Mukherjee, M. (2004b), S. 170.
42
Vgl. Heilmann, D.-H. (2006), S. 10.
43
Vgl. Dollé, G. (2006), S. 97.
44
Vgl. Ruhkamp, C. (2006a), S. 12.
45
Vgl. Grimpe, C./ Heneric, O. (2006), S. 1.
46
Vgl. Heilmann, D./ Hennes, M. (2006), S. 1. Vgl. o. V. (2006e), S. 15.
47
Vgl. o. V. (2006g), S. 11.
48
Vgl. Ruch, M. (2006b), S. 1. Vgl. auch Roth, M. (2006), S. 11.
49
Vgl. o .V. (2006b), S. 14. Vgl. Bloed, P. (2006), S. 18.
50
Vgl. Grimpe, C./ Heneric, O. (2006), S. 1.
- 9 -
3 Analyse der Umwelt der Stahlindustrie
3.1 Theoretische Grundlagen
Bevor auf die eigentliche Branchenanalyse des Stahlsektors eingegangen wird, sollen in
diesem Kapitel externe Faktoren der allgemeinen Umwelt erkenntlich gemacht und un-
tersucht werden, die eine Branche von außen tangieren und auf die die Unternehmen
keinen maßgeblichen Einfluss haben.
51
Dies ist deshalb wichtig, weil Unternehmen in einem bestimmten gesellschaftlichen und
rechtlichen Umfeld agieren und von allgemeinen makroökonomischen Faktoren beein-
flusst werden, zu denen Änderungen von Wechselkursen, technologische Entwick-
lungen oder gesetzliche Regelungen gehören können.
52
Die Hauptaufgabe der Umwelt-
analyse ist das Herausfiltern der sich daraus ableitenden Chancen und Risiken.
53
Allerdings weist die große Anzahl der externen Faktoren der Makroumwelt, die für Un-
ternehmen aller Branchen vom Grundsatz her identisch sind, ein hohes Maß an Kom-
plexität auf. Dieses Maß muss für eine sinnvolle Analyse reduziert werden, um im An-
schluss daran sinnvolle Strategien für die Unternehmen ableiten zu können. Daher teilt
sich diese angesprochene Makroumwelt weitgehend in eine politisch-rechtliche, eine
ökonomische, eine technologische, eine gesellschaftliche und eine ökologische Umwelt
auf.
54
Bei der Betrachtung dieser Segmente geht es nun darum, die vorherrschenden Trends zu
erkennen, von denen zu erwarten ist, dass sie in Zukunft einen starken Einfluss auf die
Unternehmen ausüben werden. Je früher diese Entwicklungen erkannt werden, desto
eher können die betroffenen Unternehmen reagieren und sich auf die neue Situation
einstellen. Diese Möglichkeit ist auch deshalb gegeben, da sich viele Einflussfaktoren
nicht abrupt, sondern in einem schleichenden Prozess verändern.
55
Allerdings gibt es bei den Umweltbedingungen auch Entwicklungen, die unsicher sind
oder sich dynamischer verändern und dadurch zu einer Erschwernis bei der Analyse
führen können.
56
51
Vgl. Olemotz, T. (1995), S. 27; Vgl. auch Macharzina, K./ Wolf, J. (2005), S. 23. Auf die Branchen-
umwelt (Aufgabenumwelt) und deren Faktoren wird im nachfolgenden Kapitel 4 eingegangen.
52
Vgl. Hungenberg, H. (2004), S. 86.
53
Vgl. Corsten, H. (1998), S. 26.
54
Vgl. Hungenberg, H. (2004), S. 84 ff. An Stelle der gesellschaftlichen und ökologischen Umwelt findet
man in der Literatur auch oft die Bezeichnung der soziokulturellen Umwelt (Vgl. Welge, M. K./ Al-
Laham, A. (2001), S. 185).
55
Vgl. Müller-Stewens, G./ Lechner, C. (2005), S. 205 f.
56
Vgl. Hungenberg, H. (2004), S. 87.
- 10 -
Im Nachfolgenden werden nun die Einflüsse der verschiedenen Umweltsegmente erör-
tert, die auf eine Branche einwirken und in der folgenden Abbildung noch einmal zu-
sammenfassend dargestellt sind.
Ökonomische
Umwelt
Technologische
Umwelt
Gesellschaftliche
Umwelt
Politisch-rechtliche
Umwelt
Ökologische
Umwelt
Branche
Abbildung 2: Externe Einflüsse auf die Unternehmen einer Branche.
57
Zu den politisch-rechtlichen Umweltfaktoren gehören in erster Linie die verschiedenen
gesetzlichen Regelungen und Verordnungen, denen sich die Unternehmen unterordnen
müssen. Daneben zählt die Steuer-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik genauso
zu den Einflussfaktoren wie Entscheidungen über die Privatisierung und Deregulierung
in einzelnen Branchen. Dabei haben die Unternehmen im Zuge der Internationalisierung
auch ausländische Gesetze und Richtlinien zu berücksichtigen.
58
Einen relevanten Einfluss haben auch die Regelungen zur Unternehmensverfassung, zur
Produzentenhaftung und zu Genehmigungsverfahren sowie Investitions-, Umwelt-
schutz- und Patentvorschriften. Die Faktoren Organisation, Stabilität und Verlässlich-
keit der politischen Organe spielen natürlich auch eine große Rolle für die Unterneh-
men.
59
Die ökonomische Umwelt wird primär durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
geprägt.
60
Dazu zählen die Entwicklungen in der jeweiligen Branche und die Bedin-
57
Vereinfacht nach Hungenberg, H. (2004), S. 87.
58
Vgl. Welge, M. K./ Al-Laham, A. (2001), S. 186 f.
59
Vgl. Hungenberg, H. (2004), S. 387 f.
60
Vgl. Macharzina, K./ Wolf, J. (2005), S. 24.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (Paperback)
- 9783836600392
- ISBN (eBook)
- 9783956361074
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Justus-Liebig-Universität Gießen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Dezember)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- stahlindustrie industrie porter wettbewerb rendite
- Produktsicherheit
- Diplom.de