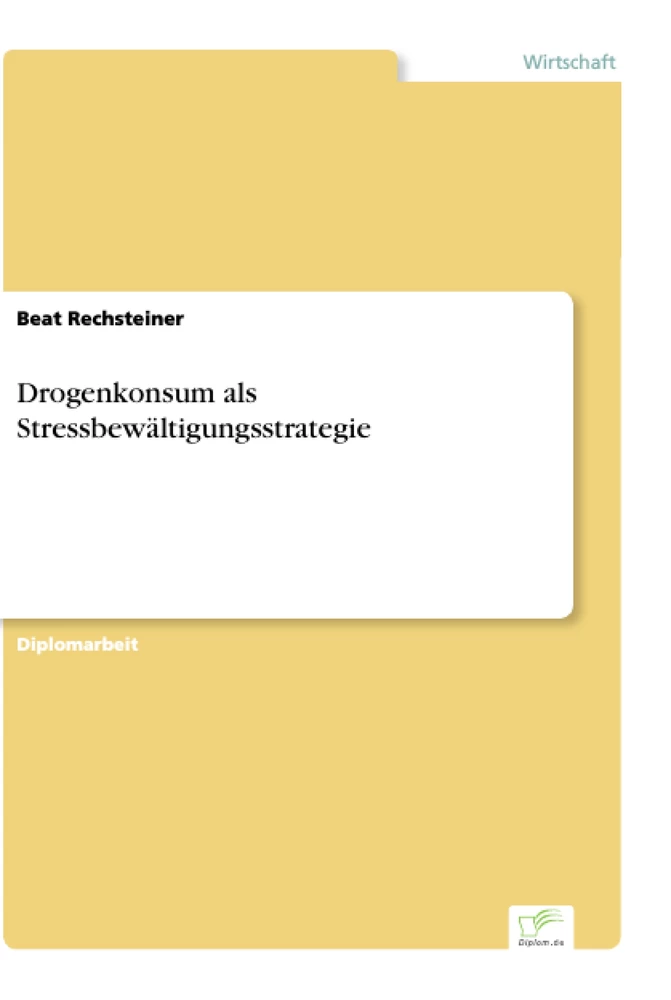Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
©2006
Diplomarbeit
96 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Diese Arbeit untersuchte, ob Drogenkonsum zur Stressbewältigung (Coping) eingesetzt wird. Dies erfolgte insbesondere durch die Untersuchung, ob bei Personen, welche in ihrer Arbeitsumgebung mehr Stressfaktoren (sog. Stressoren) ausgesetzt sind, eher ein Drogenkonsum, als bei Personen, welche in ihrer Arbeitsumgebung weniger Stressfaktoren ausgesetzt sind, festzustellen ist. Die zentrale Frage resp. zu untersuchende Aussage (Hypothese) lautete:
Je höher das Stresspotenzial einer Arbeitsumgebung ist, desto eher wird von den entsprechenden Mitarbeitern Kokain konsumiert.
Die Untersuchung bezog sich auf in der Deutschschweiz lebende Personen mit einem höheren Bildungsabschluss resp. auf Führungskräfte, wobei zur schriftlichen Befragung eine bewusste Auswahl (Sample) getroffen wurde. Insgesamt wurden 1125 Personen befragt und 472 Fragebogen konnten statistisch ausgewertet werden. Neben der Fieldresearch erfolgte eine Deskresearch. Zusätzlich zu den arbeitsbedingten Stressoren wurde der private Stress-Level anhand der Life-Events nach Holmes ermittelt.
Es konnte festgestellt werden, dass Personen, bei welchen mindestens 50% der möglichen arbeitsbedingten Stressoren vorhanden sind, eher Drogen (Kokain und/oder Amphetamine) konsumieren, als Personen, bei welchen weniger als 50% der möglichen arbeitsbedingten Stressoren vorhanden sind (Konsumquote bei 5.1% resp. 2.7%). Allerdings konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden.
Die Prüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Stressausprägung auf Grund der Life-Events und Drogenkonsums führte zu ähnlichen Resultaten. Die Personen mit einer hohen Stressausprägung konsumieren eher Drogen als Personen mit einer tiefen Stressausprägung (Konsumquote 3.8% resp. 2.7%). Aber auch hier konnte kein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden. Als Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass die Hypothese nicht verifiziert werden konnte.
Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die Arbeitswelt? Der Autor dieser Arbeit ist der Meinung, dass auf Grund der Ergebnisse nicht einfach davon ausgegangen werden darf, dass Drogenkonsum von Personen, welche im Arbeitsprozess integriert sind, als unproblematisch zu bezeichnen wäre. Wie die Ergebnisse zeigten, ist Stress am Arbeitsplatz ein ernstzunehmendes Thema. Und bei einer durchschnittlichen Drogenkonsumquote von 3.6% sollten die Arbeitgeber vor dieser Thematik die Augen nicht einfach […]
Diese Arbeit untersuchte, ob Drogenkonsum zur Stressbewältigung (Coping) eingesetzt wird. Dies erfolgte insbesondere durch die Untersuchung, ob bei Personen, welche in ihrer Arbeitsumgebung mehr Stressfaktoren (sog. Stressoren) ausgesetzt sind, eher ein Drogenkonsum, als bei Personen, welche in ihrer Arbeitsumgebung weniger Stressfaktoren ausgesetzt sind, festzustellen ist. Die zentrale Frage resp. zu untersuchende Aussage (Hypothese) lautete:
Je höher das Stresspotenzial einer Arbeitsumgebung ist, desto eher wird von den entsprechenden Mitarbeitern Kokain konsumiert.
Die Untersuchung bezog sich auf in der Deutschschweiz lebende Personen mit einem höheren Bildungsabschluss resp. auf Führungskräfte, wobei zur schriftlichen Befragung eine bewusste Auswahl (Sample) getroffen wurde. Insgesamt wurden 1125 Personen befragt und 472 Fragebogen konnten statistisch ausgewertet werden. Neben der Fieldresearch erfolgte eine Deskresearch. Zusätzlich zu den arbeitsbedingten Stressoren wurde der private Stress-Level anhand der Life-Events nach Holmes ermittelt.
Es konnte festgestellt werden, dass Personen, bei welchen mindestens 50% der möglichen arbeitsbedingten Stressoren vorhanden sind, eher Drogen (Kokain und/oder Amphetamine) konsumieren, als Personen, bei welchen weniger als 50% der möglichen arbeitsbedingten Stressoren vorhanden sind (Konsumquote bei 5.1% resp. 2.7%). Allerdings konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden.
Die Prüfung eines möglichen Zusammenhangs zwischen der Stressausprägung auf Grund der Life-Events und Drogenkonsums führte zu ähnlichen Resultaten. Die Personen mit einer hohen Stressausprägung konsumieren eher Drogen als Personen mit einer tiefen Stressausprägung (Konsumquote 3.8% resp. 2.7%). Aber auch hier konnte kein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden. Als Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass die Hypothese nicht verifiziert werden konnte.
Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die Arbeitswelt? Der Autor dieser Arbeit ist der Meinung, dass auf Grund der Ergebnisse nicht einfach davon ausgegangen werden darf, dass Drogenkonsum von Personen, welche im Arbeitsprozess integriert sind, als unproblematisch zu bezeichnen wäre. Wie die Ergebnisse zeigten, ist Stress am Arbeitsplatz ein ernstzunehmendes Thema. Und bei einer durchschnittlichen Drogenkonsumquote von 3.6% sollten die Arbeitgeber vor dieser Thematik die Augen nicht einfach […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Beat Rechsteiner
Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
ISBN-10: 3-8324-9940-7
ISBN-13: 978-3-8324-9940-2
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Private Hochschule Wirtschaft, Bern, Schweiz, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 2
Inhaltsverzeichnis
1.
V
ORWORT UND
D
ANKSAGUNG
4
2.
M
ANAGEMENT
S
UMMARY
5
3.
A
UFBAU DER
A
RBEIT
6
4.
A
USGANGSLAGE UND
P
ROBLEMSTELLUNG
6
5.
Z
IEL UND
Z
WECK DER
A
RBEIT
7
6.
A
BGRENZUNG DER
A
RBEIT
7
7.
V
ERTRAULICHKEIT DER
A
RBEIT
8
8.
M
ETHODISCHES
V
ORGEHEN
8
8.1.
Deskresearch
8
8.2.
Fieldresearch
8
8.2.1.
Grundgesamtheit und Sample
8
8.2.2.
Fragebogen
10
8.2.3.
Repräsentativität
11
8.2.4.
Validität
12
9.
T
HEORETISCHER
T
EIL
S
TRESS
13
9.1.
Einleitung
13
9.2.
Stress aus arbeitspsychologischer Sicht
14
9.3.
Grundlagen ,,Stress"
14
9.4.
Drei wesentliche Stresstheorien
16
9.4.1.
Reizorientierte Stressdefinition
16
9.4.2.
Reaktionsorientierte Stressdefinition
17
9.4.3.
Interaktionale / Transaktionale Stressdefinition
18
9.5.
Begriffsdefinition: Stressor, Stressreaktion, arbeitsbedingter Stress
20
9.6.
Stressmodelle
20
9.7.
Ursachen von Stress
23
9.8.
Schutz vor Stress
26
9.9.
Stresssymptome / Folgen von Stress
26
9.10.
Stressbewältigungsstrategien
27
10.
T
HEORETISCHER
T
EIL
K
OKAIN
28
10.1.
Einleitung
28
10.2.
Kokainkonsum in Zahlen
29
10.3.
Was ist Kokain
32
10.4.
Die Wirkungen von Kokainkonsum
33
10.5.
Konsumverhalten / Konsumentenprofile
34
10.6.
Ursachen von Drogenkonsum
35
10.7.
Folgen von Kokainkonsum
37
10.8.
Kokainismus kein neues Phänomen
38
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 3
11.
E
MPIRISCHER
T
EIL
39
11.1.
Operationalisierung Stressquellen ausserhalb des Arbeitsplatzes
39
11.2.
Operationalisierung Stressquellen am Arbeitsplatz
40
11.3.
Operationalisierung Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
42
11.4.
Operationalisierung Das Modell im Überblick
43
11.5.
Datenerhebung in sensitiven Bereichen
44
11.5.1.
Fragebogen
44
11.5.2.
Definition von sensitiven Fragen
45
11.5.3.
Design von sensitiven Fragen
45
12.
D
ATENAUSWERTUNG UND
Ü
BERPRÜFUNG DER
H
YPOTHESE
48
12.1.
Datenauswertungen
48
12.1.1.
Soziodemographische Merkmale
48
12.1.2.
Stress
49
12.1.3.
Drogenkonsum
53
12.1.4.
Weitere Auswertungen
58
12.1.5.
Unterschiede zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2
64
12.2.
Überprüfung der Hypothese
67
12.3.
Diskussion der Ergebnisse
71
13.
W
EITERE
E
MPFEHLUNGEN
74
14.
S
ELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG
75
15.
V
ERZEICHNISSE
76
15.1.
Literaturverzeichnis
76
15.2.
Abbildungsverzeichnis
78
15.3.
Tabellenverzeichnis
79
15.4.
Abkürzungsverzeichnis
81
16.
Ü
BER DEN
A
UTOR
82
17.
A
NHANG
83
17.1.
Begleitbrief zur Umfrage
83
17.2.
Fragebogen
84
17.3.
Details zur Operationalisierung / Dichotomisierung
88
17.4.
Statistische Auswertungen (SPSS Syntax)
91
17.4.1.
Prüfung der internen Validität
91
17.4.2.
Häufigkeitsauszählungen
91
17.4.3.
Kreuztabellen für verschiedene Auswertungen
92
17.4.4.
Prüfung der Hypothese
94
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 4
1. Vorwort und Danksagung
Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie: auf den ersten Blick vielleicht ein eigenartiges
Thema für eine Diplomarbeit im Rahmen eines Betriebsökonomiestudiums. Ich bin aber über-
zeugt, dass Drogenkonsum, wie jeder Konsum von Suchtmitteln, nicht ein rein privates, son-
dern auch ein betriebliches Thema sein soll. In jüngerer Zeit ist der Drogen-, und insbesondere
der Kokainkonsum, wieder vermehrt ein Thema in den Medien. Interessanterweise nicht im
Zusammenhang mit offenen Drogenszenen oder Kriminalität, vielmehr wird immer wieder be-
richtet, oder mindestens spekuliert, dass sich der Kokainkonsum in der ,normalen` Bevölkerung
immer mehr etabliere. Kokain, als aufputschende Substanz, könnte ein willkommenes Mittel für
Leute sein, die an ihrem Arbeitsplatz hohem Druck resp. Stress ausgesetzt sind. Als Arbeitge-
ber muss man davon ausgehen, dass im eigenen Unternehmen Personen arbeiten, welche
Kokain konsumieren. Es stellt sich also die Frage, ob ein Arbeitgeber diesbezüglich Verantwort-
ung übernehmen soll oder muss, oder ob die Thematik völlig aus dem Unternehmen ferngehal-
ten werden kann. Unter diesem Gesichtspunkt hat das Thema sehr viel mit Betriebswirtschaft
zu tun, sind doch die Unternehmen auf Mitarbeiter angewiesen, die zwar eine hohe Leistung er-
bringen, aber sowohl psychisch wie physisch gesund bleiben, so dass sie ihre Arbeitskraft und
ihr Know-how möglichst lange und in hoher Qualität zur Verfügung stellen können. Einen For-
schungsbeitrag in diesem Gebiet zu leisten, motivierte mich meine Diplomarbeit dem Thema
,Drogekonsum als Stressbewältigungsstrategie` zu widmen und ich hoffe, damit einen Beitrag
für die Wirtschaft, für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer und für andere interessierte Kreise zu
leisten.
Mit dieser Arbeit habe ich nicht nur einfach ein für mich spannendes Thema aufgegriffen, son-
dern damit auch mein berufsbegleitendes Studium zum Betriebsökonom abgeschlossen. Eine
intensive Zeit findet damit den Abschluss. Eine Zeit, in der ich viel positives erfahren durfte und
immer auch wieder auf die Unterstützung von zahlreichen Menschen zählen konnte. An dieser
Stelle danke ich meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern. Sie haben mich immer unter-
stützt und viel Verständnis gehabt, auch wenn ich wenig Zeit hatte oder wenn ich vor Prüfungen
ab und zu etwas angespannt war. Nicht vergessen möchte ich meinen Vater, der leider viel zu
früh verstarb. Ich bin sicher, er hätte mich während der ganzen Studienzeit begleitet und unter-
stützt. Ein weiteres Dankeschön geht an meine Freunde, die mir viel Verständnis entgegen-
brachten und auch immer wieder mal ein motivierendes Wort übrig hatten. Ein weiteres Danke-
schön geht an meinen Arbeitgeber, ohne dessen Unterstützung das Studium zur Belastung
hätte werden können.
Im Rahmen dieser Arbeit geht ein besonderer Dank an die Vorstände der Vereine, welche der
Umfrage zustimmten, an die vielen mir unbekannten Menschen, die an der Umfrage teilnahmen
und an meine Schwester für das Korrekturlesen. Ein besonderer Dank geht an Herrn Prof. Jürg
Arpagaus. Seine untersützende, fordernde und motivierende Betreuung, die vielen wissen-
schaftlichen Ratschläge und seine grosse Hilfsbereitschaft habe ich sehr geschätzt.
Ottikon, 6. September 2006, Beat Rechsteiner
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 5
2. Management Summary
Diese Arbeit untersuchte, ob Drogenkonsum zur Stressbewältigung (Coping) eingesetzt wird.
Dies erfolgte insbesondere durch die Untersuchung, ob bei Personen, welche in ihrer Arbeits-
umgebung mehr Stressfaktoren (sog. Stressoren) ausgesetzt sind, eher ein Drogenkonsum,
als bei Personen, welche in ihrer Arbeitsumgebung weniger Stressfaktoren ausgesetzt sind,
festzustellen ist. Die zentrale Frage resp. zu untersuchende Aussage (Hypothese) lautete:
,,Je höher das Stresspotenzial einer Arbeitsumgebung ist, desto eher wird von den
entsprechenden Mitarbeitern Kokain konsumiert".
Die Untersuchung bezog sich auf in der Deutschschweiz lebende Personen mit einem höhe-
ren Bildungsabschluss resp. auf Führungskräfte, wobei zur schriftlichen Befragung eine be-
wusste Auswahl (Sample) getroffen wurde. Insgesamt wurden 1`125 Personen befragt und
472 Fragebogen konnten statistisch ausgewertet werden. Neben der Fieldresearch erfolgte
eine Deskresearch. Zusätzlich zu den arbeitsbedingten Stressoren wurde der private ,Stress-
Level` anhand der Life-Events nach Holmes ermittelt.
Es konnte festgestellt werden, dass Personen, bei welchen mindestens 50% der möglichen
arbeitsbedingten Stressoren vorhanden sind, eher Drogen (Kokain und/oder Amphetamine)
konsumieren, als Personen, bei welchen weniger als 50% der möglichen arbeitsbedingten
Stressoren vorhanden sind (Konsumquote bei 5.1% resp. 2.7%). Allerdings konnte kein statis-
tisch signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden. Die Prüfung eines möglichen Zusam-
menhangs zwischen der Stressausprägung auf Grund der Life-Events und Drogenkonsums
führte zu ähnlichen Resultaten. Die Personen mit einer hohen Stressausprägung konsumieren
eher Drogen als Personen mit einer tiefen Stressausprägung (Konsumquote 3.8% resp. 2.7%).
Aber auch hier konnte kein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden. Als Schluss-
folgerung kann festgehalten werden, dass die Hypothese nicht verzifiziert werden konnte.
Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die Arbeitswelt? Der Autor dieser Arbeit ist der Meinung,
dass auf Grund der Ergebnisse nicht einfach davon ausgegangen werden darf, dass Drogen-
konsum von Personen, welche im Arbeitsprozess integriert sind, als unproblematisch zu be-
zeichnen wäre. Wie die Ergebnisse zeigten, ist Stress am Arbeitsplatz ein ernstzunehmendes
Thema. Und bei einer durchschnittlichen Drogenkonsumquote von 3.6% sollten die Arbeitgeber
vor dieser Thematik die Augen nicht einfach verschliessen.
Eine gewisse Konzentration von Drogenkonsumierenden lässt sich in den Werbebranchen wie
auch im Bereich des Gesundheits-/Sozialwesens resp. der Medizin feststellen. Die relativ tiefe
Konsumquote von 1.4% bei Personen im Bereich ,Banking` hat den Autor eher überrascht.
Generell kann sicher empfohlen werden, dass Unternehmen eine Sensibilität für Stress und
Drogenmissbrauch entwickeln sollten und diese Themen durch eine offene Kultur auch enta-
buisiert werden könnten.
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 6
3. Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit wird auf die Ausgangslage sowie die Problemstellung eingegangen. Im
Abschnitt ,Ziel und Zweck` der Arbeit wird die Hypothese formuliert. Anschliessend folgen
Ausführungen zum methodischen Vorgehen. Der Theorieteil behandelt die Themen ,Stress`
sowie ,Kokain`. Nach dem theoretischen Teil folgt der empirische Teil. Zu Beginn wird auf die
Operationalisierung sowie auf die Besonderheiten bei Untersuchungen in sensitiven Bereichen
eingegangen. Anschliessend folgt die Datenauswertung und die Überprüfung der Hypothese.
Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert. Die Arbeit schliesst mit einem Fazit sowie einem
Ausblick resp. weiteren Empfehlungen.
4. Ausgangslage und Problemstellung
In der heutigen Zeit beklagen sich viele Menschen über Stress. Die Ursachen können vielfältig
sein. Die Erwartungen, welche an einen Arbeitnehmer gestellt werden, steigen stetig. Mindes-
tens wird dies von vielen Arbeitnehmenden so empfunden. Immer mehr sieht sich der Mensch
mit Leistungserwartungen und Leistungsdruck, Unsicherheiten und Veränderungen konfrontiert.
Viele Menschen stellen auch hohe Anforderungen an sich selber: man will immer Höchstleis-
tungen erbringen, mental immer wach und präsent sein, sich keine Ruhephasen gönnen. Der
Drogenkonsum scheint heute weitverbreitet zu sein, so gehen kürzlich publizierte Schätzungen
davon aus, dass rund 100`000 Personen in der Schweiz mehr oder weniger regelmässig Kokain
konsumieren. (NZZ Online, 2006). Nimmt man an, dass die Kokain konsumierenden Personen
im erwerbsfähigen Alter sind, ergäbe dies bei rund 4 Millionen Erwerbstätigen (Quelle: BFS,
2003) eine Kokain-Drogen-Konsum-Quote von 2.5%. Oder anders formuliert würde dies be-
deuten, dass jeder vierzigste Erwerbstätige mehr oder weniger regelmässig Kokain konsumiert.
In der im Jahr 2002 vom Bund durchgeführten Gesundheitsbefragung gaben 3.8% 15- bis 24-
jährige Männer und 2.7% der Frauen in der gleichen Altersklasse an, mit harten Drogen Er-
fahrung zu haben. Drogenkonsum beschränkt sich heute nicht mehr auf Randständige oder
sozial ausgeschiedene oder abgestürzte Personenkreise, sondern etabliert sich immer mehr in
gesellschaftlich angesehenen und erfolgreichen Gruppen. So wird in den Medien immer wieder
berichtet, dass Drogenkonsum, insbesondere Konsum von Kokain, in den Chef-Etagen und
anderen leistungsorientierten Umfeldern, wie der Finanzbranche, stark verbreitet wären. Dass
der Kokainkonsum in der jüngeren Zeit, insbesondere auch von Berufstätigen, zunimmt, wird
auch von Rudolf Stohler, Arzt am Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Psychiatrischen
Universitätsklinik in Zürich, bestätigt (zit. in Context 23/05). Weiter führt er aus, dass heute
Kokain häufiger als früher von Personen konsumiert wird, welche in Beruf und Gesellschaft
integriert sind, wobei ,,Banker, ... Journalisten, Lehrer, Werber oder weitere in kreativen Berufen
Arbeitende" relativ häufig wären und es auffällig ist, dass der Kokainkonsum am Wochende von
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 7
gewissen Berufstätigen exzessiv betrieben werde; wobei er folgendes anfügt: ,,Man will extrem
intensiv leben, um den Berufsalltag zu kompensieren" (S. 4). Er hält auch fest, dass sich Ko-
kainkonsum am Arbeitsplatz gut verstecken lässt und meint: ,,schnell eine Linie konsumieren
auf der Toilette ist unauffällig" (S. 4). Der Arbeitswelt stellt er folgende Diagnose: ,,Es herrscht in
manchen Bereichen eine sehr harte Gangart: Wer die geforderte Leistung nicht bringt, muss
gehen." (S. 5). Drogenkonsum könnte also durchaus eine willkommene Strategie sein, um dem
Leistungsdruck Stand zu halten und um Stress abzubauen. Kokain ist heute auch finanziell
erschwinglich. Kostet heute ein Gramm Kokain rund einhundert Franken, lag sein Preis vor 15
Jahren noch etwa beim achtfachen (NZZ Online, 2006).
5. Ziel und Zweck der Arbeit
Diese Arbeit will untersuchen, ob Drogenkonsum zur Stressbewältigung (Coping) eingesetzt
wird. Dies erfolgt insbesondere durch die Untersuchung, ob bei Personen, welche in Arbeits-
umgebungen mit höherem Stresspotenzial arbeiten, eher ein Drogenkonsum, als bei Personen,
welche in Arbeitsumgebungen mit niedrigerem Stresspotenzial arbeiten, festzustellen ist. Die
zentrale Frage resp. zu untersuchende Aussage (Hypothese) lautet:
,,Je höher das Stresspotenzial einer Arbeitsumgebung ist, desto eher wird von den
entsprechenden Mitarbeitern Kokain konsumiert".
Im Verlaufe der Arbeit konnte der Autor auf Grund einer vielzahl von Gesprächen feststellen,
dass das gewählte Thema sehr interessiert, aber nur selten offen darüber diskutiert wird.
Insofern soll diese Arbeit auch einen Beitrag zur Entabuisierung des Themas Drogen am
Arbeitsplatz leisten.
6. Abgrenzung der Arbeit
Die Untersuchungen beschränken sich auf Personenkreise, welche (trotz Drogenkonsum) im
Erwerbsleben stehen. Der Schwerpunkt des zu untersuchenden Personenkreises liegt bei gut
qualifizierten Personen (Fachhochschulabgänger) resp. allgemein bei Führungskräften. Bezüg-
lich Drogenart wird der Fokus auf Kokain gelegt, andere Drogen (Cannabis, Medikamente,
Alkohl usw.) werden nicht untersucht. Die Ergebnisse beziehen sich auf die in Abschnitt 8.2.1
beschriebene Grundgesamtheit und kann nicht darüber hinaus als generell gültig bezeichnet
werden.
Zur Erleichterung des Leseflusses wird im vorliegenden Dokument ausschliesslich die männ-
liche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit ausdrücklich auch alle weiblichen Per-
sonen mit eingeschlossen.
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 8
7. Vertraulichkeit der Arbeit
Auf Grund der ,sensitiven` Fragestellung haben die jeweiligen Vorstände, der an der Umfrage
teilnehmenden Organisationen, hohe Anforderungen an den Daten- und Persönlichkeitsschutz
gestellt. Die erhobenen Daten (Datensatz) dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden resp.
müssen nach Abschluss der Diplomarbeit vernichtet werden. Die Ergebnisse dürfen, unter der
Wahrung des Datenschutzes und unter der Bedingung, dass keine Rückschlüsse auf die bei-
den Organisation und/oder ihre Mitglieder gezogen werden können, veröffentlicht werden. Eine
Veröffentlichung bedingt die Einwilligung des Autors.
8. Methodisches Vorgehen
Es erfolgt sowohl eine Deskresearch (Literatur, bestehende Untersuchungen) sowie auch eine
Fieldresearch (Umfrage mittels Fragebogen).
8.1. Deskresearch
Es gibt bis dato keinen zur Verfügung stehenden Datensatz, welcher zur Fragestellung beige-
zogen werden kann und dienlich wäre. Diesbezüglich wurden verschiedene Institute angefragt,
so zum Beispiel das Institut für Lifescience der Universität Zürich, das Institut für Arbeitspsycho-
logie der ETH Zürich, das OBSAN (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium) des BfS, das
Bundesamt für Gesundheit (Gesundheitssbefragung) und die Schweizerische Fachstelle für
Alkohol und Drogen, das Bundesamt für Statistik Sektion Gesundheit, Interpharma sowie
SIDOS (Schweizerischer Informations- und Datenarchivdienst für die Sozialwissenschaften).
Für die thoeretische Aufarbeitung des Themas werden Literatur, bestehende Untersuchungen
und weitere Publikationen beigezogen. Allerdings gibt es praktisch keine Literatur, welche die
Themen ,Stress` und ,Drogenkonsum` gemeinsam beleuchten.
8.2. Fieldresearch
8.2.1. Grundgesamtheit und Sample
Die Erhebung bezieht sich auf in der Deutschschweiz lebende Personen mit einem höheren
Bildungsabschluss resp. auf Führungskräfte, und stellt somit die Grundgesamtheit dar.
Zur Befragung wird eine bewusste Auswahl (Sample) vorgenommen, wobei bei folgenden
Organisationen die schrifltiche Umfrage mittels Fragebogen erfolgte:
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 9
Diese Angaben sind vertraulich und standen nur der Prüfungskommission zur Verfügung
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 10
8.2.2. Fragebogen
Die Umfrage erfolgt mittels gedrucktem Fragebogen und anonym. Es wird bewusst kein elektro-
nisches Umfragetool eingesetzt. Dies sollte das Vertrauen stärken und eher zu wahrheitsge-
treuen Aussagen führen. Der Fragebogen baut auf den von Raymond M. Lee in dem Buch
,Doing Research on Sensitive Topics` (1993) vorgeschlagenen Prinzipien auf.
Der Fragebogen wurde vor dem Versand mehreren Pre-Tests unterzogen, wobei daraus insbe-
sondere kleine Anpassungen von Skalenbezeichnungen und leichte Umformulierungen der Fra-
gen erfolgten. Der Fragebogen wurde als gut verständlich und als einfach auszufüllen bezeich-
net. Damit die eingegangen Fragebogen eindeutig der einen oder anderen Gruppe zugeordnet
werden konnten, unterschieden sich die Fragebogen durch eine unwesentliche graphische An-
passung. (Fragebogen siehe Anhang 17.2)
Der Versand aller Fragebogen erfolgte am 27. Juli 2006, wobei der letzte Rücksendetermin auf
den 12. August 2006 gelegt wurde. Es wurde ein entsprechender Begleitbrief vom Autor dieser
Arbeit verfasst (Anhang 17.1), wobei der Versand in Briefumschlägen der beiden teilnehmen-
den Vereinen und per A-Post erfolgte. Die ausgefüllten Fragebogen wurden mittels frankiertem
Geschäftsantwort-Couvert direkt dem Autor der Diplomarbeit zurückgesandt. Alle bis zum 19.
August 2006 eingegangenen Fragebogen wurden in der Erhebung berücksichtigt.
Obwohl die Randomized-Response-Technik (RRT) die Anonymität noch erhöhen kann, wurde
aber auf Grund des erhöhten Erklärungsbedarfs bei den Teilnehmenden darauf verzichtet.
Auch wird sie eher dort eingesetzt, wo die Fragen im Kollektiv (z. B. alle Befragten befinden
sich zum Umfragezeitpunkt im gleichen Raum) beantwortet werden.
Die Rücklaufquote bei postalischen Befragungen stellt ein zentrales Problem dar. Dillmann
(1978, 1983; zit. in Diekmann, 2003) hat untersucht, welche Massnahmen zu einer systema-
tischen Erhöhung der Rücklaufquote führen. Dies sind Massnahmen bezüglich Gestaltung des
Fragebogens, der Anordnung und des Designs der Fragen, sowie insbesondere bezüglich der
Implemantation. Darunter wird insbesondere ein Begleitschreiben verstanden, welches ver-
schiedene Kriterien (z. B. Empfänger-Adresse auf Brief, exaktes Datum, Nützlichkeit der Studie,
Vertraulichkeit, Rückfragemöglichkeit, Dank, Unterschrift) einhält. Weiter geht es um die
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 11
Verpackung (Aufmachung des Anschreibe-Couverts, Antwort-Couverts) sowie um den eigent-
lichen Versand, wobei es hier insbesondere um die Nachfassschreiben geht. Es werden bis zu
drei Nachfassschreiben empfohlen. Auch einer telefonischen Erinnerung sowie kleinen ,Dan-
kes-Geschenken` wird ein grosses Gewicht beigemessen (Diekmann, 2003). Was im Rahmen
der Möglichkeiten war, wurde umgesetzt (Fragebogengestaltung, Briefgestaltung, Couvertwahl,
Versand per A-Post, u.a.m.). Aus Datenschutz- und Kostengründen konnte keine telefonische
Nachfassaktion durchgeführt werden (die Adressen wurden aus Vertrauchlichkeitsgründen dem
Autor nicht zur Verfügung gestellt). Schriftliche Nachfassaktionen und kleine Geschenke hätten
die finanziellen Möglichkeiten des Autors gesprengt, weshalb darauf verzichtet werden musste.
Diekmann (2003) geht davon aus, auch wenn ein ansprechender Begleitbrief mitgeschickt wird,
dass Rücklaufquoten von über 20% schwierig zu erzielen sind, wobei Quoten um die 5% häufig
zu erwarten wären. Mit einer erreichten Rücklaufquote von über 42% konnte sicherlich ein res-
pektables Ergebnis erreicht werden.
Auf den genauen Aufbau des Fragebogens wird im Abschnitt 11.5.1 im Rahmen der Operatio-
nalisierung eingegangen.
Die erhobenen Daten wurden mit SPSS statistisch ausgewertet.
8.2.3. Repräsentativität
Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse als allgemeingültig be-
zeichnet werden können. Diekmann (2003) hält fest, dass bei der Prüfung von Zusammen-
hangshypothesen repräsentative Stichproben nicht unbedingt nötig sind und führt dazu aus,
dass ,,repräsentative Stichproben häufig ohnehin entbehrlich [sind]" (S. 369). Weiter führt er
aus, dass Zusammenhangshyptothesen ,,durchaus an willkürlichen Stichproben geprüft werden"
können, und dass dies auch der gängigen Praxis entspreche (S. 329). Der Fokus dieser Arbeit
liegt in der Untersuchung eines Zusammenhangs und nicht auf einer Häufigkeitsverteilung,
entsprechend stellt die bewusst gewählte Auswahl keinen Nachteil dar. Aussagen über die
Häufigkeiten können, bezogen auf die beiden teilnehmenden Gruppen, gemacht werden, da es
sich bezogen auf die Gruppen um eine Vollerhebung handelt. Auf Grund der Non-Response
(Ausfällen) wird eine Ausschöpfungsquote von 42.1% erreicht. Diekmann (2003) meint, dass
Ausfälle in der Grössenordnung von 40% nicht zufällig erfolgen, was zu einer mehr oder minder
systematischen Verzerrung führt. Bei der aktuellen Umfrage ist eine Ausfallquote von 57.9%
hinzunehmen. Diekmann (2003) erwähnt insbesondere den (negativen) Einfluss der Ausfall-
quote auf die Schätzung von Randverteilungen und relativiert das Problem von Non-Response
bei Untersuchungen von Zusammenhängen: ,,Die Schätzung von Korrelationen ist gegenüber
systematischen Stichprobenfehlern in der Regel robuster als die Schätzung von Mittelwerten
und Anteilen. Ist mithin das Ziel einer Untersuchung die Schätzung der Richtung und Stärke
von Zusammenhängen, dann ist Non-Response in der Regel nicht die typische Fehlerquelle."
(S. 364). Da es sich bei der einen Gruppe ausschliesslich um homosexuelle Männer handelt,
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 12
stellt sich die Frage, ob dies zu einer Verzerrung führt, da dadurch der Anteil an Homosexuellen
in der Stichprobe übervertreten ist. Dies wäre lediglich der Fall, wenn Homosexuelle auf Grund
ihrer sexuellen Präferenz per se Stressoren anders bewerten würden und/oder sie per se ein
anderes Drogenkonsumverhalten zeigten. Der Autor dieser Arbeit unterstellt, dass dies nicht
der Fall ist und somit keine Verzerrung anzunehmen ist. Da die Frauen auch in der anderen
Gruppe stark untervertreten sind, stellt sich die gleiche Frage auch bezüglich Geschlecht. Auch
hier wird vom Autor unterstellt, dass kein Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht.
8.2.4. Validität
Die Gültigkeitsprüfung von Untersuchungsergebnissen ist sinnvoll und sie erscheint bei sensi-
tiven Themen besonders wichtig. Es ist zwischen interner und externer Validität zu unterschei-
den, wobei sich die interne Validität auf die Konsitenz der Antworten auf verschiedene, aber in
einem logischen Zusammenhang stehende Fragen beziehen und sich die externe Validität auf
die Konsitenz der Resultate zu relevanten Daten aus anderen Erhebungen oder Statistiken ex-
terner Quellen bezieht (Braun, Diekmann, Weber & Zahner, 1995).
Interne Validität
Der Fragebogen wurde so aufgebaut, dass die Prüfung der internen Validität bis zu einem ge-
wissen Grad möglich ist. Da die Geburtsjahre aller Personen der Grundgesamtheit bekannt
sind, kann auf Grund dieser Angaben eine erste grobe Prüfung vorgenommen werden. Sowohl
bei der Gruppe 1 wie auch bei der Gruppe 2 sind die von den Befragten angegebenen Jahr-
gänge in der möglichen Bandbreite. Weiter wurde bei denjenigen, die in den letzten 12 Monaten
Familienzuwachs durch die Geburt eines Kindes bekamen, der Jahrgang geprüft. Die Jahr-
gänge derjenigen Personen, die angaben Familienzuwachs durch die Geburt eines Kindes
bekommen zu haben, liegen zwischen 1967 und 1979, was im Bereich des möglichen liegt.
Bezüglich Kokainkonsum können die Fragen 17c (Dichotom) mit der Frage 20d verglichen
werden. Wie aus der Tabelle 1 ersichtlich ist, wurden beide Fragen jeweils identisch beant-
wortet, was eine hohe Validität bezüglich der Kokainkonsum-Fragen annehmen lässt.
Konsumieren Sie Kokain? (Dichotom) * Wie oft konsumieren Sie Kokain?
Kreuztabelle
Anzahl
0
0
453
453
2
9
0
11
2
9
453
464
nein
ja
Konsumieren Sie
Kokain? (Dichotom)
Gesamt
mehrmals
pro Monat
selten
nie
Wie oft konsumieren Sie Kokain?
Gesamt
Tabelle 1 Kreuztabelle zur Überprüfung der internen Validität (bezogen auf Kokainkonsum)
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 13
Obwohl nur wenige Überprüfungsmöglichkeiten gegeben waren, diese aber allesamt auf zuver-
lässige Daten schliessen lassen, kann von einer internen Validität ausgegangen werden.
Externe Validität
Die Prüfung der externen Validität erscheint als schwierig, da es keine ähnliche Studien gibt,
welche den möglichen Zusammenhang zwischen Stress und Drogenkonsum untersuchten. Der
prozentuale Anteil jener, die Kokain konsumieren, lässt sich aber mit externen Schätzungen
vergleichen. Die geschätze Kokain-Konsum-Quote bei Erwerbstätigen liegt bei ca. 2.5% (Siehe
Abschnitt 4: ,Ausgangslage und Problemstellung`). 2.3% der im Rahmen dieser Arbeit Be-
fragten gaben an, Kokain zu konsumieren. Dies lässt bezüglich Kokainkonsum eine externe
Validität annehmen. Auf eine weitergehehende Prüfung der externen Validität wurde mangels
vergleichbaren Studien verzichtet.
9. Theoretischer Teil Stress
9.1. Einleitung
Allenspach und Brechbühler (2005) sind der festen Überzeugung, dass ,,Stress und vor allem
Stressbewältigung zu den wichtigsten Themen des beruflichen Alltags zählen" (S. 9). Die Um-
welt, in welcher der Mensch heute lebt, hat sich über tausende von Jahren stark verändert.
Heute bewegt sich der Mensch nicht mehr als Jäger und Sammler, sondern als Mitglied einer
modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Das Leben wurde, und wird, durch
viele Erfindungen und Entdeckungen geprägt, auch verändert sich das soziale Wertesystem
(Allenspach & Brechbühler, 2005). Die Funktion und Reaktion des menschlichen Körpers
hat sich aber über die tausenden von Jahren nicht wesentlich verändert. Auch der moderne
menschliche Körper bereitet sich in besonders fordernden, bedrohlichen oder gefährlichen
Situationen auf Flucht oder Angriff vor (Allenspach & Brechbühler, 2005). Es werden Kraftre-
serven freigesetzt wobei in der Situation unwesentliche Körperfunktionen (z. B. die Verdauung)
auf eine minimale Funktionsstufe reduziert werden. In der Steinzeit war bei bedrohlichen Situa-
tionen Flucht oder Angriff angezeigt. In unserer modernen Gesellschaft sind dies meistens
keine adäquaten Reaktionen. Aus einer Sitzung flüchten ist genauso wenig eine Alternative wie
andere Sitzungsteilnehmer (körperlich) anzugreiffen. Dem Menschen in der heutigen Zeit fehlt
somit die Möglichkeit um Energie abzuleiten, welche in Situationen von Überforderung, Be-
drohung und Angst produziert wird (Allenspach & Brechbühler, 2005).
Ramaciotti und Perriard (2000) haben mit ihrer Studie ,Die Kosten des Stresses in der Schweiz`
herausgefunden, dass sich mehr als einen Viertel der Befragten innert der letzten 12 Monate
häufig oder sehr häufig gestresst fühlten. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten fühlten sich
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 14
manchmal gestresst und lediglich gut 17% fühlten sich nie gestresst. Interessant scheint auch
der von Ramaciotti und Perriard (2000) nachgewiesene, statistisch signifikante Zusammenhang
zwischen der Häufigkeit des Stresses und dem Bildungsstand. Gruppen, die über einen hö-
heren Abschluss (Matura, Universität, Hochschule) verfügen, bezeichnen sich öfter als häufig
oder sehr häufig gestresst als der Durchschnitt.
9.2. Stress aus arbeitspsychologischer Sicht
Die technologischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind einem
andauernden Wandlungsprozess unterworfen. Dieser Wandel hat auch einen Einfluss auf die
Erwerbsarbeit, indem sich auch diese laufend verändert. Unternehmen haben sich laufend den
veränderten Umweltbedingungen anzupassen und Mitarbeitende haben sich laufend an die
veränderten Unternehmensbedürfnisse anzupassen. Für die Mitarbeitenden können diese
Veränderungen mit Belastungen, insbesondere mit psychischen Belastungen verbunden sein.
Psychische Belastungen, deren Folgen und dessen Bewältigungsmöglichkeiten werden zu-
künftig sicher zu noch wichtigeren Themen. Jeder Mensch sieht sich immer wieder mit heraus-
fordernden oder beanspruchenden Situationen konfrontiert. Mit vielen dieser Situationen kann
der Mensch gut umgehen, andere bereiten ihm Schwierigkeiten. Der Mensch ist ,,überfordert,
fehlbenansprucht, gestresst" (Udris & Frese, 1999, zit. in Poppelreuter & Mierke, 2005, S. 15).
Menschen sind heute auf Grund von steigender Konkurrenz um und am Arbeitsplatz, Angst vor
Entlassung, neuen Technologien, Job-Outsourcing, verbunden mit der Anforderung von hö-
herer Produktivität und infolge stärkerem Druck (z. B. Umsatzziele, flexible Anpassung an neue
Organisationsformen) unter Stress, was zu vermehrten Absenzen infolge Arbeitsstress führt
(Stranks, 2005).
Eine durch die Britische HSE (Health and Safety Executive) im Jahr 2002 durchgeführte Unter-
suchung (zit. in Stranks, 2005) zeigt, dass Personen mit Managementaufgaben sowie Personen
mit höherem Bildungsstand überdurchschnittlich gestresst sind. Diese Erkenntnis deckt sich mit
den Ergebnissen der von Ramaciotti und Perriard (2000) durchgeführten Studie ,Die Kosten
des Stresses in der Schweiz`. Diese Feststellung erscheint dadurch als besonders interessant,
da sich diese Arbeit genau auf diese Gruppe (Grundgesamtheit) bezieht.
Ramaciotti und Perriard (2000) haben nachgewiesen, dass die Arbeit als Stressquelle eine
zentrale Rolle spielt, und dies signifikant stärker als Einflüsse ausserhalb der Arbeit.
9.3. Grundlagen ,,Stress"
,Bin im Stress` ist sicherlich eine sehr häufige Antwort auf die Frage ,Wie geht's?`. Oft soll damit
ausgedrückt werden, dass wir viel zu tun haben oder dass einiges los ist. Stress wurde zum
Synonym für Zeit- und Leistungsdruck (Allenspach & Brechbühler, 2005). Im Volksmund wird
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 15
,Stress` kaum von ,Belastung` und ,Beanspruchung` abgegrenzt (Allenspach & Brechbühler,
2005). Ein Definitionsversuch scheint also angezeigt.
Das Wort ,Stress` hat ihren Ursprung in der Mechanik und bedeutet die Einwirkung einer äu-
sseren Kraft auf eine Struktur. Überschreitet die Druckintensität eine gewisse Limite, kommt es
zur Verformung. Auf die Psychologie bezogen wurde der Begriff ,Stress` vor allem vom öster-
reichisch-kanadischen Forscher Hans Selye geprägt (Allenspach & Brechbühler, 2005). Die
Reaktion auf Belastungen bei Mensch und Tier wurde von Seyle als Stress beschrieben. Der
Begriff Stress war also neutral, weder negativ noch positiv behaftet. Im Volksmund wird Stress
heute mit negativer Belastung gleich gesetzt (Allenspach & Brechbühler, 2005).
In den letzten 100 Jahren entstanden verschiedene Definitionen von Stress:
Cannon (1914; zit. in Allenspach & Brechbühler, 2005): ,,unspezifische Antwort des Or-
ganismus auf die Störung des homöostatischen Gleichgewichts und als den Versuch, dieses
Gleichgewicht wiederherzustellen".
Seyle (1936; zit. in Allenspach & Brechbühler, 2005): ,,Stress ist keine mechanische,
sondern eine individuelle Reaktion des Organismus auf äussere Reize".
Levi (1972; zit. in Allenspach & Brechbühler, 2005): ,,Stress ist die unspezifische Reaktion
des Körpers auf irgendeine Anforderung, die an ihn gestellt wird".
Hacker und Richter (1984, zit. in Allenspach & Brechbühler, 2005): Stress ist die Re-
aktion auf unannehmbar oder bedrohlich erlebte, konflitkhafte Fehlbeanspruchungen, die aus
starker Über- oder Unterforderung der Leistungsvoraussetzungen beziehungsweise dem ,In-
Frage-Stellen` wesentlicher Ziele, einschliesslich sozialer Rollen, entsteht".
Temml und Hubalek (1995, zit. in Allenspach & Brechbühler, 2005): Stress ist eine indi-
viduelle Reaktion des Orgnismus auf äussere oder innere Reize, wobei die Reaktion auf den
einwirkenden Stressor abhängt von der Einstellung des Einzelnen zu den Belastungen, von der
Struktur der Persönlichkeit sowie von der Stabilität des Ichs".
Eustress und Distress
Seyle forschte an Ratten und abgeleitet von den Ergebnissen entwickelte er seine Vorstellung
von Stress weiter. Die Auswirkungen von Stress bezeichnete er ab 1950 als Allgemeines
Adaptionssyndrom AAS (General Adaption Syndrom GAS). Er unterschied zwei Arten von
Stress: einen postiv empfundenen Stress bezeichnete er als Eustress, einen Stress, welcher
auf Grund negativer Beanspruchung entsteht, bezeichnete er als Distress. Damit begründete er
den Anfang der wissenschaftlichen Stressforschung. (Allenspach & Brechbühler, 2005).
Stress wird heute in der Regel als negativen, unangenehm empfundenen Spannungszustand
betrachtet (Greif, 1978; zit. in Allenspach & Brechbühler). Deshalb erscheint für Allenspach &
Brechbühler diese Unterteilung heute als wenig sinnvoll.
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 16
Belschak (2001) unterteilt den Stressprozess in zwei Teilprozesse:
1. Stressentstehung: Betrachtet wird die Entstehung von Stress, die unmittelbaren negativen
Reaktionen (strains) und welche Variablen eine Rolle spielen.
2. Stressbewältigung: Betrachtet wird wie vorhandener Stress gemindert werden kann und
welche wirkungsvollen Stressbewältigungsstrategien (Coping-Strategien) zur Verfügung
stehen.
Belschak (2001) führt aus, dass der theoretische und empirische Forschungsstand in Bezug
auf Stressentstehung wesentlich ausgeprägter ist als im Bereich der Stressbewältigung. Im
Rahmen seines integrativen Forschungsvorhabens (systematische Aufarbeitung der verschie-
denen Ansätze und deren Verbinung in einem integrativen Modell, welches die Komplexität
des Stressgeschehens angemessen darstellen soll) beschränkte sich Belschak (2001) dann
ebenfalls auf den Stressentstehungsprozess.
In den weiteren Ausführungen dieser Arbeit wird ebenfalls insbesondere auf die Stressent-
stehung eingegangen, da dies für die zu untersuchende Hypothese von wesentlicher Bedeu-
tung ist. Die verschiedenen Bewältigungsstrategien sind direkt zur Hypothesenüberprüfung
nicht nötig, werden aber zu Orientierungszwecken überblicksmässig dargestellt. Drogenkon-
sum als Stressbewältigung lässt sich dabei auch systematisch einordnen.
9.4. Drei wesentliche Stresstheorien
In der Forschung besteht eine gewisse Einigkeit, dass Stress etwas mit der Anpassung des
Organismus an die Umwelt zu tun hat (Nitsch, 1981). Zur Frage, welcher Teil dieses An-
passungsgeschehens nun mit Stress bezeichnet werden soll, besteht aber Uneinigkeit
(Belschak, 2001). Die Stresstheorien werden in der Literatur aber meist in drei Kategorien
eingeteilt (Antoni & Bungard, 1989; Frese & Udris, 1988; beide zit. in Belschak; 2001; Nitsch,
1981):
9.4.1. Reizorientierte Stressdefinition
Im Rahmen reizorientierter Ansätze wird Stress als das ,,Auftreten bestimmter Stimuli bzw.
situativer Bedingungen" definiert (Belschak, 2001, S. 24). Hierbei wird davon ausgegangen,
dass diese Stimuli Funktionsstörungen oder Angst hervorrufen. Dieser Ansatz wird insbe-
sondere von der sog. Life-Event-Forschung unterstützt (Dohrenwend & Dohrenwend, 1974;
Filipp, 1995; Katschnig, 1980; zit. in Belschak, 2001). Bestimmte Lebensereignisse (z. B.
Heirat, Tod des Ehepartners) werden als Stress definiert, wobei die subjektive Bewertung der
Ereignisse keine Rolle spielt (Belschak, 2001). Holmes und Rahe (1967; zit. in Litzcke und
Schuh, 2005) untersuchten sogenannte Lebensereignisse und erstellten eine bewertete Liste,
wobei das Lebensereignis ,Hochzeit` als Skalenmittelwert (50) gesetzt wurde. Belastender als
die eigene Hochzeit wurden bezeichnet: Tod Lebenspartner (100 Punkte), Scheidung (73
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 17
Punkte), Tod Familienangehöriger (63 Punkte), eigene schwere Verletzung oder Krankheit
(53 Punkte). Diese Skala wurde durch über 20 Jahre wissenschaftliche Arbeit verfeinert, wobei
eine Skala enstand, mit welcher die ,Menge` Stress gemessen werden kann (Siehe auch
Abschnitt 11.1). Der Life-Event-Ansatz wird aber auch kritisiert (Dohrenwend et al., 1978;
Hough, Fairbank & Garcia, 1976; Rabkin & Struening, 1976; alle zit. in Ramaciotti und Perriard,
2000) und zwar insbesondere deshalb, weil die Bedeutung, welche ein Individuum solchen Er-
eignissen beimisst, nicht berücksichtigt wird. Kanner et al. (1981; zit, in Ramaciotti und Perriard,
2000) führen aber aus, dass Life-Events alltägliche Belastungen verstärken oder ,Alltagssorgen`
erst zu einer Belastung werden lassen.
An der reizorientierten Stressdefinition gibt es noch weitere, allgemeine Kritik. So z. B. von
McGrath (1970; zit. in Belschak, 2001), welcher die fehlende Möglichkeit, qualitativ unterschied-
liche Stimuli miteinander zu vergleichen wie auch ihren Stressgehalt festzustellen, kritisiert.
Nitsch (1981) kritisiert das Fehlen eines Modelles, welches die Wechselwirkung zwischen
verschiedenen Stimuli aufzeigt. Lazarus & Launier (1981; zit. in Belschak, 2001) kritisieren die
reizorientierte Stressdefinition dahingehend, da Stimuli einem subjektiven Wahrnehmungspro-
zess unterliegen würden und somit zu deutlich unterschiedlichen Reaktionen führen können.
Udris & Frese (1999; zit. in Wiegand; 2002) halten dem aber gegenüber, dass bestimmte
Situationen (Life-Events) mit ziemlicher Regelmässigkeit von den meisten Personen als be-
lastend empfunden werden und entsprechende Stressreaktionen auslösen würden. Belschak
(2001) erachtete es als zweckmässig der Terminologie von Seyles (1981; zit. in Belschak,
2001) zu folgen und die Umweltmerkmale als Stressoren zu bezeichnen. Es sei hier angefügt,
dass gemäss Bürger & Koch (1995; zit. in Wiegand, 2002) berufliche Belastungen als Er-
krankungsursache bei Patienten in stationärer psychosomatischer Behandlung eine grössere
Bedeutung als persönliche Schwierigkeiten, familiäre oder partnerschaftliche Konflikte haben.
Insofern haben nach Ansicht des Autors dieser Arbeit Life-Events durchaus einen Einfluss auf
das Stressempfinden des Individuums und sollten bei der Untersuchung berücksichtigt werden.
9.4.2. Reaktionsorientierte Stressdefinition
Bei reaktionsorientierten Ansätzen wird das Auftreten von bestimmten Reaktionen als Stress
definiert (Levi, 1972; Selye; 1981; zit. in Belschak, 2001). Seyle, der prominenteste Vertreter
einer solchen Auffassung (Belschak, 2001) definiert Stress als ,,unspezifische Reaktion des
Organismus auf jede Anforderung" (Seyle, 1981, S. 170; zit. in Belschak, 2001, S. 25). Entspre-
chend führen verschiedene Stimuli zur identischen, unspezifischen Reaktion des Organismus,
was als Allgemeines Adaptionssyndrom (AAS) bezeichnet wird. Auch die reaktionsorientierte
Stressdefinition wird kritisiert. So z. B. von Nitsch (1981), welcher kritisiert, dass die auslösen-
den Bedingungen für eine Reaktion nicht eindeutig bestimmt werden können und dass der rein
physiologische Ansatz Seyles nicht einfach abstrahiert und auf emotionale oder handlungs-
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 18
mässige Reaktionen übertragen werden kann. Nach Belschak (2001) ermöglicht die reaktions-
orientierte Stressdefinition nur einen unvollständigen Zugang zum Stressphänomen, weshalb er
anlässlich seiner Bemühungen für ein integriertes Stressmodell diesen Zusammenhang nicht
als Stress, sondern als Stressreaktion (strain) bezeichnet.
9.4.3. Interaktionale / Transaktionale Stressdefinition
Interaktionale, resp. in Anlehnung an Lazarus (1966; zit. in Belschak, 2001) auch transaktionale
Stressdefinitionen, gehen davon aus, ,,dass sich Stress nur aus der Beziehung von Person und
Umwelt erschliesst" (Belschak, 2001, S. 27). Dadurch wird dem subjektiven Wahrnehmungs-
und Bewertungsprozess eine entscheidende Bedeutung zugemessen (Belschak, 2001).
Wiegand (2002) beschreibt das Stresserleben als subjektiven Bewertungsprozess (primary
appraisal) sowie der Einschätzung der Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten (secondary
appraisal). McGrath (1981; zit. in Nitsch, 1981) verwendet ebenfalls das transaktionale Stress-
konzept wobei er davon ausgeht, dass Stress eine Interaktion von Person und Umwelt bein-
haltet. Er hat eine einfach Darstellung (siehe Abb. 1) gefunden, aus welcher hervorgeht, dass
eine gegebene Situation vom Betroffenen bewertet wird und so zu einer subjektiv wahrge-
nommenen Situation wird. Anschliessend wird auf Grund des (unterbewussten) Entscheidungs-
prozesses eine Reaktion gewählt, was schliesslich zu einem bestimmten Verhalten führt.
Abb. 1 Transaktionale Zusammenhänge in einem vierstufigen Prozess nach McGrath (1981)
Auf Grund der Dynamik und der Komplexität der Interaktion zwischen Individuum und Umwelt
ist die empirische Überprüfung der transaktionalen Modelle gemäss Greif (1991; zit. in
Wiegand, 2002) erschwert. Trotzdem wird dieses Modell in der Arbeitsstressforschung als das
bestimmende Erklärungsmodell beigezogen (Wiegand, 2002).
A
Situation
B
Wahrgenom-
mene Situation
D
Verhalten
C
Reaktionswahl
Bewertungs-
prozess
Ausführungs-
prozess
Veränderungs-
prozess
Entscheidungs-
prozess
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 19
Dieser Ansatz wird auch von Allenspach & Brechbühler (2005) vertreten, für welche das Aus-
mass an Stress nicht in erster Linie objektive Situationsmerkmale sondern vielmehr die sub-
jektive Einschätzung der Person, ihrer Gefühle und Gedanken bedeuten. Die individuelle,
subjektive Bewertung wird als entscheidend bezeichnet. Weiter führen sie aus, dass ein be-
stimmter Reiz nicht an sich ein Stressor ist, sondern durch die sujbektive Wahrnehmung und
Verarbeitung zu einem wird. Allenspach & Brechbühler (2005) gehen davon aus, dass eine
Situation, in welcher die Anforderungen hoch und die persönliche Bewältigungskompetenz
niedrig ist und zudem Erfolg oder Misserfolg von grosser Bedeutung sind, besonders stressig
sind. So kommen sie zum Schluss, dass der Vergleich zwischen Anforderungen und Bewälti-
gungsmöglichkeiten für die Entstehung von Stress entscheidend ist, wobei das Gefühl, die
Situation kontrollieren zu können, ausschlaggebend sei. Ob eine Arbeitsstelle dem Mitar-
beitenden viel Stress bereitet, hängt nach Semmer und Udris (1995; zit. in Allenspach &
Brechbühler, 2005) von der Beziehung zwischen Arbeitsanforderung und dem eigenen Hand-
lungsspielraum ab. Gemäss dem von Karasek 1979 entwickelte Anforderungs-Kontroll-Modell
(Job Strain Model) (Abb. 2) wirken sich hohe Belastungen bei gleichzeitig geringem Entschei-
dungsspielraum besonders stressend aus. Lässt die Tätigkeit grossen Entscheidungsspielraum
zu, können sich hohe Anforderungen auch positiv auswirken.
Abb. 2 Anforderungs-Kontroll-Modell (Job Strain Model) nach Karasek, 1979 (in Wiegand, 2002)
Die Diagonale von links unten nach rechts oben bezeichnet die Stressdimension, wobei Anfor-
derungen zunehmen bei gleichzeitiger Abnahme des Entscheidungsspielraums. Die Dioganale
von links oben nach rechts unten bezeichnet die Aktivitätsdimension, wobei die Zunahme der
Anforderungen parallel zur Zunahme des Entscheidungsspielraums verläuft.
Gemäss Karasek (1979; zit. in Wiegand, 2002) hat die empirische Überprüfung des Modells
gezeigt, dass die Kombination von hohen Arbeitsanforderungen und geringem
passive
Tätigkeit
aktive
Tätigkeit
Entscheid
ungsspielra
um
hoch
nied
rig
Arbeitsanforderungen
niedrig hoch
Stress-
dimension
Aktivitäts-
dimension
stark
belastende
Tätigkeit
wenig
belastende
Tätigkeit
Diplomarbeit: Drogenkonsum als Stressbewältigungsstrategie
Seite 20
Entscheidungsspielraum am häufigsten mit Erschöpfungs- und Depressionszuständen sowie
mit geringerer Arbeitszufriedenheit und höherem Medikamentenkonsum einhergeht.
9.5. Begriffsdefinition: Stressor, Stressreaktion, arbeitsbedingter Stress
Allenspach & Brechbühler (2005) haben die Begriffe Stressor, Stressreaktion und arbeitsbe-
dingter Stress wie folgt definiert:
Stressoren
Stressoren sind Objekte, Reize, Ereignisse und Situationen, die bedrohlich sind und zu
Schädigungen führen können. Stressoren führen abhängig von ihrer Stärke und unseren
Bewältigungsfähigkeiten zu einer Stressreaktion. Allgemein gesagt, sind Anforderungen
dann stressend, wenn wir annehmen, dass wir diese nur schwer oder gar nicht bewältigen
können.
Stressreaktion
Eine Stressreaktion ist ein subjektiver Zustand, der aus der Befürchtung entsteht, eine sehr
unangenehme, zeitlich nahe und subjektiv lang andauernde Situation wahrscheinlich nicht
vermeiden zu können. Die betroffene Person erwartet, die Situation weder beeinflussen
noch durch Einsatz von persönlichen oder äusseren Ressourcen bewältigen zu können.
Eine Stressreaktion umfasst Reaktionen auf verschiedenen Ebenen. Wir reagieren mit
unserem ganzen Organismus, unserem Denken, Fühlen und Erleben auf einen Stressor.
Arbeitsbedingter Stress / arbeitsbedingte Stressreaktion
Unter arbeitsbedingtem Stress versteht man Reaktionen auf widrige und schädliche Aspek-
te des Arbeitsinhalts, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumgebung. Diese Reaktion
äussert sich in unseren Gefühlen, unserem Verhalten und unserem körperlichen Befinden.
Wir reagieren auf diese Bedingungen z. B. mit Erregung, Unbehagen und oft mit einem
Gefühl der Überforderung. Der Auslöser ist ein Stressor, der mit der Arbeit zu tun hat. Ar-
beitsbedingter Stress ist die Reaktion darauf. Arbeitsbedingter Stress ist also wissenschaft-
lich gesehen eine arbeitsbedingte Stressreaktion.
9.6. Stressmodelle
Über die Ursachen von Stress resp. wie Stress entsteht, gibt es verschiedene Modelle.
Belschak (2001) bezeichnet den theoretischen und empirischen Forschungsstand bezüglich
Stressentstehung als wesentlich stärker entwickelt als bezüglich Stressbewältigung. Belschak
(2001) hält aber fest, dass ,,es auch heute noch, zumindest für den organisationspsycholo-
gischen Bereich, kein integratives Stressmodell, das in der Lage wäre, die einflussreichsten
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832499402
- ISBN (Paperback)
- 9783838699400
- DOI
- 10.3239/9783832499402
- Dateigröße
- 658 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Private Hochschule Wirtschaft PHW Bern – unbekannt, Studiengang Betriebsökonomie
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Oktober)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- drogen stress kokain drogenkonsum stressbewältigung
- Produktsicherheit
- Diplom.de