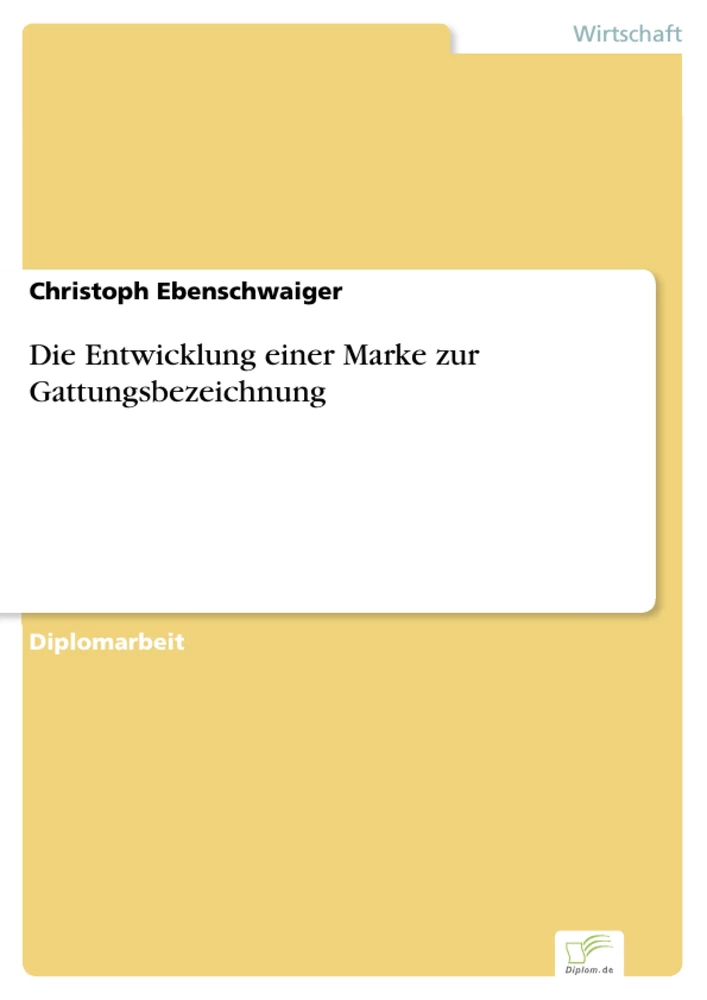Die Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung
Zusammenfassung
Diese dem Leser hier präsentierte Diplomarbeit setzt sich das Ziel, ein in juristischen Kreisen kaum behandeltes Thema mit hochgradigen wirtschaftlichen Konsequenzen zu analysieren. Es handelt sich hierbei um das Verwirken des Markenschutzes aufgrund der Transformation einer geschützten Marke in eine Gattungsbezeichnung nach § 33b MSchG. Weiters wird dargestellt, welche Eintragungshindernisse für Gattungsbezeichnungen bestehen.
Dabei möchte ich mit dem Verweis auf aktuelle österreichische, deutsche und europäische Rechtsprechung ein konkretes Bild der Eintragungsunfähigkeit von Gattungsbezeichnungen oder ihres Ausscheidens aus dem Markenregister aufgrund des Löschungstatbestandes der Evolution zum Freizeichen wiedergeben.
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Teile. Im ersten Teil möchte ich dem Leser einen Überblick über Gattungsbezeichnungen im Allgemeinen geben. Angefangen wird mit einer Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Freizeichen und einer genauen Bestimmung der Terminologie der Gattungsbezeichnung. Danach werden Freizeichen als Eintragungshindernisse und als Löschungstatbestände im österreichischen, deutschen und europäischen Markenrecht erläutert.
Im zweiten Teil der Diplomarbeit folgt eine genaue Ausarbeitung und ein Vergleich der beiden Urteile OGH 29.01.2002, 4 Ob 269/01i - Sony Walkman und OGH 6.7.2004, 4 Ob 128/04h Memory.
Im dritten Teil der Diplomarbeit wird in einem kurzen Leitfaden für Unternehmen erklärt, wie man das Eintragungshindernis und auch den Löschungstatbestand Gattungsbezeichnung vermeiden kann.
Zusammenfassung:
Das Thema Gattungsbezeichnungen hat seit der Ratifizierung der europäischen Markenrichtlinie in Österreich an Brisanz gewonnen und schuf die Möglichkeit des Verlustes des Markenschutzes aufgrund der Entwicklung zur Gattungsbezeichnung. Ziel dieser Diplomarbeit ist es, den Vorgang der Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung, welche ihren Zeichenschutz verliert, darzustellen, zu analysieren und zu zeigen, durch welches Vorgehen der Markeninhaber diese Evolution verhindern kann.
Das Resultat ist eine Analyse des österreichischen Markenschutzgesetzes, des deutschen Markengesetzes und der europäischen Markenrichtlinie in Bezug auf die Eintragungshindernisse von Gattungsbezeichnungen und den Löschungstatbestand aufgrund der Entwicklung eines Zeichens zu einer den Markenschutz verlierenden Gattungsbezeichnung. Im Speziellen wurden die beiden OGH Urteile […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Zielsetzung
2 Einleitung - Historie von Gattungsbezeichnungen in Österreich
2.1 Terminologie
2.2 Terminologie International
3 Gattungsbezeichnungen in Österreich, Deutschland und der EU
3.1 Die Gattungsbezeichnung als Eintragungshindernis - § 4 Abs 1 Z 5 MSchG
3.1.1 Verkehrsgeltung - erworbene Unterscheidungskraft
3.1.2 Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung - § 33b MSchG
3.1.3 Geographische Gattungsbezeichnungen
3.1.4 Domain-Namen – Geschäftsbezeichnungen
3.2 Deutsches Markenrecht
3.2.1 Gattungsbezeichnungen im MarkenG
3.2.2 Verkehrsdurchsetzung (erworbene Unterscheidungskraft)
3.2.3 Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung § 49 Abs 2 Nr. 1 MarkenG
3.2.4 Geographische Gattungsbezeichnungen (§ 126 Abs 2 MarkenG)
3.2.5 Domain-Namen
3.3 Europäisches Markenrecht
3.3.1 MarkenRl
3.3.1.1 Gattungsbezeichnungen in der MarkenRl
3.3.1.2 Gattungsbezeichnungen als Eintragungshindernisse in der MarkenRl
3.3.1.3 Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung
3.3.1.4 Eintragung aufgrund des Erwerbes von Unterscheidungskraft
3.3.1.5 Geographische Bezeichnungen in der MarkenRl
3.3.2 Gattungsbezeichnungen im Gemeinschaftsmarkenrecht
3.3.2.1 Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung
4 Analyse von OGH, Urteil vom 29.01.2002, 4 Ob 269/01i – Walkman
4.1 Der Walkman
4.2 Einleitung zum Urteil Sony Walkman
4.3 Zusammenfassung von den Urteilen Sony Walkman I und II
4.4 Die zugrunde liegende Rechtsnorm
4.5 Die Rechtsausführungen des OGH
4.6 Die Lehre
4.6.1 Pöchhacker zu Walkman I
4.6.2 Korn zu Walkman II
4.6.3 Gruber zu Walkman I
4.6.4 Glosse von Schanda zu Walkman I und II
4.7 Argumente der deutschen Lehre
4.8 Meinung des Autors
5 Analyse von OGH 6.7.2004, 4 Ob 128/04h - Memory
5.1 Das Memory Spiel
5.2 Zusammenfassung des Urteils OGH 6.7.2004, 4 Ob128/04h-Memory
5.3 Die Entscheidungsgründe
5.4 Das Rekursgericht
5.5 Die Lehre
5.5.1 Glosse Gamerith
5.5.2 Glosse Schumacher
5.6 OLG München 21.10.2003 Az 33 O 3824
5.7 OLG München 17.11.2005, Az 29 U 1927/05 – Memory
5.8 Meinung des Autors
6 Vergleich der beiden Urteile: Sony Walkman II und Memory
6.1 Beteiligte Verkehrskreise und deren Verkehrsauffassung
6.2 Alternativbegriffe
6.3 Erfüllung der Tatbestände nach § 33b MSchG
7 Darstellung der Entwicklung zur Gattungsbezeichnung in Ö
8 Kurzer Leitfaden für den Markeninhaber um einer Entwicklung seines Zeichens zur Gattungsbezeichnung entgegenzuwirken
9 Zusammenfassung
10 Abkürzungsverzeichnis
11 Literaturverzeichnis
12 Anhang
1 Zielsetzung
Diese dem Leser hier präsentierte Diplomarbeit setzt sich das Ziel, ein in juristischen Kreisen kaum behandeltes Thema mit hochgradigen wirtschaftlichen Konsequenzen zu analysieren. Es handelt sich hierbei um das Verwirken des Markenschutzes aufgrund der Transformation einer geschützten Marke in eine Gattungsbezeichnung nach § 33b MSchG. Weiters wird dargestellt, welche Eintragungshindernisse für Gattungsbezeichnungen bestehen.
Dabei möchte ich mit dem Verweis auf aktuelle österreichische, deutsche und europäische Rechtsprechung ein konkretes Bild der Eintragungsunfähigkeit von Gattungsbezeichnungen oder ihres Ausscheidens aus dem Markenregister aufgrund des Löschungstatbestandes der Evolution zum Freizeichen wiedergeben.
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Teile. Im ersten Teil möchte ich dem Leser einen Überblick über Gattungsbezeichnungen im Allgemeinen geben. Angefangen wird mit einer Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Freizeichen und einer genauen Bestimmung der Terminologie der Gattungsbezeichnung. Danach werden Freizeichen als Eintragungshindernisse und als Löschungstatbestände im österreichischen, deutschen und europäischen Markenrecht erläutert.
Im zweiten Teil der Diplomarbeit folgt eine genaue Ausarbeitung und ein Vergleich der beiden Urteile OGH 29.01.2002, 4 Ob 269/01i - Sony Walkman und OGH 6.7.2004, 4 Ob 128/04h – Memory.
Im dritten Teil der Diplomarbeit wird in einem kurzen Leitfaden für Unternehmen erklärt, wie man das Eintragungshindernis und auch den Löschungstatbestand Gattungsbezeichnung vermeiden kann.
2 Einleitung - Historie von Gattungsbezeichnungen in Österreich
Vor der MSchG-Novelle 1992[1] war es im österreichischen Recht nicht möglich, dass sich eine registrierte Marke zu einer Gattungsbezeichnung, welche jeglichen Zeichenschutz verliert, entwickelt.
Erst mit Österreichs Annäherung an die Europäische Union wurden auch die Vereinheitlichungsbemühungen der Union mitgetragen. Ein wesentlicher Schritt in Richtung eines gesamteuropäischen Markenschutzes war die europäische Markenrichtlinie. Im Rahmen des EWR-Abkommens musste Österreich die „Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (MarkenRl)[2] übernehmen[3] und in die innerstaatliche Rechtsordnung bis zum 1. Jänner 1993, unter der Voraussetzung des Inkrafttretens des EWR-Abkommens mit diesem Datum,[4] umsetzen.
Diese Richtlinie wurde zum großen Teil mit der österreichischen MSchG-Novelle von 1992[5] ratifiziert. Aufgrund des hohen Zeitdruckes sollte den Regelungen der Richtlinie unter weitestmöglicher Beibehaltung des bestehenden österreichischen Markenrechts nur im absolut notwendigen Umfang Rechnung getragen werden[6]. Die wichtigsten Reformen waren unter anderem die Ausdehnung des amtswegig wahrzunehmenden Registrierungshindernisses der beschreibenden Angabe auch auf Bild- und Wortbildmarken (§ 4 Abs 1 Z 2 MSchG). In § 10a MSchG wurde der Erschöpfungsgrundsatz festgelegt. Die Verwirkung des Rechts zur Antragstellung auf Löschung der jüngeren Marken unter gewissen Voraussetzungen (§ 30 Abs 2 MSchG) wurde ebenfalls implementiert. Der für diese Diplomarbeit maßgebliche Löschungstatbestand des § 33b MSchG (Entwicklung zum Gattungsbegriff) wurde als Popularlöschungstatbestand[7] neu eingeführt.[8]
Da diese Novelle die MarkenRl ungenügend umgesetzt hat erfolgte mit der MSchG-Novelle 1999[9] eine korrekte Umsetzung der europäischen MarkenRl, im Besonderen der die Eintragung von Gattungsbezeichnungen betreffenden § 4 Abs 2 MSchG[10] wurde geändert. Die Markenrechtsnovelle 1999 brachte eine Neufassung der Markendefinition und der Registrierungshindernisse (§§ 1 und 4 MSchG), einen Entfall der Notwendigkeit eines markenfähigen Unternehmens des Registrierenden (§ 3 MSchG), eine Neuerung des Ausschließungsrechtes (§ 10 MSchG), die Hinzufügung des Löschungstatbestandes des bösgläubigen Markenerwerbs (§ 34 MSchG) und eine Eingliederung der Sanktionsregelungen aus dem UWG in das MSchG (§§ 51 ff MSchG)[11].
Bei den Reformen des MSchG von 1992 und 1999 wurden auch dem TRIPS – Abkommen[12] und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken[13] Rechnung getragen.[14] Die bisher letzte Novellierung des MSchG fand 2004 statt.[15]
Damit wurde durch diese beiden Reformen das österreichische Recht in Hinblick auf Gattungsbezeichnungen (auch Freizeichen oder Appellativum genannt) in zwei Schritten bereichert. Durch die Reform von 1992 wurde die Möglichkeit der Entwicklung einer bereits registrierten Marke zu einem den Zeichenschutz verlierenden Gattungsbegriff geschaffen. Mit der Novelle von 1999 wurde die Möglichkeit der Registrierung nach § 4 Abs 2 MSchG für Freizeichen und andere relative Registrierungshindernisse geschaffen, indem Freizeichen, denen Verkehrsgeltung nachgewiesen werden kann, die Eintragungsfähigkeit bescheinigt wird.
2.1 Terminologie
Die österreichische Rechtsprechung und Literatur verwendet für Begriffe, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind, das Wort Gattungsbezeichnung (z.B. Brot, Mineralwasser). Weiters üblich sind die Ausdrücke Freizeichen, Begriffsmonopol und teilweise findet man in der Literatur den Ausdruck Appellativum, welcher in der Sprachwissenschaft ein Substantiv definiert, dass eine Gattung von Dingen oder Lebewesen und zugleich jedes einzelne Wesen oder Ding dieser Gattung bezeichnet (z.B. Mensch, Blume, Tisch).[16]
Grundsätzlich spricht man also von Gattungsbezeichnungen, auch wenn der österreichische Gesetzgeber in § 33b Abs 2 MSchG das Wort Freizeichen in diesem Gebrauch anführt. Die Bedeutung des Wortes Gattungsbezeichnung findet sich in § 4 Abs 1 Z 5 MSchG bzw. § 8 Abs 2 Z 3 MarkenG, Art 3 Abs 1 lit d MarkenRl und Art 7 lit d GMV umschrieben[17] und entspricht dem früheren Verständnis des Freizeichens.
In der Vergangenheit wurden Gattungsbezeichnungen sowohl in Deutschland als auch Österreich als Freizeichen bezeichnet.
Die Terminologie des Freizeichens ist die ursprüngliche, vom Wortlaut des § 4 Abs 1 (deutsches) WZG 1936 vom 5. Mai 1936[18] gewählte Bezeichnung, welche auf die Definition in § 10 Warenbezeichnungsgesetz vom 30. November 1874 zurückgeht. Dabei handelte es sich um „Warenzeichen, welche sich bisher im freien Gebrauch aller oder gewisser Klassen von Gewerbetreibenden befunden haben.“[19]
Dabei sind die sowohl im österreichischen MSchG als auch im deutschen MarkenG beschriebenen, allgemeinen sprachgebräuchlichen Bezeichnungen als Gattungsbezeichnungen im weiteren Sinne zu verstehen, während der Begriff „verkehrsübliche Bezeichnung“ als Gattungsbezeichnung im engeren Sinne zu verstehen ist.
Anbei eine Auflistung der für die Diplomarbeit besonders relevanten Artikel des Markenschutzes auf österreichischer, deutscher und europäischer Ebene.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Damit nicht der Eindruck entsteht, Gattungsbezeichnungen wären nur europarechtlich relevant, wird anbei eine kurze Exkurs in andere Rechtskreise unternommen.
2.2 Terminologie International
Auch in anderen Rechtskreisen, z.B. der Schweiz in Art 2 lit a Schweizer-MSchG[20] oder in den USA im Lanham Act[21], werden Gattungsbezeichnung geregelt. In der Schweiz gab es interessante Entscheidungen zu Gattungsbezeichnungen, wie „gelbe Seiten“ für Telefonbücher oder „EILE MIT WEILE“ für Spiele und Spielkarten. Im Lanham Act wird das Markenrecht für die USA kodifiziert und durch Richterrecht ständig weiterentwickelt. Damit in den USA eine Marke registriert werden kann, muss diese unterscheidbar (distinct) sein. Gattungsbegriffe (generic terms) sind genauso wie im europäischen Markenschutzrecht nicht registrierbar. Eine Marke kann auch durch langjährigen Gebrauch zu einem Gattungsbegriff werden. Beispiele wären Aspirin (für Acetyl Salicylic Acid, Bayer Co. v. United Co., 272 F. 505), Singer (für Nähmaschine, Singer Manufacturing Co., v. June Manufacturing Co., 163 US 169) oder Space Shuttle (für wieder verwendbares Raumfahrzeug, NASA v. Bully Hills Vineyards Inc., 3 USPQ 2d 1671).
3 Gattungsbezeichnungen in Österreich, Deutschland und der EU
3.1 Die Gattungsbezeichnung als Eintragungshindernis - § 4 Abs 1 Z 5 MSchG
Im MSchG besteht seit 1999 ein relatives Eintragungshindernis (siehe nächster Absatz) für Gattungsbezeichnungen. Damit soll verhindert werden, dass Zeichen registriert werden, für die ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit gegenüber existiert, oder eine Monopolisierung von Zeichen entsteht. § 4 Abs 1 Z 5 MSchG beschreibt indirekt die Attribute eines Appellativums. Gegenstand des Eintragungshindernisses sind also zum einen an sich unterscheidungskräftige Zeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet werden und deshalb nicht kennzeichnend sondern beschreibend wirken, und zum anderen Gattungsbezeichnungen, die aufgrund ihres beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind.[22] Beispiele hierzu sind Cola oder Fruchtsaft.
Als relative Eintragungshindernisse bezeichnet die österreichische Rechtsprechung jene Registrierungshindernisse, welche von § 4 Abs 2 MSchG erfasst werden. Dieser Paragraph ermöglicht trotz der Einstufung als Gattungsbezeichnung die Registrierung in den Fällen des § 4 Abs 1 Z 3, 4 und 5 MSchG, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.
Bei Gattungsbezeichnungen im Sinne des § 4 Abs 1 Z 5 MSchG handelt sich um Zeichen, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind.[23] Natürlich kann jedoch ein Wort im Geschäftsverkehr zur Bezeichnung einer Ware verwendet werden, für die sie nicht üblich ist. (z.B. Piano für Schokolade). Tritt die Beziehung des Wortes zu einer Eigenschaft der Ware nicht unmittelbar, sondern erst im Wege gedanklicher Schlussfolgerungen zu Tage, dann ist der Geschäftsverkehr in der Regel in der Lage, im betreffenden Hinweis auch ein Unternehmenskennzeichen zu sehen.[24]
Handelt es sich um seltene Waren an denen nur ein kleiner Abnehmerkreis interessiert ist, kommt es auf die Auffassung dieses kleinen fachlich gebildeten Personenkreises an.[25] Dies wird auch in Entscheidungen des OPM[26] wiedergegeben: „ein Freizeichen liegt auch dann vor, wenn nur ein kleiner Kreis, dieser aber allgemein, das Zeichen benützt.“[27]
3.1.1 Verkehrsgeltung - erworbene Unterscheidungskraft
Die einzige Möglichkeit, eine Marke, die unter § 4 Abs 1 Z 5 MSchG fällt, in das österreichische Markenschutzregister einzutragen, ist mit Hilfe eines Verkehrsgeltungsnachweises. Verkehrsgeltung bedeutet, dass das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat. Der in Österreich verwendete Terminus Verkehrsgeltung entspricht dem in Art 3 Abs 3 MarkenRl verwendeten Ausdruck „erworbene Unterscheidungskraft“.[28] Unter den beteiligen Verkehrskreisen versteht man alle möglichen Abnehmer und Mitbewerber. Bei alltäglichen Leistungen (z.B. Lebensmittel) zählen zu den Verkehrskreisen alle in Österreich lebende Konsumenten. Bei Spezialprodukten, welche nur einen bestimmten Abnehmerkreis haben (z.B. Röntgengeräte) kann schon ein kleiner Kreis relevant sein.[29] Es reicht jedoch, wenn ein erheblicher Teil der beteiligen Kreise das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht. Dieser erhebliche Teil ist nicht anhand eine bestimmten Prozentsatzes definiert sondern wird von Fall zu Fall definiert.
Von der in der MarkenRl angeführten Möglichkeit, dass die Unterscheidungskraft auch noch nach der Anmeldung oder Eintragung erlangt werden kann, hat der österreichische Gesetzgeber keinen Gebrauch gemacht (vgl § 4 Abs 2 MSchG mit Art 7 Abs 3 GMV). Bei der Prüfung der Verkehrsgeltung sind diverse Aspekte zu berücksichtigen. Der Marktanteil des Zeichens, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand (z.B. Kosten der Werbekampagne), eine Prüfung der Kennzeichenfunktion des Zeichens durch Befragung der beteiligten Verkehrskreise, sowie Erklärungen von Interessensgemeinschaften. Der Anmelder muss den Nachweis über die Verkehrsgeltung erbringen. Dies kann mittels Gutachten, Meinungsumfragen, Bestätigungen von Händlern und Konsumenten, Belegen über Werbemaßnahmen, Geschäftskorrespondenz etc. erfolgen. Dieser Nachweis muss für ganz Österreich erbracht werden. Der Grad der notwendigen Verkehrsgeltung hängt sowohl von der Unterscheidungskraft des Zeichens als auch von dem daran bestehenden Freihaltebedürfnis ab; er ist umso höher, je geringer die Unterscheidungskraft bzw. je größer das Freihaltebedürfnis ist.[30]
3.1.2 Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung - § 33b MSchG
§ 33b MSchG spricht auch von einer Marke, die im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung geworden ist. Beim Verlust des Rechtes an einer Marke handelt es sich nicht um Verwirkung oder Dereliktion[31], sondern um den objektiven Tatbestand der Umwandlung der Marke in eine allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnung aufgrund der Verkehrsauffassung.[32] Die Widerrechtlichkeit der Benutzung der Marke durch Dritte hindert eine Veränderung der Verkehrsauffassung nicht.
Entscheidende Ursache für diese Entwicklung kann auch sein, dass den genannten Marktteilnehmern kein annähernd gleichwertiger Alternativbegriff zur Verfügung steht, um damit ihr Produkt zu benennen und das eingetragene Zeichen wie ein Monopol wirkt. Unter diesen Umständen ist eine weitere Privilegierung des Zeichens nicht mehr gerechtfertigt.[33] (z.B. Walkman)
Für § 33b MSchG ist zu erwähnen, dass Verschulden an der Umwandlung zur Gattungsbezeichnung nicht notwendig ist. Es genügt die objektive Zurechenbarkeit. Diese ist anzunehmen, wenn der Zeicheninhaber in seiner Produktwerbung selbst die Marke austauschbar mit der Produktbezeichnung (substantivisch) einsetzt oder untätig bleibt, obwohl er bei angemessener Marktbeobachtung die Entwicklung seiner Marke zu Gattungsbezeichnung hätte erkennen können oder es trotz dieser Erkenntnis unterlassen hat, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um dieser Entwicklung entgegenzutreten.[34]
War das Zeichen bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Gattungsbezeichnung, ist nicht § 33b MSchG, sondern der Löschungstatbestand des § 33 MSchG anwendbar. Das erfolgt in Fällen in denen eine Marke registriert wird und später durch Widerspruch eines Dritten festgestellt wird, dass es sich eigentlich schon zur Zeit der Eintragung in das Markenregister um eine Gattungsbezeichnung handelte.
Bei dem Löschungstatbestand des § 33b MSchG handelt es sich um eine Popularklage[35], deren Löschungserkenntnis auf den Zeitpunkt zurück wirkt, auf den die abgeschlossene Entwicklung der Marke zur gebräuchlichen Beizeichnung nachgewiesen wurde.[36]
3.1.3 Geographische Gattungsbezeichnungen
Wichtig ist auch zu beachten das § 33b MSchG für Zeichen, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dienen, nicht anwendbar ist.[37] Das heißt eine geographische Angabe kann nicht auf Grund ihrer Entwicklung zur Gattungsbezeichnung gelöscht werden (z.B: Champagner ist nur Schaumwein aus der Champagne. Er ist als Zeichen geschützt und kann sich nie zu einer Gattungsbezeichnung nach § 33b entwickeln). Es kann natürlich sein, dass eine geographische Gattungsbezeichnung aufgrund des § 4 Abs 1 Z 5 MSchG nicht eingetragen werden kann. Das bedeutet, dass von der Eintragung als geographische Angabe Bezeichnungen auszuschließen sind, die lediglich Gattungsbezeichnungen darstellen.[38] Z.B: Die Bezeichnung „Emmentaler“ besitzt momentan keine Herkunftsfunktion.
Eine wichtige Rolle spielen Gattungsbezeichnungen, wenn auch nicht im Sinne des § 33b MSchG, im Domainrecht.
3.1.4 Domain-Namen – Geschäftsbezeichnungen
Die Registrierung von beschreibenden Begriffen als Domain-Namen bei NIC[39] ist wenigen rechtlichen Schranken unterworfen (z.B. www.sms.at). Domainnamen werden Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 9 UWG zugeordnet.[40] Schutzunfähig ohne Verkehrsgeltung sind Gattungsbezeichnungen und rein beschreibende Angaben somit auch für Domainnamen, wenn sie von beteiligten Verkehrskreisen zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschlossen werden können und als beschreibender Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstanden werden.[41] Enthält das Zeichen nur Andeutungen einer bestimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend.[42].
Interessant ist auch, dass sittenwidriges Domain-Grabbing nur vorliegen kann, wenn für das als Domain verwendete Zeichen kennzeichenrechtlicher Schutz besteht, nicht aber bei Verwendung beschreibender Gattungsbezeichnungen ohne Verkehrsgeltung.[43]
Auch Zeicheninhaber, deren Zeichen einen hohen Grad an Verkehrsgeltung genießen, können aufgrund des Vorliegens äußerst geringer Prägnanz des Kennzeichens, (z.B. der Begriff „Kinder“), das sich als Bestandteil der Alltagssprache und als Gattungsbezeichnung darstellt, und dessen Verwendung als Domain nicht generell wettbewerbswidrig ist, die Benutzung des Zeichens nicht untersagen.[44]
MA nach würde auch der Fall „sexnews.at“ gegen news.at unter die Bestimmungen für Gattungsbezeichnungen in Domainnamen fallen. Denn meiner Ansicht nach handelt es sich bei der Bezeichnung News für Informationsdienste (online oder auch print) um einen Begriff, der ein Freihaltebedürfnis aufweist. Der OGH begründet jedoch, dass ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Folge dieser Wechselwirkung ist es, dass bei Warenidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Warenabstand. Das der englischen Sprache entnommene Wort „news“ ist keine im Inland sprachübliche Gattungsbezeichnung für Printmedien und damit als kennzeichnungskräftig für die damit bezeichneten Produkte zu beurteilen.[45] Ich finde jedoch, dass „news“ gerade im Internet nicht kennzeichnungskräftig ist und einen Bestandteil der Alltagssprache und eine Gattungsbezeichnung (siehe kinder.at) darstellt. Weiters wurde der „Contentunterschied“ zwischen news.at (teilweise erotische Bilder aber großteils Neuigkeiten) und sexnews.at (pornografischer Inhalt) nicht im richtigen Ausmaß berücksichtigt. Der Ausgang dieses Urteils basiert auf der Verkehrsgeltung von NEWS im Printbereich, aber nicht im Internet, wo dem Wort News mA nach keine Unterscheidungskraft zukommt. Meiner Meinung nach sollte man beim Verkehrsgeltungsnachweis zwischen den Verkehrskreisen im Internet und im normalen geschäftlichen Verkehr unterscheiden.
Anders als das österreichische Markenrecht hat, das deutsche Markenrecht eine lange Tradition im Umgang mit Gattungsbezeichnungen. Besonders relevant ist das deutsche Markenrecht auch aufgrund des Zitierens deutscher Lehre durch den österreichischen OGH.
3.2 Deutsches Markenrecht
Das deutsche MarkenG beruht auf der MarkenRl, welche wiederum stark vom Vorläufer des MarkenG beeinflusst wurde. Der deutsche Gesetzgeber setzte diese Richtlinie mit Inkrafttreten des MarkenG am 1. November 1994 bzw. am 1. Januar 1995[46] um. Es löste das WZG von 1936, welches im Markenschutzgesetz vom 30. November 1874 seinen Ursprung hatte, ab.[47] Abgelöst wurden damit auch veraltete Bezeichnungen wie z.B. "Warenzeichen" zugunsten der Bezeichnung "Marke". Vor dem MarkenG befanden sich kennzeichnungsrechtliche Schutzvorschriften nicht nur im Warenzeichengesetz, sondern betreffend den Firmenschutz auch im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Darüber hinaus nahm das MarkenG auch die notorisch bekannten Marken im Sinne des Art 6 der Pariser Verbandsübereinkunft Gemeinschaftsmarken, international registrierte Marken und die geographischen Herkunftsangaben, die zuvor in den §§ 3, 5 dUWG und im § 26 WZG geschützt waren, auf. Das MarkenG schützt laut § 1 MarkenG Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben.
3.2.1 Gattungsbezeichnungen im MarkenG
Die Eintragung von Gattungsbezeichnungen ins deutsche Markenregister kann, ähnlich wie in Österreich, an mehreren Hindernissen scheitern. Zuerst kann die einzutragende Marke schon aufgrund des Fehlens der abstrakten Unterscheidungseignung im Sinne der Markenfähigkeit nach § 3 Abs 1 MarkenG nicht eingetragen werden. Weiters kann die Eintragung scheitern, wenn dem Warenzeichen jegliche Unterscheidungskraft für die konkreten Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, nach § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG fehlt (konkrete Unterscheidungskraft). § 3 Abs 1 MarkenG prüft also die Markenfähigkeit, während § 8 Abs 2 MarkenG die Eintragungsfähigkeit prüft.
Das Relevante an dieser Unterscheidung ist, dass eine Markenunfähigkeit nicht infolge des Erwerbs von Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG überwunden werden kann.[48]
Einem abstrakt unterscheidungsgeeigneten und damit als Marke schutzfähigen Zeichen kann für bestimmte Waren oder Dienstleistungen die produktidentifizierende Unterscheidungskraft fehlen, für andere Produkte kann es konkret unterscheidungskräftig sein.[49]
Die Rechtsprechung des BGH zum MarkenG führt jedoch diese Unterscheidung zwischen abstrakter Unterscheidungseignung und konkreter Unterscheidungskraft, welche die Lehre aus dem WZG übernahm, nicht mehr in dieser Konsequenz durch.
Weiters kann eine Gattungsbezeichnung, welche markenfähig und konkret unterscheidungskräftig ist (also die Prüfung nach § 3 Abs 1 MarkenG und § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt), an § 8 Abs 2 Nr. 3 MarkenG scheitern, weil die Marke als Gattungsbezeichnung im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistung üblich geworden ist. Dieses absolute Registrierungshindernis kann nach § 8 Abs 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung in den Verkehrskreisen überwunden werden.
Als allgemein sprachgebräuchliche und verkehrsübliche Bezeichnungen gelten auch allgemeine Ausdrücke der Wirtschaftssprache oder umgangssprachliche Bezeichnungen, wenn sie aufgrund ihrer Eignung schlagwortartig und werbemäßig auf wichtige Umstände im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen hinweisen. Dabei ist ein unmittelbarer Wortbezug nicht notwendig (Bonus, Mega).[50] Allgemein sprachgebräuchlich oder verkehrsüblich können Zeichen auch sein, wenn sie regional bei beachtlichen Verkehrskreisen im Allgemeingebrauch stehen.[51] Markenschutz für solche Zeichen kann zwar nach § 4 Abs 2 MarkenG durch den Erwerb von Verkehrsgeltung entstehen und regional begrenzt sein, es ist jedoch nicht möglich, dass eine Gattungsbezeichnung als regional begrenzt eintragungsfähig beurteilt wird.
Entscheidend für das Erkennen eines Freizeichens ist immer, ob der inländische Verkehr die Bezeichnung als ein identifizierendes Unterscheidungszeichen oder als eine Gattungsbezeichnung versteht.
Nahezu skandalös ist es meiner Ansicht nach, dass es aktuell der FIFA nach Interventionen der Politik in Deutschland[52] gestattet wurde, die Wortmarken WM BIER, WM DEUTSCHLAND 2006, 2006, FUSSBALL WM DEUTSCHLAND, Welt zu Gast bei Freunden, FUSSBALL WM 2006 und WM 2006 zu registrieren.[53] Dabei ist zu beachten, dass in Deutschland im Jahre 2006 weitere Weltmeisterschaften, z.B. im Tischtennis, stattfinden.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 27.04.2006[54] negativ über die Schutzfähigkeit der Marken „WM 2006“ und „FUSSBALL WM 2006“ (siehe oben) entschieden. Laut BGH fehlt der Marke Fussball WM 2006 jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr. 1 MarkenG. Die Angabe „FUSSBALL WM 2006“ sei eine sprachübliche Bezeichnung für die damit beschriebene Sportveranstaltung, nämlich der im Jahre 2006 in Deutschland stattfindenden Fußballweltmeisterschaft.
Weiters hat der Bundesgerichtshof, wenn auch mit Einschränkungen, die Löschung der Marke „WM 2006“ bestätigt. Im Gegensatz zum Zeichen „Fussball WM 2006“ kann nicht angenommen werden, dass der Verkehr diese Angabe für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen als nicht unterscheidungskräftigen Hinweis auf die Fußball Weltmeisterschaft verstehe. „WM 2006“ ist vielmehr eine Zahlen- und Buchstabenkombination, die nicht zwingend für jede Ware oder Dienstleistung einen Bezug zu einer Weltmeisterschaft im Jahre 2006 nahe lege. Daher soll durch das Bundespatentgericht eine differenzierende Prüfung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen durchgeführt werden.
Die Entscheidung des BGH ist der Schlusspunkt des Löschungsverfahrens, dass vor etwa einem Jahr mit einem Löschungsantrag des Süßwarenherstellers Ferrero beim DPMA seinen Anfang nahm, sein. Das DPMA löschte beide Marken, die Mitte 2002 bzw. Anfang 2003 für über 850 Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden waren, antragsgemäß. Das Bundespatentgericht (BPatG) hob den Beschluss teilweise auf. Es hielt den Schutz der FIFA-Marken nur für solche Waren- und Dienstleistungen aufrecht, die „nichts“ mit der WM zu tun haben. Die Marken waren weiterhin geschützt für Produkte wie Videokameras, Seifen und T-Shirts, jedoch nicht für die Artikel Postkarten und Abziehbilder.
Dagegen haben in beiden Verfahren sowohl die FIFA als auch der Süßwarenhersteller Ferrero (als Löschungsanstragstellerin) Rechtsbeschwerde eingelegt. Damit wurde die Entscheidung des Bundespatentgerichts in vollem Umfang einer rechtlichen Nachprüfung durch den Markensenat des Bundesgerichtshofs unterzogen.
Die BGH-Entscheidung hat in der Frage der Schutzfähigkeit von Allgemeinbegriffen wie „WM 2006“ oder „Fußball-WM 2006“ einen Meilenstein gesetzt. Dennoch ist ein Ende der Auseinandersetzungen noch nicht erreicht. Die FIFA ist nach wie vor im Besitz gleichlautender Marken, die als EU-Gemeinschaftsmarke beim europäischen Markenamt eingetragen sind. Auch für diese Marken ist ein Löschungsverfahren anhängig. Es ist aber ausgeschlossen, dass auch in diesem Löschungsverfahren vor der Weltmeisterschaft, welche am 9.6.2006 beginnt, eine rechtskräftige Entscheidung ergeht.[55]
Ist eine Gattungsbezeichnung Zeichenbestandteil einer Marke, so ist diese eintragungsfähig, wenn die Bezeichnung im Verkehr trotz der Gattungsbezeichnung als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen verstanden wird.[56] Auch das Bilden des Diminutivs einer Gattungsbezeichnung entwickelt nur Eintragungsfähigkeit, wenn die gebildete Formulierung Unterscheidungskraft entwickelt. Eintragungsunfähig ist daher Fernettchen; Dieses Wort stammt von Fernet und ist ein italienischer Magenbitter.[57]
3.2.2 Verkehrsdurchsetzung (erworbene Unterscheidungskraft)
Die einzige Möglichkeit der Überwindung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG ist der Erwerb von Verkehrsdurchsetzung. Der im MarkenG verwendete Begriff der Verkehrsdurchsetzung, welcher auf § 4 Abs 3 WZG zurückzuführen ist, ist mit dem Terminus „erworbene Unterscheidungskraft“ der MarkenRl gleichzusetzen. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Verkehrsdurchsetzung liegt vor, wenn das Zeichen als produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen verstanden wird.[58]
Die erworbene Unterscheidungskraft muss vor der Anmeldung zur Eintragung in das Markenregister erworben worden sein oder vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung, was aber zu einer Prioritätsverschiebung führt.[59]
Die Marke muss sich bei den beteiligten Verkehrskreisen (zur Definition von beteiligten Verkehrskreisen siehe oben MSchG) durchgesetzt haben. Dies ist für das gesamte Bundesgebiet notwendig.
Der Durchsetzungsgrad zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist abhängig von der Stärke des eventuell gegebenen Freihaltebedürfnisses.[60] Diese ist umso größer je allgemeiner der Zeichenbegriff ist und je häufiger seine Verwendung durch die Allgemeinheit ist (z.B. Kinder).
Kann einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass einem als Marke verwendeten Wortzeichnen die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit die Unterscheidungskraft fehlt.[61]
3.2.3 Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung § 49 Abs 2 Nr. 1 MarkenG
Wenn der Verkehr eine Marke nicht mehr als ein produktidenifizierendes Unterscheidungszeichen versteht, hat sich das Zeichen zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt. Nach § 49 Abs 2 Nr. 1 MarkenG tritt der Verfall des Zeichens dann ein, wenn sich die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, entwickelt hat.[62] Das bedeutet, dass die Marke der im Verkehr übliche Name für alle Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Art ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nach dem allgemeinen Sprachgebrauch geworden ist. Es ist jedoch zusätzlich notwendig, dass diese Entwicklung infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Markeninhabers eingetreten ist.[63] Das Verhalten kann in einem Tun, Dulden oder Unterlassen liegen. Verwendet der Markeninhaber seine Marke selbst als Gattungsbezeichnung, z.B. in seiner Produktwerbung, so kann darin die erforderliche Mitursächlichkeit gesehen werden. Untätigkeit definiert sich nicht nur dadurch, dass die Bezeichnung innerhalb der Fachkreise verwendet wird und Dritte nicht hinreichend über den Markencharakter der Bezeichnung aufgeklärt werden, sondern trifft auch dann zu, wenn der Zeicheninhaber bei Beobachtung des Marktes eine Entwicklung seiner Marke zum Freizeichen hätte erkennen können, oder es trotz dieser Kenntnis unterlassen hat, dieser Entwicklung entgegenzusteuern.[64]
[...]
[1] BGBl 1992/773.
[2] ABl 1989 L040, 1 mit Berichtigung ABl 1989 L 159, 60 idF ABl 1992 L006, 35 und ABl 1994 L 001, 482.
[3] Marterer, Auswirkungen der Markenschutzgesetz-Novelle 1992 auf den Ausschließungsgrund des Freizeichens, ÖBl 1993, 60.
[4] 669 BlgNR 18. GP, 4 .
[5] BGBl 1992/773.
[6] Vorblatt zu 669 BlgNR 18. GP, 4.
[7] Bezeichnet im MSchG die Paragraphen §§ 33a, 33b, 33c und § 34. Jede juristische oder natürliche Person kann einen Löschungsantrag ohne Begründung eines besonderen rechtlichen Interesses stellen.
[8] Engin-Deniz, MSchG und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen (2005) 30.
[9] BGBl I 1999/111.
[10] Pöchhacker, Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht, in Koppensteiner I/2 (1996).
[11] Engin-Deniz, MSchG. und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen (2005) 31.
[12] österr. BGBl 1995/1 Anhang 1C idF 1995/379.
[13] WIPO Veröffentlichung Nr 204.
[14] Engin-Deniz, MSchG. und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen (2005) 30.
[15] BGBl I 2004/149.
[16] Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim (2003) [CD-ROM].
[17] § 4 Abs 1 Z 5: Von der Registrierung ausgeschlossen sind Zeichen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung üblich sind.
[18] RGB1. II S. 134.
[19] Fezer, Markenrecht (1997) 341.
[20] Schweizer Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben SR 232.11 (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 28.08.1992.
[21] Trademark Act of 1946 ("Lanham Act") as Amended PUBLIC LAW 79-489, CHAPTER 540, APPROVED JULY 5, 1946; 60 STAT. 427.
[22] NA 25.6.2003, Nm 15/2000; PBl 2003, 187 = ÖBl-LS 2004/32 – Talalay.
[23] § 4 Abs 5 MSchG, Markenschutzgesetz 1970, MSchG, BGBl 260/1970 (WV) idF BGBl I 149/2004 und BGBl I 151/2005.
[24] BA 18.8.2000, Bm 19/99, ecolex 2001, 156 – Museum.
[25] OGH 24.11.1998, 4 Ob 266/98s, ecolex 1999, 134 = ÖBl 1999, 124 = RdW 1999 , 78 – Tabasco VI.
[26] Der Oberste Patent- und Markensenat ist Berufungsinstanz gegen die Endentscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes und Beschwerdeinstanz gegen die Endentscheidungen der Beschwerdeabteilung des Patentamtes. Er besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, aus mindestens acht weiterenrechtskundigen und der erforderlichen Zahl von fachtechnischen Mitgliedern als Räten.
[27] OPM 8.9.1993, Om 5/93, PBl 1994, 150 – Transzenddentale Meditation.
[28] Mutz, Markenschutz – Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz, Kucsko (2006) 127.
[29] Mutz, Markenschutz – Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz, Kucsko (2006) 127.
[30] BA 24.2.1988, Bm 9, 10/87, ÖBl 1989, 11 = PBl 1988, 201 – Waschmittel.
[31] Unter Dereliktion versteht man die Aufgabe des Eigentums an einer Sache.
[32] Fezer, Markenrecht (1997) 345; OGH, 6.7.2004, 4 Ob 128/04h – Memory; OGH 29.01.2002, 4 Ob 269/01i, - Sony Walkman II.
[33] OGH 29.01.2002, 4 Ob 269/01i, MR 2002, 169 = ÖBl 2002/38 (185); Korn, Tragbarer Kassettenspieler, Walky oder doch Walkman? MR 2002, 314; ecolex 2002/201, Schanda - Sony Walkman II.
[34] OGH 29.01.2002, 4 Ob 269/01i, MR 2002, 169,314 = ÖBl 2002/38 (185) = ecolex 2002/201 - Walkman II.
[35] Popularklage bezeichnet eine Klage, die von jedem erhoben werden kann, auch demjenigen, der nicht unmittelbar betroffen ist.
[36] § 33b Abs. 2, Markenschutzgesetz 1970, MSchG, BGBl 260/1970 (WV) idF BGBl I 149/2004 und BGBl I 151/2005.
[37] OGH 25.5.2004, 4 Ob 45/04b, ÖBl-LS 2004,166 – St. Zeno.
[38] Art 3 Abs 1 VO 2081/92.
[39] Die nic.at Internet Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H. ist die offizielle Registrierungsstelle für alle Domains mit der Endung .at, sowie den Endungen .co.at und .or.at. Die Abkürzung NIC steht für Network Information Center.
[40] OGH 24.2.1998, 4 Ob 36/98t, SZ 71/35; ecolex 1998, 65 Schanda – Jusline.
[41] OGH 24.6.3003, 4 Ob 117/03i, RdW 2004, 13 = MR 2004, 69 = wbl 2003, 309 – computerdoktor.com; OGH 13.3.2003, 4 ob 39/02t, ecolex 2002, 233 = ÖBl-LS 2002, 125 – kunstnetz.at; OGH 13.11.2001, 4 Ob 237/01h, ecolex 2002, 143 = ÖBl 2002, 10 – drivecompany.at.
[42] MR 1999, 354; ÖBl-LS 01/20 - E-MED = ecolex 2001, 127 Schanda – Wirtschaftswoche.
[43] OGH 10.2.2004, 4 Ob 229/03k, MR 2004, 374 – autobelehnung.at.
[44] OGH 16.7.2002, 4 Ob 156/02y – kinder.at.
[45] OGH 21.12.2004, 4 Ob 238/04k - sexnews
[46] BGBl. I, S. 3082, 1995 I S. 156.
[47] Fezer, Markenrecht (1997) 55.
[48] Fezer, Markenrecht (1997) 279.
[49] BPatG GRUR 1993, 670 – Diva.
[50] BGH 20.06.1996, I ZB 31/95, WRP 96,1042 = MDR 96,1029 = NJW-RR 96,1258 = GRUR 96,770 – Mega; BGH 23.10.1997, I ZB 18/95, GRUR 1998, 465 = WRP 1998, 492 - BONUS I.
[51] BPatGE 18, 239, 243 – Apollo.
[52] http://www.stern.de/sport-motor/fussball/?id=536822&nv=cp_L1_rt_al (5.4.2006).
[53] http://publikationen.dpma.de/fnd_tm_beg.do;jsessionid=Eg7MuypfjlphhFV1biSjUfZXVkvyUAaIRnIJbaonSlkgjIfh441o!-1100779978!1147206412089.
[54] BGH 27.4.2006, I ZB 97/05 – Fussball WM 2006; BGH 27.4.2006, I ZB 96/05 – WM 2006.
[55] Fabian Reinholz, http://www.haerting.de/de/3_lawraw/archiv/markenrecht.php?we_objectID=763 (2006).
[56] Fezer, Markenrecht (1997) 345.
[57] BPatG GRUR 1996, 131 – Fernettchen.
[58] Fezer, Markenrecht (1997) 385.
[59] Fezer, Markenrecht (1997) 384.
[60] Fezer, Markenrecht (1997) 388.
[61] BGH 19.1.1995, I ZB 20/92, GRUR 1995, 408 – PROTECH; BGH 25.3.1999, I ZB 21/96, PMZ 1999, 256 - PREMIERE I.
[62] Fezer, Markenrecht (1997) 1145.
[63] Fezer, Markenrecht (1997) 1146.
[64] Fezer, Markenrecht (1997) 1146.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832499167
- ISBN (Paperback)
- 9783838699165
- DOI
- 10.3239/9783832499167
- Dateigröße
- 577 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FH Joanneum Graz – Wirtschaft & Technologie
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Oktober)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- rechtswissenschaft markenrecht freizeichen memory walkman
- Produktsicherheit
- Diplom.de