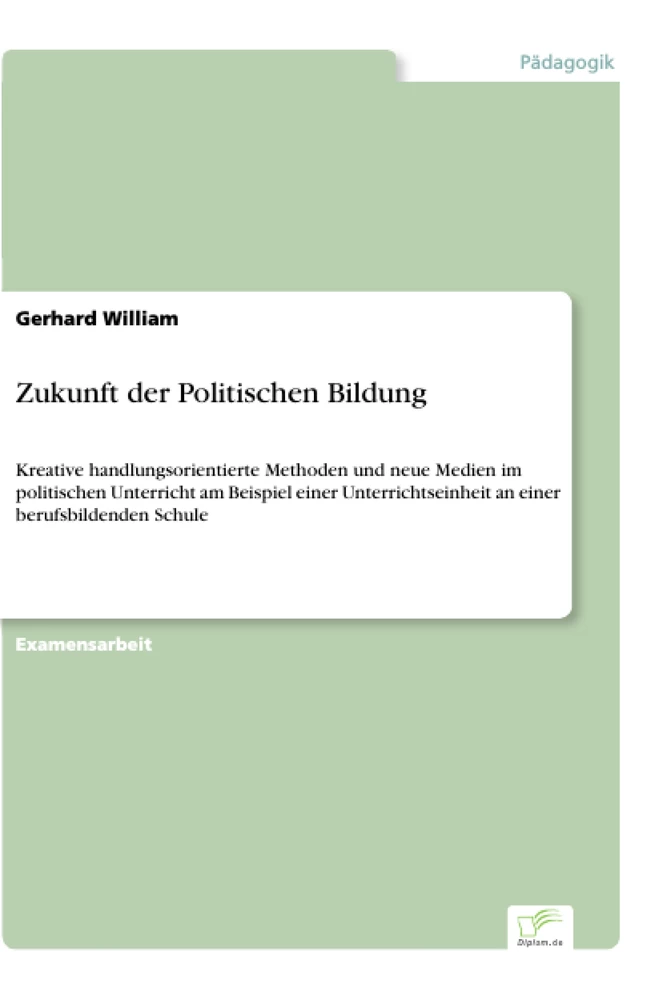Zukunft der Politischen Bildung
Kreative handlungsorientierte Methoden und neue Medien im politischen Unterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit an einer berufsbildenden Schule
©2006
Examensarbeit
135 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die berufliche Welt in unserer Gesellschaft erfährt einen immer schneller verlaufenden Wandel. In Zeiten der Globalisierung und der damit einhergehenden Öffnung der Märkte, sind die Unternehmen in einem immer stärkerem Maße dazu angehalten neue Ideen, Wege und Maßnahmen zu finden, damit der Unternehmenserfolg sich einstellt und gesichert werden kann. Die Organisationseinheiten der Unternehmen, damit auch die Mitarbeiter und Führungskräfte, stehen permanent neuen Anforderungen und Aufgaben gegenüber. Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, bedarf es der Beherrschung unterschiedlicher Kompetenzen.
Eine grobe Einteilung eines solchen Kompetenzkatalogs unterscheidet Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Methodenkompetenz, die in der Summe die Handlungskompetenz ergeben. Diese wiederum soll durch einen handlungsorientierten Unterricht erreicht werden. Dieses Kompetenzrepertoire stellt sogleich auch ein komplett verändertes Anforderungsprofil an die Berufsausbildung und damit an die Schülerinnen und Schüler sowie an die Lehrkräfte dar. Reichte es im klassischen Unterricht die Vermittlung von Fachkompetenz (Stoffvermittlung per lehrerzentriertem Unterricht) zu betreiben, so ergeben sich in Unterrichtseinheiten moderneren Typs mit dem Ziel der Handlungsorientierung komplett neue Probleme, Wege, aber auch Chancen, die sowohl auf die Lehrkräfte als auch auf die Schülerinnen und Schüler Einfluss nehmen.
Als Anregung zur oben beschrieben Beobachtung erachte ich meine eigene Ausbildungszeit (1991 1993) zum Versicherungskaufmann an der berufsbildenden Schule in Oldenburg. Im einwöchig stattfindenden Politikunterricht wurde immer ein und dieselbe Unterrichtsmethode verwendet: der Frontalunterricht. Dieser fand in der Regel in Form von fragend-entwickelndem Unterricht, dem Schüler-Lehrer-Dialog sowie dem Lehrervortrag statt. Beim Lesen von Fachzeitschriften und Fachbüchern kann sehr schnell festgestellt werden, dass es neben dem Frontalunterricht noch weitere Unterrichtsmethoden für den politischen Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen gibt. Da gibt es exemplarisch die Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit oder aber auch Rollen-, Plan- und Simulationsspiele, um nur einige belebende Elemente des Unterrichts zu benennen.
Dass politischer Unterricht dem neuen Anforderungsprofil nicht mit althergebrachten Methoden gerecht werden kann, liegt auf der Hand. Neue Herausforderungen verlangen nach neuen Methoden. Da eine komplette […]
Die berufliche Welt in unserer Gesellschaft erfährt einen immer schneller verlaufenden Wandel. In Zeiten der Globalisierung und der damit einhergehenden Öffnung der Märkte, sind die Unternehmen in einem immer stärkerem Maße dazu angehalten neue Ideen, Wege und Maßnahmen zu finden, damit der Unternehmenserfolg sich einstellt und gesichert werden kann. Die Organisationseinheiten der Unternehmen, damit auch die Mitarbeiter und Führungskräfte, stehen permanent neuen Anforderungen und Aufgaben gegenüber. Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, bedarf es der Beherrschung unterschiedlicher Kompetenzen.
Eine grobe Einteilung eines solchen Kompetenzkatalogs unterscheidet Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Methodenkompetenz, die in der Summe die Handlungskompetenz ergeben. Diese wiederum soll durch einen handlungsorientierten Unterricht erreicht werden. Dieses Kompetenzrepertoire stellt sogleich auch ein komplett verändertes Anforderungsprofil an die Berufsausbildung und damit an die Schülerinnen und Schüler sowie an die Lehrkräfte dar. Reichte es im klassischen Unterricht die Vermittlung von Fachkompetenz (Stoffvermittlung per lehrerzentriertem Unterricht) zu betreiben, so ergeben sich in Unterrichtseinheiten moderneren Typs mit dem Ziel der Handlungsorientierung komplett neue Probleme, Wege, aber auch Chancen, die sowohl auf die Lehrkräfte als auch auf die Schülerinnen und Schüler Einfluss nehmen.
Als Anregung zur oben beschrieben Beobachtung erachte ich meine eigene Ausbildungszeit (1991 1993) zum Versicherungskaufmann an der berufsbildenden Schule in Oldenburg. Im einwöchig stattfindenden Politikunterricht wurde immer ein und dieselbe Unterrichtsmethode verwendet: der Frontalunterricht. Dieser fand in der Regel in Form von fragend-entwickelndem Unterricht, dem Schüler-Lehrer-Dialog sowie dem Lehrervortrag statt. Beim Lesen von Fachzeitschriften und Fachbüchern kann sehr schnell festgestellt werden, dass es neben dem Frontalunterricht noch weitere Unterrichtsmethoden für den politischen Unterricht an kaufmännischen Berufsschulen gibt. Da gibt es exemplarisch die Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit oder aber auch Rollen-, Plan- und Simulationsspiele, um nur einige belebende Elemente des Unterrichts zu benennen.
Dass politischer Unterricht dem neuen Anforderungsprofil nicht mit althergebrachten Methoden gerecht werden kann, liegt auf der Hand. Neue Herausforderungen verlangen nach neuen Methoden. Da eine komplette […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Gerhard Mathias William
Zukunft der Politischen Bildung
Kreative handlungsorientierte Methoden und neue Medien im politischen Unterricht
am Beispiel einer Unterrichtseinheit an einer berufsbildenden Schule
ISBN-10: 3-8324-9897-4
ISBN-13: 978-3-8324-9897-9
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Oldenburg, Deutschland,
Staatsexamensarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
2
Zukunft der Politischen Bildung: Kreative handlungsorientierte Methoden und neue
Medien im politischen Unterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit an einer
berufsbildenden Schule
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 4
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ... 5
TABELLENVERZEICHNIS ... 5
1 EINLEITUNG ... 6
2 THEORIEN UND DIDAKTIK IN DER POLITISCHEN BILDUNG... 10
2.1 A
LLGEMEINE
T
HEORIEN DER
D
IDAKTIK
... 10
2.2 D
IDAKTISCHE
K
ONSTRUKTION DES POLITISCHEN
U
NTERRICHTS
... 12
2.2.1 Bürgerrollen in Demokratie und politischer Bildung ... 13
2.2.1.1 Leitbilder zur Bürgerrolle in der Politikdidaktik... 14
2.2.1.2 Die Bürgerrollen im handlungsorientierten Politikunterricht ... 16
2.2.2 Didaktische Prinzipien politischer Bildung ... 17
2.2.3 Ziele politischer Bildung ... 20
2.3 H
ANDLUNGSORIENTIERUNG ALS DIDAKTISCHES
P
RINZIP POLITISCHER
B
ILDUNG
... 22
2.3.1 Begriffsbestimmung ... 22
2.3.2 Probleme bei der Umsetzung und Realisierungskriterien... 24
2.3.3 Chancen und Grenzen ... 25
2.3.4 Handlungsorientierung im Politikunterricht... 26
2.4 P
OLITISCHER
U
NTERRICHT AN BERUFSBILDENDEN
S
CHULEN
... 28
2.4.1 Didaktik und Zielsetzungen ... 29
2.4.2 Niedersächsischer Lehrplan und Ist-Zustand des Faches Politik ... 31
2.5 E
XKURS
: P
LANUNG EINES POLITISCHEN
U
NTERRICHTS
... 34
3 METHODEN IM POLITIKUNTERRICHT... 36
3.1 T
HEORIEN DES
M
ETHODENEINSATZES
... 36
3.2 M
ETHODENKOMPETENZ
THEORETISCHE
G
RUNDLAGEN UND
V
ERMITTLUNG
... 38
3.3 M
ETHODENVIELFALT
TRADITIONELLE UND KREATIVE
W
EGE IM POLITISCHEN
U
NTERRICHT
... 40
3.3.1 Lehrerorientierte Unterrichtsmethoden ... 41
3.3.2 Schülerorientierte Unterrichtsmethoden... 43
3.3.3 Selbstgesteuerte Unterrichtsmethoden ... 47
3.3.4 Kreative handlungsorientierte Ansätze ... 51
3.4 A
NSÄTZE FÜR DEN
E
INSATZ VON
M
ETHODEN
... 56
4 MEDIEN IM POLITIKUNTERRICHT ... 59
4.1 T
HEORIEN VON
M
EDIEN IM
U
NTERRICHT
... 59
4.2 M
EDIENKOMPETENZ
... 61
4.3 D
IE
M
EDIENKOMPETENZ IN DER POLITISCHEN
B
ILDUNG
... 64
4.4 M
EDIENVIELFALT
: T
RADITIONELLE UND NEUE
M
EDIEN IM POLITISCHEN
U
NTERRICHT
.. 65
4.4.1 Darstellung traditionelle Unterrichtsmedien ... 66
4.4.2 Darstellung neue Medien ... 67
3
4.4.3 Kennzeichen neuer Medien ... 68
4.4.4 Neue Medien als Chance im politischen Unterricht ... 74
4.5 A
NSÄTZE FÜR DEN
E
INSATZ VON NEUEN
M
EDIEN
... 76
5 METHODEN UND MEDIEN IM IMPLIKATIONSZUSAMMENHANG ... 80
6. DAS UNTERRICHTSBEISPIEL: VERTEILUNG DER BUNDESMINISTERIEN
NACH DER BUNDESTAGSWAHL 2005 ... 91
6.1 D
ER
U
NTERRICHTSENTWURF
... 91
6.1.1 Vorbereitung einer Unterrichtseinheit ... 91
6.1.2. Didaktisch-methodische Entscheidungen... 93
6.1.3. Konzeptionelle Entscheidungen ... 95
6.2 D
URCHFÜHRUNG DER
U
NTERRICHTSEINHEIT
... 98
6.2.1 Die erste und zweite Unterrichtsstunde ... 99
6.2.2 Die dritte und vierte Unterrichtsstunde ... 103
6.3 E
VALUATION
... 106
7 FAZIT UND AUSBLICK ... 110
LITERATURVERZEICHNIS ... 121
INTERNETVERZEICHNIS ... 133
4
Abkürzungsverzeichnis
BBS
Berufsbildende Schule
BMBF
Bundesministerium für Bildung und Forschung
BpB
Bundeszentrale für Politische Bildung
BS
Berufsschule
GPJE
Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenen-
bildung
KMK
Kultusministerkonferenz
RRL
Rahmenrichtlinien
VK
Versicherungskaufleute
VWL
Volkswirtschaftslehre
WB
Weiterbildung
5
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Planungsfragen für den Politikunterricht
33
Abbildung 2: Vorteile von Kleingruppen
45
Abbildung 3: Phasen des Rollenspiels
48
Abbildung 4: Medienkompetenz nach Baacke
61
Abbildung 5: Ausstattung der Haushalte mit Computern
66
Abbildung 6: Internetnutzung und Bildung
73
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Konzeptuelles Deutungswissen
20
Tabelle 2: Handlungsorientierung
26
Tabelle 3: Behalten als Funktion des Vortragsumfanges
40
Tabelle 4: Der kreative Prozess
50
Tabelle 5: Möglichkeiten der Wissensvermittlung
52
Tabelle 6: Einsatz von Unterrichtsmethoden bei unterschiedlichen Lernzielen
56
Tabelle 7: Hauptmerkmale verschiedener Unterrichtsmethoden
57
Tabelle 8: Kompetenzen im Umgang mit dem Internet
77
Tabelle 9: Methoden- und Medienfaktoren
86
Tabelle 10: Auswahl der Faktoren
87
Tabelle 11: Effizienz der Kombination
89
Tabelle12: Neue Unterrichtskonzepte
94
Tabelle 13:Der Unterrichtsverlauf der ersten und zweiten Unterrichtsstunde.
95
Tabelle 14: Der Unterrichtsverlauf der dritten und vierten Unterrichtsstunde.
99
6
,,Wer einen wirklich klaren Gedanken hat, kann ihn auch darstellen. Ist der Geist einmal der
Dinge Herr, folgen die Worte von selbst." Michel Montaigne
1 Einleitung
Die berufliche Welt in unserer Gesellschaft erfährt einen immer schneller verlaufenden
Wandel. In Zeiten der Globalisierung und der damit einhergehenden Öffnung der Märkte,
sind die Unternehmen in einem immer stärkerem Maße dazu angehalten neue Ideen, Wege
und Maßnahmen zu finden, damit der Unternehmenserfolg sich einstellt und gesichert werden
kann. Die Organisationseinheiten der Unternehmen, damit auch die Mitarbeiter und
Führungskräfte, stehen permanent neuen Anforderungen und Aufgaben gegenüber. Um diesen
Aufgaben gerecht werden zu können, bedarf es der Beherrschung unterschiedlicher
Kompetenzen.
Eine grobe Einteilung eines solchen Kompetenzkatalogs unterscheidet Fachkompetenz,
Sozialkompetenz und Methodenkompetenz, die in der Summe die Handlungskompetenz
ergeben. Diese wiederum soll durch einen handlungsorientierten Unterricht erreicht werden.
Dieses Kompetenzrepertoire stellt sogleich auch ein komplett verändertes Anforderungsprofil
an die Berufsausbildung und damit an die Schülerinnen und Schüler sowie an die Lehrkräfte
dar. Reichte es im klassischen Unterricht die Vermittlung von Fachkompetenz
(Stoffvermittlung per lehrerzentriertem Unterricht) zu betreiben, so ergeben sich in
Unterrichtseinheiten moderneren Typs mit dem Ziel der Handlungsorientierung komplett neue
Probleme, Wege, aber auch Chancen, die sowohl auf die Lehrkräfte als auch auf die
Schülerinnen und Schüler Einfluss nehmen.
Als ,,Anregung" zur oben beschrieben Beobachtung erachte ich meine eigene Ausbildungszeit
(1991 1993) zum Versicherungskaufmann an der berufsbildenden Schule in Oldenburg. Im
einwöchig stattfindenden Politikunterricht wurde immer ein und dieselbe Unterrichtsmethode
verwendet: der Frontalunterricht. Dieser fand in der Regel in Form von fragend-entwickeln-
dem Unterricht, dem Schüler-Lehrer-Dialog sowie dem Lehrervortrag statt. Beim Lesen von
Fachzeitschriften und Fachbüchern kann sehr schnell festgestellt werden, dass es neben dem
Frontalunterricht noch weitere Unterrichtsmethoden für den politischen Unterricht an
7
kaufmännischen Berufsschulen gibt. Da gibt es exemplarisch die Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit oder aber auch Rollen-, Plan- und Simulationsspiele, um nur einige belebende
Elemente des Unterrichts zu benennen.
Dass politischer Unterricht dem neuen Anforderungsprofil nicht mit althergebrachten
Methoden gerecht werden kann, liegt auf der Hand. Neue Herausforderungen verlangen nach
neuen Methoden. Da eine komplette Unterrichtsplanung ein komplexes Gebilde darstellt,
sollten diese Methoden wiederum nicht ohne die dabei zum Einsatz kommenden Medien
betrachtet werden. Der ,,Hebel" müsste also gleich an zwei Stellen angesetzt werden. Zum
einen auf der Ebene der Methodik, zum anderen auf der Ebene der dabei einzusetzenden
neuen Medien.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik des Implikationszusammenhangs
handlungsorientierter Methoden und ihren kreativen Ausprägungen mit neuen im
Unterrichtsprozess eingesetzten Medien. Ziel dieser Arbeit ist es, die Kombination von
kreativen handlungsorientierten Methoden mit neuen Medien anhand eines Unterrichts-
beispiels darzustellen und den Erfolg auf der motivationalen Ebene der Schüler zu überprüfen.
Um der Zielsetzung nachgehen zu können ist es notwendig, dass verschiedene pädagogische
Methoden und Theorien anhand differierender Quellen reflektiert werden. Berücksichtigt
werden dabei der praxisrelevante Einsatz handlungsorientierter Methoden, die einen kreativen
Ansatz in sich tragen sowie praxisrelevante neue Medien.
Das Kapitel 2 der Arbeit widmet sich der Darstellung der notwendigen theoretischen
Grundlagen, die bei der Konzeption und Gestaltung eines politischen Unterrichts zu beachten
sind. Nach der Erarbeitung allgemeiner Grundlagen der Didaktik wird der Blick auf die
theoretischen Voraussetzungen zur Konstruktion eines politischen Unterrichts gerichtet. Vor
diesen Rahmenbedingungen wird ebenfalls im zweiten Teil ein Blick auf den politischen
Unterricht an der Berufsschule geworfen. Dabei wird von den verschiedenen Berufsschul-
formen abgesehen und lediglich die kaufmännische Teilzeitberufsschule, also die Berufs-
schule, die in der Lernortkooperation mit den Ausbildungsbetrieben arbeitet, betrachtet.
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Berufsschulformen ist diese Eingrenzung in dieser
Arbeit unumgänglich.
Der Gliederungspunkt 2 beschäftigt sich außerdem mit der Didaktik des politischen
Unterrichts und erläutert deren didaktische Prinzipien. Die Ziele für den politischen
8
Unterricht an berufsbildenden Schulen ergeben sich aus den landeseigenen Lehrplänen (hier:
niedersächsischer Lehrplan). Schließlich wird ein Ist-Zustand des Politikunterrichts an der
kaufmännischen Berufsschule aufgezeigt. Dies scheint gerade vor dem Hintergrund der
geringen Bedeutung des Faches Politik von großer Wesentlichkeit und soll den
Handlungsbedarf in diesem Bereich verdeutlichen.
Da der handlungsorientierten Berufsausbildung und damit auch dem politischen Unterricht an
berufsbildenden Schulen eine immer stärkere Bedeutung zukommt, wird durch eine
detailliertere Betrachtung der Handlungsorientierung, die in der pädagogischen Diskussion in
den letzten Jahren zu einem Schlagwort geworden ist, Rechnung getragen. Dennoch kann an
dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass vielfältige Bedeutungsvarianten die
Handlungsorientierung kennzeichnen. Diesem Begriff kann also keine eindeutige Definition
zu Grunde gelegt werden: die jeweils angeführten ,,Zielperspektiven, Begründungszusammen-
hänge und Argumentationslinien sind vielmehr sehr unterschiedlich" (Czycholl, 1988, S. 13).
Der dritte Gliederungspunkt beschäftigt sich mit den möglichen handlungsorientierten und
kreativen Unterrichtsmethoden, die für einen politischen Unterricht an einer kaufmännischen
Berufsschule eingesetzt werden können. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Umfang dieser
Arbeit eine Erarbeitung aller kreativen und handlungsorientierten Unterrichtsmethoden
1
aus
Zeit- und Platzgründen nicht zulässt. Somit werden nur einige mögliche praxisrelevante
Unterrichtsmethoden aufgezeigt, die nach Lehrer- und Schülerorientierung sowie nach dem
Kriterium der Selbststeuerung differenziert werden können. Der Bereich der lehrerorientierten
Unterrichtsmethoden wird exemplarisch durch den Frontalunterricht und dem Team Teaching
dargestellt. Die schülerorientierten Unterrichtsmethoden wiederum werden durch die Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit beschrieben. Stellvertretend für selbstgesteuerte Unterrichtsme-
thoden stehen das Rollen- und das Planspiel. Intensiver wird auf a) die Gruppenarbeit und b)
das Rollenspiel eingegangen, da beide im Unterrichtsbeispiel eine maßgebliche Rolle spielen.
Im vierten Gliederungspunkt wird die Rolle der Medien dargestellt, die an berufsbildenden
Schulen eingesetzt werden können. Der Fokus richtet sich an dieser Stelle auf die neuen
Medien, die in immer stärker werdendem Maße Einzug an den Schulen erhalten. Wie auch bei
der Betrachtung der Methoden werden zunächst die Theorien und die Vermittlung der
entsprechenden Kompetenz aufgezeigt, um dann auf die Vielfalt der Medien einzugehen. Eine
1
Z.B. die Leittextmethode, die Projektmethode, das Szenario oder die Zukunftswerkstatt.
9
wichtige Stellung nimmt dabei das Medium Computer sowie das Internet ein und erfahren
daher eine nähere Betrachtung.
Der fünfte Gliederungspunkt setzt sich mit den Methoden und Medien im Implikations-
zusammenhang auseinander. Er geht auf die Einführung eben dieser in den politischen
Unterricht ein wird und andersrum anhand des Unterrichtsbeispiels dargestellt. An dieser
Stelle sollen die bisher durch die Arbeit erworbenen Kenntnisse Ansätze zu Überlegungen
zum komplementären Einsatz von kreativen handlungsorientierten Unterrichtsmethoden und
neuen Medien im Politikunterricht an der kaufmännischen Berufsschule geben. Auf diese
Weise soll ein Beitrag zur bogenführenden Aufdeckung und Abmilderung der Beweggründe
der Diskrepanz zwischen Unterrichtstheorie und -praxis, also dem tatsächlich existierenden
und dem möglichen Einsatz der kreativen handlungsorientierten Unterrichtsmethoden und
neuen Medien geleistet werden.
In Gliederungspunkt sechs wird das Unterrichtsbeispiel dargestellt. Mit Inhalt der Verteilung
der Ministerien nach der letzten Bundestagswahl als politisches Thema werden exemplarische
handlungsorientierte kreative Methoden in Kombination mit neuen Medien in das
Unterrichtsgeschehen implementiert. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler von der
Lehrkraft begleitet und beobachtet.
Mit einer Zusammenfassung und Schlussbetrachtung rundet der siebte Teil diese Arbeit ab.
Die Ergebnisse meiner Beobachtungen im Unterrichtsbeispiel werden nicht empirisch
aufgearbeitet, sondern es werden lediglich die motivationalen Effekte der eingesetzten
Methoden und Medien auf die Schülerinnen und Schüler dargestellt. Dem Feld der weiteren
Forschung wird somit Rechnung getragen und es öffnet sich Raum für weiterführende
Untersuchungen.
10
2 Theorien und Didaktik in der politischen Bildung
2.1 Allgemeine Theorien der Didaktik
Die Didaktik ist eine Unterdisziplin der Pädagogik und wird von einigen Autoren als deren
Herzstück bezeichnet (www.wikipedia.de, stand 10.03.2005). Der Begriff Didaktik ist aus
dem griechischen Verbum didaskein abgeleitet und bedeutet lehren, unterrichten, klar
auseinander setzen, beweisen. Er ist im antiken Denken nicht auf Pädagogik im schulischen
Sinne beschränkt; vielmehr bezeichnet er auch eine literarische Gattung, die mit dem Begriff
'Lehrgedicht' nur unzureichend beschrieben werden kann. Die Didaktik beschäftigt sich im
engeren Sinne mit der Theorie des Unterrichts. Im weiteren Sinne bezieht sich der Didaktik-
Begriff auf die Theorie und Praxis des Lehrens und des Lernens. Die Didaktik beantwortet
sowohl die Inhaltsfrage (was wird gelernt?) als auch die Frage nach den Methoden. Didaktik
ist nicht nur die Theorie sondern auch die Praxis des Lehrens und Lernens. Die Didaktik
kümmert sich um die Frage, wer, was, wann, mit wem, wo, wie, womit, warum und wozu
lernen soll.
Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841) und seine Schüler verstehen Didaktik als Unterrichts-
lehre. Otto Willmann (1839 - 1920) bezeichnet die Didaktik als Bildungslehre. In der Reform-
pädagogik wird Didaktik zum Programm. Manche Autoren verklären sie sogar zur Lehrkunst.
Der Gebrauch des Begriffes Didaktik wechselt. Aber der Bezug auf Lehre, Lernen und Unter-
richt ist immer gegeben: Didaktik ist immer Lehre, Unterricht, Unterweisung. Der
Bedeutungsumfang des Begriffes Didaktik richtet sich nach dessen Gegenstandsfeld. Im
Anschluss an Wolfgang Klafki und seinen Klassifikationsvorschlag von 1964 hat Gottfried
Hausmann (1969) vier Gegenstandsfelder der Didaktik unterschieden, durch Felix von Cube
ist ein fünftes hinzugekommen. Der Begriffsumfang wird dabei immer enger. Didaktik wird
dabei verstanden als
·
Lehre von allen Formen und Stufen des Lernens,
·
Lehre von allen auf Bildung bezogenen Problemen,
·
Theorie des Unterrichts bzw. als Allgemeine Unterrichtslehre,
·
Lehre von den Bildungsinhalten
·
Theorie der Steuerung und Optimierung von Vermittlungsprozessen.
11
Wilhelm H. Peterszen beschreibt (2001, S. 22 f.) den aktuellen Grundkonsens der
didaktischen Theoriebildung mit folgenden Worten:
"Allgemeine Didaktik beschreibt jene wissenschaftliche Disziplin, deren Gegenstandsfeld das
Lernen schlechthin ist, die aber als integrierende Teildisziplin der Erziehungswissenschaft das
umfassendere gesamte Erziehungsgeschehen perspektivisch im Blick behält. Als Berufswis-
senschaft vor allem von Lehrern erforscht sie ihr Feld mit wissenschaftlichen Mitteln und
entwickelt Theorien des Handelns für die Lösung alltäglicher Lehr- und Lernprobleme. Sie
integriert die maßgeblichen Ergebnisse aller in Frage kommenden Wissenschaften unter dem
Gesichtspunkt ihres Beitrages für die Lösung von Lehr- und Lernproblemen" (ebenda).
Um in einem politischen Unterricht die entsprechende politische Wirklichkeit lehr- und
lernbar zu machen, bedarf es einer didaktischen Analyse. Wenn etwas gelehrt werden soll,
dann muss für diesen Zweck die Wirklichkeit erst einmal konstruiert werden. Das Lehren
einer solchen Wirklichkeit setzt ein Vereinfachen voraus. Nach Giesecke lassen sich solche
Reduktionen nur dann vertreten, wenn sie für ein Weiterlernen offen bleiben (Giesecke, 1997,
S. 5). Einer sich entwickelnden Einseitigkeit könnte so mit einer Methodenvielfalt im
Unterricht begegnet werden.
Didaktische Konstruktionen bewegen sich in einem Spannungsverhältnis. Dieses entsteht
durch die Lehrbarkeit einer Wirklichkeit und ob bei einer bestimmten Zielgruppe die Inhalte
überhaupt lernbar sind. Ob die zu vermittelnde Wirklichkeit sich überhaupt erschließen lässt,
hängt also zum einen von den Bedürfnissen der Lernenden oder von den ,,Ansprüchen der
sachlichen Analyse" (Giesecke, 1997, S. 6) ab. Durch eine didaktische Analyse soll eine
Balance zwischen diesen beiden Polen geschaffen werden.
12
2.2 Didaktische Konstruktion des politischen Unterrichts
Die Politikdidaktik hat die Aufgabe, wissenschaftlich fundierte Antworten auf die Fragen
nach dem "Was", "Wozu", "Warum" und "Wie" des Politikunterrichts zu geben:
·
Was soll gelernt werden: Auswahl der Themen und ihre Strukturierung,
·
Warum und wozu gelernt wird: pädagogische Absichten und deren Begründung und
·
Wie
soll
gelernt
werden:
Methoden,
Medien,
Lernort,
Lernsituation.
(www.dadalos-d.org, Stand 20.04.06)
Historisch betrachtet hat sich in der Politischen Bildung in Deutschland (Deutschland West
nach 1945 und Deutschland Ost nach 1989) das Denkmuster der Mündigkeit durchgesetzt.
Die Lernenden sollen sich hierbei eigenständig mit dem Wirklichkeitsbereich Politik ausein-
andersetzen. Dabei sollen die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung, die sich herausbildenden
politischen Meinungen der Lernenden nicht vorweggenommen werden. Das gleiche gilt für
die Urteile und Überzeugungen, die sich während des Unterrichts dem Einzelnen erschließen
(Sander, 2005, S. 17). Diese Mündigkeit, die die Lernenden erlangen, ist das einzige Denk-
muster, das in einer demokratischen Gesellschaft durchsetzbar ist und damit die einzige
Möglichkeit einer demokratischen Politischen Bildung. Sie setzt die Anerkennung der Frei-
heitsrechte für alle Bürger und Bürgerinnen voraus (Sander, 2005 S. 17). Als ein wünschens-
werter Lernprozess wird hier gesehen, dass die Lernenden ,,in der Beurteilung politischer
Streitfragen zu anderen Ergebnissen kommen als die Lehrenden" (Sander, 2005, S. 17).
Das Denkmuster des mündigen Bürgers wird durch den Beutelsbacher Konsens deutlich
hervorgehoben und bildet somit den Rahmen für die zentralen didaktischen Prinzipien der
Politischen Bildung:
1. ,,Das Überwältigungsverbot: Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen Mitteln auch
immer im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung
eines selbständigen Urteils zu hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen
Politischer Bildung und Indoktrination. Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle
des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und der rundum akzeptierten
Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.
2. Die Ausgewogenheit bzw. Kontroversität: Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist,
muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.
13
3. Die Schülerorientierung: Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische
Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen
zu suchen, die vorgefundene Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. [...]"
(Wehling, H.-G. in Schiele/Schneider, 1977, S. 179 ff).
Hilfreich für die Umsetzung von Politik in einen Unterricht ist es, den Begriff ,,Politik"
zunächst einmal zu definieren, wobei diese Definitionen nur Vereinfachungen darstellen und
das Politische nicht als Ganzes erfassen kann. Sinn dieser Definitionen soll sein, ,,Schneisen
des Verstehens zu schlagen" (Giesecke, 1997, S. 9). Darüber hinaus sollen sie als eine Art
Bindeglied zu den bereits vorhandenen Erfahrungen der Lernenden fungieren. Aus dieser
Sichtweise heraus bieten sich vier Definitionen von Politik an, die zum einen eine Grundlage
didaktischer Konstruktionen darstellen können und zum anderen einen Gegenwarts- und
Zukunftsbezug bei der Lebensplanung der Lernenden beinhalten:
1. Politik als ,,Funktionszusammenhang von Institutionen und deren Regeln und
Beziehungen".
2. Politik als ,,System aufeinander bezogener Handlungen". Diese Handlungen definieren
Probleme des Zusammenlebens und versuchen hierfür geeignete Lösungsansätze
anzubieten.
3. Politik als ,,aktuelles soziales Handeln". Dieses soziale Handeln stellt das Handeln von
politisch aktiven Personen dar, das der Kontroll- und Beurteilungsmöglichkeit der
Wahlberechtigten unterliegt.
4. Politik als ,,interessenbedingtes Miteinander und Gegeneinander von Gruppen".
Widersprüchliche Verhaltensweisen innerhalb dieser Gruppen können sich zu
Konflikten ausweiten und dauerhafte Probleme verursachen.
2.2.1 Bürgerrollen in Demokratie und politischer Bildung
,,Dem dient kein Wind, der keinen Hafen hat, nach dem er segelt" (Seneca)
Das Ziel politischer Bildung besteht laut Darmstädter Appell (1995) in der ,,Befähigung der
Schülerinnen und Schüler zur Wahrnehmung ihrer Bürgerrolle in der Demokratie" (1995, S.
6). Um diese Bürgerrolle genauer zu definieren ist es hilfreich, sich an Leitbildern des
Bürgers zu orientieren. Ein Blick auf die Bürgerrollen in Demokratie und politischer Bildung
14
scheint daher unerlässlich, da diese auch bei den dargestellten Medienkompetenzen eine
gewichtige Rolle spielen.
2.2.1.1 Leitbilder zur Bürgerrolle in der Politikdidaktik
Die soziale und politische Mündigkeit stehen im politischen Unterricht im Vordergrund.
Gerade der Umgang mit Dritten sowie das selbstständige Denken und Handeln in politischen
Sachverhalten sollen die Schülerinnen und Schüler erlernen. Dabei erfordert die Struktur des
Politischen nicht nur fachliches Knowhow, sondern insbesondere ein Kompetenzenrepertoire.
Die Beherrschung dieser Kompetenzen sowie das Verstehen von im politischen Unterricht zu
vermittelnden Werten sind richtungsweisend für die spätere ,,Übernahme der Bürgerrolle in
der Demokratie" (Breit/Weißeno, 2003, S. 51):
1. Der Bürger als reflektierter Zuschauer
Nach Hennis (1957) handelt es sich hierbei um einen Bürger als ,,Zuschauer, der weiß,
worum es geht" (Hennis, 1957, S. 333) und spricht dabei ,,vom einfachen Menschen und
seinem Verhältnis zur Politik
2
" (ebenda).
Nach Giesecke soll der Bürger als ,,Normalbürger"
3
betrachtet werden und die Politikdi-
daktik auf eben diese Zielgruppe zugeschnitten werden (Giesecke, 1965, S. 175).
2. Der aktive Bürger
Durch sein Buch ,,Student und Politik" und der daraus folgenden studentischen Protest-
bewegung, sorgte Jürgen Habermas für einen Wechsel der Betrachtung des Bürgers als
,,Objekt der Demokratie" (Giesecke, 1972, S. 43) hin zum ,,Subjekt" (ebenda). Zum
obersten Lernziel wird hierbei die Mitbestimmung, abgeleitet aus dem Grundgesetz.
Durch politische Bildung, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten sollen die Bürger
lernen, Mitbestimmung in politischen Handlungssituationen bestmöglich durchzusetzen
(Breit/Schiele, 1998, S. 15).
2 Gleichzeitig stellt Hennis die Forderung auf, dass der reflektierte Zuschauer wenigstens soviel über das Wesen des
Politischen erkennt, um diese einigermaßen beurteilen zu können. Hennis sieht dabei als Aufgabe der Lehrkraft an, dass
diese in der Schule zur Erziehung einer ,,rechten Reaktion" statt zur ,,rechten Aktion" führen soll.
3
Als ,,Normalbürger betrachtet Giesecke denjenigen Bürger, der ,,weder Sozialwissenschaftler ist" und auch die Politik nicht
,,zum Hauptberuf" wählt (ebenda).
15
3. Der Bürger als Interessenvertreter
In Anlehnung an den Beutelsbacher Konsens soll die Schülerin oder der Schüler in die
Lage versetzt werden, ,,eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu
analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene Lage im Sinne
seiner Interessen zu beeinflussen" (s. Punkt 2.1, Beutelsbacher Konsens`), so dass von
einem Leitbild eines Bürgers als Interessenvertreter gesprochen werden kann. Dieses
Interessenmuster erweist sich vor dem Hintergrund der pluralistischen Demokratie als
praktikables Instrument der Politikdidaktik und bewährt sich noch heute bei der
Rekonstruktion der politischen Wirklichkeit in Unterrichtsentwürfen (Breit/Schiele, 1998,
S. 16).
4. Der Weltbürger
Mit Blick auf die sich immer stärker verbreitende Globalisierung und der damit
einhergehenden internationalen Verflechtung verliert sich der Gedanke den Bürger als
Bürger eines Nationalstaats zu betrachten immer mehr. Während der Europäische Rat die
,,Herausbildung eines aufgeklärten europäischen Nationalbewusstseins" einfordert,
sprechen die Maastrichter Verträge sogar vom ,,Unionsbürger" und proklamieren den
europäischen Bürger (Ungerer, 1996, S. 129). Auch der immer größer werdende Einfluss
sogenannter Nichtregierungsorganisationen (NGO) ist als Indiz zusehen, dass der
Weltbürger auf internationale Entscheidungsprozesse in immer stärkerem Maße Einfluss
nimmt. Dieser Bürger in einer sich entgrenzenden Welt stellt eine besondere
Herausforderung an die politische Bildung dar (Breit/Schiele, 1998, S. 18).
5. Der interventionsfähige Bürger
Unter politischer Interventionsfähigkeit versteht Meyer (1996) die ,,doppelte Kompetenz
des Urteils, wann die eigene Einmischung ins politische Geschehen nötig wird und wo
und wie sie wirksam werden" (Meyer, 1996, S. 263) kann. Breit/Schiele sehen ein schwer
lösbares Spannungsfeld im ,,Zeitalter komplexer Interdependenz" und ,,die Effektivität der
politischen Problemlösungen und die demokratische Legitimation durch den Bürger"
(1998, S. 18). Diese Interventionsmöglichkeiten sind in den letzten Jahren auf allen
Ebenen erweitert und verstärkt worden und stehen für ein lernfähiges politisches System.
16
2.2.1.2 Die Bürgerrollen im handlungsorientierten Politikunterricht
Als eine der Hauptproblematiken der Politischen Bildung und damit auch bei der Planung und
Umsetzung eines handlungsorientierten Unterrichts ist in der ständig wachsenden Differenz
zwischen der eigentlichen Realität der Bürger (Lebenswelt) und der Systemwelt der Politik zu
sehen. Tatsächlich sind diese auf den ersten Blick so unterschiedlichen Welten jedoch eng
miteinander verknüpft und stehen in einem ,,dynamischen Austausch- und Wechselverhältnis"
(Breit/Schiele, 1998, S. 28). Eine Entfremdung vom heutigen politischen System ist eine
nahezu permanent zu beobachtende Diskussion in den Medien. Die Folge daraus ist eine sich
von der Politik abwendende Bürgerschaft, an die nur noch schwer heranzukommen ist.
Bei der Entwicklung einer politischen Handlungsfähigkeit in der Politischen Bildung sollen
,,den angehenden Bürgern ihre gegenwärtigen und zukünftigen Rollen in den verschiedenen
Handlungszusammenhängen und Handlungsebenen der Politik durchsichtig und verfügbar"
(Breit/Schiele, 1998, S. 26) gemacht werden. Ein bestimmtes Bürgerbild zu vermitteln, würde
dem Beutelsbacher Konsens widersprechen. Damit diese politische Handlungsfähigkeit
erreicht werden kann ist es notwendig, bestimmte bürgerschaftliche Kompetenzen zu
erlangen, die als Ziel bestimmte Verhaltensdispositionen im Sinne von Persönlichkeitsmerk-
malen aufweisen. Klippert (1991) unterscheidet dabei in folgende Kompetenzen:
·
Inhaltlich-fachliche,
·
Handlungsstrategische,
·
Sozialkommunikative Kompetenz (Klippert, 1991, S. 16)
Jank/Meyer bezeichnen die Handlungsfähigkeit in Verhaltensdispositionen als die Fähigkeit,
,,Gelerntes auch in nicht eindeutig voraussehbaren Situationen sinngemäß richtig zu beherr-
schen" (Jank/Meyer, 1991, S. 302). Erst zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisierende
Handlungsdispositionen stellen somit den Kern des handlungsorientierten Unterrichts dar. Ein
handlungsorientierter Unterricht sollte den Anspruch erheben, Politik aus der Hand-
lungsperspektive zu vermitteln. Ein solcher Unterricht verlangt allerdings, dass die Schü-
lerinnen und Schüler selbst Verantwortung für ihr Lernen übernehmen müssen. In ihm wird
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten wird, einen Zugang zur politischen
Realität zu erhalten, indem sie Politik selbstständig erfahren und sogar in politische Verant-
wortungsrollen schlüpfen können. So wird der handlungsorientierte Unterricht zum Spielfeld
und der Klassenraum zur Bühne, auf der die unterschiedlichsten Spielsituationen durch-
17
gespielt werden können. Das alleinige Nachspielen von vorgegebenen Spielsituationen würde
dem Gedanken der Handlungsorientierung aber noch keine Rechnung tragen. Daher müssen
die Schülerinnen und Schüler durch das selbstständige Entwickeln neuer Spielzüge, Strategien
oder Handlungsmodellen zum Gelingen eines handlungsorientierten Unterrichts beitragen.
Am Anfang eines handlungsorientierten Unterrichts muss ein kognitiver, komplexer Pla-
nungsprozess stehen (Jank/Meyer, 1991, S. 375). Ferner müssen die Schülerinnen und Schüler
ihre Handlungsebenen kennen. Nur wenn den Schülern und Schülerinnen ,,die politische und
ethische Problemhaftigkeit einer Handlungssituation deutlich ist," (Breit/Schiele, 1998, S. 31)
können ihre Handlungen im Unterricht sinnvoll werden. Darüber hinaus muss den Schülern
und Schülerinnen deutlich gemacht werden, dass in einem handlungsorientierten Unterricht
die ,,Komplexität, Abstraktheit und Interdependenz politischer Handlungssysteme" (ebenda)
in stark reduzierter Form dargestellt werden. Ebenso wichtig ist das Bewusstmachen, dass
zeitliche Perspektiven stark verzerrt simuliert werden. Entscheidungen, die in einer oder weni-
gen Unterrichtsstunden gefällt werden, benötigen in der politischen Realität mitunter Jahre.
Durch die Darstellung des demokratischen Systems aus der Perspektive der Schülerinnen und
Schüler oder der Handlung als solche, lassen sich Bürgerrollen in der Demokratie über
Handlungspositionen besonders gut darstellen und bieten somit eine gute Möglichkeit zur
Vorbereitung auf politische Interventionsfähigkeit der Lernenden.
2.2.2 Didaktische Prinzipien politischer Bildung
Didaktische Prinzipien helfen bei der Auswahl und Strukturierung dessen, was im Unterricht
oder in Seminaren behandelt wird. Damit machen sie das komplexe und schwer eingrenzbare
Feld der Politik lernbar. Insofern sind sie von überragender Bedeutung bei der Planung und
Durchführung von Politikunterricht. Sie dienen als Werkzeuge zur Konstruktion und der
didaktischen Strukturierung politischer Themen für Lerngegenstände und bündeln somit
,,didaktisches Wissen für Zwecke der Planung von Lernangeboten" (Sander, 2002, S. 29). Sie
helfen dabei, den Politikunterricht vorzubereiten und durchzuführen und leiten einen
Auswahlprozess ein. In diesem werden aus der komplexen Fülle politischer Sachverhalte
gezielt und begründet einzelne Themen für den Unterricht oder für Seminare ausgewählt und
strukturiert. Sie spielen eine maßgebliche Rolle bei allen vier Schritten der Unterrichts-
vorbereitung. Allgemein ist zu beachten, dass sich die didaktischen Prinzipien überlappen und
18
ergänzen; sie hängen eng miteinander zusammen. Je nach Themenstellung und Adressaten
stehen andere Prinzipien im Vordergrund. Keine Unterrichtseinheit wird allen didaktischen
Prinzipien gerecht werden können.
Eine herausgehobene Stellung haben die beiden ersten Grundsätze des Beutelsbacher
Konsenses (s. Punkt 3), da sie immer Beachtung finden müssen, unabhängig von der
Thematik. Politische Bildung, die gegen das Überwältigungsverbot oder das Prinzip der
Kontroversität verstößt, ist nicht professionell. Weitere wichtige Prinzipien sind:
·
Adressatenorientierung (auch: Schülerorientierung): sie betreibt eine Bedingungsana-
lyse im Vorfeld einer Unterrichtseinheit und zielt auf das Vorwissen der Schülerinnen
und Schüler, der potenziellen Adressaten, ab (Tietgens (1980, S. 201 ff).
·
Problemorientierung: sie verweist auf drei Bereiche des politischen Lernens (Gagel,
1988, S. 39 ff):
1. Förderung des problemlösenden Denkens in der Politischen Bildung.
2. Mit dem Ziel der Handlungsorientierung werden politische Prozesse und Struktur-
zusammenhänge von Lernenden untersucht und nach ihren Inhalten beurteilt.
3. Es sollen solche Inhalte ausgewählt und im Unterricht vermittelt werden, die als
sogenannte Schlüsselprobleme einen Gegenwarts- und Zukunftsbezug haben sowie für
die Lernenden lebensbedeutsam sind und zum aktiven Handeln verleiten.
·
Exemplarisches Lernen (Grammes, 2005, S. 93): durch eine Induktion wird ein Bei-
trag zur Allgemeinbildung betrieben. Aufgrund der explosiven Ausweitung des
Wissens in der heutigen Postmoderne in quantitativer wie qualitativer Weise, gewinnt
das exemplarische Lernen immer stärker an Bedeutung. Insbesondere gilt dies im Hin-
blick auf die kaum noch zu überschauende Daten (Informations-)menge des Internets.
·
Kontroversprinzip: das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft steht in
einem Spannungsverhältnis zwischen Führen und Wachsenlassen. Im Hinblick auf das
Kontroversprinzip lassen sich somit zwei Grundausrichtungen politischer Bildung
diversifizieren:
1. Staatsbürgererziehung: Sozialerziehung gegenüber Staat, Nation und Gemein-
schaft mit dem Ziel des loyalen Bürgers oder Erziehung zum Nationalsozialismus
mit dem Ziel der unreflektierten Gefolgschaft.
2. Menschenbildung: Erziehung zur Demokratie als Lebensform mit Blick auf die
Gesellschaft und der Betonung der grundsätzlichen Gleichstellung aller Staats-
bürger.
19
·
Wissenschaftsorientierung: sämtliche Bildungsgegenstände aller Fächer sollen auf-
grund ihrer ,,Bedingtheit und Bestimmtheit durch die Wissenschaft erkannt und ver-
mittelt werden" (Gagel, 2005, S. 156). Dieser Ansatz trägt zugleich der Forderung des
Deutschen Bildungsrates und seinem ,,Strukturplan für das Bildungswesen" (1972, S.
33) Rechnung. Hierbei wird wissenschaftliches Wissen in Alltagswissen umgewandelt
und somit ein Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Lebenspraxis hergestellt.
·
Aktualität/Anschaulichkeit: Politische Bildung soll nach Möglichkeit aktuelle Pro-
bleme und Lösungsvorschläge aufgreifen. Die Lehrinhalte sollen möglichst wenig ab-
strakt, sondern anschaulich und einprägsam vermittelt werden. Zusammen mit
Auswahlkriterien wie Betroffenheit und Bedeutsamkeit der Thematik kann dadurch
eine Steigerung der Motivation seitens der Schülerinnen oder Schülerinnen und
Schüler erreicht werden.
20
2.2.3 Ziele politischer Bildung
Die Politische Bildung hat als Bezugsrahmen immer die vorherrschende Staatsform des
jeweiligen Landes in der sie gelehrt wird. Bezogen auf unsere westliche Welt führt dies zum
Demokratielernen. Damit bildet die ,,freiheitlich demokratische Grundorientierung die Legiti-
mationsgrundlage für die Politische Bildung" (Ammon, 1977, S. 146). In demokratischen
Gesellschaften ist es das Ziel der politischen Bildung, systematisch die Kenntnisse über das
demokratische System zu vermitteln, um den Bürger zu autonomen und mündigen
Staatsbürgern zu erziehen.
Als Ziele der Politischen Bildung können die Vermittlung und Stärkung von Toleranz und
Kritikfähigkeit, das Verankern demokratischer Spielregeln und damit Beitragen zur ,,Heraus-
bildung und Weiterentwicklung von aktiver Bürgerschaft und Partizipation" genannt werden
(www.wikipedia.de, Stand: 01.05.2006). Gemäß BpB ist ein fundamentales Lernziel des
Politikunterrichts, ,,bei Schülerinnen und Schülern Verständnis für Politik zu wecken und
Einsichten in politische Zusammenhänge zu ermöglichen" (BpB, 1994, S. 17). Klafki (1993)
bezeichnet politische Bildung ,,als Kern eines zeitgemäßen Verständnisses von Allgemeinbil-
dung", dessen Aufgabe es ist, ,,die Lernenden in sachkompetenter Weise mit den wichtigsten
Problemen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Gegenwart und der absehbaren
Zukunft so zu konfrontieren, dass die Fähigkeit zu selbstständiger, rationaler Urteilsbildung
entwickelt, politische Handlungskompetenz vermittelt und so die politische Mündigkeit der
Lernenden gefördert wird" (Klafki, 1993, S4).
Einen breiten Konsens über die Ziele politischer Bildung erreichte die Fachdidaktik der
politischen Bildung mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für nationale Bildungsstandards für
den Politikunterricht in der Schule im Jahr 2004 (GPJE, 2004). Hier werden die Ziele des
Faches in drei Kompetenzbereichen definiert: politische Urteilsfähigkeit, politische Hand-
lungsfähigkeit und methodische Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten werden nach konkreten
Kompetenzbeschreibungen für alle Schulstufen differenziert und sollen insgesamt die
politische Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern. Die folgende Tabelle gibt einen
Überblick über die Inhalte der Kompetenzbereiche: das konzeptuelle Deutungswissen.
21
Politische Urteilsfähigkeit
Politische Ereignisse, Probleme und Kontro-
versen sowie Fragen der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung unter Sach-
aspekten und Wertaspekten analysieren und
reflektiert beurteilen können.
Politische Handlungsfähigkeit
Meinungen, Überzeugungen und Interessen
formulieren, vor anderen angemessen vertre-
ten. Aushandlungsprozesse führen und Kom-
promisse schließen können.
Methodische Fähigkeiten
Sich selbstständig zur aktuellen Politik sowie zu wirtschaftlichen, rechtlichen und gesell-
schaftlichen Fragen orientieren, fachliche Themen mit unterschiedlichen Methoden bearbeiten
und das eigene politische Weiterlernen organisieren können.
Tabelle 1: Konzeptuelles Deutungswissen (GPJE, 2004, S. 13)
,,Vor dem Hintergrund der Globalisierung und dem damit einhergehenden technischen
Fortschritt, dem sich immer stärker ausprägenden Individualismus und Egoismus sowie der
gesellschaftlichen Entsolidarisierung, muss weiter an der Einheit Deutschlands gearbeitet
werden" (Münchner Manifest, 1997). Der politischen Bildung wird angesichts dieser
gegenläufigen Tendenzen große Bedeutung beigemessen
4
.
Zusammenfassen lassen sich die Ziele der Politischen Bildung mit einer Definition angelehnt
an Wolfgang Mickel (1998). Mickel sieht politische Bildung als ,,Sammelbegriff für ein
schulisches oder außerschulisches, institutionalisiertes oder freies, [...] verbales oder non-ver-
bales, interaktionales Einwirken auf den Menschen, um politisches Verhalten, Handlungs-
bereitschaft und -kompetenz, demokratische Spielregeln und Grundwerte, Problem-
bewusstsein und Urteilsfähigkeit usw. zu vermitteln" (Mickel, 1998, S. 561ff.). Durch seine
herausgehobene Stellung sowie dem im Unterrichtsbeispiel angewandten didaktischen Prinzip
der Handlungsorientierung, wird im nächsten Gliederungspunkt detaillierter auf sie
eingegangen.
4
Forderungen des Münchner Manifestes:
1. Politische Bildung im öffentlichen Auftrag arbeitet pluralistisch, überparteilich und unabhängig.
2. Die Zentralen für Politische Bildung fördern die politische Partizipation der Bürgerinnen und Bürger.
3. Die Zentralen für Politische Bildung bereiten auf die globalen Zukunftsaufgaben vor.
4. Die Zentralen für Politische Bildung arbeiten für die Stabilität der Demokratie auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
5. In den ostdeutschen Bundesländern hat die Politische Bildung besondere Aufgaben.
6. Die kritische Aufarbeitung der deutschen Geschichte ist eine zentrale Aufgabe der Politischen Bildung.
7. Die Politische Bildung verfügt über vielfältige Methoden und Arbeitsweisen (www.wikipedia.de, Stand 11.05.06).
22
2.3 Handlungsorientierung als didaktisches Prinzip politischer Bildung
Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln;
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.
Konfuzius (551 - 479 v. Chr.), chinesischer Philosoph
Politische Bildung soll zum einen selbsttätiges Lernen als nachhaltige Form der Wissens-
vermittlung erlauben und fördern (z.B. durch entsprechende Methoden wie Projektarbeit).
Zweitens geht es aber auch um das Einüben grundlegender Demokratie-Kompetenzen, also
eines persönlichen Handlungsrepertoires für die politische Auseinandersetzung und
Meinungsbildung (z.B. durch Einüben von Schlüsselqualifikationen wie Diskutieren oder
Präsentieren). Diese Kompetenzen werden mit handlungsorientierten Methoden wie z.B.
Planspiel, Diskussionsrunde oder Rollenspiel eingeübt.
Handlungskompetenz gilt heute unbestritten als Leitziel der Bildungsgänge in berufsbil-
denden Schulen, und auch in Veröffentlichungen zur betrieblichen Aus- und Weiterbildung
wird der Kompetenzbegriff zunehmend als Zielkategorie übernommen. Mit dem Leitziel
Handlungskompetenz korrespondiert in der Didaktik die Konzeption handlungsorientierter
Ausbildung bzw. handlungsorientierter Unterricht. Zu Grunde liegt die Hypothese, dass
Handlungskompetenz durch solche Lehr-Lern-Arrangements besonders gefördert werden
kann, in denen die Lernprozesse sich an Handlungen orientieren.
2.3.1 Begriffsbestimmung
Die oben erläuterten Anführungen lassen darauf schließen, dass Missverständnisse und
Fehlinterpretationen in der Interpretation der Handlungsorientierung eher die Regel sind.
Diese Probleme mit der Definition sieht auch Schiele (1998) sowohl bei Gegnern als auch bei
Befürwortern von Handlungsorientierung (Schiele, 1998, S.2). Angelehnt an Becker (1991)
zielt Handlungsorientierung auf die Fähigkeit ab, zukünftige politische Situationen aus den
Handlungsfeldern der RRL bewusst, zielgerichtet und verantwortlich bewältigen zu können.
Dieses Ziel ist im Sinne der Lernpsychologie nur durch aktives Handeln der Lernenden über
planen, durchführen und auswerten (Modell der vollständigen Handlung) zu erreichen.
23
Daraus können Kombinationsmöglichkeiten von Lehr-Lern-Handlungen, Lehr-Lern-
Situationen und Situationsfolgen abgeleitet werden. Der Lehrer steht immer wieder vor der
Aufgabe, Situationsfolgen sinnvoll aufeinander zu beziehen.
Um diesen Begriff möglichst transparent zu machen, ordnete Gudjons der Handlungsorien-
tierung aus didaktisch-methodischer Sicht folgende Merkmale zu:
·
Handlungsorientierung verzichtet auf inhaltliche Vollständigkeit des Themenkanons;
·
sie richtet sich am exemplarischen Lernen aus;
·
prozesshafte Gestaltung des zu erforschenden Problems;
·
kreiert ggf. Auszüge aus der Realität nach, in denen entdeckend gelernt werden soll;
·
räumt einen gewissen Spielraum oder Offenheit ein in Bezug auf die Ziele, Inhalte,
Methoden und Lernkontrollverfahren;
·
setzt einen besonderen Fokus auf die Schülerinteressen und -erfahrungen;
·
schafft Raum für einen individuellen Lernprozess, denn ,,Lernen im Gleichschritt"
(ebenda) findet hier keine Realisierung;
·
schafft Raum für sinnlich-unmittelbares Handeln, in dem Kopf- und Handarbeit
verbunden werden können;
·
fordert von den Lernenden in Planung, Durchführung und Auswertung ein hohes Maß
an Selbststeuerung;
·
Gewinn an Verantwortung für die Schüler;
·
und ist schließlich zielorientiert, wobei die Verständigung über das Ziel im Mittel-
punkt des Unterrichts steht (Gudjons, 1992, S.59).
Hilbert Meyer (1992) formuliert per Definition den Aspekt der Ganzheitlichkeit indem er
sagt: ,,Handlungsorientierung ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die
zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des
Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes
Verhältnis zueinander gebracht werden können." (Meyer 1992, S.500)
Es wird deutlich, dass einer kurzen und klaren Definition nicht Rechnung getragen werden
kann. Zwar haben alle Definitionen eine ähnliche Richtung (ganzheitlich, offen, schüleraktiv),
doch variieren sie in ihren Formulierungen.
24
2.3.2 Probleme bei der Umsetzung und Realisierungskriterien
Handlungsorientierung kann als allgemeindidaktisches Prinzip angesehen werden (Massing,
1998, S.148). Schwieriger ist es jedoch, den Begriff Handlungsorientierung zu bestimmen
oder zu präzisieren, wenn er aus politikdidaktischer Sicht betrachtet wird bzw. als fachdidak-
tisches Prinzip verstanden wird. Die Problematik bezüglich einer effektiven Umsetzung von
Handlungsorientzierung im Politikunterricht beantwortet Massing auf drei Ebenen: auf der
Ebene der Ziele und Inhalte, der Lehr- und Lernbedingungen und der Organisation des
Lernprozesses.
1. Die Ziele für die politische Bildung, die durch handlungsorientierten Unterricht erreicht
werden können, fasst Massing unter dem Begriff ,,Politikbewusstsein" (Massing, 1998,
S.149) zusammen. Dieser Begriff beinhaltet eine Reihe Teilziele wie die Förderung der
,,Fähigkeit zur kognitiven Orientierung in Politik und Gesellschaft" (ebenda); von
politischem und gesellschaftlichem Interesse; eines gesellschaftlich-politischen Problem-
bewusstseins und einer Problemsensibilität bei den Lernenden; einer ,,Einsicht in die
Komplexität und die Zusammenhänge genereller politischer Regelungen" (ebenda) und
schließlich einer generellen Bereitschaft zur politischen und gesellschaftlichen Partizi-
pation (ebenda). Diese Ziele können dann als erreicht angesehen werden, wenn sie sich in
den Einstellungen und im Verhalten der Heranwachsenden zeigen
5
.
2. Auch auf der Ebene der Lehr- und Lernbedingungen kann so argumentiert werden wie
dies bereits Klippert mit seiner Darstellung der ,,kompensatorischen Wirkung von Hand-
lungsorientierung durch Primärerfahrungen" (1988, S.81) und Gudjons, der handlungs-
orientierten Unterricht auf drei Ebenen begründet sieht und dabei u. a. das ,,lernpsycho-
logische Argument des zumeist anschaulichpraktischen Lernertyp" (1992, S.58f) anführt
taten. Bei der Organisation des Lernprozesses wird die Frage nach der Wahl der
Unterrichtsmethoden gestellt. Diese Wahl soll nicht einfach willkürlich geschehen, denn
die ,,Aufgabe von Unterrichtsmethoden ist es, die optimalen Bedingungen für die
Begegnung von Lernenden und Sache herzustellen" (Massing, 1998, S. 151). Ebenso
werden durch Festlegung auf eine bestimmte Methode vom Lehrenden inhaltliche
Schwerpunkte gesetzt und das Thema durchstrukturiert (vgl. Massing 1998, S.148-152).
5
Demnach ist Handlungsorientierung als ,,prinzipielle Fähigkeit zum Handeln"; ,,Element von Politikbewusstsein" sowie als
ein ,,wesentlicher Aspekt der Zieldimension von Politikunterricht" (Massing, 1998, S.145) zu verstehen.
25
Hilbert Meyer (1992) sieht als Kriterien für die Realisierung handlungsorientierten
Unterrichts:
1. ,,Im Handlungsorientierten Unterricht sollen die ,,subjektiven Schülerinteressen" zum
Bezugspunkt der Unterrichtsarbeit gemacht werden.
2. Im Handlungsorientierten Unterricht sollen die Schüler zum ,,selbständigen Handeln"
ermuntert werden.
3. Durch die Handlungsorientierung des Unterrichts soll die ,,Öffnung der Schule"
gegenüber ihrem Umfeld vorangetrieben werden.
4. ,,Kopf- und Handarbeit, Denken und Handeln" sollen in ein ausgewogenes Verhältnis
zueinander gebracht werden. " (Meyer, 1992, S.509)
2.3.3 Chancen und Grenzen
Nach Breit (1998) lässt sich handlungsorientierter Unterricht wie folgt beschreiben: er
·
erzeugt Erwartungen bei den Lehrenden bezüglich qualitativer Schüleraktivität;
·
bereitet den Lernenden Freude am Lernen;
·
lässt die Schülerinnen und Schüler ihre Passivität überwinden;
·
fördert ihre Methodenkompetenz und
·
schult sie zudem in ihrer demokratischen Bürgerrolle (Breit 1998, S.115-118).
Darüber hinaus kann Handlungsorientierung bewirken, dass
·
sich Lernende mit dem Unterricht besser identifizieren können
·
und somit gleichsam effektiver und nachhaltiger lernen;
·
sich durch die Verständigung zwischen Lernern und Lehrenden eine organisatorische
Kraft bezüglich der Unterrichtsgestaltung entwickelt
·
und ,,produktive und unproduktive Nebentätigkeiten in konstruktive Bahnen gelenkt
werden" (Meyer 1992, S.507).
Ferner existieren eine Reihe von Einwänden bezüglich der unterrichtspraktischen Umsetzung
dieses didaktischen Prinzips. So sieht Breit die ,,Grenzen von Handlungsorientierung" (Breit,
1998, S.119-123) u.a. in folgenden Aspekten
6
:
6
Auch Meyer sieht neben den unbestritten vorhandenen Chancen auch Gefahren in der Handlungsorientierung: so erfordert
der Unterricht sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden einen enormen persönlichen Einsatz. Ungünstige
institutionelle und curriculare Voraussetzungen bilden einen weitern Punkt, die dem handlungsorientierten Unterricht
entgegen wirken (Meyer, 1992, S. 508ff.).
26
1. Politik als ein ungeeigneter Gegenstand zum Handeln im Unterricht. Das reale Handeln
findet im Unterricht nur wenig Anwendung. Beim simulativen Handeln besteht die Gefahr der
zu großen Reduktion der Wirklichkeit.
2. Handlungsorientierung soll dem selbstständigen politischen Denken entgegen wirken. An
Stelle einer kritischen Analyse und Beurteilung über politische Sachverhalte, rückt das
Handeln in den Vordergrund.
3. Problematik der geringen Reflexion handlungsorientierten Unterrichts durch ein hohe Maß
an ,,Begeisterung und Schwung" (Breit, 1998, S. 122): Durch gemeinsames Handeln kann ein
Gruppendruck entstehen, der einer gleichberechtigten Kommunikation widersprechen kann.
Diese Grenzen sollen verdeutlichen, dass ein kritischer Umgang mit der Handlungs-
orientierung mehr als angemessen erscheint.
2.3.4 Handlungsorientierung im Politikunterricht
Neue Impulse gehen von den ,,Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen
der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre
Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe" aus,
welche die KMK am 9. Mai 1996 vereinbart hat. Sie bilden die Arbeitsgrundlage für die
Kommissionen, die auf Bundesebene neue Rahmenlehrpläne entwickeln.
Die Handreichungen benennen ,,Handlungskompetenz" in den Dimensionen ,,Fachkompe-
tenz, Humankompetenz (Personalkompetenz) und Sozialkompetenz" als Leitziel der Berufs-
schule (RRL, S. 15), sie empfehlen die didaktische Ausrichtung des Unterrichts an der
,,Handlungsorientierung" und geben Orientierungspunkte für die Gestaltung handlungs-
orientierten Unterrichts an (RRL, S. 17 ff.). Dieses grundlegende Konzept wird curricular
gestützt durch die Ausdifferenzierung der anzustrebenden Handlungskompetenz und die
Strukturierung der Lerninhalte in der Form von Lernfeldern". Die ,,Lernfelder sind durch
Zielformulierungen beschriebene thematische Einheiten. Sie sollen sich an konkreten
beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren." (RRL, S. 22) Nach dem
Lernfeld-Konzept werden Ziel- und Inhaltsfestlegungen relativ allgemein und offen gehalten,
hierdurch erhalten die Kollegien an den Schulen Freiräume, die sie in eigener Zuständigkeit
ausgestalten sollen.
27
Im Gegensatz zum konventionellen Politikunterricht ist die Handlungsorientierung nicht
handlungsarm (Klippert, 1991, S. 9). Um eine konkrete Vorstellung von Handlungsorien-
tierung zu bekommen, bietet sich eine Tabelle nach Klippert (1991, S. 13) an:
Reales Handeln
Simulatives Handeln
Produktives Handeln
Erkundungen, Praktika,
Expertenbefragungen,
Straßeninterviews,
Projektinitiativen,
Fall- bzw. Sozialstudien,
Schulsprecherwahl,
Schülerzeitung,
Partizipation im Unterricht.
Rollenspiele,
Planspiele,
Entscheidungsspiele,
Konferenzspiele,
Pro-und-Kontra-Debatte,
Hearing,
Tribunal,
Zukunftswerkstatt.
Tabelle, Schaubild, Tafelbild,
Flugblatt, Plakate, Wandzeitung,
Reportage, Hörspiel, Diareihe,
Referat, Wochen- bzw. Monats-
berichte, Ausstellung, Fotodoku-
mentation, Rätsel, Quiz, Lern-
spiele, Fertigstellen von Arbeits-
blättern.
Methodentraining mit Schülern
Tabelle 2: Handlungsorientierung (Klippert, 1991, S. 13).
Wie in der Tabelle deutlich sichtbar, lassen sich drei Gruppen von Verfahren der Handlungs-
orientierung unterscheiden:
1. Reales Handeln: behandelt ,,die außerschulische Realität und die innerschulische reale
Realität" (Reinhardt, 2005, S. 146).
2. Simulatives Handeln: über ,,Als-OB-Handeln" wird die außerschulische Realität in
den Unterricht geholt (ebenda).
3. Produktives Gestalten: Umsetzung des erworbenen Wissens in ,,aktive Aufgaben-
stellungen" (ebenda).
28
2.4 Politischer Unterricht an berufsbildenden Schulen
Bis heute liegen keine aktuellen empirischen Befunde über die Stellung der politischen
Bildung im berufsbildenden Schulwesen und fortschrittlichen Lehrplananalysen vor.
Permanente ökonomisch-technische Modernisierungserfordernisse und damit einhergehende
aufwendige Aneignungsprozesse erfordern ein hohes Engagement auf Seiten des
Lehrpersonals. Die Folge daraus ist ein eher stiefmütterliches Behandeln der politischen
Bildung speziell in den berufsbildenden Schulen (Jung, 2005, S. 233).
Das Ziel des Berufsbildungssystems ist die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenz und
leistet ferner einen ,,Beitrag zur technisch-ökonomischen Modernisierung" (Jung, 2005, S.
221). Im Rahmen der beruflichen Bildung werden Inhalte und Verfahrensweisen vermittelt,
die im ,,unmittelbaren Zusammenhang mit dem erreichten Niveau an Erkenntnissen,
Technologien, Werkzeugen und Verfahrensweisen" (ebenda) stehen und aus den Stand einer
sich entwickelnden Gesellschaft widerspiegeln. Dies gilt auch für die Art und Weise der
Vermittlung. Einhergehend mit dem ökonomisch-technischen Wandel der unsere Gesellschaft
prägt verlangen ,,dynamische Veränderungen in Arbeitsverrichtung und Arbeitsorganisation"
(ebenda) nach neuen Qualifikationsprofilen und damit der ,,Befähigung zum lebenslangen
Lernen" (Jung, 2005, S. 221).
Politikdidaktische Ziele wie die Kommunikations-, Kritikfähig- und Teamfähigkeit wurden
auf die berufs- und wirtschaftspädagogischen Gegenstandsbereiche übernommen, so dass im
Rahmen der Schlüsselqualifikationsdebatte die Schlüsselqualifikationen ,,Gestaltungskompe-
tenz, Umweltverantwortung, Partizipationsfähigkeit, Informationsverarbeitung, Friedens-
fähigkeit und Risikobewusstsein" (Jung, 2005, S. 234) heute noch als aktuell betrachtet
werden können.
Die berufsbildenden Schulen bieten die wohl zeitlich letzte geplante Möglichkeit einer
Bildungsveranstaltung zur ,,Vermittlung gesellschaftlicher und politischer Gegenstands-
bereiche," (Jung, 2005, S. 236) ehe die Schülerinnen und Schüler ,,in eine immer unübersicht-
lichere, von immer mehr Informationen durchfluteten und durch immer härtere ökonomisch-
technische Sachzwänge geprägte Arbeits- und Lebenswelt entlassen werden" (ebenda).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832498979
- ISBN (Paperback)
- 9783838698977
- DOI
- 10.3239/9783832498979
- Dateigröße
- 942 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Sozialwissenschaften, Lehramt an Berufsbildenden Schulen
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Oktober)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- unterrichtsentwurf implikationszusammenhang bundestagswahl methodeneinsatz medieneinsatz
- Produktsicherheit
- Diplom.de