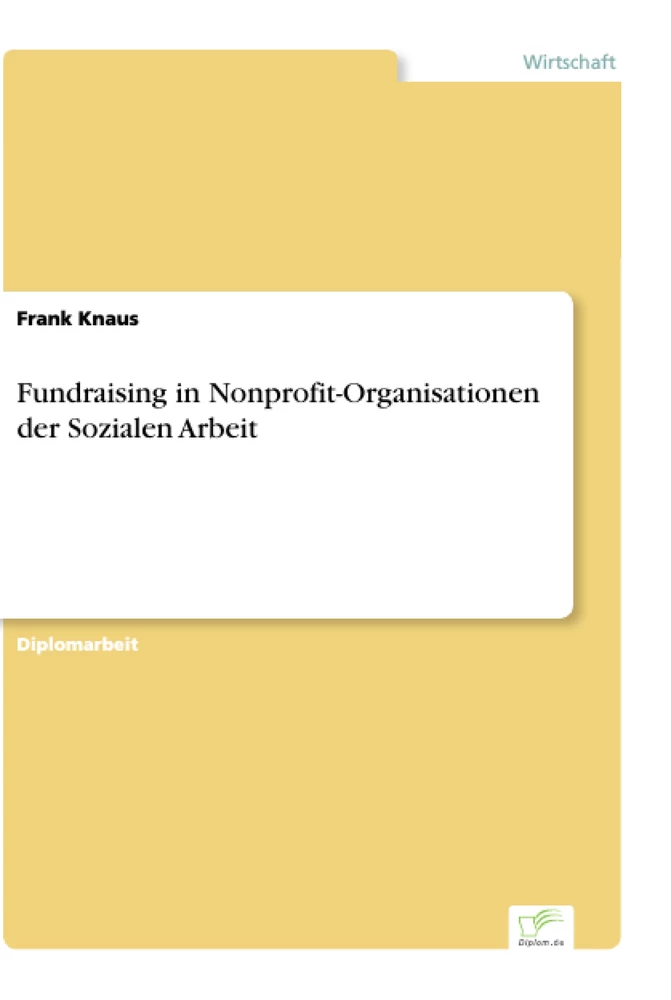Fundraising in Nonprofit-Organisationen der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung
Die Einsparung öffentlicher Finanzmittel macht sich in der Sozialen Arbeit immer stärker bemerkbar. Im Sozialbereich wird versucht, mittels verschiedener modifizierter Methoden aus der Betriebswirtschaft Geld einzusparen und die Folgen des Geldmangels zu verringern. Begrifflichkeiten wie Qualitätsmanagement und Marketing werden vermehrt in den Nonprofit-Sektor übertragen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Themenbereich Fundraising in Nonprofit-Organisationen in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Dies wird unter anderem an der zunehmenden Zahl von Fachliteratur zu diesem Thema sowie an der Zunahme von entsprechenden themenbezogenen Verbänden und Vereinen deutlich. Der wachsende Geldmangel in der Sozialarbeit, aufgrund fehlender staatlicher Mittel, verlangt ein Umdenken. Der Finanzquellen-Mix macht eine anderweitige Beschaffung von Mitteln, seien sie monetärer oder sachlicher Natur, ergänzend oder gänzlich möglich. In vielen Einrichtungen der Sozialen Arbeit scheint dies jedoch weiter erfolgreich ignoriert zu werden.
Während meiner Praktika und meiner Tätigkeiten als Honorarkraft habe ich mehrfach versucht etwas über die Finanzierung von neuen Projekten wie z. B. einer dringend benötigten Drogenberatungsstelle zu erfahren. Es wurde jedoch schnell deutlich, dass ich mir Informationen und Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten sowie Fördermittel auf andere Weise würde beschaffen müssen.
Aufgrund dieser Erfahrungen entstand die Idee für nachfolgende Diplomarbeit, welche ich als eine Einführung ansehe, da der Themenbereich für eine vollständige Betrachtung bei weitem zu komplex ist. Wer an einer eingehenden Beschäftigung mit dem Thema Fundraising interessiert ist, findet im Anhang entsprechende Adressen, Buchquellen und Internetseiten mit Informationen.
Der Anfang dieser Arbeit soll einen Einblick in den Nonprofit-Sektor der Bundesrepublik Deutschland geben. Verschiedene Begriffe zum Thema Nonprofit-Organisationen und Fundraising werden in den ersten Kapiteln kurz erklärt und definiert. Eine Beschreibung von grundlegenden organisatorischen Voraussetzungen, welche die Nonprofit-Organisationen schaffen oder schon aufweisen sollten, schließt sich dem an. Ein kleiner Einblick in die Methodenvielfalt der Mittelakquisition soll vermittelt werden. Das von mir theoretisch entwickelte Projekt mit pädagogischem Hintergrund soll die Möglichkeit bieten, in groben Zügen den […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Gliederung:
1. Einleitung
2. Begriffserklärung und Definition der Nonprofit-Organisation
2.1. Finanzierungsstruktur des deutschen Nonprofit-Sektors im S. 05 internationalen Vergleich
3. Begriffserklärung und Definition des Fundraising
3.1. Begriffe des Fundraising:
3.1.1. Philanthropie
3.1.2. Marketing und Social Marketing
3.1.3. Die Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
3.2. Organisation und Planung des Fundraising
3.2.1. Organisations- und Situationsanalyse
3.2.2. Marktanalyse
3.2.3. Organisationsphilosophie und Corporate Identity (CI)
3.2.4. Zielorientierung
3.2.5. Personelle Voraussetzungen
3.2.6. Qualitätsmanagement im Fundraising
4. Ausgewählte Fundraising-Methoden
4.1. Spendenbriefe (Mailings)
4.2. Haus- und Straßensammlungen
4.3. Fundraising-Event oder Event-Marketing
4.4. Telefon-Fundraising
4.5. Das Internet
4.6. Warenverkauf (Merchandising)
4.7. Großspenden
4.8. Spenden von Unternehmen
4.9. Erbschaftsmarketing
5. Spenderdank und Beschwerdemanagement
5.1. Der Spenderdank
5.2. Das Beschwerdemanagement
6. Busgeldakquisition
7. Sponsoring
7.1. Ziele des Sponsors
7.2. Ziele des Gesponsorten
7.3. Grundlagen von Sponsoring-Partnerschaften
7.4. Das Sponsoring-Konzept
7.5. Recht und Steuern
8. Stiftungen
8.1. Akquisition von Stiftungsgeldern
9. Staatliche Mittel und EU-Förderung
9.1. Staatliche Mittel
9.2. EU-Förderung
10. Projektvorstellung
10.1.1. Stigmatisierung
10.1.2. Delinquenz und Devianz
10.1.3. Projekttitel und Projektbeschreibung
10.1.4. Ausstattung der Ausbildungsstelle
10.1.5. Notwendige Vorbereitungen
10.1.6. Koordination des Fundraising und der Öffentlichkeitsarbeit
10.1.7. Von Theorie und Praxis
11. Schlussbetrachtung
12. Anhang und Quellenverzeichnis
Quellenverzeichnis
Nützliche Adressen und Internetseiten
Diagramme und Tabellen
1. Einleitung
Die Einsparung öffentlicher Finanzmittel macht sich in der Sozialen Arbeit immer stärker bemerkbar. Im Sozialbereich wird versucht, mittels verschiedener modifizierter Methoden aus der Betriebswirtschaft Geld einzusparen und die Folgen des Geldmangels zu verringern. Begrifflichkeiten wie Qualitätsmanagement und Marketing werden vermehrt in den Nonprofit-Sektor übertragen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Themenbereich Fundraising in Nonprofit-Organisationen in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Dies wird unter anderem an der zunehmenden Zahl von Fachliteratur zu diesem Thema sowie an der Zunahme von entsprechenden themenbezogenen Verbänden und Vereinen deutlich. Der wachsende Geldmangel in der Sozialarbeit, aufgrund fehlender staatlicher Mittel, verlangt ein Umdenken. Der Finanzquellen-Mix macht eine anderweitige Beschaffung von Mitteln, seien sie monetärer oder sachlicher Natur, ergänzend oder gänzlich möglich. In vielen Einrichtungen der Sozialen Arbeit scheint dies jedoch weiter erfolgreich ignoriert zu werden.
Während meiner Praktika und meiner Tätigkeiten als Honorarkraft habe ich mehrfach versucht etwas über die Finanzierung von neuen Projekten wie z. B. einer dringend benötigten Drogenberatungsstelle zu erfahren. Es wurde jedoch schnell deutlich, dass ich mir Informationen und Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten sowie Fördermittel auf andere Weise würde beschaffen müssen.
Aufgrund dieser Erfahrungen entstand die Idee für nachfolgende Diplomarbeit, welche ich als eine Einführung ansehe, da der Themenbereich für eine vollständige Betrachtung bei weitem zu komplex ist. Wer an einer eingehenden Beschäftigung mit dem Thema Fundraising interessiert ist, findet im Anhang entsprechende Adressen, Buchquellen und Internetseiten mit Informationen.
Der Anfang dieser Arbeit soll einen Einblick in den Nonprofit-Sektor der Bundesrepublik Deutschland geben. Verschiedene Begriffe zum Thema Nonprofit-Organisationen und Fundraising werden in den ersten Kapiteln kurz erklärt und definiert. Eine Beschreibung von grundlegenden organisatorischen Voraussetzungen, welche die Nonprofit-Organisationen schaffen oder schon aufweisen sollten, schließt sich dem an. Ein kleiner Einblick in die Methodenvielfalt der Mittelakquisition soll vermittelt werden. Das von mir theoretisch entwickelte Projekt mit pädagogischem Hintergrund soll die Möglichkeit bieten, in groben Zügen den Planungs- und Organisationsaufwand deutlich zu machen. Die notwendige Vernetzung von Öffentlichkeitsarbeit, Projektleitung und Fundraising soll anhand dieses Beispiels dargestellt und ein Bezug zur praktischen Anwendung der vorgestellten Methoden geschaffen werden.
In dieser Diplomarbeit wird von mir, lediglich um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, die männliche Form verwendet.
2. Begriffserklärung und Definition der Nonprofit-Organisation
Nonprofit-Organisationen (NPO) werden auch als Nongovernment-Organisationen (NGO) und früher als Not for profit Organisationen bezeichnet. Ich beziehe mich in dieser Diplomarbeit vor allem auf die Begrifflichkeit Nonprofit-Organisation, wobei sich dieser Begriff keineswegs nur auf den Sektor der sozialen Arbeit begrenzt.
Es gibt zum Beispiel auch Umweltorganisationen, Hochschulen, Krankenhäuser, Sportvereine usw., welche dem Nonprofit-Sektor zuzuschreiben sind. Entstanden ist dieser Begriff „(...), in Ermangelung eines positiven Oberbegriffs, (...). Markantes und namensinhärentes Merkmal ist die Nicht-Gewinnorientierung“ (URSELMANN 1998, S. 5). In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Sektor auch als Dritter Sektor bezeichnet wird, der Erste Sektor bezeichnet den freien Markt, der Zweite Sektor den Staat (vgl. URSELMANN 1998, S. 6).
Nach der Definition von ZIMMER:
„(...) sind Nonprofit-Organisationen formell strukturiert und haben eine eigenständige Rechtsform. (...) sind ferner privat und damit organisatorisch unabhängig vom Staat. (...) sie sind nicht im ökonomischen Sinne gewinnorientiert tätig, (...). Ferner verfügen Nonprofits über eine eigenständige Verwaltung. Sie sind insofern autonom, als über ihre Geschäftsführung und strategische Planung nicht an anderer Stelle entschieden werden kann. (...) Des weiteren kann man nicht zur Mitgliedschaft oder zum Mitmachen in einer Nonprofit-Organisation gezwungen werden. (...) Schließlich werden Nonprofit-Organisationen zu einem gewissen Grad durch ehrenamtliches Engagement und durch Spenden und Zuwendungen getragen“ (ZIMMER 2000, S. 89).
Die dargestellte Definition orientiert sich klar an der ’International Classification of Nonprofit Organizations’ ICNPO. Diese wurde von Wissenschaftlern im Zuge des Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project ausgearbeitet.
„Das Johns Hopkins Projekt zur vergleichenden Erforschung des Dritten Sektors bemüht sich systematisch um die Analyse der Reichweite, Struktur, Finanzierung und Rolle des privaten, gemeinnützigen Sektors in einem weltweit angelegten internationalen Vergleich“ (SALAMON 1999, S. 46).
Die Klassifikation von Nonprofit-Bereichen beinhaltet zwölf Gliederungsbereiche, welche nochmals untergliedert wurden, d. h., für die ICNPO Deutschland wurden die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche in 98 Unterpunkte unterteilt.
Die zwölf Hauptgruppen bestehen aus folgenden Bereichen:
- Kultur und Freizeit
- Bildung und Forschung
- Gesundheit
- Soziale Dienste
- Umwelt und Naturschutz
- Entwicklungsförderung
- Rechts- und Interessenvertretung, Politik
- Stiftungen und Förderung des Ehrenamts
- Internationale Entwicklungshilfe
- Religion
- Berufs- und Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften
- Sonstiges
In anderen Definitionen wird deutlich, dass eindeutige Zuordnungen im Nonprofit-Sektor, bzw. eindeutige Abgrenzungen vom ersten Markt sowie zweiten Markt nicht immer möglich sind.
„Eine eindeutige Zuordnung einer Organisation zu einem der drei Sektoren ist jedoch nicht immer möglich. Vielmehr sind bei Nonprofit-Organisationen Überlappungen mit Staats-, aber auch Marktelementen keine Seltenheit“ (URSELMANN 1998, S. 8).
Das Freiburger Management-Modell geht auf die Vielfalt der Organisationen ein und unterscheidet in der Trägerschaft zwischen staatlichen, halbstaatlichen und privaten Nonprofit-Organisationen (vgl. SCHWARZ 1996, S. 19).
„Viele private NPO
a) erbringen Dienstleistungen, die sie am Markt unter Konkurrenz und gegen mindestens kostendeckende Preise verkaufen.
b) erfüllen vom Staat übertragene oder überlassene Aufgaben unter Kontrolle des Staates. Dies betrifft insbesondere auch die durch Gesetz geschaffenen Selbstverwaltungskörperschaften mit Pflichtmitgliedschaft (Kammern in Österreich und Deutschland)“ (SCHWARZ 1996, S. 22).
Für die Zwecke dieser Diplomarbeit sind weitere Differenzierungen der Strukturtypen in mitgliedschaftlich bzw. nichtmitgliedschaftlich sowie in Selbsthilfe- und Fremdleistungs-NPO usw. nicht notwendig (vgl. SCHWARZ 1996, S. 23).
Es erscheint mir jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass es Organisationstypen gibt, welche in Grauzonen fallen, und dass einige Definitionen bzw. Abgrenzungen einen deutlichen Unterschied zur ICNPO darstellen (vgl. SALAMON 1999, S. 41).
Bei den Organisationstypen kann es sich z. B. um private Nongovernment-Organisationen handeln, welche jedoch so stark von staatlichen Behörden abhängig sind, dass sie in ihrem Wesen als Teile der Institution gelten müssen, obwohl eine strukturelle Trennung besteht. Diese Organisationen werden auch als Quango´s bezeichnet, was soviel bedeutet wie Quasi-Nongovernment-Organisation.
Es gibt vor allem in deutschsprachigen Ländern diese Vermischungen, die juristischer, personeller oder finanzieller Natur sein können und eventuell zu Abgrenzungsproblemen führen (vgl. BADELT 2002, S. 10).
2.1. Finanzierungsstruktur des deutschen Nonprofit-Sektors im internationalen Vergleich
Die Finanzierung von Nonprofit-Organisationen wird erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit dokumentiert. Dies liegt zum einen an der Verschiedenartigkeit der Rechts- und Organisationsformen in den einzelnen Staaten, zum anderen daran, dass Daten über den Bereich nur schwer zu bekommen waren. Seit 1990 wird von der John Hopkins University in Baltimore durch den Projektleiter Lester M. Salamon sowie den stellvertretenden Projektleiter Helmut K. Anheier das John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project durchgeführt. Das deutsche Projektteam verfolgte im Rahmen der Teilstudie das Ziel, eine umfassende Datenbasis aufzubauen um ein detailliertes Bild der deutschen Situation zu erstellen und den Vergleich mit anderen Ländern zu ermöglichen. Die Möglichkeit des Internationalen Vergleichs ist auch ein zentrales Anliegen der gesamten Untersuchung. Die erste Phase des Projekts fand von 1990 bis 1995 statt, die zweite Phase ging von 1995 bis1999 (vgl. SALAMON 1999, S. 12).
Die folgenden Tabellen und Zahlen sollen einen kleinen Einblick in die Finanzierungsstruktur von Nonprofit-Organisationen geben, um später die Elemente und Möglichkeiten des Fundraisings besser darstellbar und verständlich zu machen. Außerdem sollen die großen Unterschiede im Bereich der Einnahmequellen in den unterschiedlichen Staaten deutlich werden. Als Datenquellen für die deutschen Teilstudien des Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project wurden vor allem schon vorhandene Statistiken benutzt. Diese wurden gemäß der Projektzielsetzung und mit Hilfe der ICNPO einer sekundär-statistischen Analyse unterzogen (vgl. HAIBACH 2001, S. 156).
Laut Tabelle 2 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 1995 Nonprofit-Organisationen durch die öffentliche Hand und die Sozialversicherung zu 64%, durch die Einnahmen aus Gebühren zu 32% und durch Philanthropie zu 3% finanziert. Dies verhält sich in den aufgeführten westeuropäischen Ländern, ausgenommen Spanien und Finnland, ähnlich. Hier sind die Hauptquelle der Nonprofit-Einnahmen Zuwendungen und Aufträge der öffentlichen Hand. Diese Einnahmenstruktur baut auf dem Subsidaritätsprinzip auf (vgl. SALAMON 1999, S. 25).
Das Subsidaritätsprinzip beinhaltet im wesentlichen, dass der Staat nur Funktionen übernimmt, die der private Sektor nicht erfüllen kann, es handelt sich dabei um Dezentralisierung und Privatisierung staatlicher Funktionen. Die Einnahmen aus Spenden und Stiftungen betrugen im Durchschnitt aller Länder 11%, in der Bundesrepublik Deutschland nur 3%, d. h., sie spielen bisher eine untergeordnete Rolle bei der Finanzierung von Nonprofit-Organisationen, was nicht heißen soll, dass 4,6 Milliarden Mark bedeutungslos sind. Die Philanthropie ist vor allem in den osteuropäischen Ländern und in Spanien ausgeprägt (vgl. Tabelle 2).
Im Nonprofit-Sektor waren 3,7% der Bevölkerung 1990 beschäftigt, dies entsprach 1,018 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen (vgl. Tabelle 1). Die ökonomische Bedeutung des Nonprofit-Sektors entsprach zu diesem Zeitpunkt etwa dem Banken- und Versicherungswesen (890 000 Beschäftigte). Im Durchschnitt lag die Anzahl der beschäftigten Personen, welche als feste Mitarbeiter galten, in den 107 000 Nonprofit-Einrichtungen bei neun bis zehn. Der Umsatz dieser Einrichtungen im Jahr 1990 betrug 93,4 Milliarden Mark, dies entsprach ca. 3,9% des Bruttoinlandprodukts (vgl. ANHEIER, S. 33ff).
Tabelle 1:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Teilstudie Deutschland
Tabelle 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project
In Tabelle 3 werden die Einnahmen aus Spenden des Nonprofit-Sektors in der Bundesrepublik Deutschland aufgeführt. Für diese Diplomarbeit sind vor allem die Bereiche Soziale Dienste und Gesundheitswesen von Interesse.
„Neben dem Gesundheitswesen, das im wesentlichen die Krankenhäuser sowie die ambulanten und stationären Pflegedienste umfasst, zählen die Sozialen Dienste zu den ausgabenstärksten sowie maßgeblich von Hauptamtlichkeit geprägten Bereichen des deutschen Nonprofit-Sektors“ (HAIBACH 2001, S. 162).
In diesen Bereichen ist ein starker Rückgang der Spendengelder zu verzeichnen (vgl. Tabelle 3), außerdem bestehen hohe Anteile der Gesamteinnahmen aus öffentlichen Mitteln. Aufgrund des Spendenrückgangs und der Kürzung der Mittel wird hier die Notwendigkeit von Fundraising deutlich.
Tabelle 3:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Datenbasis: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, Teilstudie Deutschland
Weitere Ausführungen zu diesem Thema sind für diese Diplomarbeit nicht relevant, im Anhang finden sich noch zusätzliche Tabellen und Zahlen.
3. Begriffserklärung und Definition des Fundraising
In den USA ist das Fundraising, also die Professionalisierung im Bereich ‚der guten Gaben’ schon längst normal und außerdem ein gängiger Begriff, Philanthropie hat in den USA Tradition, in Deutschland führen diese Begriffe eher zur Benutzung des Fremdwörterbuches. In Deutschland galt das Image eines bescheidenen Helfers lange Zeit als besonders spendenwirksam, außerdem übernahm der Staat bisher einen Grossteil der Finanzierung von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. Die geplanten und durchgeführten Kürzungen der staatlichen Mittel führten und führen auch weiterhin zur Suche nach neuen staatsunabhängigen Finanziers. Seit Anfang der neunziger Jahre, fand ein Professionalisierungsschub statt. Die Spender werden neu entdeckt und die Fundraisingtechniken werden verfeinert bzw. für europäische Verhältnisse modifiziert. Die Tendenz geht eindeutig weg von der staatlichen Finanzierung hin zur Mischfinanzierung, und Fundraising ist hierfür ein probates Mittel.
„ Fundraising (angloamerikanisch fund = Geldmittel, Kapital, Fonds; to raise = etwas aufbringen) wird verstanden als die umfassende Mittelbeschaffung einer Nonprofit-Organisation (Finanz- und Sachmittel, Rechte und Informationen, Arbeits- und Dienstleistungen), wobei der Schwerpunkt auf der Einwerbung finanzieller Mittel liegt“
(HAIBACH 2001, S. 68).
Der Begriff des Fundraisings stammt aus den USA und wurde aus dem Substantiv fund und dem Verb to raise zusammengesetzt, wobei sich hinter dem Wort fund die Bedeutung von Geld und Kapital verbirgt, wie auch die Bedeutung des lateinischen Wortes „Fundus“ Vermögensreserve, Grundstock. Hinter to raise verbirgt sich ‚etwas aufbringen’ z.B. Geld (vgl. HAIBACH 2001, S. 68; KLUGE 1999, S. 278).
„Fund Raising ist somit ein Instrumentarium wie auch ein Prozeß zur Vermögensbildung (= strategisches Fund Raising) und Mittelbeschaffung (= operatives Fund Raising)“ (SCHÖFFMANN 1994, S. 7).
URSELMANN definiert den Begriff folgendermaßen:
„Unter Fundraising soll derjenige Teil des Beschaffungsmarketing einer Nonprofit-Organisation verstanden werden, bei dem die benötigten Ressourcen ohne marktadäquate materielle Gegenleistung beschafft werden. Benötigte Ressourcen sind nicht nur Finanzleistungen (aus Private Giving, Corporate Giving, Foundation Support und Public Support), sondern auch Sachleistungen (z. B. Sachspenden), Dienst-, einschließlich Arbeitsleistungen (z. B. Secondment), Rechte (z. B. Schirmherrschaft, Ausnahmerechte auf besondere Werbezeiten etc.) und Informationen (z. B. aus kostenpflichtigen Datenbanken)“ (URSELMANN 1998, S. 21).
Laut Urselmann ist das Sponsoring dem Fundraising nicht zuzuordnen, da der Sponsor nicht auf eine Gegenleistung verzichtet und diese auch vertraglich festgehalten wird. Das Sponsoring ist für den Unternehmer unbegrenzt von der Steuer absetzbar, im Gegensatz zur Firmenspende für die es klar definierte Grenzen gibt (vgl. URSELMANN 1998, S. 20). Jedoch findet man in den meisten Handbüchern über Fundraising ein Kapitel zum Thema Sponsoring, da sich Fundraiser nicht den Luxus leisten können, diese mögliche Geldquelle zu ignorieren.
Im Handbuch der Fundraising Akademie wird das Sponsoring dem Fundraising als Instrument zugeordnet und es ist auch naheliegend, dass sich Fundraiser mit dem Sponsoring in den Nonprofit-Organisationen beschäftigen.
Beim Fundraising handelt es sich somit um komplexe Marketingmaßnahmen zur Beschaffung von Ressourcen in Form von Sach- und Geldmitteln, sowie Dienst- und Arbeitsleistungen. Fundraising wird manchmal als professionelles Spendenmarketing übersetzt, wobei ich im folgenden auf Begriffe aus dem Fundraising wie z. B. Philanthropie und Marketing näher eingehen werde.
3.1. Begriffe des Fundraising:
3.1.1. Philanthropie
Wird übersetzt als Menschenliebe, Philanthrop – der Menschendfreund, Wohltäter der Menschheit (vgl. BROCKHAUS 1972, S. 572; DUDEN 1991, S. 318). Der Begriff bildet sich aus dem griechischen philos = „Freund, liebend“ und ánthropos = „Mensch“ (vgl. KLUGE 1999, S. 629). Im Fundraising versteht man heute darunter
„(...) das freiwillige nicht gewinnorientierte Geben von Zeit oder Wertgegenständen (Geld, Wertpapiere, Sachgüter) für öffentliche Zwecke, (...)“ (HAIBACH 2000, S. 67). Philanthropie steht in den USA für Eigenverantwortlichkeit, Solidarität und Selbsthilfe, als soziale Verpflichtung, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, und zwar in Form von Spenden oder ehrenamtlicher Arbeit. Diese Grundhaltung ist in den USA notwendig, da das sozialstaatliche Netz bei weitem nicht so ausgeprägt ist wie in der Bundesrepublik Deutschland. Ohne philanthropische Grundhaltung ist kein Fundraising möglich und diese muss in Deutschland erst entwickelt werden, da man sich noch immer auf den Staat verlässt. Es wird versucht, mit Schlagwörtern wie bürgerschaftliche Partizipation, Zivilgesellschaft und aktive Bürgergesellschaft Gemeinsinn zu entwickeln und zu fördern. Das Ehrenamt wird neu bewertet, und Spenden sollen Prestigegewinn für den Spender mit sich bringen. Der negative Touch des Bettelns im Spendenmarketing, welcher hierzulande noch vorherrscht, könnte durch eine vermehrte Identifikation mit Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen tatsächlich verringert werden.
3.1.2. Marketing und Social Marketing
Marketing wird in der Sozialarbeit immer noch kritisch betrachtet, sei es aus Tradition oder aus Angst vor Leistungsnachweisen. Richtig ist, dass nicht alles was aus dem ökonomischen Sektor kommt, 1:1 übertragbar ist. Doch wäre es ein großer Fehler, nicht von der Privatwirtschaft zu lernen, um neue Möglichkeiten zu erschließen, vor allem bei zunehmend leeren Kassen seitens der staatlichen Finanzierung des Sozialbereichs. Da der Begriff des Marketing umgangssprachlich oft mit Werbung gleichgesetzt wird, möchte ich hier einen Überblick über die Inhalte des Begriffs geben und den verhältnismäßig neuen Begriff des Social Marketing im Anschluss näher erklären.
„Der Begriff Marketing umschreibt die Vermarktung von Gütern, die dabei praktizierte konsequente Kundenorientierung, eine auf die Bewältigung von Engpässen abzielende Führungskonzeption und ein Instrument zur Förderung öffentlicher Anliegen im Wege der Information und Überzeugung“ (DICHTL 1997, S. 139).
Marketing beinhaltete anfangs tatsächlich „nur“ die Vermarktung von Erzeugnissen, dies wurde jedoch nach dem Übergang von der sogenannten Knappheitswirtschaft zur Überflussgesellschaft anders. Das Erschließen und Pflegen von Märkten wurde für Unternehmer immer wichtiger, die Kundenorientierung wurde ein Teil des Marketings. Das Marketing wurde zur Methode, welche unter anderem sozialpsychologische, soziologische und volkswirtschaftliche sowie analytische Hilfsmittel in sich vereinigte. Neue Probleme in der Beschaffung von Rohstoffen führten zum sogenannten Beschaffungsmarketing. Heute steht der Marketingbegriff für eine Vielzahl von Inhalten. Es geht immer noch um die Vermarktung von Gütern, aber auch um Markt- und Standortanalyse, Qualitätssicherung, Umweltschutz z. B. durch Recycling sowie um Kostenvorteile. Auch die Kommunikation und Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit) sowie die Corporate Identity fallen in den Bereich des strategischen Marketings, bzw. in den Bereich der absatzpolitischen Instrumente des Marketings (vgl. DICHTL 1997, S.134ff).
Dies ist sicherlich eine unzulängliche Beschreibung des kommerziellen Marketings, genügt jedoch um die Vielfältigen Inhalte aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass die Übersetzung mit Werbung nicht zutreffend bzw. ungenügend ist.
Zum Thema Social Marketing oder Sozialmarketing gibt es eine große Anzahl an Literatur, daher versuche ich die Begriffe nur kurz zu beschreiben. Es geht mir um die Vermittlung eines Grundverständnisses, damit der Begriff des Fundraisings für den Leser besser einzuordnen ist.
Der Begriff Social Marketing wurde mit mehreren konkurrierenden Definitions-versuchen beschrieben. Ich möchte mich jedoch bei der Unterscheidung auf zwei Sachverhalte beschränken, einmal auf den in der Privatwirtschaft angeführten, welcher folgendes beinhaltet:„(...) ein gesellschaftlich verantwortungsbewußtes Handeln bei allem, was herkömmlicherweise mit Marketing etikettiert wird“ (DICHTL 1997, S. 140).
Unternehmen, die Social Marketing betreiben, verzichten darauf, ihre egoistischen Ziele auf Kosten der Allgemeinheit und um jeden Preis zu erreichen. Hier wird auch vom Societal Marketing gesprochen. Dies beginnt beim Entlassungsverhalten eines Unternehmens und kann bis zum sogenannten Demarketing gehen.
„Eine neue Dimension erhält der Tatbestand allerdings dadurch, daß ein Unternehmen nicht mehr nur darauf verzichtet, ein lukratives Geschäft wahrzunehmen, sondern aktiv und unter Hinnahme von nicht unbeträchtlichen Kosten für eine Sache eintritt. (...) z. B. eine Mineralölgesellschaft, die in aufwendigen Anzeigen dafür wirbt, mit Benzin und Heizöl sparsam umzugehen (...)“ (DICHTL 1997, S. 140).
Der zweite Sachverhalt, den der Begriff Social Marketing beinhaltet, beschreibt Social Marketing als umfassende Führungskonzeption, welche die Führungsphilosophie und das Management umfasst, und bezieht sich auf Nonprofit-Organisationen.
„ Social Marketing ist die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle von Marketingstrategien und –aktivitäten nichtkommerzieller Organisationen, die direkt oder indirekt auf die Lösung sozialer Aufgaben gerichtet sind“ (BRUHN 1994, S. 23). Im Freiburger Management-Modell wird erklärt: „Unter Marketing verstehen wir daher generell ein aktives “Management der Umwelt-Beziehungen“ (...)“ (SCHWARZ 1996, S. 67).
Das Social Marketing oder Sozio Marketing ist eine auf dem modernen Marketing-verständnis basierende Begrifflichkeit. Diese enthält die Marketing-Philosophie, das Management-Konzept und die Marketingplanung. Es ist nicht unbedingt das Ziel des Social Marketings die Zielgruppe zu vergrößern – man denke nur an Drogenabhängige – es geht vielmehr darum, die Zielgruppe mittels des Absatzmarketings zu erreichen. Dieses Absatzmarketing ist für die Nonprofit-Organisationen notwendig, da es meist mehrere Anbieter mit vergleichbaren Angeboten gibt. Es wird berücksichtigt, dass die Klienten/ Nutzer häufig nicht gleichzeitig die Finanzierung ihrer in Anspruch genommenen Leistungen erbringen. Dies wird besonders daran deutlich, dass die Mittelbeschaffung mit Marketingmethoden wie Fundraising als Beschaffungsmarketing auf dem Spendenmarkt stattfindet. Hier werden Förderer aktiviert, um den Klienten, entsprechend der Ausrichtung der Nonprofit-Organisation Angebote machen zu können. Ziel ist nicht, den größtmöglichen Absatz eines Produktes mit maximaler Gewinnabschöpfung zu erreichen, sondern das angebotene Spektrum an Leistungen für Klienten bestmöglich zu entwickeln und zu finanzieren. Annett Staubach drückt diesen Sachverhalt wie folgt aus:
„Sozialmarketing ist die Erfassung und Erfüllung der Zielgruppenbedürfnisse und umfasst die Planung und Durchführung von Austauschbeziehungen mit dem Ziel, Ressourcen für die Sicherstellung der eigenen Arbeit zu erwerben sowie eigene Produkte und Dienstleistungen anzubieten bzw. erfolgreich abzusetzen“ (STAUBACH 2000, S. 22).
3.1.3. Die Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
„Die Öffentlichkeitsarbeit (= Public Relations) dient dazu, durch eine systematische Pflege der Beziehungen, die ein Unternehmen zur Außenwelt unterhält, den Boden für ein erfolgreiches Wirken zu schaffen bzw. zu erhalten“ (DICHTL 1997, S. 190).
Im Freiburger Management-Modell wird die Öffentlichkeitsarbeit folgendermaßen beschrieben: „Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine permanente Aufgabe jeder NPO, mit dem Zweck der Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen für das Wirken der Mitglieder oder des Erzielens von Akzeptanz der NPO und ihres Verhaltens beziehungsweise ihrer Interessen“ (SCHWARZ 1996, S. 83).
Öffentlichkeitsarbeit sollte von jeder Organisation geleistet werden, diese kann durch Berichte, Interviews, Anzeigen, Flugblätter, Plakate oder mit Spots in verschiedenen elektronischen Medien betrieben werden. Die Öffentlichkeitsarbeit ist eng mit dem Fundraising verbunden, hier sind die Übergänge fließend, um so wichtiger ist eine entsprechende konzeptionelle Abstimmung in den Nonprofit-Organisationen. Auf diese konzeptionellen Voraussetzungen wird im nächsten Kapitel noch ausführlicher eingegangen. „ Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades einer Organisation und ihrer Anliegen sowie die Schaffung eines möglichst positiven Images“ (HAIBACH 2001, S. 320). Gute Public Relation sorgt dafür, dass die Nonprofit-Organisation immer wieder „ins Gespräch“ kommt und ein stabiles Image aufgebaut und erhalten wird. Die Öffentlichkeitsarbeit sollte vor, während und nach Aktionen wie z.B. Sammlungen von Spenden betrieben werden.
Vor einer Sammlung, um das Anliegen bekannt zu machen und potentielle Spender zu informieren, während der Aktion, um Spender zu aktivieren. Es eignen sich dafür Radiospots oder prominente Persönlichkeiten, die sammeln. Nach Abschluss der Aktion sollten die Zahlen über eingegangene Spenden bekannt gemacht werden und entsprechend sollte die Organisation mitteilen, wie das Geld nun verwendet werden soll. Der individuelle Spenderdank liegt wiederum bei den Fundraisern. Dieses Thema wird unter Spenderdank im Kapitel 5 noch ausführlich behandelt.
3.2. Organisation und Planung des Fundraising
Um Fundraising zu betreiben, bedarf es einer ausführlichen Vorbereitungsphase, in welcher ein detailliertes Konzept entwickelt werden muss, dass alle Bereiche der Organisation umfassen sollte. Diese Vorbereitungsphase benötigt Zeit, da es schwer möglich ist, den Fundraising-Prozess von heute auf morgen in Bewegung zu setzen. Dies setzt besonders in der Anfangsphase eine gute Planung und Organisation voraus. Dafür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. „Fundraising bedeutet somit nicht, mal eben ein paar Bittbriefe zu versenden oder einen Zeitungsartikel über die Not der Einrichtung zu verfassen oder wahllos Unternehmen anzuschreiben mit der Bitte um Sponsoring (wenngleich damit im Grunde eine Spende gemeint ist)“ (SCHEIBE-JAEGER 2001, S. 328).
In Untersuchungen wird deutlich, dass eine intensive Planung mit Organisations- und Umfeldanalyse die Erfolgschancen für Fundraising erheblich verbessert
(vgl. URSELMANN 1998, S. 210ff). Die Fundraising-Abteilung übernimmt strategisch wichtige Management- und Marketingaufgaben. Es ist daher notwendig diese Abteilung in der Organisationsleitung oder zumindest einen Vertreter in der Führungsebene zu integrieren, um alle Schritte, die dort geplant werden, mit den Fundraising-Maßnahmen abzustimmen. Es empfiehlt sich des weiteren für kleinere Organisationen zu überprüfen, ob eine Kooperation mit anderen kleinen Einrichtungen für das Fundraising sinnvoll wäre.
Diese Konzeptionsentwicklung besteht aus mehreren Schritten, die ich im folgenden Teil, in wesentlichen Grundzügen, erklären möchte.
3.2.1. Organisations- und Situationsanalyse
Der „steinige Pfad“, der für die Organisation von Fundraising beschritten werden muss, führt zunächst zur eigenen Organisation und zur Situationsanalyse. Diese Analyse beinhaltet verschiedene Teilbereiche wie den Personalbereich, die Sachmittel und die Finanzen, also Ressourcen, die vorhanden sind. In diesen Bereichen werden die Stärken und Schwächen ausgelotet und auch Chancen und Risiken, die sich hieraus ergeben. Die Situationsanalyse im Personalbereich umfasst z. B. die Qualifikation von Mitarbeitern, das Arbeitsklima (Zufriedenheit der Mitarbeiter, Bedürfnisse, Einstellungen). Die Sachmittel umfassen die Qualität und Quantität von Arbeitsmaterialien und Gegenständen sowie die Räumlichkeiten und das Gesamterscheinungsbild der Organisation. Die bisherige Finanzierung der NPO und das Wissen über den Einsatz der Mittel ermöglichten einen Überblick und eine eventuell notwendige Umstrukturierung. Bei der Analyse des Leistungsangebots muss festgestellt werden, welche Angebote an Produkten und Leistungen vorhanden sind. Diese Überprüfung beinhaltet z. B. die Produktgestaltung und die Besonderheiten, welche diese Produktangebote von anderen Organisationen unterscheidet.
Ein weiterer Punkt ist das Leitbild oder die Unternehmensphilosophie. Wenn es eine gibt, muss festgestellt werden, ob diese nicht veraltet ist. Vielleicht hat sich auch der Aufgabenbereich der Organisation verändert und somit ist auch die Organisationsphilosophie unpassend. Die Bedeutung des Leitbildes wird im Punkt 3.2.4. noch deutlicher.
3.2.2. Marktanalyse
Die Marktanalyse folgt auf die Organisationsanalyse und hat das Ziel, den Absatzmarkt sowie den Beschaffungsmarkt zu erkunden und die relevanten Informationen dann systematisch und planvoll zusammenzutragen. Die Zielgruppen müssen definiert werden und Mängel bzw. Defizite in der Informationsbeschaffung sollten soweit wie möglich beseitigt werden. Es empfiehlt sich, die Marktforschung zu Rate zu ziehen, Kundenwünsche zu erfragen, die Umwelt zu beobachten und über Trends informiert zu sein. Es ist auch möglich, Benchmarking zu betreiben, um einzelne Bereiche effizienter zu gestalten. Die Analyse des Absatzmarktes beinhaltet das Durchschnittseinkommen sowie die Bedürfnisse der Zielgruppe, das Marktvolumen, das Image der Organisation, die Angebote von Mitbewerbern und deren Service etc.. Die Beobachtung des Beschaffungsmarktes ist notwendig, um gezieltes Fundraising betreiben zu können, denn dies minimiert unnötige Streuverluste. Die Zielgruppen sollten eingeteilt werden, um dann spezielle Kommunikationsstrategien für die entsprechenden Gruppen zu entwickeln oder vorhandene Strategien anzuwenden. Hierfür eignen sich soziologische Studien über die Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft und auch über globale, nationale und branchenbezogene Entwicklungen (vgl. STAUBACH 2000, S. 34f). Die Studien des John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project sind eine wichtige Grundlage zur Erkundung des Spendenmarktes und sollten von Fundraisern nicht unbeachtet bleiben. Da sich Märkte ständig verändern und entwickeln, ist es unbedingt notwendig, die Entwicklungen zu beobachten und Zukunftsprognosen im Auge zu behalten. Je besser die Organisation den Markt kennt, um so besser kann sie auf Veränderungen reagieren bzw. im Vorfeld agieren.
3.2.3. Organisationsphilosophie und Corporate Identity (CI)
Die Organisationsphilosophie sollte Wertvorstellungen beinhalten, mit der sich alle Mitglieder der Organisation identifizieren können. Das Leitbild ist sozusagen das Kernstück der Corporate Identity. Dieses prägt die Kommunikation, das Verhalten der Mitarbeiter und das Erscheinungsbild. Es wird versucht, alles auf ein Soll-Image hin auszurichten. „Es handelt sich hierbei um die Grundwerte und Grundideen, sowie Auffassungen über Sinn und Zweck der Organisation, Qualitätsstandards, Kundenbedürfnisse, Zusammenarbeit und menschliche Umgangsformen“ (HAIBACH 2001, S. 315).
Die sogenannte Corporate Communication wird in eine interne und eine externe Kommunikation unterteilt. Die interne Kommunikation (Corporate Culture) umfasst die Teamsitzungen, den internen Umgangston, Personalpolitik und die Informationspolitik. Bei der externen Kommunikation handelt es sich um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit, Verhalten am Telefon, Werbung usw.. Das Erscheinungsbild (Corporate Design) umfasst die Gestaltung von Materialien, z. B. das Firmenemblem auf dem Briefkopf, den Fahrzeugen, um den Identifikationsgrad und den Wiedererkennungswert zu steigern (vgl. DICHTL 1997, S. 190). Die Mitarbeiter benötigen einen entsprechenden Zeitrahmen, um sich mit dem Leitbild auseinander zu setzen. Dafür empfiehlt es sich, in kleinen und mittleren Organisationen im Vorfeld eine Leitbilddiskussion anzuregen.
Das Leitbild wird am besten in kurzen Slogans präsentiert und verbreitet.
Die Umsetzung der Corporate Identity ist notwendig für ein funktionierendes Social Marketing und für ein funktionierendes Fundraising. Die Elemente der Corporate Identity umfassen natürlich noch mehr Details, wie auch die Ziele, doch ist dieses Thema zu umfangreich, um es in dieser Arbeit weiter zu bearbeiten.
3.2.4. Zielorientierung
„(...)Almosen sind zufällig; Fundraising hingegen muss lange im Voraus systematisch und konsequent auf ein konkretes Ziel hin geplant werden, wenn es längerfristig funktionieren soll“ (SCHEIBE-JAEGER 2001, S. 328).
Nach der Organisationsanalyse und der Marktanalyse kann die Planung beginnen, doch diese setzt Ziele und Zielformulierungen voraus (vgl. URSELMANN 1998, S. 159). Es müssen konkrete und realistische Ziele sein, die sich in kurz-, mittel- und langfristige Ziele unterteilen lassen. Eine weitere Unterteilung besteht aus quantitativen (in Zahlen ausdrückbare Zielgröße) und qualitativen (Kontrolle des Identifikationsgrades der Mitarbeiter, Kundenzufriedenheit) Zielen (vgl. SCHEIBE-JAEGER 2001, S. 331). Die Zielformulierung dient natürlich auch der Kontrolle, es kann überprüft werden, welche Ziele erreicht wurden, welche nicht und was für Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit zu ziehen sind. Die Zielformulierung ist jedoch nicht nur wegen des Kontrolleffekts von Nöten, sondern es muss konkret benannt werden können, für welchen Zweck und in welcher Höhe Mittel benötigt werden. Dies gilt nicht nur für kleine Organisationen. Fundraising-Projekte kosten erst Geld bevor sie welches einbringen, es ist also ein Budget notwendig. Dies ist besonders problematisch für Organisationen die in finanzieller Hinsicht nur noch geringen Spielraum haben. Es gibt Projekte, die von einer Organisation äußerst spendwirksam eingesetzt werden können, und andere, die sich weniger für Fundraising eignen, auch darüber sollte vor Aktionen Klarheit herrschen. Erst wenn die eigene Situation klar und der Markt analysiert ist, die Corporate Identity die Mitarbeiter erreicht hat und die Ziele bzw. Projekte klar strukturiert und eingestuft sind, ist es möglich, mit dem Marketing-Mix zu beginnen.
Bevor ich auf den Marketing-Mix und auf einige ausgewählte Fundraising-Methoden eingehe, soll hier eine kurze Ausführung über die personellen Voraussetzungen für Fundraiser folgen sowie ein kurzer Exkurs zum Thema Qualitätsmanagement im Fundraising.
3.2.5. Personelle Voraussetzungen
Die Tätigkeiten von Fundraisern unterscheiden sich je nach Größe und Struktur der Organisationen. Die Ausbildung zum Fundraiser bestand bisher im deutschsprachigen Raum vor allem aus „learning by doing“, da entsprechende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten fehlten. Die Bildung der Fundraising-Akademie ist ein erster Schritt, um die Ausbildung und Fortbildung von Fachkräften zu fördern. Bisher war der Austausch von Informationen vor allem auf Kongresse und Zeitschriften beschränkt (vgl. HAIBACH 2001, S. 337).
Die personellen Voraussetzungen, die Fundraiser mitbringen sollten, sind:
- Persönlichkeitskompetenz
- Soziale und kommunikative Kompetenz
- Fachkompetenz
- Organisations- und Führungskompetenz (vgl. HAIBACH 2001, S. 106).
Je größer die Organisation und die entsprechende Fundraising-Abteilung, umso spezieller sind die auch Aufgabenstellungen der einzelnen Mitarbeiter.
Eine ausführliche Beschreibung über persönliche Voraussetzungen von Fundraisern findet sich im Handbuch der Fundraising Akademie.
3.2.6. Qualitätsmanagement im Fundraising
„ Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen “ (VON MIRBACH 2001, S. 344).
„ Qualitätsmanagement umfasst alle Techniken und organisatorischen Aufgaben, personellen Komponenten und Sachmittel zur Erfüllung der Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität“ (a.a.O., S. 344).
Verminderte Qualitätsstandards von Produkten führen zu sogenannten Fehlerfolgekosten. Hiermit sind alle Folgekosten gemeint, die aufgrund eines Fehlers entstehen, sei es bei der Behebung des oder der Fehler, sei es im Bereich des Image-Schadens z. B. Kündigung des Spendenauftrages oder seien es steuerrechtliche Folgen. Um diese zu vermeiden und vorangegangene Fehler nicht zu wiederholen bedarf es, wie im Punkt Zielorientierung angesprochen, der Kontrolle, der intensiven Planung und des Qualitätsmanagements. Das Qualitätsmanagement richtet sich nach innen und außen, es geht darum, möglichst effizient die richtigen Spender, mit der richtigen Kampagne zu erreichen. Effizienz im Einsatz des Fundraising ist sehr wichtig, da Fundraising sonst schnell zum Verlustgeschäft werden kann. Nach außen wird die Kommunikation mit Spendern und Förderern betrieben, um den Spendern Informationen über den Verbleib Ihrer Spenden zu geben, die Arbeitweise der NPO transparent zu machen und somit das Vertrauen in die Organisation zu vergrößern.
Um Qualitätsmessungen vornehmen zu können, müssen erst quantifizierbare und qualitative Messgrößen entwickelt oder von vergleichbaren Organisationen übernommen und modifiziert werden. Dies ist natürlich mit entsprechenden Kosten und einem oft abschreckenden Aufwand verbunden. Doch modernes Qualitätsmanagement sollte auf Fehlervermeidung ausgelegt sein, dies kommt auch der Qualitätssicherung entgegen (vgl. VON MIRBACH 2001, S. 344ff). Außerdem ist es für jede Organisation schwer, einen erst entstandenen Image-Schaden wieder zu beseitigen, und nicht jede Organisation kann, wie beispielsweise Daimler-Chrysler aus dem Elch- Test, eine Werbekampagne machen. Da sich Qualität auszahlt, ist sie kurzfristig betrachtet teuer, aber auf lange Sicht die billigere Variante.
4. Ausgewählte Fundraising-Methoden
Die folgenden Methoden stellen nur eine kleine Anzahl von Möglichkeiten dar, welche dem Fundraising zur Verfügung stehen. Einige hiervon könnten als „Klassiker“ bezeichnet werden, z. B. der Spendenbrief, den schon viele Menschen in Deutschland von einer Organisation bekommen haben. Wie die Adressen dieser Personen verwaltet werden, woher die Nonprofit-Organisationen Adressen beziehen und wie man mit den Spendern weiterhin umgeht, soll in diesem Kapitel im Hintergrund bleiben. Fundraising-Methoden werden von einer Vielzahl verschiedenartiger Organisationen in verschiedenen Ländern eingesetzt. Greenpeace, um nur ein Beispiel zu nennen, benutzt in 32 verschiedenen Ländern eine Vielzahl von Methoden, welche ursprünglich nur in den USA und Kanada eingesetzt wurden (vgl. SONNE 1997, S. 359f). Die Fundraising-Methoden sind, wenn sie entsprechend den Staaten und deren kulturellen Ansprüchen modifiziert wurden, in einer Vielzahl von Staaten und Kulturen einsetzbar. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass entsprechende Rahmenbedingungen in den Organisationen geschaffen werden, um erfolgreiches Fundraising betreiben zu können.
4.1. Spendenbrief (Mailings)
Der Spendenbrief wird vor allem von bundesweit agierenden Organisationen genutzt, um Spenden zu bekommen. Kleine, lokale Organisationen finden sich sehr selten darunter, obwohl die Bereitschaft zu spenden bei lokalen Einrichtungen viel größer ist, als bei anonymen Großorganisationen (vgl. HAIBACH 1997, S. 72). Dies kann zum einen damit zusammenhängen, dass der Kostenfaktor hoch ist, und zum anderen damit, dass der Streuverlust dieser Sendungen recht hoch sein kann. Um diese Streuverluste zu verringern empfiehlt es sich, verschiedene Punkte zu beachten, die hier erörtert werden sollen. Vor der Mailing-Aktion sollte der finanzielle Aufwand bedacht werden, da die Aktion geplant und vorfinanziert werden muss und erst dann evtl. ein Vielfaches der Gelder zurückfließt (vgl. SCHEIBE-JAEGER 1998, S. 110). Die Zielgruppenauswahl ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Mailings, die Ansprache, das Design und die unterschiedlichen Projekte, die angeboten werden wirken sich stark auf die Rückmeldungsrate aus. Des Weiteren ist zu bedenken, dass eine Verschickungsaktion pro Jahr nicht ausreicht. drei bis vier Briefaktionen über ein Jahr verteilt empfehlen sich, wobei es sich lohnt, für verschiedene Projekte oder Aktionen der Organisation zu werben. Die zeitliche Planung ist hierbei sehr wichtig, im Monat November werden unter Nutzung der Weihnachtsstimmung die meisten Mailings verschickt. Die anderen Termine sollten sich über das Jahr verteilen, wobei die Ferien- und Urlaubszeit eingeplant werden muss (vgl. HAIBACH 1997, S. 73). Laut SCHEIBE-JAEGER werden viele Entscheidungen für Kleinspenden am Wochenende getroffen, dies sollte natürlich beim Versand bedacht werden (vgl. SCHEIBE-JAEGER 1998, S. 107). Für Großspender wie Firmen ist dies nicht die geeignete Methode. Entsprechende Methoden zur Akquisition von Großspenden werden später dargestellt.
Das Mailing-Package beinhaltet mehrere Komponenten, welche aus dem Umschlag, Anschreiben, Zahlungsträger und sonstigen Beilagen, z. B. Infoblätter über den Sinn und Zweck der Organisation, besteht (vgl. HAIBACH 1997, S. 73). Zur Gestaltung empfiehlt es sich, auf moderne werbepsychologische Grundlagen zurückzugreifen, auch wenn dies von Vertretern des nichtkommerziellen Bereichs häufig kritisiert wird (vgl. SCHEIBE-JAEGER 1998, S. 108). Nur sollte sich der Fundraiser der Werbeflut bewusst sein, die tagtäglich auf die potentiellen Spender einströmt und sich fragen wie er diese erreichen kann. Der Umschlag sollte zum Aufmachen einladen und nicht zum Wegwerfen, dies kann z. B. erreicht werden durch einen dem Empfänger bekannten Absender oder durch handschriftliche Umschläge, was allerdings einen entsprechenden logistischen, wie auch finanziellen Aufwand (Porto) darstellt. Das wichtigste Schriftstück im Spendenbrief ist das Anschreiben. An diesem entscheidet sich innerhalb kürzester Zeit, ob der Empfänger das Mailing positiv oder negativ beurteilt. Für die Formulierung von Spendenbriefen gibt es kein Patentrezept, da die Nonprofit-Organisationen viel zu verschiedenartige Ziele verfolgen. Die Personalisierung, also eine korrekte, persönliche Anrede, erhöht die Responsrate im Verhältnis zu Briefen mit einer allgemeinen unpersönlichen Anrede. Wenn die Person schon länger als Spender bekannt ist oder die unterschreibende Person persönlich kennt, kann sich eine unpersönliche Anrede gar negativ auswirken (vgl. HAIBACH 1997, S. 73). Wichtig ist des weiteren die Struktur des Briefes, die Überschrift wird als erstes wahrgenommen und sollte daher kurz und prägnant formuliert sein, außerdem soll sie den potentiellen Spender zum Weiterlesen motivieren. Es können Geschichten, dramatische Eröffnungen, Ängste oder Visionen sein, die den Brief einleiten, wichtig ist hierbei, dass diese mit optischen Anreizen verstärkt und klare ansprechende Strukturen im Anschreiben geschaffen werden. Dies kann mittels Fettdruck, Unterstreichen und durch eine ansprechende Gliederung geschehen. Die Ängste oder Geschichten sollten nicht in Hoffnungslosigkeit enden, denn dies fördert nicht die Spendenmotivation, vielmehr sollten die Lösungen und Visionen zur Veränderung als Hoffnung und Möglichkeit dargestellt werden, welche mit Hilfe des Spenders verwirklicht werden können. Dem Spender muss vermittelt werden, dass er gebraucht wird, um dass geplante Projekt umzusetzen und dass jede noch so geringe Unterstützung ihn zu einer teilhabenden Person macht. Hierfür ist es notwendig einen einfachen, klaren und einheitlichen Schreibstil ohne Schachtelsätze zu verwenden. Der Brief sollte eine Länge von ein bis zwei Seiten haben (vgl. HAIBACH 1997, S. 73f).
Inhaltlich sollten folgende Punkte abgeklärt werden:
- Welche Organisation, welcher Verein steht hinter diesem Anschreiben?
- Warum wird der Spender angesprochen?
- Wofür wird das Geld gesammelt?
- Was hat die Organisation konkret mit den Spenden vor?
- Wie wird das Spendengeld verwaltet?
- Wie kann der Spender erfahren, was aus der Aktion geworden ist?
- Welcher Gesamtbetrag wird benötigt und wie viel soll der Spender mindestens spenden?
- Was hat der Spender davon, wenn er spendet? (vgl. SCHEIBE-JAEGER 1998, S. 109).
Der potentielle Spender sollte das Gefühl vermittelt bekommen, etwas Gutes mit seinem Geld tun zu können. Früher wurden hierfür emotionale Verstärker genutzt. Dies wurde von den Organisationen jedoch so stark ausgereizt, dass es heute üblich ist, Informationen zu präsentieren und die Gefühle der Spender sehr bedacht anzusprechen. Eine weitere Komponente des Mailing-Package ist der Zahlungsträger, welcher die Funktion eines Response-Elementes (Reaktionsmittels) inne hat. Dieser sollte wie das Anschreiben mit der korrekten Anschrift des Empfängers versehen werden. Beilagen können z. B. Broschüren, Aufkleber, Bilder oder Kopien sein. Hier ist es wichtig, das Gewicht des Mailing-Package im Auge zu behalten, um die Kosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben (vgl. SCHEIBE-JAEGER 1998, S. 116).
4.2. Haus- und Straßensammlungen
Diese Formen der Spendenakquisition sind in den meisten Bundesländern mit Hilfe von Sammlungsgesetzen geregelt und müssen rechtzeitig bei den entsprechenden Behörden angemeldet werden. Die zuständigen Behörden für die Genehmigung von Haustürsammlungen variieren je nach Bundesland, vom Ordnungsamt über die Stadt- oder Kreisverwaltungen bis zum Innenministerium des Landes. Es ist sinnvoll, sich im Voraus über die jeweiligen Bestimmungen zu informieren. Der entsprechende Zeitraum wird nach Antragstellung von den Behörden zugeteilt und beträgt eine bis maximal zwei Wochen. Die Spendensammler sollten sich nicht aus Angehörigen von Drückerkolonnen oder professionellen Haustürverkäufern zusammensetzen, welche teilweise Überrumpelungstaktiken verwenden, um Mitgliedschaften zu verkaufen und dem Ruf der Organisation evtl. mehr schaden, als die Aktion im Positiven bewirken kann (vgl. FABISCH 2002, S. 173). Was die Sammler bei Haus- und Straßensammlungen angeht, sind verschiedene Gesetzesvorschriften hinsichtlich des Alters und der entsprechenden Beaufsichtigung der minderjährigen Sammler zu beachten. Bei Haussammlungen werden die möglichen Spender in ihren Häusern, Wohnungen oder in Ladengeschäften aufgesucht und um eine Spende gebeten. Diese Methode eignet sich sehr gut für kleinere Organisationen, um im eigenen Umfeld den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und neue Kontakte zu knüpfen. Deshalb lohnt es sich, in einem Seminar den Spendensammlern und deren Führungspersonen eine Schulung über den Inhalt der Organisationsarbeit sowie über richtiges spendenförderndes Verhalten zu erteilen. Wichtig ist, dass die Spendensammler, wenn sie nicht bezahlt werden und diese Tätigkeit ehrenamtlich vollziehen, ein Dankeschön erhalten. Wie immer lohnt es sich im Vorfeld, Public Relation zu betreiben, um die Bevölkerung auf die Sammlungen vorzubereiten. Um Verärgerung bei den Spendern zu vermeiden ist es sinnvoll die Sammelgebiete im Voraus aufzuteilen. Die Spendenlisten müssen durchnummeriert werden, aus den Listen muss die Art und Zeit der Sammlung ersichtlich sein, das Sammlungsgebiet, die Telefonnummer und Adresse des Veranstalters sind in der Kopfleiste aufzuführen. In die Spendenliste muss jeder Betrag eingeschrieben werden, wobei der Spender durchaus anonym bleiben kann. Es kann hilfreich sein, für Spender und Sammler dies auf der Spendenliste zu vermerken. Die Liste muss mit einem dokumentenechten Schreibgerät geführt werden. Die Sammler müssen einen Sammlerausweis mit sich führen und ein entsprechendes Ausweisdokument (Ausweis, Führerschein). Dieser Sammlerausweis ist nach den Verwaltungsvorschriften mit folgenden Daten zu füllen:
- Personaldaten des Sammlers
- Angaben über Zweck, Ort und Zeit der Sammelaktion
- Bezeichnung der Erlaubnisbehörde, mit dem entsprechenden Aktenzeichen
- Die Anschrift des Veranstalters
Es ist sinnvoll, ein Passfoto einzufügen und die Ausweise fortlaufend zu nummerieren. Der Ausweis sollte erkennbar getragen werden, z. B. um den Hals. Diese Ausweise muss der Veranstalter wieder einziehen und ein Jahr nach Prüfung der Abrechnung durch die Erlaubnisbehörde aufbewahren. Die Spender können mit einer Dankgabe bedacht werden, was nicht zwingend notwendig ist, jedoch eine weitere Möglichkeit der Werbung bietet, z. B. in Form einer Postkarte mit schönem Motiv oder in Form eines Kugelschreibers mit dem Logo der Organisationl(vgl. HOLZHAUER 2001, S. 804ff).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832498535
- ISBN (Paperback)
- 9783838698533
- DOI
- 10.3239/9783832498535
- Dateigröße
- 457 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Kiel – Soziale Arbeit und Gesundheit
- Erscheinungsdatum
- 2006 (September)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- social marketing fundraising sponsoring akquise ngos
- Produktsicherheit
- Diplom.de