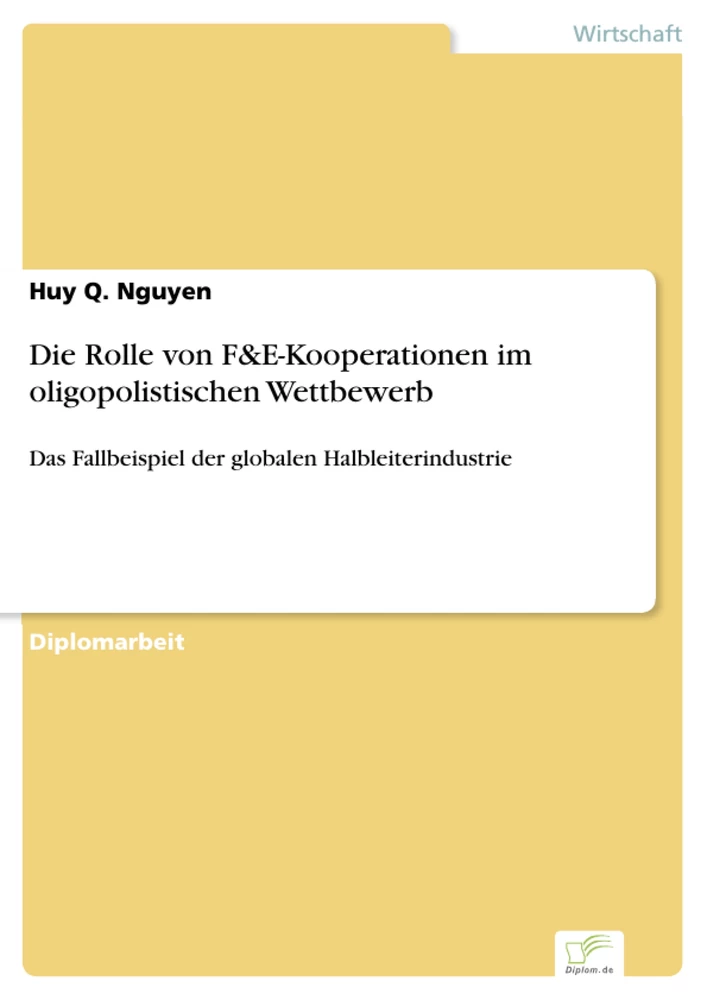Die Rolle von F&E-Kooperationen im oligopolistischen Wettbewerb
Das Fallbeispiel der globalen Halbleiterindustrie
Zusammenfassung
Innovationen gelten als die Grundlage für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen sowie gesamter Volkswirtschaften. Durch neue Produkte und Prozesse gewinnt das innovative Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Für eine Volkswirtschaft sind Innovationen eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und damit Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen. Um Innovationen zu generieren sind Investitionen in die Forschung und Entwicklung (F&E) nötig. Gerade wegen der hohen Bedeutung von neuen Technologien für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sollte der F&E-Prozess besonders gut geschützt werden. D.h. intuitiv wäre eine Abschottung der eigenen F&E-Aktivität gegenüber Konkurrenten eine logische Konsequenz. Doch in dieser Hinsicht hat sich in den vergangenen zwei Dekaden ein neuer Trend entwickelt. Entgegen der Intuition sind immer mehr Unternehmen bereit ihre F&E gemeinschaftlich - selbst mit Konkurrenten - durchzuführen und ihr Wissen miteinander zu teilen.
Hagedoorn (2002) hat in seiner empirischen Studie festgestellt, dass seit Beginn der 80er Jahre die Anzahl der F&E-Kooperationen drastisch angestiegen ist. Besonders auffällig ist, dass vor allem in den forschungsintensiven Industrien wie z.B. dem IT-Sektor sich die gemeinschaftliche Forschung immer stärker durchsetzt. Das ist insofern überraschend, da in diesen Industrien Innovationen eine weitaus größere Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit spielen als z.B. in Sektoren mit einer geringen Forschungsintensität. Man würde vermuten, dass im IT-Sektor neue Technologien noch stärker vor der Konkurrenz abgeschirmt werden als anderswo.
Eine andere Auffälligkeit diesbezüglich ist auch in der Wirtschaftspolitik verschiedener Staaten zu erkennen. Fast parallel mit dem Trend zu F&E-Kooperationen hat das staatliche Engagement in der Förderung von kollaborativer Forschung zugenommen. In den großen Industrieländern haben die Regierungen begonnen, mit verschiedenen wirtschaftspolitischen Instrumenten (wie z.B. Gesetzesänderungen oder Subventionen) F&E-Kooperationen massiv voranzutreiben. Gegeben diesen zunächst erstaunlichen Entwicklungen stellt sich die Frage nach dem Warum. Welche Motive können die Unternehmen haben, die F&E zusammen mit ihren Konkurrenten zu betreiben? Und welches Interesse hat der Staat daran, solche F&E-Kooperationen noch zu unterstützen? Ohne zuviel vorwegzunehmen, spielen Spillover eine wichtige Rolle […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung
1 Spillover und das Anreizproblem
1.1 Definition und Formen von Spillover
1.2 Darstellung des Anreizproblems
1.3 Empirische Ergebnisse
1.4 Implikationen für die Wirtschaftspolitik
2 Forschungs- und Entwicklungskooperationen
2.1 Begriff und Klassifikation von F&E-Kooperationen
2.2 Einige stilisierte Fakten
2.3 Motive
2.4 Ökonomische Modelle zu F&E-Kooperationen
2.4.1 Das Standardmodell von d´Aspremont und Jacquemin (1988)
2.4.2 Das Modell von Kamien, Muller und Zang (1992)
2.4.3 Modelle mit endogenen Spillover
2.4.4 Die Bedeutung der Absorbtionsfähigkeit
2.4.5 Inter-industrielle Spillover
2.4.6 F&E-Kooperationen und Subventionen
3 Fallbeispiel Halbleiterindustrie
3.1 Entwicklung und Bedeutung der Halbleiterindustrie
3.2 Charakteristika und Marktstruktur
3.3 Nationale Wirtschaftspolitik und Halbleiterindustrie
3.4 Beispiele von F&E-Kooperationen in der globalen Halbleiterindustrie
3.4.1 Japan: VLSI-Projekt
3.4.1.1 Hintergrund der Entstehung
3.4.1.2 Aufbau und Ziele
3.4.1.3 Bewertung und Perspektiven
3.4.2 USA: SEMATECH
3.4.2.1 Ausgangssituation
3.4.2.2 Aufbau und Entwicklung
3.4.2.3 Bewertung und Empirische Ergebnisse
3.4.3 Europa: ESPRIT
3.4.3.1 Hintergrund
3.4.3.2 Aufbau und Ziele
3.4.3.3 Bewertung
3.4.4 Vergleich der F&E-Kooperationen
4 Schlußbetrachtung
5 Literaturverzeichnis
6 Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1-1: Privater und gesellschaftlicher (sozialer) Nutzen der F&E (I)
Abbildung 1-2: Privater und gesellschaftlicher (sozialer) Nutzen der F&E (II)
Abbildung 1-3: Privates und Soziales Optimum an F&E-Ausgaben
Abbildung 2-1: Entwicklung der F&E-Kooperationen (1960-1998)
Abbildung 2-2: Anteil der Sektoren an allen F&E-Kooperationen (1960-1998)
Abbildung 2-3: Spielstruktur von d`Aspremont und Jacquemin (1988)
Abbildung 2-4: F&E-Einsatz bei Wettbewerb und Kooperation
Abbildung 2-5: Gewinne bei F&E-Wettbewerb und bei Kooperation
Abbildung 2-6: Spielstruktur von Kultti und Takalo (1998)
Abbildung 2-7: Spielstruktur von Kamien und Zang (2000)
Abbildung 2-8: Spielstruktur von Steurs (1995)
Abbildung 2-9: Spielstruktur von Hinloopen (1997)
Abbildung 3-1: Marktanteile bei der Halbleiterproduktion, 1980-1997
Abbildung 3-2: Organisationsstruktur des VLSI-Konsortiums
Abbildung 3-3: Verflechtungen der 12 großen IT-Firmen durch Esprit (1.Phase)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2-1: Motive für F&E-Kooperationen in High-Tech-Industrien
Tabelle 2-2: Szenarien bei d`Aspremont und Jacquemin (1988)
Tabelle 2-3: Szenarien bei Kamien, Muller und Zang (1992) (I)
Tabelle 2-4: Szenarien bei Kamien, Muller und Zang (1992) (II)
Tabelle 2-5: Szenarien bei Poyago-Thetoky (1999) (I)
Tabelle 2-6: Szenarien bei Poyago-Thetoky (1999) (II)
Einleitung
Innovationen gelten als die Grundlage für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen sowie gesamter Volkswirtschaften. Durch neue Produkte und Prozesse gewinnt das innovative Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz. Für eine Volkswirtschaft sind Innovationen eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und damit Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen.
Um Innovationen zu generieren sind Investitionen in die Forschung und Entwicklung (F&E) nötig. Gerade wegen der hohen Bedeutung von neuen Technologien für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sollte der F&E-Prozeß besonders gut geschützt werden. D.h. intuitiv wäre eine Abschottung der eigenen F&E-Aktivität gegenüber Konkurrenten eine logische Konsequenz.
Doch in dieser Hinsicht hat sich in den vergangenen zwei Dekaden ein neuer Trend entwickelt. Entgegen der Intuition sind immer mehr Unternehmen bereit ihre F&E gemeinschaftlich - selbst mit Konkurrenten - durchzuführen und ihr Wissen miteinander zu teilen.
Hagedoorn (2002) hat in seiner empirischen Studie festgestellt, daß seit Beginn der 80er Jahre die Anzahl der F&E-Kooperationen drastisch angestiegen ist. Besonders auffällig ist, daß vor allem in den forschungsintensiven Industrien wie z.B. dem IT-Sektor sich die gemeinschaftliche Forschung immer stärker durchsetzt. Das ist insofern überraschend, da in diesen Industrien Innovationen eine weitaus größere Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit spielen als z.B. in Sektoren mit einer geringen Forschungsintensität. Man würde vermuten, daß im IT-Sektor neue Technologien noch stärker vor der Konkurrenz abgeschirmt werden als anderswo.
Eine andere Auffälligkeit diesbezüglich ist auch in der Wirtschaftspolitik verschiedener Staaten zu erkennen. Fast parallel mit dem Trend zu F&E-Kooperationen hat das staatliche Engagement in der Förderung von kollaborativer Forschung zugenommen. In den großen Industrieländern haben die Regierungen begonnen, mit verschiedenen wirtschaftspolitischen Instrumenten (wie z.B. Gesetzesänderungen oder Subventionen) F&E-Kooperationen massiv voranzutreiben.
Gegeben diesen zunächst erstaunlichen Entwicklungen stellt sich die Frage nach dem Warum. Welche Motive können die Unternehmen haben, die F&E zusammen mit ihren Konkurrenten zu betreiben? Und welches Interesse hat der Staat daran, solche F&E-Kooperationen noch zu unterstützen?
Ohne zuviel vorwegzunehmen, spielen Spillover eine wichtige Rolle für die Entstehung von F&E-Kooperationen. Das wird ein zentraler Aspekt im theoretischen Teil dieser Arbeit sein. Anhand verschiedener spieltheoretischer Modelle werden die Anreize zur Bildung sowie die Auswirkung von F&E-Kooperationen auf den Wettbewerb analysiert.
Im praktischen Teil dieser Arbeit werden die F&E-Kooperationen an einem konkreten Beispiel untersucht. Die Halbleiterindustrie bietet sich deshalb so gut als Fallbeispiel an, da sie als eines der dynamischsten und forschungsintensivsten Industrien gilt. Zudem wird ihr häufig die Rolle einer so genannten Schlüsselindustrie zugesprochen, d.h. einer Industrie, die mit ihren Produkten den Erfolg vieler weiterer Industrien beeinflußt[1].
Ein weiterer Grund für diese Wahl ist, daß in den vergangenen zwei Jahrzehnten gerade in der Halbleiterindustrie die umfangreichsten F&E-Kooperationen mit staatlicher Unterstützung entstanden sind. Anhand von drei ausgewählten Beispielen soll daher geklärt werden, welche Rolle F&E-Kooperationen für den Wettbewerb in der Halbleiterindustrie gespielt haben.
Diese Arbeit ist wie folg organisiert: Im ersten Abschnitt nehmen wir uns das Thema der Spillover an. Es werden zunächst verschiedene Formen von Spillover vorgestellt und anschließend erläutert, welche Auswirkung sie auf das F&E-Verhalten der Unternehmen haben und warum sie Probleme für die Volkswirtschaft auslösen können (Abschnitt 1.2). Dann wird geklärt, welche Mittel die Wirtschaftspolitik zur Verfügung hat, um diese Probleme anzugehen (Abschnitt 1.4).
Im zweiten Abschnitt werden die F&E-Kooperationen behandelt. Nach einer Definition und einigen empirischen Befunden, werden die unterschiedlichen Motive erörtert, die für die Bildung einer gemeinschaftlichen Forschung in Frage kommen. Anschließend werden F&E-Kooperationen anhand verschiedener Modelle spieltheoretisch analysiert (Abschnitt 2.4). Es soll insbesondere geklärt werden, unter welchen Bedingungen es aus einzel- und gesamtwirtschaftlicher Sicht vorteilhaft ist, F&E-Kooperationen einzugehen bzw. zuzulassen. Ausgehend von dem Standardmodell von d´Aspremont und Jacquemin (1988) werden in den darauf folgenden Modellen jeweils unterschiedliche Aspekte, wie z.B. die Endogenisierung der Spillover (Abschnitt 2.4.3), Absorptionsfähigkeit (Abschnitt 2.4.4) oder Subventionen (Abschnitt 2.4.6), in der Analyse fokussiert. Es wurde versucht, Modelle mit einer ähnlichen Konstruktionsweise zu finden, um eine – wenn auch nicht in jedem Fall mögliche – Vergleichbarkeit herzustellen.
Nach der theoretischen Analyse wenden wir uns dem Praxisbeispiel zu. Zunächst werden die historische Entwicklung sowie die Charakteristika der globalen Halbleiterindustrie vorgestellt (Abschnitt 3.1 und 3.2). Dann wird die spezielle Beziehung zwischen dieser Industrie und der nationalen bzw. regionalen Wirtschaftpolitik erklärt (Abschnitt 3.3). Es folgen eine Untersuchung sowie ein anschließender Vergleich der drei großen F&E-Kooperationen in den wichtigen Regionen der Halbleiterindustrie, d.h. in Japan (Abschnitt 3.4.1), USA (Abschnitt 3.4.2) und Europa (Abschnitt 3.4.3). Diese Arbeit endet mit einer Schlußbetrachtung, in der die Ergebnisse kurz zusammengefaßt und ein Ausblick gegeben wird.
1 Spillover und das Anreizproblem
1.1 Definition und Formen von Spillover
In der neoklassischen Wachstumstheorie wurde gezeigt, daß das Wachstum einer Volkswirtschaft nicht nur durch physische Ressourcen wie Arbeit und Realkapital bestimmt wird, sondern insbesondere auch durch ihre technologische Entwicklung, d.h. durch Innovationen bzw. technischen Fortschritt[2]. Dabei umfasst der Begriff „technischer Fortschritt“ unterschiedliche Formen von Innovationen. Bei Produktinnovationen werden neue oder verbesserte Produkte geschaffen. Prozeßinnovationen hingegen betreffen die Entwicklung von neuen oder verbesserten Produktionstechniken, die zu einer Senkung der Kosten im Produktionsprozeß führen.
In diesem Zusammenhang spielt die Forschung und Entwicklung (F&E) eine bedeutende Rolle, weil sie neues technisches Wissen schafft. Investitionen in F&E sind somit notwendig, um die technologische Entwicklung und damit das Wirtschaftswachstum voranzutreiben.
Unternehmen investieren in F&E, um Innovationen zu gewinnen, die ihnen einen komparativen Vorteil im Wettbewerb verschaffen.
F&E-Investitionen besitzen die Eigenschaft - und das unterscheidet sie von anderen Investitionsarten - daß ihre Ergebnisse in den meisten Fällen auch von anderen Marktteilnehmern unentgeltlich genutzt werden können. In der F&E entstehen also Spillover, d.h. das neue Wissen selbst oder der daraus entstandene Nutzen, kann anderen Marktteilnehmern zufließen. Diese positiven Externalitäten der F&E-Tätigkeit sorgen dafür, daß andere - sei es z.B. direkte Konkurrenten, Zulieferer oder Kunden - von dem neu geschaffenen Wissen profitieren, ohne daß diese einen Preis entrichten, der ihre tatsächliche Zahlungsbereitschaft zum Ausdruck bringt[3]. Spillover verursachen somit ein typisches „Trittbrettfahrer“ (Free-Rider)-Problem.
Im Folgenden wird eine Klassifikation der Spillover vorgenommen, die stark an die von Jaffe (1998) und Pfähler und Bönte (1996) angelehnt ist.
Jaffe unterscheidet zwischen drei Formen von Spillover: Market Spillover, Knowledge Spillover und Network Spillover[4].
Market Spillover betreffen nicht den direkten Wissensfluß selbst, sondern vielmehr den Nutzen, der aus der F&E-Tätigkeit entsteht und anderen Marktteilnehmern zugute kommt. Wenn ein Unternehmen z.B. ein neues Produkt herstellt, wird es am Markt in der Regel zu einem Preis verkauft, der nicht den vollen Qualitäts- bzw. Nutzenzuwachs dieser Innovation widerspiegelt. D.h. die Konsumenten dieser Produktinnovation werden einen Preis bezahlen, der geringer ist als ihre tatsächliche Zahlungsbereitschaft und erhalten somit einen Zuwachs an Konsumentenrente. Die Innovation hat also zu einer Erhöhung der sozialen Wohlfahrt geführt, die der Innovator sich nicht vollständig aneignen konnte. Ein starker Wettbewerb im Produktmarkt beispielsweise kann verhindern, daß der Innovator einen ausreichend hohen Preis verlangen kann[5].
Aus denselben Gründen wird der Innovator auch bei einer Prozeßinnovation Schwierigkeiten haben, die gesamte Kostenersparnis für sich zu behalten. Demnach kann eine Innovation dazu führen, daß der Innovator nur einen Teil des Nutzens aus seiner F&E-Tätigkeit abschöpfen kann, während der Restnutzen den Konsumenten des Produktes zufließt.
Griliches (1992) bezeichnete diese Form von Spillover als „pekuniäre“ Externalitäten, die entstehen, weil der Preis eines Produktes nicht um seine Qualitätsänderung angepaßt wurde[6]. Griliches bemerkt hierzu: „…R&D intensive inputs are purchased from other industries at less than their full “quality” price […]. But these are not real knowledge spillovers. They are just a consequence of conventional measurement problems.”[7]
Knowledge Spillover dagegen sind nicht an ein bestimmtes Produkt gebunden. Es handelt sich hierbei um technisches Wissen, daß im F&E-Prozeß entsteht und ohne entsprechende Gegenleistung zu anderen Marktteilnehmern gelangt. Diese können das Wissen nutzen, um entweder die Produkte und Prozesse des Innovators zu imitieren oder es als ein Produktionsfaktor für die Entwicklung anderer Technologien verwenden[8]. D.h. Knowledge Spillover sorgen dafür, daß durch die eigene F&E-Tätigkeit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten verbessert wird. Somit besitzt das technische Wissen die Eigenschaften der Nicht-Rivalität und der Nicht-Ausschließbarkeit und weist Merkmale eines öffentlichen Gutes auf. Im Unterschied zu Market Spillover, die erst durch die Vermarktung eines Produktes entstehen und sich letztendlich über den Marktpreis offenbaren, treten Knowledge Spillover bereits der F&E-Phase einer Wertschöpfungskette auf und können sich über eine Vielzahl von Kanälen ausbreiten.
Für eine grobe Unterteilung wird hier zwischen unbeabsichtigten Knowledge Spillover, also das unfreiwillige Teilen von Wissen, und beabsichtigten Knowledge Spillover, das freiwillige Teilen von Wissen, differenziert.
Als Kanal für den unbeabsichtigten Wissenstransfer kann z.B. das „Reverse Engineering“ dienen; eine Methode, die in der Halbleiterindustrie häufig Anwendung fand. Dabei wird z.B. ein Mikroprozessor eines Konkurrenten zerlegt und dessen Bestandteile analysiert, um an die inhärente Technologie zu gelangen. Weitere Kanäle sind die Lizenzierung von Technologien, die Offenlegung von Patenten, die Veröffentlichung von Technologien in wissenschaftlichen Fachzeitschriften oder auf Konferenzen, das Abwerben von Mitarbeitern eines Innovators oder die informelle Kommunikation zwischen Mitarbeitern verschiedener Unternehmen[9]. Ein weniger offensichtlicher Wissenstransfer findet statt, wenn z.B. ein Unternehmen ein angefangenes Forschungsprojekt abbricht und damit signalisiert, daß dieser Forschungspfad nicht produktiv ist. So können Unternehmen aus den Fehlern anderer lernen und ersparen sich entsprechende Kosten.
Bei den beabsichtigten Knowledge Spillover können formelle, also durch Vertrag gebundene, F&E-Kooperationen wie Research Joint Ventures (RJV) oder informelle, nicht vertragliche, Kooperationen als Kanäle für den Wissenstransfer dienen.
Weiterhin können Knowledge Spillover eingeteilt werden in einseitige, d.h. das Wissen fließt nur in eine Richtung von einem Unternehmen zum anderen[10], und wechselseitige Spillover, d.h. der Empfänger von Wissen ist gleichzeitig ein Sender[11]. Spillover können zwischen Unternehmen nur innerhalb einer Industrie auftreten (intra-industrielle Spillover) oder zwischen Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien (inter-industrielle Spillover)[12]. Werden geografische Aspekte miteinbezogen, ergeben sich intra-nationale (Spillover innerhalb der geografischen Grenzen eines Landes) und internationale Spillover (z.B. der Wissensfluß von US-amerikanischen zu japanischen Unternehmen)[13].
In manchen Arbeiten zu diesem Thema wird auch zwischen Input und Output Spillover differenziert. Während bei der erstgenannten Form das Wissen in der F&E-Phase, aber noch vor der eigentlichen Innovation abfließt, findet der Wissenstransfer bei Output Spillover erst nach Entdeckung der neuen Technologie statt[14]. D.h. Output Spillover führen (im Fall einer Prozeßinnovation) unmittelbar zu einer Kostensenkung des Empfängers.
Das Ausmaß der Wissensübertragung hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z.B. der Art der Forschung (Grundlagen- versus angewandte Forschung oder Produkt- versus Prozeßinnovation) oder der Marktstruktur der Industrie. Eine weitere wichtige Determinante für die Höhe der Spillover ist auch die Absorbtionsfähigkeit des Empfängers[15].
1.2 Darstellung des Anreizproblems
In dem vorangegangenen Abschnitt wurde das Phänomen der Spillover dargestellt und gezeigt, daß Unternehmen aufgrund des Auftretens dieser positiven Externalitäten Schwierigkeiten haben, sich die Ergebnisse ihrer F&E vollständig anzueignen. Nun soll gezeigt werden, welche Auswirkungen Spillover auf das F&E-Verhalten von Unternehmen haben und welche volkswirtschaftlichen Probleme sich daraus ergeben können.
Wenn ein Unternehmen vor der Entscheidung steht, ob und wie viel es in F&E investiert, dann richtet es sich zuallererst nach seinem privaten Nutzen (private return)[16] der Investition, also dem Ertrag, der ihm als Ergebnis seiner F&E-Tätigkeit direkt zufließt. Da aber während der F&E Spillover auftreten, und andere Marktteilnehmen ebenfalls von Forschungsergebnissen profitieren, muß der gesellschaftliche Nutzen (social return) der F&E größer sein der private. Zwei Effekte bestimmen demnach das Ausmaß des gesellschaftlichen Nutzens: der direkte Effekt, d.h. den Ertrag, den das forschende Unternehmen erhält, und der indirekte (Spillover-) Effekt, also den Ertrag, den die Nutznießer der F&E-Tätigkeit bekommen[17]. Anhand der Abbildung 1-1 soll die Situation verdeutlich werden:
Ein Unternehmen (Firma 1) investiert in F&E und generiert neues Wissen, das ihm ermöglicht, bessere Produkte herzustellen (Produktinnovation) und/oder die Produktionskosten zu senken (Prozeßinnovation). Aufgrund des Wettbewerbs auf dem Produktmarkt wird Firma 1 nicht in der Lage sein, einen Preis zu fordern, der den gesamten Nutzenzuwachs seiner Innovation widerspiegelt. Es treten also Market Spillover auf; die Kunden von Firma 1 erhalten einen zusätzlichen Nutzen bzw. eine zusätzliche Konsumentenrente in Form einer höheren Qualität oder eines niedrigeren Produktpreises. Gleichzeitig entstehen auch Knowledge Spillover; das neue Wissen kann entweder direkt nach dessen Entstehung zu anderen Unternehmen abfließen oder diese können durch Beobachtung der Innovationen an neues Wissen gelangen[18]. In Abbildung 1-1 wird zunächst angenommen, daß es sich hierbei um „reine“ (pure) Knowledge Spillover[19] handelt, d.h. das Wissen gelangt zu Unternehmen, die sich nicht in derselben Industrie wie Firma 1 befinden und somit keine Konkurrenten sind. Diese können das von Firma 1 geschaffene Wissen nutzen, um ihrerseits Innovationen herzustellen, die wiederum zu Market Spillover und zu zusätzlichen Gewinnen - diesmal aber auf anderen Märkten - führen. Somit besteht der direkte Effekt der F&E-Tätigkeit von Firma 1 lediglich aus seinem Gewinn; der indirekte (Spillover-) Effekt dagegen setzt sich zusammen aus dem zusätzlichen Nutzen der Kunden von Firma 1 (Market Spillover auf dem Markt von Firma 1) , den Gewinnen der Unternehmen, die das Wissen von Firma 1 nutzen und den Nutzen derer Kunden (Knowledge und Market Spillover auf anderen Märkten).
Abbildung 1-1: Privater und gesellschaftlicher (sozialer) Nutzen der F&E (I)
Quelle: Jaffe (1998), S.13
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bernstein und Nadiri (1989) resümieren: „The existence of R&D spillovers implies that the social and private rates of return to R&D capital differ.”[20]
Spillover treiben also einen Keil zwischen dem privaten und dem gesellschaftlichen Nutzen der F&E; es entsteht ein so genannter Spillover Gap.
Die Lücke zwischen den privaten und gesellschaftlichen Nutzen der F&E wird noch vergrößert, wenn es sich nicht nur um „reine“ Knowledge Spillover handelt, sondern das Wissen jetzt auch zu Unternehmen gelangt, die auf denselben Markt wie Firma 1 agieren (intra-industrielle Knowledge Spillover), also direkte oder potentielle Konkurrenten sind (siehe Abbildung 1-2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1-2: Privater und gesellschaftlicher (sozialer) Nutzen der F&E (II)
Quelle: Jaffe (1998), S.13
D.h. die F&E-Tätigkeit der Firma 1 führt dazu, daß z.B. die Kosten der Konkurrenten gesenkt und damit deren Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird. Der Wettbewerb auf dem Markt wird verstärkt und folglich fällt der Gewinn von Firma 1. Während die „reinen“ (inter-industriellen) Knowledge Spillover den gesellschaftlichen Nutzen steigern ohne dabei den privaten Nutzen zu schmälern, führen intra-industrielle Knowledge Spillover tatsächlich zu einer Minderung der Gewinne von Firma 1. Durch F&E hat Firma 1 hat nicht nur Nutzen generiert, den sie sich nicht aneignen kann; hinzu kommt, daß durch das Auftreten von intra-industriellen Knowledge Spillover die F&E-Tätigkeit jetzt einen direkten negativen Effekt auf den Gewinn des Innovators hat. Das Aneignungsproblem wird somit verschlimmert.
Mansfield et al. (1977) identifizieren drei wichtige Faktoren, die die Höhe des Spillover Gaps beeinflussen können[21]: die Marktstruktur der Industrie (z.B. Wettbewerbsintensität), das Ausmaß der Innovation (bedeutende oder geringfügige Innovation) und die Art der Innovation (Prozeß- oder Produktinnovation). Demnach wird der Innovator bei einer hohen Wettbewerbsintensität größere Schwierigkeiten haben, sich große Teile des Nutzens anzueignen[22]. Ein ähnliches Ergebnis tritt ein, wenn es sich um eine bedeutende Innovation handelt. Der Grund hierfür ist, daß bedeutende Innovationen i.d.R. schneller erkannt und imitiert werden und der Wettbewerbsdruck auf dem Innovator folglich erhöht wird. Diese Zustände würden nach Mansfield et al. zu einer Zunahme des Spillover Gaps führen[23].
Wie sich die Diskrepanz zwischen dem privaten und gesellschaftlichen Nutzen auf das F&E-Verhalten der Unternehmen auswirkt soll anhand der Abbildung 1-3 gezeigt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1-3: Privates und soziales Optimum an F&E-Ausgaben
Quelle: Hall (1995), Fig. 1
Unter der Annahme, daß die F&E-Investitionen abnehmende Grenzerträge aufweisen, ergeben sich negativ geneigte Grenznutzen-Kurven. Weiter soll angenommen werden, daß die Grenzkosten mit Zunahme der F&E-Tätigkeit ansteigen. Ein Unternehmen, daß eine Anzahl an F&E-Projekten zur Auswahl hat, wird zunächst das Projekt mit dem höchsten Ertrag durchführen und dann seine F&E so weit ausdehnen, bis der Grenznutzen mit den Grenzkosten seiner F&E-Tätigkeit übereinstimmt[24] (siehe Punkt A). Weil das Unternehmen sich an seinem privaten Nutzen orientiert, wird es in die für ihn optimale F&E-Menge Xpriv investieren. Da, wie bereits oben angeführt, durch das Auftreten positiver externer Effekte der soziale Nutzen größer ist als der private, ergibt sich im sozialen Gleichgewicht (Punkt B) die optimale Menge Xsoz, wobei gilt Xpriv < Xsoz. D.h. im privaten Optimum wird im Vergleich zum sozialen Optimum zu wenig in F&E investiert. Es kommt zu einer Unterinvestition in F&E; die Forschungsausgaben sind gesellschaftlich suboptimal.
Das (Anreiz-) Problem besteht also darin, daß Unternehmen im Wettbewerb aufgrund der Spillover und des daraus resultierenden Free-Rider-Problems keinen Anreiz haben, die gesellschaftlich optimale Menge an F&E zu investieren.
1.3 Empirische Ergebnisse
Es gab in der Vergangenheit eine Reihe von Autoren, die anhand von Fallstudien versucht haben, Spillover empirisch nachzuweisen und den privaten und gesellschaftlichen Nutzen quantitativ oder qualitativ zu bestimmen. Obwohl bei den Untersuchungen etliche Schwierigkeiten auftraten - sei es das Problem, einen adäquaten Proxy für Spillover zu finden oder die relevanten Unternehmensdaten zu bekommen[25] – waren die Ergebnisse der Studien auffallend ähnlich. Griliches (1992) stellt in seiner Zusammenfassung verschiedener Studienergebnisse fest: „R&D spillovers are present, their magnitude may be quite large, and social rates of return remain significantly above private rates. “[26]
Mansfield (1985) beispielsweise versuchte die Geschwindigkeit zu ermitteln, mit der Informationen über ein neues Produkt oder einen neuen Prozeß an die Konkurrenz gelangt. In seiner Studie, die 100 US-amerikanische Unternehmen aus 10 Industrien umfaßte, kam er zu dem Ergebnis, daß bei 70% aller Unternehmen die Informationen innerhalb von 12 Monaten nach der Entwicklung eines Produktes an Konkurrenten gelangten[27]. Bei neuen Prozessen betrug die Zeitspanne immerhin noch 15 Monate.
Mansfield et al. (1981) fanden in einer anderen Studie heraus, daß etwa 60% aller patentierten Innovationen in ihrer Datenreihe innerhalb von vier Jahren imitiert wurden[28]. Ein Anzeichen dafür, daß selbst Patente keinen effektiven Schutz vor Spillover bieten.
Bernstein und Nadiri (1989) kamen in ihrer Studie über intra-industrielle Spillover in vier Industrien zu dem Schluß: „... both variable and average costs of each industry and every firm declined in response to the intra-industry spillover [...] A one percent increase in the spillover on average decreased variable costs by around 0,1% for machinery and instruments and by 0,2% for chemicals and petroleum.”[29]
Auch konnten die Autoren die Existenz von inter-industriellen Spillover nachweisen. In ihrer Untersuchung in fünf F&E-intensiven Industrien fanden sie heraus, daß z.B. eine einprozentige Erhöhung von Spillover, die aus der Industrie für wissenschaftliche Instrumente kamen, zu einer 0,21 prozentigen Senkung der variablen Kosten in der Industrie für chemische Produkte führte[30]. Dieses Ergebnis, wenn auch im geringeren Ausmaß, konnte auch bei allen anderen untersuchten Industrien festgestellt werden. Die Höhe der Kostensenkung variierte stark und hing davon ab, in welchen Industrien sich der Sender und der Empfänger der Spillover befanden.
Mansfield et al. (1977) haben anhand von 17 Innovationen aus verschiedenen Industrien – davon 13 Produkt- und vier Prozeßinnovationen – versucht, den privaten und sozialen Nutzen dieser Erfindungen zu schätzen. Sie fanden heraus, daß in fast allen Fällen der gesellschaftliche Nutzen beträchtlich höher war als der private. Der gesellschaftliche Nutzen war 77 bis 150% größer als der private Nutzen[31].
Diesen großen Spillover Gap konnten auch Bernstein und Nadiri (1989) feststellen, wobei das Ausmaß dieser Lücke industrieabhängig war[32].
Eine weitere Auffälligkeit der Mansfield et al.-Studie, die besonders für die Wirtschaftspolitik von Bedeutung sein dürfte, war, daß in 30% der Fälle der private nutzen so gering war, daß die Unternehmen keinen Anreiz hätten, in diese Innovationen zu investieren. Der soziale Nutzen dagegen war so groß, daß aus gesellschaftlicher Sicht eine Investition durchaus erstrebenswert war[33]. Dieses Ergebnis zeigt also, daß Spillover nicht selten einen so großen Keil zwischen den privaten und sozialen Nutzen treiben, daß es im ungünstigsten Fall zu Marktversagen führen kann.
1.4 Implikationen für die Wirtschaftspolitik
Die empirischen Befunde von den verschiedenen Autoren haben ergeben, daß das Anreizproblem signifikant und allgegenwärtig ist. Spillover führen nicht nur zu einer Unterinvestition in F&E, sondern, wie die Ergebnisse von Mansfield et al. suggerieren, im schlimmsten Fall auch zu Marktversagen.
Gerade wegen der hohen Bedeutung der F&E für das Wachstum und den Wohlstand einer Volkswirtschaft, ist es kaum verwunderlich, daß fast alle Industrienationen den innovativen Prozeß nicht allein dem Markt überlassen. Dabei dient das Argument des Marktversagens oft als eine Rechtfertigung für die staatliche Intervention in den Marktprozeß[34].
Die Fragen der Wirtschaftspolitik lauten daher: „Wie kann man den Innovationsprozeß in Hinblick auf eine sozial-optimale Allokation am besten beeinflussen?“ und „Welche Möglichkeiten gibt es, um das Problem der Unterinvestition bzw. des Markversagens zu beseitigen oder zumindest zu verringern?“
Es gibt eine Reihe von Instrumenten, die dem Staat zur Verfügung stehen um die genannten Probleme anzugehen. Im Folgenden sollen drei Ansätze vorgestellt werden. Diese wirtschaftspolitischen Instrumente zielen dabei auf unterschiedliche Aspekte des Innovationsprozesses ab.
Eine Möglichkeit besteht darin, bereits den Ursprung des Unterinvestitionsproblems zu bekämpfen. Wie wir wissen, ist die Unfähigkeit einer vollständigen Aneignung der Forschungsergebnisse eine Ursache für eine sozial-suboptimale F&E-Investition. Nun kann die Wirtschaftspolitik durch Schaffung von verschärften Eigentumsrechten (z.B. durch Patente oder Copyrights) dafür sorgen, daß innovative Unternehmen länger und effektiver vor Imitationen geschützt werden, so daß diese Unternehmen einen größeren Anreiz haben, eine höhere, dem sozialen Optimum annähende Menge an F&E zu investieren. Eine mögliche Kehrseite dieser Strategie ist, daß durch die längere Patentdauer bzw. durch den besseren Patentschutz der Innovator einen längeren Zeitraum für die Monopolpreissetzung hat, was schließlich auch zu Wohlfahrtsverlusten führen kann.
Ein zweites und in den Industrienationen beliebtes Instrument stellen die Subventionen dar. Dabei können bestimmte Projekte, Unternehmen oder Industrien gezielt gefördert werden (targeted subsidies) oder es kann sich um allgemeine F&E-Subventionen (untargeted subsidies) handeln. Staatliche Förderungen können in Form von direkten Subventionen oder in Form von Steuervergünstigungen für die forschenden Unternehmen auftreten[35]. Das Ziel der direkten Subvention ist es, die Unternehmen durch staatliche Förderung dazu zu bringen, genau die sozial-optimale F&E-Menge zu investieren. Die optimale Subvention ergibt sich durch die Differenz von dem sozialen Optimum (Punkt B) und dem privaten Nutzen (Vgl. Abbildung 1-3) und ist deshalb für jedes Unternehmen unterschiedlich hoch[36]. Bei der Bestimmung der optimalen Subvention ergeben sich jedoch erhebliche Informationsprobleme. Es müssen nicht nur die privaten Optima der einzelnen Unternehmen bekannt sein, sondern auch das soziale Optimum sowie die Struktur der Spillover[37].
Eine dritte Möglichkeit das Problem der Unterinvestition zu lösen besteht in der Erlaubnis von F&E-Kooperationen. Dahinter steckt die Idee der Internalisierung externer Effekte. Während die ersten beiden wirtschaftspolitischen Instrumente extrinsisch Anreize bieten, sollen die Unternehmen durch Kooperationen intrinsisch motiviert werden, eine dem sozialen Optimum nahe F&E-Menge zu investieren. Wenn es gestattet wird, F&E-Kooperationen mit Lieferanten und Kunden oder sogar mit Konkurrenten zu bilden, haben die Unternehmen aufgrund der Internalisierung der Spillover einen größeren Anreiz mehr Ausgaben in F&E zu tätigen.
2 Forschungs- und Entwicklungskooperationen
2.1 Begriff und Klassifikation von F&E-Kooperationen
Eine F&E-Kooperation kann grob definiert werden als eine Abmachung zwischen Unternehmen, Universitäten und/oder staatlichen Institutionen, mit der Absicht durch Zusammenlegung von F&E-Ressourcen ein bestimmtes gemeinsames Ziel zu erreichen[38].
Obwohl diese Zusammenarbeit organisatorisch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann, geht es bei allen Formen von F&E-Kooperationen im Kern um die Erzeugung und das Teilen von Wissen und Technologien.
Man kann zunächst zwischen formellen, also vertraglichen, Kooperationen und informellen Kooperationen (informeller Austausch von technischem Wissen) unterscheiden.
Research Joint Venture (RJV) ist ein weit verbreiteter Vertreter der formellen Kooperation[39]. Es handelt sich dabei um eine neu geschaffene Organisation (i.d.R. kontrolliert von zwei oder mehr Unternehmen), deren einzige Aufgabe es ist, ein klar definiertes Forschungsprojekt innerhalb einer begrenzten Zeit durchzuführen[40]. Sowohl die Kosten als auch die Ergebnisse der gemeinschaftlichen Forschung werden entsprechend der jeweiligen Organisationsstruktur unter den Mitgliedern aufgeteilt.
Auch F&E-Konsortien (häufig mit staatlicher Beteiligung) fallen unter der Kategorie der RJV, wobei sie längerfristig ausgerichtet sind und sich oft auf die Grundlagenforschung und die Verbesserung der technologischen Infrastruktur einer Industrie fokussieren.
Weiter lassen sich die Kooperationen bezüglich der industriellen bzw. geografischen Herkunft ihrer Mitglieder differenzieren. Danach gibt es horizontale bzw. intra-industrielle (Unternehmen aus derselben Industrie), vertikale bzw. inter-industrielle (F&E-Kooperation mit Lieferanten oder Kunden[41] ) und diagonale Kooperationen (zwischen Unternehmen aus unverbundenen Industrien[42] ). Ebenfalls sind nationale und länderübergreifende, internationale F&E-Kooperationen möglich.
2.2 Einige stilisierte Fakten
Kooperationen zwischen Unternehmen, selbst im Bereich F&E, waren auch in der Vergangenheit kein Novum. Auffällig dagegen ist, daß sich in den letzten Jahrzehnten in diesen Bereich drastische Veränderungen ergeben haben. Hagedoorn (2002) hat in seiner Studie mehrere Tausend F&E-Kooperationen im Zeitraum von 1960 bis 1998 untersucht und dabei einige bemerkenswerte Trends festgestellt.
In den 60er und 70er Jahren war die Entwicklung der F&E-Kooperationen eher verhalten. So wurden während der 60er Jahre etwa 10 Kooperationen jährlich abgeschlossen und es konnte lediglich ein gradueller Anstieg festgestellt werden. Erst Ende der 70er, Anfang der 80er begann sich ein Umbruch in dieser Entwicklung abzuzeichnen. 1980 stieg die Zahl sprunghaft auf ca. 200, fünf Jahre später hatte sich die Anzahl der Kooperationen schon verdoppelt. Diese „Kooperationswelle“ setzte sich in den 90er Jahren fort und erreichte 1995 mit etwa 700 Kooperationen ihren vorläufigen Höhepunkt (siehe Abbildung 2-1).
Ein weiterer Trend ist erkennbar, wenn man untersucht, in welchen Industrien diese Kooperationen geschlossen werden. Es wird deutlich, daß F&E-Kooperationen insbesondere in so genannten High-Tech-Industrien[43] gebildet werden, also Industrien mit einer vergleichsweise hohen F&E-Intensität bzw. in denen Innovationen eine entscheidende Rolle spielen. Während in den 70er Jahren zwischen 35% und 50% aller Kooperationen aus diesem Sektor kamen, stieg dieser Anteil, bei mitunter starker Oszillation, in den 90er Jahren auf rund 80% (siehe Abbildung 2-2). Innerhalb des High-Tech-Sektors fand etwa die Hälfte aller Kooperationen in einer IT-Industrie statt, also in der Computer-, Telekommunikations-, Software- oder Halbleiterindustrie.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-1: Entwicklung der F&E-Kooperationen (1960-1998)
Quelle: Hagedoorn (2002), Fig.1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-2: Anteil der Sektoren an allen F&E-Kooperationen (1960-1998)
Quelle: Hagedoorn (2002), Fig. 3
Es wurden sowohl horizontale als auch vertikale Kooperationen festgestellt, wobei in verschiedenen Untersuchungen eine deutliche Dominanz von vertikalen Kooperationen bestätigt werden konnte. Chesnais (1988) fand heraus, daß 80% der japanischen Forschungskooperationen interindustriell waren. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte Licht (1994) in seiner Untersuchung in sechs europäischen Ländern. Harabi (1997) zeigte in seiner Studie über deutsche Unternehmen, daß 84% der Befragten gemeinsame Forschungsprojekte mit ihren Lieferanten und/oder Kunden betrieben[44].
Auffällig ist außerdem, daß meisten Kooperationen innerhalb der Triade Nord Amerika, Japan und Europäische Union, also in den großen Industrienationen, zustande kam. Hagedoorn et al. (2000) schätzen diesen Anteil auf über 80%, im High-Tech-Sektor sogar auf 90%[45].
Parallel zu der starken Zunahme der F&E-Kooperationen stieg auch die staatliche Unterstützung für die gemeinschaftliche Forschung. Diese staatliche Unterstützung, sei es durch Verbesserung der Rahmenbedingungen (z.B. durch Lockerung bestehender Kartellgesetze) oder durch direkte Eingriffe (wie Subventionen oder Beteiligung an Kooperationen)[46], sollen Unternehmen einen Anreiz bieten, sich stärker für die gemeinschaftliche Forschung zu engagieren. Beispiele hierfür sind der National Cooperative Research Act (1984), ein US-amerikanisches Gesetz, das F&E-Kooperationen von den stringenten Überprüfungskriterien der Kartellbehörde befreite[47], oder die großen Forschungskonsortien in Japan (VLSI-Projekt), USA (SEMATECH) und Europa (ESPRIT), die zur Förderung der inländischen Halbleiterindustrie subventioniert wurden[48].
2.3 Motive
Der rasante Anstieg von Forschungskooperationen in den letzten beiden Dekaden läßt schnell die Frage nach den Ursachen für diese Entwicklung aufkommen. Welche Motive sind verantwortlich, daß F&E-Kooperationen gerade in der letzten Zeit, und insbesondere im High-Tech-Sektor, so stark an Bedeutung gewonnen haben?
Die zahlreichen möglichen Antworten auf diese Frage lassen sich grob in drei Kategorien einordnen: Motive aus Sicht der Transaktionskostentheorie, des strategischen Managements und der Industrieökonomik.
In der Transaktionskostentheorie, die entscheidend von Ronald Coase und Oliver Williamson geprägt wurde, versuchen Unternehmen unter verschiedenen Organisationsformen diejenige herauszufinden, die am effizientesten ist, d.h. diejenige, bei der die Transaktionskosten minimiert werden. Üblicherweise wird diese Theorie verwendet, um die klassische Make-or-Buy-Entscheidung (z.B. Eigenfertigung versus Fremdbezug) zu erklären; also die Frage, ob ein Unternehmen eine bestimmte Transaktion über dem Markt (buy) oder intern (make) abwickelt[49].
Nun lässt sich dieser Ansatz auch auf Forschungskooperationen anwenden, indem man einen Make-Buy-or-Cooperate-Vergleich anstellt[50]. Die F&E-Kooperation wird vor diesem Hintergrund als eine weitere Alternative zu den bekannten Abwicklungsformen von Transaktionen betrachtet; „a hybrid form of organisation between the market and the hierarchy“[51]
Forschungsergebnisse, die auf einem Markt gekauft werden (z.B. ein Forschungsauftrag an ein externes Unternehmen), können sehr hohe Transaktionskosten verursachen. Der Gründe dafür sind, daß zum einen der Herstellungsprozeß des technischen Wissens mit großer Unsicherheit verbunden ist, und zum andern, daß dieses Wissen fast immer positive Externalitäten erzeugt. D.h. es besteht eine latente Gefahr, daß das beauftragte Unternehmen sich opportunistisch verhält (z.B. durch Hold-Up oder Moral Hazard[52] ). Die hohe Unsicherheit und die Gefahr des opportunistischen Verhaltens erschweren die Vertragsgestaltung und treiben die Transaktionskosten in die Höhe.
Wird die Forschung dagegen intern betrieben, können Transaktionskosten zwar reduziert werden; der Nachteil ist, daß das Unternehmen keinen Zugang zu dem speziellen Wissen anderer Firmen hat.
F&E-Kooperationen können dieses Dilemma lösen, indem sie einem Unternehmen Zugang zu neuem Wissen verschaffen und zur gleichen Zeit die Transaktionskosten (im Vergleich zur Marktlösung) senken[53].
Aus der Perspektive des strategischen Managements kann die Beteiligung an einer Kooperation dazu dienen, die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber seinen Konkurrenten zu verbessern. Dadurch, daß ein Mitglied im engen Kontakt mit den verschiedenen Forschungsaktivitäten innerhalb der Kooperation steht, bekommt es einen besseren Überblick über Trends der Industrie und kann so besser auf Marktänderungen reagieren und neue Produkte schneller zur Marktreife bringen.
Ein weiterer Vorteil ist, daß die beteiligten Unternehmen durch Bündelung ihrer Ressourcen Größen- und Verbundvorteile (economies of scale and scope) im F&E-Bereich realisieren können. Gleichzeitig kann eine Koordinierung der Forschungsaktivitäten dazu beitragen, daß die Ressourcen effektiver eingesetzt werden (z.B. durch die Vermeidung von doppelter Forschung an gleichen Projekten[54] ) und Synergien entstehen.
Insbesondere in den High-Tech-Industrien ist in den letzten Jahren ein Anstieg im Risiko und in den Kosten der Forschungsprojekte erkennbar[55]. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs, teilweise bedingt durch die kürzer werdenden Produktlebenszyklen und Produkteinführungszeiten (time-to-market), sind Unternehmen gezwungen, größere Risiken bei der Produktentwicklung einzugehen, um weiter im Markt bestehen zu können[56]. Durch die gemeinschaftliche Forschung können deshalb auch besonders teure, riskante oder komplexe Forschungsprojekte leichter durchgeführt werden, weil die Risiken und Kosten auf viele Parteien verteilt werden.
Ein zentrales Motiv für die Bildung von F&E-Kooperationen ist die Suche nach komplementären Ressourcen. Nach Jorde und Teece (1990) handelt es sich dabei um jene Ressourcen, die ein Unternehmen zusätzlich zu den eigenen benötigt, um neue einschneidende Technologien zu entwickeln und erfolgreich vermarkten zu können[57]. Dahinter steckt die Annahme, daß kein auch so stark diversifiziertes Unternehmen in allen Forschungsgebieten so kompetent ist, daß es ohne fremdes Wissen neue Produkte und Märkte bestreiten kann[58].
Dieses Motiv basiert auf der Idee des Resource-Based View, ein Konzept des strategischen Managements, das zu Beginn der 90er Jahre an Aufmerksamkeit gewann. In der Sichtweise des Resource-Based View ist das Unternehmen ein Pool von tangiblen (z.B. Finanzkraft, physische Anlagen), intangiblen (z.B. Innovationsfähigkeit, Unternehmenskultur) und Human-Ressourcen (z.B. Fähigkeiten und Wissen der Mitarbeiter, Motivation). Ein Unternehmen besitzt dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn es über besonders wertvolle, einzigartige und schwer imitierbare Ressourcen verfügt[59]. Die gemeinschaftliche Forschung und damit der Zugang zu komplementärem Wissen kann einem Unternehmen helfen, diese Art von Ressourcen aufzubauen, um sich einen künftigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen[60].
In seiner Studie über ca. 4000 F&E-Kooperationen aus dem High-Tech-Sektor konnte Hagedoorn (1993) drei herausragende Motive für die gemeinschaftliche Forschung feststellen: die Suche nach komplementären Technologien (technological complementarity), die Senkung der Innovationszeit (reduction innovation time span) und damit eine schnellere Marktreife und der Zugang zu neuen, insbesondere ausländischen Märkten (market access) (Vgl. Tabelle 2-1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2-1: Motive für F&E-Kooperationen in High-Tech-Industrien
Quelle: Auszug aus Hagedoorn (1993), Table 3
Eine weitere Ursache für die Zunahme der Forschungskooperationen ist das wachsende Engagement der Politik in gemeinschaftlichen Forschungsprogrammen. Mögliche wirtschaftspolitische Motive für die staatliche Beteiligung an F&E-Kooperationen können die Schaffung von Industrie-Standards oder die Stärkung von bestimmten Industrien sein. Durch die gezielte Förderung soll u.a. die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Schlüsselindustrien (z.B. die Halbleiterindustrie) verbessert werden, um den technologischen Vorsprung von ausländischen Konkurrenten aufzuholen[61].
Die Motive aus der Sichtweise der Industrieökonomik beziehen sich primär auf die oben dargestellten Spillover und das damit verbundene Anreizproblem.
F&E-Kooperationen sollen durch Internalisierung der externen Effekte die Aneignungsfähigkeit der Innovatoren verbessern und so einen Anreiz für eine insgesamt höhere F&E-Investition bieten. Diese Internalisierung findet dadurch statt, daß die beteiligten Unternehmen sich schon vor der eigentlichen F&E-Tätigkeit verpflichten, einen Teil der Forschungskosten mitzutragen und somit nicht mehr als Trittbrettfahrer auftreten. Mit der gemeinschaftlichen Forschung soll also das Problem des Marktversagens behoben und eine möglichst sozial optimale Ressourcenallokation erreicht werden. Dieses Motiv würde zumindest auch die zunehmende staatliche Förderung von Forschungsgemeinschaften erklären.
Ob die Kooperation tatsächlich Anreize für eine höhere F&E-Investition seitens der Unternehmen erzeugt, ist allerdings noch nicht eindeutig geklärt. Katz und Ordover (1990) konstruieren einen Fall, bei dem Unternehmen zwar in der Forschung kooperieren, aber auf dem Produktmarkt in Konkurrenz zueinander stehen. In diesem Fall würde höhere F&E-Ausgaben eines Unternehmens die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten auf dem Produktmarkt verbessern. Diese negativen externen Effekte würden dann eher dazu führen, daß ein Unternehmen trotz F&E-Kooperation einen geringeren Anreiz hat, in die Forschung zu investieren[62].
Auch Kaiser (2002) befaßt sich mit der Frage: “Do cooperating firms invest more, the same or less into R&D than non-cooperating firms?”[63]
Andere Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, wären: Welchen Einfluß haben Spillover auf das F&E-Verhalten von Unternehmen innerhalb einer Kooperation? Gibt es unter den verschiedenen Varianten eine optimale Organisationsstruktur für F&E-Kooperationen? Ist die gemeinschaftliche Forschung aus Sicht des Unternehmens und der Gesamtwirtschaft dem F&E-Wettbewerb überhaupt vorzuziehen? Diese und weitere Aspekte sollen im nächsten Abschnitt anhand einer Auswahl von spieltheoretischen Modellen näher untersucht werden.
2.4 Ökonomische Modelle zu F&E-Kooperationen
Um das Phänomen der Forschungs- und Entwicklungskooperationen zu analysieren bedient sich die Industrieökonomik zweier Modell-Kategorien: Tournament und Non-Tournament Modelle.
Bei den Tournament Modellen wird angenommen, daß es nur einen Forschungspfad gibt, der von allen Unternehmen verfolgt wird. Es geht hauptsächlich darum, auf diesem Pfad als erster die Innovation zu realisieren und sich damit eine Monopolrente (in Form eines Patents) zu sichern. Die Spiele dieser Kategorie werden häufig als Patentrennen modelliert, bei dem es am Ende stets einen Sieger gibt. Für die Verlierer dieser Rennen besteht die Gefahr, aufgrund mangelnder Innovation und Wettbewerbsfähigkeit vom Markt verdrängt werden.
Bei den Non-Tournament Modellen sind mehrere Forschungspfade möglich, die neben einander existieren und von den Unternehmen alternativ verfolgt werden. Ein technologischer Fortschritt, der auf einem Pfad entstanden ist, kann auch von Unternehmen genutzt werden, die sich auf anderen Forschungspfaden befinden. Mit der Annahme der Substituierbarkeit der Forschungstätigkeit werden die Spillover in diesen Modellen berücksichtigt[64].
Somit können durchaus mehrere Unternehmen gleichzeitig erfolgreich sein, obwohl sie in unterschiedlichen Richtungen geforscht haben.
In dieser Arbeit stehen Non-Tournament Modelle mit zwei oder mehr Spielstufen im Vordergrund. Alle im Folgenden untersuchten Modelle haben die gemeinsame Annahme, daß der F&E-Prozeß keine Stochastik enthält, also völlig frei ist von Unsicherheiten und eine Investition in die Forschung stets zu einem Erfolg (z.B. in Form einer Senkung der Produktionskosten) führt. Weiter wird davon ausgegangen, daß im Fall einer Kooperation alle Unternehmen in der Industrie daran beteiligt sind und daß diese, wenn nicht anders erläutert, völlig symmetrisch sind.
2.4.1 Das Standardmodell von d´Aspremont und Jacquemin (1988)
Die wohl einflußreichste Arbeit in diesem Bereich dürfte das Modell von d`Aspremont und Jacquemin (1988)[65] sein. Es handelt sich dabei um ein zweistufiges Duopol-Modell mit homogenen Produkten, bei dem die Unternehmen auf der ersten Stufe simultan ihre F&E-Einsätze Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten wählen und auf der zweiten Stufe ihre Angebotsmengen Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenbestimmen (Vgl. Abbildung 2-3). Sowohl in der F&E-Phase als auch im Produktmarkt können sich die Unternehmen kooperativ oder wettbewerblich verhalten. Je nachdem wie sie sich entscheiden ergeben sich drei mögliche Szenarien (Vgl. Tabelle 2-2): Wettbewerb (non-cooperation), Kooperation (cooperation) oder Monopol (full cooperation)[66].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2-2: Szenarien bei d´Aspremont und Jacquemin (1988)
Es wird eine lineare (inverse) Marktnachfrage angenommen,[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] mit [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]als Marktpreis in Abhängigkeit von der gesamten Angebotsmenge [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten][Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]und [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten].
Beide Unternehmen haben annahmegemäß identische Stückkosten, die mit den Grenzkosten übereinstimmen sollen und die F&E-Tätigkeit führe stets zu einer Senkung der Produktionskosten[67].
Die Produktionskosten seien daher eine lineare Funktion der effektiven F&E-Menge[68] [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], d.h.[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten],[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] mit[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] als die fixen Grenzkosten. Ein F&E-Einsatz in Höhe von [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] führt demnach zu einer Senkung der Stückkosten auf[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]. An der Kostenfunktion wird deutlich, daß die Kosten von Unternehmen 1 nicht nur durch die eigene F&E sinken, sondern auch durch die F&E-Tätigkeit von Unternehmen 2. Die Spillover werden also über sinkende Produktionskosten in das Modell eingebracht, wobei [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]ein Spillover-Parameter darstellt; d.h. es mißt den Anteil externer F&E (hier: F&E des Konkurrenten), den ein Unternehmen internalisieren kann. Ein [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] deutet auf eine perfekte Aneignungsfähigkeit der Unternehmen hin; es entstehen also keine Spillover. Je größer der Wert von[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], desto mehr kann ein Unternehmen von der F&E anderer profitieren[69]. Bei einem [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] fließt das gesamte Wissen ab und die F&E-Ergebnisse sind ein reines öffentliches Gut[70].
Die Kostenfunktion der F&E soll quadratisch sein, Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten , und somit die abnehmenden Grenzerträge der Forschung abbilden. D.h. die Ausgaben die getätigt werden müssen, um an eine zusätzliche Einheit von Wissen zu gelangen, steigen stark an und signalisieren damit, daß es zunehmend schwieriger wird zusätzliches Wissen zu generieren. Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten lässt sich als ein Effizienz-Parameter interpretieren, d.h. je größer Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, desto geringer die Effizienz der F&E-Ausgaben (desto teurer wird es, eine zusätzliche Einheit an neuem Wissen zu gewinnen).
Unter diesen Annahmen kann ein zweistufiges Spiel mit den zwei Szenarien modelliert werden. Diese Spiele werden durch Rückwärtsinduktion (backward induction) gelöst. Das bedeutet, man beginnt mit der zweiten Stufe und bestimmt zunächst die optimalen AngebotsmengenAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, also jene Mengen, die den Gewinn der Spieler (hier: Unternehmen) maximieren. Man sucht das Nash-Gleichgewicht im Produktmarkt. Gegeben der gleichgewichtigen Mengen der zweiten Stufe wird die Gewinnfunktion nun auf den ersten Stufe nach dem F&E-Einsatz maximiert. Auf diese Weise werden die gleichgewichtigen (bzw. gewinnmaximalen) F&E-Einsätze Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten berechnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2-3: Spielstruktur von d´Aspremont und Jacquemin (1988)
In diesem Szenario findet sowohl in der F&E-Phase als auch auf dem Produktmarkt ein Wettbewerb zwischen den Unternehmen statt. Gegeben der Marktnachfrage- und Kostenfunktionen können wir auf der zweiten Stufe folgende Gewinnfunktion aufstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um nun das Cournot-Nash-Gleichgewicht zu finden, maximiert man die Gewinnfunktion zunächst nach der Angebotsmenge[71]:
(2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Löst man den Ausdruck nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten erhält man die Mengenreaktionsfunktion der Firma i in Abhängigkeit von der Angebotsmenge des Konkurrenten[72].
(3)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Reaktionsfunktion zeigt, daß die sowohl eigene als auch die fremde F&E (wenn Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten) sich positiv auf die Angebotsmenge auswirken; es gilt also Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Analog dazu lautet die Mengenreaktionsfunktion der Firma j:
(4)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Cournot-Nash-Gleichgewicht befindet sich genau im Schnittpunkt dieser Reaktionsfunktionen; dann gibt es für die Unternehmen keinen Anreiz mehr von der gewählten Angebotsmenge abzuweichen.
Setzt man die Reaktionsmenge aus Gleichung 4 in die Gleichung 3 ein und löst wieder nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten auf, erhält man die Gleichgewichtsmenge Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten:
(5)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(6)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgrund der Spillover (wennAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten) hängt die gleichgewichtige Angebotsmenge nicht nur von der eigenen Forschung ab, sondern auch von der F&E des Konkurrenten.
(7)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(8)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus Gleichung 7 wird deutlich, daß die eigene F&E unabhängig von der Höhe der Spillover immer die Gleichgewichtsmenge erhöht, während die F&E des Konkurrenten die eigene Angebotsmenge nur dann steigert[73], wenn Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ist; also wenn die Spillover ausreichend hoch sind. Bei geringen Spillover dagegen senkt die fremde F&E die eigene Angebotsmenge (siehe Gleichung 8).
Analog dazu lautet die Gleichgewichtsmenge des Unternehmens j:
(9)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gegeben den gleichgewichtigen Angebotsmengen auf dem Produktmarkt kann nun der zugehörige Gewinn berechnet werden (durch Einsetzen der Gleichung 6 und 9 in Gleichung 1):
(10)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Gleichung 10 zeigt, daß der Gewinn (wie zuvor die Angebotsmenge) von der eigenen F&E und der des Konkurrenten abhängen. Anhand dieser so genannten reduzierten Gewinnfunktion[74] kann nun die Wirkungsweise der eigenen F&E auf den Gewinn untersucht werden und es soll geklärt werden, ob es sich aus Sicht des Unternehmens in einer solchen Situation überhaupt lohnt, mehr in die Forschung zu investieren (Entscheidungsproblem der ersten Stufe). Dazu bildet man zunächst das totale Differential der reduzierten Gewinnfunktion:
(11)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Teilt man Gleichung 11 durch Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenergibt sich folgender Ausdruck:
(12)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Wirkungen der F&E-Tätigkeit auf den Gewinn werden durch die drei Terme erfaßt, wobei das jeweilige Vorzeichen Aufschluß über die Wirkungsrichtung der Investition gibt. Ein positives Vorzeichen bedeutet, daß eine F&E-Investition vorteilhaft ist, weil sie den Gewinn steigert, während ein negatives Vorzeichen eine Gewinnsenkung impliziert[75].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ist der direkte Effekt[76]. Er wird positiv, wenn der durch die F&E-Investition gewonnene Grenzerlös Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten größer ist als die Grenzkosten der ForschungAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Solange dies gilt, und die anderen Effekte ausgeblendet werden, hat das Unternehmen einen Anreiz mehr in F&E zu investieren. Der letzte Term der Gleichung 12 muß aufgrund des Enveloppen-Theorems Null sein[77]. Von Bedeutung ist jedoch der strategische Effekt (zweiter Term auf der rechten Seite). Er sagt aus, wie sich der unser Gewinn verändert, wenn der Konkurrent als Reaktion auf unsere F&E-Investition seine Angebotsmengen anpaßt. Fest steht, daß der eigene Gewinn durch eine Ausweitung der Konkurrenzmenge sinkt,Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Es bleibt zu untersuchen, wie sich die Konkurrenzmenge durch unsere F&E-Investition verändert, also Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Analog zu Gleichung 8, ist das Ergebnis wieder von Höhe der Spillover abhängig. Wenn Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, wird der Ausdruck negativ, der strategische Effekt dagegen positiv. Somit wäre der Gesamteffekt Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten (unter der Annahme, daßAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten) ebenfalls positiv. D.h. bei geringen Spillover lohnt es sich für das Unternehmen mehr in die Forschung zu investieren. Die F&E senkt die eigenen Produktionskosten (ohne die des Konkurrenten im gleichen Maße zu begünstigen) und ermöglich somit eine Ausweitung der eigenen Angebotsmenge auf dem Produktmarkt (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten); und zwar auf Kosten des Konkurrenten (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten)[78]. Gibt es dagegen hohe Spillover (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten), wird der Ausdruck Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten positiv und der strategische Effekt negativ. In diesem Fall wird jede Investition in die eigene F&E die Kosten des Konkurrenten noch mehr senken und damit seine Wettbewerbsfähigkeit verstärken. Da dieser Free-Rider-Effekt größer wird, je höher die Spillover, es ist sinnvoll, weniger in die Forschung zu investieren (Vgl. Abbildung 2-4).
Wie stark der Anreiz für eine F&E-Investition ist, hängt also entscheidend von der Höhe der Spillover Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ab.
Um nun das Nash-Gleichgewicht auf der ersten Stufe zu bestimmen, wird die reduzierte Gewinnfunktion nach dem F&E-Einsatz maximiert[79]:
(13)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgelöst nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ergibt die F&E-Reaktionsfunktion:
(14)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie sich die fremde F&E auf unsere eigene Forschungstätigkeit auswirkt, läßt sich durch eine Ableitung leicht überprüfen:
(15)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch hier ist das Ergebnis vom Spillover-Parameter abhängig. BeiAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ist hat die Reaktionsfunktion eine negative Steigung, d.h. auf einen Anstieg fremder F&E reagieren wir mit einem Rückgang der eigenen Forschung (und vice versa)[80]. Bei Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ist die Steigung positiv (d.h. steigt die fremde F&E, wird auch mehr in die eigene Forschung investiert). Somit verwandelt sich die F&E mit steigendem Spillover-Level von strategischen Substituten zu strategischen Komplementen[81].
Das symmetrische Nash-Gleichgewicht der ersten Stufe lautet demnach[82]:
(16)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Leitet man diese Gleichung nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ab, ist das Vorzeichen dieser Ableitung negativ, also (Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten). D.h. mit steigendem Spillover-Level nimmt der gleichgewichtige F&E-Einsatz ab[83].
[...]
[1] Vgl. Pfähler und Bönte (1996), S.78
[2] Vgl. hierzu z.B. das Ein-Sektoren-Modell von Solow in Romer (1996)
[3] Vgl. Pfähler und Bönte (1996), S.60
[4] auf Network Spillover soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden, da in erster Linie die Market und Knowledge Spillover für die spätere Darstellung des Anreizproblems von Bedeutung sind. Für eine nähere Betrachtung von Network Spillover sei auf den Artikel von Jaffe (1998) verwiesen.
[5] selbst wenn kein starker Wettbewerb stattfindet, kann der Innovator sich nicht den gesamten Nutzenzuwachs aneignen, wenn er nicht in der Lage ist eine vollkommene Preisdifferenzierung zu betreiben. Vgl. Katz (1986), S.527
[6] Griliches (1992), S.30
[7] Griliches (1992), S.36, Griliches` Definition von „pekuniären“ Externalitäten weicht ab von der gängigen Definition in der Literatur, wo zwischen pekuniären und technologischen Externalitäten unterschieden wird [Vgl. z.B. Fritsch et al. (1999), S.93f]. Griliches unterscheidet zwischen „pekuniären“ Spillover und Knowledge Spillover, wobei erstere in etwa den Market Spillover von Jaffe entspricht, Vgl. hierzu Branstetter (2001), S.56
[8] Jaffe (1998), S.11
[9] Vgl. De Bondt (1996), S.4
[10] ein Unternehmen agiert als Sender und ein anderes Unternehmen als Empfänger von Wissen. Vgl. Pfähler und Bönte (1996), S.66
[11] bei wechselseitigen Spillover kann man sich weiter fragen, ob die Spillover symmetrisch oder asymmetrisch sind, d.h. ob ein Unternehmen dieselbe Menge an Wissen bekommt wie es aussendet oder nicht.
[12] Vgl. Steurs (1995)
[13] Vgl. Branstetter (2001) und Bernstein und Mohnen (1998)
[14] Vgl. Hauenschild (2003), S.1066 oder Martin (2002)
[15] hierauf wird im Abschnitt 2.4.4 näher eingegangen
[16] Vgl. Jaffe (1998), S.12
[17] Vgl. Pfähler und Bönte (1996), S.63
[18] siehe die oben genannten Spillover-Kanäle
[19] Jaffe (1998), S.14. Es handelt sich also um inter-industrielle Knowledge Spillover. Es wird hier angenommen, daß diese Spillover keine Rückwirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit der Konkurrenten von Firma 1 haben.
[20] Vgl. Bernstein und Nadiri (1989), S.264
[21] Vgl. Mansfield et al. (1977),S.235f.
[22] siehe das Problem der Market Spillover auf S.3
[23] ob Prozeß- oder Produktinnovationen den Spillover Gap vergrößern ist in der Literatur umstritten. Vgl. Mansfield et al. (1977), S.236f.
[24] Grenzkosten = Grenzerlös als eine allgemeine notwendige Bedingung für ein Gewinnmaximum
[25] Vgl. Mansfield et al. (1977), S.222 und Griliches (1992), S.S33
[26] Vgl. Griliches (1992), S.S43
[27] Vgl. Mansfield (1985), S.219ff
[28] Vgl. Mansfield et al. (1981), S.913
[29] Vgl. Bernstein und Nadiri (1989), S.260f.
[30] Vgl. Berstein und Nadiri (1988), S.431
[31] Vgl. Bernstein und Nadiri (1989), S.263f
[32] in der Industrie für Maschinenbau lag der soziale Nutzen um 30% höher war als der private Nutzen, in der Erdölindustrie dagegen 123%, Vgl. Bernstein und Nadiri (1989), S.264
[33] Vgl. Mansfield et al. (1977), S.233ff
[34] Vgl. Jacquemin(1988), S.553
[35] z.B. können in vielen Industrienationen die Ausgaben in F&E von dem steuerpflichtigen Einkommen der Unternehmen abgezogen werden
[36] ein einheitlicher Subventionssatz könnte zu einer Über- oder Untersubvention führen und das Ergebnis im Vergleich zu der Ausgangssituation sogar noch verschlechtern.
[37] Vgl. Pfähler und Bönte (1996), S.68
[38] Vgl. Hagedoorn et al. (2000), S.568
[39] für weitere Arten von formellen F&E-Kooperationen sei z.B. auf Jorde und Teece (1990), S.85 verwiesen.
[40] an dieser Stelle soll auf das Problem der uneinheitlichen Definition von RJV in der Literatur hingewiesen werden. Die hier angeführte Definition geht auf Katz und Ordover (1990), S.143 zurück.
[41] Vgl. Inkmann (2000) und Atallah (2002)
[42] Vgl. Steurs (1995)
[43] dazu zählen z.B. die Pharma-, Luftfahrt- oder die IT-Industrie
[44] Vgl. Chesnais (1988), Licht (1994) und Harabi (1997) in Inkmann (2000), S.3
[45] Hagedoorn et al. (2000), S.577
[46] Vgl. Sakakibara (1997a), S.451
[47] bei Kooperationen, die unter dem NCRA angemeldet waren, wurde bei der Prüfung auf mögliche Wettbewerbsverstöße auf die „per se“-Analyse verzichtet und stattdessen die mildere „rule of reason“-Analyse angewandt. Vgl. Katz und Ordover (1990), S.169ff. Ähnliche Gesetze, die Forschungskooperationen erleichtern sollen, wurden auch in der Europäischen Union verabschiedet.
[48] Näheres zu den Forschungskonsortien im Abschnitt 3.4
[49] danach wird eine Transaktion innerhalb des Unternehmens abgewickelt, wenn die gesamten Kosten dieser internen Abwicklung geringer sind als bei der Nutzung des Marktes.
[50] Vgl. Veugelers (1998), S.422
[51] Hagedoorn et al. (2000),S.571
[52] Vgl. Fritsch et al. (1996), S.271ff
[53] Veugelers (1998), S.422. Wie aus dem Beispiel ersichtlich, dient der Transaktionskostenansatz eher dazu vertikale Kooperationen (z.B. zwischen Lieferant und Abnehmer) zu erklären.
[54] Vgl. Katz und Ordover (1990), S.145
[55] Vgl. Katz und Martin (1997), S.8
[56] Vgl. Mowery et al. (1996), S.79. Näheres hierzu am Fallbeispiel der Halbleiterindustrie im Abschnitt 3
[57] Vgl. Jorde und Teece (1990), S.83
[58] Vgl. Hagedoorn (1993), S.372
[59] Vgl. Rothaermel (2001), S.689
[60] Vgl. Sakakibara (1997b), S.145
[61] Vgl. Miotti und Sachwald (2003), S.1497
[62] Vgl. Katz und Ordover (1990), S.145
[63] Kaiser (2002), S.748
[64] Vgl. Hagedoorn et al. (2000), S.573f.
[65] im Folgenden: DJ-Modell
[66] Vgl. De Bondt (1996), S.5. Ein weiteres mögliches Szenario (1.Stufe:Wettbewerb, 2.Stufe: Kooperation) soll hier nicht betrachtet werden. In Anlehnung an Pfähler und Wiethaus (2004) soll im Folgenden nur der F&E-Wettbewerb und die Kooperation untersucht werden.
[67] in diesem Modell werden also nur die Prozeßinnovationen betrachtet
[68] hieran sieht man, daß die Forschungstätigkeit substituierbar ist. Bedeutend für das Ausmaß der Kostensenkung ist letztendlich die Höhe des effektiven F&E-Einsatzes Xi.
[69] an dieser Stelle soll angemerkt werden, daß es sich um symmetrische Spillover handelt. Eine wichtige Annahme des DJ-Modells ist, daß der Grad der Spillover exogen vorgegeben ist, d.h. die Unternehmen können die Höhe der Spillover nicht beeinflussen.
[70] Vgl. Amir et al (2003), S.187
[71] aufgrund der Annahme von symmetrischen Unternehmen wird nur die Herleitung eines Unternehmens vorgenommen. Für Unternehmen j ist die Herleitung ähnlich.
[72] auf der zweiten wird angenommen, daß die optimalen F&E-Einsätze bereits auf der ersten Stufe festgelegt wurden.
[73] die Intuition dazu ist wie folgt: (ausreichend hohe) Spillover sorgen dafür, daß die F&E des Rivalen die eigenen Stückkosten senkt. Mit fallenden Stückkosten kann c.p. mehr produziert werden und die eigene Angebotsmenge steigt.
[74] die gleichgewichtigen Angebotsmengen werden in dieser Funktion bereits berücksichtigt, sie hängt jetzt nur noch von dem F&E-Einsatz ab.
[75] Vgl. De Bondt und Veugelers (1991), S.352
[76] durch Ableitung der Gleichung 1 nach, wobei durch substituiert wird.
[77] da so gewählt wurde, daß der Gewinn maximal ist, hat eine Änderung von keinen Einfluß auf , d.h.
[78] Vgl. Mengenreaktionsfunktionen (Gleichung 3 und 4)
[79] zur Vereinfachung der Rechnung wird gesetzt. Es wird lediglich die Gleichung 10 (letzte Zeile) nach abgeleitet.
[80] dieses Ergebnis erklärt, warum bei geringen Spillover der Anreiz zu einer vermehrten F&E-Tätigkeit so groß ist. Denn durch eine Erhöhung der eigenen F&E wird der Konkurrent veranlaßt weniger Forschung zu betreiben, d.h. seine Kosten sinken nicht so stark wie die eigenen. Mit geringeren (eigenen) Kosten kann eine größere Angebotsmenge produziert und damit Marktanteile gewonnen werden.
[81] Vgl. Henriques (1990), Fig.1
[82] wenn in Gleichung 13 gesetzt und nach aufgelöst wird
[83] das liegt daran, daß bei steigenden Spillover die eigene F&E die Position des Konkurrenten verstärkt. Es gibt daher wenig Anreiz in die Forschung zu investieren.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832498085
- ISBN (Paperback)
- 9783838698083
- DOI
- 10.3239/9783832498085
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hamburg – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2006 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- strategie wettbewerbsanalyse spillover industrieökonomik spieltheorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de