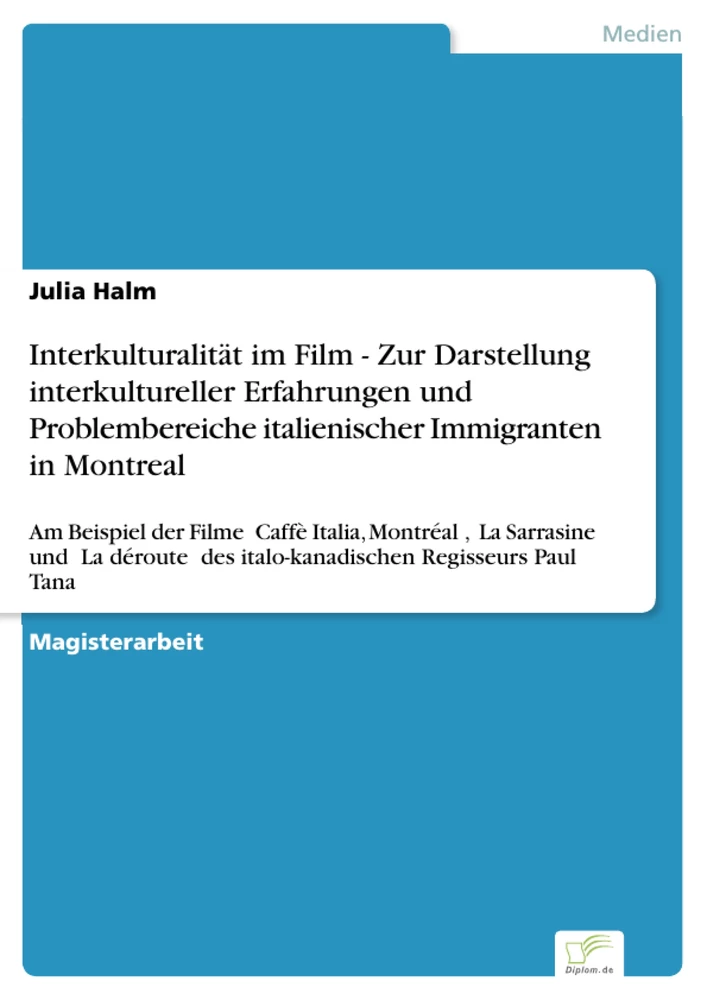Interkulturalität im Film - Zur Darstellung interkultureller Erfahrungen und Problembereiche italienischer Immigranten in Montreal
Am Beispiel der Filme Caffè Italia, Montréal, La Sarrasine und La déroute des italo-kanadischen Regisseurs Paul Tana
©2006
Magisterarbeit
220 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die gängige Präsentation von Interkulturalität im Film beschränkt sich zumeist auf Formen der Darstellung des Exotismus, in denen Interkulturalität vor allem aus der einseitigen Betrachtungsweise der Ausgangskultur mit Blick auf das Fremde dargestellt wird. So wird das Fremde meist auf Stereotypen reduziert oder durch exotisch wirkende Personen und Inszenierungen, wie zum Beispiel der orientalischen Umgebung in Minghellas Der Englische Patient, wiedergegeben. Oft spielen europäische oder amerikanische Helden in einer exotisierten und für ein Publikum, das vor allem Filmproduktionen aus Hollywood gewöhnt ist, faszinierenden Umgebung die Hauptrollen in Filmen, die ebenfalls für eine europäische und amerikanische Zuschauerschaft gedreht wurden.
Mittlerweile sind jedoch neue Themen ins Blickfeld der Interkulturalität gerückt. Durch die Migrationsströme des letzten Jahrhunderts und die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft, haben sich multikulturelle Gesellschaften entwickelt, in denen sich ethnische Gruppen und kulturelle Gemeinschaften nebeneinander herausbilden, die kulturell interagieren. Besonders die Frage der Immigration ist für viele Staaten hochaktuell und wirkt sich politisch wie auch sozial aus.
So hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Riege von Regisseuren aus Immigrantenkulturen gebildet, die aus ihrer besonderen Perspektive aus der Mitte der Immigrantengruppen Interkulturalität filmisch neu definieren. Es kann von einer filmischen Wortergreifung von innen gesprochen werden, durch die diese Künstler Problematiken und Themen der Immigration aufgreifen und in ihren Werken umsetzen.
Gerade die Quebecer Region, die im kanadischen Staat durch ihre französischsprachige Mehrheit einen besonderen Status einnimmt, beherbergt eine große Zahl an Immigranten. So formierte sich seit den 70er Jahren, die durch die politische Machtübernahme der frankophonen Mehrheit maßgebliche Veränderungen in Quebec brachten, eine Generation von Künstlern italienischer Herkunft. In ihren Werken schlägt sich ihre italo-quebecer Identität und ihre Lage als Mitglieder einer ethnischen Minderheit nieder. Zu diesen Künstlern gehört der Regisseur Paul Tana, der als Sohn italienischer Immigranten in seinen Filmen das Thema der Einwanderung und im Besonderen die Gemeinschaft der italienischen Immigranten in Montreal behandelt. So stellt sich die Frage, wie Tana interkulturelle Erfahrungen und Problembereiche dieser Immigrantengemeinschaft in […]
Die gängige Präsentation von Interkulturalität im Film beschränkt sich zumeist auf Formen der Darstellung des Exotismus, in denen Interkulturalität vor allem aus der einseitigen Betrachtungsweise der Ausgangskultur mit Blick auf das Fremde dargestellt wird. So wird das Fremde meist auf Stereotypen reduziert oder durch exotisch wirkende Personen und Inszenierungen, wie zum Beispiel der orientalischen Umgebung in Minghellas Der Englische Patient, wiedergegeben. Oft spielen europäische oder amerikanische Helden in einer exotisierten und für ein Publikum, das vor allem Filmproduktionen aus Hollywood gewöhnt ist, faszinierenden Umgebung die Hauptrollen in Filmen, die ebenfalls für eine europäische und amerikanische Zuschauerschaft gedreht wurden.
Mittlerweile sind jedoch neue Themen ins Blickfeld der Interkulturalität gerückt. Durch die Migrationsströme des letzten Jahrhunderts und die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft, haben sich multikulturelle Gesellschaften entwickelt, in denen sich ethnische Gruppen und kulturelle Gemeinschaften nebeneinander herausbilden, die kulturell interagieren. Besonders die Frage der Immigration ist für viele Staaten hochaktuell und wirkt sich politisch wie auch sozial aus.
So hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Riege von Regisseuren aus Immigrantenkulturen gebildet, die aus ihrer besonderen Perspektive aus der Mitte der Immigrantengruppen Interkulturalität filmisch neu definieren. Es kann von einer filmischen Wortergreifung von innen gesprochen werden, durch die diese Künstler Problematiken und Themen der Immigration aufgreifen und in ihren Werken umsetzen.
Gerade die Quebecer Region, die im kanadischen Staat durch ihre französischsprachige Mehrheit einen besonderen Status einnimmt, beherbergt eine große Zahl an Immigranten. So formierte sich seit den 70er Jahren, die durch die politische Machtübernahme der frankophonen Mehrheit maßgebliche Veränderungen in Quebec brachten, eine Generation von Künstlern italienischer Herkunft. In ihren Werken schlägt sich ihre italo-quebecer Identität und ihre Lage als Mitglieder einer ethnischen Minderheit nieder. Zu diesen Künstlern gehört der Regisseur Paul Tana, der als Sohn italienischer Immigranten in seinen Filmen das Thema der Einwanderung und im Besonderen die Gemeinschaft der italienischen Immigranten in Montreal behandelt. So stellt sich die Frage, wie Tana interkulturelle Erfahrungen und Problembereiche dieser Immigrantengemeinschaft in […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Julia Halm
Interkulturalität im Film - Zur Darstellung interkultureller Erfahrungen und
Problembereiche italienischer Immigranten in Montreal
Am Beispiel der Filme ,,Caffè Italia, Montréal", ,,La Sarrasine" und ,,La déroute"
des italo-kanadischen Regisseurs Paul Tana
ISBN-10: 3-8324-9799-4
ISBN-13: 978-3-8324-9799-6
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Deutschland, Magisterarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Autorenprofil
Julia Halm, M.A.
Pestalozzistr. 35
80469 München
089/ 26 01 90 08
juliahalm@gmx.net
persönliche Angaben:
geboren am 14.03.1979 in München
ledig
angestrebter Aufgabenbereich:
PR, Marketing, Gesellschaftspolitik
Interessen:
Interkultureller Austausch, Gesellschaftspolitik
A u s b i l d u n g :
11/1999
07/2006
11/1998
06/1999
Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Abschlussnote Magister Artium: 2,1
Magisterarbeit: Interkulturalität im Film, Note: 1,1
Hauptfach: Französische Kulturwissenschaft und interkulturelle
Kommunikation
Nebenfächer: Spanisch, Betriebswirtschaftslehre
Université du Québec à Montréal, Montréal, Kanada, DAAD-Stipendium,
(07/2005)
Université de Provence Aix-Marseille I, Aix-en-Provence (Frankreich), LEA
(Langues étrangères appliquées; ,,angewandte Fremdsprachen"), (09/2002 06/2003)
Universidad Autónoma, Barcelona, Übersetzen und Dolmetschen, (09/2000
02/2001)
Ludwig-Maximilian-Universität, München
Romanistik
Berufliche Entwicklung::
Seit 08/2006
01/2005 05/2005
08/2003 09/2003
02/2002 07/2002
09/2001 10/2001
03/2000
BMW Group, München, Konzernkommunikation und Politik, Gesellschaftspolitik,
Praktikum
Deutsche Handelskammer für Spanien, Madrid, Öffentlichkeitsarbeit und
Mitgliederservice, Praktikum
Bayerische Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen, München, Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit, Praktikum
ASKO EUROPA-STIFTUNG, Saarbrücken, Unterstützung der Organisation des
Deutsch- Französischen Dialogs 2002, Tätigkeit als studentische Hilfskraft
SIEMENS Saarbrücken, Vertrieb, Werkstudententätigkeit
TINSA Tasaciones Inmobiliarias, Madrid, Praktikum
S p r a c h e n :
Französisch,
Spanisch, Englisch:
fließend in Wort und Schrift
I
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ... III
I Einleitung ... 1
1 Forschungsgrundlage ... 2
2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit... 4
II Interkulturalität am Beispiel der italienischen Immigranten in Montreal ... 6
1 Theoretische Aspekte... 6
1.1 Definitorische Einführung ... 6
1.1.1 Begriffserklärung ,,Interkulturalität" und ,,Hybridität"... 6
1.1.2 Abgrenzung von ,,Multikulturalität" und ,,Transkulturalität"... 8
1.2 Interkulturalität durch Immigration ... 9
1.2.1 Sprachliche Phänomene der Interkulturalität ... 9
1.2.2 Akkulturation ... 12
1.2.3 Integration und Assimilation... 14
1.3 Problematische Aspekte der Interkulturalität ... 16
1.3.1 Identitätskonflikt ... 16
1.3.2 Gesellschaftliche Konflikte ... 18
2 Italienische Immigranten in Montreal... 21
2.1 Geschichtlicher Abriss der italienischen Einwanderung in Montreal ... 22
2.2 Die heutige italienische Gemeinschaft in Montréal ... 25
2.2.1 Kanadische Immigrationspolitik und ihre Umsetzung in Quebec ... 26
2.2.2 Die Frage der Identität... 30
III Immigration im Film am Beispiel von Caffè Italia, Montréal, La Sarrasine
und La déroute... 35
1 Eine Produktion in Teamwork: Paul Tana, ,,l'artiste immigrant", und sein Co-
Drehbuchautor Bruno Ramirez ... 35
2 Filmanalyse von Caffè Italia, Montréal ... 39
2.1 Inhalt und Personen: Die Geschichte der italienischen Einwanderung und die Suche
nach Identität ... 41
2.2 Dramaturgie und filmische Mittel: Die Form der ,,Doku-Fiktion" ... 43
2.3 Interkulturelle Aspekte: Auf der Suche nach Identität... 52
2.3.1 Mögliche Facetten der Identität... 52
2.3.2 Hybridität auf mehreren Ebenen ... 61
2.3.3 Sprachliche Darstellung der Interkulturalität ... 63
2.3.4 Identität vor dem Hintergrund des ,,Multiculturalism Act" ... 65
2.4 Zusammenfassung... 66
3 Filmanalyse von La Sarrasine... 67
3.1 Inhalt und Personenkonstellation: Ein tragischer Mordfall und die Emanzipation der
italienischen Einwanderin Ninetta ... 68
3.2 Dramaturgie und filmische Mittel: Theatrale Elemente und Perspektivenwechsel durch
elliptische Erzählweise ... 72
3.3 Interkulturelle Aspekte: Die Anfänge der Interkulturalität ... 77
II
3.3.1 Emanzipation aus dem Patriarchat ... 78
3.3.2 Ausländische Traditionen und die Reaktion darauf ... 81
3.3.3 Phänomene der multikulturellen Gesellschaft... 88
3.3.4 Die Abhängigkeit der Sprache vom Raum... 97
3.4 Zusammenfassung... 101
4 Filmanalyse von La déroute... 101
4.1 Inhalt und Personenkonstellation: Das Familiendrama des italienischen Selfmademan
Joe Aiello... 102
4.2 Dramaturgie und filmische Mittel: Der Film im Film als Prolog zur Tragödie ... 106
4.3 Interkulturelle Aspekte: Von der Darstellung der Gemeinschaft zur Darstellung einer
Konfrontation ... 111
4.3.1 Synkretismus aus Moderne und Tradition ... 112
4.3.2 Sprachliche Vermischung ... 118
4.3.3 Der Generations- und Traditionskonflikt: Joe versus Bennie ... 121
4.4 Zusammenfassung... 136
5 Vergleichende Zusammenführung... 137
5.1 Problematiken... 137
5.2 Interkulturelle Erfahrungen ... 141
5.3 Die Wahl der Filmgenres... 142
5.4 Paul Tanas Filme im historischen Kontext... 144
IV Fazit und Ausblick ... 147
Literaturverzeichnis... 149
Anhang ... 154
Anhang 1: Gespräch mit Paul Tana, am 01.08.2005 ... 155
Anhang 2: Gespräch mit Bruno Ramirez, am 28.07.2005 ... 169
Anhang 3: Sequenzanalyse zu Caffè Italia, Montréal ... 191
Anhang 4: Sequenzanalyse zu La Sarrasine... 194
Anhang 5: Sequenzanalyse zu La déroute ... 203
III
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Italienische Immigranten... 70
Abbildung 2: Franko-Quebecer... 70
Abbildung 3: Beziehungen zwischen italienischen Immigranten und Franko-Quebecern ... 71
Abbildung 4: Wichtige Personen für Giuseppes Begnadigung... 72
Abbildung 5: Familie Aiello ... 104
Abbildung 6: Wichtige Personen und ihre Verbindung zu Joe ... 105
Abbildung 7: Vom Familiendrama zum Mord... 106
(Anmerkung: Als Abbildungen sind nur selbst erstellte Diagramme aufgeführt. Zudem enthält diese Arbeit
Filmausschnitte, die teils selbst erstellt, teils aus Quellen übernommen wurden. Ein Hinweis zur Herkunft der
übernommenen Ausschnitte ist jeweils mit Quellenangabe gekennzeichnet. Die selbst erstellten
Filmausschnittesind nicht explizit markiert.)
1
I Einleitung
Die gängige Präsentation von Interkulturalität im Film beschränkt sich zumeist auf Formen
der Darstellung des Exotismus, in denen Interkulturalität vor allem aus der einseitigen
Betrachtungsweise der Ausgangskultur mit Blick auf das Fremde dargestellt wird. So wird das
Fremde meist auf Stereotypen reduziert oder durch exotisch wirkende Personen und
Inszenierungen, wie zum Beispiel der orientalischen Umgebung in Minghellas Der Englische
Patient, wiedergegeben. Oft spielen europäische oder amerikanische Helden in einer
exotisierten und für ein Publikum, das vor allem Filmproduktionen aus Hollywood gewöhnt
ist, faszinierenden Umgebung die Hauptrollen in Filmen, die ebenfalls für eine europäische
und amerikanische Zuschauerschaft gedreht wurden.
Mittlerweile sind jedoch neue Themen ins Blickfeld der Interkulturalität gerückt. Durch die
Migrationsströme des letzten Jahrhunderts und die zunehmende Globalisierung der
Wirtschaft, haben sich multikulturelle Gesellschaften entwickelt, in denen sich ethnische
Gruppen und kulturelle Gemeinschaften nebeneinander herausbilden, die kulturell
interagieren. Besonders die Frage der Immigration ist für viele Staaten hochaktuell und wirkt
sich politisch wie auch sozial aus.
So hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Riege von Regisseuren aus Immigrantenkulturen
gebildet, die aus ihrer besonderen Perspektive aus der Mitte der Immigrantengruppen
Interkulturalität filmisch neu definieren. Es kann von einer ,,filmischen Wortergreifung"
1
von
innen gesprochen werden, durch die diese Künstler Problematiken und Themen der
Immigration aufgreifen und in ihren Werken umsetzen.
Gerade die Quebecer Region, die im kanadischen Staat durch ihre französischsprachige
Mehrheit einen besonderen Status einnimmt, beherbergt eine große Zahl an Immigranten. So
formierte sich seit den 70er Jahren, die durch die politische Machtübernahme der
frankophonen Mehrheit maßgebliche Veränderungen in Quebec brachten, eine Generation
von Künstlern italienischer Herkunft. In ihren Werken schlägt sich ihre italo-quebecer
Identität und ihre Lage als Mitglieder einer ethnischen Minderheit nieder. Zu diesen Künstlern
gehört der Regisseur Paul Tana, der als Sohn italienischer Immigranten in seinen Filmen das
Thema der Einwanderung und im Besonderen die Gemeinschaft der italienischen
Immigranten in Montreal behandelt. So stellt sich die Frage, wie Tana interkulturelle
1
Lüsebrink, Hans-Jürgen und Dion, Robert, ,,Interkulturalität im außereuropäischen Film am Beispiel von
Xala (Senegal) und La Déroute (Québec)" in: Hans-Jürgen Lüsebrink und Klaus Peter Walter, (Hrsg.),
Interkulturelle Medienanalyse- Methoden und Fallbeispiele aus den romanischen Kulturen des 19. und 20.
Jahrhunderts, St. Ingbert, Röhrig, 2003, S. 193.
2
Erfahrungen und Problembereiche dieser Immigrantengemeinschaft in thematischer und
filmischer Weise darstellt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird diese Fragestellung auf die drei Filme Caffè Italia, Montréal,
La Sarrasine und La déroute des italo-kanadischen Regisseurs bezogen und anhand einer
Analyse betrachtet. Die Besonderheit dieser Arbeit liegt in der Thematisierung der
Immigration aus Sicht eines Regisseurs, der selbst Teil der Einwanderer ist. Auf diese Weise
wird ein völlig neuer Bereich bearbeitet, der bis heute noch nicht Einzug in die Forschung
erhalten hat.
Im Mittelpunkt der Analyse werden zu diesem Zweck folgende Fragen stehen:
Welche Problematiken und interkulturelle Erfahrungen behandelt der Regisseur in seinen
Filmen? Wie erfolgt die filmische Umsetzung und welche Filmgenres werden dafür
herangezogen? Inwiefern spielt der historische und gesellschaftliche Kontext Montreals eine
Rolle in Tanas Filmen?
Intention dieser Arbeit ist es demnach, den besonderen Blickwinkel des italo-kanadischen
Regisseurs als Einwanderer auf die italienische Gemeinschaft in Montreal und die
Interkulturalität, die seine Filme ausmacht, mit besonderer Berücksichtigung der filmischen
Mittel darzulegen.
1 Forschungsgrundlage
Zwar ist das Thema der Interkulturalität im Film ein wissenschaftlich viel bearbeiteter Aspekt,
jedoch beschränken sich die meisten Arbeiten auf Analysen, die Interkulturalität mit einem
Blickwinkel von Außen betrachten. So liegt jedoch die Besonderheit dieser Arbeit in der
Perspektive des Regisseurs, der von seiner Position innerhalb der Gemeinschaft der
Immigranten aus das Wort ergreift.
So betrachtet allein Summerfield (1993) in Crossing cultures through film
2
Interkulturalität
aus der für diese Arbeit nötigen Perspektive, sieht aber vor allem den Nutzen in
pädagogischer Sicht. Das Medium Film dient ihr hierbei als Instrument zum interkulturellen
Lernen. So ist ihr Werk ein didaktischer Leitfaden zum Einsatz von Film mit dem Ziel,
Schüler und Studenten interkulturell zu sensibilisieren.
Da keine zum Thema passende theoretische Grundlage aufzufinden war, wurde auf Werke
zurückgegriffen, die sich mit Interkulturalität in Literatur und Theater beschäftigen. Weil vor
allem das Theater dem Medium Film in seiner Darstellungsweise sehr nahe ist, waren
Theorien zu erwarten, die sich auch auf den Film beziehen lassen. Dennoch stellte sich
2
vgl. Summerfield, Ellen, Crossing cultures through film, Yarmouth, Intercultural Press, 1993.
3
heraus, dass sich Interkulturalität im Theater meist als Inszenierung von ,,exotischen" Stoffen
präsentierte. Zum Beispiel beschäftigt sich Pavis (1990) vor allem in Le théâtre au croisement
des cultures
3
mit der Inszenierung von Interkulturalität, wobei er weniger interkulturelle
Thematiken, sondern vor allem die Umsetzung literarischer Vorlagen aus fremden Kulturen
durch Bühnenbild und Schauspieler beschreibt. Auch die Rolle des Zuschauers, der mit der
Adaptation von fremden Stoffen konfrontiert wird, ist hier von Bedeutung.
Obwohl Blioumi (2001) in Interkulturalität als Dynamik
4
eine literarische Analyse vorschlägt,
dient dieses Buch hier als eine der wichtigsten Forschungsgrundlagen, weil im Fokus ihrer
Arbeit Migrationsliteratur steht. Sie stellt ein Analyseraster vor, das auch auf Filme bezogen
werden kann und im Rahmen dieser Arbeit angewandt wird.
Im konkreten Zusammenhang mit den analysierten Filmen wird sich vor allem auf Artikel aus
kanadischen Filmzeitschriften sowie der kanadischen Tagespresse bezogen, die zum Teil in
Interviews mit dem Regisseur auf seinen Hintergrund als Immigrant eingehen und die Filme
hinsichtlich dieses Aspekts interpretieren. Nilsson-Juliens (2002) Aufsatz Irgendwie anders:
Paul Tanas Caffè Italia, Montréal
5
betrifft die politische Realität Kanadas und stellt die
Frage, ob das Medium Film die Mauern des Multikulturalismus durchbrechen kann. Dabei
steht die Frage der Darstellung des Fremden oder des Immigranten und seines Platzes in der
Gesellschaft im Mittelpunkt. Außerdem geht er besonders auf die Person des Regisseurs,
seine Hybridität als Immigrant und deren Verarbeitung im Film ein.
Ebenso ist die ,,filmische Wortergreifung" von Tana als Immigrant Ausgangspunkt von
Lüsebrinks und Dions (2003) Filmanalyse Interkulturalität im außereuropäischen Film am
Beispiel von Xala (Senegal) und La Déroute (Québec)
6
. Der Fokus liegt hier sowohl auf der
sprachlichen Komponente als auch auf der Vermischung von Einflüssen des alten und neuen
Lebens der Immigranten.
In Sanakers (2001) Aufsatz Le Québec à l'écran: espace de rencontres et de conflits
linguistiques. Etude sur la Sarrasine de Paul Tana
7
lobt der Autor den kulturellen Realismus,
durch den der Regisseur die Dreisprachigkeit der italienischen Immigranten inszeniert. Seine
3
vgl. Pavis, Patrice, Le théâtre au croisement des cultures, Paris, Corti, 1990.
4
vgl. Blioumi, Aglaia, Interkulturalität als Dynamik- Ein Beitrag zur Griechischen Migrationsliteratur seit den
siebziger Jahren, Tübingen, Stauffenburg-Verlag, 2001.
5
vgl. Nilsson-Julien, Olivier, "Irgendwie anders: Paul Tanas Caffè Italia, Montréal. Zur Hybridität des
quebekischen Kinos und der quebekischen Kultur" In: Larouche, Michel, Quebec und Kino: die Entwicklung
eines Abenteuers, Münster, 2002.
6
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen und Dion, Robert, ,,Interkulturalität im außereuropäischen Film am Beispiel von
Xala (Senegal) und La Déroute (Québec)" In: Hans-Jürgen Lüsebrink und Klaus Peter Walter, (Hrsg.),
Interkulturelle Medienanalyse- Methoden und Fallbeispiele aus den romanischen Kulturen des 19. und 20.
Jahrhunderts, St. Ingbert, Röhrig, 2003, S. 189-209.
7
vgl. Sanaker, John Kristian, ,,Le Québec à l'écran: espace de rencontres et de conflits linguistiques. Etude sur la
Sarrasine de Paul Tana", In: Jaap Lintvelt und François Paré, Frontières flottantes - lieu et espace dans les
cultures francophones du Canada, Amsterdam (u.a.), Rodopi, 2001, S. 231-243.
4
Analyse betrachtet die Sprache als Vehikel zur kulturellen Identifikation und analysiert sie im
Bezug auf die räumliche Komponente.
Zur Filmanalyse wird sich im Folgenden auf die Artikel von Nilsson-Julien, Lüsebrink und
Dion und Sanaker bezogen, die in diesem Bereich als Forschungsgrundlage dienen.
2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Da es sich bei der Untersuchung um eine Filmanalyse handelt, sind die drei erwähnten Filme
primäre Quellen dieser Arbeit. Des Weiteren war es dank eines Stipendium des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes für einen Forschungsaufenthalt in Montreal möglich,
spezielle Fragen zu den Filmen und den Thematiken in Interviews mit dem Regisseur
(Anhang 1) und seinem Co-Drehbuchautor (Anhang 2) zu klären.
Um kurz den Aufbau dieser Arbeit zusammenzufassen, soll zunächst die vierteilige
Grobgliederung dieser Arbeit vorgestellt werden: nach der Einleitung folgt eine
Dokumentation der Interkulturalität am Beispiel der italienischen Immigranten in Montreal.
Daran schließt der Analyseteil der Filme von Paul Tana an. Abschließend wird der Mehrwert
dieser Arbeit in einem Fazit resümiert und daraufhin ein Ausblick auf die Entwicklung der
Quebecer Gesellschaft gegeben.
Das Kapitel der Interkulturalität am Beispiel der italienischen Immigranten ist zweigeteilt.
Zunächst erfolgt eine definitorische Erklärung relevanter Begriffe wie ,,Inter-", ,,Trans- " und
,,Multikulturalität", woraufhin interkulturelle Aspekte dargestellt werden, die mit Immigration
zusammenhängen. Hierzu gehören sprachliche Phänomene, Akkulturation sowie Integration
und Assimilation. Auch die problematischen Aspekte der Interkulturalität, wie die Suche nach
Identität und gesellschaftliche Konflikte, werden in diesem Abschnitt behandelt. Nach dieser
theoretischen Heranführung an das Thema der Interkulturalität im Zusammenhang mit
Immigration folgt die konkrete Weiterführung in einem deskriptiven Abschnitt über die
italienische Gemeinschaft in Montreal. Wichtig erschien hierbei die geschichtliche
Darstellung der italienischen Immigration nach Montreal, sowie Aspekte, die aktuell die
italienische Gemeinschaft betreffen, wie die Quebecer Immigrationspolitik und die Frage der
Identität. Diese Bereiche finden in den zu analysierenden Filmen ihre Erwähnung und sind
aus diesem Grund von Relevanz.
Im analytischen Part dieser Arbeit werden nach einer kurzen Vorstellung des Regisseurs und
seines Drehbuchautors die drei Filme untersucht. Dieses Kapitel macht den größten und
wichtigsten Teil der Arbeit aus. Zum besseren Vergleich wurde folgendes Analyseschema auf
jeden Film angewandt: Nach einer Inhaltsangabe und der Darstellung der
5
Personenkonstellation folgt eine Analyse hinsichtlich der Dramaturgie und der filmischen
Mittel. Schließlich werden die interkulturellen Aspekte herausgearbeitet. Zudem fließen die
Ergebnisse von Sequenzanalysen ausgewählter Szenen in die verschiedenen Unterkapitel ein,
die in je einem Sequenzprotokoll (Anhang 3-5) pro Film im Anhang nachzuvollziehen sind.
Abschließend werden die Filme in einer Zusammenführung hinsichtlich der Problematiken,
der interkulturellen Erfahrungen, der Filmgenres und des historischen Kontextes
gegenübergestellt und verglichen. In einem Fazit wird zuletzt das Ergebnis der Arbeit
zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.
6
II Interkulturalität am Beispiel der italienischen Immigranten in
Montreal
1 Theoretische Aspekte
Für eine Vorstellung der Thematik müssen zunächst einige theoretische Aspekte der
Immigration erörtert werden. Zu diesem Zweck wird im folgenden Kapitel eine definitorische
Einführung gegeben, sowie die Entstehung der Interkulturalität durch Immigration erklärt.
Abschließend wird auf Problematiken eingegangen, die durch das Phänomen der Immigration
entstehen.
1.1 Definitorische Einführung
Im Folgenden soll das Begriffspaar der ,,Interkulturalität" und ,,Hybridität" definiert, sowie
von den Begriffen ,,Multikulturalität" und ,,Transkulturalität" abgegrenzt werden.
1.1.1 Begriffserklärung ,,Interkulturalität" und ,,Hybridität"
Beim Begriff der ,,Interkulturalität" handelt es sich um die Überschreitung einer Grenze
zwischen zwei Gruppen, aus der ein neuer gemeinsamer Raum, eine Art Schnittmenge,
geschaffen wird.
8
Bleicher wendet dieses Konzept auf literarische Texte an und folgert
daraus, dass die eigene Kultur nicht ausnahmslos aus eigenen Elementen besteht, sondern
auch aus fremden Einflüssen.
9
Interkulturalität richtet somit die Aufmerksamkeit auf den neu
geschaffenen Raum zwischen verschiedenen Kulturen.
10
Während interkulturelle Kommunikation eine kommunikative Beziehung zwischen
unterschiedlichen Kulturen in verbaler, non-verbaler und medialer Form ist
11
, zeichnet sich
Interkulturalität laut Lüsebrink durch vier verschiedene Phänomene aus: Phänomene von
zwischenkultureller Natur, die nicht im Rahmen einer Kommunikation ablaufen, Phänomene
der Sprachmischung (zum Beispiel Kreolsprachen), Formen der Kulturmischung wie zum
Beispiel im kulturellen Synkretismus von Kleidung (Afrolook) oder Musik (Reggae).
Letztlich zählt er Prozesse der kreativen Integration von Elementen fremder Kulturen zu den
Phänomenen der Interkulturalität, die sich im kulturellen Bereich, wie zum Beispiel in der
8
vgl. Stefan Rieger, Schamma Schahadat und Manfred Weinberg, zit. nach Blioumi, Aglaia, S. 89.
9
vgl. Thomas Bleicher, zit. nach Blioumi, Aglaia, S. 91.
10
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 92.
11
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung,
Kulturtransfer. Stuttgart (u.a.), Verlag J.B. Metzler, 2005, S. 13.
7
Literatur, durch die Rezeption fremdkultureller Werke manifestiert.
12
Laut Lüsebrink sind die
Begriffe ,,Interkulturalität" und ,,Hybridität" synonym, wobei vor allem in der neueren
Forschung Termini wie ,,Hybridität", ,,Hybridisierung" und ,,kultureller Synkretismus" zu
finden sind.
13
Sie unterscheiden sich durch feine Nuancen, beschreiben jeweils verschiedene
Formen der Kulturmischung, weisen aber als Gemeinsamkeit ,,die kreative Verbindung und
Verschmelzung von Elementen aus unterschiedlichen Kulturen, häufig als Konsequenz
unmittelbarer interkultureller Kontakte" auf.
14
Der Begriff ,,Métissage" hingegen, ein weiteres
Synonym für ,,Interkulturalität", stammt aus dem portugiesischen Sprach- und Kulturraum des
16. Jahrhunderts und ist kolonial belastet.
15
So wird in der neueren postkolonialen
Kulturtheorie der Begriff ,,Hybridität" bevorzugt.
16
Der Term ,,Hybridität" beschreibt laut Bronfen und Marius eine ,,Vermischung von
Traditionslinien oder von Signifikantenketten" und verknüpft somit unterschiedliche Diskurse
und Technologien, die ,,durch Techniken der collage, des samplings, des Bastelns"
17
zustande
gekommen sind.
Hierbei gilt es, Brüche, Übergänge und Metamorphosen zu erörtern.
18
Hybridität ist jedoch
für das Individuum vor allem als persönlicher Nutzen zu sehen. Das kulturell Hybride sei laut
Barlowen von Constantin als Stärke und nicht als Schwäche der Persönlichkeit zu verstehen.
19
Ausschlaggebend sei dabei, das Fremde in sich selbst festzustellen und zu akzeptieren. So
würde sich eine interkulturelle Identität bilden. Wichtig sei dabei, eine gewisse Dynamik und
den Wandel zuzulassen, die das starre Verharren auf dem Gegensatz zwischen Fremdem und
Eigenem ablösen.
20
Hybridität erfährt dadurch eine Aufwertung und drückt sich beim
Individuum durch das Bewusstsein über die ständige Veränderung und den Facettenreichtum
seiner Identität aus.
21
Im Kollektiv kann Hybridität durch ,,die Anerkennung des kulturellen
Pluralismus" ausgedrückt werden. So unterscheidet Blioumi ,,Interkulturalität" und
,,Hybridität", indem sie letzteres auf Identitäten bezieht, ,,Interkulturalität" jedoch als
Oberbegriff für ,,den Zwischenraum bei der Überlappung von Kulturen"
22
sieht. So kann zum
Beispiel im Rahmen der Immigration von hybriden Identitäten die Rede sein, wenn
12
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 14.
13
vgl. ebd., zit. nach: Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 14.
14
Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 14.
15
vgl. François Laplantine und Alexis Nouss zit. nach Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation,
S. 14.
16
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 15.
17
Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius, zit. nach Blioumi, Aglaia, S. 94.
18
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 94.
19
vgl. Constantin von Barlowen, zit. nach Blioumi, Aglaia, S. 93.
20
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 93/94.
21
vgl. ebd., S. 95.
22
ebd.
8
Einwanderer nach längerem Aufenthalt in der neuen Heimat neue Elemente aufnehmen und
diese sich mit ihrer ursprünglichen Identität mischen. Da sich dieser Vorgang jedoch nicht nur
als Bereicherung, sondern auch in Verwirrung der Immigranten angesichts ihrer Identitäten
aufgefasst wird, kann es zu einem Identitätskonflikt kommen, der noch unter dem Kapitel der
Problematiken genauer betrachtet wird.
1.1.2 Abgrenzung von ,,Multikulturalität" und ,,Transkulturalität"
Allgemein definiert Lüsebrink ,,Multikulturalität" als ,,das Nebeneinander verschiedener
Kulturen (im anthropologischen Sinn) innerhalb eines sozialen Systems (meistens einer
Nation)"
23
und ergänzt diese Definition nach Mintzel, der in den 60er Jahren den Begriff der
,,Multikulturellen Gesellschaft" prägte. Mintzel beschreibt ,,Multikulturalität" als ,,vielfältige
kulturelle Differenziertheit"
24
einer Gesellschaft, die, entweder friedlich oder im Widerstreit,
nebeneinander oder miteinander existiert.
25
Das Phänomen der Multikulturalität erweitert eine
Gesellschaft nicht nur zahlenmäßig, so Bastenier, sondern auch um die Verschiedenheit der
Herkunftsländer ihrer Mitglieder. Da durch die Migrationsströme im Laufe des vergangenen
Jahrhunderts die multikulturelle Gesellschaft zur Realität vieler Länder geworden ist, könne
von einer ,,sorte de cosmopolitisme de masse"
26
gesprochen werden, die der Modernität eine
multikulturelle Dimension verleiht.
27
Es können weiterhin drei Modelle der multikulturellen Gesellschaft unterschieden werden:
Das assimilationistische Modell, das Apartheid-Modell und das polyzentrische Modell.
So bemühen sich Gesellschaften im assimilationistischen Modell, Minderheiten oder
Einwanderer kulturell anzupassen. Als Variation davon geht das integrative Modell von einer
längeren Eingewöhnungszeit aus und räumt im Besonderen Einwanderern Sonderrechte ein.
Im Gegensatz dazu grenzt ein Staat im Apartheid-Modell, wie zum Beispiel in Südafrika vor
1995, kulturelle Gruppen durch Abschottung und Ghettoisierung aus. Unterschiede wie
Hautfarbe und Herkunft sind nicht zu überwinden und eine ethnische Rangordnung begrenzt
die sozialen Chancen. Schließlich existieren im polyzentrischen Modell verschiedene
Kulturen gleichberechtigt nebeneinander, wie zum Beispiel teilweise in der Schweiz, Belgien
und Kanada.
28
23
Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 16.
24
ebd., S. 17.
25
vgl. ebd., S. 16/17.
26
Bastenier, Albert, ,,Intégration des immigrés ou réintégration dans la société?", In: Yannick Resch, Définir
l'intégration? Perspectives nationales et représentations symboliques, Montreal, XYZ, 2003, S. 64.
27
vgl. ebd.
28
vgl. Claus Leggewie, zit. nach: Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 17.
9
Während ,,Multikulturalität" auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit abzielt, steht der Begriff
,,Transkulturalität" besonders für Individuen und ihre Identität. Transkulturalität bezeichnet
Identitäten als plural kulturell und erklärt diesen Zustand als Ergebnis kultureller
Verflechtung.
29
Laut Wägenbaur sind dank Transkulturalität multilaterale Beziehungen und
Kulturaustausche möglich. Des Weiteren bezeichnet er Transkulturalität als ,,Modell der
kulturellen Dynamik"
30
: Differenzen werden von den verschiedenen Gruppen ohne weitere
Reflexion aufgenommen
31
, der Gegensatz von Eigenem und Fremden überwunden und nicht
mehr als starrer Zustand, sondern als fließend aufgefasst.
32
Ramirez bestätigt diese These und
unterstreicht, dass die Vorsilbe ,,trans" besonders das Überschreiten eines kulturellen Raumes
bedeutet, durch das neue dynamische Zustände geschaffen werden.
33
Sowohl Multikulturalität als auch Transkulturalität stehen mit der interkulturellen
Kommunikation und Phänomenen der Interkulturalität in enger Verbindung, so Lüsebrink.
Als Beispiel nennt er den Kontakt zwischen Immigranten und Hegemonialkultur im
nationalstaatlichen Rahmen oder interkulturelle Phänomene wie Sprachmischung und Code-
Switching, auf die noch im Weiteren eingegangen wird.
34
1.2 Interkulturalität durch Immigration
Durch Immigration siedeln sich ethnische und kulturelle Minoritäten in einer fremden
Hegemonialkultur an. Im Laufe der Zeit entwickeln sich durch den Kontakt der verschiedenen
Gruppen Phänomene, die einerseits die Einwanderer betreffen und sich andererseits auf die
Hegemonialkultur auswirken. Im Weiteren werden einige dieser Phänomene besprochen, die
die sprachliche Dimension, die kulturelle Transformation der Akkulturation und die
Eingliederung in die neue Kultur im Rahmen der Integration betreffen.
1.2.1 Sprachliche Phänomene der Interkulturalität
Als eines der wichtigen Felder der Immigration ist die sprachliche Dimension zu betrachten.
Um in einem neuen Land Fuß zu fassen, ist es für Einwanderer vor allem wichtig, so schnell
wie möglich die Landessprache zu erlernen. Da selbstverständlich die Muttersprache
gleichzeitig nicht verloren geht, existieren zwei Sprachen nebeneinander und bilden einen
Bilingualismus. Genauso ist es ebenfalls möglich, dass mehrere Sprachen aufeinander treffen,
29
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 17.
30
Thomas Wägenbaur, zit. nach: Blioumi, Aglaia, S. 90.
31
vgl. ebd., zit. nach: Blioumi, Aglaia, S. 90.
32
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 90.
33
vgl. Bruno Ramirez, Anhang 2, S. 170.
34
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 18.
10
wie es zum Beispiel in zweisprachigen Städten wie Montreal oder Barcelona der Fall ist, wo
sich durch die Sprache des Immigranten ein Trilingualismus entwickelt und die Diskussion
um plurilinguale Gesellschaften entfacht.
Multilinguale
35
Staaten sind keine Rarität, sondern stellen eine gewöhnliche Situation dar.
Laut Leclerc wird von einem multilingualen Staat gesprochen, sobald zwei oder mehr
Sprachen von mindestens 10% der Bevölkerung gesprochen werden. Weltweit gesehen sind
nur 38 von 197 Staaten einsprachig. Folglich stellen knapp 75% der Staaten, deren Bürger
insgesamt 91% der Weltbevölkerung ausmachen, eine multilinguale Situation dar. Aus
diesem Grund ist Quebec linguistisch gesehen keine Besonderheit.
36
Um den Begriff des Bilinguismus zu definieren, muss zwischen seinen verschiedenen
Ausprägungen differenziert werden: Von individuellem Bilinguismus ist die Rede, sobald
eine Person zwei Sprachen beherrscht. Der soziale Bilinguismus bezeichnet die
Zweisprachigkeit mehrerer Individuen einer Gruppe. Letztlich stellt der staatliche
Bilinguismus die Zweisprachigkeit im offiziellen und staatlichen Bereich dar, wobei die
Bewohner dieses Staates nicht unbedingt zweisprachig sein müssen.
37
Grundsätzlich ist ein
einsprachiges Staatsgebilde aus folgenden Gründen vorzuziehen: einsprachig organisierte
Länder sind wirtschaftlich produktiver
38
, bilden leichter ein Nationalgefühl im Bewusstsein
seiner Einwohner aus und sind einfacher bürokratisch koordinierbar.
39
Um sich diese Vorteile
zunutze zu machen, erheben Staaten eine bestimmte Sprache zur Nationalsprache. In diesen
Fällen kommt es zur ,,Diglossie". Laut Ferguson, der diesen Begriff als erster prägte, bestehen
zwei Sprachen nebeneinander, wobei aber, im Gegensatz zum Bilingualismus, eine Hierarchie
zwischen diesen Sprachen besteht.
40
Das Wort ,,glossa" kommt aus dem Griechischen und
bedeutet ,,Sprache", der Präfix ,,di" deutet auf einen Konflikt zwischen diesen Sprachen hin.
So wird die übergeordnete Sprache in geschriebener, formeller Form und in der Schule
benutzt, die untergeordnete für alltägliche Unterhaltungen. Dabei ist die Unterscheidung
zwischen übergeordneter und untergeordneter Sprache sehr konkret: in einer öffentlichen
Ansprache würde die untergeordnete Sprache lächerlich klingen, genauso wie die
übergeordnete in Alltagsgesprächen wie beim Bäcker oder auf dem Markt. Im Allgemeinen
wenden sich Eltern in der untergeordneten Sprache an ihre Kinder, so dass diese
35
Anm.: Die Begriffe ,,Multilingualität" und ,,Plurilingualität" sind als identisch aufzufassen. Jedoch wird
,,Multilingualität" zur Charakterisierung von Staaten und ,,Plurilingualität" zur Charakterisierung von
Gesellschaften und ihrer Individuen benutzt.
36
vgl. Jacques Leclerc, zit. nach: (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie,
http://wwwens.uqac.ca/~flabelle/socio/diglossie.htm, aufgerufen am 18.12.05.
37
vgl. (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie.
38
vgl. J. Pool, zit. nach: (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie.
39
vgl. (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie.
40
vgl. Charles Ferguson, zit. nach: (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie.
11
Sprachvariante zur Muttersprache wird. Die übergeordnete Sprache wird in der Schule
erlernt.
41
Als Beispiel für eine diglossische Situation gelten die Quebecer Verhältnisse der
50er und 60er Jahre, in denen laut Lieberson das Englische die Sprache der einflussreichen
Geschäftswelt und das Französische die der Dienstleister war.
42
Während Ferguson von Diglossie als Konfliktzustand ausgeht, steht bei Boyer der friedliche
Aspekt der Zweisprachigkeit im Vordergrund. Meist komme Zweisprachigkeit im Gespräch
zwischen zwei Personen vor und fördere dadurch eine Annäherung der Sprachen.
43
Hierfür
führt er das diglossische Beispiel der allemannischen Schweiz an, in der mehrere Sprachen
koexistieren ohne in Konflikt zu geraten.
44
Matthey und De Pietro stellen sich die Frage, ob
eine plurilinguale Gesellschaft möglich ist und stützen sich zur Beantwortung dieser Frage auf
die Recherchen von Lüdi und Py (im Weiteren wird diese Forschungsgruppe als ,,Corpus
Bâle-Neuchâtel" aufgeführt), die Konversationen von deutsch-, italienisch- und
spanischsprachiger Einwanderern mit anderssprachigen Gesprächspartnern (meist
französisch- oder deutschsprachig) betrachtet haben
45
. Sprachliche Vorkommnisse sind in
diesem Zusammenhang zum Beispiel die Wortneuschöpfung, ,,le néocodage", und
transkodische Markierungen, ,,les marques transcodiques"
46
Unter ,,néocodage" verstehen Matthey und De Pietro die Schöpfung neuer Wörter aus dem
Repertoire der Muttersprache und dem der fremden Sprache. So werden Formen und Wörter
geschaffen, die in keiner der beiden Sprachen ursprünglich existieren. Sie können durchaus
nur für den Zeitraum einer Konversation bestehen oder ebenso auf längerem Zeitraum
erhalten bleiben.
47
Beispielsweise verwendeten in einer Studie von Grosjean und Py
spanischsprachige Einwanderer im französischsprachigen Teil der Schweiz für den Ausdruck
,,Post" nicht mehr das spanische ,,correos", sondern ,,posta", eine Wortneuschöpfung, die so
auch nicht im Französischen vorkommt.
48
Der Begriff der ,,transkodischen Markierungen" umfasst alle sprachlichen Phänomene, die
von einer Zwei- oder Mehrsprachigkeit des Sprechers zeugen. Darunter fallen zum Beispiel
der anderen Sprache entliehene Worte, die in den Satz eingebaut werden
49
: ,,Il faut dire une
41
vgl. (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie.
42
vgl. Stanley Lieberson, zit. nach: (anonym), Langes en contact: Multilinguisme et diglossie.
43
vgl. Henry Boyer, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, ,,La société plurilingue: utopie
souhaitable ou domination acceptée?", In: Henri Boyer, Plurilinguisme: ,,contact" ou ,,conflit" de langues?,
Paris (u.a.), L'Harmattan, 1997, S. 134.
44
vgl. Georges Lüdi, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 135.
45
vgl. Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 135.
46
ebd., S. 150.
47
vgl. ebd.
48
vgl. François Grosjean und Bernard Py, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 151.
49
vgl. Georges Lüdi, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 152.
12
chose c'est que Bâle est peut-être un Sonderfall"
50
Wenn diese Ausleihungen mehrere Worte
betreffen, ist die Rede von ,,code-switching", wie zum Beispiel im folgenden Satz: ,,Erano
persino al porto dans des containers non so forse non li conoscono mais i containers ... voi
sapete cosa sono?"
51
. Schließlich ist von Sprachwechsel die Rede, wenn der Wechsel sich
über mehrere Sätze hinzieht.
52
Als Beispiel kann der folgende Wechsel zwischen Französisch
und Schwyzertütsch genannt werden:
Sprecher A: On va se mettre à parler schwyzertütsch ond eh gseen'ich au mer chönd au alli
Sprecher B: jo
Sprecher A: so dass mer au vo de Sprach her ohni witeres chönd wächsle.
53
Wie das Schweizer Beispiel belegt, ist eine Koexistenz mehrerer Sprachen auch ohne
Konflikte möglich. Aus dieser Koexistenz bilden sich verschiedene Formen der
Sprachmischung, die sich zum Beispiel im Sprachgebrauch von Immigranten wieder finden
lassen.
1.2.2 Akkulturation
Nach jahrelangem Aufenthalt in einer neuen Heimat, möchten viele Ausländer nicht mehr als
Immigranten bezeichnet werden. Dennoch drückt sich oft ihre Herkunft durch
Sprachbarrieren sowie kulturelle und mentale Unterschiede aus. Im Laufe der Zeit
übernehmen Immigranten jedoch kulturelle Eigenheiten des fremden Landes, was allgemein
als Akkulturation bezeichnet wird. Als eine der ersten Definitionen dieses Bereichs kann die
Erklärung von Redfield, Linton und Herskovitz aus dem Jahre 1936 gegeben werden:
,,Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals
having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in
the original culture patterns of either or both groups."
54
Wenn Immigranten ihre eigene Kultur
und zur ansässigen Kultur verschiedene Werthaltungen in die neue Heimat mitbringen,
machen sich nach einer gewissen Zeit Veränderungen bemerkbar, die teils selbständig, teils
von der Umwelt festgestellt werden.
55
Schmitt-Rodermund bezeichnet Akkulturation als einen Sammelbegriff für Prozesse und ihre
Ergebnisse, die sich durch den Transfer eines Individuums in einen anderen kulturellen
50
Corpus Bâle-Neuchâtel, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 151.
51
ebd., zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 151.
52
vgl. Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 152.
53
Corpus Bâle-Neuchâtel, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 152.
54
Robert Redfield, Ralph Linton und Melville Herskovits, zit. nach: Schmitt-Rodermund, Eva, Akkulturation
und Entwicklung Eine Studie unter jungen Aussiedlern, Weinheim, Beltz, 1997, S. 34.
55
vgl. Schmitt-Rodermund, Eva, S. 34.
13
Kontext ergeben. Ein Immigrant kann sich zum Beispiel im Bezug auf Einstellung und
Verhalten verändern oder eine neue Identität annehmen.
56
Abou betrachtet die Akkulturation aus einer psychologischen Sicht und teilt diese in zwei
verschiedene Formen auf: die der erwünschten Akkulturation und der erzwungenen.
Der Begriff der erwünschten Akkulturation kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden.
Einerseits wird Akkulturation als freiwillig bezeichnet, wenn das Individuum aus freien
Stücken Teile und Elemente der fremden Kultur annimmt. Ebenfalls ist bei diesem Vorgang
die Tatsache wichtig, dass die kulturelle Anpassung sich ohne Absorption der alten
kulturellen Eigenheiten vollzieht und dadurch die frühere Identität verloren geht. Dieser Fall
gilt für Immigranten, die die Möglichkeit haben, ihr eigenes Kulturgut so lange zu behalten,
wie sie es benötigen, um schließlich Werte und Eigenschaften der neuen Kultur zu
integrieren.
57
Doch erwünschte Akkulturation muss nicht unbedingt freiwillig sein. Ein Beispiel hierfür ist
der Imperialismus des 19. und 20. Jahrhunderts, als Kolonialmächte der eroberten
Bevölkerung ihre Kultur vorschrieben. Abou relativiert jedoch für diesen Ansatz den reinen
Kolonisationsgedanken und spricht von einem Modell, das, trotz geplanter
Akkulturationsmaßnahmen, auf die kulturellen Eigenheiten der Kolonialisierten eingeht. So
sei von Seiten der Kolonialisierten ein Verständnis für die Vorteile der Akkulturation
entstanden, sodass sie kulturelle Elemente der dominierenden Kultur in den eigenen
kulturellen Kontext eingebaut hätten. Diese neuen Inhalte seien uminterpretiert, mit den alten
Vorstellungen gekoppelt und von folgenden Generationen weiter getragen worden.
58
Eine Akkulturation, die keinen Platz für die kulturellen Eigenheiten der autochthonen
Gesellschaft lässt, wird als erzwungen bezeichnet. Es kann sogar von Ethnozid die Rede
sein.
59
Da diese Form der Akkulturation jegliche vorherige Form der dominierten Kultur
auslöscht, wird sie auch als Dekulturation bezeichnet.
60
Als Gegenwehr gegen die
erzwungene Akkulturation widersetzen sich die Individuen der dominierten Kultur in der
Gegen-Akkulturation den aufdoktrinierten Werten.
61
Abou fasst zusammen, dass eine Akkulturation besser gelingt, wenn sie aus freiem Willen und
nicht erzwungen vor sich geht.
62
Aus unfreiwilligen Kulturtransfers würden negative
56
vgl. Schmitt-Rodermund, Eva, S. 35.
57
vgl. Abou, Sélim, Psychopathologie de l'acculturation, Québec, Centre International de Recherche sur le
Bilinguisme, 1984, S. 15.
58
vgl. ebd., S. 13.
59
vgl. ebd., S. 9.
60
vgl. ebd., S. 11.
61
vgl. ebd.
62
vgl. ebd., S. 8.
14
Verhaltensweisen wie Hass und Aggression entstehen, sowie sich der Widerwille der
dominierten Person im Verlust des Selbstvertrauens oder in Minderwertigkeitsgefühlen
ausdrücken.
63
Um abschließend zur Immigration zurückzukehren, ist Akkulturation ein natürlicher Prozess
der Einwanderung, durch den sich die Neuankömmlinge langsam an ihr Umfeld gewöhnen,
die kulturellen Werte und Eigenheiten der Wahlheimat nach und nach in sich aufnehmen und
mit ihrer eigenen Kultur vermischen. Im allgemeinen Sprachgebrauch findet sich oft der
Ausdruck ,,Verwurzelung", durch den der Immigrant sinnbildlich zur Pflanze wird. Er will in
der neuen Erde Wurzeln schlagen und sich dort wohl fühlen. Dabei können im Laufe der Zeit
Werte und Traditionen der alten Heimat verloren gehen oder sich transformieren.
1.2.3 Integration und Assimilation
Ein weiteres Phänomen der Immigration ist die Integration der Einwanderer in das soziale
Gefüge eines Staates oder einer Gruppe. Reinhold definiert ,,Integration" wie folgt:
Integration ist die ,,Eingliederung eines Individuums in eine soziale Gruppe bei gleichzeitiger
Anerkennung als Mitglied."
64
Er unterscheidet zwischen verschiedenen Arten der Integration.
So verinnerlicht der Immigrant bei der normativen Integration Normen und Werte eines
sozialen Systems. Bei der politischen Integration wird von staatlicher Seite versucht,
unterschiedliche Gruppen zu einem gesamtgesellschaftlichen System zu verbinden. Dabei
sollen faktische und normative Unterschiede aufgehoben und verschiedenen Interessen eine
gemeinsame Richtung gegeben werden.
65
Im Rahmen der sozialen Integration soll dagegen
einzelnen Personen eine Position und Funktion in der Gesellschaft zugewiesen werden, wobei
diese Positionen im sozialen Gebilde von einander abhängig und aufeinander bezogen sind,
sodass sie ein Ganzes bilden.
66
Laut dem Sozialforscher Esser handelt es sich bei Integration um ein System im
Gleichgewicht. Dabei muss jedoch zwischen Sozialintegration und Systemintegration
unterschieden werden.
67
Unter der Sozialintegration von Einwanderern versteht man die
Eingliederung der Personen oder einer Gruppe von ihnen in ein soziales Gefüge. Diese
Sozialintegration hat zwei Dimensionen: die personale und die individuell-relationale Ebene.
In der personalen Dimension drückt sich die Zufriedenheit des Immigranten mit seiner
63
vgl. Abou, Sélim, S. 14.
64
Gerd Reinhold, zit. nach: Matkovi
, Mihael, Assimilation als Form der Eingliederung von Migranten: Eine
theoretische und empirische Analyse der Assimilation, Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, Diplomarbeit,
2004, S. 2.
65
vgl. ebd., zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 3/4.
66
vgl. ebd., zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 4.
67
vgl. Hartmut Esser, zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 11.
15
Aufnahme im Zielland aus. So steht gelungene Sozialintegration für eine erfolgreiche
Eingliederung und Überwindung der einwanderungsbedingten Probleme. Eine Ausgrenzung
sowohl von Seiten der Herkunfts- als auch Aufnahmegesellschaft wird verhindert. In der
individuell-relationalen Dimension spiegelt sich die regelmäßige und gewollte
Kontaktaufnahme zwischen Einwanderern und ansässigen Bürgern des Aufnahmelandes
wider.
Die Systemintegration bezeichnet die Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft und besitzt
eine kollektive Dimension. Durch diese Dimension wird das Gleichgewicht zwischen
verschiedenen Untergruppen in einer Gesellschaft beschrieben, wobei die einzelnen
Untergruppen nicht aneinander angeglichen werden, sondern ihre Partikularitäten behalten
können.
Sozial- und Systemintegration seien, so Esser, jedoch nicht abhängig voneinander. Es könne
eine hohe Systemintegration, also ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen
Untergruppen, bestehen, ohne dass die Immigrantengruppen in die Aufnahmegesellschaft
sozialintegriert sind. Das Gleiche gelte im umgekehrten Fall, wenn trotz hoher
Sozialintegration der einzelnen Gruppen die Systemintegration nicht funktioniere. Als
Beispiel ist hier der Zerfall des ehemaligen Jugoslawien anzuführen.
68
Während bei einer Integration von Einwanderern möglichst ihre Eigenheiten erhalten bleiben
sollen, ist die Assimilation eine Form von Eingliederung, durch die diese Eigenheiten
verloren gehen.
Allgemein kann ,,Assimilation" als die ,,Angleichung eines Individuums oder einer Gruppe an
die soziale Umgebung durch Übernahme ähnlicher Verhaltensweisen und Einstellungen"
69
bezeichnet werden. Während dieses Prozesses übernehmen Immigranten oder Minderheiten
Normen, Werte und Verhaltensmuster der Hegemonialkultur.
70
Laut Mintzel handelt es sich
hier um einen langwierigen Prozess, der entweder nur von Seiten der Immigranten oder durch
Beeinflussung der Hegemonialkultur stattfinden kann. Als Resultat der Assimilation kann von
einem Schwinden des Zugehörigkeitsgefühls zur einstigen Herkunftsgruppe die Rede sein. Da
dieser Prozess des Angleichens über mehrere Generationen abläuft, kann es zu Konflikten
zwischen den Vertretern der einzelnen Altersgruppen kommen.
71
Nach jahrelangem Aufenthalt in einer neuen Heimat, ist eine Assimilation der Immigranten
oft unumgänglich. Das Umfeld beeinflusst den Menschen so sehr, dass er sich automatisch
anpasst. Dieser Vorgang und auch der langsame Verlust der früheren heimatlichen Werte sind
68
vgl. Hartmut Esser, zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 12.
69
Werner Fuchs-Heinritz, zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 5.
70
vgl. Gerd Reinhold, zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 5.
71
vgl. Alf Mintzel, zit. nach: Matkovi
, Mihael, S. 10.
16
Immigranten bewusst, so dass sie wenigstens versuchen, aus diesem Vorgang zu profitieren
und ihre Aufnahmegesellschaft zu verändern.
72
So kann unter Integration der erwünschte Zustand der Eingliederung von Immigranten
verstanden werden, unter Assimilation aber ein unvermeidbarer Prozess, durch den die
Einwanderer zwar der fremden Gesellschaft näher kommen, dabei jedoch einen Teil ihrer
Kultur verlieren.
1.3 Problematische Aspekte der Interkulturalität
Immigration bringt nicht nur friedliche Veränderungen in der Gesellschaft mit sich, sondern
kann auch zu Konflikten führen. Der Schwebezustand zwischen alter und neuer Heimat kann
für den einzelnen Immigranten Unsicherheit in puncto Identität bedeuten. Von
gesellschaftlicher Seiten ist ebenfalls nicht immer ein Empfang mit offenen Armen zu
erwarten. Im Folgenden sollen diese problematischen Punkte besprochen werden.
1.3.1 Identitätskonflikt
Auf theoretischer Ebene ist der Begriff der ,,Identität" leicht zu definieren. Man kann vom
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Nation oder einer Gruppe sprechen. Betrachtet man jedoch
diese Definition genauer, fällt auf, dass die Erklärung nicht das ganze Spektrum von Identität
abdeckt. Faktoren wie Geschlecht, ethnische Herkunft, sowie geschichtliche Ereignisse
beeinflussen die Identitätsbildung, die durch Konstruktion, Affirmation oder durch bewusste
Reflexion angeeignet wird. Weiterhin ist der Einfluss der sozialen Gruppe nicht zu
unterschätzen, die dem Individuum das kulturelle Gedächtnis und Orientierung vermittelt.
73
Wird ein Mensch in eine fremde Kultur verpflanzt, wie es durch Immigration der Fall ist,
transformiert sich die Selbsteinschätzung ,,von einem kulturellen Zustand zu einer
interkulturellen Dynamik"
74
. Eine solche interkulturelle Identität zeichnet sich durch
Flexibilität aus, indem die Person durch Prozesse der Akkulturation für fremde Kulturen
offener wird.
75
Auch Sprache und Sprachwahl je nach Situation und Gesprächspartner zeichnen Teile der
Identität aus, die im Gespräch zum Vorschein kommt.
76
Indem ein Mensch situations- und
72
vgl. Paul Lefebvre, zit. nach: L'Hérault, Pierre, ,,L'intervention italo-québecoise dans la reconfiguration de
l'espace identitaire québécois", In: Carla Fratta und Elisabeth Nardout-Lafarge, Italies imaginaires du Québec,
S. 193.
73
vgl. Aleida Assmann, zit. nach: Blioumi, Aglaia, S. 93.
74
Blioumi, Aglaia, S. 93.
75
vgl. Constantin von Barlowen, zit. nach: Blioumi, Aglaia, S. 93.
76
vgl. Robert Le Page und Andrée Tabouret-Keller, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois,
S. 162.
17
gesprächspartnerbedingt seine Sprachwahl ändert, wird der Facettenreichtum seiner Identität
offensichtlich.
77
Gleichzeitig kann es für den Sprecher schwierig werden, diese eigene
Identität, die in hohem Maße von verschiedenen Einflüssen durchkreuzt ist, eindeutig zu
definieren. Sowohl im sprachlichen, als auch kulturellen Bereich fließen neue und alte
Einflüsse zusammen. So kann es zum Konflikt für den Immigranten kommen, wenn er nicht
mehr identifizieren kann, welcher Gruppe er sich angehörig fühlt. Denn wie Tana zum Thema
der italienischen Immigranten in Montreal bemerkt, führe die Tatsache, einerseits Italiener,
andererseits Quebecer zu sein, zum Gefühl, keiner Gruppe wirklich anzugehören. Nach der
Vorführung von Caffè Italia, Montréal im Rahmen eines Dokumentarfilmseminars in Ontario
konnten sich Immigranten verschiedener Herkunft mit dem gleichen Problem identifizieren
wie die Montrealer Italiener.
78
Es scheint sich also um eine universelle Problematik der
Immigration zu handeln.
Im sprachlichen Bereich kann sich dieser Konflikt entweder durch Ablehnung gegen gewisse
sprachliche Einflüsse oder den Hang zur übertriebenen Korrektheit manifestieren. Alber und
Oesch-Serra beobachten bei einem Gespräch zwischen erster und zweiter Generation von
Immigranten, wie die Tochter ihre Mutter korrigiert, als sie eine falsche grammatikalische
Form benutzt.
79
Matthey und De Pietro unterstreichen, dass sich die Tochter in diesem Fall
nicht um die Wahl der Sprache kümmert, sondern die Tatsache kritisiert, dass sich die
Sprachen mischen und eine ,,expression métissée, impure"
80
dabei entsteht. Nach Kielhöfer
weise diese Reaktion auf eine Art Schuldgefühl in Bezug auf die Mischung von Sprachen hin,
die selbst in Familien anzutreffen sei, die sich um eine zweisprachige Erziehung bemühen:
,,Le mélange est stigmatisé comme désordre"
81
. Eine weitere Manifestation eines sprachlichen
Konflikts ist oft bei Menschen zu beobachten, die in regelmäßigem Kontakt mit einer fremden
Sprache stehen. So werden zum Beispiel fremde grammatikalische Elemente in den Satzbau
der eigenen Sprache eingebaut. Obwohl der Einfluss der anderen Sprache sehr unauffällig ist,
kann der Sprecher in einen Konflikt geraten und Minderwertigkeitsgefühle entwickeln.
Gerade bei Immigranten sei dies, so Lüdi, ein häufiges Phänomen.
82
So einfach und trivial die Thematik der Identität auch auf den ersten Blick wirken mag, kann
sie sich jedoch sehr problematisch gestalten. Es fließen äußere Faktoren der Umwelt und
innere der Persönlichkeit ein. Verändern sich Umfeld und kulturellen Einflüsse maßgeblich,
77
vgl. Georges Lüdi, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 162.
78
vgl. Paul Tana, Anhang 1, S. 155.
79
vgl. Jean-Luc Alber und Cecilia Oesch-Serra, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S.
174.
80
Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 174.
81
Bernd Kielhöfer, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 175.
82
vgl. Georges Lüdi, zit. nach: Matthey, Marinette und De Pietro, Jean-Francois, S. 176.
18
wie es durch eine Immigration der Fall ist, kann die Frage der Identität zum Thema und für
den Betroffenen zum Konflikt werden. Abschließend dokumentiert die Aussage des Quebecer
Athleten und haitianischen Immigranten Bruny Surin anlässlich seiner Teilnahme an den
olympischen Spielen 2000 in Sydney am Besten das Thema der Identität:
Oui je suis fier d'être Haïtien. Oui je suis fier d'être Québécois, et oui je vais être fier de porter les
couleurs du Canada aux Jeux olympiques de Sydney. Mais mon choix, à moi, ce serait d'avoir un
maillot aux couleurs d'Haïti, du Québec et du Canada en même temps.
83
1.3.2 Gesellschaftliche Konflikte
Im vorangegangenen Teil dieser Arbeit wurden positive gesellschaftliche Reaktionen auf
Immigranten, wie zum Beispiel die der Integration, erklärt. Jedoch können Einwanderer auch
auf Ablehnung und Hass von Seiten der ansässigen Bevölkerung des Aufnahmelandes oder
von staatlicher Seite selbst stoßen. Prallen verschiedene Kulturen aufeinander, die sich
gegenseitig unbekannt sind, kann nicht von einem vorurteilsfreien Miteinander ausgegangen
werden. So sollen im Folgenden problematische Aspekte besprochen werden, die auf
gesellschaftlicher Ebene zum Vorschein kommen. Zu diesen Punkten gehören
Missverständnisse, genauso wie Stereotypen und Vorurteile, die als Folge daraus entstehen
können. Eine extreme Ablehnung manifestiert sich im meist rassistisch motivierten
Ausländerhass und der Diskriminierung von Ausländern.
Aufgrund der sprachlichen Barriere sowie kultureller Unterschiede kommt es im Kontakt
zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen leicht zu Missverständnissen, die als
unbeabsichtigte Konflikte bezeichnet werden können.
84
Die Tatsache, dass die Kultur einer
Gruppe nicht nur im Rahmen der Kommunikation, sondern auch im non-verbalen Bereich
maßgeblich die Handlungsweise bestimmt, spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle.
85
So
entstehen Missverständnisse nicht nur im Gespräch, sondern auch durch ungewohntes oder
befremdlich wirkendes Handeln des jeweils Fremden. Ausdruck finden diese ungewollten
Konflikte in Reaktionen wie Aggression oder im Rahmen einer Konversation durch Abbruch
oder das Schweigen der Sprecher.
86
Lüsebrink fasst interkulturelle Missverständnisse als
Folge von ,,Fehlinterpretationen des sprachlichen oder non-verbalen Verhaltens und Handelns
83
Bruny Surin, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, ,,Les assises socio-psychologiques du
racisme et de la discrimination", In: Jean Renaud, Annick Germain und Xavier Leloup, Racisme et
discrimination: permanence et résurgence d'un phénomène inavouable, Québec, Presses de l'Université Laval,
2004,, S. 238.
84
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 31.
85
vgl. Aleida Assmann und Jan Assmann, zit. nach: Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S.
32.
86
vgl. Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 32.
19
des Kommunikationspartners, die auf Unkenntnis oder fehlender Erfahrung beruhen
können"
87
, zusammen.
Kommt es nun durch Verhaltensweisen oder ein Gespräch zwischen Angehörigen
verschiedener Kulturen zu einem Missverständnis, kann diese Erfahrung sich negativ
einprägen und zu einer vorgefertigten Meinung oder einer Verallgemeinerung über die andere
Gruppe verleiten. Daraufhin bilden sich Stereotypen und Vorurteile, die in der
wissenschaftlichen Diskussion zum Bereich der Fremdwahrnehmung gehören.
Hierbei kann Fremdwahrnehmung sowohl positive als auch negative Eindrücke vermitteln
und sich einerseits auf allgemeiner Ebene, wie zum Beispiel durch Reiseberichte in der
Literatur, andererseits in extremen Kurzformen, wie zum Beispiel Werbeslogans oder Witzen,
ausdrücken. Gerade diese Kurzformen sind für die Bildung von Stereotypen prädestiniert. Für
Stereotypen dieser Art schlägt Lüsebrink eine Unterscheidung in sechs Formen vor: den
,,sozialen Typ", die ,,kulturelle Typisierung", das ,,Stereotyp" bzw. ,,Cliché", den Topos, den
Mythos und das Vorurteil.
88
Da jedoch für den weiteren Verlauf dieser Arbeit nur das
Stereotyp und das Vorurteil von Bedeutung sind, wird auf eine Definition der weiteren
Formen verzichtet, die im übrigen zu den stereotypen Wahrnehmungsformen gehören und
sich durch leichte Nuancen untereinander differenzieren.
Zunächst soll nun der Begriff Stereotyp erklärt werden, der synonym als Cliché bezeichnet
wird. Um die Komplexität der vielen Umwelteinflüsse zu verarbeiten, bilden Stereotype für
den Menschen ,,reduktionistische Ordnungsraster"
89
. Ausdruck finden sie in Vereinfachungen
sowie Typisierungen von Gruppen oder Individuen, die in Autostereotypen, also
Selbstbildern, oder Heterostereotypen, d. h. Fremdbildern, unterschieden werden. Blioumi
konnotiert Stereotype vergleichsweise negativer und bezeichnet sie als Urteil, ,,das in
ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional wertender
Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder
abspricht"
90
. Laut Bausinger zeichnen sich Stereotype aus durch ,,unkritische
Verallgemeinerungen, die gegen Überprüfung abgeschottet, gegen Veränderungen relativ
resistent sind. Stereotyp ist der wissenschaftliche Begriff für eine unwissenschaftliche
Einstellung"
91
. Darüber hinaus unterstreicht Blioumi, dass in der neueren Forschung das
87
Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 32.
88
vgl. ebd., S. 87/88.
89
ebd., S. 88.
90
Blioumi, Aglaia, S. 21.
91
Hermann Bausinger, zit. nach: Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 88.
20
Stereotyp seine negative Komponente verloren hat, und als neutrales Wahrnehmungsmuster
eine kommunikative Funktion besitzt.
92
Im Gegensatz zum wertneutralen Charakter des Stereotyps weist das Vorurteil eine affektive
und konative Komponente auf.
93
Zudem nennt Lüsebrink sie ,,ideologisch besetzte
Verfälschungen von Wirklichkeitsphänomenen [...] und nicht nur eine Reduktion von
Wirklichkeitskomplexität."
94
Als Beispiel für ein Vorurteil nennt Blioumi die rassistische
Aussage ,,Schwarze sind böse Menschen". Hierbei ruft der Signifikant, der Schwarze, den
Affekt des Hasses oder Angst hervor und ist gleichzeitig mit überholten Vorstellungen des
Schwarzen als Kannibalen konnotiert.
95
Zudem werden Vorurteile wie Traditionen von Generation zu Generation überliefert. Sie
werden durch beschränkte Wahrnehmungen verstärkt und fördern spezielle Erwartungen und
Einstellungen.
96
Da Vorurteile sich schnell verankern und sowohl auf einzelne Personen wie auch auf gesamte
Gruppen bezogen werden, ebnen sie den Weg zur Diskriminierung und der
Ausländerfeindlichkeit, die als Phänomene in fast jeder Gesellschaft anzutreffen sind.
97
Unter
Diskriminierung versteht man ein negatives Verhalten gegenüber einer fremden Gruppe oder
deren Mitgliedern, das durch Vorurteile hervorgerufen wird.
98
. Bourhis und Montreuil gehen
davon aus, dass jedes Individuum sein Umfeld in ,,endogroupe" und ,,exogroupe"
kategorisiert.
99
Unter ,,endogroupe" ist hierbei die Gruppe der Individuen zu verstehen, deren
Mitglieder ein Individuum seiner eigenen Gruppe zuteilt und mit der er sich identifiziert. Im
Gegensatz dazu umfasst die ,,exogroupe" alle Individuen, die nicht seiner eigenen Gruppe
angehören.
100
Durch die Kategorisierung der Individuen ist es dem Menschen möglich, sein
physisches und soziales Umfeld zu klassifizieren.
101
So kann er Zeit und Kräfte sparen.
102
Jedoch tendieren Menschen dazu, willkürlich Andere so zu kategorisieren, wie sie am besten
mit den Stereotypen übereinstimmen.
103
Ein gutes Beispiel hierfür ist Albert Einsteins
Aussage zum Zeitpunkt vor der Bestätigung seiner Relativitätstheorie über die Reaktion der
Menschen nach einem eventuellen Erfolg oder Misserfolg:
92
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 21.
93
vgl. Emer O'Sullivan, zit. nach: Blioumi, Aglaia, S. 22.
94
Lüsebrink, Hans-Jürgen, Interkulturelle Kommunikation, S. 91.
95
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 22.
96
vgl. Dieter A. Berger, zit. nach: Blioumi, Aglaia, S. 24.
97
vgl. Jean-Michel Blier und Solenn de Royer, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 231.
98
Richard Y. Bourhis und Jacques-Philippe Leyens, zit. nach: Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 239.
99
vgl. Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 232.
100
vgl. ebd.
101
vgl. Jacques Leyens, Vincent Yzerbyt und Georges Schadron, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil,
Annie, S. 232.
102
vgl. Henri Tajfel, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 232.
103
vgl. Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 232.
21
Si la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis Allemand, les Suisses que je suis citoyen
Suisse, et les Français que je suis un grand homme de science. Si la relativité se révèle fausse, les
Français diront que je suis Suisse, les Suisses que je suis Allemand, et les Allemands que je suis Juif.
104
Abgesehen von der Persönlichkeit des Wissenschaftlers Einstein gibt es noch Einstein, den
Juden, Einstein, den Deutschen und Einstein, den Schweizer Staatsbürger. Er gehört also
mehreren Kategorien an, aus denen sich die Menschen willkürlich die für sie passende
aussuchen.
Diskriminierung richtet sich stets gegen die Mitglieder der ,,exogroupe" und kann sich im
Berufsleben, in der Wohnungsfrage, im öffentlichen Bereich, im Geschäftsleben sowie in
zwischenmenschlichen Kontakten manifestieren.
105
Da die Spannweite der Diskriminierung
extrem ist, sieht sich die Mehrzahl der demokratischen Staaten gezwungen, zu ihrer
Bekämpfung Organisationen zu gründen und staatliche Richtlinien zu erlassen.
106
Denn wie
Studien belegen ist der psychische Schaden bei den Betroffenen gewaltig und drückt sich in
Depressionen, Stress und mangelndem Selbstwertgefühl aus. Darüber hinaus bedrohe die
Diskriminierung die soziale Identität eines Opfers.
107
Diese Bedrohung schweiße jedoch
manchmal die Opfer umso mehr an ihre eigene Gruppe, die sich daraufhin stärker abschotte
und somit, zum Beispiel im Falle einer Immigrantengruppe, ihrer Integration in die
Empfangsgesellschaft schaden könnte.
108
Es wurden in diesem Kapitel die verschiedensten Arten von gesellschaftlichen Konflikten
thematisiert, die sich durch Immigration entwickeln können. Missverständnisse, die meist
harmlos erscheinen und unbeabsichtigt einen Konflikt auslösen, führen durch die Unkenntnis
des jeweils anderen zu Vorurteilen und Stereotypen. Während Stereotype dem Gehirn als
Ordnungshilfe für die Informationsmassen dienen, die auf den Menschen täglich einprasseln,
und somit ein neutrales Wahrnehmungsmuster darstellen, sind Vorurteile negativ geprägt und
haben eine konative Komponente. Sie führen wiederum zu einer diskriminierenden Haltung
gegenüber Fremden.
2 Italienische Immigranten in Montreal
Anfang dieses Jahrhunderts zählte Quebec ungefähr 7,4 Millionen Einwohner (knapp 25% der
kanadischen Bevölkerung), wovon ungefähr 80% in Städten und deren Umland und
hauptsächlich in der Region von Montreal (3,5 Mio) und der von Quebec-Stadt (700000)
104
Albert Einstein, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 231.
105
vgl. Richard Y. Bourhis und Alain Gagnon, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 239.
106
vgl. Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 239.
107
vgl. Michael T. Schmitt und Nyla Branscombe, zit. nach: Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 240.
108
vgl. Bourhis, Richard Y. und Montreuil, Annie, S. 237.
22
lebten. Ungefähr 82% der Bevölkerung ist frankophon, 10% anglophon. Es ist jedoch in
Quebec von einer pluralistischen Gesellschaft zu sprechen, in der neben Französisch und
Englisch weitere 35 Sprachen gesprochen werden.
109
Zudem steigt die Zahl der allophonen
Bürger, d. h. der anderssprachigen Einwohner als frankophon und anglophon, stetig
110
und
machte im Jahr 2001 18% der Montrealer Bevölkerung aus. Wie viele andere Städte
charakterisiert sich Montreal durch seine ethnische und sprachliche Vielfalt. Ein großer
Unterschied zu vielen anderen Städten ist jedoch die extrem hohe Rate an dreisprachigen
Allophonen. Laut einer Umfrage im Jahre 1996 bezeichneten sich 46,8% der Allophonen als
dreisprachig im Vergleich zu 5,4% im restlichen Kanada.
111
Unter den Jugendlichen im Alter
zwischen 15 und 24 lag die Zahl fünf Jahre später sogar bei 67,8%.
112
Unter den Allophonen ist die italienische Gemeinschaft die größte und war 1985 mit einer
Zahl zwischen 180000 und 200000 Bürgern vertreten.
113
So stellen sie zahlenmäßig die
drittgrößte Gruppe nach den frankophonen und den anglophonen Montrealern dar. Wie sich
diese kulturelle Gemeinschaft seit Anfang der Einwanderung entwickelt hat, soll im
Folgenden dargelegt werden. So werden nach einem geschichtlichen Abriss der Immigration
wichtige Aspekte des heutigen Lebens der Italo-Montrealer erörtert.
2.1 Geschichtlicher Abriss der italienischen Einwanderung in Montreal
Man schätzt die Zahl der Italiener, die im Laufe des letzten Jahrhunderts ihre Heimat
verlassen haben, auf 30 Millionen und auf ungefähr fünf Millionen, die 1990 außerhalb des
Landes gearbeitet haben.
114
Während vor 1860 sich nur vereinzelte italienische Bauern auf den Weg nach Übersee
machen, kommt es ab dem Ende der 1860er Jahre zu einem permanenten Migrationsstrom,
der enorme Ausmaße annimmt. Hauptsächlich sind die mittleren Regionen Italiens betroffen,
da dieser Teil des Landes im Gegensatz zum Norden geografisch benachteiligt ist. Seit der
Vereinigung Italiens im Jahre 1861 breitet sich zudem die Industrialisierung des Nordens auf
109
vgl. Gagné, Madelaine, ,,Les politiques d'immigration et d'intégration", In: Marie Mc Andrew und Jordi
Garreta, Diversité culturelle, identité et langue: le rôle de l'éducation, Rencontre Québec-Catalogne, Barcelona,
Spanien, 24-26 avril, 2001, http://im.metropolis.net/research-
policy/research_content/doc/diversit__McAndrew.pdf, S. 12/13.
110
vgl. Louise Marmen und Jean Pierre Corbeil, zit. nach: Lamarre, Patricia, ,,Growing Up Trilingual in
Montreal: Perceptions of Allophone Youth" In: Marie Mc Andrew und Jordi Garreta, Diversité culturelle,
identité et langue: le rôle de l'éducation, Rencontre Québec-Catalogne, Barcelona, Spanien, 24-26 avril, 2001,
http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/doc/diversit__McAndrew.pdf, S. 92.
111
vgl. ebd., zit. nach: Lamarre, Patricia, S. 92.
112
vgl. Lamarre, Patricia, S. 92.
113
vgl. Orioli, Stefano, Ethnicité et idéologie: le cas des italophones de Montréal, Quebec, Université Laval,
Dissertation, 1990, S. 18.
114
vgl. ebd., S. 8.
23
Kosten des ländlichen Südens aus. So kann zwischen 1891 und 1900 eine jährliche
Durchschnittszahl von 280000 Auswanderern genannt werden, die im darauffolgenden
Jahrzehnt auf 600000 ansteigt. Mehr als 50% der Emigranten begeben sich ins
außereuropäische Ausland.
115
Die ersten massiven Einwanderungsströme erreichen Kanada
zwischen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Arbeiter für den boomenden Bau
der Infrastruktur benötigt werden. Da jedoch einerseits kanadische Firmen wie die Canadian
Pacific Railway oder die Dominion Coal Company Schwierigkeiten haben, passende
Arbeitskräfte unter den Italienern aufzuspüren und zu rekrutieren und andererseits sich die
Einwanderer auf dem kanadischen Arbeitsmarkt nicht auskennen, organisiert sich bald eine
Gilde an italienischen Arbeitsvermittlern. Sie kümmern sich um die Beschaffung der
Arbeitskräfte und erhalten sowohl von den Firmen dafür eine Entlohnung, als auch von den
Arbeitern eine Art Vermittlungsgebühr.
116
Da einige Vermittler die Abhängigkeit der
Immigranten ausnutzen und zudem in den Augen der Regierung in Ottawa eine zu große
Machtposition erreichen, wird der Praxis der Arbeitsvermittler, die in einem Bericht als
,,traffic de chair humain"
117
bezeichnet wird, durch eine staatliche Untersuchungskommission
ein Ende gesetzt.
118
Durch die skrupellosen Machenschaften der italienischen
Arbeitsvermittler, wie auch durch kriminelle Handlungen einzelner italienischer Einwanderer,
werden kritische Stimmen aus der Quebecer Gesellschaft laut, die der Gemeinschaft der
Italiener vorschnell ,,des instincts sanguinaires"
119
zuschreiben. So sehen sich die
Einwanderer schon in dieser frühen Phase der Immigration mit Vorurteilen konfrontiert.
Viele Italiener hatten zunächst gehofft, mit dem in Kanada verdienten Geld ein besseres
Leben in der Heimat führen zu können. Jedoch müssen sie bald auf Grund der schlechten
wirtschaftlichen Lage in Italien die Aussichtslosigkeit dieses Plans erkennen. Aus diesem
Grund siedeln sie sich schließlich besonders in Toronto und Montreal an, wo sie bald
italienische Gemeinschaften bilden, die die italienischen Neuankömmlinge empfangen.
120
Denn nach den schlechten Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt schützen sich die Immigranten
gegenseitig durch gemeinsame Hilfe und Integration in die Gemeinschaft.
121
So dauert es
nicht lange bis den italienischen Ankömmlingen, anfangs meist allein stehende Männer,
Wohnmöglichkeit in Pensionen zur Verfügung stehen. Italienische Familien bieten einzelne
Zimmer in ihren Häusern an. Diese Unterbringung vermittelt somit durch den familiären
115
vgl. Orioli, Stefano, S. 10.
116
vgl. Ramirez, Bruno, Les premiers Italiens de Montréal, Montréal, Boréal Express, 1984, S. 39/40.
117
Robert Harney zit. nach: Ramirez, Bruno, Les premiers Italiens de Montréal, S.47.
118
vgl. Ramirez, Bruno, Les premiers Italiens de Montréal, S.47.
119
ebd., S. 44.
120
vgl. Orioli, Stefano, S. 17/18.
121
vgl. Ramirez, Bruno, Les premiers Italiens de Montréal, S. 56.
24
Verbund außer Kost und Logie auch eine soziale Komponente.
122
Demographisch gesehen
sind bereits 1901 1600 Montrealer Einwohner italienischen Ursprungs zu verzeichnen
123
,
1905 laut dem Gemeindebericht der Pfarrei Notre-Dame du Mont-Carmel sogar 4000.
124
Diese erste große Einwanderungswelle reißt mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs ab, an
dessen Ende die traditionellen Einwanderungsländer wie die USA und Kanada der
Immigration durch schärfere Gesetze Einhalt gebieten. Ausschlaggebend dafür ist ebenfalls
die Machtergreifung Mussolinis 1922
125
, die ab ungefähr 1930 zusätzlich die Möglichkeiten
zur Auswanderung einschränkt. So sinken in den Jahren 1921 und '22 die italienischen
Auswanderungszahlen auf 280000 und schließlich auf 83000 im Jahre 1931. Dennoch erreicht
die Zahl der italienischen Einwanderer in Montreal 1921 bereits 14000, was 2% der
Stadtbevölkerung ausmacht.
126
Die faschistische Regierung Italiens betrachtet die ständige Emigration als einen Verlust des
Reichtums und der Macht der italienischen Nation und unterbindet sie. Die Institution der
,,Direzione generale degli Italiani all'estero" wird gebildet, die dem zunächst freien
italienischen Emigranten, der im Ausland sein Glück sucht, den offiziellen Status eines
,,Italieners im Ausland" verleiht. Dadurch ist es nun seine Pflicht, die faschistischen Ideale zu
respektieren und zu propagieren. Auf institutioneller Basis werden verschiedenste
Einrichtungen wie die ,,Italien-Häuser" und lokale Sektionen zur Verbreitung des
italienischen Faschismus gegründet, die besonders im katholischen Quebec von Seiten der
lokalen Autoritäten wegen ihrer antikommunistischen Funktion begrüßt werden.
127
So wird
zum Beispiel die Flugstaffel des Generalgouverneurs Italo Balbo, der in der faschistischen
Regierung eine führende Position besitzt, herzlich von der Montrealer Bevölkerung und ihrem
Bürgermeisters im Juli 1933 empfangen.
128
Auch die Mehrzahl der Montrealer Italiener
schätzen laut dem Zeitzeugen Capozzi das faschistische Regime, da es Interesse für die
Italiener im Ausland zeigt und die Einwanderer durch Staatsbesuche in Kontakt mit ihrer
Heimat hält.
129
Als aber die faschistische Bewegung auf internationalem Parkett mehr und mehr an Boden
verliert und schließlich Mussolini den Alliierten den Krieg erklärt, folgt eine Reihe teils
umstrittener Internierungen Montrealer Italiener aufgrund ihrer Mitgliedschaft in
122
vgl. Ramirez, Bruno, Les premiers Italiens de Montréal, S. 81.
123
vgl. Orioli, Stefano, S. 18.
124
vgl. Ramirez, Bruno, Les premiers Italiens de Montréal, S. 37.
125
vgl. Orioli, Stefano, S. 12/13.
126
vgl. ebd., S. 18.
127
vgl. Salvatore, Filippo, Le Fascisme et les Italiens à Montréal- Une histoire orale: 1922-1945, Montréal,
Guernica, 1995, S. 7.
128
vgl. ebd., S. 31.
129
vgl. Sam Capozzi, zit. nach: Salvatore, Filippo, Le Fascisme et les Italiens à Montréal, S. 23.
25
faschistischen Gruppierungen.
130
Für die italienischen Gemeinschaften in Montreal wie auch
im restlichen Kanada, deren Ansehen in kürzester Zeit zu Nichte gemacht wird, bedeuten
diese Internierungen eine tiefe Erniedrigung.
131
Am Ende des Zweiten Weltkriegs ist besonders der Süden Italiens von der Armut betroffen,
die eine zweite Immigrationswelle auslöst. Zwischen 1951 und 1971 verlassen mehr als
1800000 Italiener diese Region.
132
In der Quebecer Region setzt die Einwanderung wieder ab
1946 ein und erreicht ihren Höhepunkt in den 50er Jahren, in denen sich von den 216000
Italienern in Kanada allein 56000 in Quebec niederlassen.
133
1960 sind die Italiener die größte
der allophonen Gruppen in Montreal.
134
Jedoch erweisen sich die Demonstationen der italienischen Bevölkerung in den 60er und 70er
Jahren für eine Dezentralisation der Produktionsstätten als sehr effektiv und stoppen die
Auswanderung aus den mittleren Regionen Italiens.
135
So sind schließlich 1961 zahlenmäßig
mehr als 100000 italienischstämmige Bürger in Montreal wohnhaft, was 5% der
Stadtbevölkerung und 62% der Italiener in der Quebecer Region ausmacht.
136
Für den
Montrealer Raum beginnt der italienische Einwanderungsstrom ab 1971 zu schwinden und hat
heute sein Ende erreicht. Im regionalen Vergleich gesehen machte 1971 die italo-montrealer
Gemeinschaft insgesamt 91% der italienischstämmigen Bevölkerung Quebecs aus.
137
2.2 Die heutige italienische Gemeinschaft in Montréal
Nach der historischen Einführung zum Thema der Italo-Montrealer sollen im Weiteren
Aspekte thematisiert werden, die das Leben der Gemeinschaft heutzutage betreffen.
Interessant in diesem Zusammenhang sind die kanadische Immigrationspolitik und deren
Umsetzung in Quebec. Anschließend wird aufbauend auf den theoretischen Teil dieser Arbeit
die Frage der Identität direkt auf die Montrealer Italiener bezogen, um deren Selbstdefinition
darzustellen.
130
vgl. Orioli, Stefano, S. 14.
131
vgl. Salvatore, Filippo, Le Fascisme et les Italiens à Montréal, S. 42.
132
vgl. Orioli, Stefano, S. 15.
133
vgl. ebd., S. 18.
134
vgl. Linteau, Paul-André, ,,The Italians of Quebec: key Participants in Contemporary Linguistic and Political
Debates" In: Roberto Perin und Franc Sturino, Arrangiarsi: the Italian immigration experience in Canada,
Montréal, Guernica, 1989, S. 182.
135
vgl. Orioli, Stefano, S. 15/16.
136
vgl. ebd., S. 18.
137
vgl. ebd.
26
2.2.1 Kanadische Immigrationspolitik und ihre Umsetzung in Quebec
Bevor hier die kanadische Immigrationspolitik in groben Zügen umrissen werden soll, muss
darauf hingewiesen werden, dass in Fragen der Einwanderung die Gesetzgebung zwischen der
Quebeker und der kanadischen Regierung geteilt ist.
Der Grundstein zur politischen Eigenständigkeit wird 1978 mit der ,,Entente Couture-Cullen"
gelegt, die der Quebecer Regierung die Entscheidungskraft überträgt, einen Teil der
Immigranten und deren Zusammensetzung auszuwählen. Schließlich wird 1991 durch den
,,Accord Canada-Québec" das Recht der Quebecer Regierung besiegelt, eine Auswahl von
50% der Immigranten zu treffen. Die wichtigsten Neuerungen sind die soziale
Zusammenstellung der Immigranten sowie die Übertragung der Verantwortung für ihren
Empfang und ihre Integration. Der Föderalstaat behält sich währenddessen das
Entscheidungsrecht in Sachen Familienzusammenführung und der Frage um Personen vor, die
den offiziellen Flüchtlingsstatus tragen.
138
Nun stellt sich die Frage, weshalb der Region der Sonderstatus in der Immigrationsfrage
besonders wichtig ist. Die Antwort liegt in ihrer wirtschaftlichen und demographischen
Situation. Wie viele andere Industriestaaten auch, steht Quebec vor allem im High-Tech-
Bereich einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gegenüber. Des Weiteren sinken die
Geburtenraten gegenüber einer steigenden Vergreisung der Gesellschaft stetig. Die Dynamik
der Geburtenrate ist also rückläufig, weshalb der Generationsvertrag nicht gesichert ist.
Letztendlich sieht Quebec durch diese demographische Entwicklung seine frankophone
Existenz als Enklave im englischsprachigen Kanada bedroht.
139
Nun soll ein kurzer Abriss der Entwicklung der Immigrationspolitik seit den 70er Jahren
folgen, um den historischen Hintergrund zu vervollständigen. Für ein besseres Verständnis
der Veränderungen Quebecs muss die Lage der 60er Jahre erklärt werden, die zur so
genannten ,,Révolution tranquille" führten. Dieser Begriff steht für die Periode der 60er und
70er Jahre, die der frankophonen Mehrheit in Quebec größeren Einfluss verlieh. Nach der
jahrzehntelangen Benachteiligung gegenüber der englischsprachigen Minderheit, die dennoch
die Finanzwelt regierte und politischen Einfluss ausübte, erhielt die französischsprachige
Bevölkerung schließlich sowohl kulturelle als auch politische Macht.
140
Immer mehr
Intellektuelle und Politiker verlangten nicht mehr nur Chancengleichheit, sondern einen
radikalen Wechsel zu einer rein frankophonen Gesellschaft. Dabei lehnten sie den
138
vgl. Gagné, Madelaine, S. 14.
139
vgl. ebd., S. 13.
140
vgl. Nilsson-Julien, Olivier, S. 206.
27
traditionellen Bilingualismus ab, da er nur zur Assimilation in die englischsprachige
Gesellschaft führen würde.
141
So wurde 1977 die ,,Charte de la langue française", die auch unter dem Schlagwort ,,Loi 101"
bekannt ist, verabschiedet, die das Französische zur allgemeinen Gebrauchssprache und zur
schulischen Pflichtsprache für Immigrantenkinder machte.
142
Ziel der Quebecer Regierung,
die seit 1976 erstmals von einer franko-quebecer Partei, dem ,,Parti Québécois", geführt
wurde, war es, die allophone Bevölkerung, sprachlich von der anglophonen zu trennen.
143
Immigranten tendierten nämlich vor der ,,Révolution tranquille" dazu, ihre Kinder in
anglophone Schulen zu schicken, da für Englischsprachige bessere wirtschaftliche Chancen
bestanden. Diese gesetzlichen Schritte waren wichtig für den nationalen Gedanken der
Quebecer Bevölkerung. So stand laut L'Hérault am Ende der 70er Jahre weder Immigration
noch Integration im öffentlichen Interesse, sondern vor allem die Ideale der Franko-Quebecer
und die separatistische Bewegung für die Unabhängigkeit von Kanada.
144
Jedoch ist darauf
hinzuweisen, dass das ,,Programme d'enseignement des langues d'origine" (PELO) zum
Schutz der kulturellen Minderheiten geschaffen wurde. Im schulischen Rahmen wird
Unterricht in den Muttersprachen der Immigrantenkinder angeboten.
145
Erst nach dem
Scheitern des ersten Referendums 1980 zur Unabhängigkeit Quebecs wurden die Frage der
Immigranten und die der ,,Interkulturalität" wirklich thematisiert.
146
Denn um das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher kultureller Gruppen zu sichern,
propagierte die föderalistische Regierung in Ottawa den ,,Multiculturalism Act", der aber vor
allem auf ein Nebeneinander, anstatt ein Miteinander der Gruppen abzielte.
147
Das Prinzip des
Multikulturalismus, das Horowitz abwertend als ,,the masochistic celebration of Canadian
nothingness"
148
bezeichnet, erlangte 1982 Verfassungsrang. Hinter dieser Ideologie steht das
Bild des ,,multikulturellen Mosaiks", in dem jede Gruppe ein Steinchen repräsentiert, durch
dessen Zusammensetzung mit den anderen ein Ganzes, eine Nation entsteht.
149
Der
Multikulturalismus trifft jedoch auch heute noch auf Kritik, da er oft historisches
Ungleichwicht aus der postkolonialen Ära übersieht, alle Gruppen als gleich und deswegen
homogen erklärt, Mehrheiten-Minderheiten-Beziehungen verfestigt und kulturelle Hybridität
141
vgl. Linteau, Paul-André, S. 193.
142
vgl. Gagné, Madelaine, S. 13.
143
vgl. Marshall, Bill, Quebec National Cinema, Montréal, Mc Gill's University Press, 2001, S. 265.
144
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 181.
145
vgl. Marshall, Bill, S. 265.
146
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 181.
147
vgl. Nilsson-Julien, Olivier, S. 207.
148
G. Horowitz, zit. nach: Marshall, Bill, S. 263.
149
vgl. Bruno Ramirez, Anhang 2, S. 170.
28
übergeht.
150
Nilsson-Julien mutmaßt sogar, dass die föderale Regierung in Ottawa den
Multikulturalismus verfechte, um die Franko-Quebecer als ,,ethnische" Minderheit zu
erklären und ihnen somit den Status einer der drei ,founding nations` zu nehmen.
151
So kann
die Quebecer Diskussion um Interkulturalität als Antwort auf den Multiculturalism Act
gesehen werden, um sich von ihm zu distanzieren.
152
Man strebte ein ,,Quebecer Miteinander"
der ethnischen Gruppen an, im Gegensatz zum ,,föderalen Nebeneinander". So wurde 1981
das Ministerium für Immigration in das ,,Ministère des Communautés Culturelles et de
l'Immigration" umbenannt, um somit die Wichtigkeit der kulturellen Minoritäten offiziell
anzuerkennen. Schließlich wurde 1986 die ,,Declaration sur les relations interethniques et
interraciales" verabschiedet, die vor allem neue Programme gegen den Rassismus und
Diskriminierung ins Leben rief.
153
Seit den 90er Jahren richtet sich das politische Interesse vor
allem auf die Integration von Einwanderern. Grundsätzlich gilt hier weiterhin, dass diese auf
Französisch erfolgen soll und den kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, institutionellen und
persönlichen Bereich betrifft. Dennoch setzt der Staat voraus, dass Selbstinitiative von Seiten
der Immigranten und die Beihilfe der Quebecer Bevölkerung zu erwarten ist, und bietet zu
diesem Zwecke zwei Arten von Integrationshilfe an: die der Wohnungs- und Arbeitssuche
und die der Französisierung, um durch die sprachliche Komponente den Zugang zu
verschiedensten Bereichen zu erleichtern.
154
Im Folgenden wird ein besonderes Ereignis erwähnt, das im Zusammenhang mit der
Integrationspolitik die Wichtigkeit der italienischen Gemeinschaft in Montreal unterstreicht.
Wie bereits erwähnt, wurde durch die ,,Charte de la langue française" 1977, den Immigranten
die Entscheidung genommen, ihre Kinder in frankophonen oder anglophonen Schulen
erziehen zu lassen. Dies war der Ausgangspunkt einer Welle der Empörung, der die Italiener
zu vehementem Widerstand veranlasste.
Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die katholische Kirche einen großen Einfluss auf die
Montrealer Italiener, sodass sie ihre Kinder meist auf katholische Schulen schickten, in denen
französischsprachig unterrichtet wurde. Obwohl die italienische Gemeinschaft einen starken
Verbund darstellte, teilte sie doch den gleichen sozioökonomischen Status wie die Franko-
Quebecer.
155
Jedoch die Immigranten, die in den 50er Jahren in Montreal eintrafen,
unterschieden sich in einem wichtigen Punkt von ihren Vorgängern: sie hatten eine bessere
150
vgl. Marshall, Bill, S. 263.
151
vgl. Nilsson-Julien, Olivier, S. 207.
152
vgl. Bruno Ramirez, Anhang 2, S. 170.
153
vgl. Marshall, Bill, S. 265.
154
vgl. Gagné, Madelaine, S. 16.
155
vgl. Linteau, Paul-André, S. 188.
29
schulische Bildung.
156
So wählten die Eltern dieser Einwanderergeneration für ihre Kinder
englischsprachige Schulen, da sie sich durch diese Sprachwahl für ihre Kinder bessere
berufliche Chancen ausrechneten. 1961 besuchten bereits 70% der Immigrantenkinder
Schulen des englisch-katholischen Schulsystems, die im 19. Jahrhundert für die irische
Bevölkerung errichtet worden waren. Während der irische Einwandererstrom bereits seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts nachgelassen hatte, ersetzten die Italiener nun diese ethnische
Gruppe.
157
Die Wahl dieser Schulform bedeutete für die Italiener eine logische Folgerung ihrer
Immigration, da sie ihre Heimat verlassen hatten, um ein besseres Leben zu führen und von
der boomenden nordamerikanischen Wirtschaft zu profitieren. In Montreal manifestierte sich
diese eindeutig als englischsprachig. Dennoch wurden die Italiener nicht in die britische
Gemeinschaft assimiliert, da sie den meisten Kontakt zur frankokanadischen Gesellschaft
pflegten und außerdem ihre eigene kulturelle Identität behielten.
158
Als nun die Anglo-
Quebecer feststellten, dass die Integration von allophonen Gruppen in das englischsprachige
Schulsystem die britische Minderheit stärkte, deren Zahl anfing zu sinken, veränderten sie ihr
anglo-protestantisches und anglo-katholisches Schulsystem in ein englischsprachiges
Multiethnik-System. So wurden die allophonen Gruppen, unter denen die Italiener die größte
darstellte, zum Spielball im Streit zwischen Franko- und Anglo-Quebecern.
159
Zu einer wahrhaftigen ,,Language Battle"
160
kam es schließlich im Montrealer Vorort Saint-
Léonard, der damals zu ungefähr 63% von Franko-Kanadiern bewohnt wurde, aber eine sehr
starke italienischstämmige Minderheit von 27% beherbergte
161
. Der Konflikt begann 1968 mit
der schrittweisen Einführung von Einschränkungen der Schulsprache durch die Quebeker
Regierung.
162
Als schließlich 1974 allen Immigrantenkindern Französisch als Schulsprache
vorgeschrieben wurde, reagierten die anglophonen Gruppen sowie die italienische
Gemeinschaft mit Protesten.
163
Die Mehrzahl der Italiener sah sich der Chancen ihrer Kinder
beraubt und änderte ihre Einstellung zur Quebecer und kanadischen Gesellschaft. Einige
wählten den offenen Widerstand, indem sie die ,,Französisierung" öffentlich ablehnten,
heimlich Schulklassen organisierten und ihre Kinder illegal in englische Schulen
156
vgl. Linteau, Paul-André, S. 189.
157
vgl. ebd., S. 190.
158
vgl. Jeremy Boissevain, zit. nach: Linteau, Paul-André, S. 191.
159
vgl. Linteau, Paul-André, S. 194.
160
ebd., S. 195.
161
vgl. Labrie, Normand, Choix linguistiques, changements et alternances de langue: Les comportements
multilingues des italophones de Montréal, Québec, Centre international de recherche en aménagement
linguistique, 1991, S. 47.
162
vgl. Linteau, Paul-André, S. 196.
163
vgl. ebd., S. 197.
30
einschrieben.
164
Es kam sogar zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Italienern
und Franko-Quebekern.
165
Viele Italiener waren überzeugt, dass die englische Sprache
ausschlaggebend für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufstieg ihrer Kinder und
notwendig sei, sich später auch außerhalb von Quebec zu bewegen.
166
Trotz gleich bleibender Gesetzgebung entspannte sich der Konflikt in den folgenden Jahren
jedoch mehr und mehr, da sich die Sprachfrage in Quebec maßgeblich änderte. Mit der Zeit
war unter den Franko-Quebecern eine neue Generation herangewachsen, die eine bessere
Schulbildung genossen hatten und der Jahrzehnte alten Diskriminierung entgegentreten
wollten. So entstanden seit den 70er Jahren viel mehr Unternehmen unter frankophoner
Kontrolle. Junge Italiener, die ihre Erziehung in den 60er Jahren auf Englisch erhalten hatten,
fanden sich nun auf einem meist französischsprachigen Arbeitsmarkt wieder.
167
Mittlerweile
kann jedoch auch von mehr Offenheit der Italiener gegenüber dem Französischen gesprochen
werden.
168
Diese Tatsache ist sicherlich auch auf die Haltung der Quebecer Regierung
zurückzuführen, die sich um Integration bemüht und den ethnischen Minoritäten den
offiziellen Status von ,,communautés culturelles" zuschreibt. Heute hat sich die Diskussion
um die Sprachpolitik angesichts der Entwicklung des Arbeitsmarktes und den damit
verbundenen Chancen für frankophon erzogene Immigrantenkinder weitgehend beruhigt.
Dennoch bemühen sich weiterhin zum Beispiel ,,Alliance Québec", eine Gruppierung mit
verschiedensten ethnischen Vertretern, unter anderem um mehr Rechte in der Frage der
Schulsprache.
169
2.2.2 Die Frage der Identität
Die bereits theoretisch erörterte Frage nach der Identität von Immigranten ist eines der
wichtigen Themen, das sich im Rahmen der Einwanderung stellt. Es ist nun interessant, wie
sich die Italo-Montrealer selbst definieren. Zu diesem Zweck werden im Folgenden zwei
Aspekte betrachtet: die Sprachwahl von Jugendlichen und ihre Auffassung von Identität und
die Umsetzung der Thematik einiger italo-quebecer Künstler in ihre Werke.
Die Sprachwahl stellt eine Facette dar, durch die sich Identität meist unbewusst manifestiert.
Aus diesem Grund soll im Weiteren auf das sprachliche Verhalten der italienischstämmigen
164
vgl. Linteau, Paul-André, S. 199.
165
vgl. ebd., S. 197.
166
vgl. ebd., S. 200.
167
vgl. ebd., S. 202.
168
vgl. ebd., S. 203.
169
vgl. Gouvernement du Canada, Un outil de renforcement des capacités communautaires: Profil de la
communauté territoires d'Alliance Québec,
http://www.rhdcc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=/fr/pip/scmlo/publications/boite_outils/bo12.shtml&hs=oxi,
aufgerufen am 11.01.06.
31
Bevölkerung im Montreal eingegangen werden. Im besonderen Fokus dieser Betrachtung
steht die Studie von Lamarre mit Studenten, die dreisprachig in Montreal aufgewachsen sind.
Leider war es nicht möglich, eine vergleichbare Studie zu finden, die ausschließlich den
Sprachgebrauch der italio-quebecer Jugendlichen demonstriert. Jedoch haben neben
Portugiesen, Haitianern und Vietnamesen auch Italiener an dieser Studie teilgenommen,
weshalb sie für diese Arbeit aussagekräftig ist.
So bestätigten die Studenten, dass Vielsprachigkeit zu ihrem Lebensstil gehöre, da sie in einer
vielsprachigen Umgebung leben, in der sie täglich verschiedene Sprachen hören und
sprechen.
170
Ihr Verhältnis zum Bilingualismus des Englischen und Französischen
beschreiben sie als eine Notwendigkeit, die im Montrealer Berufsleben erwartet wird. So
ermöglichen ihnen die beiden Sprachen einen Zugang zum Arbeitsleben, sind aber nicht
ausschlaggebend in Gehaltsfragen. Allgemein stimmen alle Studenten in der Meinung
überein, dass der englisch-französische Bilingualismus in Montreal eine Notwendigkeit ist
und von ihrer Altersgruppe vorausgesetzt wird. Das Französische nimmt für sie den
wichtigsten Rang zur sozialen und wirtschaftlichen Integration ein.
171
Die meisten der
Befragten jedoch fühlten ungeachtet der Tatsache, ob ihre Muttersprache international oder
zum Beispiel im Bereich der Arbeit von Wichtigkeit ist, eine starke Bindung zu ihr. Das
Beherrschen der Muttersprache gilt oft als ,,Eintrittskarte" zur ethnischen Gemeinschaft und
hat einen großen Stellenwert als ,symbolische` Identität.
172
Viele junge Erwachsene sehen vor
allem angesichts der Globalisierung in ihrer Dreisprachigkeit einen Vorteil.
173
Um abschließend nochmals die Frage der Identität aufzugreifen, bezogen sich die Befragten
interessanterweise nicht auf sprachliche Gemeinschaften, obwohl gerade in Montreal die
Aufteilung der Bevölkerung in französischsprachig, englischsprachig oder allophon gang und
gäbe ist. Im Allgemeinen wurde Identität mehr auf Bürgerschaft und ethnische Herkunft
bezogen und als komplex, hybrid und eine Mischung von beiden Seiten betrachtet, die
Ausdruck in der eigenen Bezeichnung als Italo-Kanadier findet. Schließlich beschrieben sie
ihre Vielsprachigkeit nicht nur als sprachlichen Reichtum, sondern symbolisch als eine
Sammlung an verschiedenen Pässen oder ,,cartes d'identités".
174
Während die Jugendlichen der Studie vor allem über die Gefühle und Eindrücke, die ihre
Identität betreffen, berichten, beschäftigten sich seit Anfang der 80er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts immer mehr Intellektuelle der zweiten Generation der italienischen
170
vgl. Lamarre, Patricia, S. 92.
171
vgl. ebd.
172
vgl. ebd.
173
vgl. ebd., S. 93.
174
ebd.
32
Einwanderer, also die Immigrantenkinder, die zumeist in Quebec geboren wurden, mit der
Frage um die Eingliederung in die Quebecer Gesellschaft, die zur Bildung einer ,,italo-
quebecer" Identität führt.
175
Goldin spricht von einer ,,quête d'identité par la création"
176
, bei
der vor allem die Problematik der Sprache eine wichtige Rolle spielt. Faktoren wie
Geburtsort, Sprache im familiären Rahmen, Schulsprache und Wunsch nach ethnischer
Anerkennung beeinflussen maßgeblich, ob die Künstler ihre Werke in französisch, englisch
oder italienisch verfassen. Dennoch fiel die Wahl bei den meisten auf eine vielsprachige
Ausdrucksweise.
177
Ausschlaggebend für diese künstlerische Bewegung waren vor allem die Entwicklung der
Quebecer Gesellschaft, die sich zum Beispiel in der bereits erwähnten ,,Loi 101" ausdrückte,
und die der italienischen Gemeinschaft in Montreal, deren traditionelle Einstellungen sich
maßgeblich durch das allmähliche Ende des Migrationsflusses, sowie das langsame
Verschwinden der Vorkriegsgeneration und die Akkulturation der Nachkriegsgeneration
verändert hatte.
178
.
In diesem künstlerischen Zusammenhang entstand der Begriff der ,,transculture", der in der
italo-quebecer Zeitschrift Vice Versa geprägt wurde. Herausgeber dieser Zeitschrift waren
Lamberto Tassinari und Fulvio Caccia, die in ihren Artikeln auf die Theorie der ,,transculture"
aufbauten. Marco Micone ist schließlich ein weiterer wichtiger Schriftsteller, der sich mit der
italo-quebecer Frage auseinandersetzt. Aus diesem Grund soll auch sein Werk im Folgenden
erwähnt werden.
Vice Versa, das sich auf seinem Deckblatt selbst als ,,Magazine transculturel. Transculturel
magazine. Rivista transculturale"
179
titulierte, war seit seiner Gründung 1983 bis zu seiner
Einstellung 1996 ein Medium des Dialogs zwischen italo-quebecer und Quebecer
Intellektuellen, die aufgrund des zunehmend pluralistischen Charakters der Quebecer und
besonders Montrealer Gesellschaft eine Notwendigkeit darin sahen, die ,,Quebecer Frage" aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
180
In diesem Zusammenhang versteht Tassinari unter ,,transculture" eine Möglichkeit, das
Thema der Herkunft neu zu definieren. Anstatt zwischen dem nostalgischen Hang an der
Vergangenheit und der bedingungslosen Zustimmung einer Modernität, zu schwanken, die
paradoxerweise diese Vergangenheit ablehnt, verlangt er eine Aufarbeitung der
175
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 181.
176
Goldin, Jeanne, ,,Quêtes: trouver sa place ou non", In: Vice Versa, Vol. 2, Nr. 4, Juni/ Juli 1985, S. 20.
177
vgl. ebd., S. 20/21.
178
vgl. Fulvio Caccia, zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 181.
178
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 179.
179
ebd., S. 184.
180
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 182/183.
33
Vergangenheit. Durch ,,transculture" soll die Wunde, die jeder Immigrant durch den Verlust
der Heimat in sich trägt, als schöpferische Kraft der Identität sehen, um endlich die
Versuchung zu besiegen, der Vergangenheit zu entkommen oder sich in ihrem Schatten zu
verstecken.
181
Im Gegensatz zu Tassinari, der ,,transculture" vor allem auf den politischen und kulturellen
Bereich bezieht, wendet Fulvio Caccia ihn auf Sprache und Literatur an. Dabei stützt er sich
auf Gobards viersprachiges Model zur Analyse der transkulturellen Situation der Italo-
Quebecer, das die Sprachbeziehungen je nach Raum und Zeit in die landesabhängige
(vernaculaire), bewegliche (véhiculaire), vom Gesprächspartner abhängige (référentiaire) und
die mythische (mythique) Komponente aufteilt.
182
Caccia bezieht nun dieses Model auf die
Situation des ,,créateur d'origine italienne"
183
, die sich besonders durch die Verneinung und
das Zurückdrängen der Herkunftssprache, aber auch durch die Versöhnung mit ihr durch den
Gebrauch des Englischen und/ oder des Französischen charakterisiert. Dadurch zeigt er, was
wichtig und auch fraglich an der Beziehung zwischen den Italo- und Franco-Quebecern ist.
184
Als weiterer Vertreter der italo-quebecer Schriftsteller vertritt Marco Micone die Theorie der
,,culture de transition"
185
. Er beeinflusste maßgeblich die Debatte um Beziehungen zwischen
Immigrantenkulturen und der franko-quebecer Kultur. In dieser Debatte steht vor allem der
Bereich der Neugestaltung der Identität und des kulturellen und sprachlichen Raums im
Mittelpunkt, der sich seit der Gesetzesänderungen auf sprachlicher Ebene auf die
verschiedenen Teile der Quebecer Gesellschaft auswirkt.
Ausgehend von einem Unterschied zwischen ,,Immigrantenkultur" und ,,ethnischer Kultur"
sieht Micone in seiner Theorie die Immigrantenkultur als eine Erweiterung der ethnischen.
186
So steht die ethnische Kultur als unbewegliches Element der Mobilität der Immigrationskultur
gegenüber. Aus dieser Mobilität leite sich, so L'Hérault, die ,,transition" oder
,,transformation" ab
187
, die Micone wie folgt auf die Immigrantenkultur bezieht:
Aucune culture ne peut totalement en absorber une autre ni eviter d'etre transformée au contact de celle-
ci. La culture immigrée est une culture de transition qui, à defaut de pouvoir survivre comme telle,
pourra, dans un echange harmonieux, feconder la culture quebecoise et ainsi s'y perpetuer.
188
181
vgl. Lamberto Tassinari, zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 185.
182
vgl. Henri Gobard, zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 186.
183
Fulvio Caccia, zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 186.
184
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 186.
185
Marco Micone, zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 192.
186
vgl. ebd., zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 192.
187
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 192.
188
Marco Micone, zit. nach: L'Hérault, Pierre, S. 192.
34
Micone vertritt folglich die Meinung, dass sich die Immigrantenkultur verändern muss, dabei
aber ein Teil der Quebecer Kultur wird und so als ein Teil von ihr weiter bestehen kann.
Da Micone der hohe symbolische Wert der Sprache bewusst ist, wählt der Schriftsteller das
Französische und den Rahmen einer Quebecer Landschaft zur Beschreibung italienischer
Begebenheiten und zwingt somit den Quebeker und italo-quebeker Raum, sich der Hybridität
zu öffnen.
189
Letztlich fasst L'Hérault zusammen, dass sich die italo-quebecer und Quebecer Gesellschaft
in den letzten Jahren sehr angenähert haben, was einerseits durch die Akkulturation der
zweiten Immigrantengeneration und andererseits durch die allgemeine Tendenz zur
,,Desethnisierung" zustande komme. Daraus entstehe eine Annäherung, die von beiden Seiten
als sehr positiv gesehen werde.
190
So ist die Frage der Identität von solcher Wichtigkeit, dass sie sowohl das alltägliche Leben
der Italo-Montrealer beeinflusst als auch von ihnen thematisiert und künstlerisch umgesetzt
wird.
189
vgl. L'Hérault, Pierre, S. 196.
190
vgl. ebd., S. 201.
35
III Immigration im Film am Beispiel von Caffè Italia, Montréal,
La Sarrasine und La déroute
Durch die theoretische Einführung in die Thematik der Immigration sowie ihres
interkulturellen Hintergrunds und der expliziten Darstellung der heutigen Italo-Montrealer
wurde die Grundlage für die folgende Analyse der Trilogie des Regisseurs Paul Tana und
seines Co-Drehbuchautors Bruno Ramirez Caffè Italia, Montréal, La Sarrasine und La
déroute geschaffen. Für jeden Film erfolgt eine Analyse hinsichtlich des Inhalts und der
Personenkonstellation, Dramaturgie und filmischer Mittel sowie der interkulturellen Aspekte
Abschließend wird Tanas filmische Darstellungsweise interkultureller Erfahrungen und
Problembereiche der italienischen Immigranten in Montreal untersucht.
Bei dieser Analyse stellte sich die Frage, unter welchen Aspekten Interkulturalität im Film
auftreten kann. Als ,,interpretative Werkzeuge" wurden zu diesem Zweck verschiedene
Analysekategorien verwendet, die Blioumi im literarischen Zusammenhang zur
interkulturellen Interpretation vorschlägt: der ,,dynamische Kulturbegriff", die ,,Selbstkritik",
das ,,Dazwischen", die ,,Hybridität" und die ,,doppelte Optik".
191
Dabei bezeichnet der
,,dynamische Kulturbegriff" den Wandel und Prozess, der durch Immigration entstehen kann.
,,Selbstkritik" meint die Hinterfragung der eigenen kulturellen Vorstellungen.
192
Das
,,Dazwischen" steht für die ,,Schnittmenge der Kulturen"
193
und stellt gleichzeitig die Frage,
ob es als Chance verstanden wird oder zu Identitätskonflikten führt.
194
Die bereits im
Theorieteil dieser Arbeit definierte ,,Hybridität" kennzeichnet Mischformen kultureller Art.
Schließlich untersucht die ,,doppelte Optik" die unterschiedlichen Perspektiven der
Darstellung des Eigenen und Fremden.
195
1 Eine Produktion in Teamwork: Paul Tana, ,,l'artiste immigrant", und
sein Co-Drehbuchautor Bruno Ramirez
Der Filmemacher und Dozent Paul Tana immigrierte 1958 im Alter von elf Jahren mit seiner
Familie von Süditalien nach Montreal. Seine Jugend verlebte er weit ab vom italienischen
Viertel in einem frankophonen Wohngebiet.
196
Dort besuchte er im Unterschied zu vielen
191
vgl. Blioumi, Aglaia, S. 96/97.
192
vgl. ebd., S. 96.
193
ebd.
194
vgl. ebd., S. 96/97.
195
vgl. ebd., S. 97.
196
vgl. Caccia, Fulvio, Interviews with the Phoenix, Montréal, Guernica, 1985, S. 158.
36
anderen italienischen Immigrantenkindern die französischsprachige Schule, wo er als
Immigrant bisweilen Opfer von Vorurteilen wurde. Anschließend besuchte er die Universität
und schloss 1970 sein Studium in Französischer Literatur ab.
197
Tana war stets an Kunst
interessiert, jedoch hätte er sich nach eigener Aussage zu diesem Zeitpunkt nie als Regisseur
gesehen. Ebenfalls kann er aus Mangel an den damaligen kinematographischen
Ausbildungsmöglichkeiten als Autodidakt gesehen werden, der sich während verschiedenster
Projekte sein filmtechnisches Wissen aneignete. Als einzige Lernmöglichkeit dienten ihm die
Treffen in Filmclubs und das Kameramaterial für Studentenfilme, das er sich in der
Universität ausleihen konnte. So wurde er Mitglied der ,,Association Coopérative de
Production Audio-Visuelle" in Montreal, einer Gruppe von jungen Filmemachern, durch die
er schließlich richtig in die Welt des Films eintrat.
198
Nach mehreren Kurzfilmprojekten folgte
1980 Tanas erster Spielfilm Les grands enfants und 1981 die sechsteilige TV-Serie Planète
über die italienische Gemeinschaft in Montreal. Schließlich entstanden in Zusammenarbeit
mit dem Historiker Bruno Ramirez in den Jahren 1985 Caffè Italia, Montreal, 1992 La
Sarrasine und 1997/98 La déroute. Seitdem war Tana, der seit 1988 als Dozent den Bereich
für Film des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaften der Université du Québec à
Montréal leitet, an weiteren Projekten teils in beratender Funktion, teils in Zusammenarbeiten
oder als Produzent beteiligt.
199
Zu seinen Einflüssen zählt der Regisseur den Dokumentarfilm, der am Anfang seiner
filmischen Karriere zu den großen Filmgenres gehörte.
200
Bezüglich des Einflusses des
italienischen Kinos auf seine Arbeit zeigt der Regisseur in einem Interview eine gespaltene
Meinung. Obwohl er den italienischen Film zwischen 1960 und '75 als beeindruckend
bezeichnet, ist sein Werk mehr von den osteuropäischen Filmemachern der 60er Jahre
beeinflusst. Jedoch habe das italienische Kino ihn in seiner Person als Immigrant vor allem
näher an Italien herangebracht.
201
Da er in einem absolut frankophonen Umfeld aufgewachsen
und somit komplett von der italienischen Gemeinschaft isoliert war, identifizierte sich Tana
lange Zeit mit der Quebecer Gesellschaft und den Veränderungen der 60er und 70er Jahre.
Nur zu Hause lebte er seine italienische Seite aus, außerhalb schämte er sich für seine
Herkunft und versuchte sie auszublenden. Dieser Konflikt war für ihn sehr schwierig und
verursachte in ihm ein Gefühl des Gespaltenseins. Auch in seinen frühen Werken drückte sich
197
vgl. Paul Tana, zit. nach: Caccia, Fulvio, S. 159.
198
vgl. ebd., zit. nach: Alnirabie, Fuad und Vesia, Michael, An Interview with Paul Tana,
http://www.horschamp.qc.ca/new_offscreen/Tana.html, aufgerufen am 03.06.05.
199
vgl. Université du Québec à Montréal, Département de communication, Paul Tana,
www.comm.uqam.ca/departement/documents/Paul_Tana_CV.doc, aufgerufen am 12.06.05.
200
vgl. Paul Tana, zit. nach: Alnirabie, Fuad und Vesia, Michael, An Interview with Paul Tana.
201
vgl. ebd., zit. nach: Caccia, Fulvio, S. 169.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832497996
- ISBN (Paperback)
- 9783838697994
- Dateigröße
- 2.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität des Saarlandes – Philosophische Fakultät, Französische Kulturwissenschaften und Interkulturelle Kommunikation
- Note
- 1,1
- Schlagworte
- transkulturalität soziolinguistik integration akkulturation identitätskonflikt
- Produktsicherheit
- Diplom.de