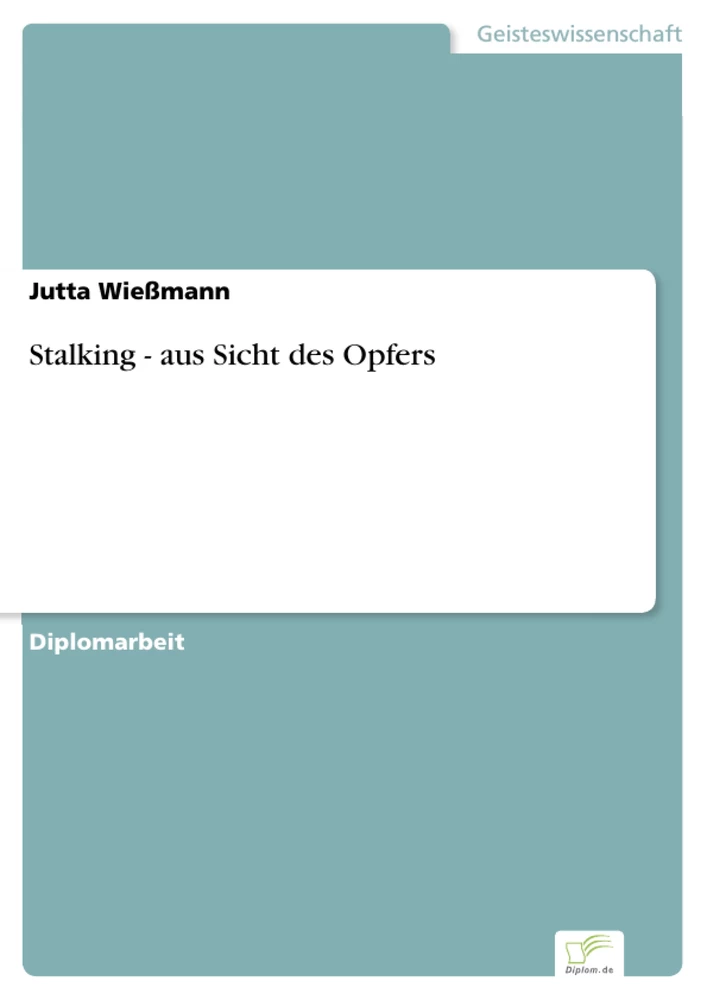Zusammenfassung
Die vorliegende Diplomarbeit beschreibt die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, basierend auf einem Fragebogen zum Phänomen Stalking aus Sicht der Opfer. Die Arbeit wurde im Rahmen einer gemeinsamen Forschungsarbeit der britischen Opferschutzorganisation Network for Surviving Stalking und der Arbeitsgruppe Stalking der Technischen Universität Darmstadt erstellt.
Ziel der Untersuchung war es, ein umfangreiches und detailliertes Bild über Stalking aus Sicht der Opfer zu erlangen, um Hilfsangebote und die Unterstützung der Betroffenen zu verbessern. Neben den demografischen Daten von Tätern und Betroffenen, die ihre Beziehungskonstellation wiedergeben sollen, war es ein Anliegen, Hintergründe über die Stalking-Vorfälle in Erfahrung zu bringen, die sich auf das Wissen, die Wahrnehmung um das Problem, sowie die Auslöser für die Ereignisse beziehen und die Art und Weise, in der sich Stalking geäußert hat.
Das Interesse galt weiterhin den Reaktionen offizieller und inoffizieller Dritter auf die Vorfälle. Um einen tiefgreifenden Eindruck auch in die persönlichen Belange der Opfer zu erhalten, wurden diese ausführlich zu ihrer Meinung befragt. Für ein besseres Bild über die Bedürfnisse in einer Stalking-Situation sollten die Befragten angeben, welche Hilfsmaßnahmen für sie wünschenswert wären, bzw. gewesen wären.
Erfasst wurden weiterhin die Reaktionen der Betroffenen auf den Stalker und das Stalking, so wie die mit den Ereignissen verbundenen physischen, psychischen, sozialen und finanziellen Konsequenzen. Um einen Einblick in ganz individuelle Probleme und Nöte der Geschädigten zu erhalten, konnten diese noch weitere Anmerkungen ergänzen.
Da die Stalking-Forschung in Deutschland eine sehr junge Wissenschaft ist, werden in letzter Zeit hierzulande vermehrt Untersuchungen zu diesem Phänomen durchgeführt. Hierzu zählen die Mannheimer Studie von 2004 von Dr. med. Marina Martini, die bisher umfangreichste deutsche der TU Darmstadt von 2004 unter der Leitung von Diplom-Psychologe Dr. Jens Hoffmann., über die in der Einleitung ein ausführlicher Überblick gegeben wird.
Der Schwerpunkt eines neuen Forschungsprojekts der Technischen Universität Darmstadt liegt in der ausführlichen Erfassung der emotionalen und physischen Befindlichkeiten der Opfer und der Erfassung deren Meinung über das Phänomen Stalking.
Endziel ist es, Unterstützung und Hilfsangebote in Deutschland, die momentan noch sehr eingeschränkt […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
B Zusammenfassung
C Abbildungsverzeichnis
D Tabellenverzeichnis
E Aufgabenstellung
F Hauptteil
1 Einführung
1.1 Probleme der Begriffsdefinition
1.2 Mythen des Stalking
1.2.1 „Stalking ist eine Krankheit“
1.2.2 „Stalking ist gleich Liebeswahn“
1.2.3 „Der Stalker ist ein Fremder“
1.2.4 „Täter und Opfer zu konfrontieren ist eine mögliche Lösungsstrategie“
1.2.5 „Kontakt- und Näherungsverbote sind immer ein wirksames Mittel“
1.3 Die rechtliche Seite
1.4 Stalker-Typologien
1.4.1 Typologie von Mullen, Pathé und Purcell51)
1.4.1.1 Der zurückgewiesene Stalker
1.4.1.2 Der verärgerte Stalker
1.4.1.3 Der intimitätssuchende Stalker
1.4.1.4 Der inkompetente Verehrer
1.4.1.5 Der räuberische Stalker
1.4.2 Typologie von Sheridan und Boon
1.4.2.1 Der Ex-Partner-Stalker
1.4.2.2 Der vernarrter Stalker
1.4.2.3 Der wahnhaft fixierter Stalker
1.4.2.4 Der sadistische Stalker
1.5 Cyberstalking
1.6 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Stalking
1.6.1 Die psychodynamische Theorie und die Psychopathologie
1.6.2 Die Bindungstheorie
1.6.3 Die Objektbeziehungstheorie
1.7 Beziehung zwischen der Art des Stalking-Verhaltens und psychopathologischen Symptomen
1.8 Die Opfer
1.8.1 Opfertypen nach Pathé, Mullen und Purcell
1.8.1.1 Ex-Partner
1.8.1.2 Bekannte und Freunde
1.8.1.3 Berufliche Kontakte
1.8.1.4 Arbeitskollegen
1.8.1.5 Fremde
1.8.1.6 Berühmtheiten
1.9 Umgang mit Stalking
1.9.1 Verhaltensmaßnahmen von Pathé, Mullen und Purcell
1.9.1.1 Kontakt und Konfrontation vermeiden
1.9.1.2 Andere Personen informieren
1.9.1.3 Dokumentation der Vorkommnisse
1.9.1.4 Erwirken einer Einstweiligen Verfügung
1.9.2 Therapeutische Maßnahmen nach Pathé, Mullen und Purcell
1.9.2.1 Pädagogische Maßnahmen
1.9.2.2 Kognitive Verhaltenstherapie
1.9.2.3 Pharmakotherapie
1.9.2.4 Gruppentherapie
1.9.2.5 Familien und Paartherapie
1.9.2.6 Unterstützung durch Organisationen
1.10 Risikofaktoren für Gewalt bei Stalking
1.10.1 Die Metaanalyse von Rosenfeld (2004)63)
1.10.1.1 Probleme
1.10.2 Zusammenhang zwischen Bedrohung und Gewalt
1.10.3 Mentale Störungen und Gewalt
1.10.4 Kriminelle Vergangenheit und Gewalt
1.10.5 Früheres gewalttätiges Verhalten als Risikofaktor
1.11 Wahrnehmung von und Erfahrung mit Stalking zwischen zwei Kulturen
1.12 Unwahre Stalking-Anschuldigungen
1.13 Auswirkungen der Gewalt bei Frauen
1.14 Zusammenhänge zwischen psychischen Symptomen und Gewalt
1.15 Direkte Effekte auf das Opfer
1.15.1 Opferspezifische Variablen
1.15.2 Effekte, ausgelöst durch ein früheres Trauma
1.15.3 Reaktivität
1.15.4 Komorbide Störungen
1.15.5 Modelle komplexer Wirkungsmechanismen
1.15.5.1 Rape Trauma Syndrome (RTS)
1.15.5.2 Battered Woman Syndrome (BWS)
1.15.5.3 Complex PTSD
1.16 Vier Prävalenzstudien im Vergleich
1.16.1 NVAW – National Violence Against Women
1.16.1.1 Alter der Opfer
1.16.1.2 Häufigkeit und Dauer von Stalking
1.16.1.3 Wer stalkt wen?
1.16.1.4 Vermutete Gründe für Stalking
1.16.1.5 Stalking-Handlungen
1.16.1.6 Maßnahmen der Polizei bei Anzeige
1.16.1.7 Gründe für Nichtanzeige
1.16.1.8 Maßnahmen zum Selbstschutz
1.16.1.9 Vermutete Gründe für das Aufhören des Stalking
1.16.1.10 Psychologische und soziale Konsequenzen
1.16.2 BCS – British Crime Survey
1.16.2.1 Alter der Opfer
1.16.2.2 Häufigkeit von Stalking
1.16.2.3 Art der Beziehung zwischen Täter und Opfer
1.16.2.4 Handlungen der Täter
1.16.2.5 Risikogruppen
1.16.2.6 Auswirkungen auf die Opfer
1.16.2.6.1 Emotionale Auswirkungen
1.16.2.6.2 Auswirkungen auf den Lebensstil
1.16.2.6.3 Angst vor körperlichen Übergriffen
1.16.2.6.4 Stalking – Straftat oder keine Straftat
1.16.2.6.5 Kontaktaufnahme zur Polizei
1.16.2.6.6 Zufriedenheit mit der Polizei
1.16.2.6.7 Berichterstattung an Dritte
1.16.3 CSH – Community Study of Harassment
1.16.3.1 Alter der Opfer
1.16.3.2 Häufigkeit von Stalking
1.16.3.3 Art der Beziehung zwischen Opfer und Täter
1.16.3.4 Handlungen der Täter
1.16.3.5 Dauer des Stalking
1.16.3.6 Auswirkungen auf die Opfer
1.16.4 Mannheimer Studie
1.16.4.1 Wer stalkt wen?
1.16.4.2 Dauer und Häufigkeit von Stalking
1.16.4.3 Handlungen der Täter
1.16.4.4 Bedrohung und Gewalt
1.16.4.5 Psychosoziale und medizinische Folgen
1.16.4.6 Maßnahmen der Opfer
1.16.5 Die Darmstädter Studie
1.16.5.1 Wer stalkt wen wie lange?
1.16.5.2 Wie wurde gestalkt?
1.16.5.3 Körperliche und seelische Auswirkungen
1.16.6 Fazit des Vergleichs
1.17 Metaanalyse von Spitzberg
1.18 Erfahrungen von Stalking-Opfern mit der Polizei in Deutschland
2 Methode
2.1 Messinstrumente
2.1.1 Instruktion
2.1.2 Formen der Befragung
2.1.3 Inhalt des Fragebogens
2.2 Durchführung der Untersuchung
2.3 Statistische Auswertung
2.4 Stichprobe
3 Ergebnisse
3.1 Demografische Daten der Opfer
3.1.1 Geschlecht der Opfer
3.1.2 Wohnsitz der Opfer
3.1.3 Beruf der Opfer
3.1.4 Alter der Opfer
3.1.5 Familienstand der Opfer
3.1.6 Kulturelle Herkunft der Opfer
3.1.7 Änderung der demografischen Daten der Opfer aufgrund des Stalking-Vorfalles
3.1.8 Weg, auf dem Opfer von diesem Fragebogen erfuhren
3.2 Demografische Daten der Stalker
3.2.1 Identität der Stalker
3.2.2 Geschlecht der Stalker
3.2.3 Wohnsitz der Stalker
3.2.4 Beruf des Stalkers
3.2.5 Alter der Stalker
3.2.6 Familienstand des Stalkers
3.2.7 Kulturelle Herkunft des Stalkers
3.2.8 Änderung der demografischen Daten der Stalker aufgrund des Stalking-Vorfalles
3.3 Hintergründe des Stalking-Falles
3.3.1 Wissen um Stalking
3.3.2 Wahrnehmung von Stalking
3.3.3 Beginn des Stalking
3.3.4 Fortdauer des Stalking
3.3.5 Beendigung des Stalking
3.3.6 Dauer des Stalking
3.3.7 Gründe für die Beendigung des Stalking
3.3.8 Umstände der ersten Begegnung mit dem Stalker
3.3.9 Gewalttätige Ex-Partner
3.3.10 Bewusstsein für das Stalking
3.3.11 Auslöser für das Stalking
3.3.12 Häufigkeit der Kontaktaufnahme durch den Stalker
3.3.13 Art und Weise der Belästigungen
3.3.14 Belästigung übers Internet
3.3.15 Belästigung von einem anderen Land aus
3.3.16 Stalking von Deutschland aus in ein anderes Land
3.3.17 Ausmaß der Angst
3.3.18 Einstellung der Umwelt gegenüber den Opfern
3.3.19 Der am meisten beängstigende Aspekt des Stalking
3.3.20 Angst vor körperlicher Verletzung
3.3.21 Belästigung Dritter durch den Stalker
3.3.22 Selbstmorddrohungen des Stalkers
3.3.23 Versuch des Stalkers, Informationen über Dritte zu bekommen
3.3.24 Helfer des Stalkers
3.3.25 Informationsquellen des Stalkers
3.3.26 Kontaktaufnahme aus dem Gefängnis
3.3.27 Beschwerde über Kontaktaufnahme
3.3.28 Reaktionen auf die Beschwerde
3.3.29 Auswirkungen der Beschwerde
3.4 Reaktionen Dritter auf den Stalking-Vorfall
3.4.1 Offizielle Bekanntmachung des Stalking-Vorfalls
3.4.2 Anzahl der einzelnen Vorfälle von Belästigung
3.4.3 Nachfrage der Polizei nach früheren Vorfällen
3.4.4 Instanz, bis zu jener Anzeige gelangt ist
3.4.5 Genauere Beschreibung der Verurteilung des Stalkers
3.4.6 Einzelverfahren gegen den Stalker
3.4.7 Gründe, warum ein Fall nicht vor Gericht kam
3.4.8 Ausmaß der Unterstützung
3.4.9 Medienberichterstattung
3.4.10 Kontaktaufnahme zu den Medien
3.5 Meinungen der Opfer
3.5.1 Empathie der Polizei für die Opfer
3.5.2 Ausreichende Schulung der Polizei
3.5.3 Wirksamste Maßnahme der Polizei
3.5.4 Annahmen der Opfer über Beendigung des Stalkings
3.5.5 Ratschläge für andere Opfer
3.5.6 Beste Maßnahme, den Stalker zu stoppen
3.6 Hilfe für Stalking-Opfer
3.6.1 Kontakt zu Stalking-Beratungsstelle
3.6.2 Erwartungen an Stalking-Beratungsstelle
3.6.3 Bevorzugte Uhrzeit für die Kontaktaufnahme zu einer Stalking-Beratungsstelle
3.6.4 Bevorzugtes Geschlecht des Beraters
3.6.5 Bevorzugte Informationsquellen zum Thema Stalking
3.6.6 Bereitschaft, für Informationsmaterial zu zahlen
3.6.7 Idee einer elektronische Überwachung
3.6.8 Nutzung einer elektronischen Überwachung
3.7 Reaktionen der Opfer auf das Stalking
3.7.1 Umgang mit Stalking
3.7.2 Einsatz von Bewältigungsstrategien
3.7.3 Generelle Reaktionen der Opfer auf den Stalker
3.7.4 Zeitpunkt der Reaktion auf den Stalker
3.7.5 Auswirkungen der Reaktionen
3.7.6 Reaktionen Dritter gegenüber dem Stalker auf Wunsch des Opfers
3.7.7 Auswirkungen der Reaktionen Dritter
3.8 Die Auswirkungen von Stalking
3.8.1 Physische Auswirkungen
3.8.2 Emotionale Auswirkungen
3.8.3 Medizinische Versorgung
3.8.4 Verweisung des Hausarztes an Beratungsstelle
3.8.5 Soziale Konsequenzen und finanzielle Einbußen
3.8.6 Höhe der finanziellen Aufwendungen
3.8.7 Allgemeine Auswirkungen des Stalkings
3.8.8 In Mitleidenschaft gezogene Personen
3.8.9 Erhöhte Sensibilität bei anderen Ereignissen
3.8.10 Emotionaler Zustand der Opfer
4 Diskussion
4.1 Die Methode
4.2 Die Stichprobe
4.3 Der Fragebogen
4.4 Die Ergebnisse
4.4.1 Demografische Daten der Opfer
4.4.1.1 Geschlecht der Opfer
4.4.1.2 Alter der Opfer
4.4.1.3 Beruf der Opfer
4.4.1.4 Familienstand der Opfer
4.4.2 Demografische Daten der Stalker
4.4.2.1 Geschlecht des Stalkers
4.4.2.2 Alter des Stalkers
4.4.2.3 Beruf des Stalkers
4.4.2.4 Familienstand des Stalkers
4.4.3 Hintergründe des Stalking
4.4.3.1 Wissen um Stalking
4.4.3.2 Wahrnehmung von Stalking
4.4.3.3 Dauer des Stalkings
4.4.3.4 Beendigung des Stalking
4.4.3.5 Umstände der ersten Begegnung
4.4.3.6 Gewalt in der Partnerschaft
4.4.3.7 Bewusstsein für Stalking
4.4.3.8 Auslöser für Stalking
4.4.3.9 Häufigkeit der Kontaktaufnahme
4.4.3.10 Art und Weise der Belästigung
4.4.3.11 Belästigung übers Internet
4.4.3.12 Belästigung von einem anderen Land aus oder von Deutschland aus in ein anderes Land
4.4.3.13 Ausmaß der Angst
4.4.3.14 Der am meisten beängstigende Aspekt
4.4.3.15 Angst vor körperlicher Verletzung
4.4.3.16 Versuch des Stalkers, Informationen über Dritte zu
erhalten
4.4.3.17 Helfer des Stalkers
4.4.3.18 Informationsquellen des Stalkers
4.4.3.19 Einstellung der Umwelt gegenüber den Opfern
4.4.3.20 Kontaktaufnahme aus dem Gefängnis und Beschwerde darüber
4.4.4 Reaktionen Dritter auf den Stalking Vorfall
4.4.4.1 Offizielle Bekanntmachung des Stalking-Vorfalles
4.4.4.2 Anzahl der einzelnen Vorfälle der Belästigung
4.4.4.3 Instanz, bis zu jener die Anzeige gelangt ist
4.4.4.4 Einzelverfahren gegen den Stalker
4.4.4.5 Gründe, warum ein Fall nicht vor Gericht kam
4.4.4.6 Ausmaß der Unterstützung
4.4.4.7 Einbezug der Medien
4.4.5 Meinungen der Opfer
4.4.5.1 Empathie der Polizei
4.4.5.2 Wirksamste Maßnahme der Polizei
4.4.5.3 Annahmen über die Beendigung des Stalkings
4.4.5.4 Beste Maßnahme, den Stalker zu stoppen
4.4.5.5 Ratschläge für andere Opfer
4.4.6 Hilfe für Stalking-Opfer
4.4.6.1 Bevorzugte Uhrzeit für die Kontaktaufnahme zu einer Beratungsstelle
4.4.6.2 Bevorzugtes Geschlecht des Beraters
4.4.6.3 Bevorzugte Informationsquelle zum Thema Stalking
4.4.6.4 Bereitschaft für Informationsmaterial zu zahlen
4.4.6.5 Idee und Einsatz einer elektronischen Überwachung
4.4.7 Reaktionen der Opfer auf das Stalking
4.4.7.1 Umgang mit Stalking
4.4.7.2 Einsatz von Bewältigungsstrategien
4.4.7.3 Generelle Reaktionen der Opfer auf den Stalker
4.4.7.4 Reaktionen Dritter auf den Stalker
4.4.8 Die Auswirkungen von Stalking
4.4.8.1 Physische Auswirkungen
4.4.8.2 Psychische Auswirkungen
4.4.8.3 Medizinische Versorgung
4.4.8.4 Soziale und finanzielle Konsequenzen
4.4.8.5 Allgemeine Auswirkungen von Stalking
4.4.8.6 In Mitleidenschaft gezogene Personen
4.4.8.7 Erhöhte Sensibilität bei anderen Ereignissen
4.4.8.8 Emotionaler Zustand der Opfer
G Schlusswort
H Danksagung
I Anhang
1 Zusätzliche Tabellen
1.1 Bewusstsein für Stalking
1.2 Auslöser für Stalking
1.3 Art und Weise der Belästigung
1.4 Einstellung der Umwelt – andere Angaben
1.5 Der am meisten beängstigende Aspekt
1.6 Belästigung Dritter
1.7 Infos über Dritte
1.8 Informationsquelle des Stalkers – andere Angaben
1.9 Offizielle Bekanntmachung des Stalking-Vorfalles – andere Angaben
1.10 Beschreibung der Verurteilung des Stalkers
1.11 Gründe, warum ein Fall nicht vor Gericht kam
1.12 Empathie der Polizei – andere Angaben
1.13 Polizei ausreichend geschult – andere Angaben
1.14 Wirksamste Maßnahmen der Polizei – andere Angaben
1.15 Anmerkungen der Betroffenen
2 Fragebogen zum Thema Stalking
3 Variablendefinition für SPSS
J Literatur- und Quellenverzeichnis
B Zusammenfassung
Die vorliegende Diplomarbeit beschreibt die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, basierend auf einem Fragebogen zum Phänomen Stalking aus Sicht der Opfer. Die Arbeit wurde im Rahmen einer gemeinsamen Forschungsarbeit der britischen Opferschutzorganisation „Network for Surviving Stalking“ und der Arbeitsgruppe „Stalking“ der Technischen Universität Darmstadt erstellt.
Ziel der Untersuchung war es, ein umfangreiches und detailliertes Bild über Stalking aus Sicht der Opfer zu erlangen, um Hilfsangebote und die Unterstützung der Betroffenen zu verbessern. Neben den demografischen Daten von Tätern und Betroffenen, die ihre Beziehungskonstellation wiedergeben sollen, war es ein Anliegen, Hintergründe über die Stalking-Vorfälle in Erfahrung zu bringen, die sich auf das Wissen, die Wahrnehmung um das Problem, sowie die Auslöser für die Ereignisse beziehen und die Art und Weise, in der sich Stalking geäußert hat. Das Interesse galt weiterhin den Reaktionen offizieller und inoffizieller Dritter auf die Vorfälle. Um einen tiefgreifenden Eindruck auch in die persönlichen Belange der Opfer zu erhalten, wurden diese ausführlich zu ihrer Meinung befragt. Für ein besseres Bild über die Bedürfnisse in einer Stalking-Situation, sollten die Befragten angeben, welche Hilfsmaßnahmen für sie wünschenswert wären, bzw. gewesen wären. Erfasst wurden weiterhin die Reaktionen der Betroffenen auf den Stalker und das Stalking, so wie die mit den Ereignissen verbundenen physischen, psychischen, sozialen und finanziellen Konsequenzen. Um einen Einblick in ganz individuelle Probleme und Nöte der Geschädigten zu erhalten, konnten diese noch weitere Anmerkungen ergänzen.
C Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Beruf der Opfer-Alter der Opfer
Abbildung 2: Familienstand der Opfer
Abbildung 3: Beruf der Stalker
Abbildung 4: Familienstand der Stalker
Abbildung 5: Wissen um Stalking
Abbildung 6: Gründe für die Beendigung des Stalking
Abbildung 7: Umstände der ersten Begegnung mit dem Stalker
Abbildung 8: Gewalttätige Ex-Partner
Abbildung 9: Häufigkeit der Kontaktaufnahme durch den Stalker
Abbildung 10: Ausmaß der Angst
Abbildung 11 Angst vor körperlicher Verletzung
Abbildung 12: Belästigung dritter durch den Stalker
Abbildung 13: Versuch des Stalker, Informationen ü. Dritte zu bekommen
Abbildung 14: Informationsquellen des Stalkers
Abbildung 15: Kontaktaufnahme aus dem Gefängnis
Abbildung 16: Beschwerde über Kontaktaufnahme
Abbildung 17: Offizielle Bekanntmachung des Stalking-Vorfalls
Abbildung 18: Wirksamste Maßnahme der Polizei
Abbildung 19: Kontakt zu Stalking-Beratungsstelle
Abbildung 20: Erwartungen an Stalking-Beratungsstelle
Abbildung 21: Bevorzugte Uhrzeit für die Aufnahme zu einer Stalking- Beratungsstelle
Abbildung 22: Bevorzugtes Geschlecht des Beraters
Abbildung 23: Bevorzugte Informationsquellen zum Thema Stalking
Abbildung 24: Bereitschaft, für Informationsmaterial zu zahlen
Abbildung 25: Idee einer elektronischen Überwachung
Abbildung 26: Nutzung einer elektronischen Überwachung
Abbildung 27: Generelle Reaktionen der Opfer auf den Stalker
Abbildung 28: Zeitpunkt der Reaktion auf den Stalker
Abbildung 29: Auswirkungen der Reaktionen
Abbildung 30: Reaktionen Dritter gegenüber dem Stalker auf Wunsch des Opfers
Abbildung 31: Auswirkungen der Reaktionen Dritter
Abbildung 32: Physische Auswirkungen
Abbildung 33: Emotionale Auswirkungen
D Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Weg, auf dem Opfer von Fragebogen erfuhr
Tabelle 2: Wahrnehmung von Stalking
Tabelle 3: Beginn des Stalking
Tabelle 4: Beendigung des Stalking
Tabelle 5: Dauer des Stalking
Tabelle 6: Art und Weise der Belästigung
Tabelle 7: Belästigung übers Internet
Tabelle 8: Einstellung der Umwelt gegenüber den Opfern
Tabelle 9: Helfer des Stalkers
Tabelle 10: Anzahl der einzelnen Vorfälle von Belästigung
Tabelle 11: Nachfrage der Polizei nach früheren Vorfällen
Tabelle 12: Einzelverfahren gegen den Stalker
Tabelle 13: Gründe, warum ein Fall nicht vor Gericht kam
Tabelle 14: Ausmaß der Unterstützung
Tabelle 15: Ausmaß der Unterstützung – andere Angaben
Tabelle 16: Ausmaß der Unterstützung – andere Angaben Total
Tabelle 17: Endgültiges Ende des Stalking
Tabelle 18: Endgültige Ende des Stalkings – andere Anmerkungen
Tabelle 19: Ratschläge für andere Opfer
Tabelle 20: Beste Maßnahme, den Stalker zu stoppen
Tabelle 21: Erwartungen an Stalking-Beratung - andere Formen der Unterstützung
Tabelle 22: Erwartungen an Stalking-Beratungsstelle – andere Formen der Information
Tabelle 23: Weg von Rat/Info – andere Angaben
Tabelle 24: Betrag für Infomaterial – andere Angaben
Tabelle 25: Reaktionen auf Stalking
Tabelle 26: Bewältigungsstrategien
Tabelle 27: Bewältigungsstrategien – andere Angaben
Tabelle 28: Reaktionen der Opfer – andere Angaben
Tabelle 29: Reaktionen dritter – andere Angaben
Tabelle 30: Reaktionen dritter – Personen
Tabelle 31: Physische Auswirkungen – andere Angaben
Tabelle 32: emotionale Auswirkungen – andere Angaben
Tabelle 33: Medizinische Versorgung
Tabelle 34: Soziale Konsequenzen und finanzielle Einbußen
Tabelle 35: Soziale Konsequenzen und finanzielle Einbußen – andere Angaben
Tabelle 36: Höhe der finanziellen Aufwendungen
Tabelle 37: Allgemeine Auswirkungen des Stalking
Tabelle 38: In Mitleidenschaft gezogenen Personen
Tabelle 39: Erhöhte Sensibilität
Tabelle 40: Emotionaler Zustand der Opfer
Tabelle 41: Bewusstsein für Stalking
Tabelle 42: Auslöser für Stalking
Tabelle 43: Art und Weise der Belästigung
Tabelle 44: Einstellung der Umwelt – andere Angaben
Tabelle 45: Der am meisten beängstigende Aspekt
Tabelle 46: Belästigung Dritter – andere Angaben
Tabelle 47: Versuche des Stalkers Informationen über Dritte zu bekommen – andere Angaben
Tabelle 48: Informationsquelle des Stalkers – andere Angaben
Tabelle 49: Offizielle Bekanntmachung des Stalking-Vorfalles – andere Angaben
Tabelle 50: Beschreibung der Verurteilung des Stalkers
Tabelle 51: Gründe, warum ein Fall nicht vor Gericht kam
Tabelle 52: Empathie der Polizei – andere Angaben
Tabelle 53: Ausreichende Schulung der Polizei – andere Angaben
Tabelle 54: Wirksamste Maßnahmen der Polizei – andere Angaben
E Aufgabenstellung
Da die Stalking-Forschung in Deutschland eine sehr junge Wissenschaft ist, werden in letzter Zeit hierzulande vermehrt Untersuchungen zu diesem Phänomen durchgeführt. Hierzu zählen die Mannheimer Studie von 2004 von Dr. med. Marina Martini, die bisher umfangreichste deutsche der TU Darmstadt von 2004 unter der Leitung von Diplom-Psychologe Dr. Jens Hoffmann., über die in der Einleitung ein ausführlicher Überblick gegeben wird.
Diese sind im Kontext zu früheren Studien aus anderen Nationen wie z. B. der in dieser Arbeit angesprochenen „National Violence Against Women – NVAW aus dem Jahre 1998 von Tjaden und Thoennes 72), der englische „British Crime Survey“, ebenfalls von 1998 von Budd und Mattinson12), der australischen aus 2001, durchgeführt von Purcell, Pathé und Mullen59), zu sehen.
Der Schwerpunkt eines neuen Forschungsprojekts der Technischen Universität Darmstadt liegt in der ausführlichen Erfassung der emotionalen und physischen Befindlichkeiten der Opfer und der Erfassung deren Meinung über das Phänomen Stalking.
Endziel ist es Unterstützung und Hilfsangebote in Deutschland, die momentan noch sehr eingeschränkt vorhanden sind zu verbessern und gegebenenfalls neue bereitzustellen.
Um einen Anknüpfpunkt an bestehende Untersuchungen im europäischen Ausland und damit eine auch internationale Vergleichbarkeit zu erzielen sollen in einem ersten Schritt im Rahmen dieser Diplomarbeit auf der Basis einer zu erstellenden deutschen Fassung des britischen Erhebungsbogens die Erfahrungen von Opfern im deutschsprachigen Raum erfasst und detailliert ausgewertet werden.
F Hauptteil
1 Einführung
Der Begriff Stalking bedeutet aus dem Englischen übersetzt „anpirschen“ und beschreibt das wiederholte, unerwünschte Belästigen und Verfolgen einer Person durch eine andere, ein Phänomen, dessen Existenz nicht neu ist, jedoch erst vor nicht all zu langer Zeit einen Namen erhalten hat. Im aktuell behandelten Gesetzesentwurf des Bundesjustizministeriums wird der Begriff „Nachstellen“ verwendet
Schon 550 v. Chr. konnte man im 4. Buch des alten Römischen Gesetzesbandes die Passage „Iniuria commititur ... si quis matrem familiar aut praetextatum praetextatumve adsectatus fuerit“ lesen, was sinngemäß bedeutet, es ist verboten, eine verheiratete Frau zu verfolgen. Verhalten, welches heute als Stalking bezeichnet wird, findet man auch in einem Werk von Dante Alighieri aus dem Jahre 1292 oder bei Shakespeare 1592.
Stalking ist ein ausgesprochen komplexer Sachverhalt, die Handlungen der Täter vielgestaltig und daher kaum vollständig zu nennen. Sie reichen von unerwünschten Briefen bis hin zum Mordanschlag. Stellvertretend seien einige Täteraktionen genannt:
Verfolgen
Schreiben von Briefen oder E-Mails
direkte und indirekte Bedrohung
Telefonterror
Schalten von falschen Anzeigen in der Zeitung (Hochzeits- oder Todesanzeigen)
Hinterlassen von Geschenken
Beobachten
Häufige Präsenz in der Nähe der Wohnung oder des Arbeitsplatzes des Opfers
Sachbeschädigung
Vandalismus
Verleumdung/Rufschädigung
Falsche Verdächtigung des Opfers bei Polizei oder Staatsanwaltschaft
Ausspionieren der Familie oder des Bekannten-/Freundeskreises der Opfer
Ausspionieren persönlicher Daten
Bestellen von Waren unter dem Namen der Opfer
Bedrohung des Opfers
Bedrohung der Familienmitglieder der Opfer
Töten oder Androhung der Tötung eines Haustiers der Opfer
sexuelle Belästigung/Nötigung
Vergewaltigung
Überfälle mit Gegenständen
Mordversuche
etc.
Daraus ergeben sich zwangsläufig Schwierigkeiten, das Problem Stalking adäquat zu definieren.
1.1 Probleme der Begriffsdefinition
Es werden viele Diskussionen darüber geführt, welche Verhaltensweisen und Aktivitäten der Täter der Begriff Stalking beinhaltet. Die meisten US Bundesstaaten verstehen unter Stalking ein absichtliches, wiederholtes oder unerwünschtes Belästigen, das eine „vernünftige Person“ als bedrohlich oder Angst einflößend erlebt (Miller, 2001)46).
Das südaustralische Strafgesetzbuch Artikel 1935, s19AA71) definiert Stalking als Verfolgen einer Person, Herumlungern vor Haus oder Arbeitsplatz, Eindringen in oder Zerstören des Eigentums derselben, Abgabe beleidigender Schriften oder Gegenstände an die Person, Überwachen der Person oder Agieren in einer Art und Weise, die erwarten lässt, dass sich bei dem Betroffenen Besorgnis oder Furcht regt.
In England und Wales dagegen versucht das Gesetz zum Schutz vor Belästigung nicht Stalking zu beschreiben, sondern legt fest, eine Person darf kein Verhalten zeigen, durch das sich eine andere belästigt fühlt.
Blaauw, Sheridan und Winkel (2002)3) bemängeln nicht nur die Unterscheidung der Verhaltensbeschreibungen in den diversen Anti-Stalking-Gesetzen, sondern auch in der Menge der Verhaltensweisen, die als belästigend angesehen werden, so wie der Absicht des Täters, das Opfer zu malträtieren.
Die mannigfaltigen Definitionsversuche führen zwangsläufig zu einer unterschiedlichen Auffassung darüber, was Stalking letztendlich ausmacht. So verwenden einige Forscher für den gleichen oder einen ähnlichen Sachverhalt differierende Bezeichnungen wie „besessenes Verfolgen“ (z. B. Meloy, 199642); McCann, 199840)), „obsessive Belästigung“ (Rosenfeld, 200061)) oder „obsessive Zudringlichkeit“ (Cupach und Spitzberg, 199813)).
Das Hauptproblem dabei ist das nicht Greifbare des Phänomens. Stalking ist ein außergewöhnliches Verbrechen, das selten aus Bedrohung oder Gewaltanwendung besteht, sondern oftmals „nur“ aus augenscheinlich harmlosem, sich ständig wiederholendem Verhalten, wie z. B. plötzliche Anwesenheit des Stalkers an Orten, an denen sich sein Opfer aufhält – was für dieses jedoch eine unzumutbare Belästigung darstellt. Daraus ergibt sich auch die Schwierigkeit zu einer befriedigenden und einheitlichen Definition des Tatbestandes Stalking zu gelangen, ein Umstand, der sich auch auf die Rechtsprechung auswirkt.
1.2 Mythen des Stalking
Ein Grund, warum das Phänomen Stalking nicht in angemessener Weise Würdigung erfährt, sind die Mythen, die mit dem Begriff verbunden sind:
1.2.1 „Stalking ist eine Krankheit“
Stalking ist per se keine Krankheit, sondern eine Verhaltensweise, bei der der Täter stark auf sein Opfer fixiert ist. Im Umgang mit anderen wird diese auf ein Objekt ausgerichtete pathologische Verhaltensweise nicht auftreten, weshalb eine solche Person in alltäglichen Interaktionen mit Dritten unauffällig erscheint.
1.2.2 „Stalking ist gleich Liebeswahn“
Beim Liebeswahn – auch Erotomanie genannt – unterliegt eine Person dem unerschütterlichen Irrglauben, von einem anderen Menschen geliebt zu werden, ohne die geringsten Beweise für diese Annahme. Tatsächlich liegt der Anteil der Stalker, die diesem Wahn erlegen sind lediglich bei 10 %.
1.2.3 „Der Stalker ist ein Fremder“
Wie in den obigen Studien bereits dargestellt kommt das Gros der Stalker aus dem nächsten sozialen Umfeld – wie bei vielen Missbrauchs- und Gewaltdelikten. Von Fremden werden vorwiegend Prominente gestalkt.
1.2.4 „Täter und Opfer zu konfrontieren ist eine mögliche Lösungsstrategie“
Diese Maßnahme führt genau zu dem gegenläufigen Effekt, denn durch eine Konfrontation mit seinem Opfer erhält der Täter weitere Nahrung, die Nähe zu seinem Opfer noch stärker zu suchen.
1.2.5 „Kontakt- und Näherungsverbote sind immer ein wirksames Mittel“
Die Empfehlung zu einer solchen Handhabe muss individuell vorgenommen und von Fall zu Fall entschieden werden, da sie sich – je nach Persönlichkeit des Stalkers – als wirkungsvoll oder kontraindiziert erweisen kann, was im ungünstigsten Fall in einem Gewaltakt eskaliert.
1.3 Die rechtliche Seite
Der erste Stalkingfall mit dem die breite Öffentlichkeit in den USA in Berührung kam war die Ermordung der Schauspielerin Theresa Saldana im Jahre 1982. Als 1989 in Los Angeles die Mimin Rebecca Schaeffer ebenfalls durch die Hand eines obsessiven Fans ums Leben kam, richtete das Los Angeles Police Department (LAPD) eine bis dahin einmalige dauerhafte Sondereinheit zur Bewältigung von Bedrohung ein. Deren Aufgabe besteht darin, die Gefahr, die von einem Stalker ausgeht einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine Eskalation der Situation verhindern. Damit soll dem Täter gleichzeitig bewusst gemacht werden, er steht unter der Beobachtung der Rechtsvertreter. Weiterhin gibt diese Polizeieinheit den Opfern Ratschläge und Hilfestellungen, wie sie die Situation rechtlich aber auch psychisch bewältigen können. Die kalifornische Justiz reagierte auf die Ermordung von Frau Schaeffer mit der Verabschiedung des ersten Anti-Stalking-Gesetzes der USA im Jahre 1990.
Bis 1995 verfügten alle 50 US Bundesstaaten und der District of Columbia über entsprechende Erlasse. Die Gesetzeslage ist allerdings von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. In einigen wird Stalking als schweres Verbrechen geahndet, in anderen als leichtes Vergehen. Dementsprechend variiert das Ausmaß der Strafe.
Seit 1996 existiert eine Staaten übergreifende Bundesverordnung (Federal Crime). Amerika hat somit eine Vorreiterrolle in der Problematisierung und Bekämpfung von Stalking übernommen, die möglicherweise auf den hohen Stellenwert der Unantastbarkeit der persönlichen Freiheit für das Amerikanische Volk zurückzuführen ist.
Kanada, alle australischen Bundesstaaten und Territorien, Großbritannien, Irland, Belgien und die Niederlande folgten dem Beispiel Amerikas und schufen ähnliche Gesetze. 1993 traten in Kanada und Australien entsprechende Verordnungen erstmals in Kraft. Es folgten 1997 England und Wales, 1998 Belgien. Hierzulande existieren zwar Straftatbestände, die Stalking-Handlungen der Täter beinhalten, wie Hausfriedensbruch (§ 123 StGB), falsche Verdächtigung (§ 164 StGB), Beleidigung (§ 185 StGB), üble Nachrede (§ 186 StGB), Verleumdung (§ 187 StGB), Körperverletzung (§ 223 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), und Bedrohung (§ 241 StGB), aber sie erfassen nicht die Komplexität dieses Verhaltens. Da jedoch Stalking in Deutschland immer häufiger auftritt und somit auch ein erweitertes Bewusstsein für dieses Problem in der Öffentlichkeit entstanden ist, befasst sich die Politik mit diesem Thema. So stellte am 29. Juni 2004 Hessens Justizminister Dr. Christian Wagner einen Entwurf zur Bekämpfung unzumutbarer Belästigung vor, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden soll. Der Bundestag empfahl daraufhin folgende Gesetzesänderung:
§ 241a StGB
Unzumutbares Nachstellen oder Verfolgen
(1) Wer einem Menschen unbefugt gegen dessen ausdrücklich oder schlüssig erklärtem Willen unzumutbar nachstellt oder ihn verfolgt, indem er fortwährend dessen körperliche Nähe sucht
1. unter Verwendung von Fern- oder sonstigen Kommunikationsmitteln Kontakt herzustellen versucht,
2. ihn, einen Angehörigen oder eine andere ihm nahestehende Person bedroht oder
3. einen ähnlichen Eingriff vornimmt
und dadurch bei ihm die begründete Befürchtung einer gegenwärtigen Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut der eigenen Person, eines Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person hervorruft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen wird die Tat mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter durch die Tat zugleich gegen eine zivilrechtliche Schutzanordnung verstößt.
(3) Die Tat nach Absatz 1 wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.“
Kritik an diesem Gesetz – auch an dessen Wortlaut – wird von juristischer Seite geübt. Eine Strafandrohung von bis zu zwei Jahren – und auch nur, wenn gegen eine richterliche Anordnung verstoßen wird – schreckt beharrliche Stalker nicht ab. Des weiteren soll § 241a als Privatklagedelikt gehandhabt werden, was zu der Befürchtung Anlass gibt, dass die Staatsanwaltschaft überwiegend Gebrauch von der Verweisung der Opfer auf den Privatklageweg machen wird. Auch bringt der Straftatbestand keine Verbesserung im Umgang mit psychisch Kranken und somit in der Regel vermindert schuldfähigen Stalkern, die ihr Treiben ohne Befürchtung von Konsequenzen fortsetzen können.
Inzwischen werden in einem weiteren Entwurf Haftstrafen bis zu drei Jahren für Stalking-Täter gefordert. Allerdings sollen nach dem jüngsten Vorschlag von Bundesjustizministerin Zypries – vorgestellt am 15. 04. 2005 – lediglich
Telefonterror
Auflauern vor der Wohnungstür oder am Arbeitsplatz
ständige Belästigung per E-Mail und
das Bestellen von Waren für Dritte
unter den Straftatbestand von Stalking fallen, eine Definition des Phänomens, die nach Medienberichten Politikern wie auch Betroffenen zu eingeschränkt ist.
1.4 Stalker-Typologien
Typologien gestatten eine Zuordnung von Verhaltensweisen in bereits existierende Kategorien und somit eine rasche Orientierung im Kontext des Geschehens – ein eindeutiger Vorteil in der Praxis. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass durch das Hervorheben nur einiger weniger Merkmale, die als typisch definiert werden, nicht die ganze Komplexität der Verhaltensweise in Betracht gezogen wird. Trotzdem erweisen sich Klassifikationen im Hinblick auf Diagnose und Bewertung von Verhaltensweisen als sehr wertvoll. So wurden auch für die Beurteilung von Stalkern unterschiedliche Typologien entwickelt.
1.4.1 Typologie von Mullen, Pathé und Purcell51)
Das Australische Forscherteam entwickelte im Jahr 2000 aufgrund seiner Untersuchungen mit 167 Stalkern ein Klassifikationsschema bestehend aus drei Achsen. Achse eins umfasst die Motivationslage des Stalkers und den Kontext, in dem dessen Verhalten auftritt und beinhaltet fünf Typen. Achse zwei ordnet die Beziehung zwischen Täter und Opfer ein, Achse drei erfasst den psychiatrischen Zustand des Stalkers.
1.4.1.1 Der zurückgewiesene Stalker
Hierunter fällt mit 50 % die größte Gruppe von Stalkern. Meist sind es Ex-Partner, deren Motivation eine Mischung aus Wut und Wiederannäherung darstellt. Sie sind dem Glauben verfallen, ihr Opfer provoziere sie und hegen Rachegefühle infolge narzisstischer Kränkungen.
1.4.1.2 Der verärgerte Stalker
Diese Kategorie von Stalkern betrachtet sich selbst als Opfer und ihre Handlungen als gerechtfertigte Maßnahme gegen vermeintlich erlittenes Unrecht. Sie beabsichtigen Angst bei ihrem Objekt zu schüren und befriedigen somit ihre Macht- und Kontrollbedürfnisse. Betroffene sind häufig Personen, gegen die die Täter einen persönlichen Groll hegen, oder Organisationen, die eine konträre Position vertreten. Aber auch Ärzte oder Psychologen zählen zu deren Opfern
1.4.1.3 Der intimitätssuchende Stalker
Stalker dieser Kategorie pflegen in der Regel keine befriedigenden Beziehungen und versuchen mit ihrem Verhalten eine solche zu einer von ihnen verehrten Person herzustellen, von der sie jedoch zuvor zurückgewiesen wurden, oder von der sie irrtümlicherweise annehmen, sie hege ihnen gegenüber tiefere Gefühle. Sie idealisieren ihr Opfer und hoffen auf Erfüllung ihres Wunsches nach Intimität und Nähe zum Objekt ihrer Begierde. Opfer finden sich häufig unter Prominenten, aber auch unter Ärzten oder Psychologen, da die Stalker zuletzt genannte als Menschen wahrnehmen, die ihnen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, was von den Tätern oft fehlinterpretiert wird.
1.4.1.4 Der inkompetente Verehrer
Auch dieser Typus sucht die Beziehung, allerdings keine intime, sondern möchte mit seinem Opfer, das er sich aufgrund besonderer Auffälligkeiten auserkoren hat, lediglich unverbindliche Verabredungen treffen. Da solche Stalker für gewöhnlich nicht besonders hartnäckig aber trotzdem außerordentlich belästigend sind, wenden sie sich nach wiederholter Zurückweisung meist von ihrem Opfer ab, suchen sich jedoch unmittelbar darauf wieder ein neues.
1.4.1.5 Der räuberische Stalker
Jene Art von Stalkern stellen zwar den geringsten Anteil der Täter, sind dafür aber die gefährlichsten. Ziel dieser fast ausschließlich männlichen Gruppe ist der meist sexuell motivierte Angriff des Opfers und dessen damit einhergehende körperliche Verletzung.
1.4.2 Typologie von Sheridan und Boon
Sheridan und Blaauw (2002)65) sowie Sheridan und Boon (2002)68) analysierten die demografischen Daten von Stalking-Tätern und -Opfern, den Ablauf des Geschehens, die emotionalen und verhaltensmäßigen Auswirkungen auf die Opfer, sowie den Einfluss professioneller Hilfestellungen, die den Betroffenen zuteil wurde. Daraus ergaben sich für die Forscher vier Stalking-Typen:
1.4.2.1 Der Ex-Partner-Stalker
Ca. 50 % der Stalker repräsentieren diesen Typus. Das Gewaltpotential jener Täter ist außerordentlich hoch und zieht auch Dritte in Mitleidenschaft.
1.4.2.2 Der vernarrter Stalker
Hier spielt Gewalt für gewöhnlich keine Rolle. Vielmehr versucht der Stalker zu seinem Opfer eine Beziehung zu beginnen, was die Abgrenzung zu einem normalen Werben um eine Person erschwert. Mit Briefen, Geschenken oder permanenter Anwesenheit sind solche Stalker außerordentlich lästig. Die Betroffenen fühlen sich meist eingeschüchtert.
1.4.2.3 Der wahnhaft fixierter Stalker
Bei diesem Typ liegt eine – meist wahnhafte – Persönlichkeitsstörung vor, wobei eine Differenzierung zwischen gefährlich und nicht gefährlich vorgenommen werden muss.
Gefährliche Stalker dieser Kategorie leiden nicht selten unter Schizophrenie oder einem Borderline-Syndrom, was den Umgang mit ihnen schwierig gestaltet, da sie rationalen Argumenten gegenüber nicht zugänglich sind.
Weniger gefährliche Vertreter werden als Erotomanen bezeichnet. Sie verhalten sich so, als ob eine intime Beziehung zu ihrem Opfer bestehen würde. Es kommt häufig zu Handlungen oder Angriffen gegenüber Dritten, die als Eindringlinge in dieses eingebildete Verhältnis betrachtet werden, vor dem der Stalker seinen „Partner“ schützen muss.
1.4.2.4 Der sadistische Stalker
Psychopathologische Persönlichkeitsstörungen zeichnen diesen Stalker-Typus aus. Er ist unfähig Gefühle wie Reue, Schuld oder Mitgefühl zu empfinden und verhält sich seiner Umgebung gegenüber ausgesprochen dissozial. Seine Motivation liegt in einem übersteigerten Macht- und Kontrollstreben. Er setzt sehr subtile Stalking-Strategien ein, um sein Opfer zu quälen. Ein sadistischer Stalker kann sehr gefährlich werden.
1.5 Cyberstalking
Bocij und McFarlane (2002)4) definieren Cyberstalking als Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), besonders des Internets zu dem Zweck, Personen zu belästigen. Diese Belästigung erfolgt per Übersenden von beleidigenden E-Mails, Diebstahl der Identität, Zerstörung von Daten oder Materialien durch versenden von Viren, Verbreiten bösartiger Gerüchte, Eintragungen mit obszönen Inhalten in Internet-Gästebücher. Die Handlungen der Täter variieren nach Dauer und Intensität.
Bei einem Fall von Identitätsdiebstahl in den USA versuchte Abraham Abdallah`s, der im März 2001 in den USA verhaftet wurde, via Internet an vertrauliche Informationen über die Finanzen einiger Berühmtheiten, u.a. Steven Spielberg, Oprah Winfrey und George Lucas zu gelangen, um mit diesen Millionen von Dollars von deren Konten abzubuchen (Bocji und McFarlane, 20024)).
Der Terminus Cyberstalking lässt vermuten, diese Form des Verhaltens spiele sich ausschließlich ‚online’, innerhalb der virtuellen Welt des Internets ab. Dabei wird jedoch allzu oft die Übertragung dieses Verhaltens in die Wirklichkeit übersehen (Bocji und McFarlane, 20024)). Beispielsweise ist die Angst, die die Opfer empfinden real und dauert an, wenn der Computer bereits ausgeschaltet ist. Außerdem tritt Cyberstalking nicht nur per se auf, sondern auch im Kontext mit anderen Stalking-Vorkommnissen.
Cyberstalking bietet zudem für den Täter einige Vorteile. Er kann sein Opfer in der Abgeschiedenheit seiner vier Wände verfolgen, ein Umstand, der Anonymität und Sicherheit verleiht, da physische Kontakte ausgeschlossen sind. Meloy (1998)43) bemerkt in diesem Zusammenhang, Stalking erleichtert gerade sozial inkompetenten Persönlichkeiten via Internet die Kontaktaufnahme zu einem anderen Menschen und das Ausdrücken sowohl positiver als auch negativer Emotionen.
Des Weiteren existieren keine räumlichen Grenzen mehr. Belästigung in dieser Form ist nicht auf eine Stadt oder ein Land beschränkt, sondern weltweit ausführbar.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es nur wenige Studien zu diesem Themenkomplex. Hierzu vorliegende Erkenntnisse beziehen sich in erste Linie auf Fallbeschreibungen oder Angaben vor Organisationen. So berichtet z. B. die Internet-Hilfsorganisation Cyber-Angels von 500 Cyberstalking-Fällen pro Tag (Dean, 2000)15).
Weitere Angaben stammen von der WiredSafety.org`s 200278). Die Ergebnisse bezüglich Alter und Geschlecht ähneln in diesem Report denen des „klassischen“ Stalking. Allerdings werden bestimmte Trends verzeichnet. Der Anteil der weiblichen Stalker nimmt kontinuierlich zu – von 25 % in 2001 auf 40 % in 2002 – ebenso wie der Anteil männlicher Opfer in bestimmten Alterskategorien. Die Tendenz zu Cyberstalking unter Kindern ist steigend. 25 % der Täter kennen ihre Opfer. Die meisten Cyberstalking-Opfer wurden mit 62 % in den USA ermittelt, die restlichen 38 % verteilen sich zu geringen Anteilen auf England, Kanada, Indien und andere Länder. 18 % der Opfer werden z. B. per E-Mail belästigt, 11 % im Chatroom. 16 % der Betroffenen wird auf diesem Wege körperliche Gewalt angedroht.
Angesichts der Zunahme dieses Phänomens ist hier weiterer Forschungsbedarf gegeben.
1.6 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Stalking
In Anbetracht der Vielfältigkeit der Stalker-Typologien ergeben sich auch unterschiedliche theoretische Erklärungsansätze für die Verhaltensweisen von Stalkern. Die meisten Überlegungen stammen aus dem Feld der Psychopathologie, wonach Stalking-Verhalten als Ergebnis einer sozial und emotional frühkindlichen Fehlentwicklung der Persönlichkeitsstruktur betrachtet wird. Da die Stalking-Forschung allerdings eine recht junge Disziplin ist, liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die fortgeschrittensten Ansätze zur Erklärung von Stalking bieten die psychoanalytischen Modelle wie die psychodynamische Theorie und Psychopathologie, die Bindungs- und die Objektbeziehungstheorie.
1.6.1 Die psychodynamische Theorie und die Psychopathologie
Der psychodynamische Ansatz betrachtet Stalking als Versuch einer psychischen Konfliktregulation, der eine gestörte Persönlichkeitsstruktur zugrunde liegt. Externale Faktoren stellen kein auslösendes Moment dar – mit Ausnahme der Zurückweisung des Gestalkten.
Im Mittelpunkt dieser Auffassung stehen die narzisstische und die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Genannt werden soll hier allen voran die Theorie von Meloy (199642), 199843)) des „Obsessive Followers“, da diese die umfangreichste Erklärung auf der Basis der Psychoanalyse darstellt. Nach Meloy sind Stalker zwanghafte Verfolger, die durch einen in jüngster Vergangenheit erlittenen Verlust zu obsessiven Belästigern werden. Deren Motivation ist weniger in sexuellem Verlangen, als in Ärger oder Feindseligkeit gegenüber seinem Opfer zu suchen.
Sein Prozessmodell umfasst sechs Phasen:
1, Narzisstische Vereinigung zwischen Täter und Opfer: der Stalker entwickelt die Vorstellung, mit seinem Opfer verbunden zu sein
2. Kontaktaufnahme: diese Phantasie der Vereinigung zwischen Stalker und Gestalktem motiviert den Täter, mit seinem Opfer Kontakt aufzunehmen, er wird jedoch zurückgewiesen
3. Zurückweisung: durch die Zurückweisung entwickelt sich beim Täter eine narzisstisch Kränkung, die mit dem Gefühl der Erniedrigung und Scham einher geht
4. Wut/Aggression: mit der Ausbildung einer narzisstischen Wut wird versucht, das Schamgefühl abzuwehren
5. negative Handlung: auf Grund dessen wird die begehrte Person abgewertet, der Stalker versucht sie zu beherrschen, zu verletzen oder zu zerstören
6. Rekonstitution der Phantasie: gelingen diese Vorhaben, kann die narzisstische Phantasie der Vereinigung mit dem Opfer wieder hergestellt werden.
Psychopathologisch ist hier vor allen Dingen der gravierende Realitätsverlust, der unterschiedliche Ausmaße annehmen kann und im extremsten Fall in einer schweren Persönlichkeitsstörung gipfelt.
1.6.2 Die Bindungstheorie
Bindung stellt eine biologische Tatsache dar, die das Überleben eines Neugeborenen per Versorgung durch andere sichert und dessen Entwicklung prägt. Somit liegt die Basis für den Aufbau einer Bindungsbeziehung sowohl in der genetischen Disposition, als auch in der frühkindlichen Interaktion eines Kindes mit seinen Versorgern, die von einer Vielzahl von psychologischen Faktoren geprägt ist.
Nach Ainsworth (1989)1) und Bowlby (19696), 1980)7) ist für die Ausbildung eines gesunden Bindungsverhaltens die stabile, emotional gesicherte und einzigartige Beziehung eines Kindes zu seiner Bezugsperson – meist die Mutter – unabdingbar. Da die Bezugsperson als so genanntes Beziehungsmodell fungiert, gilt die Art und Weise, wie sich die Beziehung zwischen dieser und dem Kind gestaltet als ausschlaggebend für die spätere Bindungsqualität eines Menschen, sein Umgang mit und sein Verhältnis zu anderen. Ist die Bindungsgenese in der frühen Kindheit gestört oder fehlt sie vollständig, resultieren daraus Probleme beim Aufbau von gesunden Beziehungen.
Die Bindungstheorie zur Erklärung von Stalking postuliert zwei Prämissen:
1. eine Prädisposition für Stalking aufgrund einer in der Kindheit gestörten Bindungsentwicklung
2. Auslösung des Stalking-Verhaltens durch das Wiedererleben eines ähnlichen, in der Kindheit als traumatisch erfahrenen, Ereignisses
So weisen Forscher (Kienlen, Birmingham, Solberg, O`Regan und Meloy, 199733); Zona, Sharma und Lane, 199380); Kienlen, 199834)) auf die Existenz pathologischer Bindungsmuster im Verhalten von Stalkern hin. Deren zeitweise gewalttätigen Handlungen, die auf Ärger, Wut und Frustration aufgrund erlittener Abweisung zurückzuführen sind, gelten als Reaktionen auf eine gestörte Bindungsentwicklung.
1.6.3 Die Objektbeziehungstheorie
Analog zur Bindungstheorie geht auch die Objektbeziehungstheorie von einer stabilen Beziehung zu einer festen Bezugsperson (Objekt) in der Kindheit als Voraussetzung für die Ausformung eines gesunden Beziehungsverhaltens aus. Allerdings steht hier als Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, aufgrund der Interaktion mit dem „Objekt“, ein stabiles Selbstwertgefühl im Mittelpunkt. Das Kind bildet im Verlauf seiner Entwicklung somit zum einen eine feste positive Vorstellung von sich selbst aus, erlebt sich dadurch als wertvoll und geliebt, zum anderen nimmt es aber auch seine Bezugspersonen als verlässlich und vertrauenswürdig wahr, wodurch es unabhängig von dieser selbständig zu agieren lernt. Dies betiteln Mahler, Pine und Bergmann (1975)38) als „psychologische Geburt des Individuums“ – der menschliche Prozess der frühen Entwicklung mit Trennung von der Bezugsperson und Individuation. Wird dieser Balanceakt nicht erfolgreich vollzogen, resultiert daraus ein ambivalentes Beziehungsverhalten. Das Kind ist hin und her gerissen zwischen Anklammern an das und Zurückweisung durch das Beziehungsobjekt. Dieses Verhaltensmuster setzt sich im Erwachsenenalter fort. Die Person reagiert auf andere entweder äußerst zurückweisend oder äußerst unterwürfig und zuvorkommend.
Bei Stalkern fanden Dutton und Golant (1995)16) dieses Spaltungsphänomen im Wechsel extremer Idealisierung und extremer Abwertung der Opfer.
So vermuten die Autoren einen Zusammenhang zwischen Missbrauch und Gewaltanwendung und einer nicht gelungenen Verarbeitung im Umgang mit widersprüchlichen Gefühlen in einer Phase der frühen Kindheit. Daraus resultieren eine geringe Toleranz gegenüber Trennung und Alleinsein, sowie Angst vor Nähe aber auch Distanz, was wiederum ein Gefühl der Hilflosigkeit auslöst.
1.7 Beziehung zwischen der Art des Stalking-Verhaltens und psychopathologischen Symptomen
Blaauw, Winkel und Arensman (2000)2) postulieren einen Zusammenhang zwischen psychopathologischen Symptomen und der Art und Weise, wie ein Stalker sein Opfer belästigt. Sie ermittelten in ihrer Studie eine stärkere Symptomatik, wenn das Stalking-Verhalten Verfolgen oder Diebstahl/Zerstörung von Eigentum beinhaltete und länger als sechs Monate andauerte. Im Gegensatz zu Pathé und Mullen (1997)54) fanden sie bei ihren Probanden, dass gewaltloses mit größeren psychopathologischen Folgen verbunden war als gewalttätiges Verhalten. Die Opfer berichteten weiterhin von mehr Symptomen, wenn sie erst seit kurzem gestalkt wurden und die Belästigungen täglich stattfanden. Eine größere Anzahl von Krankheitszeichen konnte ebenso vermerkt werden, wenn die Dauer des Stalking kurz war und die Betroffenen sechs oder mehr Maßnahmen ergriffen haben das Stalking zu unterbinden. Einen Zusammenhang zwischen der Beendigung der unerwünschten Belästigung und psychiatrischen Symptomen gab es nicht. 39 % der Betroffenen berichteten ein Jahr nach dem letzten Stalking-Vorfall noch immer von psychischen Probleme.
1.8 Die Opfer
Zahlreiche Kino- und Fernsehfilme (z. B. „Fatal Attraction“, „Play Misty for Me“) und Bücher (z. B. „Liebeswahn“) erzählen – oftmals sehr dramatisch – Geschichten von Stalking-Opfern. Darin ist das „typische“ Opfer weiblich und etwa im gleichen Alter wie sein Stalker, mit dem es vormals eine intime Beziehung pflegte.
Ein anderes und häufig perniziöses Szenario ist Stalking als Folge einer langen Geschichte häuslicher Gewalt. Untersuchungen von Wilson und Daly (1993)77) ergaben, die Wahrscheinlichkeit von seinem Partner getötet zu werden ist nach einer Trennung 2-4 mal höher, als bei zusammenlebenden Paaren.
Die Folgen monate- oder jahrelanger Belästigung oder Bedrohung führen zu ernsthaften psychologischen und auch materiellen Konsequenzen für die Betroffenen. Die größte Belastung stellt das permanente Eindringen des Stalkers in die Privatsphäre der Opfer dar. Das lang andauernde und intensive Wesen der Invasion und das sich nicht entziehen können der permanenten Verfolgung macht die Besonderheit der Belastung durch Stalking im Vergleich mit anderen mehr oder weniger traumatischen, stressauslösenden Momenten aus.
In ihrer Stichprobe von Stalking-Opfern ermittelten Pathé und Mullen (1997)54) auf der Basis von persönlichen Berichten bei 37 % der Betroffenen eine Posttraumatische Belastungsstörung (Posttraumatic-Stress-Disorder (PTSD)). Dies entspricht ungefähr dem Anteil der durch häusliche Gewalt entstehenden PTSD, der in den verschiedenen Studien von Holtzworth-Munroe et al. (1998)26) gefunden wurde und zwischen 40 % und 60 % liegen.
Hall (1998)21) fand in seinen Untersuchungen als Folge von Stalking Persönlichkeitsveränderungen bei den Betroffenen. Wachsende Vorsicht, gesteigertes Misstrauen, erhöhte Ängstlichkeit und Aggressionen ergaben sich häufig als Resultat überdauernder Belästigung.
Pathé und Mullen (1997)54) eruierten ebenso eine signifikante Veränderung im sozialen und beruflichen Leben von Gestalkten, wie ein gesteigertes Ergreifen von Vorsichtsmaßnahmen.
1.8.1 Opfertypen nach Pathé, Mullen und Purcell
Genau wie Stalker bilden Stalking-Opfer keine homogene Gruppe. Eine Kategorisierung der Betroffenen entsprechend ihres Verhältnisses zum Täter und dem Kontext, in dem Stalking-Handlungen auftreten, erweist sich als hilfreich.
1.8.1.1 Ex-Partner
In dieser Gruppe ist das typische Opfer weiblich, malträtiert von einem Ex-Partner oder Ex-Ehemann. Aber auch die umgekehrte Konstellation oder gleichgeschlechtliche Täter/Opfer-Kombinationen kommen vor (Pathé et al. 200056)). Diese Opfer sind meist über einen sehr langen Zeitraum einer massiven Belästigung ausgesetzt und besonders gefährdet gegenüber physischer Gewalt (Mullen et al., 199950)). Sie empfinden für gewöhnlich große Schuld darüber, in der Wahl ihrer Partner versagt zu haben.
1.8.1.2 Bekannte und Freunde
Unter diese Kategorie fallen meist männliche Opfer. Auslöser für Stalking-Aktionen des Täters sind zufällige Begegnungen. Die Betroffenen werden üblicherweise nur über einen kurzen Zeitabschnitt von sozial nicht kompetenten Persönlichkeiten gestalkt, die auf der Suche nach intimen Beziehungen sind. Eine Gefahr vor Gewalttätigkeiten besteht kaum.
1.8.1.3 Berufliche Kontakte
Bestimmte Berufsgruppen sind prädestiniert Opfer von Stalkern zu werden. Darunter fallen Lehrer, Personen in Heilberufen oder mit juristischer Profession, da sie bei den Tätern das Gefühl des Interesses und des umsorgt Werdens hervorrufen, ein Umstand, der von diesen meist ebenfalls sozial inkompetenten Persönlichkeiten missdeutet wird. Gerade langwierige therapeutische Beziehungen sind häufig Auslöser für Stalking-Verhalten.
1.8.1.4 Arbeitskollegen
Arbeiter oder Angestellte, die zugunsten eines anderen in eine höhere Position befördert werden, werden gelegentlich zum Angriffsobjekt der zuletzt genannten, sofern diese Defizite im sozialen Umgang aufweisen. Jene Stalker neigen oftmals zu Gewalttaten, wobei auch Dritte – wie Vorgesetzte, welche die Beförderung veranlasst haben – in Mitleidenschaft gezogen werden.
1.8.1.5 Fremde
Mullen et al. (1999)50) fanden heraus, Opfer, die ihren Verfolger nicht kennen, laufen weniger Gefahr körperlich attackiert zu werden, als solche mit vor allem intimen Beziehungen, die ihren Peiniger einst zurückwiesen. Trotzdem rufen die Belästigungen bei den Opfern Verwirrung und erhöhte Alarmbereitschaft hervor, da die Attacken meist mit harmlosen Geschenken beginnen, im Verlaufe des Geschehens aber bizarre Formen annehmen können. Der verwirrendste Aspekt hierbei ist, dass die Opfer sich keinen Reim auf diese Geschehnisse machen können, in ihnen keinen Sinn sehen und vor allem keine Ahnung von der Identität ihres Stalkers haben.
1.8.1.6 Berühmtheiten
Diese Kategorie umfasst bekannte Persönlichkeiten aus Film, Funk, Fernsehen, Sport, Politik oder andere Berühmtheiten des öffentlichen Lebens. Sie ziehen beziehungsmotivierte und sozial defizitäre Täter an. Die Möglichkeit von mehreren Stalkern gleichzeitig belästigt zu werden ist bei dieser Opfergruppe wahrscheinlich. Sie sind daher die meiste Zeit von professionellen Beschützern umgeben.
1.9 Umgang mit Stalking
Stalking-Opfer sind verständlicherweise auf der Suche nach professioneller Hilfe, um ihre Situation zu bewältigen. Die Ratgebenden müssen sich zunächst einmal darüber im klaren sein, dass manche Strategien die Opfer schützen, andere gewisse Risiken in sich bergen. Pathé, Mullen und Purcell (2000)56) schlagen folgende Verhaltensmaßnahmen vor.
1.9.1 Verhaltensmaßnahmen von Pathé, Mullen und Purcell
1.9.1.1 Kontakt und Konfrontation vermeiden
Der Betroffene sollte dem Peiniger zu Beginn seiner Attacken ein einziges mal unmissverständlich klar machen, dass er keinen Kontakt und keine Beziehung zu diesem wünscht. Weitere Belästigungsversuche sind zu ignorieren. Sein Stalker ist entweder nicht willens oder unfähig, die Wünsche des Opfers zu respektieren und interpretiert eine Reaktion des zuletzt genannten auf seine Bemühungen hin als Ansporn, sein Verhalten fortzusetzen.
1.9.1.2 Andere Personen informieren
Aufgrund von Scham, Peinlichkeitsgefühl oder Fehleinschätzung der Gefährlichkeit ihrer Situation, scheuen sich Betroffene davor, sich anderen mitzuteilen und das Problem im Alleingang zu bewältigen. Es ist jedoch angeraten, Polizei, Familie, Freunde Arbeitskollegen und Nachbarn zu informieren, um den Schutz für die Opfer zu erhöhen.
So wird auch die unwissentliche Weitergabe von Daten über die Betroffenen von Freunden oder Bekannten an den Stalker vermieden, zum anderen können sich mögliche Drittbetroffene vor dem Täter besser schützen.
1.9.1.3 Dokumentation der Vorkommnisse
Die Opfer sollten alle Vorkommnisse dokumentieren und Beweise für das Stalking sammeln wie Briefe oder Geschenke, Aufzeichnungen von Telefonanrufen etc..
1.9.1.4 Erwirken einer Einstweiligen Verfügung
Auch wenn Tjaden und Thoennes (1998)72) von 81 % der männlichen und 69 % der weiblichen Opfer berichten, die diese juristische Maßnahme einleiten, sollte sie nicht automatisch an oberster Stelle der Interventionen stehen, da sie zum einen nicht bei allen Tätertypologien den gewünschten Effekt erzielt und zum anderen keine gerichtliche Handhabe zum Tragen kommt, wenn der Täter sich der Verfügung widersetzt. Gerade bei zurückgewiesenen Ex-Partnern ruft eine solche Intervention ein Gefühl der öffentlichen Demütigung hervor, auf das der Stalker mit gewalttätigen Angriffen reagiert. Besonders bei Erotomanen fruchtet eine Einstweilige Verfügung eher nicht, da sie jene als einen Test für ihre Liebe und Ergebenheit ansehen.
Die Opfer sollten sich nach Ansicht der Autoren der Tatsache bewusst sein, dass diese Art der Gegenmaßnahme nicht nur nicht fehlschlagen, sondern die Situation verschlimmern kann. Sie sind daher angehalten, erst einen forensischen Experten zu Rate zu ziehen, bevor sie agieren. Wenn dieser Schritt gewählt wird, sollten die Opfer schon im frühesten Stalking-Stadium die Einstweilige Verfügungen erwirken, sich aber gleichzeitig darüber im klaren sein, das Risiko, sich einem gewalttätigen Akt ausgesetzt zu sehen, ist unmittelbar nach diesem Erlass am höchsten. Die richterliche Order stellt keinerlei Garantie für Sicherheit oder die Lösung des Problems dar.
1.9.2 Therapeutische Maßnahmen nach Pathé, Mullen und Purcell
Ziele der Behandlung von Stalking-Opfern ist die Linderung von deren Leid und Kummer sowie die Stabilisierung ihrer angegriffenen Persönlichkeit, damit sie Privat- und Berufsleben bewältigen können.
Viele Betroffenen, die bei einem Therapeuten vorstellig werden, suchten bereits an anderer Stelle Unterstützung, meist ohne Erfolg. Sie stoßen auf Reaktionen von Ungläubigkeit, Unverstand, Verharmlosung, was ihr Misstrauen, ihre Desillusionierung, ihre wahrgenommene Schuld, den Ärger und den damit verbunden Rückzug weiter verstärkt. Daher muss der professionelle Behandler diese Individuen mit vorurteilsfreier Empathie und ohne Bewertung annehmen. Sie sollen Hoffnung schöpfen und auf die therapeutische Beziehung vertrauen können. Sie brauchen Verständnis für ihre Situation und jemanden, der um die zerstörerische Kraft von Stalking weiß und sie ernst nimmt. Allem voran muss der Therapeut dem Patienten vermitteln, dieser sei nicht alleine und trage keine Schuld an den Geschehnissen. Entscheidend ist die Sicherheit, die die therapeutische Umgebung gewährleistet und die Tatsache, dass alle Informationen absolut vertraulich behandelt werden.
1.9.2.1 Pädagogische Maßnahmen
Da manche Opfer glauben, den Verstand zu verlieren, ist es notwendig ihnen zu versichern, ihre Symptome sind eine normale Reaktion auf ein ernst zunehmendes Verbrechen. Pädagogische Maßnahmen sollen den Betroffenen helfen, ihre Situation zu verstehen, sowie sie in die Lage versetzen, sich besser zu schützen und den Stalker zu entmutigen. Viele Opfer, die sich von ihrer Familie und Freunden im Stich gelassen fühlen, wissen die Unterstützung einer professionellen Vertrauensperson zu schätzen.
1.9.2.2 Kognitive Verhaltenstherapie
Zu Beginn der Therapie muss der Behandler unbegründete Ängste lindern und dem Patienten zu einer realistischen Einschätzung seiner Situation verhelfen. Die kognitive Verhaltenstherapie hat zum Ziel, die verzerrte Wahrnehmung von einer allseits bedrohlichen Umwelt, in der jedem mit Misstrauen zu begegnen ist, zu korrigieren. Probleme wie der Glaube an die eigene Verantwortlichkeit für die Stalking-Situation und Gefühle der Machtlosigkeit müssen bearbeitet werden. Techniken zur Bewältigung der Angst wie Autogenes Training, Muskelrelaxation oder Atemübungen sind weitere unterstützende therapeutische Interventionen. Letztendlich soll vermeidendes Verhalten, welches die Betroffenen in die Isolation stürzt, verändert werde. Gemeint ist hier nicht Vermeidungsverhalten, das die Opfer gegenüber dem Täter schützt.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832499884
- ISBN (Paperback)
- 9783838699882
- DOI
- 10.3239/9783832499884
- Dateigröße
- 1.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Darmstadt – Erziehungswissenschaft, Psychologie u. Sportwissenschaft, Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2006 (November)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- stalking stalker verfolgung verehrer belästigung
- Produktsicherheit
- Diplom.de