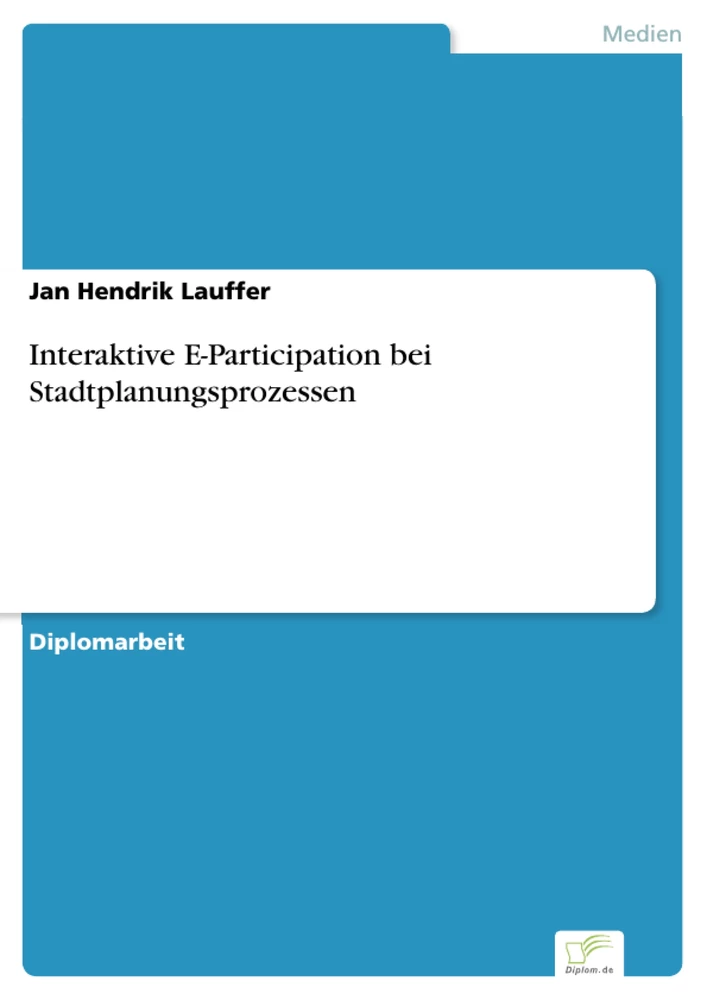Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
©2006
Diplomarbeit
253 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Interaktive E-Participation ist mehr als das Kontaktieren eines Verwaltungsmitarbeiters per E-Mail. Interaktive E-Participation heißt, die Beziehung zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern neu zu gestalten. Die politisch beschlossenen Inhalte von Deutschland-Online besagen, dass in jährlichen Schritten bis 2008 alle geeigneten Verwaltungsverfahren online zu Verfügung gestellt werden sollen und dann auch alle Behörden untereinander auf diesem Wege kommunizieren.
Im Rahmen der Stadtplanung bieten neue IuK-Technologien enorme Potenziale, diese neue Form der Verwaltung umzusetzen. Hier können nicht nur Verfahren für die Beteiligten vereinfacht, sondern auch völlig neue demokratische Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung etabliert werden: die E-Participation. Einerseits können die Bürger somit an kommunalen Entwicklungen einfacher teilhaben und andererseits kann die Planung Konzepte besser visualisieren. Die Grundlage hierfür ist ein onlinegestütztes Beteiligungstool, welches in dieser Arbeit entwickelt wird.
Ob ein solches Tool eine bessere, vereinfachte Partizipation erfüllen kann, wie es diese Aufgabe erfüllen kann und ob es diese Aufgabe erfüllen soll, sind dabei die zentralen Fragestellungen. Der erste Schritt zur E-Participation wurde bereits durch den neuen § 4a BauGB gemacht, welcher den Einsatz elektronischer Informationstechnologien zulässt. Nun können formelle Verfahren bei gegenseitigem Einverständnis auch online durchgeführt werden. Eine Erweiterung dieses Verfahrens vor allem für die Bürger birgt enorme Informations- und Visualisierungspotenziale, welche vorbereitend für die Partizipation genutzt werden können.
Einleitung:
Planungen waren schon immer geprägt durch unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen der Umwelt. Um die demokratischen Rechte der Bevölkerung in die Planung mit einfließen zu lassen, wurden nach und nach die Gesetze an die Belange der Betroffenen angepasst. In mehreren Schritten wurde so die heutige formelle zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt, welche nun nach § 4a Abs. 4 BauGB auch erlaubt, ergänzend elektronische Informationstechnologien bei der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden zu nutzen. Aber nicht nur das Planungsverständnis bei den Bürgern änderte sich, auch die Fachwelt erkannte die Potenziale einer umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit über die formellen Verfahren hinaus. Die Verbesserung der Planungsergebnisse durch endogene Informationen […]
Interaktive E-Participation ist mehr als das Kontaktieren eines Verwaltungsmitarbeiters per E-Mail. Interaktive E-Participation heißt, die Beziehung zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern neu zu gestalten. Die politisch beschlossenen Inhalte von Deutschland-Online besagen, dass in jährlichen Schritten bis 2008 alle geeigneten Verwaltungsverfahren online zu Verfügung gestellt werden sollen und dann auch alle Behörden untereinander auf diesem Wege kommunizieren.
Im Rahmen der Stadtplanung bieten neue IuK-Technologien enorme Potenziale, diese neue Form der Verwaltung umzusetzen. Hier können nicht nur Verfahren für die Beteiligten vereinfacht, sondern auch völlig neue demokratische Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung etabliert werden: die E-Participation. Einerseits können die Bürger somit an kommunalen Entwicklungen einfacher teilhaben und andererseits kann die Planung Konzepte besser visualisieren. Die Grundlage hierfür ist ein onlinegestütztes Beteiligungstool, welches in dieser Arbeit entwickelt wird.
Ob ein solches Tool eine bessere, vereinfachte Partizipation erfüllen kann, wie es diese Aufgabe erfüllen kann und ob es diese Aufgabe erfüllen soll, sind dabei die zentralen Fragestellungen. Der erste Schritt zur E-Participation wurde bereits durch den neuen § 4a BauGB gemacht, welcher den Einsatz elektronischer Informationstechnologien zulässt. Nun können formelle Verfahren bei gegenseitigem Einverständnis auch online durchgeführt werden. Eine Erweiterung dieses Verfahrens vor allem für die Bürger birgt enorme Informations- und Visualisierungspotenziale, welche vorbereitend für die Partizipation genutzt werden können.
Einleitung:
Planungen waren schon immer geprägt durch unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen der Umwelt. Um die demokratischen Rechte der Bevölkerung in die Planung mit einfließen zu lassen, wurden nach und nach die Gesetze an die Belange der Betroffenen angepasst. In mehreren Schritten wurde so die heutige formelle zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt, welche nun nach § 4a Abs. 4 BauGB auch erlaubt, ergänzend elektronische Informationstechnologien bei der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden zu nutzen. Aber nicht nur das Planungsverständnis bei den Bürgern änderte sich, auch die Fachwelt erkannte die Potenziale einer umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit über die formellen Verfahren hinaus. Die Verbesserung der Planungsergebnisse durch endogene Informationen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Jan Hendrik Lauffer
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
ISBN-10: 3-8324-9786-2
ISBN-13: 978-3-8324-9786-6
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Technische Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Deutschland, Diplomarbeit,
2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis... I
Vorwort... VII
Zusammenfassung... IX
Einführung ... 1
1
Das Internet und die Partizipation... 2
2
Zunahme des Partizipationsinteresses und der Urban
Governance bei Stadtplanungsprozessen ... 6
3
Ziel der Arbeit: Konzeption eines interaktiven
E-Participation-Tools ... 8
4
Vorgehensweise und Struktur der Arbeit ... 10
Kapitel 1:
Zweck und Ziel von Partizipation im Kontext der Interaktivität... 13
1
Baurechtliche Regelung der Beteiligung... 16
1.1
Akteure im Beteiligungsprozess ... 16
1.2
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ... 17
1.3
Öffentliche Auslegung ... 17
2
Vermittlung von Planaussagen ... 19
2.1
Akteure und Planverständnis... 20
2.2
Methoden der Planung, Plandarstellung und Partizipation ... 20
3
Partizipations- und Interaktionsbedarf bei
Planungsprozessen ... 23
3.1
Kommunikation mit der Öffentlichkeit ... 25
3.2
Interaktive Verzahnung der Beteiligten im Planungsprozess ... 27
4
Erkenntnisse des ersten Kapitels ... 28
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
II
Kapitel 2:
Potenziale und Grenzen, Herausforderungen und Ziele der
interaktiven E-Participation ...30
1
Planungstools und Geoinformationssysteme ...32
1.1
GIS: Die zentralen Datenspeicher...35
1.2
SIS: Interaktive Landkarten...41
1.3
CAD: Digitale Entwurfsmethoden...45
1.4
3-D: Animationen und Visualisierungen ...46
2
Verfügbarkeit elektronischer Medien ...50
2.1
Anschluss-Situation und technische Verfügbarkeit...51
2.2
Einbeziehung von Randgruppen...52
3
Eine Änderung der klassischen Beteiligungsprozesse
für die interaktive E-Participation?...57
3.1
Fachliche Hintergründe...59
3.2
Finanzielle Hintergründe ...60
3.3
Juristische Hintergründe ...62
4
Dynamisierungspotenziale im Partizipationsprozess ...64
4.1
Vermeidung von Medienbrüchen ...65
4.2
Formelle und informelle Planungsprozesse...66
4.3
Frühzeitiger Nutzen modularer Werkzeuge...67
4.4
Potenzielle Dynamisierungsbereiche in der
Öffentlichkeitsbeteiligung ...68
5
Erkenntnisse des zweiten Kapitels...71
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
III
Kapitel 3:
Fachliche und technische Anforderungen an die interaktive
E-Participation ... 73
1
Fachliche Anforderungen aus Sicht der Planung ... 74
1.1
Partizipation als demokratisches Grundelement... 74
1.2
Legitimation der Planung... 75
1.3
Aktivierung des bürgerlichen Sachverstandes... 75
1.4
Sammlung innovativer Ideen und Konzepte ... 75
1.5
Aufspüren von Fehlentwicklungen... 76
1.6
Verbesserung der E-Governance... 77
1.7
Diskursivität und Konfrontation mit Planinhalten... 77
1.8
Identifikation mit der Planung ... 77
2
Technische Anforderungen für Internetseiten aus
Nutzersicht ... 79
2.1
Strukturen und Elemente einer Webseite ... 79
2.2
Zielgruppenspezifisches Seitenkonzept... 85
2.2.1
Das interaktive E-Participation-Tool für Anwender ... 85
2.2.2
Hilfsmittel und Tutorials für Anfänger und Experten... 87
2.3
Merkmale einer funktionalen Website... 89
2.3.1
Optische Seitenaufteilung ... 89
2.3.2
Anforderungen an die Darstellung von Inhalten... 92
2.3.3
Protokollierung des Planungsverlaufs ... 95
2.4
Interaktive Module... 95
3
Erkenntnisse des dritten Kapitels... 99
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
IV
Kapitel 4:
Auswertung ausgewählter Internetauftritte bezüglich digitaler
Planung, Plandarstellung und Partizipation...101
1
Analyse wegweisender Web-Angebote...102
1.1
Auswahlgründe für die Betrachtung eines Web-Angebotes...102
1.2
Vorgehensweise der Betrachtung ...103
2
Erkenntnisse der Untersuchung...104
2.1
Kriterienblock 1: Benutzerfreundlichkeit der
Internetpräsenzen...104
2.2
Kriterienblock 2: Planerische Inhalte ...106
2.3
Kriterienblock 3: Technische Umsetzung der Navigation
und Kommunikation ...111
3
Erkenntnisse des vierten Kapitels...115
Kapitel 5:
Konzeption der interaktiven E-Participation bei
Stadtplanungsprozessen...117
1
Interaktive E-Participation als Teil der Systematik
des E-Governments ...120
1.1
Die Position des interaktiven E-Participation-Tools in der
vernetzten Welt...120
1.2
Die Position des interaktiven E-Participation-Tools
im E-Government...122
2
Grundlegende Bausteine eines interaktiven
Planungstools ...124
2.1
Fachliche Definition eines interaktiven Angebotes ...124
2.2
Technische Bausteine eines interaktiven Planungstools ...124
2.3
Rechtliche Verortung der interaktiven E-Participation ...125
3
Leistungsspektrum der interaktiven E-Participation...127
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
V
4
Funktionsspektrum des interaktiven
E-ParticipationTools ... 128
4.1
Eingangsseite als Benutzerinterface ... 129
4.2
Textbasierte Informationselemente ... 131
4.2.1
Hilfesystem ... 132
4.2.2
Knowledgebase... 133
4.2.3
Dokumentenserver... 134
4.2.4
Newsserver ... 135
4.3
Kartenbasierte Partizipationselemente ... 136
4.3.1
Darstellung verschiedener Planungsebenen ... 138
4.3.2
Handlungsspielräume der interaktiven Partizipation ... 141
4.3.2.1
Betrachten und Recherchieren... 142
4.3.2.2
Betrachten und Initiieren ... 143
4.3.2.3
Betrachten und Kommentieren... 144
4.3.2.4
Betrachten und Diskutieren ... 146
4.3.2.5
Betrachten und Kommunizieren
... 146
4.4
Kommunikationsorientierte Kooperationselemente... 147
4.4.1
Formular zur Stellungnahme ... 148
4.4.2
Forum ... 148
4.4.3
E-Mail... 150
4.4.4
Chat ... 150
4.4.5
Befragung ... 150
5
Erfolgsfaktoren der interaktiven E-Participation... 152
5.1
Moderation für eine erfolgreiche interaktive E-Participation... 152
5.2
Non-Cyber-Veranstaltungen und interaktive E-Participation.. 153
5.3
Einbindung in den Gesamtprozess... 154
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
VI
Kapitel 6:
Fazit und Ausblick...155
1
Ist das interaktive E-Participation-Tool nur ein neues
Werkzeug?...157
2
Was sind die zukünftigen Aufgaben der Stadtplanung?..159
3
Hat die interaktive E-Participation Auswirkungen auf
Stadtplanungsprozesse? ...160
4
Welche gesellschaftlichen Potenziale birgt die
interaktive E-Participation?...161
Anhang... XXI
1
Abkürzungen... XXII
2
Fachbegriffe ...XXIV
3
Abbildungsverzeichnis...XXXIII
4
Tabellenverzeichnis... XL
5
Literatur- und Quellenverzeichnis ... XLI
6
Analyse der Online-Partizipationsangebote ... LXI
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
VII
Vorwort
Anfang des Jahres 2005 hielt Frau Dipl.-Ing. Simone Tiedtke vom Institut für
Freiraumentwicklung und planungsbezogene Soziologie der Universität
Hannover einen Vortrag an der Technischen Universität Kaiserslautern. Sie
stellte den ,,Interaktiven Landschaftsplan Königslutter" vor.
Dieser Landschaftsplan war nicht nur zur gesetzlich vorgesehenen Beteili-
gung konzipiert, sondern sollte aktiv zur Teilnahme einladen und gleichzeitig
auch noch Wissen über die Erfordernisse der Landschaftsplanung liefern
und Ideen visualisieren.
Dies gab den Anstoß für die hier vorliegende Arbeit. Wenn es möglich ist,
eine Landschaftsplan interaktiv zu visualisieren, warum sollte eine interakti-
ve Darstellung der Bebauungsplanung nicht auch möglich sein?
Zielführend zu Lösung dieser Frage stellte sich heraus, dass eine enormer
Menge empirischer Grundlagen analysiert und strukturiert werden musste.
Die wesentlichen Elemente dieser Arbeit werden daher von den theoreti-
schen
Basis
der
elektronischen
Öffentlichkeitsbeteiligung,
der
E-Participation, dominiert. Ein weiterer Teil behandelt die Entwicklung und
den heutigen Stand der digitalen Planungsmethoden und -techniken, um
abschließend die Kernidee daraus zu entwickeln: ein internetgestütztes Be-
teiligungstool, mit dem die Beteiligung nicht nur durchgeführt werden kann
sondern auch umfassende Informationen zur Planung, den entsprechenden
Themenfeldern und eben der Visualisierung von städtebaulichen Ideen,
möglich zu machen.
Im Laufe der Bearbeitung haben sich einige der wesentlichen Faktoren, die
diese Arbeit bestimmen, weiterentwickelt. Neben neuen gesetzlichen Ent-
wicklungen und Festsetzungen kamen neue Techniken für die Visualisie-
rung und Planung auf den Markt. Dies machte umfangreiche Recherchen in
aktuellen Medien wie dem Internets neben der klassischen Literatursuche in
der Bibliothek notwendig. Jedoch konnten die wesentlichen richtungweisen-
den Impulse durch die Teilnahme an einem im Dezember 2005 in Stuttgart
stattgefundenen Workshop gesammelt werden. Abgesehen von aktuellen
Berichten aus der kommunalen Politik bestand dort auch die Möglichkeit,
mit den derzeit im wissenschaftlichen Forschungsfeld der E-Participation
aktiven Experten zu diskutieren. Diese bestätigten die allgemeine, in dieser
Arbeit vertretene, positive Einstellung zu neuen Planungs- und Beteili-
gungsmethoden und damit zur interaktiven E-Participation bei Stadtpla-
nungsprozessen.
Jan Hendrik Lauffer
Kaiserslautern, im Januar 2006
Zu
sa
m
m
en
fa
ss
un
g
Zusammenfassung
Einführung
Kapitel 1
Zweck und Ziel von Partizipation im Kontext
der Interaktivität
Kapitel 2
Potenziale und Grenzen, Herausforderungen und
Ziele der interaktiven E-Participation
Kapitel 3
Fachliche und technische Anforderungen an
die interaktive E-Participation
Kapitel 4
Auswertung ausgewählter Internetauftritte bezüglich
digitaler Planung, Plandarstellung und Partizipation
Kapitel 5
Konzeption der interaktiven E-Participation
bei Stadtplanungsprozessen
Kapitel 6
Fazit und Ausblick
Anhang
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
IX
Zusammenfassung
Interaktive E-Participation ist mehr als das Kontaktieren eines Verwal-
tungsmitarbeiters per E-Mail. Interaktive E-Participation heißt, die Bezie-
hung zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern neu zu gestalten.
Die politisch beschlossenen Inhalte von Deutschland-Online besagen, dass
in jährlichen Schritten bis 2008 alle geeigneten Verwaltungsverfahren online
zu Verfügung gestellt werden sollen und dann auch alle Behörden unterein-
ander auf diesem Wege kommunizieren.
Im Rahmen der Stadtplanung bieten neue IuK-Technologien enorme Poten-
ziale, diese neue Form der Verwaltung umzusetzen. Hier können nicht nur
Verfahren für die Beteiligten vereinfacht, sondern auch völlig neue demokra-
tische Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung etabliert werden: die
E-Participation. Einerseits können die Bürger somit an kommunalen Ent-
wicklungen einfacher teilhaben und andererseits kann die Planung Konzep-
te besser visualisieren. Die Grundlage hierfür ist ein onlinegestütztes Betei-
ligungstool, welches in dieser Arbeit entwickelt wird.
Ob ein solches Tool eine bessere, vereinfachte Partizipation erfüllen kann,
wie es diese Aufgabe erfüllen kann und ob es diese Aufgabe erfüllen soll,
sind dabei die zentralen Fragestellungen.
Der erste Schritt zur E-Participation wurde bereits durch den neuen
§ 4a BauGB gemacht, welcher den Einsatz elektronischer Informations-
technologien zulässt. Nun können formelle Verfahren bei gegenseitigem
Einverständnis auch online durchgeführt werden. Eine Erweiterung dieses
Verfahrens vor allem für die Bürger birgt enorme Informations- und Visuali-
sierungspotenziale, welche vorbereitend für die Partizipation genutzt wer-
den können.
Kapitel 1:
Zweck und Ziel von Partizipation im Kontext der Interaktivität
Planungen waren schon immer geprägt durch unterschiedliche Meinungen
und Vorstellungen der Umwelt. Um die demokratischen Rechte der Bevöl-
kerung in die Planung mit einfließen zu lassen, wurden nach und nach die
Gesetze an die Belange der Betroffenen angepasst. In mehreren Schritten
wurde so die heutige formelle zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung entwi-
ckelt, welche nun nach § 4a Abs. 4 BauGB auch erlaubt, ,,ergänzend elek-
tronische Informationstechnologien" bei der Beteiligung der Öffentlichkeit
und der Behörden zu nutzen. Aber nicht nur das Planungsverständnis bei
den Bürgern änderte sich, auch die Fachwelt erkannte die Potenziale einer
umfassenden Beteiligung der Öffentlichkeit über die formellen Verfahren
hinaus. Die Verbesserung der Planungsergebnisse durch endogene Infor-
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
X
mationen der Betroffenen ist daher als ausschlaggebendes Argument zu
sehen, warum die Partizipation weiter entwickelt wurde und auch in Zukunft
weiter zu entwickeln ist.
Die ursprünglich durch technische Schwierigkeiten bspw. bei der Planver-
vielfältigung und Informationsbereitstellung problematische Beteiligung kann
heute mit Hilfe moderner IuK-Technologien wesentlich einfacher und um-
fassender durchgeführt werden.
Zur Ermittlung der Grundlagen der E-Participation werden in Kapitel 1 zu-
nächst die rechtlichen und fachlichen Grundlagen erarbeitet.
Baurechtliche Regelung der Beteiligung
Das Baurecht unterscheidet zwischen der Öffentlichkeit (§ 3 BauGB), den
Behörden und den Trägern öffentlicher Belange (§ 4 BauGB). Die Aufgabe
der in dieser Arbeit hauptsächlich betrachteten Öffentlichkeit, konkret den
Bürgern, ist ein Beitrag von ortsspezifischem Wissen, wertvollen Hinweisen
und Stellungnahmen zu Planungen und anderen kommunalen Entwicklun-
gen. Gesetzlich wird die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung in den §§ 3 und
4a des BauGBs geregelt und in zwei Phasen durchgeführt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit soll die Bevölkerung in einer
ersten Phase sensibilisieren, indem sie über die Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen sowie mögliche Planalternativen informiert. Dies ist durch
Workshops, Pressearbeit, Aushänge oder Erörterungen, aber auch eine
elektronische Informations- und Beteiligungsmöglichkeit denkbar. Dies soll
möglichst frühzeitig erfolgen. Die Ergebnisse dieser Diskussion sind die
Grundlage für einen formellen und konkreten Planentwurf für das weitere
Verfahren.
Die Auslegung als zweite Phase erfolgt nach einem rechtsförmlichen Ver-
fahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach einer mindestens einwöchigen orts-
üblichen Bekanntmachung und dauert einen Monat. Während der Ausle-
gung kann jedermann Änderungen oder Ergänzungen zur Planung vorbrin-
gen. Der Rat wägt nach § 1 Abs. 3 BauGB die öffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander gerecht ab und entscheidet über
ihre Berücksichtigung oder Zurückweisung. Den Einsendern der Stellung-
nahmen muss das Ergebnis der Entscheidung schriftlich mitgeteilt werden
(§ 3 Abs. 2 BauGB). Ergeben sich durch Stellungnahmen wesentliche Än-
derungen oder Ergänzungen des Planentwurfs, so muss eine erneute öf-
fentliche Auslegung erfolgen.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XI
Vermittlung von Planaussagen
Die Planung ist von verschiedenen Akteuren geprägt. Die größte Differenz
ist zwischen Bürgern und Experten zu erwarten. Die Vielzahl von Symbolen
und Planzeichen in der Regional-, Flächennutzungs- und Bebauungspla-
nung sowie die allgemeinen Zusammenhänge stellen für den Bürger ein
Verständnisproblem dar. Die Planpräsentation findet häufig nur bei Groß-
projekten anschaulich statt, kleinere Problemstellungen im kommunalen
Bereich, welche ein hohes Partizipationsinteresse der betroffenen Bürger
vermuten lassen, können auf herkömmliche Art nicht visualisiert werden und
es können Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Planaussagen auftreten.
Rechtlich ausreichend sind klassisch erstellte Pläne für Flächennutzungs-
planung oder Bebauungsplanung. Nach § 1 BauGB regeln sie die Nutzung
der Grundstücke und übernehmen eine Entwicklungs- und Ordnungsfunkti-
on. Um diese Pläne bürgerfreundlich darzustellen, greift man auf Modelle
und Visualisierungen zurück. Dabei handelt es sich jedoch immer noch um
starre Karten ohne jegliche interaktive Funktion. Über das Medium Internet
und entsprechende IuK-Technologien könnte aber eine neuartige interaktive
Plandarstellung ermöglicht werden.
Momentan arbeiten Experten an neuen Gesetzesvorschlägen und Ände-
rungen, da bisher immer noch nicht alle notwendigen Neuerungen Eingang
ins Gesetz gefunden haben. Die Integration von IuK-Technologien auf ge-
setzlicher Basis würde den Weg für die interaktive E-Participation ebnen.
Partizipations- und Interaktionsbedarf bei Planungsprozessen
Planerische Konzepte können nicht starr entworfen und durchgesetzt wer-
den. Ein lange vorlaufender und auch nachlaufender korrigierender Pla-
nungsprozess kann dazu beitragen, der Ideallösung näher zu kommen. R
IT-
TEL
definiert dazu in seiner Planungstheorie:
·
Planungsprobleme können erst im Suchprozess nach unterschiedli-
chen Lösungen verstanden werden.
·
Planungsprobleme können nicht endgültig gelöst werden. Die Fest-
legung des Endes eines Problemlösungsprozesses ist demnach
schwierig.
·
Das Wissen für die Problemlösung ist niemals auf einen oder wenige
Experten konzentriert.
·
Lösungen sind niemals richtig oder falsch, sondern je nach Betrach-
ter gut oder schlecht.
Daher ist eine frühestmögliche Beteiligung mit unterschiedlichen, gleichbe-
rechtigten Akteuren geboten. Zukunftsträchtig wäre eine multimediale He-
rangehensweise, um die Bürger auf unterschiedliche Weise interaktiv zu
erreichen. Die herkömmlichen, auf eine Kommunikationsrichtung festgeleg-
ten Informationswege sollten dazu vermieden werden. Moderne IuK-
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XII
Technologien wie das Internet und GIS versprechen hierfür sinnvolle Lö-
sungen, da einerseits eine bessere Kommunikationsrichtung zur Öffentlich-
keit hin möglich ist, andererseits auch eine Vernetzung aller Akteure unter-
einander. Dazu kommen interaktive Plandarstellungen, welche durch Inter-
net und GIS möglich werden.
Erkenntnisse des ersten Kapitels
Die Partizipation war in ihrer Geschichte zunächst eher durch politische und
technische Probleme geprägt. Nach einigen gesellschaftlichen und gesetzli-
chen Änderungen scheint heute jedoch eine Neuorientierung durch IuK-
Technologien möglich zu sein.
Dies wird zudem noch durch die Erkenntnis gestützt, dass Planungen nicht
starr durchgeführt werden können, sondern einem ständigen Verbesse-
rungsprozess ausgesetzt sind. Dies kann durch eine möglichst frühzeitig
einsetzende und langfristig fortgeführte Partizipation erreicht werden.
Kapitel 2:
Potenziale und Grenzen, Herausforderungen und Ziele der
interaktiven E-Participation
Das besondere Potenzial der Kommunikationsangebote im Internet wird
darin gesehen, dass Informationsbeschaffung und austausch Spaß ma-
chen kann. Man sollte sich daher den neuen Medien offen nähern, Mut zu
Experimenten haben, ohne dabei aber ihre Möglichkeiten zu überschätzen.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über den momentanen Stand der Technik.
Planungstools und Geoinformationssysteme
Die heutigen Planungstools und Geoinformationssysteme gehen aus den
EDV-Systemen der 60er Jahre hervor. Die anfänglich nur zu kaufmänni-
schen Zwecken eingesetzten Systeme entwickelten sich immer an der
Grenze des technisch möglichen bis zu den heutigen GIS und SIS sowie
dem CAD und dreidimensionalen Visualisierungen. Durch neue Planungs-
werkzeuge ist heute eine Verzahnung von Planung und GIS möglich, wo-
durch ein wesentlich höherer Standard für Plangrundlagen und die Visuali-
sierung gegeben werden kann. Die essentiellen Fortschritte einer GIS-
gestützten Planung sind die Möglichkeiten der Speicherung von Sachinfor-
mationen (Grenzen, Leitungen, Grenzpunkte, Flurstücke, Biotope, usw.)
und räumliche Analyseverfahren. Die Topologie eines Plangebietes kann
schnell erfasst und einfache Ansichten generiert werden, ohne Veränderun-
gen der Datensätze oder des Planlayouts vornehmen zu müssen. GIS kön-
nen zu diesem Zweck als Geodaten- oder Kartenserver dienen und sind die
Grundlage für kartengestützte Online-Auskunftssysteme. Online-GIS und
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XIII
GIS-Funktionsserver können direkt geographische Anfragen bearbeiten und
in einem Beteiligungstool zu Verfügung stehen. Die Verbindung von städti-
schen Informationen und einem GIS stellt zudem leistungsfähige Funktio-
nen für ein SIS zur Verfügung.
Die Verarbeitung der digitalen Daten kann mithilfe eines CAD-Programms
geschehen. Die Möglichkeiten dazu sind heute beinahe unbegrenzt. Es ist
durch diverse Techniken möglich, dreidimensionale Darstellungen mit wirk-
lichkeitsnahen Texturen zu generieren. Die Planung in CAD ermöglicht zu-
dem eine Rückkopplung mit den GIS, womit eine Übernahme der Daten und
eine Darstellung im jeweilig anderen System möglich ist.
Verfügbarkeit elektronischer Medien
Der technische Standard in Deutschland ist flächendeckend für eine interak-
tive E-Participation geeignet. Hauptsächlicher Kritikpunkt an elektronischen
Hilfsmitteln ist dennoch die Ausstattung an Endgeräten bei den Nutzern,
hier haben immerhin 48 Prozent der Haushalte noch keinen PC zur Verfü-
gung. Dessen ungeachtet sind die Zugangsmöglichkeiten über diverse Ein-
richtungen aber gewährleistet.
Problematischer stellt sich die momentane Situation der Technik-
Verweigerer dar, welche aus sozialen oder demographischen Gründen nicht
an Online-Verfahren teilnehmen. Diese Personengruppe wird sich erst
durch langfristige demographische Entwicklungen auflösen. In diesem Zeit-
raum muss auch im Sinne des Bundesgleichstellungsgesetzes (BGG) eine
gleichwertige Zugangsmöglichkeit für alle geschaffen werden.
Eine Änderung der klassischen Beteiligungsprozesse für die
interaktive E-Participation?
Allein für die Partizipation erscheint eine Änderung der Planungs- und Betei-
ligungsprozesse nicht sinnvoll. Im Rahmen eines ressortübergreifenden
E-Planning-Konzeptes wäre eine interaktive E-Participation aber ein Gewinn
für die Öffentlichkeit.
Alle onlinefähigen Partizipationsvorgänge könnten so realisiert und in einem
bürgerfreundlichen gebrauchsfähigen digitalen Beteiligungstool integriert
werden. E-Participation würde im Zuge des E-Governments eingeführt und
hätte wesentliche Umstrukturierungen auch in der öffentlichen Verwaltung
zur Folge. Die finanziellen Vorteile sind dabei offensichtlich. Zwar muss vo-
rübergehend mit einem Produktivitätsverlust in der Einlernphase gerechnet
werden, allerdings wird sich der anfangs investierte zeitliche und finanzielle
Mehraufwand durch eine vereinfachte Bearbeitung der Planungsdaten nach
einiger Zeit wieder kompensieren. Bisher akzeptiert die Rechtsprechung
aber nur die Beteiligung der Behörden über elektronische Medien. Dies zu
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XIV
reformieren wäre ein wesentlicher Antrieb, die Vorgehensweisen komplett
zu überdenken.
Dynamisierungspotenziale im Partizipationsprozess
Gesetzliche Fristen bei Partizipationsprozessen sind festgelegt und können
nicht verkürzt werden. Essentielles Dynamisierungspotenzial bietet daher
die komplette Abwicklung von Verfahren und Prozessen über IuK-
Technologien. Die Vermeidung von Medienbrüchen beschleunigt und ver-
einfacht auf Seite der Verwaltung die Herausgabe von Informationen und
lässt eine einfachere Bearbeitung der Stellungnahmen und Anfragen zu.
Wichtige Dokumente können wesentlich schneller elektronisch verschickt
werden. Eine Zusammenarbeit von Bürger und Experten kann schneller und
einfacher vonstatten gehen. Dazu ist die Einführung eines echten GIS-
gestützten Tools nötig, welches eigenständig interaktiv Informationen gene-
rieren und zu Verfügung stellen kann. Effizienteste Auswirkungen werden
sich dann schlichtweg daraus ergeben, dass frühzeitig eingebundene Bür-
ger schon im Vorfeld viele Planungshürden aus dem Weg räumen können
und damit im späteren Planungsprozess mit einem flüssigeren Verlauf zu
rechnen ist.
Erkenntnisse des zweiten Kapitels
Die Einführung eines E-Government-Systems, und damit auch der
E-Participation, liegt in der Hand des Staates. Die technischen Möglichkei-
ten sind soweit vorhanden, ebenso scheinen die damit zusammenhängen-
den sozialen Probleme lösbar zu sein. Die Entwicklung der IuK-
Technologien ist mittlerweile weit genug fortgeschritten, um die Aufgabe der
Verknüpfung von GIS, Bürger und Experte zu bewältigen. Würden entspre-
chende rechtliche Grundlagen manifestiert, ergäben sich nicht nur Vereinfa-
chungen für die Bürger, sondern auch Dynamisierungspotenziale für den
gesamten Planungsprozess.
Kapitel 3:
Fachliche
und
technische
Anforderungen
an
die
interaktive E-Participation
Die empirische Ermittlung der fachlichen Anforderungen der Stadtplanung
an die elektronische Beteiligung sowie die konkreten Anforderungen an die
genutzten Internet-Technologien werden in Kapitel 3 dargelegt.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XV
Fachliche Anforderungen aus Sicht der Planung
Die Integration endogenen Wissens der Bevölkerung durch Partizipation
verbessert die Planung inhaltlich. Zudem kann die Umsetzung erleichtert
werden, da durch eine Vorwegnahme der Diskussion die Zufriedenheit und
Zustimmung zu einem Projekt gesteigert werden kann.
Die Partizipation stellt also gewissermaßen ein demokratisches Grundele-
ment dar, wodurch die Bevölkerung in kommunale Entscheidungsprozesse
miteinbezogen wird. Durch diese Möglichkeit, Missfallen zu einem Plan zu
äußern, ergibt sich gleichzeitig eine Legitimation der Planung bei Unterlas-
sung von ablehnenden Stellungnahmen.
Für Planer unentdeckte Stolperfallen können durch bürgerlichen Sachver-
stand entlarvt und alternative Ideen und Konzepte entwickelt werden. Planer
und Bürger qualifizieren sich gegenseitig und bei langfristigen Beobachtun-
gen werden Fehlentwicklungen identifiziert.
Die Integration der Bürger zeigt ihnen auch ihre Relevanz im Planungspro-
zess auf. Diskussionen über kommunale Entwicklungen fördern das Ver-
ständnis über die politischen und technischen Zusammenhänge und tragen
somit zu einer besseren Akzeptanz der Planung bei.
Technische Anforderungen für Internetseiten aus Nutzersicht
Wichtig für den Benutzer ist allem voran eine bedienfreundliche Website.
Die elementaren Merkmale für nutzerfreundliche Seiten werden in der
DIN EN ISO 9241 geregelt. So muss eine übersichtliche Seitenstruktur vor-
handen sein, welche in das Gesamtkonzept des Internetangebotes der
Stadt integriert ist. Es dürfen sich keine Schwierigkeiten bei der Lesbarkeit
(Schriftgröße, -art, -farbe, usw.) und der Bedienfähigkeit (Pull-Down-Menüs,
Scrollen, Plugins, usw.) ergeben und die Seite soll den Kriterien des barrie-
refreien Internets entsprechen.
Der Inhalt der Seite muss eine logische Gitternetzstruktur aufweisen und
sollte dem Nutzer über eine Sitemap dargelegt werden können. Darüber
hinaus sollten Möglichkeiten zur eigenen Informationsrecherche aufgezeigt
werden.
Um eine einfache Handhabung zu gewährleisten, muss die Seite sowohl für
Anfänger als auch für Fortgeschrittene einfach und ohne Hindernisse be-
dienbar sein. Die dargestellten Funktionen sollten daher für eine möglichst
effiziente Nutzung optimiert werden. Erfahrene Nutzer sollen sich schnell
auf der Seite bewegen können, damit wird die Attraktivität der Seite ge-
stärkt. Für Anfänger dagegen muss bereits am Anfang des Angebotes die
Möglichkeit bestehen, sich über die allgemeine Technik (also Bedienung
des Programms sowie über planerische Grundkenntnisse) zu informieren.
Dies kann in Handbuchform oder besser mit Tutorials geschehen. Diese
Hilfestellungen dürfen selbstverständlich nicht nur von der Eingangsseite
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XVI
aus erreichbar sein, sondern können über Links jederzeit auch während der
Nutzung des Beteiligungstools aufgerufen werden. Fachbegriffe und we-
sentliche Handlungsschritte sollten durch maussensitive Schaltflächen bei
Text- und Grafikelementen im Anwendungsprogramm erläutert werden.
Die optische Gliederung der Seite sollte Seriosität widerspiegeln. Dies ist
durch sparsame Verwendung von großflächigen bunten Schaltflächen zu
erreichen sowie über eine Seitenaufteilung, die mindestens 50 bis 80 Pro-
zent des gesamten Bildschirms für den Inhalt des Tools reserviert. Darge-
stellt werden müssen im Wesentlichen ein Kartenfenster, dazugehörende
Legenden und Optionen sowie Wege zur Online-Hilfe. Bei der Darstellung
ist auf eine mediumsspezifische Darstellung (bei Schraffuren, Planzeichen,
usw.) und ihre möglichst stufenfreie Möglichkeit zur Vergrößerung zu ach-
ten.
Zur Information der Nutzer können Newsletter und Newsticker sowie ein
FAQ-Bereich oder diverse GIS-Anwendungen eingerichtet werden. Als in-
teraktive Kommunikationsinstrumente kommen für ein Beteiligungstool ins-
besondere ein Planbearbeitungseditor, ein Forum mit Community oder Chat
sowie ein Gästebuch in Frage. Die Ausführbarkeit (abhängig von der Sys-
temkonfiguration) sollte bestmöglich gewährleistet sein.
Erkenntnisse des dritten Kapitels
Der Bürger und seine Stellungnahme haben einen hohen fachlichen Wert in
der Planung, seine Aussagen dienen gewissermaßen als Indikator für die
Angemessenheit eines Plans. Die Integration des Bürgers schon im Vorfeld
der Planung ermöglicht darüber hinaus, dass bereits hier eine richtungwei-
sende Entwicklung initiiert werden kann. Da das Interesse an herkömmli-
chen Beteiligungsprozessen eher als gering einzustufen ist, kann durch
angemessene Gestaltung und Ausstattung von Online-Angeboten evtl. er-
reicht werden, dass eine höher frequentierte Partizipation stattfindet.
Kapitel 4:
Auswertung ausgewählter Internetauftritte bezüglich digitaler
Planung, Plandarstellung und Partizipation
Der Status quo der interaktiven E-Participation wurde durch die Analyse von
10 Städten mit Internetauftritt untersucht. Kapitel 4 prüft daher die Angebote
auf Bedienfreundlichkeit, technische und fachliche Hintergründe sowie die
verwendeten Kommunikationstools.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XVII
Analyse wegweisender Web-Angebote
Die Analyse erfolgte in Ober-, Mittel- und Unterzentren, welche sich bereits
durch ihre vorhandenen Webangebote auszeichneten. Bewertet wurde auch
die Eingängigkeit und Erreichbarkeit der Seiten.
Erkenntnisse der Untersuchung
Die Betrachtung der benutzerspezifischen Inhalte der Internetpräsenzen hat
ergeben, dass bei Vorhandensein einer Partizipationsmöglichkeit diese die
im Rahmen des gültigen Rechts erforderlichen Kriterien erfüllen. Kleinere
Gemeinden zeigen sich bei der Umsetzung engagierter und kreativer. Dies
zeigt sich allein schon an den ausführlicheren Zusatzoptionen und Texten.
Die einfach und sachlich wirkenden Auftritte größerer Städte lassen durch
ihre prägnante fachliche Ausstrahlung zwar die Relevanz der getätigten
Aussagen besser zur Geltung kommen, jedoch fehlt auch hier eine zufrie-
den stellende Verlinkung der Partizipationselemente mit Hilfe- und Glossar-
texten.
Die fachliche Darstellung der planerischen Inhalte ist durchweg zufrieden
stellend, aber es fehlen die leicht zugänglichen Hintergrundinformationen.
Hier zeigen sich kleinere Städte wiederum wesentlich mitteilungsfreudiger.
Die Auskunft über Verfahrensschritte stellt sich zweigeteilt dar: Entweder
war eine gute Übersicht über den Stand eines Verfahrens (leider ohne mög-
liche Optionen) vorhanden oder es gab keinerlei Informationen hierzu.
Praktisch nicht vorhanden sind alle Funktionen, welche annähernd etwas
mit interaktiver Partizipation zu tun haben könnten. Nur sehr rudimentär sind
interaktive Ansätze zur Kommunikation vorhanden, selbst die heute doch
recht übliche Maussensitivität kommt bei Schaltflächen oder Planzeichen
nicht vor.
Ursache für die fehlenden Elemente könnten Probleme bei der technischen
Umsetzung und Navigation sein. Diese wurden in die Betrachtung ebenfalls
miteinbezogen, da zu viele Ausfälle, Störungen und Fehlermeldungen eben-
falls die Partizipation unmöglich machen. Ein Verzicht auf unnötige techni-
sche Spielereien ist daher geboten.
Dies verleitet offensichtlich bisher dazu, lediglich die primäre Funktion des
Internets, die Informationsbereitstellung, anzubieten. Hier wäre eine interak-
tive Aufbereitung angebracht, welche sich an den wichtigsten Kriterien für
die Benutzerfreundlichkeit orientiert. Dazu gehören übersichtliche Struktu-
ren, Rückklickfunktionen sowie eindeutige Kontaktaufnahmemöglichkeiten.
Eine direkte Ansprechperson steht bei guten Internetauftritten immer zur
Verfügung. Dies muss auch Usern möglich sein, welche kein lokales Profil
auf einem Rechner angelegt haben.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XVIII
Erkenntnisse des vierten Kapitels
Die Analyse bestätigt die vorausgegangenen empirischen Untersuchungen
und zeigt, dass überwiegend das Internet als neues elektronisches Werk-
zeug verwendet wird, die Verfahren und Prozesse sich aber noch nicht an
die neuen web-spezifischen Medien angepasst haben. Die wesentlichen
formellen Vorgänge des E-Governments werden in großen Städten fast
flächendeckend angeboten, jedoch definiert sich eine echte interaktive Par-
tizipation nicht nur durch Informationsbereitstellung und ein Online-Formular
zur formellen Stellungnahme. Die mangelnde Umsetzung kann aber nicht
mit dem heutigen Stand der Technik begründet werden.
Kapitel 5:
Konzeption der interaktiven E-Participation bei Stadtplanungs-
prozessen
Kapitel 5 versucht, die erarbeiteten Erkenntnisse mit den Best-Practice-
Beispielen zu einem möglichst allumfassenden interaktiven Tool für die
E-Participation zu kombinieren.
Interaktive E-Participation als Teil der Systematik des
E-Governments
Das Beteiligungstool steht nicht für sich alleine, sondern ist von fachlicher
Seite mit verschiedensten Servern (GIS, Online-Hilfe, usw.) und Kompe-
tenzquellen (Expertenforum, E-Mail, usw.) des E-Governments vernetzt.
Den Bürgern stehen außer der Möglichkeit, Stellung zu nehmen, noch wei-
tere Kommunikationskanäle offen. Dort kann es sowohl von Bürgern als
auch Experten zu Planungs- und Kommunikationszwecken genutzt werden.
Im Rahmen des E-Governments sind wesentlich mehr Funktionen über die
Partizipation hinaus denkbar.
Elementar unterscheidet sich die Partizipation von anderen E-Government-
Dienstleistungen dadurch, dass eine Angebotssituation entstehen soll, um
möglichst viele Teilnehmer für die Beteiligung zu gewinnen.
Folglich sollte die interaktive E-Participation in wenigen Schritten vorrangig
über das virtuelle Rathaus und im Speziellen über den Bereich des Bauam-
tes erreichbar sein. Jedoch sind auch andere Anwendungsmöglichkeiten
denkbar, bspw. im Bereich des Stadtmarketings oder als Informationszent-
rum. Hierfür eigenen sich Links und Verknüpfungen zu den entsprechenden
Visualisierungen.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XIX
Grundlegende Bausteine eines interaktiven Planungstools
Grundsätzlich werden die gleichen Bausteine für formelle und informelle
Beteiligungsverfahren benötigt. Formell erforderlich sind ein Beteiligungs-
verfahren mit Planauslage, begleitenden Informationen und die Möglichkeit
der Stellungnahme. Dazu kommen die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung,
Bekanntmachung von Beschlüssen und die Benachrichtigung über Zwi-
schenergebnisse. Informelle Partizipation benötigt darüber hinaus einen
Bürgerserver für BIS, Chats und Foren zur interaktiven Kommunikation.
Über die Bausteine Information, Kooperation und Partizipation können so-
wohl Bürger als auch Experten Erkenntnisse gewinnen und in die Pla-
nungsüberlegungen integrieren. Die Rechtsgrundlage für eine formelle Be-
teiligung
über
elektronische
Informationstechnologien
liefert
§ 4a Abs. 4 BauGB, womit eine der herkömmlichen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gleichwertige Vorgehensweise gefordert wird. Partizipation über die
rechtlich notwendigen Grenzen hinaus dagegen liegt im Ermessen von Pla-
nung und Verwaltung und wird im Rahmen dieser Bausteine ausgestaltet.
Leistungsspektrum der interaktiven E-Participation
Insbesondere für formelle Verfahren gelten definierte Zeitspannen sowie
eine klare Ziel- und Ergebnisorientierung durch definierte Themen und Fra-
gestellungen bei Diskussionen zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen.
Eine flüssige Durchführung kann durch Online-Moderation und eine Struktu-
rierung der Beiträge gewährleistet werden. Insbesondere die ungleichzeitige
Kommunikation via E-Mail und Foren lässt inhaltlich überdachte Ergebnisse
erwarten.
Funktionsspektrum des interaktiven E-Participation-Tools
Das Funktionsspektrum stellt einen konzeptionellen Vorschlag für die inhalt-
liche Ausgestaltung eines interaktiven Angebotes zur E-Participation dar. Es
werden die verschiedenen Elemente eines Beteiligungstools vorgestellt, auf
welche von der Eingangsseite im virtuellen Rathaus, aber auch von diver-
sen anderen Seiten zugegriffen werden kann.
Eingangsseite
Die Eingangsseite gibt dem Nutzer die Wahl zwischen technischen und
rechtlichen Hilfs- und Lernfunktionen, diversen Informationen, Kontaktmög-
lichkeiten sowie zu den aktuellen öffentlichen Auslegungen und Beteiligun-
gen.
Textbasierte Informationselemente
Um dem Einzelnen die Partizipation zu erleichtern, wird eine am individuel-
len Wissensstand angepasste Hilfe angeboten. Diese setzt an den grund-
sätzlichen Techniken, Arbeitsweisen und Bedienungshinweisen für das Tool
an und führt den unbedarften Nutzer durch Tutorials in die Funktionsweise
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XX
des Tools ein. Weitergehend werden planerische und rechtliche Wissens-
grundlagen vermittelt, so dass im späteren Verlauf auch selbsttätig recher-
chiert werden kann. Recherchen können sowohl in einer Knowledgebase
stattfinden sowie auch in einem Dokumenten- und Newsserver, welcher die
aktuellen politischen Entwicklungen der Gemeinde bereithält.
Kartenbasierte Partizipationselemente
Die interaktive Darstellung erlaubt die Anzeige aller Planungsebenen inklu-
sive verschiedener Planversionen in einem maßstabsfreien Hybrideditor.
Datengrundlage können neben GIS auch Orthofotos oder Skizzen sein. Die
Anzeige über einen zentralen Editor hat den entscheidenden Vorteil, veror-
tete Informationen zu Landschaftsdetails oder Grundstücken planunabhän-
gig anzeigen und abfragen zu lassen. Des Weiteren ist es möglich, grafi-
sche Notizen zu hinterlassen sowie auf die wesentlichen Kommunikations-
mittel zuzugreifen. Der Nutzer hat innerhalb des Editors die größte Auswahl
an formellen und informellen Partizipationsmöglichkeiten. Das System akti-
viert automatisch die möglichen Optionen. Als grundlegende Funktion ist es
jederzeit möglich, jeden aktuellen Plan (bereits rechtsgültig oder in der Er-
stellungsphase) sowie Informationen aus dem GIS zu beziehen.
Je nach Plantyp ist eine entsprechende dreidimensionale Visualisierung
möglich, um dem Nutzer die Auswirkungen des Plans näher zu bringen.
Interaktiv veränderbare Grundeinstellungen (je nach Plantyp z. B. Art und
Maß der baulichen Nutzung, Vegetationstypen, usw.) können sofort visuali-
siert werden und fördern das Verständnis für die räumlichen Zusammen-
hänge.
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse kann eine Initiierung von Planungs-
prozessen und anderen kommunalen Entwicklungen in Gang gesetzt oder
eine laufende Partizipation beurteilt werden. Im Fall der formellen Beteili-
gung ist dies durch eine Eingabemaske möglich, informelle Beteiligungen
können alle Kommunikationswege nutzen. Zur Orientierung des Nutzers
zeigt eine Checkliste den momentanen Stand und Status (formell/informell)
des Planungsprozesses an.
Ausgehend von konkreten Verortungen ist es möglich, über verschiedene
Kanäle Diskussionen zu führen und diese auch konkret an Plänen zu veror-
ten oder zu skizzieren. Dabei kann ein öffentlicher Meinungsaustausch zwi-
schen Bürgern, aber auch Experten stattfinden. Eine direkte persönliche
Kommunikation mit Experten ist jedoch auch gegeben, um individuelle, nicht
für die Öffentlichkeit gedachte Anfragen zu stellen.
Kommunikationsorientierte Kooperationselemente
Die ergebnisorientierte Zusammenarbeit von Bürgern und Experten wird
durch verschiedene Kommunikationsinstrumente unterstützt, welche aus-
gehend von der Eingangsseite oder dem Kartenwerkzeug erreicht werden.
Durch die Einbindung in IuK-Technologien findet eine Verschriftlichung von
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XXI
Diskussionen statt. Die Auswertung von vielen Dokumenten kann einfacher
und systematischer durchgeführt werden.
Optimalen Nutzen erzielen diese Instrumente in einem planungsbegleiten-
den informellen Aushandlungs- und Entscheidungsprozess. Zur Verfügung
steht ein Formular zur Stellungnahme zu einer bestimmten Planung, aber
auch als einfache Möglichkeit, zu einer städtebaulichen oder landschaftli-
chen Situation Hinweise oder Konflikte zu nennen.
Interaktive Kommunikation mit mehreren Teilnehmern findet über ein Forum
statt, in welchem Meinungsäußerungen und Diskussionen möglich sind.
Potenzielle Themen sind Beteiligungen und Kooperationen, die Reflexion
über das Beteiligungstool sowie auch Protest. Dies ist anonym oder mit per-
sonifiziertem Profil durchführbar. Den ordnungsgemäßen Ablauf kann ein
Moderator unterstützen.
Für direkte Rückfragen mit Experten oder individuelle, nicht für die Öffent-
lichkeit gedachte Rückfragen steht E-Mail zu Verfügung. An allen relevanten
Stellen werden Kontaktmöglichkeiten angegeben, um einen einfachen In-
formationsaustausch möglich zu machen.
Ein öffentlichkeitswirksames Mittel sind direkte Chats, welche an festgeleg-
ten Terminen stattfinden und eine direkte Kommunikation und gleiche Rede-
rechte zwischen Experten und Bürgern ermöglichen.
Zur zielorientierten Ermittlung der Bürgermeinung können Internetbefragun-
gen durchgeführt werden, um tendenzielle Trends aufzudecken. Befragt
werden kann durch direkte Ansprache registrierter Nutzer, aber auch im
Rahmen eines öffentlichen Aufrufs.
Erfolgsfaktoren der interaktiven E-Participation
Verschiedene organisatorische Maßnahmen der Moderation, strategisches
Vorgehen der Politik, Qualifikation der Mitarbeiter und die Kommunikation
mit allen Beteiligten sind die wesentlichen Faktoren für eine effiziente E-Par-
ticipation. Zudem muss den Beteiligten die Relevanz ihres Handelns gezeigt
werden, sowie eine angebrachte Software zur Partizipation zur Verfügung
stehen. Unterstützt wird dies durch eine neutrale Moderation des Beteili-
gungstools. Diese geht über die Betreuung des Forums weit hinaus. Sie hat
für einen flüssigen Ablauf zu sorgen und sollte dauerhaft zur Verfügung ste-
hen. Das wird erreicht durch eine Offline-Marketing- und Informations-
Kampagne, welche über das Tool und aktuelle Prozesse informiert. Zur Ab-
rundung des Partizipationsverfahrens hat die Moderation die Internet-
Ergebnisse mit Non-Cyber-Veranstaltungen zu verknüpfen. Bürgerver-
sammlungen und Treffen sind bei zwischenmenschlichen Aspekten wie der
Gestaltung von Lebensräumen nötig und wirken sich zudem positiv auf das
Image und die Relevanz aus.
Nicht zu vernachlässigen ist letztlich auch die Akzeptanz moderner IuK-
Technologien auf Seite von Politik und Verwaltung. Diese müssen die auf
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
XXII
diesem Wege gewonnenen Erkenntnisse auch in den entsprechenden Pro-
zess-Schritten integrieren können und wollen sowie es als einen gewünsch-
ten Handlungsspielraum ansehen.
Kapitel 6:
Fazit und Ausblick
Diese Arbeit hat versucht, einen Überblick über die Entwicklung der elektro-
nischen Partizipation und deren Grundlagen im Bereich der computerge-
stützten Planung zu schaffen. Trotz immer noch kritischer Stimmen ist die
gesellschaftliche Tendenz hin zur weiteren Digitalisierung der Arbeitsweisen
und vieler Lebensbereiche zu erkennen. Wissenschaftliche Untersuchungen
gehen diesbezüglich davon aus, das E-Participation in Deutschland heute
bereits möglich ist. Dennoch werden einige wesentliche Elemente eines
Partizipationsprozesses auch in Zukunft nur über persönliche Kontakte sinn-
voll sein.
Das entwickelte interaktive E-Participation-Tool stellt eine völlig neue Art der
Partizipation dar, da es eine neue Art der Interaktivität, individuelle Visuali-
sierungen und Analysen zulässt. Durch den Einblick in Planungsunterlagen
können so eine echte Beteiligung und Teilhabe und echte interaktive Parti-
zipationsmöglichkeiten entstehen. Viele der bisherigen Werkzeuge, von Stift
und Papier bis zur der öffentlichen Auslegung, sind in dem Beteiligungstool
integriert. Die technisch denkbaren Grenzen dieser Werkzeuge sind bei
Weitem noch nicht erreicht, daher stellt diese Arbeit nur einen modellhaften
Ansatz für ein Beteiligungstool dar. Die Möglichkeiten dieses Tools sollen
helfen, die in Zukunft erwarteten extremen Veränderungsprozesse in der
Bevölkerungsstruktur und die damit zusammenhängenden städtebaulichen
Aufgaben wie Stadtumbau und Sanierungsprojekte schneller und dynami-
scher zu lösen.
Das Tool hat das Potenzial, einen sinnvollen Impuls zur Etablierung moder-
ner IuK-Technologien zu geben und gleichzeitig ein modernes Planungsin-
strument zu liefern, welches die multimedialen Ansprüche der heutigen Zeit
erfüllt.
E
in
fü
hr
un
g
Zusammenfassung
Einführung
Kapitel 1
Zweck und Ziel von Partizipation im Kontext
der Interaktivität
Kapitel 2
Potenziale und Grenzen, Herausforderungen und
Ziele der interaktiven E-Participation
Kapitel 3
Fachliche und technische Anforderungen an
die interaktive E-Participation
Kapitel 4
Auswertung ausgewählter Internetauftritte bezüglich
digitaler Planung, Plandarstellung und Partizipation
Kapitel 5
Konzeption der interaktiven E-Participation
bei Stadtplanungsprozessen
Kapitel 6
Fazit und Ausblick
Anhang
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
1
Einführung
,,E-Participation ist mehr als das Kontaktieren eines Verwaltungsmitarbeiters
via E-Mail und mehr als die bloße Bereitstellung einer interaktiven Beteili-
gungsplattform im Web. E-Participation heißt, durch neue computerunter-
stützte Kommunikationsprozesse die Beziehung zwischen Verwaltung, Poli-
tik und Bürgern neu zu gestalten. Dies ist eine lohnende und zugleich vor-
raussetzungsreiche Aufgabe. Gelingt ihre Umsetzung, wird nicht nur die
Legitimität und Akzeptanz von Entscheidungen erhöht, sondern auch mehr
Handlungsspielraum gewonnen. Denn Politik und Verwaltung können durch
E-Participation neues Wissen über die Auswirkungen von Entscheidungen
gewinnen und auf diese Weise ihre Beratungs- und Entscheidungsprozesse
qualifizieren und verbessern" [Märker/Trénel/Poppenborg 2003: 18].
Die Etablierung der interaktiven E-Participation hängt eng mit der Umset-
zung der vom ehemaligen Bundeskanzler und den Regierungschefs der
Länder beschlossenen Zielmarken zusammen. Die im Dezember 2003 be-
schlossenen Inhalte von Deutschland-Online haben den ersten Schritt be-
reits komplett erreicht: Ende 2005 haben alle Behörden in Bund, Ländern
und Kommunen einen Zugang für elektronische Kommunikation eingerich-
tet. Bis Ende 2006 sollen alle 2003 beschlossenen Deutschland-Online-
Vorhaben im Internet verfügbar sein.
Bis spätestens Ende 2007 werden die Behörden auch untereinander aus-
schließlich elektronisch kommunizieren, um ab Anfang 2009 alle geeigneten
Verwaltungsverfahren in Deutschland online zur Verfügung zu stellen [Bun-
desministerium des Inneren 2004: 7].
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
2
1 Das Internet und die Partizipation
,,Politikwissenschaftler und Technikphilosophen haben in der elektronischen
Demokratie immer mehr gesehen als die Fortführung etablierter Verfahren
repräsentativer Demokratien mit neuen Mitteln. Optimisten erhoffen sich von
der millionenfachen Vernetzung Großes: Das Internet soll den Willensbil-
dungsprozess moderner Gesellschaften perfektionieren. Wie in der idealty-
pischen Dorfgemeinschaft von Aristoteles soll jeder Bürger nach seiner Mei-
nung gefragt werden. Wahlen werden einfacher, dringende Entscheidungen
liegen nur noch einen Mausklick entfernt. Willy Brandts Forderung "mehr
Demokratie wagen" scheint plötzlich umsetzbar" [Bundesministerium des
Inneren 2004: 7].
Aber nicht nur die großen politischen Entscheidungen fallen unter diese
neue Betrachtung von Demokratie, auch die kleinen Prozesse können so
beeinflusst werden. Besonders im Rahmen von kommunalen Entwicklungen
bei Bau- und Planungsprojekten können so die Bürger theoretisch wesent-
lich einfacher einbezogen werden.
Was steckt nun hinter einer solchen interaktiven E-Participation?
Zunächst einmal gibt es das interaktive Internet, die weltweite Verknüpfung
von Rechnern, welche theoretisch jedermann die Kommunikation mit jedem
einzelnen Teilnehmer ermöglicht und eine völlig neuartige Form der Infor-
mationsbereitstellung bietet.
Des Weiteren gibt es Stadtplanungsprozesse. Diese beginnen bei der Not-
wendigkeit oder der Idee, etwas zu verändern und gehen über die Erarbei-
tung von Planskizzen und Abwägung aller relevanter Interessen der Betrof-
fenen bis hin zur Planerstellung. Das Spektrum reicht von informellen Plä-
nen und Programmen bis zu gesetzlich geregelten vorbereitenden Bauleit-
plänen, verbindlichen Bauleitplänen oder Konzeptionen nach dem besonde-
ren Städtebaurecht.
Die Partizipation der Bürger schließlich ist erwünscht, um eine gesteigerte
demokratische Absicherung und möglichst endogene Basis bei städtebauli-
chen Neuplanungen zu haben [Battis/Krautzberger/Löhr 2005: 141].
Die Vorgehensweise für die organisatorischen Abläufe ist gesetzlich gere-
gelt, es gibt keinen Grund zur Änderung.
Oder doch?
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien bereiten schon seit
Jahren den Weg für eine Abkehr von Stift und Papier hin zu Bildschirm und
Maus. Die Anwendungen im Internet bieten völlig neue Möglichkeiten, Vor-
gänge durchzuführen, Informationen zu verbreiten und aufzubereiten und
mit anderen Menschen zu kommunizieren.
Vergleicht man das Internet mit traditionellen und sich entwickelnden neuen
Planungsmethoden, so wird einem der Begriff Interaktivität schnell klar. Je
mehr direkte Kommunikation stattfindet und je höher der Aktionsbedarf und
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
3
die Aktionsmöglichkeiten des einzelnen sind, umso höher wird die Interakti-
vität. Konnte dies früher nur durch ein direktes Gespräch zwischen Men-
schen erfolgen, ermöglicht das Internet mit seinen Chats, Foren und
Newslettern unzählige Möglichkeiten, auch über zeitlich oder lokal weit
entfernte Strecken miteinander zu kommunizieren. Änderungen an Doku-
menten können sofort weltweit online beeinflusst werden und die neuesten
Entwicklungen eingesehen werden.
Abbildung 1: Die Evolution der interaktiven Kommunikation [geänderte Darstellung
nach Welker 2002: 113]. Das Internet stellt das neueste Medium dar und bietet eine
interaktive Massenkommunikation. Allerdings wird i. d. R. nur ein Teilbereich genutzt.
Der Interaktivitätsgrad wird bestimmt, indem eine bestimmte Anwendung gewählt
wird. Je weiter links in der Skala, umso geringer der Kommunikationsgrad, je weiter
rechts in der Skala, umso fortgeschrittener ist das Interface. Dieses stellt sich dar als
Web-Seite und steigert sich über E-Mail, Chat und Diskussionsforum bis hin zur
Videokonferenz.
Überlagert man die evolutionäre Entwicklung der Kommunikation mit der
Entwicklung der Planung, erreichen beide die sich heute abzeichnende
Spitze, das Internet.
E
vo
lu
tio
n
Niedrig
Grad der Interaktivität
hoch
Planumsetzung
Höhlenmalerei
Interaktive E-Participation
Beteiligungsverfahren
Stellungnahme/Anregung
Videoanimation
Öffentliche Bekanntmachung
Bürgerversammlung
Modell
Buchdruck
Internet
Hörfunk
Telefon
Videotext
Videokonferenz
Face-to-Face-
Gespräch
Zeitung
Fernsehen
Beteiligungsmethode
Kommunikationsform
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
4
Und genau dieses Medium, das Internet, beinhaltet alle bisher dagewese-
nen Formen der Kommunikation, von der schlichten (passiven) Informati-
onsbereitstellung bis hin zu direkten (interaktiven) Gesprächspartnern oder
in Echtzeit ablaufenden Entwicklungen.
Ob dieses Medium diese Aufgabe einer besseren, vereinfachten Par-
tizipation erfüllen kann, wie es diese Aufgabe erfüllen kann und ob es
diese Aufgabe erfüllen soll, werden zentrale Fragen in dieser Arbeit
sein.
Ein erster Schritt in diese Richtung erfolgte bereits schon im Zuge der
jüngsten BauGB-Novellierung und dem neuen § 4a BauGB, der in Absatz 4
die Vorschrift enthält, dass ,,bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
ergänzend elektronische Informationstechnologien genutzt werden können"
[Streich 2005: 381]. Freiwillige Eigeninitiativen von Städten und Gemeinden
werden so nachhaltig gestützt und es können moderne öffentliche Verwal-
tungen entstehen die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg eines
jeden Landes. Eine umfassende gleichartige Medienlandschaft für die Pla-
nung könnte einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Als gegenwärtige
Aufgabe gilt es, die heute heterogene und schwerfällige, durch Medienbrü-
che gekennzeichnete IT-Landschaft von Bund, 16 Bundesländern, über 300
Kreisen und weit über 13.000 Kommunen auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen [Benner/Krause/Müller 2005: 487].
IT bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur die technische Lösung der
behördlichen IuK-Systeme, sondern auch eine bürgernahe verständliche
Aufbereitung von Informationen: diese sind als Grundlage aller räumlichen
Planungs- und Management-Bemühungen anzusehen [Fischer 1997: 25].
Da die räumliche Planung schon immer durch das Erfassen der Umwelt,
Sammeln von Erkenntnissen und Informationen und Erarbeiten eines Plan-
werkes zur Verbesserung der gegebenen Umstände charakterisiert war,
konnten sich nur Experten durch den Berg an Informationen arbeiten, wel-
che die menschliche Zivilisation im Laufe ihrer Entwicklung hervor brachte.
Zugang zu Informationen war lange Zeit nur unter aus heutiger Sicht
erschwerten Bedingungen möglich. Erst neue technische Entwicklungen
lassen einen unbeschränkten Zugriff auf das gesammelte Wissen zu.
Durch die rasante Entwicklung des Internets ergeben sich neue einfache
Möglichkeiten, im Bereich der Raum- und Stadtplanung Informationen einer
breiten Masse zur Verfügung zu stellen und diese für die Planung zu nut-
zen. Während das momentane Verwaltungshandeln noch überwiegend
durch die Aktionen der ,,eigenen" Verwaltung geprägt ist, wird bei einer kon-
sequenten Weiterentwicklung der Informationstechnologien ein Mitwirken
jeder beliebigen Gruppe oder Person bei der Entscheidungsfindung möglich
sein. Die Bürger und die Öffentlichkeitsbeteiligung bekommen für die
Raumplanung einen immer höheren Stellenwert. Dadurch machen die pla-
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
5
nenden Institutionen ihre Stellung bei der Entwicklung des Raumes deutlich,
aber auch die Akzeptanz der Planungen und die Umsetzung kann durch
gezielte Öffentlichkeitsarbeit verbessert werden [Frahm/Gnest 2004: 421].
Dabei können sowohl Experten als auch der kundige Bürger vor Ort wertvol-
le Beiträge in jedem Schritt des Planungsprozesses liefern:
·
Zusammenstellung relevanter Daten und Informationen über die
Entscheidungszusammenhänge durch einfache Instrumente,
·
Mitteilung von allgemeinen Anmerkungen,
·
gezielte Mitteilung von Bedenken und Anregungen zu einzelnen
Planelementen,
·
Eingabe von alternativen Planelementen [Schmidt 1997: 123].
Im Bereich der örtlichen Planung im Zusammenhang mit der Öffentlich-
keitsbeteiligung bietet eine derartige Informationsfülle ganz neue Planungs-
grundlagen und Beteiligungsmöglichkeiten, wodurch die Partizipation revo-
lutioniert werden könnte und dadurch zukünftig die Ergebnisse verbessert
werden können.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
6
2 Zunahme des Partizipationsinteresses und der
Urban Governance bei Stadtplanungsprozessen
,,Das EAG Bau betont insbesondere in § 4a Abs. 1 die Bedeutung der Betei-
ligung von Öffentlichkeit und Behörden für die Gewähr materieller Recht-
mäßigkeit des Bauleitplanes durch ordnungsgemäßes Verfahren" [Bat-
tis/Krautzberger/Löhr 2005: 140]. Dazu kommt die Zunahme außergewöhn-
licher Planungsprozesse im Kontext von lokalen Agenden, des Stadtum-
baus oder anderen konfliktträchtigen Planungen im Bestand. Der Planer ist
in diesem Zusammenhang mehr und mehr in die Moderator-Rolle des Pla-
nungsprozesses gerückt.
Diese mit dem Begriff Urban Governance in Verbindung gebrachte Vorge-
hensweise, welche dem Staat eher leitende Funktionen zuspricht und die
Ergebnisse und Vorstellungen der Bürger, Privatwirtschaft und Behörden
koordiniert, bedingt jedoch neuartige Kommunikations- und Informationswe-
ge.
Es geht dabei nicht mehr nur um die Koordination von Arbeit, sondern auch
darum, die verschiedensten Bedenken und Anregungen, Vorschläge und
Beiträge in netzwerkartiger Form zu steuern, aufzuarbeiten und damit die
demokratische Legitimation der Planungen zu untermauern [Bat-
tis/Krautzberger/Löhr 2005: 140]. Gestützt wird dies auf einem neuen Rol-
lenverständnis der einzelnen Bürger, aber auch diverser anderer Akteure,
bezüglich der Mitgestaltung der Umwelt.
,,Die Öffentlichkeitsbeteiligung erhöht den Verwaltungsaufwand und kann
das Planungsverfahren verlängern" [Battis/Krautzberger/Löhr 2005: 141].
Im Zuge einer Integration neuer Planungsmethoden könnten alte überkom-
mene Strukturen gelöst und Verfahren dynamisiert werden, wie etwa die
durch die Vermeidung von Medienbrüchen. Die hohe zeitliche Belastung bei
Planungen wird in Deutschland oft bemängelt. Es wird zunehmend schwie-
riger, Planungen ohne langwierige Mediationsprozesse in die Tat umzuset-
zen. Dazu kommen oft sehr hohe Investitionskosten bei der Aufstellung von
Bauleitplänen und ggf. Schadensersatzanforderungen an Städte und Ge-
meinden.
Jedoch stellt die heutige Zeit extrem anspruchsvolle Forderungen an die
Planung: Die in der Agenda 21 festgehaltene Endlichkeit der Flächenres-
sourcen ist in den Industriestaaten längst ausgeschöpft, jeder zusätzliche
Anspruch an neue Flächen bedarf einem besonderen Begründungszwang.
Dieser muss nicht nur durch Experten verifiziert werden sondern es bedarf
auch einer Integration der Öffentlichkeit. Besonders den Bürgern ist eine
,,konkrete Rechenschaft über die einzelnen Entscheidungen und deren
Spiegelung in übergeordnete Ziele" [Peithmann/Schaal/Jung 2001: 308] zu
geben.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
7
Ein Lösungsweg scheint hier eine interaktiv ausgestattete Partizipations-
möglichkeit zu sein.
Jedoch ergeben sich aus der Beteiligung sowohl des einzelnen Bürgers
aber auch der Behörden enorme Verwaltungskosten und aufwändige Ver-
fahren, welche die Verwaltungen zu tragen haben. Diese Aufwendungen
stehen den finanziellen Engpässen der Gemeinden gegenüber, welche ver-
suchen müssen, trotz dieser Situation handlungsfähig zu bleiben und auch
wirtschaftlich interessante Angebote für potenzielle Investoren bieten zu
können. Schließlich wird es zukünftig auch Aufgabe der Gemeinden sein,
nicht nur ihre Planungen durchzusetzen, sondern auch Informationen an die
Öffentlichkeit zu liefern und diese auf dem aktuellen Stand zu halten. Die
Planung selbst stellt hohe fachliche Anforderungen an die Partizipation,
welche sich längst zur Quelle wertvoller Ideen und Hinweisen entwickelt hat
und nicht mehr als Hindernis im Planungsprozess angesehen wird.
Diese Aufgabenvielfalt stellt die Herauforderungen an ein neues Planungs-
werkzeug, und der Bereich der interaktiven E-Participation stellt eine der
Säulen im Netzwerk des E-Governments, welche dabei eine wesentliche
Unterstützung liefern könnten.
Die Planung der Zukunft wird weit über das klassische Beteiligungsverfah-
ren hinausgehen können. Die heutigen, mehr auf Information, aber weniger
auf direkte Interaktion ausgerichteten Beteiligungsverfahren bieten einen
Angriffspunkt, um mehr Beteiligungsmöglichkeiten und interaktive Visuali-
sierungen zu fordern.
Die Informationsdichte und das Wissenspotenzial einer virtuellen Partizipa-
tion wird wertvolle Aufklärungsarbeit leisten und die Akteure zu einer zielge-
richteten Beteiligung motivieren können.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
8
3 Ziel der Arbeit: Konzeption eines interaktiven
E-Participation-Tools
Als Zielsetzung dieser Arbeit soll ein Systemschema für ein interaktives
Informations-, Kommunikations- und Partizipationstool erstellt werden. Eine
gute individuelle Zugänglichkeit zu allen Umweltbelangen wird bereits in der
A
ARHUS
-K
ONVENTION
(Übereinkommen über den Zugang zu Informationen,
die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten) gefordert und kann mit einem ent-
sprechenden Tool gewährleistet werden [Aarhus-Konvention 1998: Art. 1].
Das Internet als Plattform für bürgerliche Angelegenheiten bietet sich dafür
ideal an, da es wesentliche Potenziale für ein Beteiligungstool birgt [Burg
1999: 228ff]:
·
Verbesserung der [interaktiven] Information,
·
Erleichterung der [interaktiven] Kommunikation,
·
Förderung der [interaktiven] Partizipation.
Das Tool soll multi-channel-fähig sein, d. h. über das Internet, Bürgertermi-
nals oder TV-Zugänge erreichbar sein und alle Eingangsströme in der
kommunalen IuK-Infrastruktur zusammenführen [Grabow/Drücke/Siegfried
2004: 79]. Der Schwerpunkt bei der Entwicklung des Tools soll die Interakti-
vität sein. Dem Bürger sollen vielfältige Kommunikations- und wechselseiti-
ge Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden, welche den zukünftigen An-
sprüchen an die Partizipation gerecht werden.
Das Systemschema soll als Gesamtkonzept im E-Government implemen-
tiert sein. Die Partizipation im elektronischen Alleingang soll weder aus
funktionstechnischen noch aus Kostengründen angestrebt werden, sondern
ein Element des gesamten Planungsprozesses sein. Die Aufarbeitung der
Pläne rein für die Beteiligung würde sich schon allein aus Kostengründen
nicht für sinnvoll erweisen.
Unterziele dieser Arbeit sind die Untersuchung der Rahmenbedingungen
sein und die Darstellung der Vor- und Nachteile einer solchen Beteiligungs-
form. Es soll daraus ein System konzipiert werden, mit welchem eine inter-
aktive Partizipation für die Bürger (ohne die Träger öffentlicher Belange im
Sinne der Öffentlichkeit von § 3 ff. BauGB) durchgeführt werden kann. Die
digitale Beteiligung im Internet bietet dabei eine neue Form eines Mediums,
welches die Möglichkeiten der bisherigen Beteiligungsprozesse bei weitem
übertrifft. Kann man davon ausgehen, dass ein solches Medium gegen die
bei Weitem nicht im vollen Umfang ausgenutzte Partizipation vorgehen
kann und mehr Transparenz in die politische Prozesse bringt? Kann eine
Rückkopplung der Politik mit dem Bürger so wesentlich gesteigert werden?
Oder bleibt die elektronische Partizipation als Allheilmittel von Politik- und
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
9
Mitwirkungsverdrossenheit auch in nächster Zukunft noch fraglich?
[Kleinsteuber 2001: 21]
Es soll daher untersucht werden, ob sich die heutigen digitalen Techniken
generell für eine Planungspartizipation eignen, wie dies dann im Idealfall
durchgeführt werden sollte und welche elektronischen Medien sich für eine
solche Beteiligung eignen. Die vorhandenen und erwarteten Probleme, aber
auch die Vorteile und neuen Errungenschaften, sollen aufgezeigt werden.
Grundsätzlich ist eine Betrachtung aller Planungsebenen angebracht, je-
doch liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der örtlichen Ebene, da das
Potenzial für eine Beteiligung dort am höchsten anzusetzen ist und eine
Konzeption des Systems für die Beteiligung dort vorerst am sinnvollsten
erscheint. Es soll eine inhaltliche Systematik für die Entwicklung eines In-
ternet-Tools entstehen, welche den Aufbau der Benutzerseiten und die
Auswertung der Daten darstellt. Die interaktive E-Participation wird keine
rechtliche Grundlage haben, daher werden die Ansprüche an das Tool
durch die fachlichen Anforderungen der Planung geprägt sein.
Auf die technische Umsetzung der Programmierung kann im Rahmen die-
ser Arbeit nicht eingegangen werden.
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
10
4 Vorgehensweise und Struktur der Arbeit
Zur Strukturierung der Arbeit werden im Wesentlichen vier Fragen unter-
sucht:
·
Was sind die Inhalte und Prozesse der Partizipation?
·
Welche Personengruppen stellen welche Ansprüche an die Partizi-
pation?
·
Welche Ziele werden mit der Partizipation verfolgt?
·
Welche Medien und Methoden können zur Zielerreichung ange-
wandt werden?
Grundlagen
Kapitel 1
·
Baurechtliche Aspekte
·
Akteure und Methoden in der Planung
·
Grundlagen der Partizipation
Kapitel 2
·
Planungswerkzeuge
·
Internetgrundlagen
·
Reform der Partizipationsprozesse
·
Dynamisierungspotenziale
Empirische Basis
Kapitel 3
·
Fachliche Anforderungen aus Sicht der
Planung
·
Technische Anforderungen aus Sicht
der Nutzer
Analyse
Kapitel 4
·
Analyse wegweisender E-Participation im Internet
Konzeption der interaktiven E-Participation
Kapitel 5
·
Grundlegende Bausteine eines Beteiligungstools
·
Funktionsspektrum eines Beteiligungstools
·
Erfolgsfaktoren der E-Participation
Fazit und Ausblick
Abbildung 2: Aufbau der Arbeit [eigene Darstellung]
Anhand dieser Fragen erfolgt eine Erarbeitung der Grundlagen angefangen
vom Internet und der rechtlichen Basis über die fachlichen und technischen
Anforderungen an die Partizipation bis hin zu einer daraus sich ergebenden
Analyse von zehn Internetauftritten verschiedener Städte und Gemeinden.
Diese Vorüberlegungen erschließen die Thematik von verschiedenen Blick-
richtungen und sollen die für ein Beteiligungstool relevanten Elemente her-
ausarbeiten.
Die Ergebnisse der Analyse und die Erkenntnisse aus der Empirie bilden
letztendlich die konkreten Inhalte des interaktiven E-Participation-Tools für
die Bürger. Dessen Funktionsspektrum wird anhand seiner grundlegenden
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
11
Bausteine im E-Government sowie den einzelnen interaktiven Elementen
erläutert. Begleitend zu der technischen Ausgestaltung des Tools werden
die Erkenntnisse der vorhergegangenen Untersuchungen in Erfolgsfaktoren
für die interaktive E-Participation formuliert.
,,Die flexible Beschreibung [der interaktiven E-Participation] muss der Tat-
sache Rechnung tragen, dass es grundsätzlich nicht möglich ist, den kom-
plexen [Beteiligungs-]prozess komplett und detailliert mit allen seinen Aus-
nahmen und Sonderfällen darzulegen. Daher muss es möglich sein, ihn nur
annähernd komplett in einem System darzustellen. Dies steht nicht im Wi-
derspruch dazu, dass man bestrebt ist, möglicht viele Bereiche so gut es
eben geht abzubilden" [Pews 1999: 29].
K
ap
ite
l 1
Zusammenfassung
Einführung
Kapitel 1
Zweck und Ziel von Partizipation im
Kontext der Interaktivität
Kapitel 2
Potenziale und Grenzen, Herausforderungen und
Ziele der interaktiven E-Participation
Kapitel 3
Fachliche und technische Anforderungen an
die interaktive E-Participation
Kapitel 4
Auswertung ausgewählter Internetauftritte bezüglich
digitaler Planung, Plandarstellung und Partizipation
Kapitel 5
Konzeption der interaktiven E-Participation
bei Stadtplanungsprozessen
Kapitel 6
Fazit und Ausblick
Anhang
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
13
Kapitel 1:
Zweck und Ziel von Partizipation im Kontext der
Interaktivität
Planungen waren schon immer geprägt durch unterschiedliche Meinungen
und Vorstellungen der Umwelt. Während in vergangenen Zeiten beispiels-
weise hygienische Bedingungen oder andere chaotische Zustände in den
Städten zu weitgreifenden und kompromisslosen Plänen zwangen, ist das
Interesse und der Mitgestaltungswille der Bürger bis zur zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts enorm gewachsen. Hinsichtlich der Legitimation von
Planungen wurde die demokratische Funktion von Beteiligungen erkannt
und wird heute in der Rechtsprechung deutlich, welche für einen verbesser-
ten Rechtsschutz während des Planungs- und Abwägungsprozesses sorgt
[Battis/Krautzberger/Löhr 2005: 141].
Das Verlangen nach Beteiligung ging bereits 1960 in das erste Bundesbau-
gesetz ein und manifestierte die Rechtstraditionen der vorhergegangenen
Reichs-, Bundes und Landesgesetze. Das Städtebauförderungsgesetz von
1971 schuf wenige Jahre später ein begrenztes Sonderrecht, um die Belan-
ge der Betroffenen gegeneinander abzuwägen. Ein für die Partizipation we-
sentlicher Schritt war die Gelegenheit, im Rahmen dieses Gesetzes bei der
Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmassnahmen mitzuwirken.
Im Jahre 1976 wurden durch eine Baurechtsnovelle die Planungsbefugnisse
der Gemeinden verbessert und gleichzeitig eine frühere und intensivere
Beteiligung der Bürger an der Planung festgelegt. Seit 1977 gilt nun die
zweistufige Bürgerbeteiligung.
Die früher häufig großmaßstäbliche und nur durch Experten beeinflusste
Planung, die berüchtigte Flächensanierung, konnte so seit den 70er Jahren
des letzten Jahrhunderts mehr und mehr durch partizipatorische Planung
verdrängt werden. Widerstände gegen die Zerstörung der Städte, autoge-
rechter Ausbau von Innenstädten und zunehmende Umweltprobleme stärk-
ten die Einstellung der Bürger, bei öffentlichen Projekten ebenfalls mit-
bestimmen zu wollen. Dies führte dann zu einer kompletten Überarbeitung
der Rechtsschriften und das Baugesetzbuch wurde 1986 erlassen. Dort
wurde das Städtebaurecht neu geregelt, besonders hinsichtlich der objekt-
bezogenen und innerstädtisch orientierten Entwicklung. Erstmals wurde der
Umweltschutz, Stadtökologie und das Stadtbild beim Stadt- und Woh-
nungsbau explizit erwähnt.
Seitdem wurden in unregelmäßigen Abständen inhaltliche Ergänzungen
vorgenommen, um die Beteiligung zu erleichtern. Die letzte Novelle durch
das EAG Bau 2004 erlaubt nun nach § 4a Abs. 4 BauGB auch ,,ergänzend
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
14
elektronische Informationstechnologien" bei der Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden zu nutzen.
Die Entwicklung der Partizipation bei der Planung und Wandlung des Pla-
nungsverständnisses auch auf Seiten der Planer wurde schrittweise gesetz-
lich manifestiert, so dass von ursprünglichen Widerständen gegen Pläne
heute ein geregeltes Beteiligungsverfahren entstanden ist. Die Einbezie-
hung der Öffentlichkeit und der Behörden nimmt zwar heute einen wesentli-
chen Teil des Planungsprozesses in Anspruch, jedoch können damit im
Vorfeld Fehlplanungen oder unangebrachte Entwicklungen frühzeitig er-
kannt werden. Die Erkenntnis, dass eine frühzeitige Einbeziehung der Be-
troffenen zu besseren und angemesseneren Ergebnissen führt, bekräftigt
die Bemühung, möglichst viele Beteiligte an einen Tisch zu bekommen.
Abbildung 3: Die Entwicklung des Beteiligungsverständnisses [nach Selle 1996: 69]
Vor wenigen Jahren waren derartige Beteiligungen noch wesentlich durch
die Reproduktionstechnik und Kommunikationshindernisse geprägt. Auch
das Interesse der Bevölkerung lag auf anderen Schwerpunkten und man
verließ sich auf das ordnungsgemäße Vorgehen der Verwaltung. Das Ver-
ständnis der Beteiligung hat sich bis zum heutigen Tage jedoch wesentlich
gewandelt. Die heutige Entwicklung des Internets ermöglicht ganz neue
Wege, Betroffene zu ermutigen, an der Gestaltung ihrer Umgebung teilzu-
Interaktive E-Participation
Integrieren durch Multimediaeffekte, Ef-
fektivierung der Planungsprozesse
Online-Beteiligung
Nutzen des Internet-Booms
Kooperation, gemeinsame Problembehandlung
Nutzen von Eigenaktivitäten und Synergieeffekten
Aufsuchende, aktivierende Beteiligung
Motivieren, Mobilisieren endogenen Potenzials,
Demokratisieren
Information und Anhörung der (Verfahrens-) Beteiligten
Verfahrensrechtsschutz
1960
1970
1980
1990
2000
Information der breiten Öffentlichkeit, Erörterungen
Effektivieren von Planung und Umsetzung,
Legitimation, Demokratisierung der Planung
2010
?
Interaktive E-Participation bei Stadtplanungsprozessen
15
nehmen. Zunehmend wird das Medium Internet von bestimmten Gruppen
als vorrangige Quelle zur Informationsbeschaffung und Kommunikation
genutzt [Sinning/Selle/Pflüger (Hg.) 2003: 13]. Die anfängliche reine Bereit-
stellung von Verwaltungsdienstleistungen entwickelte sich mehr und mehr
weg von der E-Administration hin zur E-Democracy, also der Informati-
on und Kommunikation mit den Bürgern [Richter/Sinning 2005: 1ff.].
Ein Teil der E-Democracy ist die E-Participation: Durch diese interaktive E-
Participation soll dem Einzelnen die Möglichkeit gegeben werden, von je-
dem Ort an städtebaulichen und raumplanerischen Partizipationsprozessen
teilnehmen zu können. Mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikati-
onstechnologien (IuK-Technologien) können wertvolle Informationen zur
Verfügung gestellt und interaktiv Auskünfte über Nutzerwünsche gewonnen
werden. Die sich seit Jahren abzeichnende Tendenz der Abkehr vom regie-
renden zum lenkenden Staat spiegelt sich in dieser elektronischen Form der
Urban E-Governance wieder. Darunter ist die ,,Art und Weise, die Methode
oder das System" [Braun/Giraud 2003: 147] zu verstehen, wie eine Gesell-
schaft regiert wird oder sich selbst organisiert. Durch die IuK-Technologien
scheint im Bereich der Stadtplanung ein ganz neuer Trend möglich zu wer-
den, welcher sich von den anfänglich reinen Informationsdiensten zur heuti-
gen interaktiven E-Participation zu entwickeln scheint. Eine Abkehr von der
reinen Regierung hin zu aktiven Mit- und Selbstgestaltungsprozessen ist zu
erkennen, bei denen die Einbeziehung der Bevölkerungsmeinung eine wich-
tige Rolle spielt. Von staatlicher Seite aus wird der Prozess gelenkt, aber
nicht beherrscht. Das traditionelle ,,zentrale Regierungssubjekt" [Selle 2005:
115 ff.] ist nicht mehr vorhanden.
Im folgenden Kapitel soll nun dargestellt werden, welche Elemente für eine
ordnungsgemäße Beteiligung notwendig sind und wie ein Beteiligungspro-
zess abläuft. Dazu werden die Methoden beleuchtet, mit denen Planungen
für verschiedene Akteure dargestellt werden und warum eine derartige Be-
teiligung bei Planungsprozessen überhaupt nötig ist.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832497866
- ISBN (Paperback)
- 9783838697864
- DOI
- 10.3239/9783832497866
- Dateigröße
- 14 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau – Architektur / Raum- und Umweltplanung / Bauingenieurswesen
- Erscheinungsdatum
- 2006 (August)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- öffentlichkeitsbeteiligung geographische informationssysteme regionalplanung dynamischer planungsprozess internettools
- Produktsicherheit
- Diplom.de