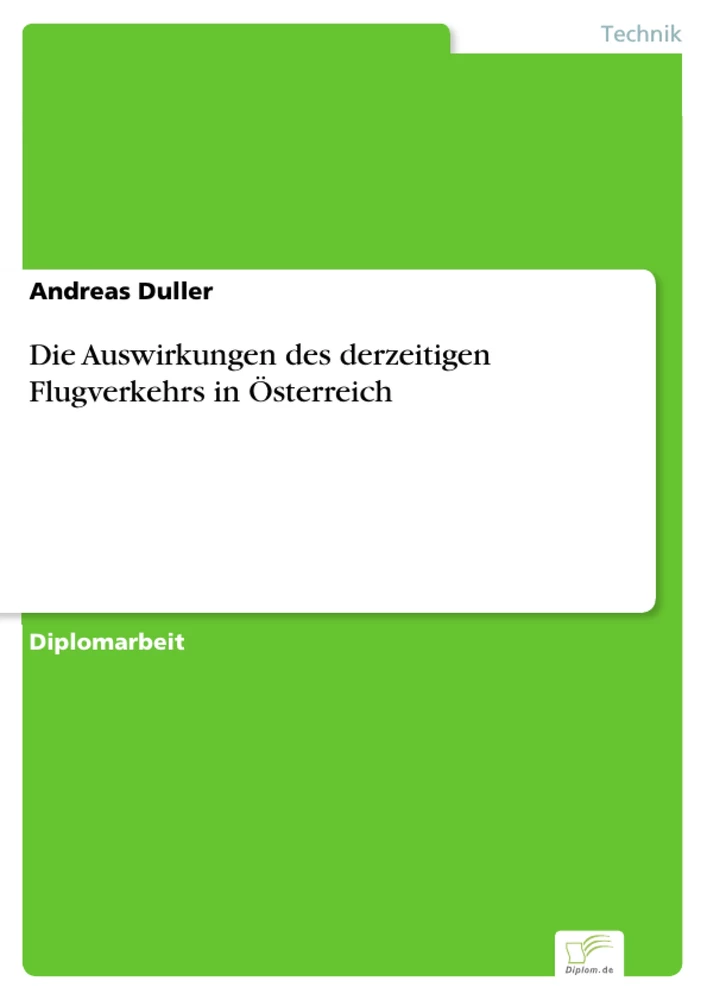Die Auswirkungen des derzeitigen Flugverkehrs in Österreich
Zusammenfassung
Mit der vollständigen Liberalisierung des Luftverkehrs in Europa Ende der neunziger Jahre ist der Luftverkehrsmarkt deutlich in Bewegung geraten. Neben den etablierten Fluggesellschaften haben sich in Europa immer mehr Low-cost Airlines durchgesetzt. Mittlerweile tragen sie einen erheblichen Teil zum wachsenden Luftverkehrsaufkommen bei und sind bei uns nicht mehr wegzudenken. Die Low-cost Airlines haben sich neben dem herkömmlichen Linienverkehr der traditionellen Fluggesellschaften und dem Charterflugverkehr als drittes Marktsegment fest verankert.
Das Modell der Low-cost Airlines wurde erfolgreich von den USA auf den europäischen Markt übernommen. War es zuerst vor allem der britische und irische Markt, auf dem sich diese neue Art des Flugverkehrs durchsetzte, konnte in den letzten Jahren eine starke Zunahme in ganz Europa festgestellt werden. Mit der Erweiterung der Europäischen Union wurden ganz neue Märkte erschlossen und fest in das jeweilige Steckennetz der betreffenden Low-cost Airlines integriert.
Hauptgewinner dieser neuen Entwicklung sind aber nicht nur die großen internationalen Flughäfen. Vor allem die regionalen Flughäfen haben die Bedeutung und die Auswirkungen der Low-cost Airlines erkannt und bemühen sich darum, Low-cost Anbieter zu gewinnen.
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des derzeitigen Flugverkehrs in Österreich. Im ersten Teil der Arbeit wird auf die unterschiedlichen Phasen der Liberalisierung des europäischen Flugverkehr eingegangen. Im Vergleich zu den USA ist die Liberalisierung und Marktöffnung in Europa relativ spät durchgeführt worden. Die Liberalisierung erfolgte nicht in einem Paket. Die Marktöffnung hat sich über mehrere Jahre hinaus gezogen und ist sehr behutsam durchgeführt worden. Die Schwierigkeit lag auch darin, einen zum Teil sehr unterschiedlichen Markt mit den unterschiedlichsten rechtlichen Bestimmungen zu vereinheitlichen.
Das Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Phänomen der Low-cost Airlines, ausgehend von der Entstehung bis zur zukünftigen Entwicklung. Betrachtet werden die Erfolgsfaktoren, die verschiedenen Strategien, die wirtschaftliche Situation sowie zukünftige Wachstumsperspektiven aber auch Risken.
Das dritte Kapitel setzt sich mit einzelnen Low-cost Anbietern auseinander. Vor allem die zwei Anbieter Ryanair und HLX werden aufgrund ihrer starken Präsenz in Österreich - einer genauen Analyse unterzogen. Im Anschluss daran […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Deregulierung und Liberalisierung im Flugverkehr
1.1. Grundlagen der Regulierung
1.2. Deregulierung des Luftverkehrs in den USA
1.3. Liberalisierung des Luftverkehrs in Europa
1.3.1. Erstes Liberalisierungspaket
1.3.2. Zweites Liberalisierungspaket
1.3.3. Drittes Liberalisierungspaket
1.4. Transatlantische Liberalisierung
1.5. Auswirkungen der Liberalisierung in Europa
2. Das Prinzip von Low-Cost Airlines
2.1. Einleitung Low-Cost Airlines
2.2. Entwicklung von Low-Cost Airlines
2.3. Southwest Airline als Vorbild der LCA
2.4. Der Durchbruch von Low-cost Airlines in Europa
2.5. Das Produkt der Low-cost Airlines
2.5.1. Tarife
2.5.2. Vertrieb
2.5.3. Service
2.5.4.Frequenzen
2.5.5. Pünktlichkeit
2.5.6. Flugroute
2.5.7. Marktauswahl
2.5.8. Marketing
2.5.9. Flugzeuge
2.5.10. Wartung der Flugzeuge
2.5.11. Personal
2.5.12. Flughäfen
2.5.13. Verwaltung
2.6. Kostenstrukturen einer Low-cost Airline
2.6.1. Anschaffungskosten
2.6.2. Betriebskosten
2.6.3. Stückkosten
2.6.4. Non-operating-Kosten
2.6.5. Kostenvergleich mit herkömmlichen Fluggesellschaften
2.7. Passagiere der Low-cost Airlines
2.7.1. Geschäftsreisende
2.7.2. Freizeitreisende
2.8. Krisen in der Luftfahrt – Low-cost Airlines profitieren
2.9. Marktanteile der europäischen Low-cost Airlines
2.10. Low-cost Airlines im Wettbewerb
2.10.1. Start- und Landerechte (Slots)
2.10.2. Bodenverkehrsdienste
2.10.3. Vielflieger-Programme
2.10.4. „Predatory Pricing“
2.10.5. Computerreservierungssysteme (CRS)
2.11. Traditionelle Fluggesellschaften versus Low-cost Airlines
2.11.1. Preisreduktionen
2.11.2. Kooperationen mit den Low-cost Airlines
2.11.3. Gründung eigener Low-cost Airlines
2.11.4. Koexistenz mit den Low-cost Airlines
2.12. Perspektiven der Low-cost Airlines
2.12.1. Herausforderungen in der Zukunft
2.12.2. Mittel- und langfristige Perspektiven
3. Low-Cost Airlines
3.1. Ryanair
3.2. Hapag-Lloyd-Express (HLX)
3.3. SkyEurope
3.4. Germanwings
3.5. EasyJet
3.6. FlyNordic
3.7. flyniki
3.8. Air Berlin
3.9. Helvetic
3.10. BMI Baby
3.11. Deutsche BA
4. Flughäfen
4.1. Definition Flughafen
4.1.1. Flugbetriebsflächen
4.1.2. Flughafenanlagen
4.1.3. Verkehrserschließung
4.2. Flughäfen Europas
4.3. Flughafen Wien Schwechat (VIE) – Vienna International Airport
4.3.1. Entstehung des Flughafens
4.3.2. Aktuelle Situation
4.3.3. Erreichbarkeit
4.3.4. Zukunftsperspektiven
4.4. Flughafen Salzburg – Wolfgang Amadeus Airport (SZG
4.4.1. Entstehung des Flughafens
4.4.2. Aktuelle Situation
4.4.3. Erreichbarkeit
4.4.4. Zukunftsperspektiven
4.5. Flughafen Graz Thalerhof (GRZ)
4.5.1. Entstehung des Flughafens
4.5.2. Aktuelle Situation
4.5.3. Erreichbarkeit
4.5.4. Zukunftsperspektiven
4.6. Flughafen Blue Danube Airport Linz (LNZ
4.6.1. Entstehung des Flughafens
4.6.2. Aktuelle Situation
4.6.3. Erreichbarkeit
4.6.4. Zukunftsperspektiven
4.7. Flughafen Innsbruck (INN)
4.7.1. Entstehung des Flughafens
4.7.2. Aktuelle Situation
4.7.3. Erreichbarkeit
4.7.4. Zukunftsperspektiven
4.8. Flughafen Alpe Adria Airport Klagenfurt (KLU)
4.8.1. Entstehung des Flughafens
4.8.2. Aktuelle Situation
4.8.3. Erreichbarkeit
4.8.4. Zukunftsperspektiven
4.9. Flughafen Bratislava (BTS)
4.10. Flughafen Ljubljana (LJU)
4.11. Flughafen Altenrhein (St. Gallen) (ACH)
5. Low-cost Airlines in Österreich
5.1. Low-cost Airlines - Flughafen Wien
5.2. Low-cost Airlines - Flughafen Salzburg
5.3. Low-cost Airlines - Flughafen Graz
5.4. Low-cost Airlines - Flughafen Linz
5.5. Low-cost Airlines - Flughafen Innsbruck
5.6. Low-cost Airlines - Flughafen Klagenfurt
5.7. Neue Low-cost Airline Verbindungen
5.8. Anhang: Auswertung Low-cost Airlines in Österreich
6. Fazit
7. Fachbegriffe
8. Abkürzungen
9. Abbildungsverzeichnis
10. Tabellenverzeichnis
11. Literaturverzeichnis
Einleitung
Mit der vollständigen Liberalisierung des Luftverkehrs in Europa Ende der neunziger Jahre ist der Luftverkehrsmarkt deutlich in Bewegung geraten. Neben den etablierten Fluggesellschaften haben sich in Europa immer mehr Low-cost Airlines durchgesetzt. Mittlerweile tragen sie einen erheblichen Teil zum wachsenden Luftverkehrsaufkommen bei und sind bei uns nicht mehr wegzudenken. Die Low-cost Airlines haben sich neben dem herkömmlichen Linienverkehr der traditionellen Fluggesellschaften und dem Charterflugverkehr als drittes Marktsegment fest verankert.
Das Modell der Low-cost Airlines wurde erfolgreich von den USA auf den europäischen Markt übernommen. War es zuerst vor allem der britische und irische Markt, auf dem sich diese neue Art des Flugverkehrs durchsetzte, konnte in den letzten Jahren eine starke Zunahme in ganz Europa festgestellt werden. Mit der Erweiterung der Europäischen Union wurden ganz neue Märkte erschlossen und fest in das jeweilige Steckennetz der betreffenden Low-cost Airlines integriert.
Hauptgewinner dieser neuen Entwicklung sind aber nicht nur die großen internationalen Flughäfen. Vor allem die regionalen Flughäfen haben die Bedeutung und die Auswirkungen der Low-cost Airlines erkannt und bemühen sich darum, Low-cost Anbieter zu gewinnen.
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen des derzeitigen Flugverkehrs in Österreich. Im ersten Teil der Arbeit wird auf die unterschiedlichen Phasen der Liberalisierung des europäischen Flugverkehr eingegangen. Im Vergleich zu den USA ist die Liberalisierung und Marktöffnung in Europa relativ spät durchgeführt worden. Die Liberalisierung erfolgte nicht in einem Paket. Die Marktöffnung hat sich über mehrere Jahre hinaus gezogen und ist sehr behutsam durchgeführt worden. Die Schwierigkeit lag auch darin, einen zum Teil sehr unterschiedlichen Markt mit den unterschiedlichsten rechtlichen Bestimmungen zu vereinheitlichen.
Das Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Phänomen der Low-cost Airlines, ausgehend von der Entstehung bis zur zukünftigen Entwicklung. Betrachtet werden die Erfolgsfaktoren, die verschiedenen Strategien, die wirtschaftliche Situation sowie zukünftige Wachstumsperspektiven aber auch Risken.
Das dritte Kapitel setzt sich mit einzelnen Low-cost Anbietern auseinander. Vor allem die zwei Anbieter Ryanair und HLX werden – aufgrund ihrer starken Präsenz in Österreich - einer genauen Analyse unterzogen. Im Anschluss daran kommt es zu einer Kurzbeschreibung weiterer europäischer Low-cost Airlines.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Flughäfen im Allgemeinen. Wesentliche Fragestellungen sind die Entstehung bzw. Entwicklung der betreffenden Flughäfen, die aktuelle wirtschaftliche Situation, die Erreichbarkeit sowie Perspektiven für die Zukunft. Auch die Flughäfen im näheren Umfeld Österreichs (Ljubljana, Bratislava, Altenrhein) werden andiskutiert.
Im abschließenden fünften Kapitel wird gezielt auf Low-cost Airlines in Österreich eingegangen. Anhand der aktuellsten Passagierzahlen der österreichischen Flughäfen im Zeitraum von 2000 bis 2004 kann sehr detailliert auf die zunehmende Bedeutung des Low-cost Verkehrs hingewiesen werden. Neben einer statistischen Auswertung (Low-cost Airlines versus Netzwerkcarrier) kommt es auch zu einer Auflistung aller aktuell bestehenden Low-cost Verbindung in Österreich.
1. Deregulierung und Liberalisierung im Flugverkehr
1.1. Grundlagen der Regulierung
Die bedeutendste Grundlage der Regulierung des internationalen Luftverkehrs wurde 1944 auf der Konferenz von Chicago festgelegt. Die Ziele waren eine grundlegende Neuorganisation des internationalen Luftverkehrs und weltweit einheitliche Regelungen für die internationale Zivilluftfahrt.
Unabhängig von ihrer Größe und Bedeutung sowie von der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit ihrer Luftfahrtunternehmen räumen sich hiernach die Vertragsstaaten gegenseitig Verkehrsrechte (Freiheiten) in bilateralen Luftverkehrsabkommen ein.[1]
Während sich die USA sehr für freie Märkte und für ein Minimum an Regulierung aussprachen, waren für europäische Staaten staatliche Fluggesellschaften („flag carrier“) ein Symbol staatlicher Souveränität und dementsprechend vertraten diese Staaten auch eine weniger liberale Auffassung.[2]
Aus diesem Grund konnte man sich lediglich auf die Gewährung der Freiheiten 1 und 2 einigen (die sogenannten „technischen Freiheiten der Luft“), während die „kommerziellen Freiheiten der Luft“ (Freiheiten 3 bis 8) in einer Vielzahl bilateraler Abkommen geregelt wurden (Freiheiten der Luft siehe Tabelle 1). Außerdem einigte man sich auf die Gründung einer internationalen Luftfahrtsbehörde (IATA – International Air Transport Association), die für die Regulierung des Luftverkehrs zuständig sein sollte.[3]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Die Freiheiten der Luft
Quelle: Tina Reiter, Die Liberalisierung des Europäischen Luftverkehrs (2004), S. 11f.
Die Liberalisierung des Luftverkehrs wurde in den USA sowie in Europa zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt. In den Vereinigten Staaten begann man mit der Liberalisierung bereits im Jahre 1978. In Europa begann die Liberalisierung zehn Jahre später. Sie dauerte über einen Zeitraum von zehn Jahren und wurde in drei Etappen durchgeführt.
1.2. Deregulierung des Luftverkehrs in den USA
Die Marktöffnung des Flugverkehrs innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika erfolgte im Jahre 1978. Die gesetzliche Grundlage dafür bildete der Airline Deregulation Act vom 24. Oktober 1978.
Die Ursachen dafür waren eine immer breiter werdende öffentliche Diskussion aufgrund verschiedenster Faktoren:
- Krise der Luftfahrtsindustrie Anfang der 70er Jahre wegen der rezessionsbedingt schwachen Nachfrage, der Ölkrise von 1973 und hoher Überkapazitäten
- hohe Konzentration im amerikanischen Luftverkehrsmarkt
- zunehmend kritische Einstellung gegenüber staatlicher Regulierung
Ziel der amerikanischen Deregulierungspolitik war die schrittweise Abschaffung der Genehmigungspflicht bezüglich Strecken und Preisen innerhalb einer Übergangszeit von vier Jahren.[4]
Da von Anfang an auch der politische Wille bestand, Wettbewerb auf den inländischen Luftverkehrsmärkten so weit als möglich ohne staatliche Eingriffe zuzulassen, vollzog sich die Deregulierung äußerst rasch. Bereits im Januar 1983 gab es keine Zutrittsschranken und Vorschriften mehr, die bislang Preise und Kapazitäten geregelt hatten.[5]
1.3. Liberalisierung des Luftverkehrs in Europa
Im Gegensatz zur amerikanischen Deregulierungspolitik wählte man in Europa einen sanfteren und vor allem langsameren Weg mit mehreren Zwischenschritten.
Diese Vorgangsweise war auch nötig, da man, im Unterschied zu den USA, wo nur eine einzige Rechtslage zu berücksichtigen war, in Europa vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und auch ideologischen Interessen gegenüberstand. In Europa wurde der Flugverkehr mit sehr vielen bilateralen Abkommen geregelt, was den Abschluss eines multilateralen Abkommens sehr schwierig gestaltete. Der erste Schritt in Richtung Liberalisierung des Flugverkehrs in Europa wurde daher mit dem Abschluss liberalerer bilateraler Abkommen gesetzt. Großbritannien kommt dabei eine Vorreiterrolle zu. Bereits 1980 hat es mit seinem „Civil Aviation Act“ den inländischen Flugverkehr dereguliert. 1984 handelte Großbritannien mit den Niederlanden ein liberales bilaterales Abkommen aus, welches einen erleichterten Marktzutritt, die Aufhebung jeglicher Kapazitäts- und Frequenzbeschränkungen sowie eine freie Preisfestsetzung, vorsah. Während bei vorhergehenden Verträgen nur eine nationale Luftverkehrsgesellschaft die Destination bedienen durfte, war es nun für alle Fluglinien Großbritanniens und der Niederlande möglich, beliebige Strecken des anderen Landes anzufliegen.[6]
Als Folge dieses Abkommens kam es zu Preisreduktionen zwischen Großbritannien und den Niederlanden, welche wiederum andere europäische Länder dazu veranlassten, mit Großbritannien ebenfalls neue Verträge auszuhandeln. Zu diesen Ländern zählten Belgien, Luxemburg, Irland, Frankreich, Schweiz und Deutschland. Da aber die restlichen Länder nicht bereit waren, an diesen Liberalisierungsbestrebungen teilzunehmen, wurde in der europäischen Union an einem multilateralen Abkommen gearbeitet.[7]
Die Liberalisierung des europäischen Flugverkehrs erfolgte in drei aufeinander folgenden Liberalisierungspaketen. Der Liberalisierungsprozess kann folglich als „Evolution“ angesehen werden. Ziel der schrittweisen Marktöffnung war eine Überwindung des komplexen Systems bilateraler und internationaler Regelungen.[8]
1.3.1. Erstes Liberalisierungspaket
Die erste Stufe der Liberalisierung des Linienverkehrs der Europäischen Union trat am 01. Jänner 1988 in Kraft. Der Europäische Ministerrat verabschiedete eine Richtlinie über Tarife[9], eine Entscheidung über die Kapazitäten im Fluglinienverkehr[10] sowie eine Verordnung über die Anwendung von Wettbewerbsregeln.[11]
Erstmals in der Europäischen Luftfahrt wurde damit innergemeinschaftlicher Luftverkehr abseits von bilateralen Abkommen möglich. Im Zusammenhang mit der Richtlinie über Tarife wurde ein System von Zonen eingeführt, das innerhalb einer bestimmten Bandbreite Sonderflugpreise erlaubte, die allerdings an bestimmte Bedingungen wie Reisedauer und Vorausbuchung gebunden waren. Im Bezug auf die Entscheidung der Kommission über die Kapazitäten durften erstmals ab einem bestimmten Passagieraufkommen mehrere Fluggesellschaften eine Strecke bedienen.[12]
Insgesamt war das erste Liberalisierungspaket ein sehr behutsamer Schritt in Richtung eines europäischen Luftverkehrmarktes.
1.3.2. Zweites Liberalisierungspaket
Im Juli 1990 verabschiedete der Europäische Ministerrat das zweite luftverkehrspolitische Maßnahmenbündel, welches den eingeleiteten Liberalisierungsprozess fortsetzte. Durch die erlassenen Verordnungen wurden die Maßnahmen des ersten Liberalisierungspaketes aufgehoben und durch weitergehende Bestimmungen ersetzt.[13]
Wesentliche Liberalisierungen ergaben sich beim Marktzugang. Mit der Freigabe des Marktzugangs auf den innergemeinschaftlichen Strecken erhielten die EU-Fluggesellschaften erstmals Zugang zu allen internationalen Gemeinschaftsflughäfen, ohne auf ein bilaterales Abkommen und die dort ausgehandelten strikten Festlegungen angewiesen zu sein.[14]
Ab Jänner 1993 durften die Fluggesellschaften keine Kapazitätsvereinbarungen mehr treffen und den Fluggesellschaften wurde ein größerer Handlungsspielraum bei der Preisfestsetzung gewährt.[15]
1.3.3. Drittes Liberalisierungspaket
Mit der Einführung des gemeinsamen Binnenmarktes am 01. Januar 1993 wurde das dritte Liberalisierungspaket des Fluglinienverkehrs wirksam. Dieses galt nicht nur wie die beiden vorherigen Pakete für den Linienflugverkehr, sondern auch für den Gelegenheitsflugverkehr (Charter).[16]
Es wurden Regelungen geschaffen, deren Auswirkungen auf den Wettbewerb im europäischen Luftverkehr wesentlich stärker waren, als die der ersten beiden Maßnahmenpakete, bzw. die den Wettbewerb sogar erst ermöglichten.[17]
Durch dieses Liberalisierungspaket wurde ein gemeinschaftsweit einheitliches Betriebsgenehmigungsverfahren eingeführt. Seitdem wird allen in der Europäischen Union registrierten Luftverkehrsgesellschaften das Recht gewährt, Tochtergesellschaften innerhalb der EU zu gründen bzw. bestehende Unternehmen mehrheitlich zu erwerben. Durch die neue Marktzugangsverordnung des dritten Pakets erhielten die Fluggesellschaften einen freieren Zugang zu den innergemeinschaftlichen Strecken, da fast alle existierenden Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben wurden. Darüber hinaus wurden die Tarifzonen für die Preisgestaltung abgeschafft. Die Luftverkehrsunternehmen konnten nun die Flugpreise nach ausschließlich kommerziellen Gesichtspunkten festlegen.[18]
Aber auch mit dem dritten Liberalisierungspaket wurde keine vollständige Liberalisierung des Marktes in Europa erreicht. Bis zum Jahre 1997 blieb das Recht auf die Binnenkabotage (Unter Kabotage versteht man das Recht einer Fluglinie aus dem Land „A“ Inlandsflüge im Land „B“ durchzuführen) aufrecht. Erst im April 1997 erfolgte die Freigabe der Kabotage. Dies war der letzte Schritt zu einer ganzheitlich liberalen Marktordnung in Europa. Von nun an war es allen Fluglinien innerhalb der Europäischen Union erlaubt, auch Inlandsflüge in anderen Mitgliedsstaaten durchzuführen.
Heute ist der europäische Luftverkehr zwischen den EU-Mitgliedsstaaten sowie mit den Ländern Norwegen und Island vollständig liberalisiert. Jede europäische Fluggesellschaft kann daher innerhalb der Union in jedem beliebigen Land zu eigenen Konditionen Flüge durchführen. Die jeweiligen Regierungen können lediglich Beschränkungen bezüglich Umweltbedingungen, Infrastrukturknappheit oder technische Mindeststandards der Flugzeuge auferlegen.[19]
1.4. Transatlantische Liberalisierung
Die weitgehende Liberalisierung des Luftverkehrs beschränkt sich aber bis heute auf die Europäische Union und die USA. Der Flugverkehr zwischen diesen beiden Gebieten und auch mit anderen Drittländern wird weiterhin durch restriktive bilaterale Abkommen geregelt. Dabei muss aber festgehalten werden, dass die USA mit mehreren EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Österreich, seit 1992 liberale „Open Sky“ - Abkommen abgeschlossen hat, die ebenfalls den freien Marktzutritt sowie eine freie Preisfestsetzung ermöglichen sollen.[20]
1.5. Auswirkungen der Liberalisierung in Europa
Verursacht durch die Liberalisierung konnten in den vergangenen Jahren massive Veränderungen des Luftverkehrsmarktes festgestellt werden. Die Maßnahmen des dritten Liberalisierungspaketes haben sich verstärkt auf den innergemeinschaftlichen Luftverkehrsmarkt ausgewirkt. Im Oktober 1996 wurde von der Europäischen Kommission die „Auswirkungen des dritten Pakets von Maßnahmen zur Liberalisierung des Luftverkehrs“ veröffentlicht. Basierend auf diesen Bericht konnten folgende Auswirkungen festgestellt werden:
- Zunahme des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs allgemein
- Ausweitung des Angebots an Flugdiensten mit kleineren Flugzeugen durch kleinere und mittlere Luftfahrtsunternehmen
- stärkere Nutzung der neu eingeführten Freiheiten der Luft
- Erhöhung des Anteils der Strecken mit zwei Wettbewerbern
- in den meisten Mitgliedsstaaten eine Verringerung des Abstands zwischen dem führenden Luftfahrtsunternehmen und seinem wichtigsten Wettbewerber.[21]
Die Liberalisierung und der damit verbundene Preiswettbewerb zwischen den europäischen Airlines führten zu einem Preisverfall und zu verstärkten Neugründungen von Fluggesellschaften (zwischen 1993 und 1997 wurden 80 neue Airlines gegründet).
Mit steigender Wichtigkeit kommerzieller Interessen besteht allerdings die Gefahr, dass Routen mit geringer Nachfrage mittelfristig nicht mehr bedient werden, sofern es sich nicht um subventionierte Flugstrecken handelt. Resultierend aus der Liberalisierung des Luftverkehrsmarktes können im Wesentlichen zwei neue Strategien beobachtet werden:
- der Knotenpunktbetrieb zur Verdichtung von Verkehrsströmen und Verbesserung des Auslastungsgrades von Flugzeugen sowie
- die Entstehung von Low-cost Airlines.[22]
2. Das Prinzip von Low-Cost Airlines
2.1. Einleitung Low-Cost Airlines
„Low-Cost“ oder „No-frills“-Airlines (umgangssprachlich werden sie auch Billiganbieter, Billigflieger oder Diskontcarrier genannt), unterscheiden sich wesentlich von herkömmlichen Fluggesellschaften. Als Low-Cost Airlines bezeichnet man Fluggesellschaften, welche mit niedrigen Tarifen in Kombination mit einem auf die reine Transportleistung reduzierten Serviceangebot am Markt operieren.[23]
Prinzipiell kann zwischen zwei verschiedenen Arten der Umsetzung des Low-cost Konzeptes unterschieden werden.
a) Neugründung einer Fluggesellschaft
b) Tochterunternehmen bereits bestehender Fluggesellschaften
Ad a) neu gegründete Low-cost Airlines sind die Ryanair sowie Easyjet
Ad b) renommierte Fluggesellschaften gründen Tochterunternehmen, die mit der Low-cost Strategie ins Rennen geschickt werden.
Beispiele dafür: KLM mit Buzz (mittlerweile von der Ryanair übernommen), British Airways mit Go (Go wurde mittlerweile von Easyjet aufgekauft), Lufthansa mit der Germanwings oder Britisch Midland mit BMI Baby.[24]
2.2. Entwicklung von Low-Cost Airlines
Die Strategie, mit Hilfe von günstigen Flugticketpreisen die etablierten Fluggesellschaften zu stören, gab es schon relativ früh. Als die erste Billigfluglinie in Europa kann die Laker Airways bezeichnet werden, welche im Jahre 1972 in Großbritannien gegründet wurde. Der Flugbetrieb konnte aber erst im Jahre 1977 aufgenommen werden, da es keine Verkehrsrechte für die Strecke zwischen London und New York gab.
Weitere Fluglinien, die transatlantische Flüge im Niedrigpreissegment anboten, waren die Fluggesellschaften Braniff (1979), Virgin Atlantic und People Express (1983). Aber bereits Mitte der achtziger Jahre beendeten mit Ausnahme der Virgin Atlantic die genannten Fluglinien den Flugbetrieb. Virgin Atlantic stieg zum „Qualitätscarrier“ auf. Obwohl die Niedrigpreisstrategie nicht so erfolgreich war, hinterließ dieser Versuch dennoch nachhaltige Spuren in der Luftfahrtbranche, denn die etablierten Fluglinien reagierten mit stark reduzierten Sondertarifen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten.
Die erste Low-cost Airline, die erfolgreich das Konzept der Kostenführerschaft umgesetzt hat, war die Southwest Airline in den USA in den späten siebziger Jahren. In Europa gab es hingegen kaum nennenswerte Gründungen von Billigfluglinien (LCC – Low-cost carrier).[25]
Mit einer zeitlichen Verzögerung gegenüber den USA ist erst seit Mitte der neunziger Jahre auch in Europa ein verstärktes Eintreten von Low-cost Airlines am europäischen Markt zu verzeichnen.[26]
2.3. Southwest Airline als Vorbild der LCA
Southwest Airline (SWA) ist eine Low-cost Airline in Texas, USA. Die SWA hält in den Vereinigten Staaten einen Marktanteil von 90% im Billigflugsegment und ist dadurch der unumstrittene Marktführer. Die SWA war nicht die einzige Fluglinie, die sich Anfang der siebziger Jahre mit dem Konzept eines Low-cost Anbieters versuchte (siehe Kapitel 2.2). Die europäischen LCA scheiterten aber bereits nach wenigen Jahren. Die SWA verfolgte dieselbe Strategie, aber anders als die Laker Airways oder die People Express hatte man damit einen großen Erfolg.
Heute hat SWA mit über 350 Flugzeugen ein Streckennetz über die ganze USA gelegt und ist an den Passagierzahlen gemessen, die viertgrößte Fluggesellschaft der USA. Mit den 32.000 Mitarbeitern bedient SWA 58 Städte in 29 amerikanischen Bundesstaaten. Täglich werden 2700 Flüge durchgeführt.[27]
Das erstaunliche an der SWA ist aber nicht nur deren Größe sondern auch die wirtschaftliche Leistung. Während des mittlerweile 30-jährigen Bestehens der Airline konnte mit Ausnahme der ersten zwei Jahre immer eine positive Bilanz gezogen werden. Damit ist SWA aber auch die einzige Fluggesellschaft, die während der wirtschaftlich schwierigen Zeit Anfang der 90er Jahre Gewinne schreiben konnte.[28] Auch die Terroranschläge im Jahre 2001 in New York konnten der SWA nichts anhaben. Abermals wurden satte Gewinne erzielt.[29]
Gegründet wurde die SWA bereits im Jahre 1967 durch den Geschäftsmann Rollin King und dem Anwalt Herb Kelleher. Die ansässigen Fluglinien Braniff und Texas International versuchten aber damals den Eintritt einer weiteren Fluglinie gerichtlich zu verhindern und aus diesem Grunde konnte die SWA erst mit 4-jähriger Verzögerung den Flugbetrieb aufnehmen. Als Reaktion auf den Markteintritt von SWA begannen die ansässigen Fluglinien mit einem Preiskrieg, der die SWA vom Markt verdrängen sollte. Doch während beide Mitbewerber später scheiterten, konnte sich die SWA mit der Low-cost Strategie am Markt behaupten.[30]
SWA begann den Flugbetrieb im Jahre 1971 mit drei Boeing 737-200. Vom Hauptsitz der Fluggesellschaft, dem Flughafen Dallas Love Field, wurden günstige Flüge auf drei Strecken zwischen Dallas, Houston und San Antonio, angeboten. Erst nach der Deregulierung der amerikanischen Zivilluftfahrt begann man Flüge auch in andere amerikanische Bundesstaaten anzubieten.[31]
Der Business-Plan von SWA sieht Folgendes vor: es gibt nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf Kurzstrecken. Angeflogen werden, bis auf wenige Ausnahmen, nur Nebenflughäfen (Sekundär- bzw. Regionalflughäfen). Auf diesen Flughäfen müssen Turn-around Zeiten von 15 bis 20 Minuten eingehalten werden. Die Flotte der SWA besteht ausschließlich aus Boeings 737 in vier verschiedenen Modellen. Den Passagieren bietet SWA keine Bordmenüs, angeboten werden nur Käsekräcker oder Erdnusspäckchen sowie Getränke wie Kaffee oder Fruchtsäfte. Teure alkoholische Getränke können an Bord käuflich erworben werden.
Trotz der heutigen Größe von SWA hat man eine Expansion des Streckennetzes nur sehr langsam und sehr bedacht vorangetrieben. Seit 1994 wurden nur 17 neue Strecken ins Programm aufgenommen. Bei der Auswahl der Strecke wurde darauf geachtet, dass man entweder der einzige Anbieter auf der Strecke war, oder dass relativ rasch eine dominierende Marktstellung erreicht werden konnte. Diese Marktdominanz erreichte die SWA vor allem durch niedrige Preise, aber auch durch hohe Frequenzen und einer großen Pünktlichkeit. Der Erfolg der SWA lässt sich zum Teil auch auf die hohe Produktivität der Mitarbeiter, welche gut bezahlt werden, zurückführen.[32]
2.4. Der Durchbruch von Low-cost Airlines in Europa
In Europa gab es zwar bereits Ende der achtziger Jahre mehrere Versuche, Low-cost Airlines mit einer kostengünstigen Struktur anzubieten und damit mit den renommierten Fluglinien wie zB. der Lufthansa zu konkurrieren (zB. Aero Lloyd, Germanwings, German Air). Diese Versuche scheiterten aber zunächst. Erst die konsequente Entwicklung der Niedrigpreis-Strategie durch die irische Ryanair, der britischen Easyjet und der belgischen Virgin Express verhalfen zum Durchbruch am europäischen Luftverkehrsmarkt. Eine wesentliche Voraussetzung zur Etablierung von Low-cost Airlines in Europa war die Liberalisierung des europäischen Luftverkehrsmarktes und der damit verbundenen Niederlassungsfreiheit. Waren es im Jahre 1994 noch weniger als 3 Millionen Passagiere, die in Europa mit den neuen Low-cost Anbietern geflogen sind, so ist die Passagierzahl im Jahre 1999 bereits auf 17,5 Millionen gestiegen.[33]
Die in Europa neu etablierten Low-cost Anbieter wachsen sehr rasch. Die herkömmlichen Fluggesellschaften hofften generell, dass die Billiganbieter es in Europa nicht schaffen würden, da die Flughafengebühren und Überfluggebühren in Europa etwa um dreißig bis vierzig Prozent höher liegen als in den USA und dadurch der Spielraum für Preisreduktionen sehr gering ist. Doch die Prognosen der nationalen Fluggesellschaften haben sich nicht bestätigt. Der Marktanteil der Low-Cost Airlines wird von Jahr zu Jahr größer.[34]
Die erste Low-cost Airline, die Österreich bediente, war Mitte der neunziger Jahre die Euro-Belgian Airline (EBA). Die EBA war die erste Low-cost Airline in Kontinentaleuropa. 1996 wurde sie an die Virgin Gruppe verkauft. Die damalige EBA bediente die Strecke Brüssel – Wien - Brüssel.[35]
2.5. Das Produkt der Low-cost Airlines
Low-cost Airlines bieten in regional begrenzten Märkten günstige Kurzstreckenverbindungen mit eingeschränktem Service an. Es werden ausschließlich Direktflüge (Punkt zu Punkt Verbindungen) angeboten. Damit bleibt der mögliche Umsteigeverkehr ausgeschlossen.[36] Anders als traditionelle Fluggesellschaften, die heute meistens als Mitglied einer Flugallianz ein weltweites Streckennetz anbieten, konzentrieren sich Low-cost Airlines auf Strecken mit einem hohem Passagieraufkommen und bedienen diese Strecken mit besonders hohen Frequenzen. Die durchschnittliche Streckenlänge ist geringer als bei traditionellen Fluglinien oder bei Charterfluggesellschaften und liegt unter 1000 km.[37]
Nicht vorgenommen werden Sitzplatzreservierungen. Der Hauptanziehungspunkt der Low-cost Airlines sind deutlich günstigere Flugpreise gegenüber herkömmlichen Fluglinien. Durch die günstigen Flugtickets wird nicht nur die Nachfrage von den Wettbewerbern abgezogen, sondern sie erschließen auch ganz neue Kundenpotenziale.[38]
Die Strategie der Low-cost Anbieter zielt darauf ab, die Kosten so gering wie möglich zu halten, um günstigere Flugpreise als die herkömmlichen Fluggesellschaften anbieten zu können. Den Low-cost Airlines gelingt es geringe Kosten zu erzielen, indem sie sich gänzlich auf das Kernprodukt – nämlich den Flug - konzentrieren und alle Nebenprodukte eines Fluges weglassen.[39]
Bei den Low-cost Airlines gibt es daher:
- keine kostenlose Bordverpflegung
- keine Gratiszeitungen oder Unterhaltung an Bord
- keine Tickets
- keine Klassenunterteilung (Business, Economy)
- freie Platzwahl an Bord
- Umbuchungs- und Rücktrittsmöglichkeiten nur gegen einen Aufpreis
- einheitliche Flotten
- dichte Bestuhlung im Flugzeug
- längere tägliche Flugzeugbenützung
- angeflogen werden Regional- und Nebenflughäfen
- Direktvertrieb der Tickets über das Internet oder eigene Call-Center
- Outsourcing vieler Bereiche wie Instandhaltung, Check-In usw.
- geringe Lohnkosten durch nicht gewerkschaftlich organisiertes Personal
- leistungsbezogene Entlohnung
- kein Umsteigeverkehr[40]
Trotz der leicht abweichenden Strategien unter den Low-cost Anbietern kann man einige gemeinsame Merkmale zusammenfassen. Alle Low-cost Airlines bieten:
- günstigen Linienverkehr
- ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
- Flüge nur auf Kurzstrecken
- eine häufige Flugfrequenz[41]
Anhand der folgenden Faktoren kann erklärt werden, worin sich die Kosten pro Passagier der Low-cost Airlines gegenüber traditionellen Fluggesellschaften unterscheiden können.
- Tarife
- Vertrieb
- Service
- Flugfrequenzen
- Pünktlichkeit
- Flugroute
- Marktauswahl
- Marketing
- Flugzeuge
- Wartung der Flugzeuge
- Personal
- Flughäfen
- Verwaltung
2.5.1. Tarife
Um eine einfache Preisstruktur zu gewährleisten, bieten die meisten Low-cost Airlines oneway-Tickets ohne Beschränkungen an. Da die regulären Preise ohnedies weit unter den Preisen von herkömmlichen Fluglinien liegen, besteht keine Notwendigkeit, spezielle Tarife mit besonderen Beschränkungen anzubieten. Dies führt zu einer Reduktion der administrativen Kosten. Erwähnt werden muss aber, dass die Low-cost Airlines nur einen geringen Teil ihrer Sitzplatzkontingente zum niedrigsten Preis anbieten. Für jeden Flug gibt es daher unterschiedliche Preise, welche von der jeweiligen Auslastung des Fluges abhängen. Je höher die Auslastung des Fluges, desto höher die Preise. Dies führt dazu, dass die Kunden ihre Flüge schon relativ früh buchen, um in den Genuss von billigen Tickets zu gelangen. Zu erwähnen ist noch, dass die Preise mit dem Zeitablauf eher steigen, aber im Falle von vielen Stornierungen bzw. Sonderangeboten auch wieder sinken können. Zu Marketingzwecken werden sehr oft Tickets besonders günstig bzw. sogar gratis angeboten. Vom Kunden sind dann nur mehr die Flughafen- und Sicherheitsgebühren sowie der Kerosinzuschlag zu entrichten.[42]
2.5.2. Vertrieb
Die Kosten für den Vertrieb halten die Low-cost Airlines sehr niedrig. Der Verkauf von Flugtickets wird von den Low-cost Anbietern direkt über das Internet oder auch über Call-Center angeboten. Die Bezahlung erfolgt mittels einer Kreditkarte. In seltenen Fällen (zB. bei der HLX – siehe Kapitel 3.2.) ist auch ein Bankeinzugsverfahren möglich. Einige Low-cost Airlines (zB. die Ryanair – siehe Kapitel 3.1.) verrechnen einen geringen Aufschlag bei einer Bezahlung mit einer Kreditkarte.
Mit Hilfe des direkten Vertriebs ersparen sich die Low-cost Airlines den teuren Anschluss an das Computerreservierungssystem (CRS). Der Verkauf von Tickets in Reisebüros findet relativ selten statt. Jedoch bieten mittlerweile auch Reisebüros Flugtickets von Low-cost Airlines an, um die Kundenabwanderung zu Internetbuchungen einzudämmen.[43]
Die meisten Low-cost Airlines stellen keine herkömmlichen Papiertickets aus, sondern ermöglichen das Einchecken mit der Vorlage der Buchungsbestätigung und eines amtlichen Lichtbildausweises. Dabei werden an die Passagiere Nummernkarten ausgegeben.[44]
2.5.3. Service
Im Gegensatz zu traditionellen Fluglinien bieten die Low-cost Airlines nur eingeschränkte Serviceleistungen für ihre Passagiere an. Es gibt nur ein herkömmliches Check-In am Schalter, Check-In über das Internet oder über einen Automaten wird nicht angeboten. In den Flugzeugen selbst gibt es keine nummerierten Sitze. Dadurch wird der Einsteigevorgang erheblich erleichtert. Ein weiterer positiver Aspekt ist der, dass sich die Passagiere frühzeitig zum Abflug einfinden, damit sie sich einen guten Sitzplatz sichern können.[45]
Die Low-cost Airlines bieten auf ihren Flügen kein kostenloses Essensservice an. Die Passagiere müssen für Imbisse separat zahlen. Die Imbisse und Erfrischungen stellen daher eine zusätzliche Einnahmequelle dar. Auf zusätzliches Kundenservice wie Flughafenlounges und kostenintensive Vielflieger- bzw. Bonusprogramme wird verzichtet.[46]
Ein weiterer Unterschied zu herkömmlichen Fluglinien besteht auch darin, dass es bei den Low-cost Airlines keine Klassenunterteilung in Business und Economy gibt. Dadurch fallen auch die verschiedenen Beförderungsklassen des Gepäcks weg.
2.5.4.Frequenzen
Ein wichtiges Merkmal von Low-cost Airlines sind hohe Frequenzen mit denen eine Route beflogen wird. Diese Strategie hat sich aber (im Vergleich zu SWA in den USA) in Europa bisher kaum durchgesetzt. Einzige Ausnahme sind die Verbindungen nach London.[47]
2.5.5. Pünktlichkeit
Durch einen effizienten Einsatz in der Flugzeugabfertigung und durch die Nutzung weniger ausgelasteter Flughäfen weisen die Low-cost Airlines eine sehr gute Pünktlichkeitsstatistik auf. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Fluggesellschaften müssen die Low-cost Anbieter nicht auf Anschlusspassagiere warten.[48]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Pünktlichkeit der Fluggesellschaften
*Flüge, welche innerhalb von 15 Minuten des Flugplanes landen
Quelle: URL: http:// www.ryanair.com [49]
2.5.6. Flugroute
Bei den Flugrouten bieten die Low-cost Airlines nur Flüge von A nach B an. Dieser Punkt zu Punkt Verkehr bedient die europäischen Wirtschaftszentren und Strecken mit hohem Anteil an touristischem Verkehr. Meistens herrscht auf diesen Strecken schon ein hohes Verkehrsaufkommen bzw. kann es durch die Low-cost Airlines erhöht werden. Die Verbindung dieser Zentren erfolgt aber nicht über einen Hub (Drehscheibe im Flugverkehr), sondern über so genannte Sekundärflughäfen. Diese Flughäfen werden wenig bis überhaupt nicht von den traditionellen Fluggesellschaften angeflogen.[50]
Auf die Möglichkeit des Interlining (Wechsel der Fluggesellschaft mit dem gleichen Ticket) wird vollkommen verzichtet. Vielmehr entsteht eine Art „Trough-Check-In“. Damit meint man ein Aus- und Wiedereinquecken im Falle eines Weiterfluges. Auf diese Art und Weise können die Low-cost Anbieter ihre Kosten stark reduzieren.
Die Streckenverbindungen der Low-cost Airlines konzentrieren sich fast ausschließlich auf Kurzstrecken in West- und Zentraleuropa. Für einen Flug nach Osteuropa (sofern der Staat kein EU-Mitglied ist) ist die Zustimmung der jeweiligen Regierung notwendig. Die Auswahl der Flugstrecke bestimmen folgende Kriterien:
- derzeitige Wettbewerbsintensität auf der Strecke
- gibt es alternative Transportmittel
- als Drehkreuz für den Umsteigeverkehr nutzbar
- vergangene Passagierzahlen
- Bodenservice
- Slot-Verfügbarkeit
Entschließt sich eine Low-cost Airline zum Markteintritt, dann wird dieser zu Beginn äußerst aggressiv mit zwei bis drei Verbindungen pro Tag durchgeführt. Hohe Frequenzen sind vor allem bei Geschäftsreisenden von großer Bedeutung. Die für Urlaubsreisende interessanten Strecken in die Urlaubsregionen Südeuropas werden dagegen nur ein- bis zweimal in der Woche angeboten.[51]
2.5.7. Marktauswahl
Wie unter Punkt 2.5.6. schon erwähnt, werden von den Low-cost Airlines nur Punkt zu Punkt Verbindungen angeboten. Dies vorwiegend auf Strecken, auf denen sowohl auf der Abflugs- als auch auf der Ankunftsdestination eine relativ hohe Nachfrage herrscht.
Bei der Marktauswahl geht man vor allem auch auf die Bedürfnisse von Freizeitreisenden ein. Angeflogen werden wenig bediente Destinationen. Dies hat auch positive Auswirkungen auf die touristische Entwicklung dieser Gebiete.[52]
Eine weitere Strategie ist es, in Konkurrenz mit den renommierten Fluggesellschaften zu treten, und Strecken zu befliegen, welche durch hohe Preise bekannt sind (zB. London – Paris oder London – Rom). Hier tritt man als sinnvolle Alternative gegenüber den herkömmlichen Fluggesellschaften auf. Die Flüge werden vorwiegend als Tagesrandverbindungen außerhalb der Hauptgeschäftszeiten durchgeführt.
2.5.8. Marketing
Für zahlreiche Low-cost Airlines ist der Aufbau eines starken Markenimages von großer Bedeutung. Die Anbieter Ryanair, HLX, Germanwings oder EasyJet haben große Anstrengungen unternommen, eine Marke aufzubauen.
Abgesehen von traditionellen Werbemaßnahmen bieten viele Low-cost Anbieter einen beschränkten Anteil ihrer Tickets zu einem symbolischen Preis von 1 Cent an. Dazu gezahlt werden müssen vom Kunden nur mehr die Flughafen- und Sicherheitsgebühren sowie der Kerosinzuschlag und etwaige Steuern. Solche Werbemaßnahmen werden vor allem in den nachfrageschwachen Monaten forciert, um zusätzliche Sitzplätze zu verkaufen.[53]
Eine häufig genutzte Marketingmaßnahme ist die Vermarktung einer wenig bekannten Zieldestination unter den Namen der nächstgelegenen größeren Stadt. Die Ryanair zB. bietet folgende Flüge an:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: angeflogene Flugdestinationen
Quelle: URL: http:// www.ryanair.com
2.5.9. Flugzeuge
Der mit Abstand kostenintensivste Bereich der Low-cost Airlines sind die Flugzeuge. Aus diesem Grund ist eine effiziente Nutzung unbedingt erforderlich. Die Flugzeuge sind meistens nur geleast. Verwendet werden einheitliche Flugzeugtypen. Das am meisten verwendete Flugzeug ist die Boeing 737 in unterschiedlichen Ausführungen. Aber auch der europäische Konkurrent Airbus hat in den vergangen Jahren beachtliche Marktanteile auf diesem Sektor dazu gewinnen können[54].
Durch den Einsatz eines einheitlichen Flugzeugtyps können die Kosten beim Personal (Pilot, Techniker) und bei den Instandhaltungsdiensten (Ersatzteile, Wartung) im Gegensatz zu den renommierten Fluggesellschaften gering gehalten werden. Durch die dichtere Bestuhlung (damit meint man eine Verringerung der Sitzbreite und des Sitzabstandes) wird die Passagierkapazität erhöht und damit die Kosten pro Sitzplatz gesenkt. Bei den Bodenstandzeiten wird durch schnelleres Boarding aufgrund freier Sitzplatzwahl und durch geringeren Zeitverlust bei der Ladung von Fracht und Catering enorm Zeit gewonnen.[55]
Durch die Nutzung von Sekundärflughäfen kommt es zu keinen Knappheiten am Boden. Die Aufenthaltszeiten am Boden werden relativ knapp gehalten. Auch das Warten auf Anschlussflüge entfällt.[56]
Die Nutzungsdauer der Flugzeuge pro Tag liegt bei den Low-cost Anbietern im Durchschnitt bei etwa 12 Stunden. Bei effizienten traditionellen Airlines sind die Flugzeuge im Durchschnitt bis zu neun Stunden im Einsatz.[57] Zu erwähnen ist noch, dass die Flugzeuge über Nacht auf ihren „Heimflughäfen“ abgestellt werden, um weitere Kosten zu sparen.[58]
2.5.10. Wartung der Flugzeuge
Die Wartung der Flugzeuge wird meist an einen externen, dafür spezialisierten Betrieb ausgelagert (Outsourcing). Diese Unternehmen produzieren die Technikleistungen wesentlich kostengünstiger als die Low-cost Airlines selbst.[59]
2.5.11. Personal
Die größten europäischen Low-cost Anbieter haben ihre Zentralen in Großbritannien oder in Irland. In diesen Ländern herrscht generell ein niedrigeres Lohnniveau. Hier haben die Anbieter einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Besonders die Löhne für Piloten sind um fast ein Drittel niedriger als zB. in Deutschland bei der Lufthansa.[60]
Ein hoher Kostenfaktor ist der Personalbereich für eine Fluglinie aber allemal. Dies ist auch bei den Low-cost Airlines so. Es gilt aber, diesen Kostenbereich so niedrig wie möglich zu halten. Zur Kostensenkung bieten sich folgende Möglichkeiten an:
- geringeres Gehaltsniveau bei längerer Arbeitszeit
- Einsatz junger Crews mit niedrigen Einstiegsgehältern
- Einsatz von Personal aus Ländern mit niedrigem Lohnniveau
- Vermeidung gewerkschaftlicher Organisation des Flugpersonals
- Ausschöpfung der Crewarbeitszeiten bis an die Grenze der gesetzlichen Möglichkeiten
- Vermeidung freiwilliger sozialer Leistungen
- Fliegen mit einer Minimum-Crew, d.h. mit möglichst niedriger, lediglich den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprechender Anzahl an Flugbegleitern
- Reduktion der Crew-Reisekosten durch dezentrale Einsatzstellen[61]
2.5.12. Flughäfen
Angeflogen werden vorwiegend Sekundärflughäfen, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Aber auch Primärflughäfen werden mittlerweile im Punkt zu Punkt Verkehr angeflogen (zB. durch die HLX, Germanwings oder Flyniki). Bei den Sekundärflughäfen müssen geringere Kosten für die Start- und Landegebühren sowie für die Bodenabfertigung aufgewendet werden. Aus Kundensicht bringt dieser Umstand Vorteile wie zB. geringere Parkgebühren, kürzere Wege zum Flughafen, weniger Passagieraufkommen und somit eine schnellere Abwicklung am Check-In Schalter. Ein zusätzlicher Vorteil der Sekundärflughäfen besteht darin, dass es zumeist Verbindungen zu äußerst attraktiven Tagesflugzeiten (für Geschäftsreisende morgens und abends) gibt.[62]
In den letzten Jahren hat sich ein rasanter Wettbewerb unter den Flughäfen als Zieldestination einer Low-cost Airline entwickelt. Immer wieder scheinen in den Medien Gerüchte über illegale Preisreduktionen oder Subventionen für die Anbieter auf.[63]
2.5.13. Verwaltung
In der Verwaltung herrscht das Konzept der schlanken Strukturen. Die Low-cost Airlines konzentrieren sich auf die Kernkompetenzen ihres Geschäfts. Alle nicht strategisch relevanten Tätigkeiten werden an Spezialisten ausgelagert, bzw. extern zugekauft.[64]
2.6. Kostenstrukturen einer Low-cost Airline
Studien verdeutlichen, dass Passagiere bereit sind auf besseres Service zu verzichten, damit sie beim Flugpreis deutlich sparen können. Der Ticketpreis einer Low-cost Airline muss um die Hälfte billiger sein als bei herkömmlichen Fluggesellschaften, damit Passagiere diese auch nutzen.
Nachdem aber die traditionellen Fluggesellschaften oft ohne Profite wirtschaften, stellt sich die Frage, wie die Low-cost Airlines Preiserwartungen entsprechen und trotzdem Profite erwirtschaften.[65]
2.6.1. Anschaffungskosten
Die Anschaffungskosten eines Flugzeuges sind sehr hoch. Während es in den letzten 30 Jahren bei den Ticketpreisen zu starken Preissenkungen gekommen ist, war bei den Flugzeugpreisen der umgekehrte Effekt bemerkbar.[66]
Der Markt für Linienflugzeuge wird von den beiden großen Anbietern Airbus und Boeing dominiert. Low-cost Airlines nutzen meist nur einen Flugzeugtyp, wobei die Boeing 737 wegen ihrer niedrigen Betriebskosten auf den von den Low-cost Anbietern bedienten Kurzstrecken (Kurzstrecken haben eine Länge zwischen 800 und 1000 km) besonders geeignet ist. Durch die Verwendung eines einheitlichen Flugzeugtyps können die Anbieter Einsparungen bei den direkten Betriebskosten erzielen.[67]
Der Kaufpreis einer Boeing 737 mit ca. 130 Sitzplätzen liegt bei etwa 36 Millionen Euro. Der tatsächliche Kaufpreis wird jedoch zwischen den Flugzeugherstellern und den Fluglinien individuell ausgehandelt. Da sich die Flugzeughersteller international in einer Krise befinden, kann angenommen werden, dass Low-cost Airlines beachtliche Rabatte bei den großen Flugzeugherstellern aushandeln konnten.[68]
2.6.2. Betriebskosten
Die Betriebskosten einer Fluggesellschaft werden, wie in den meisten Branchen, in direkte und indirekte Kosten eingeteilt.[69]
Die direkten Betriebskosten einer Fluggesellschaft, wie etwa Instandhaltung, Gehälter der Flugbesatzung, Treibstoff, und Abschreibung können dem einzelnen Flugzeug und Flug zugeordnet werden. Die indirekten Betriebskosten sind pro Flug gleich, da diese Kosten im Zusammenhang mit den Passagieren und nicht mit dem eingesetzten Fluggerät stehen. Dazu zählen Kosten des Vertriebes (Flughafen- und Bodenkosten), Verkauf und Ausstellung von Tickets sowie die Verwaltungskosten.[70]
Grob gerechnet können die indirekten und direkten Betriebskosten im Verhältnis 50:50 aufgeteilt werden. Von Fluglinie zu Fluglinie kann dieses Verhältnis allerdings variieren.[71]
2.6.3. Stückkosten
Die Kosten einer Fluggesellschaft werden meist in „cents per available seat mile“ (ASM) oder „cents per available seat kilometre (ASK) angegeben. Dabei wird die Anzahl der Sitzplätze mit der Streckendistanz multipliziert. Eine Fluggesellschaft ist demnach umso effizienter, je geringer die Kosten pro ASK sind. Die Kosten pro ASK verringern sich, je länger die Flugstrecke ist. Durch das hohe Lohnniveau in Europa sowie den fast doppelt so hohen Flughafen- und Streckengebühren liegen die Betriebskosten hier etwa 40 – 50 % über denen der USA.[72]
2.6.4. Non-operating-Kosten
Nach der ICAO, werden vier „Non-operating-Kosten“, die nicht unter die Betriebskosten fallen, unterschieden. Zu ihnen zählen die Verluste beim Verkauf eines Flugzeuges, die Zinsen für Kredite, Verluste von Tochterunternehmen (Hotelagenturen, Reisebüros etc.) und Verluste durch Wechselkursschwankungen.[73]
2.6.5. Kostenvergleich mit herkömmlichen Fluggesellschaften
Low-cost Airlines erzielen große Kostenunterschiede im Vergleich zu herkömmlichen Fluggesellschaften. Eine attraktive Marktabgrenzung durch das Anbieten von Punkt zu Punkt Verbindungen, eine starke Freizeit-Komponente, signifikante Preisunterschiede sowie eine starke Nachfrage gelten als die wichtigsten Elemente einer Erfolg versprechenden Low-cost Strategie. Durch die konsequente Anwendung dieser Strategie, straffer Kontrolle durch das Management und Motivation an vorderster Front können diese Konzepte erfolgreich umgesetzt werden.[74]
Traditionelle Fluggesellschaften betonen oft, dass sie auf etwa 80% ihrer Kosten keinen Einfluss haben und ihnen daher kaum Raum für Kostensenkungen gegeben ist. Trotzdem ist es den Low-cost Anbietern gelungen, viel geringere Kosten pro ASK als die traditionellen Fluglinien zu erzielen.[75]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Betriebskosten der Low-cost Airlines pro ASK
Quelle: Mason et al. (2001); Appendix 1 und 2; Endres in:
Airline Business vom November 2001, S.76.
Kritiker von Low-cost Airlines behaupten, dass die geringen Betriebskosten zum Teil künstlich durch schlechte Entlohnung oder der Verwendung von Teilzeitarbeitskräften erzeugt werden. Die Personalkosten sind aber nur ein Kostenfaktor, bei dem Einsparungen erzielt werden können. Auch durch die Kombination von Kosteneinsparungsfaktoren können Kosten reduziert werden. Vor allem der Wegfall der Business Klasse sowie der Verzicht auf jedes zusätzliche Service, eine engere Bestuhlung, dem längeren Einsatz der Flugzeuge, die niedrigeren Flughafengebühren und die geringeren Personalausgaben sind entscheidend.[76]
[...]
[1] Vgl.: Reiter, T.: Die Liberalisierung des Europäischen Luftverkehrs, S. 10.
[2] Vgl.: Grundmann, S.: Marktöffnung im Luftverkehr, S. 29.
[3] Vgl.: Klauzner, M.: Eine Analyse der strategischen Wettbewerbsposition und Bewertung, S. 10.
[4] Vgl.: Klauzner, M.: Eine Analyse der strategischen Wettbewerbsposition und Bewertung, S. 12.
[5] Vgl.: Reiter, T.: Die Liberalisierung des Europäischen Luftverkehrs, S. 12.
[6] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost A. am europäischen Markt, S. 14ff.
[7] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 15.
[8] Vgl.: Klauzner, M.: Eine Analyse der strategischen Wettbewerbsposition und Bewertung, S. 13.
[9] Vgl.: Richtlinie 87/601/EWG des Rates vom 14. Dezember 1987
[10] Vgl.: Entscheidung 87/602/EWG des Rates vom 14. Dezember 1987
[11] Vgl.: Verordnung (EWG) 3975, 3976/87 des Rates vom 14. Dezember 1987
[12] Vgl.: Reiter, T.: Die Liberalisierung des Europäischen Luftverkehrs, S. 14ff.
[13] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 8.
[14] Vgl.: Reiter, T.: Die Liberalisierung des Europäischen Luftverkehrs, S. 15.
[15] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 15.
[16] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 9.
[17] Vgl.: Reiter, T.: Die Liberalisierung des Europäischen Luftverkehrs, S. 15ff.
[18] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 9.
[19] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 16.
[20] Ebda.
[21] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 10.
[22] Vgl.: Klauzner, M.: Eine Analyse der strategischen Wettbewerbsposition und Bewertung, S. 15.
[23] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 24.
[24] Vgl.: Schreder, E.: Die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 15.
[25] Ebda. S. 11ff..
[26] Vgl.: Sutter, S.: Entwicklungen und Perspektiven für den Regionalflughafen, S. 40.
[27] Vgl.: URL: http://www.iflyswa.com (Stand: 11.08.2005)
[28] Vgl.: Schweinschwaller, U: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 27ff
[29] Vgl.: Sutter, S.: Entwicklungen und Perspektiven für den Regionalflughafen, S. 40.
[30] Vgl.: Schweinschwaller, U: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 27ff
[31] Ebda.
[32] Ebda.
[33] Vgl.: Sutter, S.: Entwicklungen und Perspektiven für den Regionalflughafen, S. 40ff.
[34] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 36.
[35] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 15.
[36] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 37.
[37] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 24.
[38] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 37.
[39] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 25.
[40] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 25.
[41] Ebda. S. 24.
[42] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 37ff.
[43] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 18.
[44] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 40.
[45] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 41.
[46] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 19.
[47] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 41.
[48] Ebda. S. 42.
[49] Vgl.: URL: http://www.ryanair.com/site/DE/about.php?sec=charter&ref=01 (Stand: 17.07.2005)
[50] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 19.
[51] Vgl.: Piltz B.: Die Liberalisierung im Luftverkehr, S. 55ff.
[52] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 43.
[53] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 42.
[54] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 43.
[55] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 17.
[56] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 43.
[57] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 17.
[58] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 43ff.
[59] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 17.
[60] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 46.
[61] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 17ff.
[62] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 18.
[63] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 44ff.
[64] Vgl.: Schreder, E.: die Attraktivität der Billigfluglinien, S. 19.
[65] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 54.
[66] Ebda.
[67] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 48.
[68] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 48ff.
[69] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 56.
[70] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 49.
[71] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 56.
[72] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 49.
[73] Vgl.: Schweinschwaller, U.: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 56.
[74] Vgl.: Weidisch J.: Low-cost Airlines am österreichischen Linienflugmarkt, S. 53.
[75] Vgl.: Schweinschwaller, U: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 59ff
[76] Vgl.: Schweinschwaller, U: Perspektiven der Low-Cost Airlines am europäischen Markt, S. 59ff
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832497071
- ISBN (Paperback)
- 9783838697079
- DOI
- 10.3239/9783832497071
- Dateigröße
- 1006 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik, Geographie und Regionalforschung
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Juli)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- liberalisierung low-cost airlines flughafen luftverkehr billigflüge
- Produktsicherheit
- Diplom.de