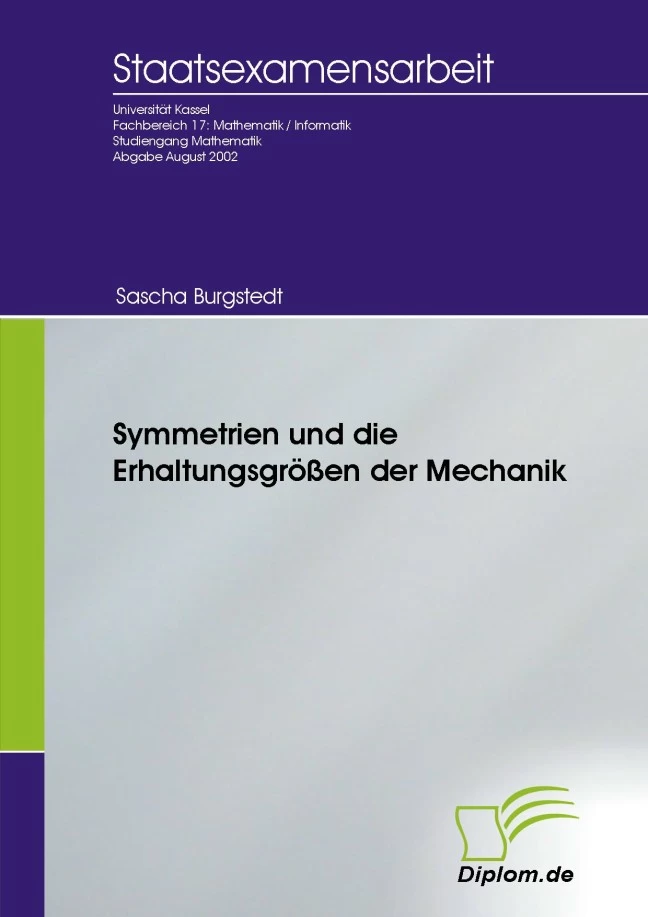Symmetrien und die Erhaltungsgrößen der Mechanik
©2002
Examensarbeit
84 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Das Thema dieser fachwissenschaftlichen Arbeit ist sicherlich kein rein mathematisches, kommt der Hauptgegenstand doch aus der Physik. Die klassische Mechanik als Teil der theoretischen Physik eröffnet aber eine Vielzahl von Anwendungszusammenhängen f r die mathematischen Disziplinen.
Die im Zentrum der Mechanik stehenden konservativen Systeme von Massenpunkten weisen bezüglich spezieller Transformationen Symmetrien auf, aus denen sich Erhaltungsgrößen ableiten lassen. Dieses Phänomen ist das eigentliche Thema dieser Arbeit. Hinführend soll jedoch erst die zugrundeliegende Theorie besprochen werden.
Im ersten Kapitel wird der Begriff der Symmetrie definiert. Dabei wird die Gruppentheorie allerdings ausgelassen, da diese, trotz ihrer Relevanz bezüglich des Symmetriebegriffs in der Mathematik, f r die Untersuchungen in dieser Arbeit nicht benötigt wird.
Das zweite Kapitel bietet eine kurze Einführung in die NEWTONsche Mechanik. Es werden grundlegende Begriffe und Größen eingeführt, z. B. Begriffe wie Ort, Zeit, Massenpunkt oder Größen wie Impuls, Kraft, kinetische und potentielle Energie. Am Ende des zweiten Kapitels stehen Koordinatentransformationen im Blickpunkt, da sich durch die Einführung geeigneter allgemeiner Koordinaten das Auffinden der die Bahnkurven der Massenpunkte beschreibenden Funktionen vereinfachen 1ässt.
Die im dritten Kapitel hergeleitete EULER-Differentialgleichung ist als notwendige Bedingung an die Bahnkurve ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil der Mechanik. Die Herleitung ergibt sich anschaulich aus dem sog. Brachistochronenproblem, das von JACOB BERNOULLI formuliert wurde. Mit der im vierten Kapitel definierten LAGRANGE-Funktion und dem darauf folgenden HAMITLONSchen Prinzip hat man zusammen mit den Ergebnissen des dritten Kapitels Instrumente, um die Bewegungsgleichungen von Massenpunkten nur mit Hilfe der Kenntnis über kinetische und potentielle Energie eines Massenpunktsystems zu bestimmen: die EULER-LAGRANGE-Gleichung. Sie wird am Ende des Kapitels auf einige ausgesuchte physikalische Probleme angewendet.
Das fünfte Kapitel bildet den Höhepunkt dieser Arbeit. Mit Hilfe des HAMILTONschen Prinzips aus dem vorigen Kapitel und des Theorems von EMMY NOETHER lassen sich Erkenntnisse über den Zusammenhang der LAGRANGE-Funktion mit Erhaltungsgrößen gewinnen. Die nachfolgenden Symmetriebetrachtungen und die daraus folgenden Erhaltungsgrößen bilden schließlich den Abschluss dieser […]
Das Thema dieser fachwissenschaftlichen Arbeit ist sicherlich kein rein mathematisches, kommt der Hauptgegenstand doch aus der Physik. Die klassische Mechanik als Teil der theoretischen Physik eröffnet aber eine Vielzahl von Anwendungszusammenhängen f r die mathematischen Disziplinen.
Die im Zentrum der Mechanik stehenden konservativen Systeme von Massenpunkten weisen bezüglich spezieller Transformationen Symmetrien auf, aus denen sich Erhaltungsgrößen ableiten lassen. Dieses Phänomen ist das eigentliche Thema dieser Arbeit. Hinführend soll jedoch erst die zugrundeliegende Theorie besprochen werden.
Im ersten Kapitel wird der Begriff der Symmetrie definiert. Dabei wird die Gruppentheorie allerdings ausgelassen, da diese, trotz ihrer Relevanz bezüglich des Symmetriebegriffs in der Mathematik, f r die Untersuchungen in dieser Arbeit nicht benötigt wird.
Das zweite Kapitel bietet eine kurze Einführung in die NEWTONsche Mechanik. Es werden grundlegende Begriffe und Größen eingeführt, z. B. Begriffe wie Ort, Zeit, Massenpunkt oder Größen wie Impuls, Kraft, kinetische und potentielle Energie. Am Ende des zweiten Kapitels stehen Koordinatentransformationen im Blickpunkt, da sich durch die Einführung geeigneter allgemeiner Koordinaten das Auffinden der die Bahnkurven der Massenpunkte beschreibenden Funktionen vereinfachen 1ässt.
Die im dritten Kapitel hergeleitete EULER-Differentialgleichung ist als notwendige Bedingung an die Bahnkurve ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil der Mechanik. Die Herleitung ergibt sich anschaulich aus dem sog. Brachistochronenproblem, das von JACOB BERNOULLI formuliert wurde. Mit der im vierten Kapitel definierten LAGRANGE-Funktion und dem darauf folgenden HAMITLONSchen Prinzip hat man zusammen mit den Ergebnissen des dritten Kapitels Instrumente, um die Bewegungsgleichungen von Massenpunkten nur mit Hilfe der Kenntnis über kinetische und potentielle Energie eines Massenpunktsystems zu bestimmen: die EULER-LAGRANGE-Gleichung. Sie wird am Ende des Kapitels auf einige ausgesuchte physikalische Probleme angewendet.
Das fünfte Kapitel bildet den Höhepunkt dieser Arbeit. Mit Hilfe des HAMILTONschen Prinzips aus dem vorigen Kapitel und des Theorems von EMMY NOETHER lassen sich Erkenntnisse über den Zusammenhang der LAGRANGE-Funktion mit Erhaltungsgrößen gewinnen. Die nachfolgenden Symmetriebetrachtungen und die daraus folgenden Erhaltungsgrößen bilden schließlich den Abschluss dieser […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALT
EINLEITUNG ... 5
1. ZUM SYMMETRIEBEGRIFF ... 7
2. EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK ... 10
2.1 Die Axiome von Newton ... 12
2.2 Abgeschlossene ideale Systeme... 15
2.3 Potentiale in nicht-abgeschlossenen idealen Systemen 17
2.4 Generalisierte Koordinaten und Zwangsbedingungen.. 18
2.4.1
Zwangsbedingungen... 18
2.4.2
Generalisierte Geschwindigkeiten... 19
2.4.3
Generalisierte Kräfte und Potentiale ... 20
2.4.4
Beispiel: Koordinatentransformation in Polarkoordinaten.. 20
3. EULERSCHE DIFFERENTIALGLEICHUNG... 23
3.1 Funktionale... 24
3.2 Variationsrechnung... 25
3.2.1
Variation einer Kurve ... 25
3.2.2
Der Hauptsatz der Variationsrechnung mit Beweis... 28
3.2.3
Die E
ULER
sche Differentialgleichung... 29
3.2.4
Variation mit Nebenbedingung ... 30
3.3 Das Brachistochronenproblem ... 31
4. LAGRANGE-FUNKTION ... 38
4.1 Zur Wohldefiniertheit der L
AGRANGE
-Funktion ... 38
4.2 Weitere Eigenschaften der L
AGRANGE
-Funktion ... 42
4.3 H
AMILTON
sches Prinzip... 44
4.4 Anwendungen ... 46
4.4.1
Die A
TWOOD
sche Fallmaschine ... 46
4.4.2
Das ebene mathematische Pendel ... 49
4.4.3
Das ebene Doppelpendel ... 56
5. DAS THEOREM VON EMMY NOETHER UND
ERHALTUNGSGRÖSSEN... 64
5.1 Invarianz des Wirkungsfunktionals ... 64
5.2 Symmetrien und Erhaltungsgrößen... 69
5.2.1
Transformationen... 69
5.2.2
Homogenität der Zeit ... 70
5.2.3
Homogenität des Raums... 73
5.2.4
Isotropie des Raums... 75
5.2.5
Relativität der Raum-Zeit ... 79
6. LITERATUR ... 83
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
3
Abbildungsverzeichnis
Nr. Bezeichnung
Seite
Abb. 1
Kraft und Gegenkraft ...
14
Abb. 2
Polareinheitsvektoren ... 21
Abb. 3
Brachistochronenproblem (aus: F
LIEßBACH
, S. 108) ...
23
Abb. 4
Variiertes Brachistochronenproblem ...
31
Abb. 5
Graph einer Brachistochrone ... 37
Abb. 6
A
TWOOD
sche Fallmaschine ... 46
Abb. 7
Mathematisches Pendel ... 49
Abb. 8
Graph eines mathematischen Pendels ... 54
Abb. 9
Von MAPLE ausgegebener Graph des ebenen mathematischen
Pendels um
0
t
=
...
55
Abb. 10
Ebenes Doppelpendel ... 56
Abb. 11
Graph der Schwingungen für
15
t
=
... 62
Abb. 12
Graph der Schwingungen für
100
t
=
... 62
Abb. 13
Phasenbild der Schwingungen ...
63
Abb. 14
Drehung des Systems ... 75
Abb. 15
Gleichförmige Bewegung des Systems ...
79
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
4
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
Bd. Band
bez. bezüglich
bzw. beziehungsweise
d. h.
das heißt
ebd. ebenda
f. folgende
o. B. d. A.
ohne Beschränkung der Allgemeinheit
q.e.d. quod
erra
demonstrandum
s. siehe
S. Seite
sog. sogenannt(e)
vgl. vergleiche
z. B.
zum Beispiel
EINLEITUNG
5
EINLEITUNG
Das Thema dieser fachwissenschaftlichen Arbeit ist sicherlich kein rein
mathematisches, kommt der Hauptgegenstand doch aus der Physik.
Die klassische Mechanik als Teil der theoretischen Physik eröffnet aber
eine Vielzahl von Anwendungszusammenhängen für die mathemati-
schen Disziplinen.
Die im Zentrum der Mechanik stehenden konservativen Systeme von
Massenpunkten weisen bezüglich spezieller Transformationen Symmet-
rien auf, aus denen sich Erhaltungsgrößen ableiten lassen. Dieses Phä-
nomen ist das eigentliche Thema dieser Arbeit. Hinführend soll jedoch
erst die zugrundeliegende Theorie besprochen werden.
Im ersten Kapitel wird der Begriff der Symmetrie definiert. Dabei wird
die Gruppentheorie allerdings ausgelassen, da diese, trotz ihrer Rele-
vanz bezüglich des Symmetriebegriffs in der Mathematik, für die Unter-
suchungen in dieser Arbeit nicht benötigt wird.
Das zweite Kapitel bietet eine kurze Einführung in die N
EWTON
sche Me-
chanik. Es werden grundlegende Begriffe und Größen eingeführt, z. B.
Begriffe wie Ort, Zeit, Massenpunkt oder Größen wie Impuls, Kraft, ki-
netische und potentielle Energie. Am Ende des zweiten Kapitels stehen
Koordinatentransformationen im Blickpunkt, da sich durch die Einfüh-
rung geeigneter allgemeiner Koordinaten das Auffinden der die Bahn-
kurven der Massenpunkte beschreibenden Funktionen vereinfachen
lässt.
Die im dritten Kapitel hergeleitete E
ULER
-Differentialgleichung ist als
notwendige Bedingung an die Bahnkurve ein nicht zu vernachlässigen-
der Bestandteil der Mechanik. Die Herleitung ergibt sich anschaulich
EINLEITUNG
6
aus dem sog. Brachistochronenproblem, das von J
ACOB
B
ERNOULLI
formu-
liert wurde. Mit der im vierten Kapitel definierten L
AGRANGE
-Funktion
und dem darauf folgenden H
AMITLON
schen Prinzip hat man zusammen
mit den Ergebnissen des dritten Kapitels Instrumente, um die Bewe-
gungsgleichungen von Massenpunkten nur mit Hilfe der Kenntnis über
kinetische und potentielle Energie eines Massenpunktsystems zu
bestimmen: die E
ULER
-L
AGRANGE
-Gleichung. Sie wird am Ende des Kapi-
tels auf einige ausgesuchte physikalische Probleme angewendet.
Das fünfte Kapitel bildet den Höhepunkt dieser Arbeit. Mit Hilfe des
H
AMILTON
schen Prinzips aus dem vorigen Kapitel und des Theorems von
E
MMY
N
OETHER
lassen sich Erkenntnisse über den Zusammenhang der
L
AGRANGE
-Funktion mit Erhaltungsgrößen gewinnen. Die nachfolgenden
Symmetriebetrachtungen und die daraus folgenden Erhaltungsgrößen
bilden schließlich den Abschluss dieser Arbeit.
1 ZUM SYMMETRIEBEGRIFF
7
1. ZUM SYMMETRIEBEGRIFF
Symmetrie ist ein Phänomen, mit dem wir regelmäßig in verschiedens-
ten Bereichen konfrontiert werden. Lebewesen weisen gewisse Symmet-
rien auf, Bauwerke erhalten durch Symmetrie einen besonderen Cha-
rakter; sogar in der Musik wird Symmetrie als gestalterisches Mittel
eingesetzt. In diesem Kapitel soll zunächst geklärt werden, was Sym-
metrie bedeutet, bevor der Begriff später seine Anwendung findet.
Grundlegend für Symmetrie ist die Möglichkeit einer Änderung. In die-
sem Sinne definiert
R
OSEN
den Begriff Symmetrie:
Symmetrie ist die Invarianz gegenüber einer möglichen Änderung
1
.
Eine Situation, in der eine mögliche Änderung einen bestimmten Aspekt
der Situation unverändert lässt, wird auch als symmetrisch unter der
Änderung im Bezug auf den speziellen Aspekt bezeichnet.
Bei einem gleichseitigen Dreieck besteht die Möglichkeit der Drehung
um den Dreiecksmittelpunkt. Eine Drehung um Vielfache von 60° lässt
die Gestalt des Dreiecks unverändert. Es ist demnach symmetrisch un-
ter einer Drehung um Vielfache von 60° bezüglich seiner Gestalt.
Die beiden elementaren Komponenten von Symmetrie sind nach obiger
Definition also (R
OSEN
, S. 4):
(1) Möglichkeit einer Änderung. Es muss die Möglichkeit bestehen,
eine Änderung zu vollziehen, obwohl sie nicht unbedingt vollzo-
gen werden muss.
(2) Invarianz. Gewisse Eigenschaften der Situation würden unverän-
dert bleiben, falls die Änderung vollzogen wird.
1
Übersetzt nach R
OSEN
, S. 1.
1 ZUM SYMMETRIEBEGRIFF
8
Falls eine Änderung möglich ist, aber Eigenschaften der Situation nicht
invariant gegenüber der Änderung sind, liegt Asymmetrie vor (R
OSEN
,
S. 158). Man kann aber nur dann von Asymmetrie sprechen, wenn die
Möglichkeit einer Änderung nach (2) überhaupt besteht.
R
OSEN
führt zusätzlich noch die approximative Symmetrie als Begriff ein,
der in dieser Arbeit zwar keine Rolle spielt, aber der Vollständigkeit hal-
ber angeführt wird
2
. Auch in diesem Fall muss (2) erfüllt sein, denn das
Approximative findet sich in der Invarianz: Falls eine Situation Eigen-
schaften besitzt, die nach einer Änderung annähernd gleich bleiben,
spricht man von approximativer Symmetrie.
Symmetrie braucht neben den beiden elementaren Bestandteilen (1)
und (2) auch noch einen Bezugsrahmen. Ein gleichseitiges Dreieck auf
einer unendlich ausgedehnten homogenen Fläche kann man nicht als
symmetrisch ansehen, solange man diesem keinen Bezugsrahmen gibt.
Ein Bezugsrahmen für das Dreieck kann ein das Dreieck umfassendes
Rechteck sein, da es für den Bezugsrahmen die folgende notwendige
Forderung erfüllt:
(3) Der Bezugsrahmen ist ein veränderbarer Aspekt der Situation,
der nicht invariant gegenüber der Änderung ist (R
OSEN
, S. 160).
Andererseits würde der Bezugsrahmen seinem Zweck nicht erfüllen.
Hier wird deutlich, dass Symmetrie auch immer den Begriff der Asym-
metrie impliziert: Liegt Symmetrie einer Situation bezüglich einer Ände-
rung vor, so ist der Bezugsrahmen der Situation nicht invariant gegen-
über dieser Änderung.
R
OSEN
fasst die Ergebnisse in einem Diagramm zusammen:
2
Bezüglich der in Kapitel 5.2 untersuchten Symmetrieeigenschaften und Erhaltungs-
größen werden an einigen Stellen die mindestens in zweiter Potenz auftretenden infini-
tesimalen Größen vernachlässigt. Trotzdem wird hier mit Blick auf die physikalische
Interpretation der Ergebnisse regelrechte Symmetrie festgestellt.
1 ZUM SYMMETRIEBEGRIFF
9
Symmetrie
Diese ,,Axiomatik" des Symmetriebegriffs reicht aus, um ihn später auf
spezielle physikalische Probleme anwenden zu können. In diesem Zu-
sammenhang entspricht (1) der Translation, Drehung oder Bewegung
eines Systems und damit einhergehenden Koordinatentransformatio-
nen. (2) wird anhand der L
AGRANGE
-Funktion in Kapitel 4 und 5 unter-
sucht. (3) ist gegeben durch ein zugrundegelegtes Bezugssystem (z. B.
ein kartesisches Koordinatensystem), auf das im nächsten Kapitel ein-
gegangen wird.
Möglichkeit einer
Änderung
Bezugsrahmen
Asymmetrie unter
der Änderung
Invarianz gegen-
über der Änderung
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
10
2. EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
Der Ausdruck klassische Mechanik wird gegenwärtig häufig verwendet,
um diese Theorie von neueren physikalischen Theorien, z. B. der Quan-
tenmechanik, abzugrenzen (vgl. G
OLDSTEIN
, S. 1). Die hier untersuchte
Mechanik basiert auf den Grundsätzen von N
EWTON
, die im folgenden
Unterkapitel besprochen werden. Zunächst sollen grundlegende Begriffe
der klassischen Mechanik definiert werden, um eine eindeutige An-
wendbarkeit mathematischer Theorien zu gewährleisten.
Einer der Grundbegriffe der Mechanik ist der Massenpunkt oder auch
Teilchen. Man fasst darunter Körper zusammen, ,,deren Ausmaße man
bei der Beschreibung seiner Bewegung vernachlässigen kann" (L
AN-
DAU
/L
IFSCHITZ
, S. 1). Dabei ist die Masse die elementare und einzige Ei-
genschaft eines jeden Massenpunktes (S
TÖCKER
, S. 32).
Im Mittelpunkt stehen Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Bewegungen
von Massenpunkten ablaufen. Als Bewegung bezeichnet man die Ände-
rung des Ortes als Funktion der Zeit (vgl. F
LIEßBACH
, S. 1). Um die Be-
wegung beschreiben zu können, wird zuvor ein Bezugssystem festge-
legt. Dies kann ein statisches kartesisches Koordinatensystem sein, das
von drei orthogonalen Vektoren aufgespannt wird
3
oder gar ein beweg-
tes, z. B. rotierendes Bezugssystem.
3
Es sei angemerkt, dass geradlinige Koordinatensysteme nur in Euklidischen Räumen
möglich sind; die Oberfläche einer Kugel stellt beispielsweise einen gekrümmten Raum
dar.
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
11
Die Zeit wird über die Festlegung eines Messverfahrens durch eine Uhr
definiert. F
LIEßBACH
definiert den Begriff Uhr als ein ,,Instrument, das
die Periodenzahl eines periodischen, kontinuierlichen Vorgangs anzeigt"
(F
LIEßBACH
,
S.
6).
Die Zeiteinheit 1 Sekunde wird als das
"9.191.631.770-fache des Übergangs zwischen den beiden Hyperfein-
strukturniveaus des Grundzustands von Cäsium 133" (F
LIEßBACH
, S. 6)
festgelegt.
Der Ort eines Massenpunktes kann mit Hilfe von Koordinaten eindeutig
beschrieben werden. Einer ausgezeichneten Stelle im Bezugssystem
entspricht ein Punkt O im mathematischen Bildraum. Damit lässt sich
die Menge der Punkte P im euklidischen Punktraum bijektiv auf die
Menge der Ortsvektoren OP
= r
!!!"
abbilden (vgl. H
EIL
/K
ITZKA
, S. 20). Da-
mit kann man jeden Punkt einer Bahnkurve durch das Paar ,t
r
be-
schreiben. H
EIL
und K
ITZKA
nennen ein solches Paar auch Ereignis. Im
Falle eines kartesischen Koordinatensystems ist ein Ereignis bzw. ein
Punkt der Bahnkurve durch die Angabe dreier zeitabhängiger Parame-
ter
( )
x t , ( )
y t , ( )
z t festgelegt. Sein Ortsvektor lässt sich dann als Linear-
kombination der drei Basisvektoren schreiben:
( )
( )
( )
( )
x
y
z
t
x t
y t
z t
=
+
+
r
e
e
e .
Zylinderkoordinaten
(t),
(t), z(t) und Kugelkoordinaten r(t),
(t),
(t) bie-
ten sich an, wenn die Bewegungsgleichungen dadurch eine einfachere
Form erhalten. Sie sind wie folgt definiert (vgl. H
EIL
/K
ITZKA
, S. 23):
Zylinderkoordinaten:
cos
x
=
sin (0
; 0
2 ;
)
y
z
=
<
<
- < <
z
z
=
Kugelkoordinaten:
sin cos
x
r
=
sin sin (0
; 0
; 0
2 )
y
r
r
=
<
<
cos
z
r
=
(2.1a)
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
12
Die lokale Änderungsrate von r heißt Geschwindigkeit. Sie wird als Ab-
leitung von r nach der Zeit t geschrieben:
d
( )
( )
lim
( )
( )
( )
d
x
y
z
t
t
t
t
x t
y t
z t
t
t
t
-
=
=
=
+
+
-
r
r
r
r
e
e
e
#
#
#
#
.
Die lokale Änderungsrate der Geschwindigkeit heißt Beschleunigung
und wird als zweite Ableitung von r nach der Zeit geschrieben:
d
( )
( )
lim
( )
( )
( )
d
x
y
z
t
t
t
t
x t
y t
z t
t
t
t
-
=
=
=
+
+
-
r
r
r
r
e
e
e
#
#
#
##
##
##
##
.
Damit ist für jede Abbildung
( )
t
t
r
$
, die die Bahnkurve eines Massen-
punkts beschreibt, die zweimalige Differenzierbarkeit impliziert.
Im Falle eines Systems von n Massenpunkten ist die die Bahnkurven
beschreibende Funktion eine vektorielle, die sich aus 3n Koordinaten-
funktionen und der Zeit t zusammensetzt:
1
3
( ( ),..,
( ), )
n
x t
x
t t
=
r
r
,
wobei
der
-te
Massenpunkt durch die Koordinaten
3
2
3
1
3
(
( ),
( ),
( ))
x
t x
t x
t
-
-
beschrieben wird. Je nach dem, ob die Bahnkurve
eines Massenpunktes oder die Bahnkurven mehrerer Massenpunkte in
einem System beschrieben werden sollen, ist r eine Abbildung nach
(2.1a) oder (2.2). Wenn im Folgenden von Systemen gesprochen wird, ist
zugrunde gelegt, dass es sich um Systeme von n Massepunkten han-
delt.
2.1 Die Axiome von N
EWTON
In seinem Werk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica formulierte
N
EWTON
1687 drei Axiome, auf denen die Mechanik basiert. Er geht da-
bei von Systemen aus, die keinen von außen wirkenden Kräften ausge-
setzt sind. Hier gilt:
(2.1b)
(2.1c)
(2.2)
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
13
Bezugssysteme, die keinen äußeren Kräften unterliegen, nennt man
auch Interialsysteme. H
EIL
und K
ITZKA
unterscheiden zwischen lokalen
und unendlich ausgedehnten Inertialsystemen. Als Beispiele für ein lo-
kales Inertialsystem nennen sie ein ,,weit von Himmelskörpern antriebs-
los fliegendes Raumschiff, das bez. des Fixsternhimmels keine Eigenro-
tation hat" (Heil und K
ITZKA
, S. 18). Später stellen sie heraus, dass alle
Inertialsysteme durch eine sog. G
ALILEI
-Tansformation miteinander ver-
bunden sind. Dies sind Koordinatentransformation der Art
t
=
+
r
r
v
mit
3
,
r v
! (H
EIL
und K
ITZKA
, S. 69), auf die in Kapitel 5.2.5 genauer
eingegangen wird.
Das Produkt aus der Masse m eines Teilchens und seiner Geschwindig-
keit r! heißt Impuls ( )
( )
t
m
t
p
r
=
!
und ist demnach eine vektorielle Größe.
Für den Impuls formulierte N
EWTON
das 2. Axiom:
Aus dem 2. Axiom folgt der Hauptsatz der Mechanik:
d
d(
)
d
d
m
m
t
t
=
=
=
p
r
K
r
"
"" .
Diese Differentialgleichung zweiter Ordnung wird auch als N
EWTON
sche
Bewegungsgleichung bezeichnet.
Weiterhin üben die einzelnen Teilchen in einem System von Massen-
punkten aufeinander Kräfte aus, die als innere Kräfte bezeichnet wer-
2. Axiom: In Inertialsystemen gilt:
d
d t
p
K
=
(Kraft).
(2.4)
(2.5)
1. Axiom: Eine kräftefreie Bewegung kann in einem solchen Bezugs-
system durch
( ) : ( )
.
t
t
const
r
v
=
=
!
beschrieben werden.
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
14
den. Für diese Kräfte formuliert das 3. Axiom eine grundlegende Ei-
genschaft:
D. h. jede Wirkung, die die Umgebung auf einen Körper ausübt, ruft ei-
ne Gegenwirkung gleichen Betrages hervor:
Dem dritten Axiom werden zwei weitere wichtige Eigenschaften der
Kraft hinzugesetzt:
(i)
(
)
0
r
r
K
µ
µ
-
×
=
,
beide Vektoren liegen also parallel zueinander. D. h. Kräfte, die
zwei Massepunkte aufeinander ausüben, wirken in Richtung
der Verbindungslinie.
(ii) Wirken mehrere Kräfte auf einen Massenpunkt, so ist die re-
sultierende Gesamtkraft
i
i
K
K
=
(vgl. F
LIEßBACH
, S. 15-16).
Demnach gilt in einem System von n Massenpunkten für das -te
Teil-
chen und die inneren Kräfte
1
n
i
i
=
=
K
K
(mit
: 0
=
K
)
und nach dem 3. Axiom
1
1
1
0
n
n
n
i
i
=
=
=
=
=
K
K
3. Axiom:
actio
reactio
= -
K
K
1
r
2
r
12
K
21
K
(2.6)
(2.7)
(2.8)
(2.9)
Abb. 1 Kraft und Gegenkraft
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
15
2.2 Abgeschlossene ideale Systeme
In diesem Unterkapitel sollen die Begriffe abgeschlossen und ideal defi-
niert werden. Sie ergeben sich aus einer weiteren Unterscheidung von
Kräften.
Zum einen werden die in Kapitel 2.1 genannten inneren Kräfte
( )
i
K
unterschieden von den von außen auf das System wirkenden Kräften
( )
a
K
. Die Gravitation der Erde ist ein Beispiel für eine äußere Kraft.
DEFINITION:
Ist ein System von Massenpunkten frei von äußeren Kräften
(
( )
0
a
=
K
), so wird es als abgeschlossenes System bezeichnet.
Die inneren Kräfte lassen sich zudem in einen konservativen (
kons
K
) und
einen dissipativen (
diss
K
) Anteil zerlegen. Die Kraft, die auf ein Teilchen
wirkt, kann somit als die Summe der Teilkräfte dargestellt werden:
kons
diss
=
+
K
K
K
F
LIEßBACH
bezeichnet als konservative Kräfte solche, die ein Potential
besitzen (F
LIEßBACH
, S. 24). Über die Definition eines konservativen Sys-
tems lässt sich die der konservativen Kräfte ableiten. Nach S
TÖCKER
ist
ein konservatives System ein System, ,,in dem sich die Energie in der
Zeit nicht ändert" (S
TÖCKER
, S. 205). Daher kann man diese auch als
Kräfte ansehen, die das System derart beeinflussen, dass ihm keine
Energie entzogen wird.
Dissipative Kräfte sind verantwortlich für die teilweise Umwandlung der
Energie des Systems in andere Energieformen; sie gelten dann als verlo-
ren. Ein Beispiel für eine dissipative Kraft ist die Reibung eines Körpers
auf einer Unterlage. Durch diese wird ein Teil der Energie des Körpers
in Wärmeenergie umgewandelt.
(2.10)
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
16
DEFINITION
Ein System wird als ideal bezeichnet, wenn
0
diss
=
K
ist.
Um weitere Eigenschaften der Kräfte und der Energie zu untersuchen,
werden zunächst die N
EWTON
schen Bewegungsgleichung (2.5) mit r#
multipliziert:
:
m
N
=
=
rr
Kr
###
#
.
N ist die an das System übertragene Leistung (vgl. F
LIEßBACH
, S. 24).
(2.11) lässt sich auch schreiben als
2
d
d
2
m
N
t
=
r#
;
dies bedeutet, dass die Geschwindigkeit des Massenpunktes sich mit
der Zu- oder Abführung von Energie ändert. Dabei wird der Term
2
:
2
m
T
=
r#
als kinetische Energie bezeichnet.
Die konservativen Kräfte wurden bereits als diejenigen identifiziert, die
sich durch ein Potential darstellen lassen. Die potentielle Energie ist all-
gemein die Energie, die nur vom Ort des Körpers und nicht von dessen
Geschwindigkeit abhängt (vgl. S
TÖCKER
, S. 61):
d ( )
d
kons
U
t
= -
r
K
r#
Im Falle
( ( ), ( ), ( ), )
x t y t z t t
=
r
r
lässt sich (2.13) ausführlich schreiben als
grad
kons
U
x
U
y
U
z
U
U
x
t
y
t
z
t
t
= -
+
+
+
= -
K
r#
Aus (2.11) und (2.10) folgt zunächst:
2
d
d
2
kons
diss
m
t
=
+
r
K
r
K
r
#
#
#
Mit (2.14) ergibt sich:
2
d
( )
d
2
diss
m
U
t
+
=
r
r
K
r
#
# ,
woraus sofort der Energieerhaltungssatz für ideale Systeme folgt:
(2.11)
(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
17
In idealen Systemen ist die Summe aus kinetischer und potentieller
Energie konstant:
2
2
d
( )
0
( )
.
d
2
2
m
m
U
U
const
t
+
=
+
=
r
r
r
r
#
#
2.3 Potentiale in nicht-abgeschlossenen idealen Systemen
Systeme sind nicht-abgeschlossen, wenn eine Kraft von außen auf das
System wirkt. Dies hat Einfluss auf die Potentiale der Massenpunkte.
Die Kraft, die auf ein Teilchen eines idealen nicht abgeschlossenen Sys-
tems wirkt, lässt sich dann zerlegen in
( )
( )
a
i
=
+
K
K
K .
Mit (2.14) folgt aus (2.19):
( )
( )
d ( )
d
a
i
U
t
+
= -
r
K r
K r
#
#
.
Hier ist es sinnvoll, das Potential U in das von den äußeren Kräften er-
zeugte Potential
( )
a
U
und das von den inneren Kräften erzeugte Potenti-
al
( )
i
U einzuteilen, sodass
( )
( )
a
i
U
U
U
=
+
gilt. Bei n Massenpunkten ist
( )
1
( )
n
a
U
U
=
=
r .
Die inneren Teilkräfte K
µ
hängen von den Abständen der Masseteil-
chen zueinander ab. Daher ist das Teilpotential
( )
i
U ebenfalls abhängig
von den Abständen der Teilchen zueinander, also
( )
1
1
(
) (
: 0)
n
n
i
U
U
U
µ
µ
µ
=
=
=
-
=
r
r
.
Dadurch wird (2.21) zu
1
1
1
( )
(
)
n
n
n
U
U
U
µ
µ
µ
=
=
=
=
+
-
r
r
r
.
(2.18)
(2.19)
(2.20)
(2.21)
(2.22)
(2.23)
(2.24)
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
18
BEISPIEL
Betrachtet man ein System von Massenpunkten im Schwerefeld der Er-
de, bei dem die Summe der inneren Kräfte gleich Null ist, so ist das in-
nere Potential ebenfalls gleich Null. Damit hängt das Gesamtpotential
des Systems nur noch von den äußeren Kräften ab.
Mit (2.20) ist
d
( )
( )
d
U
U
t
= -
= -
r
r
K r
r
r
#
#
und daher
( )
g
U
m
=
= -
r
K
r
.
Damit ist das Gesamtpotential
U gleich:
(
)
(
)
1
1
g d
g
.
g
.
n
n
U
m
m
const
M
const
=
=
=
=
+
=
+
r
r
R
4
R ist der Schwerpunkt und M die Gesamtmasse des Systems. Dies gilt
nach der Definition des Schwerpunktvektors (vgl. G
OLDSTEIN
, S. 5):
1
1
1
:
n
n
n
m
m
M
m
=
=
=
=
=
r
r
R
.
2.4 Generalisierte Koordinaten und Zwangsbedingungen
2.4.1 Zwangsbedingungen
In vielen physikalischen Anwendungsbeispielen bietet es sich an, von
kartesischen Koordinaten auf krummlinige Koordinaten überzugehen,
da sich dadurch eventuell die Bewegungsgleichungen vereinfachen.
Für eine allgemeine Betrachtung werden sog.
generalisierte Koordinaten
i
q eingeführt. Diese ergeben sich meist aus den Zwangsbedingungen,
die ein System unterliegt.
4
Hier wurde der 1. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung angewandt.
(2.25)
(2.26)
(2.27)
(2.28)
2 EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE MECHANIK
19
DEFINITION
Zwangsbedingungen sind Bedingungen, die die Bewegung eines Sys-
tems einschränken.
Zwangsbedingungen treten schon bei einem starren Körper dadurch
auf, dass die Abstände der Massenpunkte konstant bleiben. Ein Pendel,
das an einem nicht dehnbaren Faden reibungslos aufgehängt ist, ist ge-
zwungen, sich auf einer Kreisbahn um den Aufhängungspunkt herum
zu bewegen.
Zwangsbedingungen werden klassifiziert in
holonome, d. h. solche, die
sich in der Form
1
( ,.., , )
0
n
Z
t
r
r
=
schreiben lassen (vgl. G
OLDSTEIN
,
S. 12). Andernfalls werden sie als
nicht-holonom bezeichnet. Sind die
Zwangsbedingungen explizit zeitabhängig, so bezeichnet man sie als
skleronom, ansonsten rheonom.
Durch Zwangsbedingungen sind die Koordinaten der Massenpunkte ei-
nes Systems nicht mehr alle unabhängig voneinander. Im Falle von
k
Zwangsbedingungen hat ein System von
n Massenpunkten nur noch
3
n-k Freiheitsgrade. An dieser Stelle bietet es sich an, 3n-k neue, un-
abhängige generalisierte Koordinaten einzuführen, mit denen die ur-
sprünglichen Koordinaten ausgedrückt werden können:
1
1
1
3
3
3
1
3
( ,..,
, )
( ,..,
, )
n k
n
n
n k
x
x q
q
t
x
x
q
q
t
-
-
=
=
&
Die generalisierten Koordinaten enthalten implizit die Zwangsbedingun-
gen (vgl. G
OLDSTEIN
, S. 13).
2.4.2 Generalisierte Geschwindigkeiten
Die Geschwindigkeit eines Massenpunktes
T
3
2
3
1,
3
(
,
)
x
x
x
-
-
=
r
ist
r#
mit
T
3
2
3
1
3
(
,
,
)
x
x
x
-
-
=
r#
#
#
#
. Für die Koordinate
i
x bedeutet das:
3
1
3
1
d
( ,..,
, )
d
n k
i
i
i
i
n k
j
j
j
x
x
x
x q
q
t
q
t
q
t
-
-
=
=
=
+
#
#
.
(2.29)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (Paperback)
- 9783832496869
- ISBN (eBook)
- 9783956360435
- Dateigröße
- 913 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Kassel – 17: Mathematik / Informatik
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- euler lagrange brachistochronen hamilton theorem
- Produktsicherheit
- Diplom.de