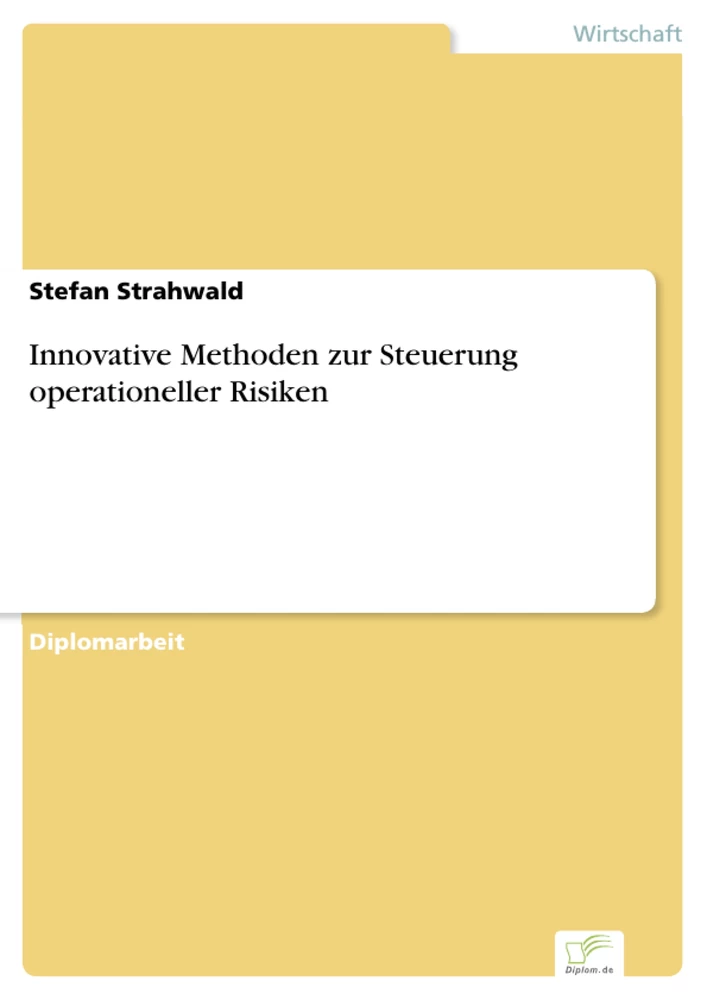Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
©2005
Diplomarbeit
77 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Das Vorhandensein operationeller Risiken ist, auch wenn es manchmal den Anschein haben mag, keinesfalls eine neue Erkenntnis. Sie zählen vielmehr zu den ältesten Risiken überhaupt, da sie untrennbar mit jeder Art wirtschaftlichen Handelns verbunden sind. Folglich haften sie auch einem jeden Unternehmen an, unabhängig von dessen Geschäftstätigkeit. Während operationelle Risiken bei Industrieunternehmen schon seit je her Beachtung finden, wurden sie in der Bankbranche wegen der scheinbaren Dominanz der Kredit- und Marktrisiken lange Zeit vernachlässigt. Dabei ist der Finanzsektor ganz besonders von der Gefahr durch operationelle Risiken betroffen, wie zahlreiche darauf zurückzuführende Verlustfälle zeigen. Exemplarisch sei hier der Bankrott des britischen Bankhauses Barings, verursacht durch nicht autorisierte und mangelhaft überwachte Handelsgeschäfte eines Mitarbeiters namens Nick Leeson, genannt.
Ereignisse wie dieses veranlassten den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht operationelle Risiken in die Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute neu mit aufzunehmen. Zukünftig müssen diese Risiken also auch mit angemessenen Eigenmitteln unterlegt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ein eigenständiges Instrumentarium zur Handhabung dieser Risiken zu entwickeln. Die diesbezüglichen Bemühungen der Banken drehen sich bisher hauptsächlich um die Identifizierung und Quantifizierung von operationellen Risiken. Dabei kommt die Risikosteuerung als wesentlicher Bestandteil des gesamten Risikomanagementprozesses derzeit noch zu kurz. Gerade aber die Beherrschung und systematische Steuerung von operationellen Risiken gilt als einer der strategisch entscheidenden Erfolgsfaktoren im Konkurrenzkampf zwischen den Banken. Schließlich kann durch eine situationsbedingte Vermeidung, Verminderung oder Abwälzung der Risiken eine entsprechende Wertsteigerung erzielt werden.
Operationelle Risiken haben die Eigenschaft, dass sie nur zum Teil beeinflussbar sind, so dass die Methoden der Risikovermeidung und -verminderung letztendlich nur in begrenztem Umfang anwendbar sind. Der Einsatz von Methoden des Risikotransfers, die finanzielle Konsequenzen von schlagend werdenden Risiken auf Dritte abwälzen, scheint dagegen auf breiterer Basis möglich zu sein. Hier besteht allerdings das Problem, dass die bereits in der Praxis verwendeten Instrumente hauptsächlich traditionelle Versicherungslösungen wesentliche Schwachstellen aufweisen. […]
Das Vorhandensein operationeller Risiken ist, auch wenn es manchmal den Anschein haben mag, keinesfalls eine neue Erkenntnis. Sie zählen vielmehr zu den ältesten Risiken überhaupt, da sie untrennbar mit jeder Art wirtschaftlichen Handelns verbunden sind. Folglich haften sie auch einem jeden Unternehmen an, unabhängig von dessen Geschäftstätigkeit. Während operationelle Risiken bei Industrieunternehmen schon seit je her Beachtung finden, wurden sie in der Bankbranche wegen der scheinbaren Dominanz der Kredit- und Marktrisiken lange Zeit vernachlässigt. Dabei ist der Finanzsektor ganz besonders von der Gefahr durch operationelle Risiken betroffen, wie zahlreiche darauf zurückzuführende Verlustfälle zeigen. Exemplarisch sei hier der Bankrott des britischen Bankhauses Barings, verursacht durch nicht autorisierte und mangelhaft überwachte Handelsgeschäfte eines Mitarbeiters namens Nick Leeson, genannt.
Ereignisse wie dieses veranlassten den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht operationelle Risiken in die Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute neu mit aufzunehmen. Zukünftig müssen diese Risiken also auch mit angemessenen Eigenmitteln unterlegt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ein eigenständiges Instrumentarium zur Handhabung dieser Risiken zu entwickeln. Die diesbezüglichen Bemühungen der Banken drehen sich bisher hauptsächlich um die Identifizierung und Quantifizierung von operationellen Risiken. Dabei kommt die Risikosteuerung als wesentlicher Bestandteil des gesamten Risikomanagementprozesses derzeit noch zu kurz. Gerade aber die Beherrschung und systematische Steuerung von operationellen Risiken gilt als einer der strategisch entscheidenden Erfolgsfaktoren im Konkurrenzkampf zwischen den Banken. Schließlich kann durch eine situationsbedingte Vermeidung, Verminderung oder Abwälzung der Risiken eine entsprechende Wertsteigerung erzielt werden.
Operationelle Risiken haben die Eigenschaft, dass sie nur zum Teil beeinflussbar sind, so dass die Methoden der Risikovermeidung und -verminderung letztendlich nur in begrenztem Umfang anwendbar sind. Der Einsatz von Methoden des Risikotransfers, die finanzielle Konsequenzen von schlagend werdenden Risiken auf Dritte abwälzen, scheint dagegen auf breiterer Basis möglich zu sein. Hier besteht allerdings das Problem, dass die bereits in der Praxis verwendeten Instrumente hauptsächlich traditionelle Versicherungslösungen wesentliche Schwachstellen aufweisen. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Stefan Strahwald
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
ISBN-10: 3-8324-9651-3
ISBN-13: 978-3-8324-9651-7
Druck Diplomica® GmbH, Hamburg, 2006
Zugl. Universität Bayreuth, Bayreuth, Deutschland, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
I
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis ...IV
Abkürzungsverzeichnis ... V
1. Einleitung ...1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung...1
1.2 Zielsetzung...2
1.3 Aufbau der Arbeit...3
2.
Grundlagen des Managements operationeller Risiken ...4
2.1 Charakterisierung operationeller Risiken ...4
2.1.1 Definition und Systematisierung ...4
2.1.2 Abgrenzung zu anderen Risikoarten...6
2.1.3 Besondere
Eigenschaften...8
2.2 Einbezug
operationeller
Risiken in die Unternehmenssteuerung...9
2.2.1 Rechtliche und regulatorische Anforderungen ...9
2.2.2 Ablauf des operationellen Risikomanagements ...11
3.
Ziele und Strategien bei der Steuerung operationeller Risiken ...14
3.1 Zielsetzungen bei der Steuerung operationeller Risiken ...14
3.2 Strategien zur Erreichung der Steuerungsziele...16
3.2.1 Ausgangsbasis für die Strategie-Entscheidung...16
3.2.2 Alternative
Strategien
zur
Steuerung operationeller Risiken ...17
3.2.2.1 Risikoverminderung ...17
3.2.2.2 Risikovermeidung...18
3.2.2.3 Risikotransfer...18
3.2.2.4 Risikoakzeptanz...19
3.2.3 Auswahl und Implementierung einer geeigneten Strategie...20
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
II
4.
Methoden zur Steuerung operationeller Risiken...22
4.1. Überblick ...22
4.2. Versicherungen und versicherungsähnliche Konstrukte ...23
4.2.1 (Externe) Versicherungen...23
4.2.1.1 Funktionsweise und Ausgestaltungen ...23
4.2.1.2 Probleme hinsichtlich Kontrahentenrisiken...26
4.2.1.3 Probleme hinsichtlich Kosten...27
4.2.1.4 Probleme hinsichtlich Deckung...28
4.2.2 Selbst-Versicherung mit Captives ...29
4.2.2.1 Funktionsweise und Ausgestaltungen von selbst
gegründeten Captives ...29
4.2.2.2 Funktionsweise und Ausgestaltungen von gemieteten
Captives ...32
4.2.2.2 Vorteile ...33
4.2.2.3 Nachteile...35
4.2.3 Finite
Risk
Konzepte ...37
4.2.3.1 Funktionsweise und Ausgestaltungen ...37
4.2.3.2 Vorteile ...40
4.2.3.3 Nachteile...41
4.3 Kapitalmarktinstrumente ...43
4.3.1 Operational Risk Linked Bonds ...43
4.3.1.1 Funktionsweise und Ausgestaltung ...43
4.3.1.2 Alternativen zur Bestimmung der Schadensbasis ...46
4.3.1.3 Vorteile ...48
4.3.1.4 Nachteile...50
4.3.2 Operational
Risk
Swaps...51
4.3.2.1 Funktionsweise und Ausgestaltung ...51
4.3.2.2 Vor- und Nachteile ...52
4.4. Bewertung der Steuerungsmethoden ...53
4.4.1 Vergleichende Bewertung aus unternehmerischer Perspektive...53
4.4.1.1 Realisierbarkeit der Ziele...54
4.4.1.2 Kosten...55
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
III
4.4.1.3 Beschränkungen bei der Einsetzbarkeit...56
4.4.2 Aufsichtsrechtliche Bewertung und Anerkennung...58
5. Fazit...60
Literaturverzeichnis ...62
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
IV
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1:
Systematisierung von Risikoursachen ...5
Tabelle 2:
Systematisierung von Verlustereignissen...5
Abbildung 1:
Zusammenhang zwischen den Risikoarten...7
Abbildung 2:
Verlustverteilung ...9
Abbildung 3:
Risikomanagementprozess ...12
Abbildung 4:
Kosten-Nutzen-Funktion ...15
Abbildung 5:
Risikolandkarte...16
Abbildung 6:
Generische Strategieempfehlungen ...20
Abbildung 7:
Versicherungsvertrag...24
Abbildung 8:
Deckungsbereich von Versicherungen ...24
Abbildung 9:
Zusammensetzung der Versicherungsprämie ...27
Abbildung 10: Erstversicherungs-Captive...29
Abbildung 11: Rückversicherungs-Captive...30
Abbildung 12: Funded Cover Konzept...39
Abbildung 13: Operational Risk Linked Bond ...44
Abbildung 14: Varianten eines Operational Risk Linked Bonds ...45
Abbildung 15: Operational Risk Linked Bond mit Einschaltung eines SPV ...46
Abbildung 16: Operational Risk Swap ...52
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
V
Abkürzungsverzeichnis
AMA
Advanced Measurement Approach
bzw. beziehungsweise
ca. circa
d.h. das
heißt
Diss. Dissertation
einschl. einschließlich
f. folgende
(Seite)
ff. fortfolgende
(Seiten)
FIORI
Financial Institutions Operational Risk Insurance
Hrsg. Herausgeber
KonTraG Gesetz
zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
max. maximal
neg. negativ
Nr. Nummer
o.g. oben
genannten
p.a. pro
anno
PCSI
Property Claims Service Index
pos. positiv
S. Seite
sog.
so genannte, so genanntes
SPV
Special Purpose Vehicel
u.a. und
andere
usw.
und so weiter
VG Versicherungsgeber
vgl. vergleiche
z.B. zum
Beispiel
zugl. zugleich
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
1
1.
Einleitung
1.1
Ausgangslage und Problemstellung
Das Vorhandensein operationeller Risiken ist, auch wenn es manchmal den
Anschein haben mag, keinesfalls eine neue Erkenntnis. Sie zählen vielmehr zu
den ältesten Risiken überhaupt, da sie untrennbar mit jeder Art wirtschaftlichen
Handelns verbunden sind.
1
Folglich haften sie auch einem jeden Unternehmen an,
unabhängig von dessen Geschäftstätigkeit. Während operationelle Risiken bei
Industrieunternehmen schon seit je her Beachtung finden, wurden sie in der
Bankbranche wegen der scheinbaren Dominanz der Kredit- und Marktrisiken
lange Zeit vernachlässigt.
2
Dabei ist der Finanzsektor ganz besonders von der
Gefahr durch operationelle Risiken betroffen, wie zahlreiche darauf
zurückzuführende Verlustfälle zeigen.
3
Exemplarisch sei hier der Bankrott des
britischen Bankhauses Barings, verursacht durch nicht autorisierte und mangelhaft
überwachte Handelsgeschäfte eines Mitarbeiters namens Nick Leeson, genannt.
4
Ereignisse wie dieses veranlassten den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
operationelle Risiken in die Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute neu mit
aufzunehmen. Zukünftig müssen diese Risiken also auch mit angemessenen
Eigenmitteln unterlegt werden.
5
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ein
eigenständiges Instrumentarium zur Handhabung dieser Risiken zu entwickeln.
Die diesbezüglichen Bemühungen der Banken drehen sich bisher hauptsächlich
um die Identifizierung und Quantifizierung von operationellen Risiken.
6
Dabei
kommt die Risikosteuerung als wesentlicher Bestandteil des gesamten Risiko-
managementprozesses derzeit noch zu kurz. Gerade aber die Beherrschung und
1
Vgl. Romeike (2004), S. 16.
2
Vgl. Jovic/Piaz (2001), S. 923.
3
Vgl. Hoffman (2002), S. XXVI. Eine Auflistung von Verlustfällen aus operationellen Risiken
findet sich beispielsweise bei King (2001), S. 24-33.
4
Der Händler Nick Leeson hatte in erheblichem Umfang in Optionen auf den Nikkei-Index
investiert. Diese Geschäfte waren zumindest in dieser Höhe nicht von der
Unternehmensführung autorisiert, konnten aber durch raffinierte Verschleierungsaktionen von
Nick Leeson geheim gehalten werden. Eine Naturkatastrophe führte schließlich zu einem
heftigen Einbruch des Nikkei-Index. Insgesamt entstanden Verluste in Höhe von etwa 1,4
Milliarden US-Dollar. Eine ausführliche Erläuterung dieses Beispiels gibt Erben (2004), S. 47-
50.
5
Vgl. hierzu Kapitel 2.2.1.
6
Vgl. Dresel/Duldinger/Von Zanthier (2003), S. 472.
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
2
systematische Steuerung von operationellen Risiken gilt als einer der strategisch
entscheidenden Erfolgsfaktoren im Konkurrenzkampf zwischen den Banken.
7
Schließlich kann durch eine situationsbedingte Vermeidung, Verminderung oder
Abwälzung der Risiken eine entsprechende Wertsteigerung erzielt werden.
Operationelle Risiken haben die Eigenschaft, dass sie nur zum Teil beeinflussbar
sind, so dass die Methoden der Risikovermeidung und -verminderung letztendlich
nur in begrenztem Umfang anwendbar sind. Der Einsatz von Methoden des
Risikotransfers, die finanzielle Konsequenzen von schlagend werdenden Risiken
auf Dritte abwälzen, scheint dagegen auf breiterer Basis möglich zu sein. Hier
besteht allerdings das Problem, dass die bereits in der Praxis verwendeten
Instrumente hauptsächlich traditionelle Versicherungslösungen wesentliche
Schwachstellen aufweisen.
8
Deswegen werden neuartige, innovative Transfer-
methoden benötigt, um in der Folge eine optimale Risikobewältigung zu
gewährleisten.
1.2 Zielsetzung
Zielsetzung dieser Arbeit ist zum einen die Darstellung von innovativen
Methoden zur Steuerung operationeller Risiken und zum anderen deren
Bewertung aus unternehmerischer Perspektive.
,Innovativ' sollte in diesem Zusammenhang nicht als ,revolutionär', sondern
vielmehr als ,evolutionär' verstanden werden. Durch das Aufzeigen der Grenzen
traditioneller Instrumente wird die Notwendigkeit für neue, weiterentwickelte
Produkte aufgezeigt.
Den Schwerpunkt der Analyse bilden die Methoden des Risikotransfers. Dabei
besteht allerdings nicht der Anspruch auf eine abschließende Vorstellung aller
denkbaren Varianten, sondern eher auf eine detaillierte Erläuterung wesentlicher
Grundkonzepte.
Weiterhin ist anzumerken, dass sich die Ausführungen in dieser Arbeit
vorwiegend auf Kreditinstitute beziehen. Daher wird stets auch auf
7
Vgl. Van den Brink (2001), Einführung.
8
Vgl. hierzu Kapitel 4.2.1.2 bis 4.2.1.4.
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
3
Besonderheiten und Probleme im Zusammenhang mit Basel II hingewiesen.
Insgesamt wurde aber versucht, die Arbeit so allgemeingültig wie möglich zu
halten, da die dargestellten Steuerungsmethoden grundsätzlich auch für andere
Dienstleistungs- und Industrieunternehmen anwendbar sind.
1.3
Aufbau der Arbeit
Um eine entsprechende Arbeitsgrundlage zu schaffen, erfolgt in Kapitel 2
zunächst eine Definition operationeller Risiken. Dies beinhaltet auch eine
Abgrenzung zu anderen Risikoarten sowie eine knappe Zusammenstellung
charakteristischer Eigenschaften. Außerdem wird kurz aufgezeigt, welche
(aufsichts-)rechtlichen Anforderungen an das Management operationeller Risiken
bestehen und wie dessen Ablauf ist.
In Kapitel 3 folgt dann die Beschreibung des Steuerungsprozesses als Teil des
allgemeinen operationellen Risikomanagements. Neben den Zielen werden dabei
insbesondere die verschiedenen Bewältigungsstrategien erläutert.
Kapitel 4 stellt mit der Darstellung der Methoden zum Transfer operationeller
Risiken den Kern der Arbeit dar. Hier wird ausführlich die Funktionsweise der
einzelnen Konzepte dargelegt und anschließend deren Vor- und Nachteile
gegenüber traditionellen Versicherungen, die anfangs vorgestellt werden,
herausgearbeitet. Am Ende findet sowohl aus unternehmerischer, als auch aus
aufsichtsrechtlicher Perspektive eine vergleichende Bewertung der verschiedenen
Methoden statt.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 5, in dem alle wichtigen
Erkenntnisse noch einmal zusammenfassend dargestellt werden.
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
4
2.
Grundlagen des Managements operationeller Risiken
2.1
Charakterisierung operationeller Risiken
2.1.1
Definition und Systematisierung
Voraussetzung für ein effektives Management operationeller Risiken ist deren
eindeutige und unmissverständliche Definition. Dies ist aber längst nicht so
einfach wie beispielsweise bei Markt- und Kreditrisiken, da unter dem Begriff
,Operationelle Risiken' eine ganze Reihe heterogener Risikokategorien gebündelt
werden.
9
Arbeitsgrundlage für die folgenden Ausführungen soll die mittlerweile
auch in der Praxis etablierte Definition des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
sein:
,,Operationelles Risiko ist die Gefahr von Verlusten, die infolge einer
Unzulänglichkeit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und
Systemen oder infolge externer Ereignisse eintreten."
10
Diese Formulierung ist allerdings noch sehr abstrakt und möglicherweise nicht
klar verständlich, so dass eine weitere Konkretisierung unumgänglich ist.
Erzielbar ist dies beispielsweise durch eine Untergliederung der Risikotreiber
bzw. Risikoursachen ,Interne Verfahren', ,Menschen', ,Systeme' und ,externe
Ereignisse' (vgl. Tabelle 1).
Problematisch dabei ist, dass ein Risiko nicht selten auf eine Kombination
mehrerer Ursachen zurückzuführen ist, so dass in vielen Fällen keine eindeutige
Zuordnung möglich ist.
11
Beispielweise können für einen Datenverlust sowohl ein
Computerausfall (Ursache System), als auch eine nicht durchgeführte
Datensicherung (Ursache Mensch oder Prozess) verantwortlich sein. Aus diesem
Grund schlägt der Baseler Ausschuss eine Systematisierung nach
Verlustereignissen vor. Statt danach zu fragen, warum ein Verlust entstanden ist,
wird nun danach gefragt, was überhaupt passiert ist. Auf diese Weise kann noch
am ehesten eine überschneidungsfreie Abgrenzung der einzelnen operationellen
Risiken erreicht werden (vgl. Tabelle 2).
12
9
Z.B. Betrug, Naturkatastrophen, Systemausfälle, Modellfehler; vgl. auch Peemöller/Friedrich
(2002), S. 44f.
10
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (2004), Abs. 644.
11
Vgl. Küng (2003), S. 14.
12
Vgl. Küng (2003), S. 14.
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
5
Risikoursachen
(1.Ebene)
Risikoursachen
(2.Ebene)
Beispiele
Verhalten
Veruntreuung,
mangelhafte Beratung
Menschen
(Mitarbeiter)
Spezialwissen
Mangelhafte Qualifikation,
Abgang von Schlüsselpersonal
Katastrophen Naturgewalten,
Brand
Externe Faktoren
(Externe) kriminelle
Handlungen
Betrug, Raub,
Sachbeschädigung
Hardware &
technische Infrastruktur
Systemausfall,
veraltete Systeme
Systeme
Software
Programmfehler,
Inkompatibilitäten
Planung, Steuerung &
Kontrolle
Planungsfehler,
Abwicklungsfehler
Interne Verfahren
(Prozesse)
Geschäftsanweisungen
Unsachgemäße Richtlinien,
Mangelhafte Umsetzung
rechtlicher Anforderungen
Tabelle 1:
Systematisierung von Risikoursachen
Quelle:
eigene
Darstellung
Ereigniskategorie
Definition
Interne betrügerische
Handlungen
Verluste aufgrund von Handlungen mit
betrügerischer Absicht, Veruntreuung, Umgehung
von Vorschriften, Gesetzen oder internen
Bestimmungen, an denen mindestens eine interne
Partei beteiligt ist; ausgenommen sind Ereignisse,
die auf Diskriminierung oder (sozialer und
kultureller) Verschiedenheit beruhen
Externe betrügerische
Handlungen
Verluste aufgrund von Handlungen mit
betrügerischer Absicht, Veruntreuung oder der
Umgehung von Gesetzen durch einen Dritten
Beschäftigungspraxis und
Arbeitsplatzunsicherheit
Verluste aufgrund von Handlungen, die gegen
Beschäftigungs-, Gesundheits- oder Sicherheits-
vorschriften bzw. -abkommen verstoßen; Verluste
aufgrund von Zahlungen aus Ansprüchen wegen
Körperverletzung; Verluste aufgrund von Dis-
kriminierung bzw. sozialer und kultureller
Verschiedenheit
Kunden, Produkte und
Geschäftsgepflogenheiten
Verluste aufgrund einer unbeabsichtigten oder
fahrlässigen Nichterfüllung geschäftlicher
Verpflichtungen gegenüber bestimmten Kunden
(einschl. treuhänderischer und auf Angemessen-
heit beruhender Verpflichtungen); Verluste
aufgrund der Art oder Struktur eines Produkts
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
6
Sachschäden
Verluste aufgrund von Beschädigungen oder
Verlust von
Sachvermögen durch Natur-
katastrophen oder andere
Ereignisse
Geschäftsunterbrechungen
und Systemausfälle
Verluste aufgrund von Geschäftsunterbrechungen
oder
Systemausfällen
Abwicklung, Lieferung
und Prozessmanagement
Verluste aufgrund von Fehlern bei der Geschäfts-
abwicklung
oder im Prozessmanagement;
Verluste aus
Beziehungen mit Handelspartnern
und
Lieferanten/Anbietern
Tabelle 2: Systematisierung von Verlustereignissen
Quelle: Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (2004), Anhang 7.
2.1.2
Abgrenzung zu anderen Risikoarten
Eine eindeutige, überschneidungsfreie Abgrenzung ist nicht nur untereinander,
sondern auch zu anderen Risikoarten erforderlich. Für die verschiedenen
Risikoarten existieren schließlich sowohl unterschiedliche Steuerungsstrategien,
als auch unterschiedliche regulatorische Vorschriften bezüglich der Eigenkapital-
unterlegung. Nicht zuletzt deshalb könnten Fehl- oder Doppelerfassungen zu
entscheidenden Wettbewerbsnachteilen führen.
Die Abgrenzung ist allerdings nicht immer einfach, da gelegentlich
Überlappungen zwischen operationellen Risiken auf der einen Seite und Markt-
und Kreditrisiken auf der anderen Seite entstehen. Beispielsweise kann ein
Verlust aus einem Kreditgeschäft sowohl auf einen nicht vorhersehbaren Ausfall
des Kreditnehmers (Kreditrisiko), als auch auf Falschangaben bei der
Beantragung des Kredites (operationelles Risiko) zurückzuführen sein.
13
Unterschiedliche Meinungen existieren außerdem, ob Rechtsrisiken, strategische
Risiken und Reputationsrisiken zu den operationellen Risiken zählen oder als
eigenständige Risikoart betrachtet werden sollten.
14
Der Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht sieht Rechtsrisiken als integralen Bestandteil von operationellen
Risiken, während die beiden anderen Kategorien explizit ausgeschlossen
13
Weitere Beispiele für Abgrenzungsschwierigkeiten finden sich bei Kaiser/Köhne (2004), S.
26f.
14
Vgl. Minz (2004), S. 25.
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
7
werden.
15
Strategische Risiken und Reputationsrisiken bleiben aber nicht
unberücksichtigt weil diese von geringerer Bedeutung wären
16
, sondern weil sie
nahezu unmöglich zu erfassen sind.
17
Die isolierte Betrachtung ist zudem
berechtigt, da sie eher als vor- bzw. nachgelagerte Risikoarten zu verstehen sind.
Strategische Entscheidungen haben nämlich wesentlichen Einfluss auf die
Ausprägung von operationellen Risiken sowie von Markt- und Kreditrisiken.
Dagegen resultieren Reputationsrisiken erst als Konsequenz anderer Risiken.
18
Abbildung 1: Zusammenhang zwischen den Risikoarten
Quelle: in Anlehnung an Van den Brink (2002), S. 107.
15
Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2004), Abs. 644. Strategische Risiken und
Reputationsrisiken werden vom Baseler Ausschuss unter ,Andere Risiken' eingeordnet; vgl.
Basel Committee on Banking Supervision (2004), Abs. 742.
16
Der Schaden aus strategischen und Reputationsrisiken kann sogar um ein Vielfaches höher
sein, als bei direkten Verlusten aus Kredit-, Markt- oder operationellen Risiken; vgl. Pézier
(2003), S. 60; Van den Brink (2001), S. 4.
17
Vgl. Pézier (2003), S. 60; Hoffman (2002), S. 40.
18
Vgl. Hofmann (2002), S. 15; Münchbach (2001), S. 14.
Marktrisiken
Kreditrisiken
Operationelle
Risiken
Strategische Risiken
Reputationsrisiken
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
8
2.1.3 Besondere
Eigenschaften
Aus der oben genannten Definition wird bereits ersichtlich, dass operationelle
Risiken einseitig auf die ,Gefahr' von negativen Folgen im Sinne von Verlusten
beschränkt sind. Die ,Chance' auf positive Erträge, die nach modernem
Risikoverständnis explizit zu berücksichtigen ist, besteht in diesem Fall gar
nicht.
19
Operationelle Risiken werden auch niemals mit der Absicht eingegangen
Gewinne zu erzielen, wie dies bei Kredit- und Marktrisiken üblich ist. Sie lassen
sich vielmehr durch den normalen Geschäftsbetrieb nicht (vollständig)
ausschließen.
20
Unabhängig von Unternehmensbranche und -bereich sind sie stets
latent vorhanden und können theoretisch auftreten, noch bevor es überhaupt zu
einem Kunden- oder Eigengeschäft kommt.
21
Zwar können viele der Risiken
durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen reduziert werden, aber ihre
Beeinflussbarkeit ist längst nicht immer gegeben (z.B. bei extern verursachten
Naturkatastrophen).
22
Während bei Markt- und Kreditrisiken das Verlustpotenzial durch den Marktwert
bzw. das Kreditvolumen beschränkt wird
23
, ist der mögliche Verlust bei
operationellen Risiken nahezu unbegrenzt.
24
In der Regel treten aber wirklich
existenzbedrohende Verluste (sog. Stress-Verluste) relativ selten auf, wohingegen
aber mit einer Vielzahl von Verlusten mit relativ geringem Ausmaß gerechnet
werden muss. Die Gesamtverlustverteilungskurve ist also stark linksschief (vgl.
Abbildung 2).
19
Ausnahmen sind höchstens Zufallsprodukte (z.B. Kassenplusbestände); vgl. Schiller/Bitz
(2003), S. 36.
20
Vgl. Schiller/Bitz (2003), S. 36.
21
Vgl. Minz (2004), S. 1.
22
Vgl. Münchbach (2001), S. 25f.
23
Eventuelle Folgeschäden, z.B. Reputationsverluste, werden dabei nicht berücksichtigt.
24
Vgl. Kaiser/Köhne (2004), S. 25.
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
9
Abbildung 2: Verlustverteilung
Quelle: in Anlehnung an Schierenbeck (2001), S. 343.
2.2
Einbezug operationeller Risiken in die Unternehmenssteuerung
2.2.1
Rechtliche und regulatorische Anforderungen
Das Management operationeller Risiken ist zweifellos ein wichtiger Bestandteil
der Unternehmenssteuerung. Schlagend werdende Risiken können schließlich den
Fortbestand des Unternehmens ernsthaft gefährden. In vielen Ländern sind
deshalb gesetzliche Regelungen entstanden, die Unternehmen zur Einführung
eines Risikomanagementsystems, welches insbesondere auch operationelle
Risiken berücksichtigen sollte, verpflichten.
25
Auch der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat die hohe Bedeutung von
operationellen Risiken erkannt. Untersuchungen bei führenden Großbanken haben
gezeigt, dass diese bis zu 20% des Gesamtrisikos ausmachen und bei einigen
Instituten sogar bedeutsamer als Markt- und Kreditrisiken sind.
26
Der Baseler
25
Hierzu zählt auch das deutsche Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG). Weitere Beispiele nennt King (2001), S. 40-43. In diesen Gesetzen ist zwar nicht
explizit die Rede von operationellen Risiken, allerdings sind diese ein wesentlicher Bestandteil
des Gesamtrisikos und müssen daher auf jeden Fall berücksichtigt werden; vgl. auch
Kaiser/Köhne (2004), S. 10 und Minz (2004), S. 37.
26
Vgl. Lammers (2005), S. 10; Cruz (2002), S. 1.
Verlusthäufigkeit
Verlusttragweite
Innovative Methoden zur Steuerung operationeller Risiken
10
Ausschuss plant daher in den neuen Eigenkapitalrichtlinien (Basel II) eine
explizite Unterlegungspflicht für operationelle Risiken einzuführen.
27
Die Kreditinstitute haben dabei die Wahl, ob sie eine pauschale Eigenmittel-
unterlegung, die sich nach der Höhe des Bruttoertrags richtet, bevorzugen oder
mit eigenen Methoden der Risikoquantifizierung eine risikosensitivere Kapital-
unterlegung anstreben.
Beim einfachsten Ansatz, dem so genannten Basisindikatoransatz (Basic Indicator
Approach), beträgt die Eigenkapitalanforderung für operationelle Risiken genau
15% des jährlichen Bruttoertrags.
28
Nach Erkenntnissen des Baseler Ausschusses
ist der Bruttoertrag positiv mit operationellen Verlusten korreliert und daher ein
geeigneter Indikator für die Risikointensität.
29
Der Standardansatz (Standardised Approach) unterscheidet sich methodisch nur
geringfügig vom Basisindikatoransatz. Hierbei sind die Tätigkeiten der Bank
zunächst in acht Geschäftsfelder aufzuteilen, für die jeweils der jährliche Brutto-
betrag ermittelt und dann mit einem vorgegebenen Unterlegungsfaktor (beträgt je
nach Geschäftsfeld 12%, 15% oder 18%) multipliziert werden muss.
30
Basisindikator- und Standardansatz haben jedoch den Nachteil, dass Investitionen
in ein besseres Risikomanagement nicht im Geringsten honoriert werden.
31
Eigentlich sollten solche Investitionen eine reduzierte Eigenkapitalanforderung
nach sich ziehen, faktisch geschieht jedoch eher das Gegenteil. Schließlich lässt
sich durch gezielte Steuerungsmaßnahmen eine Erhöhung des Bruttoertrags
erreichen, was demzufolge zu einer höheren Eigenkapitalunterlegung führt.
Eine effektive Kapitalentlastung ist nur mit den fortschrittlichen Ansätzen
(Advanced Measurement Approaches) erreichbar. Hierbei gibt die Aufsicht keine
konkreten Modelle vor, sondern überlässt es der Bank eigene Verfahren zur
Berechnung des tatsächlichen Risikos und der notwendigen Eigenkapital-
unterlegung zu entwickeln und einzusetzen. Es müssen lediglich gewisse
27
Neben der quantitativen Eigenmittelunterlegung werden noch zusätzliche qualitative
Anforderungen an das Management operationeller Risiken gestellt; vgl. hierzu Basel
Committee on Banking Supervision (2003a), Abs. 10-51.
28
Der Bruttoertrag wird dabei als Dreijahresdurchschnitt berechnet, wobei nur Jahre mit
positiven Erträgen berücksichtigt werden; vgl. Basel Committee on Banking Supervision
(2004), Abs. 649.
29
Vgl. Deutsche Bundesbank (2004), S. 87.
30
Vgl. Basel Committee on Banking Supervision (2004), Abs. 652ff.
31
Vgl. Van den Brink (2002), S. 108.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832496517
- ISBN (Paperback)
- 9783838696515
- DOI
- 10.3239/9783832496517
- Dateigröße
- 592 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bayreuth – Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Juni)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- basel risikomanagement versicherung derivate risiko
- Produktsicherheit
- Diplom.de