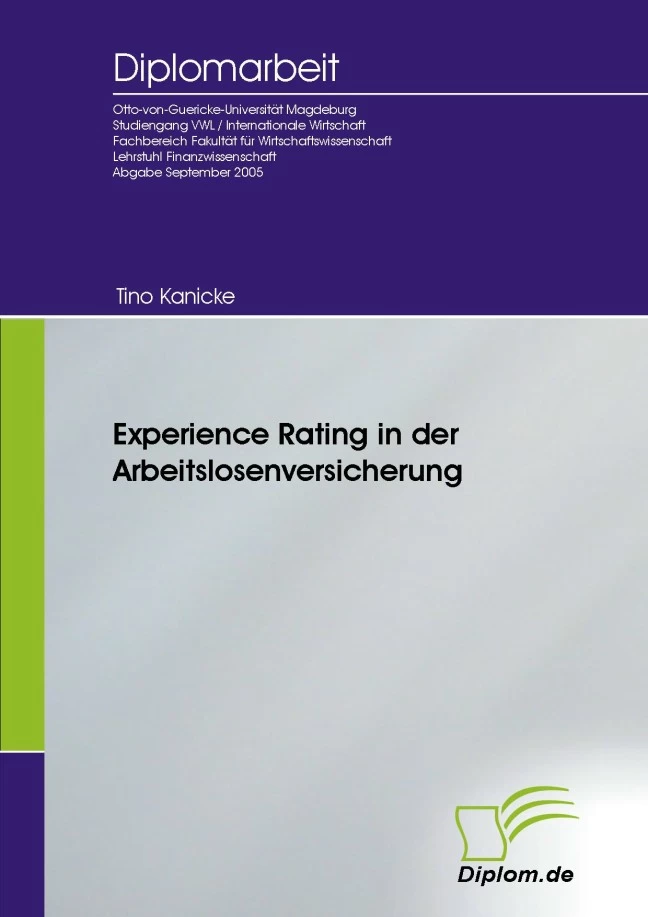Experience Rating in der Arbeitslosenversicherung
Zusammenfassung
Mit über 4,7 Millionen registrierten Arbeitslosen erfährt der deutsche Arbeitsmarkt derzeit seine schwerste Krise seit Ende des zweiten Weltkriegs. Eine oft genannte Ursache für die hohe Arbeitslosigkeit ist die Entwicklung der Weltwirtschaft. Dies scheint jedoch nicht die alleinige Erklärung zu sein. Bei einem Vergleich der Arbeitslosenquoten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Deutschlands über den Zeitraum der letzten zehn Jahre verdeutlicht, dass die der Vereinigten Staaten weitaus geringere Schwankungen aufweist. Eine allgemeingültige Erklärung dafür ist schwerlich zu geben, vielmehr sind es eine ganze Reihe von Faktoren die diesen Unterschied zur Entwicklung in Deutschland beeinflussen.
Als bedeutende Faktoren sind dabei die Ausgestaltung der US amerikanischen Arbeitslosenversicherung sowie die der sonstigen sozialen Sicherungssysteme zu nennen. Ausgehend von der durchschnittlich weitaus niedrigeren Höhe des Lohnersatzes sowie deutlich kürzeren Maximalbezugszeiten ist davon auszugehen, dass die Versicherten in den Vereinigten Staaten einen größeren Anreiz haben, zum einen eine mögliche Arbeitslosigkeit zu verhindern und zum anderen im Fall der Arbeitslosigkeit sich möglichst intensiv um eine neue Beschäftigung zu bemühen. Jedoch wurde vor allem mit dem Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ein erster wichtiger Schritt zur stärkeren Motivation der deutschen Versicherten gemacht, die Wahrscheinlichkeit und Dauer einer möglichen Arbeitslosigkeit zu reduzieren.
Aus dem Vergleich der Arbeitslosenversicherungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten ergibt sich jedoch noch ein weiterer und wie sich zeigen wird ein nicht unbedeutender Unterschied. Dieser liegt in der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. Während in Deutschland der für alle Beitragszahler einheitliche Beitragssatz zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern entrichtet wird, sind in den Vereinigten Staaten allein die Unternehmen für die Mittelaufbringung verantwortlich, wobei sich jedoch ihre Beiträge unterscheiden. Die Ursache für diese Beitragsdifferenzierung liegt in dem so genannten experience rating. Diese Methode der Beitragsberechnung berücksichtigt die der Arbeitslosenversicherung durch die von einem Unternehmen bisher entlassenen Mitarbeiter verursachten Kosten sowie die von ihm eingezahlten Beiträge. Daher verändert sich die Höhe der Arbeitslosensteuer eines Unternehmens jeweils zum […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 EINLEITUNG
2 Die deutsche und US amerikanische Arbeitslosenversicherungen
2.1 Die deutsche Arbeitslosenversicherung
2.1.1 Die Geschichte der deutschen Arbeitslosenversicherung
2.1.2 Die Leistungen der deutschen Arbeitslosenversicherung
2.1.3 Die Finanzierung der deutschen Arbeitslosenversicherung
2.2 Die Arbeitslosenversicherung der Vereinigten Staaten von Amerika
2.2.1 Die Leistungen der Arbeitslosenversicherungen in den Vereinigten Staaten
2.2.2 Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherungen in den Vereinigten Staaten
2.3 Verhaltensrisiken in der Arbeitslosenversicherung
2.3.1 Moral hazard der Versicherten
2.3.2 Moral hazard der Unternehmen
2.3.3 Moral hazard der Gewerkschaften
3 Einheitliche Lohnsummensteuer versus Experience Rating
3.1 Effekt der Berücksichtigung der Arbeitslosenversicherungskosten
3.1.1 Annahmen des Modells
3.1.2 Keine Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Arbeitslosenversicherung
3.1.3 Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Arbeitslosenversicherung
3.1.4 Wohlfahrtseffekte einer Internalisierung der Kosten
3.2 Das Modell von Albrecht und Vroman
3.2.1 Annahmen des Modells
3.2.2 Das Anstrengungsniveau
3.2.3 Arbeitsnachfrage und Lohnsetzung
3.2.4 Das Gleichgewicht
3.2.5 Numerische Lösung
3.3 Diskussion der Ergebnisse
4 Empirische Evidenz und Diskussion
5 Schlussbemerkung
6 Quellenverzeichnis
7 Mathematischer Anhang
8 Tabellenanhang
9 Eidesstattliche Erklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Entwicklung der Beitragssätze zur Arbeitslosen- versicherung, der Arbeitslosenquoten in Deutschland von 1989 bis 2003 und der jährliche Bundeszuschuss
Abbildung 2 Vergleich der monatlichen Arbeitslosenquoten in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Januar 1995 bis April 2005
Abbildung 3 Durchschnittliches Arbeitslosengeld im Vergleich zum vorherigen Durchschnittseinkommen der Arbeitslosen in ausgewählten Bundesstaaten
Abbildung 4 Die Bestimmung des unternehmensspezifischen Steuersatzes
Abbildung 5 Gleichgewicht ohne Internalisierung der Arbeitslosen-versicherungskosten
Abbildung 6 Gleichgewicht ohne Internalisierung der Arbeitslosen-versicherungskosten in einer Zwei-Regionen-Ökonomie vor Schock
Abbildung 7 Gleichgewicht ohne Internalisierung der Arbeitslosen-versicherungskosten in einer Zwei-Regionen-Ökonomie nach Schock
Abbildung 8 Gleichgewicht nach Internalisierung der Arbeitslosenversicherungskosten
Abbildung 9 Gleichgewicht nach Internalisierung der Arbeitslosen-versicherungskosten in einer Region vor und einer Region nach einem Preisschock
Abbildung 10 Wohlfahrt vor und nach einer Internalisierung der Kosten
Abbildung 11 Wohlfahrt nach einem Preisschock ohne Internalisierung der Kosten
Abbildung 12 Wohlfahrt nach einem Preisschock und nach Internalisierung der Kosten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Maximale Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes
Tabelle 2 Annahme der exogenen Größen für die numerische Lösung
Tabelle 3 Die Ergebnisse der numerischen Lösung
Tabelle 4 Fleißigenanteil, Durchschnittsproduktivität und aggregierter Output
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 EINLEITUNG
Unter dem Eindruck von 4,37 Millionen Arbeitslosen und daraus für die Bundesagentur für Arbeit resultierenden Kosten von über 50 Milliarden Euro im Jahr 2003, stellte der Sachverständigenrat (2003) eine Reihe von Reformvorschlägen zur Steuer-, Arbeitsmarkt- und Geldpolitik vor, die helfen sollen, zum einen der deutschen Wirtschaft konjunkturelle Impulse zu verleihen und zum anderen das deutsche Steuer- und Sozialsystem effizienter zu gestalten. Die Vorschläge zur Arbeitsmarktpolitik bezogen sich unter anderem auf eine Flexibilisierung des Tarifvertragsrechts, der Reduzierung des Kündigungsschutzes und der Reform der Arbeitslosenversicherung. Letzterer beinhaltete eine Umgestaltung deren Finanzierung. So kritisiert der Sachverständigenrat (2003), dass Unternehmen, aufgrund des einheitlichen Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung in Deutschland in Bezug auf ihre Entlassungsentscheidungen, den für die Arbeitslosenversicherung entstehenden Schaden nicht berücksichtigen, und empfiehlt die Einführung differenzierter Unternehmensbeiträge, welche sich an deren Entlassungsverhalten orientieren.
Mit dem Hintergrund, dass nach der Zusammenlegung der deutschen Arbeitslosen- und Sozialhilfe Anfang 2005 die Zahl der registrierten Arbeitslosen im selben Jahr zeitweise auf über fünf Millionen gestiegen ist, soll diese Arbeit diesen Reformvorschlag näher untersuchen. Wie der Sachverständigenrat (2003) bemerkt, existiert bereits ein derartiges Finanzierungssystem. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von den Unternehmen zu zahlen. Jedoch unterscheiden sich deren Beiträge, da diese sich an deren Entlassungsverhalten orientieren. Diese Methode wird im Allgemeinen experience rating genannt und soll in dieser Arbeit näher dargestellt werden. Das Ziel dieser Arbeit soll es auf der einen Seite sein, zu zeigen, worin genau der Unterschied zwischen den Finanzierungssystemen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten besteht und welche unterschiedlichen Auswirkungen sie auf die Arbeitslosigkeit und die Wohlfahrt haben. Auf der anderen Seite soll unter Verwendung der Erkenntnisse aus dieser und aus einer Reihe anderer Arbeiten die vom Sachverständigenrat (2003) vorgeschlagene Einführung des experience rating als Finanzierungsbestandteil der deutschen Arbeitslosenversicherung diskutiert werden.
Da es offensichtlich deutliche Unterschiede in den Arbeitslosenversicherungen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten gibt, werden beide Systeme auf ihre institutionellen Eigenschaften untersucht, um dadurch auf die Wirkungsweise und Effektivität der jeweiligen Finanzierungsart schließen zu können. Somit werden im Teil 2 dieser Arbeit zum einen die beiden Arbeitslosenversicherungen ausführlich erläutert, wobei es für die weitere Betrachtung notwendig ist, neben der Finanzierung beider Versicherungen auch deren Leistungen zu betrachten. Sich voneinander unterscheidende Finanzierungssysteme und Versicherungsleistungen implizieren voneinander abweichende Anreize, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Daher soll zum anderen im zweiten Teil dieser Arbeit gezeigt werden, welchen Verhaltensrisiken die Arbeitslosenversicherungen in den beiden betrachteten Ländern gegenüberstehen, um daraus auf die unterschiedlichen Anreize der Versicherten, Unternehmen und Gewerkschaften schließen zu können.
Anhand zweier Modelle sollen im dritten Teil dieser Arbeit die Auswirkungen beider Finanzierungsarten auf das Beschäftigungsniveau und die Gesamtwohlfahrt einer Ökonomie verdeutlicht werden. Dabei wird im ersten Abschnitt des dritten Teils verdeutlicht, welche generellen Auswirkungen eine fehlende Berücksichtigung der Kosten der Arbeitslosenversicherung bei der Entlassungsentscheidung nach sich zieht. Um die Effekte besser Veranschaulichen zu können, ist dieses Modell jedoch recht einfach gehalten. Das zweite vorgestellte Modell, ein Effizienzlohnmodell mit heterogenen Firmen und Arbeitern von Albrecht und Vroman (1999), vergleicht ein einheitlich lohnsummensteuerfinanziertes mit einem auf experience rating - basierten System, um in einer wirklichkeitsnäheren Umgebung die Erkenntnisse des ersten Modells anhand einer numerischen Lösung zu bestätigen.
Mit Teil 4 dieser Arbeit schließt sich an die modelltheoretische Betrachtung eine Diskussion der Erkenntnisse aus dem zweiten und dritten Teil dieser Arbeit im Kontext diverser empirischer und theoretischer Arbeiten an. Darauf aufbauend wird im fünften und letzten Teil dieser Arbeit eine kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse und einige Empfehlungen für die Ausgestaltung des deutschen Finanzierungssystems gegeben.
2 Die deutsche und US amerikanische Arbeitslosenversicherungen
2.1 Die deutsche Arbeitslosenversicherung
Um über Fehlanreize und eine effiziente Beitragsgestaltung der deutschen Arbeitslosenversicherung zu diskutieren, ist es hilfreich deren derzeitigen Aufbau und ihre Aufgaben und Leistungen zu betrachten. Daher soll im folgenden Abschnitt die Veränderungen der Bezugsdauern, der Leistungen und der Finanzierung im Kontext der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung eingehend dargestellt werden.
2.1.1 Die Geschichte der deutschen Arbeitslosenversicherung
Bis in die 1920er Jahre existierte laut Glismann und Schrader (2002) keine Arbeitslosenversicherung. Dabei wird eine solche Versicherung definiert als „Institution (…) die gegen Prämienzahlung für einige Zeit dem versicherten Arbeitslosen finanzielle Leistung zukommen lässt; die Höhe dieser Leistung steht im funktionalen Zusammenhang mit der Prämienhöhe, und die Leistung ist einklagbar.“ (Glismann und Schrader 2002, S. 8) Jedoch gab es eine Reihe von Institutionen, welche eine soziale Absicherung Arbeitsloser zum Ziel hatten. So gab es diverse Unterstützungskassen, Selbsthilfekassen und vereinzelt Hilfsfonds von Unternehmen, die jedoch alle spätestens mit Beginn des ersten Weltkriegs wieder verschwanden (vgl. Glismann und Schrader 2002, S.10).
Mit dem Mitte der 1920er Jahre in dieser Dimension erstmaligen Auftreten des Phänomens Massenarbeitslosigkeit[1] in Deutschland wurde die Notwendigkeit einer reichseinheitlichen Unterstützung von Erwerbslosen unübersehbar. Das Inkrafttreten des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) und damit die Einführung der Arbeitslosenversicherung in Deutschland im Jahr 1927 war nach Ansicht von Spree (2001) keine grundlegende Neuerung, sondern vielmehr eine „Kodifizierung und Vereinheitlichung vorhandener Regelungen“ (Spree 2001, S.168) wie beispielsweise der zuvor eingeführten Erwerbslosenfürsorge[2].
Glismann und Schrader (2002) stellen fest, dass wesentliche Eigenschaften der Arbeitslosenversicherung bis heute Bestand haben. In diesem Zusammenhang werden die risikounabhängigen und nur an das Einkommen gekoppelten Prämien und Arbeitslosengeldzahlungen, die gleichmäßige Beteiligung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer an den Beiträgen, das Arbeitsvermittlungsmonopol des Staates, eine vom Gesetzgeber definierte maximale Bezugsdauer und der Charakter einer Pflichtversicherung genannt.
Die deutsche Arbeitslosenversicherung sollte laut Eekhoff und Milleker (2000) nach ihrer Einführung als gesetzliche Pflichtversicherung Einkommensverluste in konjunkturellen Schwächephasen über einen begrenzten Zeitraum, die Zeit der Arbeitsuche, teilweise ausgleichen und darüber hinaus auch als Ausgleich für den konjunkturell bedingten Nachfragerückgang dienen. Es ist eben diese antizyklische Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, die, so Bertold und von Berchem (2004), neben positiven Wohlfahrtseffekten aufgrund einer breiteren Risikoverteilung und der Ermöglichung einer selektiven Jobsuche[3], der Arbeitslosenversicherung eine „allokativ begründbare ökonomische Existenzbegründung“ (Bertold und von Berchem 2004, S.2) gibt.
Seit Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre war Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik kein nennenswertes Problem. Laut Glismann und Schrader (2002) stand die 1951 gesetzlich wieder eingeführte Arbeitslosenversicherung ganz in der Tradition derer der Weimarer Republik. Jedoch konzentrierte sie sich anfangs auf die Beschaffung von Arbeit für noch kriegsbedingten Arbeitslosen. 1957 wurde das AVAVG aus den 1920er Jahren neu formuliert, wobei keine grundlegenden Änderungen vorgenommen wurden. Die Neuerungen bestanden vielmehr aus Ergänzungen, wie Kurzarbeitergeld und Stillegungsvergünstigungen bei Wasser- und Energiemangel. 1969 wurde, so Glismann und Schrader (2002) weiter, das AVAVG durch das Inkrafttreten des Arbeitsförderungsgesetz (AFG) aufgelöst. Zu den entscheidenden Neuerungen dieses Gesetzes zählten die Einführung des Schlechtwetter- und des Unterhaltsgeldes. Die damit verbundene Kostenerhöhung konnte mit Arbeitslosenquoten, die teilweise deutlich unter einem Prozent[4] lagen, und einem Arbeitsnachfrageüberschuss in einigen Wirtschaftszweigen gerechtfertigt werden, da de facto Vollbeschäftigung erreicht wurde. Dies änderte sich jedoch 1973 nach dem ersten Ölschock, der Aufwertung der Deutschen Mark (DM) nach dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods (vgl. Schöb und Weimann 2004, S.12-13; Spree 2001, S.111) und der damit einhergehenden Rezession. 1975 waren erstmalig seit 1950 in der Bundesrepublik mehr als eine Million Menschen als arbeitslos registriert. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre erholte sich die deutsche Wirtschaft wieder, jedoch trifft das nicht auf den Arbeitsmarkt zu. Zwar verringerte sich auch die Zahl der Arbeitslosen, jedoch erreichte sie nicht annähernd das Niveau von 1972. Schöb und Weimann (2004) machen vor allem die überhöhten Reallohnsteigerungen zwischen 1973 und 1974 dafür verantwortlich[5]. Insbesondere der überproportionale Lohnanstieg in den untersten Lohnsegmenten sei ursächlich für die Erhöhung der Arbeitslosenzahlen besonders in diesem Einkommensbereich sowie auch für die überdurchschnittliche Verweildauer der zu diesem Bereich zurechenbaren Arbeitslosen in der Erwerbslosigkeit.
Weiterhin ist zu erwähnen, dass 1975 die Leistung für Arbeitslosengeldempfänger auf 68 Prozent ihres Nettolohns in den letzten drei Beschäftigungsmonaten erhöht und die Empfänger gesetzlich rentenversichert wurden. Laut Schäfer (2003) wurde zwischen 1975 und 1985 als Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Rentenversicherung das letzte Bruttoeinkommen eines Arbeitslosen vor der Arbeitslosigkeit genutzt. Besonders für ältere Arbeitslose bestand darin ein Anreiz länger in der Arbeitslosigkeit zu verweilen. Unterstellt man, dass die Produktivität älterer Arbeitsloser mit steigendem Alter abnimmt, so wird es ihnen immer schwerer fallen, bei Aufnahme einer neuen Beschäftigung ein in der Höhe dem Vorhergehendem äquivalentes Einkommen zu erzielen. Eine schnelle Wiederaufnahme einer Beschäftigung zu niedrigeren Konditionen hätte somit zwar ihr kurzfristiges Einkommen erhöht, jedoch ihre Rentenansprüche dauerhaft gesenkt. Dies änderte sich erst 1985 mit der Änderung des AFG nach welcher das Arbeitslosengeld als Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist.
2.1.2 Die Leistungen der deutschen Arbeitslosenversicherung
Die Bezugsdauer
Mit Beginn der zweiten Ölkrise und der ihr folgenden Rezession von 1979 bis 1983 verschärfte sich die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt abermals. Mit mehr als zwei Millionen Arbeitslosen wurde die Krise auf dem deutschen Arbeitsmarkt unverkennbar. Aufgrund eines konjunkturellen Hochs seit 1983 konnte nach Schöb und Weimann (2004) nicht nur ein weiteres Anwachsen der Arbeitslosenzahl abgewendet werden, vielmehr nahm diese, trotz einer steigenden Zahl von Arbeitsanbietern, bis Ende der 1980er Jahre leicht ab. Die jedoch weiterhin existierende Massenarbeitslosigkeit erzeugte einen "politischen Druck zur Verbesserung der sozialen Absicherung von Arbeitslosen" (Schäfer 2003, S.34). Daraufhin wurde während der starken Wachstumsphase in den 1980er Jahren der Leistungsumfang der Arbeitslosenversicherung weiter erhöht. Schäfer (2003) stellt folgende Leistungsänderungen hervor, die als Einführung von Senioritätsprivilegien in der Arbeitslosenversicherung verstanden werden können:
1.) Für Arbeitslose, welche das 50. Lebensjahr erreicht hatten und mindestens sechs Jahre beitragspflichtig beschäftigt waren, wurde 1985 die maximale Bezugsdauer von 12 auf 18 Monate erhöht[6]. Ziel dieser Verlängerung war es, neben einer Entlastung der vom Bund finanzierten Arbeitslosenhilfe, die Bedürftigkeitsprüfung älterer Arbeitsloser, welchen es nach langjährigem Einzahlen in die Arbeitslosenversicherung nun besonders schwer fiel auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, zu vermeiden[7]. Diese Bezugsdauerverlängerung wurde bis 1989 befristet. Trotz der daraus resultierenden Mehrkosten konnte 1985 laut Schäfer (2003) aufgrund eines Überschusses der Bundesanstalt für Arbeit der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung um 0,2 Prozent gesenkt werden.
2.) Die maximale Bezugsdauer wurde 1986 neben einer Stärkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik[8] für Arbeitslose, welche 44 Jahre oder älter waren, nochmals erhöht. Für Arbeitslose, die das 44. aber noch nicht das 49. Lebensjahr vollendet hatten, erhöhte sich die maximale Bezugsdauer auf 16 Monate, für die 49 bis 53jährigen von 18 auf 20 Monate und für diejenigen die 54 oder älter waren von 18 auf 24 Monate. Als Gründe für diese erneute Verlängerung wird die vom Deutschen Bundestag geforderte „Wahrung der sozialen Sicherungsfunktion der Arbeitslosenversicherung“ (Schäfer 2003, S.36) und eine erneute Umschichtung der Kostenträgerschaft[9] angeführt.
3.) 1987 schließlich wurde die Bezugsdauer abermals, aber letztmalig, angehoben. Für alle Arbeitslosen unter 44 Jahren erhöhte sich die maximale Dauer des Leistungsbezugs auf 18, für die 44 bis 48jährigen auf 20 und für die 49 bis 53 jährigen auf 26 Monate. Arbeitslose die das 54. Lebensjahr vollendet hatten, konnten seitdem maximal 36 Monate Arbeitslosengeld beziehen. Neben der Senkung der Zahl der eingezahlten Monatsbeiträge von drei auf zwei Monate je Anspruchsmonat, wurde auch die Befristung der Bezugsdauerverlängerungen der beiden Jahre zuvor aufgehoben.
Schäfer (2003) stellt fest, dass die Motivation für diese Bezugdauerverlängerungen von sozial- und budgetpolitischer Natur waren. Vor allem das Streben nach einer sozialen Sicherungsgrundlage für ältere Arbeitslose wird als deutliche Abkehr vom Versicherungsprinzip gewertet, deren negative Arbeitsanreize sich jedoch als verheerend erweisen sollten. Diesen wurde, so Schäfer (2003) weiter, erstmals 1997 Rechnung getragen, als die Altersgrenzen für die jeweiligen maximalen Bezugsdauern leicht angehoben wurden. Seit 2003 gelten neue, weitaus geringere Bezugdauern.
Tabelle 1 zeigt, dass das Senioritätsprinzip nach der Anpassung von 2003 im Verhältnis zu den Bestimmungen der 1980er Jahre, aber auch noch zu denen von 1997, nur noch bedingt Geltung besitzt. Derzeit besitzen allein Arbeitslose, welche das 55. Lebensjahr vollendet haben, die Möglichkeit bis zu 18 Monate Arbeitslosengeld zu beziehen. Für alle anderen gilt eine maximale Bezugsdauer von zwölf Monaten.
Tabelle 1 Maximale Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen: SGB III § 127 Abs. 2 und Werner und Winkler (2003) S.24
Für jeden Arbeitslosen, ob jünger oder älter als 55, gilt: Für jeden Monat Arbeitslosengeldbezug müssen zuvor mindestens zwei Monatsbeiträge eingezahlt werden. Darüber hinaus muss der Arbeitslose innerhalb der letzten drei Jahre mindestens zwölf Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. Um den Arbeitslosengeldempfängern einen Anreiz zur schnellen Wiederaufnahme einer Beschäftigung zu geben, sieht das 3. Sozialgesetzbuch (SGB III) eine Verlängerung der Bezugsdauer bei einem späteren Arbeitslosengeldbezug um die noch ausstehenden Monatsansprüche vor[11], solange diese nicht mehr als vier Jahre zurück liegen.
Die Höhe der Leistung
Nachdem die Entwicklung der Anspruchsdauer für den Erhalt von Arbeitslosengeld betrachtet wurde, soll nun kurz beschrieben werden, wie sich die Höhe des Arbeitslosengeldes und seine Bemessung über die Zeit verändert haben. Auch hier konzentriert sich die Arbeit auf die Entwicklungen in den letzten 40 Jahren, um den Bezug zur heutigen, und später eingehender diskutierten, Arbeitslosenversicherung zu wahren.
Wie bereits erwähnt, wurde im Jahr 1975 das Arbeitslosengeld der Höhe nach auf 68 Prozent des Nettolohns eines jeden Anspruchberechtigten in den drei Monaten vor Eintritt der Arbeitslosigkeit festgelegt. Schäfer (2003) beschreibt zwei weitere Senkungen des Arbeitslosengeldes. Die Anpassung 1984 sah vor, dass Arbeitslose ohne unterhaltspflichtige Kinder[12] statt 68 nur noch 63 Prozent ihrer vorhergehenden Nettoeinkommen als Arbeitslosengeld erhalten sollten. Die Senkung des Arbeitslosengeldanspruchs für Kinderlose stellt einen erneuten Bruch mit dem Versicherungsprinzip dar, da auch hier das Streben nach sozialer Absicherung, in diesem Fall die der Familien, im Mittelpunkt stand. Zehn Jahre später, 1994, wurde die Höhe des Arbeitslosengeldes erneut auf die heute noch geltenden reduziert, Arbeitslose mit Kindern erhielten seitdem 67 Prozent und kinderlose Arbeitslose 60 Prozent ihres vorherigen Nettoeinkommens. Mit Verabschiedung des ersten und zweiten „Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ Ende 2002 wurde die 1970 eingeführte Dynamisierung des Arbeitslosengeldes, welche bis dahin die Höhe des Arbeitslosengeldes an die jährliche Steigerung der Bruttoentgelte[13] anpasste, abgeschafft (vgl. Sachverständigenrat 2003, S.142). Die absolute Höhe des Arbeitslosengeldes ist durch Festsetzung einer Beitragsbemessungsgrenze begrenzt. Diese bestimmt den maximalen Betrag eines Arbeitseinkommens auf den Beiträge zu Arbeitslosenversicherung abzuführen sind. In Westdeutschland beträgt dieser 5.100 und in Ostdeutschland 4.250 Euro. Somit ergibt sich nach Werner und Winkler (2003) ein maximaler Arbeitslosengeldanspruch von wöchentlich 340,48 Euro in den Alten und 325 Euro in den Neuen Bundesländern. Das zur Berechnung herangezogene Nettoeinkommen eines Antragstellers konnte laut Schäfer (2003) seit 1984, bei Vorliegen eines überdurchschnittlichen Lohnanstiegs unmittelbar vor seiner Entlassung, das Nettoeinkommen des zurückliegenden Jahres anstatt nur der letzten drei Monate herangezogen werden. Somit sollte eine Missbrauchsmöglichkeit der bestehenden Regelungen[14] beseitigt werden. Seit 2001 werden generell die Nettoentgelte der letzten zwölf Monate als Bemessungsrahmen zur Berechnung der Bemessungsentgelte herangezogen (vgl. SGB III § 130).
Schäfer (2003) fast zusammen, dass der Gesetzgeber auf die steigenden Arbeitslosenzahlen mit einer Erhöhung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes reagiert hat, wobei zwei Motive unterstellt werden. Zum einen die soziale Absicherung älterer Langzeitarbeitsloser und zum anderen die Entlastung der vom Bund finanzierten Arbeitslosenhilfe und der von den Kommunen getragenen Sozialhilfe. Diese Entlastung belastete wiederum den Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit, worauf sich deren Leistung, bei steigenden Beiträgen, verringerte. Weiter wird der Widerspruch zur empirischen Arbeitsmarktforschung aufgezeigt, die ergab dass die Bezugsdauer viel größere Auswirkung „auf die Übergangsraten von Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit“ (Schäfer 2003, S.39) hat als die Höhe des Lohnersatzleistung.
2.1.3 Die Finanzierung der deutschen Arbeitslosenversicherung
Nachdem bisher die Entwicklung der Leistungen der deutschen Arbeitslosenversicherung in den letzten 30 Jahren beschrieben wurde, soll im Folgenden gezeigt werden, wie deren
Leistungen, auch die versicherungsfremden Leistungen, finanziert werden. Nach Eekhoff und Milleker (2000) sichert sich ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit seinen Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung im Schadensfall einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzausfallgeld und auf eine kostenlose und individuelle Arbeitsberatung und -vermittlung. Während das Winterausfallgeld eindeutig als versicherungsfremde Leistung bezeichnet wird, sind die von der Bundesagentur für Arbeit durchgeführten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, wie beispielsweise die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fort- und Weiterbildungen und die Gewährung von Eingliederungszuschüssen, nicht klar in versicherungseigene oder -fremde Leistungen einzustufen. Des Weiteren bezeichnet der Sachverständigenrat (2003) den höheren Arbeitslosengeldanspruch von Arbeitslosen, welche mindestens ein unterhaltspflichtiges Kind besitzen, als versicherungsfremde Leistung, da für diese erhöhte Leistung kein höherer Beitrag zu zahlen ist[15]. Eekhoff und Milleker folgend, werden nur 50 Prozent der von der Bundesagentur für Arbeit aufgebrachten Mittel für die versicherungseigenen Leistungen Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld verwendet. Der Großteil, etwa 87 Prozent, der dafür verwendeten Mittel wird laut Eekhoff und Milleker (2003) durch Beiträge zur Arbeitslosenversicherung aufgebracht. Eine weitere wichtige Säule in der Finanzierung ist der so genannte Bundeszuschuss. Aufgrund der Defizithaftung des Bundes wurde laut Sachverständigenrat (2003) der Haushalt der Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2003 um 6,2 Milliarden Euro entlastet, das entsprach 12,25 Prozent des Gesamtbudgets in diesem Jahr. Des Weiteren stammt ein kleiner Teil der verwendeten Mittel aus Umlagebeiträgen von Unternehmen, aus Verwaltungskostenerstattungen des Bundes und aus Fördermitteln Europäischer Sozialfonds. Der Beitragssatz für einen sozialversicherungspflichtigen[16] Beschäftigten liegt derzeit bei bundeseinheitlich 6,5 Prozent seines monatlichen Bruttoeinkommens jedoch nur bis zu der festgelegten Bemessungsgrenze. Diese liegt in Westdeutschland bei 5.100 und in Ostdeutschland bei 4.250 Euro. Auf alle diese Grenze übersteigenden Arbeitseinkünfte wird kein Beitrag zur Arbeitslosenversicherung erhoben. Da der Versicherungsbeitrag auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichmäßig aufzuteilen ist, zahlen beide je 3,25 Prozent des Bruttoeinkommens.
Die erwähnte Erhöhung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und die gestiegenen Kosten aufgrund höherer Arbeitslosenzahlen und der Ausweitung der Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit machte, mit Ausnahme einer leichten Beitragssenkung Mitte der 1980er Jahre, eine stetige Beitragserhöhung seit Mitte der 1970er Jahre notwendig. Der Beitragssatz betrug zu Beginn der 1950er Jahre vier Prozent, was letztendlich auf die noch nicht überwundene Kriegsbedingte Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist. Aufgrund des stetigen Wirtschaftswachstums und der damit einhergehenden Verbesserung am Arbeitsmarkt sank der Beitrag bis Anfang der 1960er Jahre auf 2 Prozent und konnte sogar kurzeitig ausgesetzt werden[17] (vgl. Glismann und Schrader 2002, S.24). Erreichte er zwischen 1964 und 1971 den bisher niedrigsten Wert von 1,3 Prozent, betrug der Beitragssatz 1980 schon drei Prozent und erreichte bis zu Beginn des Jahres 1990 die Höhe von 4,3 Prozent des zu berücksichtigenden Bruttoentgelts. Trotz des einigungsbedingten konjunkturellen Aufschwungs in Westdeutschland und einem Absinken der Arbeitslosenzahlen auf deutlich unter zwei Millionen in Westdeutschland zwischen 1990 und 1992 (vgl. Statistisches Bundesamt 2005a, S.107), wurde aufgrund des erwarteten Anstiegs der Zahl der Arbeitslosen in Ostdeutschland der Beitragssatz noch im April 1990 auf 6,8 Prozent erhöht, um die zukünftigen Mehrkosten auffangen zu können. Seitdem blieb er relativ konstant, wie aus Abbildung 1 hervorgeht. Des Weiteren zeigt die Abbildung den zusätzlichen Finanzbedarf der Bundesanstalt für Arbeit im Zeitraum von 1990 bis 2003, der notwendig war, um trotz steigender Ausgaben für Versicherungsleistungen und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen den Beitragssatz konstant zu halten. Dies war im Hinblick auf die in den letzten 30 Jahren enorm gestiegenen Sozialabgabenlast[18] um einen weiteren Rückgang der Arbeitsnachfrage aufgrund steigender Lohnnebenkosten zu verhindern.
Abbildung 1 Entwicklung der Beitragssätze zur Arbeitslosenversicherung, der Arbeitslosenquoten [19] in Deutschland von 1989 bis 2003 und der jährliche Bundeszuschuss
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Sachverständigenrat (2003) und Statistisches Bundesamt (2005b)
Die Steigerung des Beitragssatzes in den letzten 30 Jahren von nur 1,7 Prozent bis Mitte der 1970er Jahre auf die heutigen 6,5 Prozent entspricht laut Glismann und Schrader (2002) einer jahresdurchschnittlichen Beitragssteigerung von zehn Prozent für Arbeitnehmer an der Beitragsbemessungsgrenze. Somit wird vermutet, dass die gestiegenen Arbeitslosenzahlen zum Teil auf diese Verteuerung des Produktionsfaktors Arbeit zurückzuführen sind.
Abschließend ist jedoch zu bemerken, dass die deutschen Arbeitgeber bei einer Entlassungsentscheidung die daraus entstehenden Belastungen für die Arbeitslosenversicherung nicht mit in ihr Optimierungskalkül einbeziehen. Jedoch sind Entlassungen für sie aufgrund des strengen Kündigungsrechts in Deutschland nicht generell kostenneutral. Dem Sachverständigenrat (2003) folgend, ergibt sich der Kündigungsschutz in Deutschland vor allem aus Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches, des Kündigungsschutzgesetzes, des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie aus der Arbeitsrechtssprechung. Die Unternehmen, ausgenommen Kleinstfirmen[20] sind aufgrund der daraus hervorgehenden Regelungen mit einer Einschränkung ihrer Kündigungsfreiheit konfrontiert. So haben sie im allgemeinen für Mitarbeiter, welche länger als sechs Monate im Unternehmen verweilen, und im Besonderen für schutzbedürftige Mitarbeiter, wie zum Beispiel Mütter, Schwerbehinderte und Mitglieder betriebsverfassungsrechtlicher Institutionen, bestimmte Fristen und Vorraussetzungen für eine Kündigung einzuhalten. Jedoch liegt es bei den Arbeitnehmern, durch eine Einwilligung in einen Auflösungsvertrag eine außerordentliche Kündigung zu ermöglichen (vgl. Sachverständigenrat 2003, S.383). Ein solcher Auflösungsvertrag ist jedoch allgemein mit Kosten verbunden und führt somit zu Entlassungskosten. Sollte es bei einer Kündigung nicht zu einer Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen, besteht für letzteren die Möglichkeit einer Kündigungsschutzklage. Laut Sachverständigenrat (2003) ergeben sich aus der deutschen Arbeitsrechtssprechung Entschädigungszahlungen in Höhe eines Monatsgehaltes je Betriebszugehörigkeitsjahr[21] und der seit der Kündigung ausgebliebenen Monatslöhne. Da die Erfolgsaussicht solcher Klagen mit rund 75 Prozent recht hoch ist, ergeben sich daraus Abfindungszahlung zwischen einem halben und einem vollen Jahresgehalt (vgl. Sachverständigenrat 2003, S.391). Diese aus einer Abfindungszahlung resultierenden Kosten sind offensichtlich nicht an den entstehenden Kosten für die Arbeitslosenversicherung orientiert, wie es im Fall eines experience rating basierten Finanzierungssystem einer Arbeitslosenversicherung der Fall wäre, indem die Kosten zumindest teilweise von der entlassenden Firma zu tragen sind. Vielmehr entstehen diese Kosten neben den Abfindungskosten und werden von allen Beitragszahlern getragen.
2.2 Die Arbeitslosenversicherung der Vereinigten Staaten von Amerika
Nachdem Aufbau, Aufgaben und Finanzierung der deutschen Arbeitslosenversicherung detailliert beschrieben wurden, soll in diesem Teil der Arbeit ein Einblick in die Arbeitslosenversicherung in den Vereinigten Staaten (USA) gegeben werden. Da diese Arbeit das Ziel besitzt, die Vor- und Nachteile eines experience rating in der Arbeitslosenversicherung zu untersuchen, ist es unerlässlich, die weltweit einzige zu betrachten, welche eine solche Differenzierung in der Beitragsbemessung besitzt.
Abbildung 2 Vergleich der monatlichen Arbeitslosenquoten [22] in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Januar 1995 bis April 2005
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: U.S. Department of Labor (2005b), Statistisches Bundesamt (2005a) und (2005b)
Abbildung 2 verdeutlicht, dass die Arbeitslosenquoten in den Vereinigten Staaten deutlich unter denen in Deutschland liegen und auch deren Schwankung im Jahresverlauf deutlich geringer ausfallen. So lässt sich erkennen, dass vor allem der prozentuale Anstieg der Zahl der Arbeitslosen in den Wintermonaten in den Vereinigten Staaten deutlich geringer ist als in Deutschland. Es scheint, als könnte daraus auf die höhere Effizienz eines solchen Finanzierungssystems geschlossen werden. Jedoch würde dieser Schluss trügen, da sich die Arbeitslosenquoten in den Bundesstaaten saisonal deutlich unterscheiden und somit offensichtlich zu einer Glättung der Gesamtarbeitslosenquoten der Vereinigten Staaten führen. Um diesen Effekt zu verdeutlichen, wurde die Abbildung um die monatlichen Arbeitslosenquoten zweier ausgewählte Bundesstaaten Mississippi und Minnesota ergänzt, welche sich schon aufgrund ihrer geographischen Lage deutlich unterscheiden. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum aus der unterschiedlichen Entwicklung der Arbeitslosenquoten nicht unmittelbar auf die Effizienz eines der beiden Finanzierungssysteme geschlossen werden kann. Ein anderer besteht, wie im Folgenden beschrieben werden soll, in der unterschiedlichen Ausgestaltung der Leistungen der Arbeitslosenunterstützung.
Zu Beginn der Betrachtung des US amerikanischen Arbeitslosenversicherungssystems ist festzustellen, dass darin keine einheitliche Arbeitslosenversicherung existiert, sondern es vielmehr aus auf die Bundesstaaten begrenzten Versicherungen besteht. Der Aufbau dieser Versicherungen und deren gesetzlich festgelegten Durchführungs- und Ausgestaltungsfreiheiten der einzelnen Bundesstaaten geht laut Glismann und Schrader (2001a) auf den Social Security Act aus dem Jahr 1935 zurück. Die Anspruchsbedingungen, die Beitragssätze, die Höhe sowie die Bezugszeiten der Unterstützungsleistung unterscheiden sich demnach auch zwischen den Bundesstaaten, so dass im Folgenden nur ein Überblick über die gängigsten Bestimmungen gegeben werden kann.
2.2.1 Die Leistungen der Arbeitslosenversicherungen in den Vereinigten Staaten
Anspruchsberechtigt ist laut Glismann und Schrader (2001a) jeder Arbeitslose, der zum einen seine Arbeitslosigkeit nicht verschuldet hat, arbeitsfähig ist und sich auch weiterhin um Arbeit bemüht. Darüber hinaus existieren zwischen den Bundesstaaten unterschiedliche Bedingungen für den Bezug der Arbeitslosenunterstützung. Dem U.S. Department of Labor (2005a) folgend, bestehen diese zum großen Teil aus vorher zu erzielenden Mindesteinkommen und Mindestbeschäftigungszeiten. So müssen die Arbeitslosen in den meisten Bundesstaaten ein bestimmtes Mindesteinkommen in den ersten vier der letzten fünf Quartale vor Antragsstellung vorweisen. Nach California budget project (2003) wird in den meisten Bundesstaaten die Arbeitslosenunterstützung bis zu 26 Wochen gezahlt, wobei laut U.S. Department of Labor (2005a) ein Bundesgesetz den Bundesstaaten in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit eine Erhöhung der Höchstbezugdauer um bis zu 20 Wochen, welche als extended benefits bezeichnet werden, erlaubt[23]. Eine mit dem deutschen Arbeitslosengeld 2 vergleichbare Unterstützungsleistung nach Ende der maximalen Bezugszeit gibt es jedoch nicht[24]. Die Höhe der Unterstützungsleistung beträgt nach Glismann und Schrader (2001a) etwa 50 Prozent des zur Berechnung herangezogenen Bruttoentgelts der letzten 52 Wochen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, wobei die Bemessungsgrundlagen in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedlich sind. Da es jedoch jedem Bundesstaat erlaubt ist, die Unter- und Obergrenze der Unterstützungsleistung selbst festzulegen solange diese nicht gegen das Grundgesetz verstoßen (vgl. Kissling 1997, S.29), existieren deutliche Unterschiede zwischen dem durchschnittlichen Lohn-Unterstützung-Verhältnis. Besonders Arbeitslose welche vorher ein überdurchschnittliches Gehalt bezogen haben, erhalten aufgrund des Höchstbetrages deutlich weniger als 50 Prozent.
Abbildung 3 Durchschnittliches Arbeitslosengeld im Vergleich zum vorherigen Durchschnittseinkommen der Arbeitslosen in ausgewählten Bundesstaaten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: california budget project (2003) S.2
Abbildung 3 stellt für ausgewählte Bundesstaaten den durchschnittlich erzielten Wochenlohn und die durchschnittliche Unterstützungsleistung eines Arbeitslosen gegenüber. Es zeigt sich, dass allein auf Hawaii im Durchschnitt die von Glismann und Schrader (2001a) erwähnte Unterstützungshöhe von 50 Prozent des vorhergehenden Bruttolohns überschritten wird.
Des Weiteren wird in der Abbildung deutlich, dass die Arbeitslosenunterstützung im Bundesdurchschnitt nur 37,6 Prozent des vorhergehenden Einkommens beträgt. Darüber hinaus weist U.S. Department of Labor (2005a) darauf hin, dass Einkommen aus der Arbeitslosenunterstützung gemäß der geltenden Einkommensteuerrichtlinien zu versteuern sind. Laut Werner (1997) verliert ein Beschäftigter bei einer Entlassung auch die zuvor vom Arbeitgeber finanzierte Krankenversicherung. Neben der niedrigeren Höhe und der geringeren Bezugsdauer der Arbeitslosenunterstützung ergibt sich daraus für die US amerikanischen Arbeitslosen im Vergleich zu deutschen Arbeitslosen ein weitaus höherer Anreiz möglichst schnell eine neue Beschäftigung zu finden.
2.2.2 Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherungen in den Vereinigten Staaten
Die erste Arbeitslosenversicherung in den Vereinigten Staaten wurde im Jahr 1931 in Wisconsin eingeführt. Laut Rosbrow (1985) hatte jedes Unternehmen an den Arbeitslosenfonds des Bundesstaates einen Beitrag zu entrichten, der ausschließlich für Arbeitslose verwendet wurde, die von diesem Unternehmen entlassen wurden. Somit veränderten sich die Beiträge eines Unternehmens in Abhängigkeit seines Entlassungsverhaltens. Die Unterstützungsleistungen für einen Arbeitlosen hingen wiederum von der Beschäftigung und den gezahlten Löhnen des Unternehmens ab, in dem er vorher gearbeitet hat.
Wie bereits beschrieben wurde, geht die heutige Ausgestaltung der Arbeitslosenversicherung in den einzelnen Bundesstaaten auf den Social Security Act von 1935 zurück. Dieser verpflichtete die Bundesstaaten eine eigene Arbeitslosenversicherung zu errichten und gab ihnen Empfehlungen für die Ausgestaltung einer solchen Institution. Jedoch ergab sich vorerst eine sich zwischen den Bundesstaaten deutlich unterscheidende Finanzierung der Arbeitslosenunterstützung durch teilweise bundesstaatseinheitlichen Lohnsummensteuern. Nach Rosbrow (1985) wurde erst 1985 in allen Bundesstaaten ein experience rating basiertes Finanzierungssystem verwendet.
Heute wird die Arbeitslosenunterstützung in den meisten Bundesstaaten[25] ausschließlich durch die Beiträge der Unternehmen finanziert. Nach Anderson und Meyer (1993) sind ungefähr 97 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse durch die Arbeitslosenversicherung abgedeckt. Festgelegt durch den Federal Unemployment Tax Act (FUTA), bestehen die Beiträge laut Glisman und Schrader (2001a) grundsätzlich aus einer bundeseinheitlichen Lohnsummensteuer in Höhe von 6,2 Prozent, wobei jedoch ein Einkommen nur bis zu einem Höchstbetrag von 7.000 US Dollar besteuert wird. Von diesen 6,2 Prozent werden 0,8 Prozent für die anfallenden Verwaltungskosten verwendet und die übrigen 5,4 Prozent den Bundesstaaten überlassen. Die Bundesstaaten haben wiederum das Recht zusätzliche Arbeitslosensteuern zu erheben und die dafür geltenden Bemessungsgrundlagen festzulegen, wenn ein Unternehmen über einen bestimmten Zeitraum hinweg mehr Kosten verursacht als es in Form von Beiträgen in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Des Weiteren haben sie aber auch die Möglichkeit, den aus der Bundessteuer erhaltenen Anteil als Rückerstattung an die Unternehmen zurückzugeben. Somit besteht die Möglichkeit, Unternehmen, die über denselben Zeitraum mehr einbezahlen als die von ihnen Entlassenen an Kosten verursachen, durch niedrigere Arbeitslosensteuern[26] zu belohnen.
Die Höchststeuersätze unterscheiden sich zwischen den Bundesstaaten. Laut Glismann und Schrader (2001a) weist Tennessee mit zehn Prozent den höchsten Maximalsteuersatz auf. Die Untergrenze für den Höchststeuersatz ist laut FUTA auf 5,4 Prozent festgelegt. Glismann und Schrader (2001a) zeigen weiter, dass jedoch Tennessee neben zwölf anderen Staaten mit null Prozent auch den niedrigsten Steuersatz als Untergrenze besitzt.
Auch die Obergrenze für das zu besteuernde Einkommen je Arbeiter variiert zwischen den Bundesstaaten. California budget project (2003) zeigt, dass sich das maximal besteuerbare Einkommen von der beschriebenen Untergrenze von 7.000 US Dollar in einer Reihe von Bundesstaaten bis zu einem Höchstwert von 30.200 US Dollar auf Hawaii stark unterscheidet.
Abhängig von seinem Bundesstaat wird der für ein Unternehmen zutreffende Beitragssatz durch eine der zwei Berechnungsarten des experience rating festgelegt. Diese beiden Berechnungsarten werden als reserve ratio beziehungsweise benefit ratio bezeichnet. Die reserve ratio ist die am häufigsten verwendete Berechnungsmethode, da sie in 33 der 50 Bundesstaaten verwendet wird (vgl. Glismann und Schrader 2001a, S. 32). Sie stellt sich wie folgt dar
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten .
Jedes Unternehmen besitzt bei der Arbeitslosenversicherung in seinem Bundesstaat ein Konto, dessen Bilanz, also die bisher eingezahlten Beiträge abzüglich der durch die von ihm entlassenen Arbeitnehmer verursachten Kosten für die Arbeitslosenversicherung, als Reserve bezeichnet wird. Die reserve ratio Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten stellt wiederum das Verhältnis der Reserve zu dem durchschnittlichen versteuerbaren Lohneinkommen der Mitarbeiter des Unternehmens in den letzten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Jahren dar, aus denen sich auf die Beiträge der nächsten Jahre schließen lässt. Die benefit ratio ergibt sich laut Schrader und Glismann (2001a) wiederum aus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten .
Hierbei wird für die Berechnung des unternehmensspezifischen Steuersatzes die Veränderung des Verhältnisses zwischen den in den letzten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Jahren aufgrund von Entlassungen verursachten Kosten für die Arbeitslosenversicherung und der zur Finanzierung der Kosten zugrunde liegenden Steuerbasis der letzten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Jahre herangezogen. Glismann und Schrader (2001a) bemerken, dass keine der beiden Methoden die andere in jeglicher Beziehung überlegen ist.
Der Beitragssatz eines Unternehmens wird laut Werner und Winkler (2003) nicht nur mit Hilfe der reserve ratio beziehungsweise der benefit ratio berechnet, sondern unterliegt auch dem Einfluss der replenishment rate.
Nach Werner und Winkler (2003) wird jedoch unter beiden Berechnungsmethoden nach einer Anhebung der Steuersätze geprüft, ob ein Unternehmen die kostenverursachende Entlassung selbst zu verantworten hat und ihm somit die entstandenen Kosten durch eine Steuererhöhung aufzuerlegen sind. Sollte es aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten des Entlassenen oder wegen Naturkatastrophen diese Entlassung nicht zu verantworten haben, gehen die Kosten zu Lasten der gesamten Arbeitgeberschaft. Darüber hinaus lassen sich Kosten, welche für die Arbeitslosenversicherung durch Entlassungen von Unternehmen mit dem Höchststeuersatz entstehen, nicht durch diese Firmen ausgleichen und müssen somit auch querfinanziert werden. Nach Anderson und Meyer (1993) wird in den meisten Bundesstaaten ein Unternehmen nur für ehemalige Mitarbeiter steuerlich verantwortlich gemacht, die wenigstens zwei Quartale in diesem gearbeitet haben. Daraus resultieren zusätzliche, nicht abgedeckte Kosten, sollte der betreffende Arbeitslose nicht in den letzten fünf Quartalen wenigstens in einer Firma länger als ein halbes Jahr gearbeitet haben. Des Weiteren werden laut Woodbury (2004) die aus dem extended benefit - Programm entstehenden Kosten dem Unternehmen nicht angelastet, welches deren Teilnehmer zuvor beschäftigt hat. Sollte ein Unternehmen aus dem Markt austreten und können die durch seine Entlassungen entstandenen Kosten nicht durch die Reserve des Unternehmens gedeckt werden, so müssen auch diese Kosten durch die anderen Beitragszahler ausgeglichen werden, so Woodbury (2004). Die replenishment rate ist die Rate mit der sich die Ausgabenlast der Arbeitslosenunterstützung aufgrund der beschriebenen Ereignisse verändert. Zum Jahresbeginn ändert sich daher nicht nur der Steuersatz aufgrund eigener Entlassungen sondern auch durch den verteilten Verlust der Arbeitslosenversicherung.
Abbildung 4 verdeutlicht, Hamermesh (1993) folgend, die Bestimmung des firmenspezifischen Beitragssatzes für den Fall der reserve ratio - Methode. Es wird gezeigt, dass der Steuersatz Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten mit steigender reserve ratio sinkt bis er den im betreffenden Bundesstaat geltenden minimalen Steuersatz Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten erreicht. Darüber hinaus wird gezeigt, dass der Steuersatz auch nach oben begrenzt ist und somit ein Unternehmen, das bereits mit Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten besteuert wird, für zusätzliche Entlassungen und die daraus resultierende Verringerung ihrer reserve ratio nicht bestraft wird.
Abbildung 4 Die Bestimmung des unternehmensspezifischen Steuersatzes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hamermesh (1993), S.311
Abschließend lässt sich feststellen, dass im Gegensatz zur Arbeitslosenversicherung in Deutschland das in den Vereinigten Staaten existierende Arbeitslosenversicherungssystem größere Anreize für Unternehmen schafft, die durch ihre Entlassungsentscheidung entstehenden Kosten der Arbeitslosigkeit zu reduzieren, da diese im Allgemeinen[27] von ihnen selbst zu tragen sind. In Deutschland sind Entlassungen dagegen höchstens mit Abfindungszahlungen verbunden, ändern jedoch den langfristigen Beitragssatz nicht. Das angewendete System der Beitragsberechnung muss jedoch als unvollkommenes[28] experience rating bezeichnet werden, da die durch eine erneute Entlassung entstehenden Kosten aufgrund der Unter- und Obergrenzen der Besteuerung nur von den Unternehmen berücksichtigt werden, welche aufgrund ihres bisherigen Entlassungsverhalten mit einem Steuersatz zwischen diesen Grenzen besteuert werden oder für die die Möglichkeit besteht, durch diese Entlassungsentscheidung in diesen Bereich der differenzierten Besteuerung zu gelangen[29]. Firmen, die in der Vergangenheit deutlich höhere beziehungsweise niedrigere Kosten verursacht haben als von ihren Beitragszahlungen gedeckt wurde, können durch die Entscheidung über eine geringfügige Entlassung ihren Steuersatz nicht verändern.
Neben den beschriebenen unterschiedlich starken Anreizen für die Unternehmen, die Kosten der Arbeitslosigkeit zu reduzieren, ergeben sich aus der unterschiedlichen Ausgestaltung der Arbeitslosenversicherungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten auch unterschiedlich starke Anreize für Arbeiter und Arbeitslose, eine mögliche Arbeitslosigkeit zu verhindern beziehungsweise im Fall der Arbeitslosigkeit möglichst schnell eine neue Beschäftigung aufzunehmen. Dies wird beim Vergleich der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und anderer Sozialleistungen und der Höhe des Nettoeinkommens während der Arbeitslosigkeit in beiden Ländern deutlich. In Anbetracht der in Abschnitt 2.1 vorgestellten Leistungsmerkmale der deutschen Arbeitslosenversicherung erhalten Arbeitslose in den Vereinigten Staaten durchschnittlich bedeutend weniger Arbeitslosengeld für eine deutlich kürzere Zeit. Somit ist zu erwarten, dass die niedrigeren Arbeitslosenquoten in den Vereinigten Staaten nicht allein auf die unterschiedliche Finanzierung der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen sind.
2.3 Verhaltensrisiken in der Arbeitslosenversicherung
Da es das Ziel dieser Arbeit ist, die Eigenschaften des experience rating in der Arbeitslosenversicherung zu untersuchen, wurden in den vorhergehenden Abschnitten zwei Systeme der Arbeitslosenversicherung vorgestellt, welche sich durch eine Differenzierung ihrer Beitragssätze unterscheiden. Es scheint jedoch notwendig, neben der reinen Gegenüberstellung der Ausgestaltung der auf einheitlichen Beitragssätzen basierten Arbeitslosenversicherung in Deutschland und der der Vereinigten Staaten, welche zumindest zu einem großen Teil durch differenzierte Unternehmensbeiträge finanziert wird, die durch diese Systeme hervorgerufenen Anreize, Arbeitslosigkeit zu verhindern, zu untersuchen. Die Arbeitslosenversicherung steht generell verschiedenen Verhaltensrisiken der Versicherungsteilnehmer gegenüber, welche direkt der Ausgestaltung der Systeme zurechenbar sind. Diese Verhaltensrisiken werden in diesem Abschnitt der Arbeit beschrieben und voneinander abgegrenzt, bevor die folgenden Teile der Arbeit diese sowohl modell-theoretisch als auch empirisch belegen, sowie mögliche Veränderungsvorschläge für die Ausgestaltung der deutschen Arbeitslosenversicherung geben.
Die bedeutendsten Verhaltensrisiken bestehen in verschiedenen Arten des moral hazard. „Nachvertragliche Informationsasymmetrien“ (Schmidt-Mohr 1996, S.749) sind die Ursache für moral hazard Problematiken, welche auf versteckten Informationen und versteckten Aktionen beruhen können (vgl. Schmidt-Mohr 1996, S.749). Für die betrachteten Arbeitslosenversicherungen ergeben sich vorwiegend Risiken aus dem nachvertraglichen Handeln der Versicherten, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Diese sollen im Folgenden in der beschriebenen Reihenfolge dargestellt werden.
2.3.1 Moral hazard der Versicherten
Das Risiko der versteckten Aktionen durch die Versicherten besteht für die Arbeitslosenversicherung laut Bertold und von Berchem (2004) in dem nicht zu beobachtenden und demnach nicht sanktionierbaren Verhaltensspielraum der versicherten Arbeitnehmer beziehungsweise der Arbeitslosen mit Anspruch auf die Unterstützungsleistung. Diese besitzen somit geheime Informationen über das eigene Verhalten, von dem sie auch wissen, dass es geheim beziehungsweise schwer beobachtbar ist. So kann die Arbeitslosenversicherung für einen versicherten Arbeitnehmer nur bedingt beobachten, in wiefern er eine mögliche Entlassung entweder durch einen geringeren Arbeitseinsatz, durch eine Weigerung zur Fort- und Weiterbildung oder aufgrund erhöhter Lohnforderungen mit verursacht hat, so Bertold und von Berchem (2004). Das Risiko, dass ein versicherter und anspruchsberechtigter Arbeitnehmer zu diesen Verhaltensweisen neigt, wird als individuelles moral hazard bezeichnet und ist nach Bertold (2001) umso größer, je höher der im Fall der Arbeitslosigkeit gezahlte Lohnersatz, je länger dessen Bezugsdauer und je höher die Zumutbarkeitskriterien für eine erneute Beschäftigung sind. Aus den vorhergehenden Abschnitten ergibt sich, dass sowohl die Höhe des Arbeitslosengeldes als auch dessen maximale Bezugsdauern in Deutschland die der Vereinigten Staaten weitaus übersteigen. Darüber hinaus kann ein Arbeitsloser in Deutschland, in Abhängigkeit von seiner Bedürftigkeit, nach Ende der maximalen Bezugszeit das steuerfinanzierte Arbeitslosengeld 2[30] erhalten, während in den Vereinigten Staaten zusätzliche Sozialhilfe nur gezahlt wird, wenn ein Arbeitsloser bereit ist eine gemeinnützige Arbeit zu verrichten oder an Fortbildungen teilzunehmen. Ein amerikanischer Arbeitnehmer wird somit sein Verhalten nur von der Bezugszeit des Arbeitslosengeldes abhängig machen, da er im Fall der Sozialhilfe für ein ähnliches Arbeitsleid ein geringeres Einkommen beziehen würde. Für den deutschen Arbeitnehmer besteht somit ein geringerer Anreiz eine mögliche Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Des Weiteren ergeben sich laut Berthold und von Berchem (2004) aus den beschriebenen unterschiedlichen Bezugsdauern und Lohnersatz- beziehungsweise Sozialleistungen der beiden Systeme auch unterschiedlich starke Anreize für einen Arbeitslosen, seine Arbeitsplatzsuche zu intensivieren. Topel und Welch (1980) verdeutlichen, dass Arbeitslose, die eine höhere beziehungsweise längere Arbeitslosenunterstützung beziehen, in Bezug auf eine neue Beschäftigungsstelle bedeutend wählerischer sind. Dies ist, so Glismann und Schrader (2001a), auf sinkende Opportunitätskosten der Arbeitssuche zurückzuführen, die einen Arbeitslosen aufgrund des gestiegenen Akzeptanzlohns eher eine angebotene Arbeit ablehnen lassen, um auf bessere Angebote zu warten. Dies wird auch von Hunt (1995) belegt, indem gezeigt wird, dass die in Abschnitt 2.1.2 beschriebene Verlängerungen der Bezugszeiten für das Arbeitslosengeld in Deutschland Mitte der 1980er Jahre zu einer signifikanten Erhöhung der Verweildauer in der Arbeitslosigkeit geführt haben und dass diese generell höher ist als in den Vereinigten Staaten. Berthold (2001) und Hunt (1995) kritisieren weiterhin die negativen Anreize, die durch die Ausgestaltung der bis 2004 existierenden Arbeitslosenhilfe ausgegangen ist, welche sich wie das Arbeitslosengeld an den zuletzt erzielten Bruttoeinkommen orientierte und somit im Allgemeinen über dem Sozialhilfeniveau lag. Aus der Zusammenlegung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe und den erhöhten Bedürftigkeitskriterien, kann somit von einer Reduzierung des Risikos für die deutsche Arbeitslosenversicherung ausgegangen werden. Jedoch erscheinen deren weiterhin bestehenden Risiken bezüglich ihrer Versicherten immer noch größer zu sein als die der US amerikanischen Arbeitslosenversicherung, da zusätzlich zu den geringeren Bezugsdauern und niedrigeren Lohnersatzraten, das Arbeitslosengeld in den Vereinigten Staaten wie gewöhnliches Einkommen besteuert wird und die Arbeitslosen zum anderen für ihre Krankenversicherung selbst aufzukommen haben[31].
An dieser Stelle soll bemerkt sein, dass das Verhalten der Arbeitnehmer nicht nur gegenüber der Arbeitslosenversicherung sondern auch gegenüber den Unternehmen als private Information angesehen werden kann. Auch für Unternehmen stellt sich die Beobachtung der Anstrengungsniveaus ihrer Mitarbeiter oft als schwierig dar. Mit einer steigenden Höhe des Lohnersatzes oder der Bezugsdauer steigt, wie bereits beschrieben, auch der Anreiz die Arbeitsanstrengungen zu reduzieren, da, bei einem höheren Nutzen durch die geringere Anstrengung, der mögliche Einkommensverlust geringer wird. Die Methoden der Unternehmen, die dieses Risiko eindämmen sollen, sind sehr unterschiedlich und reichen von motivierenden Entlohnungssystemen bis zur Überwachung der Arbeitsintensität durch Monitoring-Systeme (vgl. hierzu Lazear und Wolff 2001, S. 180ff.). Das in Abschnitt 3.2 vorgestellte Modell von Albrecht und Vroman (1999) zeigt beispielsweise, dass Unternehmen im Fall einer experience rating - basierten Besteuerung auf dieses moral hazard Problem mit einer Erhöhung der Löhne reagieren, um die Zahl der fleißigen Mitarbeiter zu erhöhen und dadurch die Entlassungsrate zu senken.
2.3.2 Moral hazard der Unternehmen
Neben dem beschriebenen Risiko durch die Versicherten, existiert laut Berthold und von Berchem (2004) für eine Arbeitslosenversicherung zusätzlich ein externes moral hazard durch ein nicht sanktionierbares Entlassungsverhalten der Unternehmen. Dies gilt sowohl für die US amerikanische, wenn auch eingeschränkt, als auch für die deutsche Arbeitslosenversicherung. In einem Finanzierungssystem ohne oder mit nur unvollkommener Belastung der Firmen mit den durch ihr Entlassungsverhalten verursachten Kosten, neigen Unternehmen laut Topel (1983) dazu, in wirtschaftlich schlechteren Zeiten verstärkt Mitarbeiter zu entlassen, da sie die daraus entstehenden Kosten nur teilweise zu tragen haben. Berthold und von Berchem (2004) folgend, werden durch die in den Versicherungssystemen existierende Quersubvention die Kosten vielmehr auf die Gesamtheit der Beitragszahler umgelegt. Wie in Abschnitt 2.2.2 erläutert wurde, besitzt auch die US amerikanische Arbeitslosenversicherung eine derartige Quersubventionierung. Auch wurde gezeigt, dass es Unternehmen gibt, solche die bereits den Höchststeuersatz zahlen, die im Fall einer Entlassung die daraus resultierenden Kosten nicht zu tragen haben. Diese Problematik des unvollkommenen experience rating, die damit einhergehender Risiken für die Arbeitslosenversicherung und deren Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau einer Ökonomie werden in diversen Arbeiten diskutiert, wobei Feldstein (1976), als einer der ersten, diese aufgreift. Es wird gezeigt, dass zum einen ein Großteil der Entlassungen nur vorübergehend sind und die entlassenen Mitarbeiter oft nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden. Zum anderen stellt Feldstein (1976) dar, dass eine effiziente Arbeitslosenversicherung eines vollkommenen experience rating - basierten Finanzierungssystems bedarf[32]. Im deutschen System der Arbeitslosenversicherung existiert keine derartige Rückkoppelung. Somit gibt es für die Arbeitslosenversicherung auch keine Möglichkeit einem möglichen Verhaltensrisiko entgegenzuwirken. Die durch diese Fehlanreize entstehenden negativen Beschäftigungs- und Wohlfahrtseffekte werden im Teil 3 dieser Arbeit anhand zweier Modelle verdeutlicht.
2.3.3 Moral hazard der Gewerkschaften
Das Verhaltensrisiko, welches sich für die Arbeitslosenversicherung durch das Verhalten der Gewerkschaften ergibt, bezeichnen Berthold und von Berchem (2004) als kollektives moral hazard. Dieses Risiko besteht darin, dass die Gewerkschaften bei steigender Höhe des Lohnersatzes und dessen Bezugsdauer zu einer aggressiveren Lohnpolitik neigen, so Berthold (2001). Da der Anteil der tarifvertraglich abgedeckten Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland laut OECD (2004) nahezu fünfmal so hoch ist wie in den Vereinigten Staaten, kann davon ausgegangen werden, dass auch dieses Risiko für die deutsche Arbeitslosenversicherung als bedeutend größer angenommen werden kann.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die deutsche Arbeitslosenversicherung, aufgrund der Ausgestaltung ihrer Leistungen und ihrer Finanzierung sowie durch institutionelle und sozialpolitische Unterschiede zwischen den betrachteten Staaten, bedeutend größeren Verhaltensrisiken gegenübersteht, die sie entweder vor Eintritt des Schadensfall nicht beobachten oder sie nach dem Schadenseintritt nicht sanktionieren kann. In diesem zweiten Teil der Arbeit wurde der institutionelle Rahmen für die Betrachtung der unterschiedlichen Finanzierungssysteme dargestellt. Darauf aufbauend werden im folgenden Teil der Arbeit anhand zweier Modelle die unterschiedlichen Auswirkungen einer undifferenzierten und einer differenzierten, vom Entlassungsverhalten abhängigen Finanzierung der Arbeitslosenversicherung auf die beschriebenen Verhaltensrisiken sowie auf das Beschäftigungs- und Wohlfahrtsniveau einer Volkswirtschaft näher untersucht.
3 Einheitliche Lohnsummensteuer versus Experience Rating
Wie bereits im Teil 2 dieser Arbeit dargestellt wurde, ist jedes deutsche Unternehmen mit demselben Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung konfrontiert. Da die Zahl der Unternehmen hinreichend groß ist, kann angenommen werden, dass sie bei ihren Einstellungs- und Entlassungsentscheidungen die daraus resultierenden zusätzlichen Kosten für die Arbeitslosenversicherung nicht ins Kalkül ziehen. Bei der Kalkulation der Arbeitskosten wird der Beitragssatz also lediglich als externe Größe betrachtet und auf mögliche Änderungen dieser Größe mit einer nachträglichen Anpassung reagiert.
Bertold und von Berchem (2004) kritisieren die daraus resultierende Quersubvention von Unternehmen[33], deren durch sie verursachten Kosten für die Arbeitslosenversicherung unter dem Durchschnitt liegen, zu den Verursachern hoher Kosten. Die massive Quersubvention in Deutschland führt zu gesamtwirtschaftlich ineffizienten Einstellungsverhalten der Unternehmen, die eine Verzerrung von Lohn- und Preisstrukturen nach sich zieht. Diese könnte jedoch durch differenzierte Beitragssätze überwunden werden, so Bertold und von Berchem (2004) weiter.
Im Folgenden wird anhand eines einfachen Modells untersucht, wie sich die fehlende Berücksichtigung der Kosten der Arbeitslosenversicherungskosten auf die Arbeitsnachfrageentscheidung eines Unternehmens auswirkt und inwieweit die Quersubvention auch die Arbeitsnachfrage anderer Unternehmen oder Branchen beeinflusst. Darauf aufbauend werden die Auswirkungen einer Internalisierung dieser Kosten in die Kostenfunktion eines Unternehmens auf dessen Arbeitsnachfrage und anschließend die Wohlfahrteffekte einer Berücksichtigung und einer Nicht-Berücksichtigung auf eine Ökonomie und ihre Wirtschaftssubjekte dargestellt.
Daran anschließend werden anhand eines Effizienzlohn-Modells von Albrecht und Vroman (1999) mit heterogener Arbeiterschaft und heterogenen Unternehmen die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung durch eine für jedes Unternehmen gleiche Lohnsummensteuer und durch ein experience rating -basiertes System, wie es in den Vereinigen Staaten verwendet wird, auf ihre Beschäftigungswirkung untersucht.
3.1 Effekt der Berücksichtigung der Arbeitslosenversicherungskosten
3.1.1 Annahmen des Modells
In einer kleinen offenen Volkswirtschaft gibt es nur einen Unternehmenssektor mit jeweils einem Unternehmen in einer der n Regionen. Die Zahl der Individuen, die alle potentielle Beschäftigte sind, ist in jeder Region gleich und sei durch Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten gegeben. Sie, die Individuen, sind hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihrer Leistungsbereitschaft als homogen anzusehen und aufgrund fehlender Mobilität an ihre Region und somit an das regionale Unternehmen gebunden. Die Zahl der Beschäftigten sei Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung. Die Unternehmen, welche allein den Produktionsfaktor Arbeit nachfragen, sind in Bezug auf ihre fixen Kosten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten und ihre ProduktionsfunktionAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, mit Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten für Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, identisch und erzielen für ihren Output denselben Preis[34] Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Diese Gleichheit in den Eigenschaften ist den Firmen jedoch nicht bekannt.
In der Ökonomie existiert ein Mindestlohn Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, welcher sich an der Höhe der garantierten Arbeitslosenunterstützung Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten je Arbeitslosen orientiert und auf Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten festgelegt ist[35]. Diese Unterstützung durch die Arbeitslosenversicherung wird vollständig durch die Unternehmen über eine Lohnsummensteuer mit einem Beitragssatz Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten finanziert, welcher jedoch von diesen als exogen gegeben angesehen wird. Der Beitragssatz und die Höhe der individuellen Unterstützungsleistung seien in allen Regionen der Ökonomie identisch.
3.1.2 Keine Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Arbeitslosenversicherung
Somit stellt sich das Optimierungskalkül eines Unternehmens Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten wie folgt dar:
( 1 ) Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
mitAbbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten , Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten sowie mit Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenund Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten. Das Ableiten der Gleichung (1) nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten, ergibt die Bedingung erster Ordnung (BEO)
( 2 ) Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
und nach Auflösen nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten die optimale Arbeitsnachfrage des Unternehmen Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten in Abhängigkeit von Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten,Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten und Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
( 3 ) Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten .
Aus der Bedingung, die Arbeitslosenunterstützung sei vollständig aus der Lohnsummensteuer zu finanzieren, ergibt sich die Budgetgleichung für die Arbeitslosenversicherung:
( 4 ) Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Summe der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung aller Unternehmen in der Ökonomie muss gleich der Summe der Unterstützungsausgaben in allen Regionen sein. Da alle Unternehmen identisch sind und sie den gleichen Faktor- und Outputpreisen sowie identischen Arbeitskräftepotential gegenüberstehen, kann (4) auch wie in (4.1) formuliert werden. Das Auflösen der Gleichung (4.1) nach Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten ergibt Gleichung (5), den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung in Abhängigkeit von der Arbeitsnachfrage und der Höhe der Unterstützungsleistung.
[...]
[1] 1926 waren im Deutschen Reich mehr als zwei Millionen Menschen arbeitslos (vgl. Spree, 2001, S.74). Auch Glismann und Schrader (2002) verdeutlichen die Entwicklung der Massenarbeitslosigkeit mit jährlichen Arbeitslosenquoten zwischen sieben bis 18 Prozent zwischen 1923 und 1926.
[2] Die Erwerbslosenfürsorge, zentralisierte steuerfinanzierte Mindestsicherung für Arbeitslose, wurde 1918 aufgrund der kriegsbedingten Arbeitslosigkeit eingeführt und von Reich, Ländern und Gemeinden finanziert. Jedoch war sie, im Gegensatz zur Arbeitslosenhilfe und zum heutigen Arbeitslosengeld 2, seit 1921 auf maximal 26 Monate beschränkt (vgl. Glismann und Schrader 2002, S.12 ff.).
[3] Bertold und von Berchem (2004) folgend haben Arbeitslose durch den zeitlichen Ausgleich des Einkommensverlustes, dem Prinzip nach eine Glättung der individuellen Einkommensströme über die Zeit, die Möglichkeit eine Selektion möglicher Beschäftigungen durchzuführen und auf einen zu ihnen möglichst gut passenden Job zu warten. Die gesamtwirtschaftliche Produktivität würde sich im Vergleich zur Nichtexistenz einer Arbeitslosenversicherung erhöhen.
[4] Von 1961 bis 1971 lag die Arbeitslosenquote mit Ausnahme des Zeitraums 1967-68 deutlich unter einem Prozent (vgl. Glismann und Schrader 2002, S.22).
[5] Schöb und Weimann (2004) verweisen darauf, dass die Gewerkschaften nach einem Anstieg der Inflationsrate auf sieben Prozent in den Jahren 1973 und 1974 und in Erwartung einer weiteren Inflationssteigerung Lohnsteigerungen von mehr als zehn Prozent durchsetzten, um ihre Mitglieder vor einem drohenden Rückgang ihrer realen Einkommen zu bewahren.
[6] Zuvor galt für alle Arbeitslosen ein maximaler Leistungsanspruch von 12 Monatsleistungen, wobei drei einbezahlte Monatsbeiträge einen Monat Leistungsanspruch entsprachen (vgl. Schäfer 2003, S.35).
[7] Siehe auch Schäfer (2003) S.35.
[8] Schäfer (2003) nennt hier eine Unterhaltsgeld-Erhöhung, die Einführung des Überbrückungsgeldes und die Absenkung des Mindestalters für eine Teilnahme an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
[9] Besonders wegen der steigenden Zahl älterer Langzeitarbeitsloser hat sich die Belastung der Arbeitslosenhilfe von 1,9 Milliarden DM (1980) auf 9 Milliarden DM (1985) erhöht, während die Arbeitslosenversicherung Überschüsse erwirtschaftete (vgl. Schäfer 2003, S.36).
[10] Hierbei werden nur Zeiten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hinzugezählt.
[11] Wäre dies nicht der Fall, würde eine schnelle Wiederaufnahme einer Beschäftigung für den Versicherten einen erheblichen Einkommensverlust nach sich ziehen, sollte er nicht lange genug in dieser Beschäftigung verweilen, um ähnlich große Ansprüche zu erzielen.
[12] Die im Folgenden verwendete Bezeichnung kinderlos oder Kinderlose bezieht sich immer auf Arbeitslose, die kein Kind bzw. auch deren Ehe- oder Lebenspartner kein Kind im Sinne des Einkommensteuergesetz § 32 haben (siehe auch SGB III § 129).
[13] Zwischen 2000 und 2001 wurde die Dynamisierung von der an die Entwicklung des Preisindex der Lebenshaltung abhängig gemacht (vgl. Schäfer 2003, S.38).
[14] Um den Frieden im Unternehmen und mit den Gewerkschaften zu wahren, könnten Unternehmer zu entlassende Arbeitnehmer dadurch entschädigen, indem sie ihnen in den letzten drei Monaten überdurchschnittlich hohe Löhne zahlen und ihm dadurch ein Arbeitslosengeldanspruch verschaffen, der bedeutend näher an seinem eigentlichen Lohn liegt. Der Arbeitnehmer und auch seine Interessensvertreter würden in diesem Fall eher eine Entlassung akzeptieren beziehungsweise im Fall betrieblicher Mitbestimmung ihr sogar zustimmen. Die Kosten dafür werden auf alle Beitragszahler umgewälzt und sind für das betreffende Unternehmen verschwindend gering. (Zu Risiken der Arbeitslosenversicherung, welche wie dieses auf asymmetrischer Informationsverteilung beruhen, wird in einem späteren Teil dieser Arbeit näher eingegangen.)
[15] Zusätzlich bemängelt der Sachverständigenrat (2003), dass sich die Leistung zum einen nicht an der Anzahl der Kinder orientiert und dass dieses „Kindergeld für Arbeitslose“ (Sachverständigenrat 2003, S.396) proportional vom ehemaligen Nettoeinkommen der arbeitslosen Eltern abhängt und somit unterschiedlich hoch ausfallen kann.
[16] Als sozialversicherungspflichtig gilt ein Beschäftigter, wenn er mindestens 15 Stunden in der Woche arbeitet und sein monatliches Einkommen die Geringfügigkeitsgrenze von 325 Euro übersteigt.
[17] Laut Glismann und Schrader (2002) wurde der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zwischen 3. August 1961 und 30. März 1962 ausgesetzt.
[18] Sesselmeier (2003) beschreibt, wie aufgrund steigender Sozialbeiträge sich das Verhältnis von Bruttolohn zu Nettolohn zwischen 1970 und 2003 von 1,5 : 1 auf 1,9 : 1 in Westdeutschland veränderte. Betrug die Abgabenlast der Sozialbeiträge 1970 26,5 Prozent der Bruttoentgelts (8,2 Prozent für Kranken-, 17 Prozent für Renten- und 1,3 Prozent für Arbeitslosenversicherung), stieg diese bis 2003 auf über 42 Prozent (14,4 Prozent für Kranken-, 19,5 Prozent für Renten-, 6,5 Prozent für Arbeitslosen- und 1,7 Prozent für die neu eingeführte Pflegeversicherung).
[19] Anteil der registrierten Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen
[20] Laut Sachverständigenrat (2003) sind Unternehmen, die höchstens fünf Mitarbeiter beschäftigen, von den Regelungen des Kündigungsschutzgesetzes nicht betroffen.
[21] Bei einer Betriebszugehörigkeit von mehr als 15 Jahren werden dem Kündigungsopfer sogar zwei Monatsgehälter pro Jahr der Betriebszugehörigkeit zugesprochen.
[22] Die abgebildeten Arbeitslosenquoten stellen den zum jeweiligen Zeitpunkt existierenden Anteil der gemeldeten Arbeitslosen an der Gesamtzahl der abhängigen zivilen Erwerbspersonen dar.
[23] Laut California budget project (2003) werden extended benefits für ursprünglich 13 zusätzliche Wochen gezahlt, jedoch haben einige Bundesstaaten diese zusätzliche Bezugsdauer um weitere sieben Wochen aufgestockt.
[24] Es existiert die Möglichkeit zeitlich befristet Sozialhilfe zu beziehen, jedoch wird diese in der Regel an Arbeitsstunden oder Fortbildungsmaßnahmen gekoppelt (vgl. Sinn et al. 2002, S.16).
[25] Werner und Winkler (2003) bemerken, dass allein in den drei Bundesstaaten Alaska, New Jersey und Pennsylvania auch geringe Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung erhoben werden.
[26] Glismann und Schrader (2001a) bemerken, dass die Steuergutschriften de facto eine Steuersenkung bedeuten.
[27] Wie bereits beschrieben, können diese Kosten nur auf Firmen übertragen werde, die die Kündigung selbst zu vertreten haben und nicht schon mit dem Höchststeuersatz besteuert werden.
[28] In der angelsächsischen Literatur wird der Begriff des imperfect experienc rating verwendet.
[29] Das experience rating wird auf alle Firmen angewandt. Unternehmen, deren bisheriges Entlassungsverhalten dazu führte, dass sie nur leicht über der Obergrenze beziehungsweise gering unter der Untergrenze bewertet wurden sind, werden daher auch die möglichen Kosten bei einer Entlassung mit berücksichtigen.
[30] Zusätzlich zum Arbeitslosengeld 2 wird in den ersten zwei Jahren des Bezugs ein Zuschlag gezahlt, der den Einkommensunterschied zwischen Arbeitslosengeld 1 und 2 zum Teil ausgleichen soll.
[31] In Deutschland werden im Fall der Arbeitslosigkeit und bei Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 oder 2 die Beiträge für die Krankenversicherung von den zuständigen Institutionen getragen.
[32] Eine ausführlichere Darstellung dieser Diskussion befindet sich im vierten Teil dieser Arbeit.
[33] Nicht nur Unternehmen mit unterdurchschnittlichem Anteil an den Kosten der Arbeitslosenversicherung und deren Arbeitnehmer subventionieren überdurchschnittliche Kostenverursacher sondern auch der Bund mit Hilfe des Bundeszuschuss zur Arbeitslosenversicherung (siehe auch Teil 2 dieser Arbeit).
[34] Da die Ökonomie als hinreichend klein und offen bestimmt ist, ist der Outputpreis durch den Weltmarktpreis bestimmt und nicht von den Unternehmen beeinflussbar.
[35] Dieser kann zum einen mit der Existenz eines solchen Mindestlohns in einer Reihe europäischer Länder und zum anderen mit der Freizeitpräferenz der Beschäftigten begründet werden. Ein potentieller Beschäftigter wird nur eine Beschäftigung aufnehmen, wenn der ihm ausgezahlte Lohn die sicheren Sozialleistungen mindestens um die ihm entstehenden Kosten durch den Freizeitverlust übersteigt.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (Paperback)
- 9783832496227
- ISBN (eBook)
- 9783956360138
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Juni)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- entlassungsverhalten quersubvention finazierungssystem
- Produktsicherheit
- Diplom.de