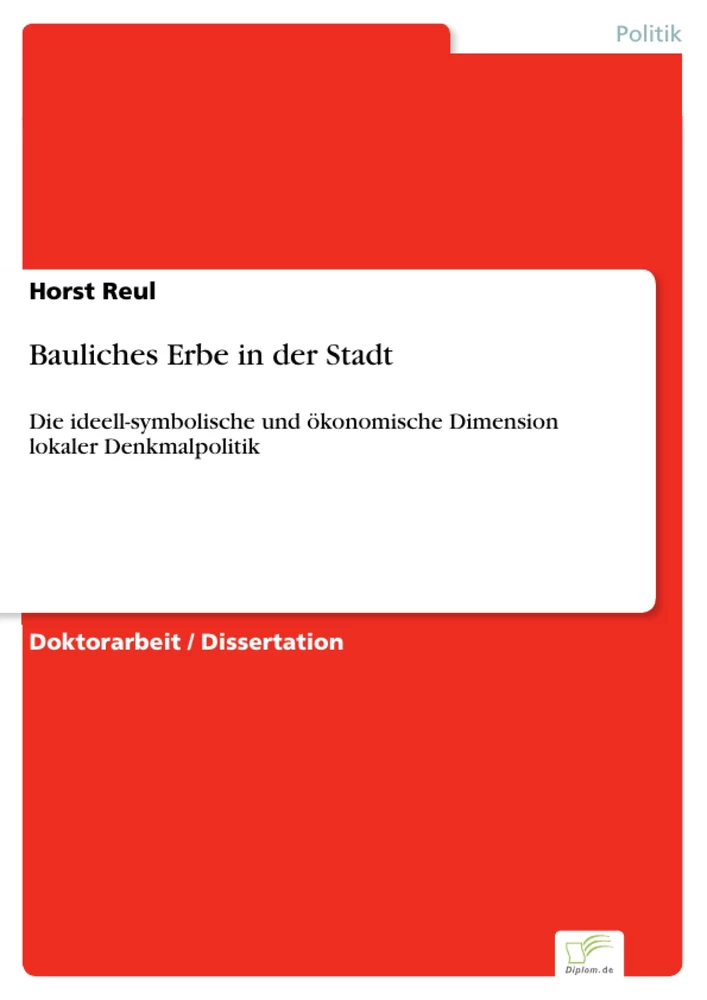Bauliches Erbe in der Stadt
Die ideell-symbolische und ökonomische Dimension lokaler Denkmalpolitik
Zusammenfassung
150 Jahre Stadt Neu-Ulm, zum Jubiläum der Abbruch - titelte das bayerische Fernsehen in einem Beitrag vom 31.7.94 in der Reihe Aus Schwaben und Altbayern.Im Mittelpunkt dieses Features steht der Beschluss des Neu-Ulmer Stadtrates vom 19.5.94, die unter Denkmalschutz stehende Caponniere 4 abreißen zu lassen.
Während gerade der Freistaat Bayern sich seiner denkmalfreundlichen Kulturpolitik rühmt, der Bezirk Schwaben Denkmalpflege als Gemeinschaftsaufgabe mit Zukunft sieht und dies stolz durch eine aufwendige Broschüre im Jahre 1994 zum 20-jährigen Jubiläum des Bezirkstagspräsidenten Simnacher dokumentiert, fast täglich in der Tages- und Fachpresse über erfolgreiche Sanierungen, Restaurierungen und Konservierungen unter Denkmalschutz stehender Gebäude berichtet wird, wollte sich die Stadt Neu-Ulm von einem ihrer Denkmäler trennen. Die Entscheidung des Neu-Ulmer Stadtrates mobilisierte die lokale und überregionale Presse, das Landesdenkmalamt, den Landesdenkmalrat, das bayerische Kultusministerium, den Förderverein Bundesfestung Ulm sowie Ulmer und Neu-Ulmer Bürger. Darüber hinaus findet man Zeitungsberichte mit der Überschrift wie Industriedenkmalen droht Verfall.
Darin wird auf den drohenden Verfall von Textilfabriken, Mühlen und Wasserbauwerken in Bayerisch-Schwaben und den damit verbundenen Problemen der Nutzung hingewiesen. Eine kurze Zeitungsnotiz mit der Titelzeile Förderkreis für Erhalt der Kienlesberg-Kaserne berichtet über die Absicht der Stadt Ulm, diesen gut erhaltenen Teil der Bundesfestung Ulm nach dem Auszug der Bundeswehr abbrechen zu lassen, um an dieser Stelle Wohnblocks zu errichten. Der Förderverein Bundesfestung Ulm fordert dagegen um jeden Preis die Erhaltung der Kienlesberg-Kaserne. Die AZ berichtet über ein bedrohtes Denkmal in privater Hand mit der Überschrift 600 Jahre altes Haus steht vor dem Abriss; Nördlingen: Stadtrat überstimmt OB und Denkmalschutz.
Mit der Kopfzeile im Kulturteil Sinkt ein Flaggschiff der Industriekultur? Der Kattunfabrik Augsburg droht die Zerstörung wehklagt die Augsburger Allgemeine Zeitung über den drohenden Abriss des privaten, aber der Stadt Augsburg zum Verkauf angebotenen Denkmals. Andererseits betonen Kulturpolitiker, wie z. B. der bayerische Kultusminister Zehetmeir bei der Eröffnung des frisch renovierten, unter Denkmalschutz stehenden Gögginger Kurhauses, dass bayerische Denkmalpolitik als wichtiges politisches Signal gewertet werden muss und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel I Stadtplanung, Stadterneuerung zwischen Kontinuität und Wandel
A Problemstellung Stadterneuerung und Substanzerhaltung in Mittelstädten als Planungsaufgabe
B Die Stadterhaltung, Stadterneuerung und der Denkmalschutz
1. Stadtutopien, Stadtwirklichkeit
2. Stadterneuerung als historischer Prozeß
3. Stadterneuerung und gesellschaftlicher Modernisierungsprozeß
4. Die politische Komponente der Stadterneuerung
5. Instrumente des Städtebaurechts zu Stadterhaltung und Denkmalschutz
6. Zwischen fachgesetzlichem Denkmalschutz und gemeindlicher Fachplanung
7. Zum öffentlichen Interesse im kommunalen Denkmalschutz und der kommunalen Denkmalpflege
8. Änderungen des Denkmalschutzrechts in Bayern 1994 - Stär kung der Rechtsstellung der unteren Denkmalschutzbehörde
C Städtebauliche Leitbilder als Spiegel der demokratischen Gesellschaftsordnung
Kapitel II Die Verwaltung der Geschichte und das ungeliebte Erbe
A Denkmalpflege und der Umgang mit der Zeit
B Vom kooperativen Kulturföderalismus zum kulturpolitischen Handlungsfeld kommunale Denkmalpflege
1. Akteure der Kulturpolitik
2. Denkmalpflege und kulturell bedeutsames
3. Motive und Funktionen der Denkmalpflege
4. Denkmalschutz und Denkmalpflege als Teil einer Identitätstrategie zur Konstruktion einer kulturregion
C Zur Adoption des baulichen Erbes - erbe als politische kategorie
Kapitel III Der Kampf um das Denkmal: Der kommunale Umgang mit baulichen Denkmalen
A Zwischen Erhaltungsanspruch und Abrißwunsch
B Von der Villa bis zur Bundesfestung
1. Die Gründerzeitvilla Ecarius in Speyer
2. Ein kunsthistorisches Bauwerk von Weltruf: Das Kurhaus in Göggingen
3. Neu-Ulms ungeliebtes Denkmal: Die Caponniere 4
C Baulicher Denkmalschutz und gemeindliche Selbstverwaltung - Eine vorläufige Bilanz
Kapitel IV Im Schatten des Münsters
A Zur Genese Neu-Ulms - Geburtshelfer Bundesfestung
B Zwischen dem Frieden von Luneville 1801 und dem Ende des 2. Weltkriegs
1. Ulm auf dem rechten Ufer
2. Die Bundesfestung Ulm
C Von der Garnisonsstadt zur Industriestadt
D Innovative Stadtplanung und die Bundesfestung im Neu-Ulmer Stadtgebiet
Kapitel V Kommunale Denkmalpolitik: Verwaltungshandeln im Rampenlicht der
Öffentlichkeit
A Kommunale Denkmalpflege und der Denkmalschutz im Geflecht der Kommnalen Verwaltung
B Medien, organisierte Interessen und Macht im Lichte der
lokalen Denkmalpolitik
1. Kommunale Macht- und Entscheidungsstrukturen
2. akteure und Entscheidungsmechanismen bei städtebaulichen, denkmalrelevanten Maßnahmen und der Einfluß der Medien
C Kommunale Denkmalpolitik: Verwaltungshandeln als Ergebnis staatlicher Bevormundung und öffentlichen Drucks
Schlußfolgerung
Abkürzungsverzeichnis
bild- und graphiknachweis
Quellen- und literaturverzeichnis
Einleitung
"150 Jahre Stadt Neu-Ulm, zum Jubiläum der Abbruch" - titelte das bayerische Fernsehen in einem Beitrag vom 31.7.94 in der Reihe "Aus Schwaben und Altbayern".
Im Mittelpunkt dieses Features steht der Beschluß des Neu-Ulmer Stadtrates vom 19.5.94, die unter Denkmalschutz stehende Caponniere 4 abreißen zu lassen.
Während gerade der Freistaat Bayern sich seiner denkmalfreundlichen Kulturpolitik rühmt, der Bezirk Schwaben "Denkmalpflege als Gemeinschaftsaufgabe mit Zukunft" sieht und dies stolz durch eine aufwendige Broschüre[1] im Jahre 1994 zum 20-jährigen Jubiläum des Bezirkstagspräsidenten Simnacher dokumentiert, fast täglich in der Tages[2] - und Fachpresse über erfolgreiche Sanierungen, Restaurierungen und Konservierungen unter Denkmalschutz stehender Gebäude berichtet wird, wollte sich die Stadt Neu-Ulm von einem ihrer Denkmäler trennen. Die Entscheidung des Neu-Ulmer Stadtrates mobilisierte die lokale und überregionale Presse, das Landesdenkmalamt, den Landesdenkmalrat, das bayerische Kultusministerium, den Förderverein "Bundesfestung Ulm" sowie Ulmer und Neu-Ulmer Bürger. Darüber hinaus findet man Zeitungsberichte mit der Überschrift wie "Industriedenkmalen droht Verfall"[3]. Darin wird auf den drohenden Verfall von Textilfabriken, Mühlen und Wasserbauwerken in Bayerisch-Schwaben und den damit verbundenen Problemen der Nutzung hingewiesen. Eine kurze Zeitungsnotiz mit der Titelzeile "Förderkreis für Erhalt der Kienlesberg-Kaserne" berichtet über die Absicht der Stadt Ulm, diesen gut erhaltenen Teil der Bundesfestung Ulm nach dem Auszug der Bundeswehr abbrechen zu lassen, um an dieser Stelle Wohnblocks zu errichten.[4] Der Förderverein "Bundesfestung Ulm" fordert dagegen um jeden Preis die Erhaltung der Kienlesberg-Kaserne. Die AZ berichtet über ein bedrohtes Denkmal in privater Hand mit der Überschrift "600 Jahre altes Haus steht vor dem Abriß; Nördlingen: Stadtrat überstimmt OB und Denkmalschutz".[5]
Mit der Kopfzeile im Kulturteil "Sinkt ein Flaggschiff der Industriekultur? Der Kattunfabrik Augsburg droht die Zerstörung"[6] wehklagt die Augsburger Allgemeine Zeitung über den drohenden Abriß des privaten, aber der Stadt Augsburg zum Verkauf angebotenen Denkmals.
Andererseits betonen Kulturpolitiker, wie z. B. der bayerische Kultusminister Zehetmeir bei der Eröffnung des frisch renovierten, unter Denkmalschutz stehenden Gögginger Kurhauses, daß "bayerische Denkmalpolitik als wichtiges politisches Signal gewertet werden muß" und über die bayerische Kulturlandschaft hinaus beachtet wird[7].
Der jährlich stattfindende Tag des Denkmalschutzes[8], der zunehmende Erfolg der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, gestützt durch das Medium Zweites Deutsches Fernsehen[9], weist auf das geradezu dichotomisch scheinende Phänomen hin - hier die Bereitschaft der Öffentlichkeit, die Erhaltung baulicher Denkmale der Identitätsstiftung wegen zu fordern, dort dagegen die Forderung kommunaler Parlamente, bauliche Kulturdenkmale zum Abriß freizugeben und gibt Anlaß zu der Frage, unter welchen Rahmenbedingungen Kommunalparlamente zu Abrißentscheidungen neigen oder Erhaltungsmaßnahmen beschließen. Danach ist zu fragen welche Akteure in den Kommunen auf die Entscheidungen Einfluß nehmen, ob dahinter rational begründbare oder emotional begründete, also anthropologische Entscheidungsfaktoren den Ausschlag geben. Des weiteren stellt sich die Frage, ob das Denkmal in öffentlicher Hand einem besonderen öffentlichen Interesse unterliegt. Zu fragen ist, ob sich in jüngerer Zeit ein Leitbildwechsel abzeichnet, der sich in der kommunalen Denkmalpolitik niederschlägt. Zu fragen ist ferner, ob eine Entscheidungs- und gegebenenfalls Wertehierarchie in der Konkurrenz zwischen Denkmalschutz und anderen Aufgaben öffentlicher Hand handlungsleitend ist.
Die politikwissenschaftliche Literatur setzt sich mit den kommunalpolitischen Zielkonflikten, die aus denkmalrelevanten Entscheidungen herrühren, nur marginal auseinander.
Häberle beleuchtet die Kulturpolitik in der Kommune aus verfassungsrechtlicher Sicht.[10] In seiner Abhandlung, dessen Anlaß das Augsburger Friedensfest 1979 war, stellt Häberle die drei vorläufige Thesen auf, "daß das kommunale Kulturverfassungsrecht ein Rechtsgebiet eigener Art und Größe, durch Grundgesetz und Länderverfassung konturiert und von der kommunalen Kulturpolitik mit Leben zu erfüllen sei, das kommunales Kulturverfassungsrecht als Einzelelement u.a. das verfassungsgeschützte kommunale Kulturhoheitselement ist und daß sich kommunale Kulturpolitik in drei Dimensionen und zwar in Raum, Zeit und Öffentlichkeit entfaltet." Die kommunale Denkmalpolitik an sich wird dabei nicht beleuchtet. Weniger von der verfassungsrechtlichen, sondern von der kulturphilosophischen Seite her betrachtet Lübbe[11] generell das Problem des Denkmalschutzes. Aus der Sucht aus Altem Neues zu machen, immer jüngere Artefakte und Bauten unter Denkmalschutz stellen zu wollen, ohne sich der Folgelasten bewußt zu werden, resultiert ein immer geringer werdender Grenznutzen, schlußfolgert Lübbe unter anderem.
Arbeiten, die sich mit städtebaulichen, kunsthistorischen, touristischen und steuerrechtlichen Fragen befassen, liegen dagegen in umfangreicher Fülle vor. Darüber hinaus setzt sich die juristische Literatur aus verwaltungsrechtlicher und baurechtlicher Sicht mit den Fragestellungen, die sich aus denkmalpflegerischem Anspruch ergeben, intensiv auseinander.[12]
Im Bundesland Bayern trat am 1.6.94 die Änderung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes in Artikel 12, Absatz 3 DSCHG in Kraft.
Danach wird "Die Staatsregierung... ermächtigt ... Vorschriften zu erlassen über 1. Die Übertragung von Aufgaben des Landesamtes für Denkmalpflege an andere staatliche Stellen, 2. Die Verfahrensbeteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege, 3. Ausnahmen oder Erlaubnispflicht". Artikel 15, Absatz 2, Satz 2 DSCHG (sogenanntes Dissensverfahren) wird aufgehoben. Ebenso trat am 1.6.94 eine Änderung der Bayerischen Bauordnung in Kraft. Danach bedürfen Abbrüche von Baudenkmälern künftig nicht mehr der baurechtlichen Abbruchgenehmigung. Statt dessen lebt die denkmalrechtliche Abbrucherlaubnis, gemäß Artikel 6, Absatz 1, Satz 1 Denkmalschutzgesetz wieder auf.[13] Zu fragen ist, ob diese Gesetzesänderung auf die kommunale Denkmalpolitik Einfluß nimmt.
In den sogenannten alten Bundesländern mehren sich die Anzeichen dafür, daß dem Denkmalschutz der "Wind stärker ins Gesicht bläst". Exemplarisch sei auf die Situation im Bundesland Bayern in den Jahren '95 und '96 verwiesen. So befürchtete der Vorsitzende des Landesdenkmalrates Erich Schosser, bis 1994 CSU Landtagsabgeordneter, eine Schwächung des Denkmalschutzes durch die Baurechtsnovelle und die Änderung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes[14] und verweist auf die Reduktion der Zuschüsse für das bayerische Landesamt für Denkmalpflege von 49 Mill. DM im Jahre 1990 auf 36 Mill. DM im Jahre 1996.[15] Hier befürchtet der Landesdenkmalrat einen negativen ökonomischen Einfluß auf das betroffene Handwerk, im besonderen auf die bayerischen Kirchenmaler. Manifeste des beim Bundesinnenministerium angesiedelten Nationalkomitees für Denkmalschutz[16], regelmäßig erscheinende Informationsdienste des Bundesministeriums für Raumwesen, Bauordnung und Städte[17], regelmäßig erscheinende Publikationen der Landesdenkmalämter, Berichte der Architektenkammern in den einzelnen Bundesländern, immer häufiger stattfindende Seminare und Kongresse, meist mit internationaler Akzentuierung - beispielhaft soll die erstmals 1994 in Leipzig und im November '96 zum zweiten Mal stattgefundene Denkmalmesse erwähnt werden - Veranstaltungen der Organisationen der öffentlichen Hand auf nationaler, Länder-, Bezirks-, Landkreis und Kommunalebene, Städtebauförderungsprogramme, besonders im Beitrittsgebiet, Programme zur Dorferneuerung, die Zunahme von Altstadtfesten, Altstadt-, Stadt- und Dorfjubiläen, fast immer in Verbindung mit der Würdigung historischer Bauten und der Stadt- und Dorfgeschichte, zeugen von der Allgegenwart der Rückbesinnung, der Erinnerung und des Bewußtseins, in Geschichtlichem zu leben.
Deshalb geht die Vermutung dahin, daß zwar der Denkmalschutz in der Kommune von der Bevölkerung akzeptiert wird, von den politischen Akteuren in der kommunalen Praxis dagegen als dichotomisches tagespolitisches Problem erfahren wird.
Die Vermutung geht außerdem dahin, daß ausschließlich der Nutzungsaspekt handlungs- und entscheidungsleitend ist.
Die Allgegenwart denkmalpflegerischer und denkmalschutzrechtlicher Fragen einerseits und der kommunale bzw. regionale Wettbewerb mit der ökonomischen Kategorie "Standortfaktor" andererseits, führen zu einem Zielkonflikt, der die zentrale Frage aufwirft:
welchem Entscheidungsmuster folgt die Kommunalpolitik beim Schutz der baulichen Denkmale, insbesondere wenn diese in öffentlicher Hand sind?
Von dieser Problemstellung her entscheiden sich die weiteren Verfahrensweisen und Methoden.
Da die politikwissenschaftliche Literatur die ökonomische und kulturelle Dimension kommunaler Denkmalpolitik, besonders wenn der Eigentümer die öffentliche Hand ist, unberücksichtigt läßt, gilt es zunächst den normativen Hintergrund zum Denkmalrecht und Städtebaurecht für die Fragestellung funktional auszuwerten, die Theorieansätze der Denkmal- und Städtebautheorie zu beleuchten und Fallbeispiele empirisch-analytisch zu strukturieren und zu überprüfen.
Die theoretische Reflexion wird uns dann Kategorien bereitstellen, die eine empirische Überprüfung der politischen, utilitaristischen Forschungsthesen erlaubt. Die dabei gewonnenen Untersuchungsergebnisse liefern uns Indikatoren für die Öffentlichkeitsbezogenheit kommunaler Denkmalpolitik. Die Fragen nach der ökonomischen und kulturellen Dimension lokaler Denkmalpolitik erweckt nicht nur theoretisches Interesse, sondern besitzt auch eine erhebliche Bedeutung für die kommunalpolitische Praxis.
Es gilt Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die bei Konkurrenzsituationen zwischen kommunalem Denkmalschutz und anderen Aufgaben öffentlicher Hand zu einer angemessenen Berücksichtigung der "kulturellen Belange" beiträgt. Dabei soll Kommunen mit fortifikatorischen Denkmalen und hier besonders der bayerischen Stadt Neu-Ulm besonderes Augenmerk gewidmet werden.
Der raum-, zeit- und öffentlichkeitsbezogene Forschungsansatz fordert die Auseinandersetzung mit Begriffen, die in der politikwissenschaftlichen Literatur nur kursorisch oder gar nicht angewandt werden: Wie beispielsweise "Denkmalkultus" und "Denkmalkultur" als kulturphilosophische Bezugskategorie, "kulturelles Erbe", "geschichtliche Zeugen, Zeugnisse der Vergangenheit", "identitäts- und sinnstiftend", Begriffe, die der kunstgeschichtlichen und kulturanthropologischen, soziologischen und psychologischen Phänomenologie zuzuordnen sind. Im Verlauf der Arbeit wird sich erweisen, daß diese Begriffe politikwissenschaftliche Relevanz besitzen.
Die Untersuchung "Bauliches Erbe in der Stadt: Die ideell-symbolische und ökonomische Dimension lokaler Denkmalpolitik" verfolgt das Ziel, die konfligierenden Interessen in der Konkurrenzsituation baulicher Denkmalschutz mit anderen öffentlichen Aufgaben darzustellen, auf unterschiedliche "Nutzungsfunktionen" von Baudenkmalen hinzuweisen und die Vergangenheitsbezogenheit kommunaler Politik an sich zu verdeutlichen.
Darüber hinaus liegt dieser Arbeit der Wunsch zugrunde, den Denkmalschutz in die politische Diskussion einbeziehen und dessen politische Dimension innerhalb der empirischen Sozialwissenschaften zu betonen.
Kapitel I Stadtplanung, Stadterneuerung zwischen Kontinuität und Wandel
A Problemstellung Stadterneuerung und Substanzerhaltung in Mittelstädten als Planungsaufgabe.
B Die Stadterhaltung, Stadterneuerung und der Denkmalschutz
1. Stadtutopien, Stadtwirklichkeit
2. Stadterneuerung als historischer Prozeß
3. Stadterneuerung als gesellschaftlicher Modernisierungsprozeß
4. Die politische Komponente der Stadterneuerung
5. Instrumente des Stadtbaurechts zu Stadterhaltung und Denkmalschutz
6. Zwischen fachgesetzlichem Denkmalschutz und gemeindlicher Fachplanung
7. Zum öffentlichen Interesse im kommunalen Denkmalschutz und der kommunalen Denkmalpflege
8. Änderungen des Denkmalschutzgesetzes in Bayern 1994 - Stärkung der Rechtsstellung der unteren Denkmalschutzbehörde
C Städtebauliche Leitbilder als Spiegel der demokratischen Gesellschaftsordnung
Kapitel I Stadtplanung, Stadterneuerung zwischen Kontinuität und Wandel
A Problemstellung Stadterneuerung und Substanzerhaltung in Mittelstädten als Planungsaufgabe
Die Stadt ist nicht nur in der westlichen Welt sondern mittlerweile global die vorherrschende und bestimmende Lebensform geworden.
Die Stadt hat stets auch historische, soziale, ökologische und politische Dimensionen.[18] Wie bei jedem Akt menschlichen Siedelns sind drei elementare Handlungsweisen im Spiel die Bewegung (Linea), die Besetzung (Fläche) und das Aufrichten (räumlich). Diese Elemente sind uns als Erschließung, Parzellierung und als Baustruktur vertraut. Alte Städte verbinden Kultur und epochenübergreifende Gemeinsamkeiten. Der Gesamtorganismus ist klar nach außen abgegrenzt. Die Zugänge in den Stadtkörper sind begrenzt und bündeln die von außen kommenden Wegestrukturen.[19]
In dem Begriff Stadterneuerung verbirgt sich der Begriff Stadtentwicklung im Topos Substanzerhaltung dagegen Denkmalpflege bzw. Denkmalerhaltung. Mörsch[20] stellt die Denkmalpflege der Stadtentwicklung als "ständig auf der Suche nach sinnvollen Bewegungsrichtungen seiend im Gegensatz zur Denkmalpflege, die bewahrend und vorsichtig zu handeln habe", gegenüber.
Dabei ordnet Mörsch den beiden Begriffen folgende Attribute zu, die zugleich den methodischen Ansatz des Kunsthistorikers und Stadtplaners verraten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Zuordnung gilt sicher für die Denkmalpflege in Ländern, in denen es keine katastrophalen Situationen gegeben hat. Bei denen "das Wiederbeginnen städtischer Entwicklung nach dem 1. und 2. Weltkrieg an die Bedingung geknüpft war, historische Gestalt wiederzugewinnen", wo die Stadtentwicklungsarbeit "an der sozialen und baulichen Gestalt der Stadt auf die geradezu therapeutische Wirkung geschichtlicher Bausubstanz für ihre Bewohner hinweist und die Denkmalpflege entsprechend beschäftigen muß",[21] resultiert aus der Rolle der Denkmalpflege in friedlicheren Situationen der Stadtentwicklung die integrale Stadtentwicklung. Diese bedeute zunächst die " gerechte Abwägung" aller vorhandenen und künftiger Faktoren, die bei der Existenz der jeweiligen Stadt diese unter den sozialen, kulturellen, ökonomischen und funktionalen Gesichtspunkten als kompliziertes Gewebe Stadt- oder Siedlungsraum begreift.
Weiter bedeutet nach Mörsch die integrale Stadtentwicklung ein vielfach miteinander Verbundensein und darüber hinaus, daß nicht nur "alle Beteiligten am Abwägungsprozeß das gemeinsame Ziel einer gerecht abgewogenen komplexen Stadt vor Augen haben", sondern, daß der Planungsprozeß als integrativer und interdisziplinärer partnerschaftlicher Vorgang begriffen und praktiziert werden muß.
Integrale Stadtplanung bedeutet demnach, den Denkmalpfleger und all jene, die über konkrete denkmalbezogene Daten, Fakten und Absichten verfügen, möglichst frühzeitig einzuschalten und kontinuierlich zu beteiligen, ihn über Nutzungsänderungen, Richtplanmöglichkeiten, Investitionstendenzen zu informieren.
Wie noch zu untersuchen sein wird, hat die Praxis mancher Art von Denkmalpflege bewiesen, daß aus ihrem Zusammenhang gerissene Denkmale ihren Sinn weitgehend verlieren und entsprechend für gesellschaftliche Sinngebung unbrauchbar werden. Mörsch fordert weiter die Bewahrung vielfältiger materieller Spuren und deren Beachtung für den Planer der Stadtentwicklung und verbindet diese Forderung mit der Frage, wem diese Spuren mehr sein sollen als kunsthistorisches Bildungsgut oder touristische Werbeträger und gibt hierzu die Antwort, "nämlich nahe räumliche Wohn- und Arbeitswelt, vertrauter Verfügungsraum, überschaubarster, mit ihm sich verändernder Teil seiner Welt. Die Rede ist vom symbiotischen Verhältnis zwischen Bewohner und alter Substanz".[22] Wenn die Symbiose zwischen Bausubstanz und Nutzer wichtig ist, dann "kann es der Denkmalpflege nicht gleichgültig sein, welche Wege die Stadtentwicklung hier geht". Sie muß fordern, daß man den Zugriff auf die attraktive Innenstadt nicht nur von der momentanen Zahlungspotenz des Leistungsfähigsten abhängig macht, sondern auch von stadterhaltenden Gesamtkonzepten. Dabei ist die Artikulierung eines entsprechenden politischen Willens ausschlaggebend.
Es bedarf also der integralen Denkmalpflege. Es gehört deshalb auch zu den guten Traditionen denkmalpflegerischer Arbeit, die Nutzbarkeit alter Bausubstanz in den Grenzen der Verträglichkeit immer wieder zu überdenken und an Finanzierungsmodellen und anderen positiven Wirtschaftsbedingungen für Baudenkmäler und ihre Besitzer mitzuwirken. Ist der Eigentümer des Denkmals die öffentliche Hand, insbesondere die Kommune, so stehen besonders fortifikatorische Denkmäler, wegen ihrer kurzfristig kaum überschaubaren Benutzbarkeit "Innenstadtsanierungen" im Wege und verleiten bei Stadterneuerungsprojekten zum Euphemismus Sanierung, der oft für Abbruch und Neubau steht. Die Vorbildfunktion des öffentlichen Denkmaleigentümers wird ob solchen Handelns in Frage gestellt.
B Die Stadterhaltung, Stadterneuerung und der Denkmalschutz
1. Stadtutopien, Stadtwirklichkeit
Aus der Perspektive der Stadtgeschichte über westliche Modernisierungsutopien und damit auch Stadterneuerungsprozessen nachzudenken, führt uns zu den bekanntesten Utopien seit Platos Konstruktion eines idealen Staates zum Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, von Morus und Campanella zu den Stadtvorstellungen der Architekten Alberti und Filarete. Mit Beginn der Industrialisierung folgten die Vorstellungen idealer utopischer Gemeinschaften der Frühsozialisten Owen, Fourier, Godin, Chabet und die Stadt von Ledoux.
In der jüngeren Geschichte zeichneten sich zwei Stränge utopischen Denkens ab, die gegen Ende des 19ten Jahrhunderts in einer Phase massiver Großstadtkritik mündeten. Zwischen den Kriegen fand deren Ausformung statt und nach dem 2. Weltkrieg deren Entfaltung. Die ältere und zuerst programmatisch artikulierte Tradition resultiert aus einer Kritik an den hygienischen, sozialen und ästhetischen Mißständen der industriellen Großstadt des späten 19. Jahrhunderts. Ebenezer Howard propagierte ein neues Siedlungsmodell, bekannt unter dem Terminus "Gartenstadt"-Idee, der eine Vorstellung von der Stadt als quasi-biologischer Organismus zugrunde lag. Der zweite Strang utopischen Denkens folgte dem Leitbild der Maschine.
Aus der Kritik am Eklektizismus der akademischen Architektur, einer maßlosen Wertschätzung von Ingenieurleistung und dem Versuch die heterogenen Anforderungen an die Stadt planerisch zu bewältigen, entstand besonders in den USA vor dem 1. Weltkrieg die Strömung des "Funktionalismus". Dieses Modell war gestützt auf Taylors Theorie der Arbeitsorganisation und des Managements und einer Philosophie des korporativen Interessenausgleichs zwischen Arbeit und Kapital (Fordismus).
Nahezu gleichzeitig wurden die technischen Voraussetzungen für den Hochhausbau geschaffen, der die alte Utopie vom "Turmbau zu Babel" zu erfüllen half.[23] Die Verknüpfung beider Stränge mündete auf konzeptioneller Ebene im Bild der "gegliederten und aufgelockerten Stadt". Soziale Theorien der Zeit liegen als utopische Ideen städteplanerischen Handlungen zugrunde. Aber seit es urbane Ansiedlung gibt, werden auch Vorstellungen von Städten überliefert, die als Idealstädte, Planstädte oder utopische Städte bezeichnet werden können. Mit solchen Stadtgründungen oder Stadtausbauten ist stets Herrschaftsanspruch verbunden. Orte der Religion, Residenzen und Zentren der Herrschaft werden als Idealstädte stilisiert oder ausgebaut oder auch neu begründet. Im mittelalterlichen Städtebau ist der antike Typus der ummauerten Festungsstadt ebenso wichtig wie die christliche Vorstellung des himmlischen Jerusalem. Wirkliche Idealstadtkonzepte entstehen aber erst seit der Renaissance in der Theorie der Architektur (Albrecht Dürer), in der Literatur (z.B. Thomas Morus) und der Realität (z.B. Piacenca). Grundsätzlich stehen diese Städte in enger Verbindung mit dem Befestigungsbau und bestechen durch ihre Berechenbarkeit und rational mathematische Gliederung.[24] Es liegt aber im Wesen der Utopie, daß sie aufhört Utopie zu sein, wenn sie sich als realisierbar erweist. In der gebauten Idealstadt begegnen sich Utopisches und Wirklichkeit. Beides schließt sich gegenseitig aus, die Überführung in die bauliche Realität bedeutet für den einheitlich abbildhaft gedachten Charakter der Idealstadt stets mehr oder minder rasch jeweils auch Veränderung.[25]
2. Stadterneuerung als historischer Prozeß
Stadterneuerung als historischer Prozeß war in der Regel Wiederherstellung nach Katastrophen, in denen die alte Bausubstanz weitgehend untergegangen war. Aber daneben findet sich auch der obrigkeitliche Eingriff in das vorhandene Stadtgefüge schon in frühen Beispielen. Unter dem euphemistischen Begriff Sanierung dagegen gibt es ihn erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts.
In den Großstädten war Sanierung zunächst gleichbedeutend mit dem Abbruch alter vorindustrieller Bausubstanz und Neubau, meist auch unter Veränderung des Strukturgefüges. Im Gegensatz dazu ist in Kleinstädten die vorindustrielle Bausubstanz schrittweise und nur in Teilbereichen durch neuere verdrängt worden, weil der wirtschaftliche Druck in diese Richtung fehlte. Heutige Verkehrs- und Wirtschaftsanforderungen werfen Probleme auf, denen die Mittel- und Kleinstadt nicht ausweichen kann, wenn sie ihre, auch unter Raumordnungsgesichtspunkten wichtige wirtschaftliche Rolle als zentraler Ort nicht aufgeben will. Inwieweit dabei Bausubstanz erhalten werden kann und soll, hängt einerseits wesentlich von strukturellen Entscheidungen, anderseits von zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten ab, die wiederum nicht unabhängig voneinander sind.[26]
Städtebauliche Erneuerung und Substanzerhaltung die "erhaltende Stadterneuerung" im Sinne von Stadtreparatur[27] wird offensichtlich zum Kernpunkt der praktischen Politik. Ist der Denkmaleigentümer die Kommune, bzw. die öffentliche Hand, bedarf es der Beachtung und Überprüfung der normativen und institutionellen Rahmenbedingungen, des Erkennens der politisch handelnden Akteure und der resultierenden Konflikte und Defizite zwischen Denkmalpflege und Innenstadtentwicklung.
Zum Verständnis des Erkennens der Muster der Stadterneuerung hilft die Betrachtung der Entwicklung mittelalterlicher Städte. Drei wesentliche technische Erfindungen in der Neuzeit veränderten jeweils radikal die Entwicklung der Städte vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Entwickelte sich die Stadt von der Antike zum Mittelalter relativ langsam und kontinuierlich, so bringt die Erfindung der Kanone den ersten Einschnitt, der "Sicherheitsbehälter" ist nicht mehr ausreichend und wird umgebaut. Die Hypotrophierung des "Schutzsystems"[28] ist vergleichbar mit der Entwicklung der Ritterrüstung. Mit ihrer Panzerung drosselt sich die Stadt fast selbst ab. Diese wesentliche Erfindung der Stadt für ihre Sicherheit und Abgrenzung wird durch die Waffenentwicklung überholt. Das Wachstum der Stadt wird nicht mehr durch Barrieren strukturiert, sondern die Entfernung der überflüssigen Befestigungsanlagen ermöglicht das erste Flächenrecycling der Städte. Dies ist die Erfindung der Ringstraßen, auch Boulevardsystem genannt. Aus dem ehemaligen Sicherheitssystem wird ein verkehrliches Entlastungssystem. In den großen Metropolen wird dies ergänzt durch labyrinthartig verknüpfte Kernkörper, die mit großen Schnitten aufgeschlossen und entlastet werden.
Die Erfindung der Eisenbahn zu Beginn des vorigen Jahrhunderts eröffnet eine völlig neue Transport- und Geschwindigkeitsdimension, die nun der Stadt die Verflechtung mit ihrem Umfeld in einer bislang unbekannten Größenordnung möglich macht.
Die dritte und größte Veränderung für die Stadt resultiert aus der Erfindung des Kraftfahrzeugs. Das alte Muskelkraftstraßensystem ist dieser Transportmenge in keiner Weise gewachsen und muß radikal um- bzw. ausgebaut werden. Dieser Prozeß ist längst noch nicht abgeschlossen und wird die Städteplaner und Stadterneuerer noch lange beschäftigen.
Stadterneuerung ist seit jeher eine Daueraufgabe. An jeder Stadt läßt sich nicht nur ihre Erweiterung ablesen, sondern ihre Veränderung und Erneuerung im Inneren spätestens alle zwei Generationen. Eine Stadt ist nie fertig, sie verändert sich mit ihren Bewohnern im Laufe der Jahrhunderte ständig. "Unterbliebene Veränderungsprozesse fördern die Verödung, den Verfall, es zeigen sich bald Mumifizierungserscheinungen."[29]
Städte geben uns Schutz und Entwicklungsmöglichkeiten, sind der Hintergrund individueller und gemeinschaftsstiftender Lebensbewegungen. Über alle Zeiten hinweg ist das Stadtbild das sichtbare Resultat der Absichten und Aktivitäten der Benutzer und Bewohner und verweist in der Unterschiedlichkeit der vielen Städte auf ihren individuellen und einmaligen Charakter, den es zu bewahren und zu bestärken gilt.
Dieser Stadtcharakter ist eine Summe von Eigenschaften und Qualitäten, die eine Stadt ihren Benutzern bietet. Neben den materiellen Lebensbedingungen Arbeiten, Essen und Schlafen soll die Stadt zur Verwirklichung der immateriellen Lebensvoraussetzung wie Orientierung, Anregung, Abwechslung, Ruhe, Selbstverwirklichung und Kontakt beitragen. Aus diesen Zielen resultiert die Aufgabe der Stadtgestaltung mit den Zielbereichen Stadtcharakter, Stadtqualität und Stadtfunktion.
Stadterneuerung bedeutet aber auch immer Eingriff in die Stadtgestalt.
Stadterneuernde Stadtplanung weiß um die Folgen der kleinen und großen Eingriffe in den Stadtorganismus. Neues in einer Stadt sticht ins Auge, Bekanntes wird erneut registriert.
Erinnerungen und Erfahrungen lenken gleichsam den Blick.
Straße und Plätze verhelfen zur Orientierung, prägen den Charakter der Stadt, führen zum Stadtbild.
Im Stadtbild wird die materielle Stadt sichtbar. Der Städtebauer versteht unter Stadtarchitektur in analytischer Sicht die Komponenten der Stadtbausteine wie
- natürliche Situation, z.B. Topografie, Klimaeinflüsse
- Stadtshilhouette, wie Fernwirkung und Umriß der Stadt
- Stadtgrundriß
- Stadtraum wie Formen des öffentlichen Raumes
- Gebäude, wie Grundeinheiten der Stadtraumbildung, gegliedert in Bauteile wie Dach, Fassade, Material, Konstruktion und Farbe und
- Freiraumausstattung wie natürliche, künstlerische und technische Objekte im Stadtraum z.B. Denkmäler.
Systematisches Sehen löst Stadtbausteine aus ihrer örtlichen Gebundenheit und verhilft zur Identifizierung des Stadtbewohners aber auch zur Identität der Stadt. Der Stadtplaner muß bei der Stadterneuerung die architektonischen Mittel erfassen, aus denen sich das Stadtbild zusammensetzt. Dabei sind drei Gestaltungsprinzipien, wie Brendle[30] postuliert, zu beachten und zu unterscheiden, welche die formalen Bezüge innerhalb und zwischen unterschiedlichen Bausteinen regulieren, und zwar
- Synthese aus Einheit und Vielfalt
- Synthese aus Kontinuität und Veränderung und
- Synthese aus Typus und Metamorphose
Wird der Begriff "Stadt" verwendet, so bedarf es der Hinterlegung von Bedeutung der Bezeichnung Stadt. Bezeichnungen benennen einen Gegenstand; Begriffe sind Theorien. Zur Begrifflichmachung der Bezeichnung Stadt bedarf es einer Theorie der Stadt. Theorie sei die Fähigkeit in der Fülle der Erscheinungen Muster zu erkennen. Wer über solche Muster verfügt, der findet sich zurecht. Diese Muster sind nicht Eigenschaften der beobachteten Umwelt, sondern beruhen auf Bedürfnissen und Absichten der Beobachter (Deutsch, K.).
Mackensen reflektiert in seinem Beitrag "Die Stadt in der postindustriellen Gesellschaft"[31] über den Begriff Stadt aus soziologischer Sicht und sucht dabei Antworten, sowohl bei den Klassikern der Soziologie, als auch bei den Systemtheoretikern. Für Mackensen ist die Stadt Lokus der Kultur, zumindest unserer Kultur.[32] "Kultur" (Gesellschaft) und "Muster" (Strukturen) haben weitgehende definitorische Gemeinsamkeiten. Daraus folgt: Ohne Struktur keine Kultur, ohne Kultur aber auch keine Struktur - eo ipso keine Stadt. Die Skizzierung einer Stadttheorie durch Mackensen führt zur Aussage, daß die Aufgaben der Stadtplanung in erster Linie mit der "Allokation von Nutzungen zu tun haben."[33]
Aus der Güteraustauschtheorie leitete J.L. Berry (1974) ab, daß "die Stadt ein System in einem System von Städten sei". Aus dem reinen Handlungssystem der Wirtschaft läßt sich aber kein Theorieansatz erarbeiten. Zum Verständnis der gegenwärtigen Stadt müssen die Dimensionen Politik, Sozialstruktur und Kultur als Handlungssystem in ihrer Interaktion zur Region beachtet werden. Aus dem umfangreichen Theorieansatz von Mackensen soll dessen Kulturaspekt vom Städtebau herangezogen werden, weil er zur Aufhellung der Problemstellung Stadterneuerung und Substanzerhaltung im historischen Kontext dient. Die Stadt wird stets nur zu einem gewissen Anteil von aktuellen Bedingungen und Veränderungstendenzen geprägt. Das gilt ebenso für die immaterielle wie für die materielle Kultur. Als gebaute Stadt besteht sie aus einander überlagernden Schichten, die unter unterschiedlichen Bedingungen zu verschiedenen Zeiten entstanden sind.[34] Die für die Gegenwart umrissenen Bedingungen gelten danach also nur für die jüngste Schicht der Stadtentwicklung und für die Planung in der Gegenwart. Planungen der Gegenwart müssen aber auf frühere Schichten Rücksicht nehmen. In den letzten Jahren hat das Verständnis für die Erhaltung historischer Bausubstanz zugenommen, wie später noch im einzelnen erläutert wird. Der Wert, der ihr zugemessen wird, ist gegen den Wert abzuwiegen, der den Erneuerungen zugesprochen werden kann. Die Entscheidung hierfür ist eine politische und beruht auf dem gewandelten Verhältnis zur Geschichte, das auch das Lebensgefühl der Menschen in der Stadt verändert hat. "Der Wert wird letztlich durch die Bereitschaft bestimmt, die Erhaltung und Nutzung älterer Gebäude aus öffentlichen oder privaten Mitteln zu finanzieren."[35] Der Wert vorhandener Bausubstanz kann nicht aufgrund theoretischer Überlegungen festgestellt werden. Die Wertentscheidung ist ein politisches Urteil. Dies gilt auch für die Entscheidung über Bau- und Planungsalternativen. Was als das beste und zukunftsträchtigste bei der Stadtgestaltung in den Augen der Einwohner und / oder der Planer betrachtet wird, leitet sich von funktionalen wie ästhetischen Dimensionen ab. "Eine sozial akzeptierbare Ästhetik setzt allgemeine Wahrnehmungs- und Interpretationsregeln voraus; auch die gebaute Umwelt hat ihre Sprache, die einer eigenständigen Semiotik entspricht."[36]
Diese Sprache darf aber nicht allein auf kulturelle Eliten abheben, sondern muß auch die Lebenswelt der Mehrheit berücksichtigen. Es bedarf bei der Entscheidung deshalb der Beteiligung der Einwohner an den Entscheidungen über Bau- und Planungsalternativen. Aber auch das Urteil der Einwohner ist nicht einheitlich. Unter ihnen gilt ebenso wie für die Bausubstanz das Theorem der Überlagerung historischer Schichten. Wertvorstellungen sind vielleicht noch langlebiger als Gebäude.
Der Wertewandel erfaßt nur einen Teil der Bevölkerung und einen Teil ihrer Vorstellungen[37]. Darunter liegen ältere Schichten, sie haben gleiche Berechtigungen. Dies darf bei der Einschätzung der kulturellen Lage nicht übersehen werden.
3. Stadterneuerung und gesellschaftlicher Modernisierungsprozeß
Nach Ipsen[38] ist Stadterneuerung nichts anderes als "die Anpassung der baulichen, physischen Struktur einer Stadt an die jeweilige Hegemonialstruktur, also die Anpassung an das herrschende Muster der ökonomischen Nutzung, der Vergesellschaftungsform, der herrschenden Technik und kulturellen Muster".
Deshalb treten Stadterneuerungen oftmals in historisch völlig unterschiedlicher Situation auf. Ipsen fragt deshalb, ob es für bestimmte Perioden spezifische Muster der Stadterneuerung und besonders in den letzten Jahrzehnten eine typische gesellschaftliche Konstellation der Stadterneuerung gibt. Ipsen behauptet, daß den Fordismus, eine tayloristische Arbeitsorganisation, Masseneinkommen und Massenkonsum zu einer Sicherung von Arbeitsrechten und eine Vielzahl von staatlichen Regulierungsversuchen kennzeichnen. Dem entspricht in der Stadterneuerung das Prinzip der Zonierung, das Prinzip des‑Ordnung‑schaffen.[39] Dieses Prinzip ist typisch für die bundesrepublikanische SPD-Zeit. Kennzeichen hierfür ist die Schaffung von Raumsegmenten für den Verkehr, den Konsum, die Verwaltung und das Wohnen, jeweils in getrennter Form. Daraus resultiert die Flächensanierung als eine geeignete Methode, um die neue Ordnung herzustellen. Nach dem Ende der SPD-Zeit mit Beginn der 80er Jahre wechselt der "Sinn" der Sanierung. Die fordistische Vergesellschaftung ist weitgehend abgeschlossen. W. Wallmann (CDU) formulierte in seiner Funktion als Frankfurter Oberbürgermeister " Die Städte treten in eine verschärfte Konkurrenz mit anderen Städten. Sie konkurrieren um ihre Position in einer sich abzeichnenden Ökonomie der Medien und der Datenverarbeitung."
Mit der materiellen und symbolischen Aufwertung von Teilen einer Stadt, die in Konkurrenz zu anderen Städten treten, zeichnet sich der Beginn der postfordistischen Stadterneuerung ab.[40] In einem in der NS-Zeit publizierten Beitrag[41] wird auf die konsequente fordistische Stadterneuerungspolitik mit dem Ziel der Volksgesundheit, volksschädigendes nicht länger schwächlich zu dulden und das Erkennen volksschädigender Elemente im städtischen Raum, hingewiesen.
In diesem Werk zeigt sich das Motiv der Raumkontrolle, welches nach Ipsen nach dem Ende der NS-Herrschaft in der Sanierungspraxis weiter lebt. "Bei der Sanierungstechnik hat die Entkernung von Hinterhöfen, . auch das Ziel, den Raum überschaubarer und kontrollierbarer zu machen."[42] Lutz (1984)[43] weist darauf hin, daß die Modernisierung der letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik Deutschland einer "inneren Landnahme" ähnelt und damit der Markterschließung dienen kann. Zur Funktion der Stadterneuerung als Instrument der Markterschließung zählt auch, daß Lebenswelten, die sich den Begriffen Ökonomie und Staat entziehen, als rückständig wahrgenommen werden.
Mit dem fordistischen Produktions- und Konstruktionsprinzip verwandt ist das Prinzip der Raumorganisation, d.h. das Prinzip der Zonierung einer Stadt.
Das Städtebauförderungsgesetz stellt die Zonierung als die erstrangige Aufgabe des Sanierung fest und begründet diese Aufgabe mit der geringeren Produktivität und gehemmten Entfaltungsmöglichkeit, die durch die städtebauliche Mischung entstehen. Als das zentrale Institut der Stadtsanierung wurde die Bodenwertabschöpfung in der Konzeption des Städtebauförderungsgesetzes gesehen.
Jätzold[44] schlägt aus der Sicht des Klimaforschers die Abgrenzung von Kulturräumen nach objektivierbaren Kriterien der Struktur und Funktion vor und klassifiziert nach wertvollen und weniger wertvollen Kulturräumen. Grundlage für die Hierarchisierung der Kulturräume in einer Stadt ist für Jätzold das "historische Erbe".
Jätzold stützt sich dabei auf Vorbilder aus Italien und erinnert an die von Lichtenberger erarbeitete, geographisch begründete Zonierung nach Raumdifferenzierung bzw. Stadtdifferenzierung.
Jede europäische Stadt sollte danach ihr urbanes Kernstück abgrenzen. Diesem Kernstück als wertvollstem Kulturraum gebührt die höchste Priorität der Erhaltungsmaßnahmen und wird als Stadtschutzzone Nr. 1 bezeichnet. An erster Stelle stehen in dieser Zone die Restauration und sogar die Rekonstruktion von Denkmälern und unter Ensembleschutz stehenden Gebäuden bzw. Baudenkmälern. Der Schutzzone Nr. 1 werden sechs Funktionen zugeordnet und zwar:
"Sie muß erstens herausragendes historisches Zeugnis sein, also die Funktion der Bewahrung unseres Kulturerbes erfüllen."
"Historische Zeugnisse dürfen zweitens nicht leer sein, sondern müssen die Funktion des gehobenen Dienstleistungsangebots erfüllen." Jätzold nennt Bauten mit dieser Funktion "Urbanotope."
Als dritte Funktion soll diese Zone innerstädtisches Wohnen höchster Stufe erreichen.
Der Zone 1 wird als vierte Funktion Raum für Kultur und Kultstätten, wie Kirchen, Museen oder andere vergleichbare Einrichtungen zugemessen.
Als fünfte Funktion hat die Zone 1 die Aufgabe, Raum für Unterhaltung, Entspannung und Begegnung zu bieten. D.h. der Freizeitwert der Innenstadt muß demnach erhöht werden. Und als sechste Funktion soll die Schutzzone Nr. 1 den Freizeitwert des Innenstadtbereiches so weit anheben, daß die Fremdenverkehrsfunktion erhöht wird.
In der Zone II kommt es nicht mehr auf die historische Rekonstruktion sondern nur noch auf die Erhaltung der Gesamtwirkung an. Hier ist also noch "Ensembleschutz" notwendig.
In der Zone III ist allgemein weniger wertvolle Bausubstanz mit einigen wertvollen Objekten durchsetzt. Es muß deshalb nur noch Objektschutz erfolgen.
In der Zone IV scheint die Bewahrung historischer Substanz normalerweise nicht notwendig zu sein. Hier sollten sogar moderne Komplexe erstellt werden, denn jede Zeit hat ihre eigenen Ausdrucksformen. Diese sollen aber sich dem Gesamtcharakter der Stadt verpflichtet fühlen.
In der Zone V schließlich, die oft auch Übergangszone zu den ländlichen Siedlungsgebieten ist, sollte man "sich bezüglich der Baugestaltung nach dem Charakter des Landes verantwortlich fühlen".
Jätzold mahnt, die vom 2. Weltkrieg verschonte historische Bausubstanz nicht durch sogenannte Modernisierungsmaßnahmen weiter zu zerstören, sondern durch die Zonierung von Stadtschutzzonen, besonders die Innenstadt, wieder mit lebendigen Funktionen zu erfüllen helfen. Im Gegensatz zu der Stadterneuerung in den 70er Jahren zeichnet sich in der 80er Jahren ein grundsätzlich anderes Stadterneuerungsprinzip ab. Nach der Phase der Suburbanisierung als Folge der fordistischen Sanierung zeichnen sich für Ipsen zwei Kräfte für die Erneuerungslogik ab und zwar die interurbane Konkurrenz und das Kräftesystem von Ex- und Reurbanisierung.
Nicht nur Regionen, sondern Städte stehen als Standortfaktor im Wettbewerb. Mit einer Politik der "Reurbanisierung" reagiert die Verwaltung auf die Abwanderung aus Agglomerationsräumen."[45] Postmoderne, d.h. postfordistische Stadterneuerung ist demnach erheblich außenorientiert.
Das Ziel dieser Politik ist es, das Raumbild einer Stadt in Bezug auf eine Städtehierarchie neu zu prägen. Die baulichen Maßnahmen sind in starkem Maße semiotisch d.h. sie konzentrieren sich auf Zeichen. Ipsen erläutert weiter, daß postfordistische Stadterneuerung eher punktuell ist und sich dadurch erheblich von der fordistisch orientierten Stadterneuerung unterscheidet. Mit der Außenorientierung der neuen Stadterneuerungskonzeptionen werden aber auch Räume und Nischen geschaffen, in denen sich der "Widerstand gegen die Modernisierungspolitik als Stadtgestaltungskonzept organisieren kann". Kulturelle Initiativen oder Bürgerinitiativen zur Abwehr kommunaler Stadterneuerungsmaßnahmen zeigen, daß sich Menschen der Durchdringung ihrer Lebenswelt durch Ökonomie und staatliche Regulierung erwehren können. "Sie kann so gut sein, daß die postmoderne politisch ökonomisch neokonservative Stadterneuerung ungewollt einer Wiedergewinnung emanzipatorischer Urbanität dienlicher ist, als die eher sozialdemokratisch geprägte Modernisierungspolitik, die flächendeckend auf die Reformierung des Alltags zielte und vielfach gewachsene urbane Strukturen zerstörte."[46]
4. Die politische Komponente der Stadterneuerung
Stadterneuernde und stadtplanerische Maßnahmen lasten nicht allein auf den Schultern von Stadtplanern, sondern werden von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen begleitet, deren Ergebnisse und daraus resultierende Theorien zur Aufhellung und zur Erkennung des Musters der Stadterneuerung dienen. Hamm (1991)[47] erinnert in seiner Stadterneuerungstheorie daran, daß städtebaulicher Erneuerungsbedarf ein normaler Vorgang ist, den es in der Geschichte von Städten immer gegeben habe. Gebäude werden älter und müssen renoviert, im Extremfall abgerissen und neu gebaut werden, Ausstattungen genügen aktuellen Standards nicht mehr. "Das Problem liegt weniger dort als in der Frage, auf welche Weise, in wessen Interesse solcher Erneuerungsbedarf ´künstlich´, also absichtsvoll beschleunigt wird, wozu die Erneuerung dienen soll und wem die sozialen Kosten dafür aufgebürdet werden sollen."[48] Hamm postuliert, daß Erneuerungsbedarf unter kapitalistischen Bedingungen dann entsteht, wenn die Grundrentenerwartungen auf dem Grundstück erheblich über der tatsächlich realisierten Grundrente liegen. Dies kann z.B. wegen Veränderungen der Verkehrserschließung oder wegen einer Politik der Fall sein, die wohlhabenden Haushalte ins Stadtzentrum zurückzubringen. Aus der Segregationstheorie ist uns bekannt, welche Bevölkerungsgruppen in den untergenutzten Gebieten leben und damit auch wer die Betroffenen im Falle einer Sanierung sein werden, die Armen und Unterprivilegierten. Hamm weist weiter darauf hin, daß für den Eigentümer Grundstücke nicht ihres Gebrauchswertes, sondern ihres Tauschwertes wegen profitträchtig und daher interessant sind. Und "dies um so mehr, je mehr innerstädtische Immobilien ins Eigentum juristischer Personen übergehen und damit dem ausschließlichen Profitdiktat überantwortet werden". Wenn Umnutzung, Abbruch und Neubau Gewinn versprechen, wird die Sanierungsanfälligkeit beschleunigt.
In dem zweiten Teil seiner Stadterneuerungstheorie weist Hamm auf Selbstverständlichkeiten der Sozialwissenschaften hin, nämlich auf die Theorie des Problemlösens und die damit verbundenen Methoden, die wissenschaftlich gut entwickelt sind. Sozialwissenschaftler erarbeiten Prognosen und formulieren Ziele, z.B. für ein städtisches Teilgebiet, definieren Probleme, wenn es erhebliche Differenzen zwischen Prognosen und formulierten Zielen gibt und leiten daraus den Handlungsbedarf ab. Aus einer Kosten- und Nutzenabschätzung wird ein Programm zur Realisierung und Implementierung ausgewählt und nach dem Abschluß über die Erfolgskontrolle festgestellt, ob die beabsichtigte Wirkung erzielt werden konnte (Theorie des rationalen Handelns). Aber der öffentliche oder öffentlich beauftragte Akteur, z.B. die Bauverwaltung und der Sanierungsträger, können sich nicht ausschließlich am Profitmaximierungsprinzip orientieren und rational planen.
Es gibt noch
"Sozialbindung des Eigentums, das öffentliche Interesse, die soziale Gerechtigkeit, Bürgerinitiativen"
und die sich abzeichnende Situation politischer Mehrheiten, Macht, Beschäftigung, gegebenenfalls Einkommen zu verlieren. Max Weber lehrt uns, daß die Stadt ihre eigene, weitgehend selbständige, politische Verfassung hatte. Dies ist heute längst nicht mehr der Fall. Die Stadt ist in das vertikale Muster integriert. Ihr tatsächlicher Handlungsspielraum ist sehr gering. "Eine eigene Wirtschaftspolitik ist ihr kaum möglich, wenn man um die Einwerbung von gewerbesteuerträchtigen Betrieben absieht."[49] Aber über Stadtplanungsmaßnahmen und Satzungen besitzt die Gemeinde großen Einfluß auf die internen Lebensbedingungen einer Stadt. Man kann diesen Einfluß unter dem Gesichtspunkt des Konfliktes zwischen verschiedenen Machteliten und der wechselnden Parteienstärke begreifen, wie es uns die Community Power Forschung bewiesen hat. Aus den Ergebnissen dieser Forschung lassen sich aber kaum Folgerungen für die Stadtgestaltung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung ableiten. Bökemann (1982)[50] dagegen entwickelt einen Ansatz, der nicht von dem Begriff Stadt oder Gemeinde ausgeht, sondern den Begriff Standort zugrunde legt und danach Standorte "als Ergebnis des politischen Handelns der Gemeinden begreift." Standorte bestimmen den Wert eines Grundstücks, abgesehen von dessen Fläche, Beschaffenheit und Lage durch Investitionen und vor allem durch die Bereitstellung von Infrastruktur. Der Wert[51] eines Grundstückes wird darüber hinaus durch die Festlegung der "Bodenordnung" d.h.
[...]
[1] Vergangenheit hat Zukunft. 20 Jahre Denkmalpflege in Bayerisch Schwaben. Herausgegeben vom Bezirk Schwaben 1994 (vgl. auch Denkmalpflege in Schwaben - Kulturelles Erbe und Lebensraum. Herausgegeben vom Bezirk Schwaben 1989.
[2] Exemplarisch sei aus der Fülle der täglich erscheinenden Berichte ein Beitrag zitiert: 300 Jahre alte Scheune wird Wohnhaus, Allgemeine Bauzeitung, 30. Juni 1995, S 3.
[3] Industriedenkmalen droht Verfall, in: AZ vom 10.10.1994, S. 10, von Angela Bachmair
[4] Förderkreis für Erhalt der Kienlesbergkaserne, in: NUZ Nr. 63 vom 15.3.1996, S. 21
[5] 600 Jahre altes Haus steht vor dem Abriß, in: AZ vom 20.1.1995
[6] Sinkt ein Flaggschiff der Industriekultur, in: AZ Nr. 113, 17.5.1996
[7] Kurhaus als wichtiges Signal der Kulturpolitik, in: AZ vom 3.2.96, S. 4
[8] Schätze auf dem Land zu finden. Zum zweiten Mal ein Tag des offenen Denkmals, in: AZ Nr. 208 vom 9.9.94, S. 4
[9] Im Rahmen eigener Sendungen oder der deutschen Stiftung Denkmalschutz gewidmeten Sendungen im ZDF sammelt die Stiftung Geld zur Unterstützung denkmalpflegerischer Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an identitätsstiftenden Bauwerken wie Burgen, Schlössern, Klöstern und herausragenden Einzeldenkmälern, wobei der Schwerpunkt der Förderung in den neuen Bundesländern liegt
[10] Häberle, Peter: Kulturpolitik in der Stadt ein verfassungspolitischer Auftrag, Heidelberg, Hamburg, Karlsruhe 1979, S. 3
[11] Lübbe, Hermann: "Denkmalschutz oder die Paradoxa des Versuchs Altes neu zu machen", in: ders. Im Zug der Zeit - Verkürzter Aufenthalt in der Gegenwart Berlin, Heidelberg, New York 1992, S. 55-74
[12] Es seien nur einige Forschungsarbeiten mit verwaltungsrechtlicher Zielsetzung genannt: Zoller, R.: Der verwaltungsrechtliche Schutz der Kulturdenkmale im sozialen Rechtsstaat unter besonderer Berücksichtigung Bayerns; Jur. Diss. Würzburg 1965; Leidinger, Tobias: Ensembleschutz durch Denkmalbereichssatzungen der Kommunen: Darstellung, Analyse und Bewertung eines Instruments des Denkmalschutzrechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Westfalen, Dissertation an der Juristischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Berlin, 1993; Zur Stadtgestaltung sei exemplarisch auf die Arbeiten von Karliczek, R.H.: Ortsbaustatut und Ortsbauplan als Instrumente der Stadtgestaltung Dr.-Ing.-Dissertation Universität Stuttgart, 1979 hingewiesen. Soweit die Literatur für die vorliegende Arbeit relevant ist, wird sie in den Folgefußnoten zitiert bzw. in der Literaturzusammenstellung aufgeführt
[13] DSI 2/94 18. Jahrgang, S. 38,39
[14] Schwächung des Denkmalschutzes, in: Allgemeine Bauzeitung vom 11.2.94, S. 5
[15] Bayerische Kirchenmaler müssen um ihre Arbeit bangen, in: AZ 31.1996, S. 5
[16] auf die Veröffentlichungen und Aktivitäten des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz wird in dieser Arbeit häufiger eingegangen und relevante Veröffentlichungen und Aussagen des deutschen Nationalkommitees zitiert
[17] Informationsdienste städtebaulicher Denkmalschutz, hrsg. v. Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung e.V., Bonn, exemplarisch: Dokumentation "Städtebaulicher Denkmalschutz" Dokumentation 2. Kongreß Städtebaulicher Denkmalschutz in den neuen Ländern am 31.8. und 1.9.1992 in Quedlinburg, Infodienste 5/6, Bonn, Oktober 1992
[18] Lampugnani, V.M.: Für ein Projekt der Erinnerung, Festvortrag zur Verleihung des Preises der Hypo-Kulturstiftung am 23.6.96, in: Arx 2/96, S. 30
[19] Humpert, K. et al: Die Stadt, ein universelles Phänomen, in: Einführung Städtebau, Arbeitsmaterialien, hrsg. vom Städtebaulichen Institut der Universität Stuttgart 1990, S. 4
[20] Mörsch, G.: Denkmalpflege und Stadtentwicklung, in: DISP 80/81 Stadtentwicklung. hrsg. vom Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung ETH Zürich, Juli 1985
[21] ebd., S. 24
[22] ebd., S. 26
[23] Böhme H.: Stadtutopien und Stadtwirklichkeit in ihrer historischen Dimension, Vortragsmanuskript, Internationale Städtetagung, Krems; hrsg. Arbeitsgemeinschaft "Die alte Stadt" e.V., 1995
vgl. Rabeleler, G.: Wiederaufbau und Expansion westdeutscher Städte 1945-1960 im Spannungsfeld von Reformideen und Wirklichkeit, Dissertation Bonn 1990,
vgl. auch Reul, H.: Denkmalschutz und Denkmalpflege mehr als Kulturpolitik, Stuttgart 1993, S. 73f.
[24] Volcelka, K.: Vom himmlischen Jerusalem bis Brasilia, Int. Städtetagung, Krems 1995, Vortragsmanuskript S. 7
[25] Gebessler, A.: Freudenstadt Geschick und Geschichtlichkeit einer Idealstadt, Krems 1995, Vortragsmanuskript, S. 9
[26] Albers, G.: Stadterneuerung und Substanzerhaltung in Dörfern als Planungsaufgabe, 9. Fachtagung ländlicher Raum- und Denkmalschutz, 1987, München, Institut für Städtebau und Wohnungswesen der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, 21.09.87, München, Vortragsmanuskript, S. 2
[27] Petzet, M.: Das Denkmal als Altlast? Auf dem Weg in die Raparaturgesellschaft. In Tagungsheft des Deutschen Nationalkomitees, ICOMOS, Heft 21, München, 1996 S. 18 u. 19
[28] Humpert, K.: Die Stadt, ein universelles Phänomen, Stuttgart 1990, S. 12
[29] Hieber, U.: Städtebauliche Erneuerung, in: Einführung Städtebau, Stuttgart 1990, S. 181
[30] Brendle, K.: Stadtgestaltung, in: Einführung Städtebau, Stuttgart 1990, S. 165
[31] Mackensen, R.: Die Stadt in der postindustriellen Gesellschaft, in: Stadterneuerung, hrsg. von Deutsche UNESCO Kommission, Bonn, 1991, S. 33-63
[32] ebd., S. 35
[33] ebd., S. 36
[34] ebd., S. 57
[35] ebd., S. 57
[36] ebd., S. 57
[37] Klein, Markus: Wieviel Platz bleibt im Prokrustesbett? Wertewandel in der BRD zwischen 1973 - 1992. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 47, Heft 2, 1995, S. 207-230
[38] Ipsen, D.: Stadterneuerung als gesellschaftlicher Modernisierungsprozeß, in: Stadterneuerung - Probleme, Perspektiven, Ziele, hrsg. von W. Strubelt und B. Jalowitzki, Deutsche UNESCO, Bonn 1991
[39] Brohm, W.: Der Schutz erhaltenswerter Bausubstanz, in: DVBl 1985, S. 594
[40] Harvey, D.: Postmodernismus in amerikanischen Städten, Prokla 6 1987 und Häußermann, H. Siebel, W. Die neue Urbanität, Frankfurt 1988 (vgl. Literaturverz. in: Ipsen D. 1991)
[41] Walther, A.: Neue Wege zur Großstadtsanierung, Stuttgart, 1936
[42] ebd., S. 106
[43] Lutz, W.: Der kurze Traum immerwährender Prosperität, Frankfurt 1984
[44] Jätzold, R.: Die Erhaltung der europäischen Stadt als Kulturraum, in: Trierer Beiträge, hrsg. von der Uni Trier, 1983, Heft 12, S. 71-80
[45] Ipsen, D.: Stadterneuerung, 1991, S. 109
[46] ebd., S. 110
[47] Hamm, B.: Sozialwissenschaft - Praxis - Betroffene in Stadterneuerung, in: Stadterneuerung, Bonn 1991, S. 69
[48] ebd., S. 69
[49] Mackensen, R.: Die Stadt in der postindustriellen Gesellschaft, in: Stadterneuerung, Bonn 1991, S. 50
[50] Bökemann, D.: Theorie der Raumplanung - Regionalwissenschaftliche Grundlagen der Regional- und Landesplanung, München Oldenburg, 1982
[51] Man unterscheidet bei Wertermittlungen nach objektivem, subjektivem und Affektionswert. Der Verkehrswert ergibt sich aus dem Sachwert, dem Ertragswert und Vergleichswert; Werther und Astl: Beurteilung und Bewertung von Baudenkmälern; Seminar an der IHK für München und Oberbayern am 18.10.96
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1998
- ISBN (eBook)
- 9783832495503
- ISBN (Paperback)
- 9783838695501
- Dateigröße
- 5.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Augsburg – Philosophische Fakultät I, Politische Wissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- stadtplanung stadterneuerung denkmalpflege kulturpolitik bundesfestung
- Produktsicherheit
- Diplom.de