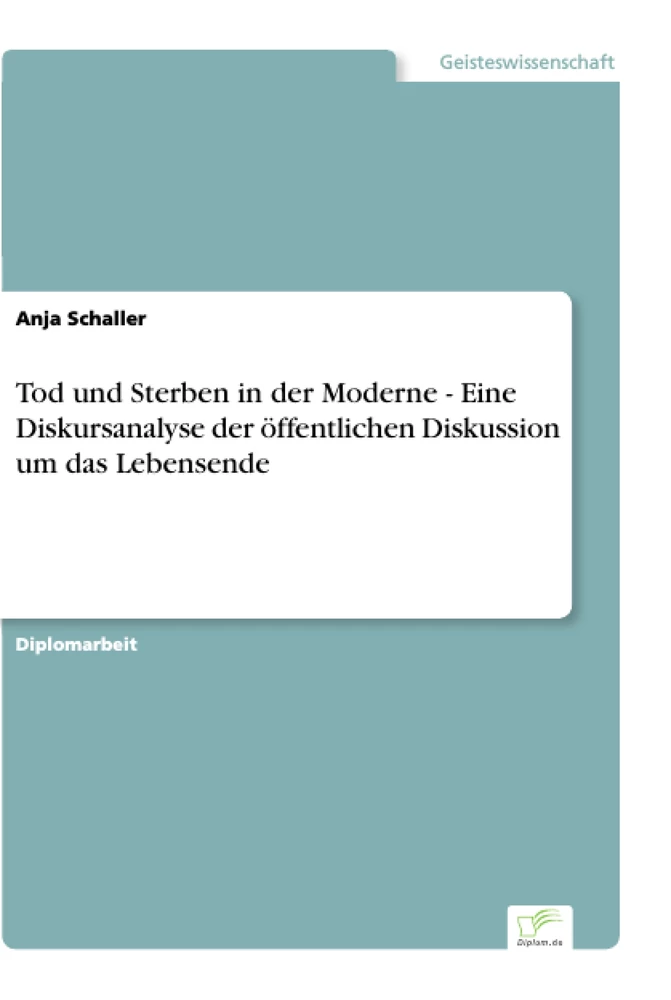Tod und Sterben in der Moderne - Eine Diskursanalyse der öffentlichen Diskussion um das Lebensende
Zusammenfassung
Die neueren Entwicklungen in der Medizin führen zu einer Medikalisierung des Sterbens. Das Bild des Todes in der modernen Gesellschaft hat im Gegensatz zum Todesbild der Vormoderne einen grundlegenden Wandel erfahren. Fürchtete man früher den plötzlichen, den unerwartbaren Tod, ist es heute eher ein künstlich verlängertes und langsames Sterben, das Angst auslöst.
Häufig hört man die Aussage, ein schöner Tod wäre der, einfach einzuschlafen. Aber lässt die moderne Medizin dies überhaupt zu? Welche Wege und Mittel hat der Einzelne, seinen Tod zu gestalten wie er es für richtig findet und welche Chancen aber auch Risiken bergen institutionalisierte Formen des Umgangs mit dem Tod wie etwa Patientenverfügungen? Können Patientenverfügungen halten, was sie versprechen? Geben sie Sicherheiten in einem Thema voller Unsicherheiten?
Und weiter, gibt es gute Gründe für eine aktive Entscheidung für den Tod? Darf man in einer modernen Gesellschaft einem Patienten das Recht zusprechen, sich auch gegen ein Weiterleben zu entscheiden? Kann man verantworten, dass andere in Form von passiver oder auch aktiver Sterbehilfe in diese Entscheidung mit eingebunden werden und damit auch Verantwortung tragen? Kann und darf eine solch schwerwiegende Entscheidung einer Person in die Hände gelegt werden, kann diese autonom entscheiden?
Diese und andere Fragen drängen sich bei diesem heiklen Thema auf und um deren Beantwortung wird es unter anderem in dieser Arbeit gehen. Ziel dieser Arbeit wird also sein, die Konstruktion von Sicherheiten im Umgang mit Sterben und Tod in der modernen Gesellschaft zu untersuchen. Es soll dabei vor allem um die Veränderung der Todesbilder und die ethische Frage der Sterbenspraktiken vor dem Hintergrund von Patientenverfügungen und Sterbebegleitung gehen, unter besonderer Beachtung der Herstellung von Sicherheiten.
Tod, Sterben und was damit zu tun hat ist in der heutigen Zeit immer noch ein Tabu-Thema. Zwar wird es mittlerweile durchaus thematisiert und es entstehen immer mehr Einrichtungen, die für den Sterbeprozess ausgelegt sind wie etwa Hospize oder palliativmedizinische Einrichtungen. Aber wie differenziert die Auseinandersetzung mit Sterben in der heutigen Gesellschaft wirklich ist, lässt sich daraus nicht erkennen.
Im Laufe der Arbeit wird zu zeigen sein, wie durch die aktuelle Debatte vor allem von so genannten Experten Sicherheiten in die soziale Wirklichkeit hineinkonstruiert werden, wie aber im […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Diskurs
2.1. Diskurse als Aussagensysteme
2.2. Diskursive Praktiken
2.3. Die Formationsregeln
2.4. Die Wahrheit der Diskurse
2.5. Die Macht der Diskurse
3. Die Diskursanalyse - theoretisch
3.1. Vorgehensweise
3.1.1. Verortung des Diskursstrangs
3.1.2. Materialaufbereitung für die Analyse des Diskursstrangs
3.1.3. Materialaufbereitung für die Feinanalyse
3.1.4. Die Feinanalyse
3.2. Einordnung der Untersuchungsergebnisse
4. Die Diskursanalyse – praktisch
4.1. Zur Beschreibung des Diskurses
4.2. Aufstellung des Datenmaterials
4.3. Diskursive Themen
4.3.1. Selbstbestimmungsrecht
4.3.1.1. Autonomie
4.3.1.2. Patientenwille
4.3.1.3. Werte
4.3.2. Würde
4.3.3. Lebensqualität
4.3.4. Angehörige
4.3.5. Leiden
4.3.6. Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
4.4. Einordnung der Untersuchungsergebnisse
5. Sterben und Tod in der Moderne
5.1. Der Wandel der Todesbilder
5.2. Die Theorie von der Verdrängung des Todes
5.3. Die Konstruktion „moderner“ Todesbilder
5.4. Die gesellschaftliche Konstruktion von Sicherheit
5.4.1. Der Hospizgedanke und die Palliativmedizin
5.4.2. Patientenverfügungen und Sterbehilfe
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
8. Anhang
Summary
Die vorliegende Arbeit untersucht in einer Diskursanalyse, inwiefern Sicherheiten in die Diskussion am Lebensende hineinkonstruiert werden. Zugrunde liegen dabei Artikel aus der Zeitschrift „Ethik in der Medizin“, die nach wirklichkeits- und wahrheitsschaffenden Konstruktionen untersucht werden. Die diskursiven Themen ‚Selbstbestimmungsrecht’, ‚Würde’, ‚Lebensqualität’, ‚Angehörige’, ‚Leiden’ und ‚Verbindlichkeit von Patientenverfügungen’ zeigen in der Analyse, wie den Autoren in der Diskussion gelingen kann, den Todesvorstellungen am Lebensende neue Begründungen und damit neue Sicherheiten zu geben.
"Oft denk' ich an den Tod, den herben,
Und wie am End' ich's ausmach?!
Ganz sanft im Schlafe möcht ich sterben
Und tot sein, wenn ich aufwach!"
Carl Spitzweg
1. Einleitung
Die neueren Entwicklungen in der Medizin führen zu einer Medikalisierung des Sterbens. Das Bild des Todes in der modernen Gesellschaft hat – im Gegensatz zum Todesbild der Vormoderne – einen grundlegenden Wandel erfahren. Fürchtete man früher den plötzlichen, den unerwartbaren Tod, ist es heute eher ein künstlich verlängertes und langsames Sterben, das Angst auslöst. Häufig hört man die Aussage, ein schöner Tod wäre der, einfach einzuschlafen. Aber lässt die moderne Medizin dies überhaupt zu? Welche Wege und Mittel hat der Einzelne, seinen Tod zu gestalten wie er es für richtig findet und welche Chancen aber auch Risiken bergen institutionalisierte Formen des Umgangs mit dem Tod wie etwa Patientenverfügungen? Können Patientenverfügungen halten, was sie versprechen? Geben sie Sicherheiten in einem Thema voller Unsicherheiten? Und weiter, gibt es gute Gründe für eine aktive Entscheidung für den Tod? Darf man in einer modernen Gesellschaft einem Patienten das Recht zusprechen, sich auch gegen ein Weiterleben zu entscheiden? Kann man verantworten, dass andere in Form von passiver oder auch aktiver Sterbehilfe in diese Entscheidung mit eingebunden werden und damit auch Verantwortung tragen? Kann und darf eine solch schwerwiegende Entscheidung einer Person in die Hände gelegt werden, kann diese autonom entscheiden? Diese und andere Fragen drängen sich bei diesem heiklen Thema auf und um deren Beantwortung wird es unter anderem in dieser Arbeit gehen. Ziel dieser Arbeit wird also sein, die Konstruktion von Sicherheiten im Umgang mit Sterben und Tod in der modernen Gesellschaft zu untersuchen. Es soll dabei vor allem um die Veränderung der Todesbilder und die ethische Frage der Sterbenspraktiken vor dem Hintergrund von Patientenverfügungen und Sterbebegleitung gehen, unter besonderer Beachtung der Herstellung von Sicherheiten.
Tod, Sterben und was damit zu tun hat ist in der heutigen Zeit immer noch ein Tabu-Thema. Zwar wird es mittlerweile durchaus thematisiert und es entstehen immer mehr Einrichtungen, die für den Sterbeprozess ausgelegt sind wie etwa Hospize oder palliativmedizinische Einrichtungen. Aber wie differenziert die Auseinandersetzung mit Sterben in der heutigen Gesellschaft wirklich ist, lässt sich daraus nicht erkennen.
Im Laufe der Arbeit wird zu zeigen sein, wie durch die aktuelle Debatte vor allem von so genannten Experten Sicherheiten in die soziale Wirklichkeit hineinkonstruiert werden, wie aber im gleichen Atemzug auch Unsicherheiten entstehen und wie die konstruierten Sinnzusammenhänge ihre Wirkung finden.
Um diese Problemstellung auch und vor allem methodisch erschließen zu können, bietet sich eine Diskursanalyse der aktuellen öffentlichen (Experten-) Diskussion an. Dazu werden erst die begrifflichen Grundlagen einer kritischen Diskursanalyse anknüpfend an die Diskurstheorie von Michel Foucault gelegt, um dann das methodische Vorgehen theoretisch zu spezifizieren. Die Analyse des Datenmaterials wird den nächsten großen thematischen Abschnitt dieser Arbeit bilden. Daran anschließend sollen die Ergebnisse mit dem Bild des Sterbens und des Todes in der Moderne in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht werden.
Natürlich kann im Rahmen einer solchen Arbeit nicht alles erschöpfend dargestellt werden, dennoch soll am Ende ein differenzierter Überblick über die Thematik entstehen.
2. Der Diskurs
Bevor ich zur Analyse selbst übergehen werde, ist dazu die Methodik zu erläutern, was im Folgenden geschehen soll. Dieser erste große Teil widmet sich dabei der Entwicklung und den Hintergründen der Diskursforschung in der Soziologie, der begrifflichen Einordnung und dem methodischen Vorgehen. Anschließend werde ich zur Vorstellung des von mir bearbeiteten Datenmaterials und der Analyse selbst übergehen, werde auf die Fragestellung und den zu behandelnden Diskursstrang eingehen. Nach der Feinanalyse an sich werden die Ergebnisse reflektiert und im Gesamtzusammenhang dargestellt.
Zunächst einmal möchte ich den Foucaultschen Diskursbegriff skizzieren. Diesem begrifflich Herr zu werden scheint mir für die weiteren Ausführungen dieser Arbeit wichtig, denn die Methodik der kritischen Diskursanalyse wird sich an Michel Foucaults Diskurstheorie orientieren. Es gibt eine Vielzahl von Interpretationen und Definition des Diskursbegriffes und der Diskursanalyse. Diese überschneiden sich teilweise, schlagen teilweise aber auch verschiedene Richtungen ein und so wird auch in den wissenschaftlichen Disziplinen selbst der Diskursbegriff nicht einheitlich verwendet.
So hat etwa der deutsche Soziologe und Philosoph Jürgen Habermas einen populären Diskursbegriff begründet, der eine Diskursethik anstrebt. Das Diskurskonzept von Habermas zielt darauf ab, dass es formale Merkmale und Strukturen der Sprache gibt und die Teilnehmer eines Diskurses bereits durch die Form und Struktur des Verfahrens gebunden sind. Ihn interessiert dabei vor allem die Intersubjektivität der Teilnehmer gegenüber dem Diskurs. Michel Foucault, französischer Historiker und Philosoph (1926 – 1984) hat eine andere Sichtweise begründet: Für ihn ist die intersubjektive Ebene durch den Diskurs erst konstituiert. Er prägt den Begriff des Diskurses, und auch wenn er dabei selbst keine anwendbare empirische Methode begründet hat, so beruhen doch die wichtigsten und heute am besten weiterentwickelten Überlegungen zur Diskursanalyse als ein methodisches Instrument auf seinen Grundsätzen im Anschluss an den französischen Poststrukturalismus. Der Diskursbegriff dieser Arbeit folgt daher dem Diskursbegriff und der –theorie von Michel Foucault.
Diskurse im sozialwissenschaftlichen Sinn dürfen nicht mit dem Begriff „Diskurs“ verwechselt werden, wie er im alltäglichen Gebrauch häufig aufgegriffen wird. Es handelt sich nicht nur um allgemein diskutierte Themen in Alltagssituationen oder breite öffentliche Diskussionen über bestimmte Themen. Vielmehr handelt es sich bei Diskursen um institutionalisierte Regeln von Aussagenformen.
Den Fragen was Diskurse sind, wie sie sich konstituieren und warum sie funktionieren wie sie funktionieren, ob sie denn überhaupt funktionieren, soll im Folgenden nachgegangen werden.
2.1. Diskurse als Aussagensysteme
In seiner Diskursforschung geht es Foucault vor allem um die Aufdeckung von Regelmäßigkeiten. „Hinsichtlich jener großen Familien von Aussagen, die sich unseren Gewohnheiten auferlegen – und die man als die Medizin oder die Ökonomie oder die Grammatik bezeichnet -, hatte ich mich gefragt, worauf sie ihre Einheit gründen könnten.“ (Foucault 1973: 57; Hervorhebungen im Original) Er geht in seiner „Archäologie des Wissens“ vor allem der Frage nach, wann wir Aussagen in Beziehung zueinander setzen, wie es kommt, dass wir bestimmten Gruppierungen von Aussagen schon von vornherein eine Einheit unterstellen. Dabei versucht und riskiert er zugleich über die gewohnten Einheiten hinwegzusehen, seine Ergebnisse einer anderen Sichtweise zu unterstellen. Diese Sichtweise erfordert eine zeitweilige Abkehr von den üblichen Deutungen von Texten.
Zunächst einmal soll dabei geklärt werden, was Aussagen sind. Sie tauchen nach Foucault als die kleinste Einheit des Diskurses auf. Dabei stehen sie wiederum in bestimmten Beziehungen zu anderen Aussagen. Entdecken kann man sie dort, „wo man einen Akt der Formulierung erkennen und isolieren kann …“ (Foucault 1973: 120). Aber nicht überall dort, wo ein Satz gesagt wird, verbirgt sich auch eine Aussage. Und nicht nur wenn ein Satz als Satz gesagt wurde, sondern Inhalte zum Beispiel als bloße Aufzählung oder Tabellen vermittelt werden, existiert eine Aussage. „Die Sprache existiert nur als Konstruktionssystem für mögliche Aussagen; andererseits existiert sie nur als (mehr oder weniger erschöpfende) Beschreibung, die man aus einer Menge wirklicher Aussagen erhält.“ (Foucault 1973: 124)
Zeichen werden also zu Aussagen, sofern sie in einer Beziehung zu dem was sie aussagen wollen und sollen stehen. Diese Aussagen sind nach Foucault einzigartig in ihrer Anwendung. Auch wenn sie wortgleich wiederholt werden, heißt dies nicht, dass es sich um die gleichen Aussagen handelt. Ort und Zeit determinieren die Aussage. Die Behauptung, dass die Sonne um die Erde kreist etwa, ist nach der Ablösung des geozentrischen Weltbilds hin zum heliozentrischen Weltbild nicht mehr dieselbe. War die Aussage im geozentrischen Weltbild noch aktuell, so hat die Aussage nach Kopernikus einen ganz anderen Stellenwert. Zudem stehen Aussagen in einer bestimmten Beziehung zu einem bestimmten Subjekt als dem Schöpfer dieser Aussage. Dieses Subjekt kann zwar auch neutral sein, zum Beispiel im Fall eines allgemein anerkannten Faktums, welches jeder aussprechen kann, dennoch ist das Subjekt vorhanden und determiniert ebenso die Aussage. Das Subjekt darf dabei nicht als Individuum gesehen werden, denn Diskurse sind für Foucault losgelöst von autonomen Sprechern. Es handelt sich vielmehr um Aussagensysteme, die bestimmten Regeln gehorchen und eben nicht zwangsläufig nur durch einen spezifischen Sprecher konstituiert werden, sondern aufgrund diskursiver Verfahren hervorgebracht, im sozialen Raum anschlussfähig und durch spezifische kulturelle Wissensvorräte gespeist sind.
„Eine Formulierung als Aussage zu beschreiben besteht nicht darin, die Beziehung zwischen dem Autor und dem, was er gesagt hat (oder hat sagen wollen oder, ohne es zu wollen, gesagt hat) zu analysieren; sondern darin, zu bestimmen, welche Position jedes Individuum einnehmen kann und muß, um ihr Subjekt zu sein.“ (Foucault 1973: 139)
Das heißt, nicht die Individuen als Autoren einer Aussage geben der Aussage Sinn. Erst der Anschluss, den die Aussage im sozialen Feld erfahren kann und erst durch die diskursive Praxis bekommen Aussagen eine Bedeutung. Sie agieren in einem Feld von Aussagen, stehen mit diesen und jenen in Verbindung und treten nicht isoliert in einem Raum auf. Erst dann handelt es sich um Aussagen. Um diese unendliche Vielzahl möglichen Anschlusses zu limitieren hält die Gesellschaft Mechanismen bereit. So Foucault: „In einer Gesellschaft wie der unseren kennt man sehr wohl Prozeduren der Ausschließung. Die sichtbarste und vertrauteste ist das Verbot. Man weiß, daß man nicht das Recht hat, alles zu sagen, daß man nicht bei jeder Gelegenheit von allem sprechen kann, daß schließlich nicht jeder beliebige über alles beliebige reden kann.“ (Foucault 1974: 7; Hervorhebungen im Original). In der Gesellschaft sind dabei eben schon Regeln vorgeschrieben. Das heißt durch den Diskurs ist vorstrukturiert, wann es angebracht ist, was und vor allem wie anzusprechen und wer (in welcher Position) dies darf. So beschreibt denn auch Keller: "In 'Die Ordnung des Diskurses' führt Foucault den Gedanken aus, daß Diskurse unmittelbar mit Ermächtigungs- und Ausschlußkriterien verkoppelt sind, die mögliche Sprecher von nicht möglichen Sprechern unterscheiden und damit 'Subjekt-Positionen' konstituieren. Mit seinem Begriff der 'diskursiven Praktiken' wird darauf verwiesen, daß spezifische Denk- oder Deutungsschemata mit spezifischen, sie stützenden Handlungsschemata verknüpft sind.“ (Keller 1997: 314) Nicht jeder darf in jeder Situation seinen Standpunkt kundtun. Bestimmte Professionen haben Anspruch darauf, jedoch sind Diskurse mit eben solchen Ausschluss- und Ermächtigungskriterien wie etwa akademischen Graden unterlegt, worin determiniert ist, wer die Qualifikation hat, möglicher Sprecher in einer Situation zu sein.
Foucault geht davon aus, dass jede Gesellschaft ihre Diskurse kontrolliert und unter bestimmten Regeln produziert, hier durch den Verknappungsprozess durch Legitimierung oder eben Nicht-Legitimierung von möglichen Sprechern. Die Gesellschaften versuchen dabei gleichsam die Gefahren welche Diskurse bergen, zu minimieren. Wie dies genau geschieht soll im Folgenden anhand der diskursiven Praktiken und ihrer Formationsregeln aufgezeigt werden.
2.2. Diskursive Praktiken
Für Foucault verwirklichen Diskurse die Aufgabe, die ‚Ordnung der Dinge’[1] aufrechtzuerhalten und dazu Regelungen bereit zu halten. „Dabei schließt Foucault von beobachtbaren Regelmäßigkeiten in (bspw. wissenschaftlichen) Texten auf eine zugrunde liegende Regelstruktur, einen Code.“ (Keller 2004: 44) Der Diskurs wird als System dargestellt, das durch bestimmte Ordnungen und Strukturen Stabilität erzeugt. Diese Regelungen und Konventionen bestimmen etwa, wer wann, wo und wem gegenüber über welche Themen sprechen darf.[2] Sie halten auch Systeme bereit, wie Themen vermittelt werden. Foucault beschreibt eben solche diskursive Praktiken, welche diese Aufgaben erfüllen und möglich machen, den Diskurs als solches zu strukturieren.
„Foucaults Interesse an solchen Regelsystemen bezieht sich nicht auf die sprachlich-grammatikalischen Muster des Sprachgebrauchs, sondern einerseits auf die semantische Ebene der Bedeutungen bzw. die institutionell eingebetteten, stabilisierten Praktiken der Diskursproduktion.“ (Keller 2004: 45) Foucault bezeichnet diese Praktiken als diskursive Formationen. Diese normieren, in welcher Situation welche spezifischen Aussagen zugelassen sind: Lassen sich bestimmte Regelmäßigkeiten in den Abläufen von Aussagen erkennen, operieren also gewisse Gruppen von Aussagen nach den gleichen Gesetzen kann man nach Foucault von Diskursformationen sprechen.
Letztendlich besteht also ein Set an Regeln, diese schreiben vor, „(…) was in einer diskursiven Praxis in Beziehung gesetzt werden mußte, damit diese sich auf dieses oder jenes Objekt bezieht, damit sie diese oder jene Äußerung zum Zuge bringt, damit sie diesen oder jenen Begriff benutzt, damit sie diese oder jene Strategie organisiert. Ein Formationssystem in seiner besonderen Individualität zu definieren, heißt also, einen Diskurs oder eine Gruppe von Aussagen durch die Regelmäßigkeit einer Praxis zu charakterisieren.“ (Foucault 1973: 108). Foucault nennt diese Regeln, welche die diskursiven Formationen bedingen, Formationsregeln. Wobei wichtig zu unterscheiden ist, dass diese Formationsregeln nicht von außen auf den Diskurs wirken oder ihn beeinflussen. Allein schon der Diskurs determiniert die möglichen Variationen von Aussagen und führt zu einer Verknappung der Möglichkeiten. Interessant ist dabei, warum in einer spezifischen Situation genau das ‚gesagt’ wurde, was auch gesagt wurde. Warum genau diese und nicht eine andere Aussage an dieser Stelle in den Diskurs eingebracht worden ist. Und unter welchen Voraussetzungen derjenige etwas gesagt hat, der etwas gesagt hat. Foucault identifiziert dabei vier Diskurssysteme, die man an ihren Formationsregeln abhängig voneinander analysieren kann. Diese bilden zusammen ein Formationssystem.
2.3. Die Formationsregeln
Die Formation der Gegenstände regelt, wann ein Diskursgegenstand überhaupt in einen Diskurs eintreten kann. Es gibt ganz unterschiedliche und zahlreiche Bedingungen dafür. „Das bedeutet, daß man nicht in irgendeiner Epoche über irgendetwas sprechen kann; es ist nicht einfach Neues zu sagen; es genügt nicht, die Augen zu öffnen, Obacht zu geben, sich bewußt zu werden, damit neue Gegenstände sich sofort erhellen und auf ebener Erde ihr erstes Licht hervorbringen.“ (Foucault 1973: 68)
Es ist interessant für die Diskurstheorie die diskursiven Systeme der Beziehungen, welche die Gegenstände ermöglichen, untereinander und im Zusammenwirken mit den primären und sekundären Systemen der Beziehungen aufzudecken. Die diskursiven Beziehungen sind dabei dem Diskurs zwar nicht immanent, stehen aber auch nicht außerhalb: „Sie befinden sich irgendwie an der Grenze des Diskurses: sie bieten ihm die Gegenstände, über die er reden kann, oder vielmehr (denn dieses Bild des Angebots setzt voraus, daß die Gegenstände auf der einen Seite gebildet werden und der Diskurs auf der anderen) sie bestimmen das Bündel von Beziehungen, die der Diskurs bewirken muß, um von diesen und jenen Gegenständen reden, sie behandeln, sie benennen, sie analysieren, sie klassifizieren, sie erklären zu können.“ (Foucault 1973: 70) In der Formation der Gegenstände ergab sich die Suche nach der Einheit des Diskurses daher nicht in den Gegenständen als solchen, vielmehr verweist Foucault auf die Beziehungen zwischen den Gegenständen, auf deren Entstehung im Diskurs und auf die Charakterisierung durch die diskursive Praxis selbst. Es geht ihm ja auch eben darum aufzudecken, warum diese Gegenstände im Diskurs auftauchen, diese Formationen zu entlarven und nicht um eine Beschreibung der Gegenstände selbst.[3]
Die Formation der Äußerungsmodalitäten beleuchtet das System der Äußerungen von Subjekten im Diskurs. Es geht Foucault dabei darum, wer (aus welchem Status heraus), an welchen Orten, aus welcher Position in dem Gesellschaftsgefüge heraus in den Diskurs eintritt oder ihn schon begeht. Aufzudecken ist dabei, wie und in welcher Form sich der Diskurs äußert. Handelt es sich z.B. um qualitative Beschreibungen, Statistiken oder Forschungsaussagen. Zusammenfassend beschreibt Foucault: „Vorhin haben wir gezeigt, daß es sich weder um die ‚Wörter’ noch um die ‚Sachen’ handelte, wenn man das System der einer diskursiven Formation eigenen Gegenstände definieren wollte. Ebenso muß man jetzt erkennen, daß es weder durch den Rückgriff auf ein transzendentales Subjekt noch durch den Rückgriff auf eine psychologische Subjektivität zu leisten ist, wenn es um die Definition des Systems seiner Äußerungen geht.“ (Foucault 1973: 82)
Die Formation der Begriffe hingegen bezieht sich eben nicht auf eine genaue Analyse jedes einzelnen Begriffes losgelöst von seinem Kontext. „Anstatt die Begriffe in einem virtuellen deduktiven Gebäude anordnen zu wollen, müßte man die Organisation des Feldes der Aussagen beschreiben, in dem sie auftauchen und zirkulieren.“ (Foucault 1973: 83) Es geht ihm hier um die Verbindung von Textelementen, um den begrifflichen Aufbau von Aussagen und Argumenten. Von Interesse sind zudem die rhetorischen Muster, mit denen im Diskurs bestimmte Themenstränge miteinander verkoppelt werden. Weiter zu beachten sind auch die Arten der Beziehungen die zu anderen, bereits bestehenden Aussagen, hergestellt werden. Werden diese benutzt um scheinbare Tatsachen zu verifizieren oder als Mittel um diese als Unwahrheiten zu enttarnen? Dazu stellt der Diskurs Prozeduren der Intervention bereit, d.h. Techniken um bereits bestehende Aussagen auf unterschiedliche Weise zu reformulieren. Foucault nennt dabei Techniken der Neuschreibung, Methoden der Transkription, Übersetzungsweisen, Methoden der Annäherung an Aussagen oder auch deren Abgrenzung, sowie der Transferierung und Systematisierung. (vgl. Foucault 1973: 89), auf die ich – ob ihrer Klarheit – an dieser Stelle nicht weiter eingehen werde.
Auch an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass dabei nicht im diskursiven Interesse steht, die Begriffe als solche zu analysieren, sondern vielmehr wie durch diese Begriffe Beziehungen zwischen verschiedenen Elementen innerhalb des Diskurses hergestellt werden.
Die Formation der Strategien „richtet sich auf die Außenbezüge eines Diskurses: Was sind die Themen und Theorien des Diskurses? Wie beziehen sie sich auf andere Diskurse? Inwieweit geben sie vor, bessere Problemlösungen zu sein als jene? Was ist die Funktion eines Diskurses in nicht-diskursiven Praktiken?“ (Keller 2004: 46)
Foucault selbst beschreibt diese Formationsregel sehr vorsichtig, denn diese scheint ihm die am wenigsten ausgearbeitete und spezifizierte zu sein. So bleiben auch seine Ausführungen undeutlicher als bei den vorangegangenen Analysepunkten. „Eine diskursive Formation wird individualisiert werden, wenn man das Formationssystem der verschiedenen sich darin entfaltenden Strategien definieren kann; in anderen Worten, wenn man zeigen kann, wie sie sich alle (trotz ihrer manchmal extremen Unterschiedlichkeit, trotz ihrer Verstreuung in der Zeit) vom selben Mechanismus von Relationen ableiten.“ (Foucault 1973: 100 f)
Betrachtet man diese vier Diskursformationen, zeichnet sich ein Bild von Foucaults Vorgehen ab. Seine Analyse setzt immer wieder an der Beschreibung von Beziehungen an, die als Normen fungieren. Diesem Regelsystem sind die Aussagen zugeordnet und eine Menge von Aussagen innerhalb eines gleichen Formationssystems stellt den Diskurs als solchen dar. Foucault führt den Begriff des ‚Dispositiv’ ein, mit ihm bezeichnet er „nunmehr das Maßnahmenbündel, das einen Diskurs trägt und in weltliche Konsequenzen umsetzt“ (Keller 2004: 50). So lässt sich das Dispositiv als das Gefüge des Regelwerks verstehen, das den Diskurs immer wieder reproduzierbar, ihn anknüpfbar macht. Es sind die Verbindungen von einzelnen Elementen wie Gesetzen, Institutionen, allgemein „routinisierte bzw. institutionalisierte Verhaltens- und Handlungsmuster“ (Keller 2004: 50), welche im Zusammenwirken mit nicht-diskursiven Elementen[4] betrachtet werden. Diese sind dynamisch, verändern sich innerhalb des Gefüges. Keller formuliert eine Definition von Dispositiven: „Damit sind institutionalisierte infrastrukturelle Momente und Maßnahmenbündel – wie Zuständigkeitsbereiche, formale Vorgehensweisen, Objekte, Technologien, Sanktionsinstanzen, Ausbildungsgänge usw. – bezeichnet, die einerseits zur (Re-) Produktion eines Diskurses beitragen, und durch die andererseits ein Diskurs in der Welt intervenieren, also Machteffekte realisieren kann.“ (Keller 2004: 63)
2.4. Die Wahrheit der Diskurse
Durch Regeln werden also in einer diskursiven Praxis Elemente gebildet. „Die so gebildeten Elemente konstituieren keine Wissenschaft mit einer Struktur definierter Idealität; ihr System von Beziehungen ist gewiß weniger genau; es sind aber auch keine nebeneinander angehäuften, aus Erfahrungen, Überlieferungen der heterogenen Entdeckungen stammenden und nur durch die Identität des sie besitzenden Subjekts verbundene Erkenntnis. Sie sind das, wovon ausgehend kohärente (oder nicht kohärente) Propositionen gebaut, mehr oder weniger genaue Beschreibungen entwickelt, Verifizierungen vollzogen und Theorien entfaltet werden. Sie bilden die Vorform dessen, was als eine Erkenntnis oder eine Illusion, eine anerkannte Wahrheit oder ein denunzierter Irrtum, eine endgültige Erfahrung oder ein überwundenes Hindernis sich enthüllen funktionieren wird.“ (Foucault 1973: 258)
Damit sich ein wissenschaftlicher Diskurs entwickeln kann, müssen also Elemente durch eine diskursive Praxis gebildet werden und diese Menge an Elementen nennt Foucault dann Wissen. Es ist „der durch die verschiedenen Gegenstände, die ein wissenschaftliches Statut erhalten werden oder nicht, konstituierte Bereich (..);“ (Foucault 1973: 259)
Foucault unterstellt den Willen zur Wahrheit. Der vorherrschende Wille zum Wissen hat dazu beigetragen. Diskurse haben in dieser Denkweise eine wichtige Position. In früheren Zeiten, etwa noch bei den Dichtern und Denkern im 6. Jahrhundert, war der Diskurs allein schon das Wahre. Er trug zur Verwirklichung des Gesagten bei. „Aber schon ein Jahrhundert später lag die höchste Wahrheit nicht mehr in dem, was der Diskurs war, oder in dem, was er tat, sie lag in dem, was er sagte: eines Tages hatte sich die Wahrheit vom ritualisierten, wirksamen und gerechten Akt der Aussage weg und zur Aussage selbst hin verschoben: zu ihrem Sinn, ihrer Form, ihrem Gegenstand, ihrem referentiellen Bezug.“ (Foucault 1974: 11 f; Hervorhebungen im Original)
War man im Mittelalter noch der Ansicht, dass wissenschaftliche Aussagen allein durch ihren Autor an Wahrheit gewinnen, können – wie gezeigt – Diskurse heute ohne Rekursivität auf ihren jeweiligen Autor Bestand haben. Der Diskurs wird wahr durch die Aussagen die in ihm getroffen werden und wie sie getroffen werden. Als wirklich wahr beobachtet werden Diskurse aber auch nur dann, wenn man sich den Regeln, Gesetzen und Maßstäben der jeweiligen Zeit und Kultur unterwirft. „Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven ‚Polizei’ gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muß.“ (Foucault 1974: 25) Hält man sich aber daran, so kann man auf die Funktion des Diskurses vertrauen. Wer versteht Diskurse richtig anzuwenden, kann scheinbare Wahrheiten suggerieren. Diskurse operieren indem sie vorgeben wahr zu sein. In ihren Aussagen verschwimmen richtig und falsch. Sie haben somit die Macht, Aussagen als scheinbar schlüssig und logisch darzustellen. So auch Angèle Kremer-Marietti, die Foucault als den ‚Archäologen des Wissens’ bezeichnet: „Die richtige Methode und der richtige Gebrauch sind dabei die Garanten der Legitimität des Diskurses, die Gewißheit, die Wahrheit. Wer nach den autonomen Regeln und mit den Mitteln und Wegen der Sprache spricht, weiß richtig zu analysieren und hat sich in den Besitz und in die Macht des richtigen Urteilens gesetzt (von daher eröffnet die richtige Sprache den Weg zur Naturbeherrschung).“ (Kremer-Marietti: 77) Es geht nicht um das Wissen, um die Wahrheit an sich, sondern um die Praktiken, die uns annehmen lassen eine Aussage sei wahr während eine andere als falsch angesehen wird.
Diskurse sind also an bestimmte Rituale wie Redeformen, Institutionen, Strategien oder Äußerungsformalitäten gekoppelt, in ihnen und durch sie äußern sich Machtstrukturen. Wie Foucault dies in seinen Kontext der Diskursanalyse einbaut wird im Folgenden kurz zu zeigen sein.
2.5. Die Macht der Diskurse
Foucault sieht Macht und Wissen als eng verkoppelt an, so wird Wissen über Regeln systematisiert, diese Regeln entspringen dabei auch Machtverhältnissen. „Es gibt bei Foucault ‚Macht-Wissen-Komplexe’, aber nichts außerhalb davon, was als Eigentliches oder Wesentliches durch die Macht behindert wäre. Weil Machtverhältnisse immer auch Wissensverhältnisse sind, konnte Foucault die rezipierte Sichtweise auf den Kopf stellen: Insofern jedes Bekenntnis etwas Gezwungenes an sich hat, (…) ist solche Macht selber wissensproduzierend und muss als eine Art Diskursivierungsmaschine begriffen werden.“ (Schneider 2004: 169) Macht ist dabei in der Theorie Foucaults nicht-subjektiv, d.h. Individuen wird weder Macht übertragen, noch wird Macht durch sie ausgeführt. Macht reguliert und schafft Strukturen. Auch hier hält sich Foucault an die schon eingangs erwähnte Intersubjektivität, die nicht durch die Individuen entsteht, sondern schon da ist und erst durch sie zum Vorschein kommt, eine Intersubjektivität, die allem vorgelagert ist. Macht ist demnach nicht etwas, was jemandem zugeschrieben werden kann oder durch Subjekte ausgeübt wird. Macht im Foucaultschen Sinne überzieht das gesamte Handlungsfeld der Subjekte. Dabei ist Macht eben nicht negativ zu beurteilen, sie zeichnet sich nicht nur durch Unterdrückung und Einschränkungen aus. Sie ist vielmehr produktiv, sie produziert Diskurse. Macht ist überall und nicht von oben nach unten definiert. Die Macht- und Kräfteverhältnisse der Gesellschaft überziehen gewissermaßen die gesamten sozialen Komponenten wie ein Netz. „Mit Foucault lassen sich Machtverhältnisse jenseits der politischen Theorie und außerhalb der studierten Kenntnis sozialer Institutionen analysieren, unter Absehung von geläufigen Legitimationen und Funktionalitäten.“ (Schneider 2004: 170)
An dieser Stelle sollen die Ausführungen zu den Begriffen und der Theorie Michel Foucaults genügen um nun die Beschreibung der Methodik selbst anzuschließen. So sollten die Grundlagen für die Diskursanalyse - aufbauend auf der Diskurstheorie - gelegt werden. Michel Foucault hat ja – wie bereits erwähnt – keine anwendbare Methode entwickelt, in seiner Tradition führten aber diverse Wissenschaftler den Diskursbegriff weiter und versuchten ein empirisch anwendbares Analyseverfahren zu entwerfen.
3. Die Diskursanalyse - theoretisch
Anknüpfend an diesen Diskursbegriff nach Michel Foucault möchte ich auf die in dieser Arbeit verwendete Methodik der Diskursanalyse selbst eingehen. Die Diskursanalyse als solche hat sich in den letzten Jahrzehnten interdisziplinär entwickelt, nicht nur die Soziologie hat an dieser Entwicklung ihren Anteil. Auch in der Linguistik, der Pädagogik, der Psychologie, den Politikwissenschaften und verwandten Disziplinen wurde versucht, den Diskursbegriff hin zu einer Methodik, zu einem Analyseverfahren zu entwickeln. In meinen Ausführungen und auch in der späteren empirischen Umsetzung werde ich mich dabei an den Grundsätzen der kritischen Diskursanalyse orientieren. Vor allem Michel Pêcheux hat anknüpfend an den vorgestellten Diskursbegriff ein Verfahren entwickelt, um Foucaults Theorie an einer empirischen Methode weiter zu entwickeln. Im deutschsprachigen Raum tritt Siegfried Jäger in den Vordergrund, der im Anschluss an Pêcheux und den Bochumer Sprachwissenschaftler Jürgen Link die methodische Vorgehensweise um den Foucaultschen Diskursbegriff spezifiziert hat. „Als allgemeines Ziel von Diskursanalyen stellt sich die Aufgabe, einen Diskursstrang oder auch mehrere miteinander verschränkte Diskursstränge historisch und gegenwartsbezogen zu analysieren.“ (Jäger 1997; Hervorhebungen im Original) Jäger benutzt – in Anlehnung an Foucaults Begriff der Aussage – den Begriff Diskursfragment. Ein Diskursfragment ist ein thematisch zusammenhängender Text oder Teil eines Textes. Die Diskursfragmente eines gleichen Themas bilden den oben erwähnten Diskursstrang. In der Diskursanalyse soll herausgestellt werden, welche Routinen Subjekte veranlassen in bestimmten Themengebieten gerade die Aussage zu treffen, die sie treffen. Dabei interessiert nicht die inhaltliche Ordnung der Diskursfragmente im Sinne von Wahrheit oder richtigem Wissen. Hierzu auch Schneider: "Entgegen einem solchen (Alltags-) Verständnis von Ideologie, welches entlang der Prädikation 'wahr' oder 'falsch' die Möglichkeit eines unverzerrten Zugangs zur Wirklichkeit 'wie sie tatsächlich ist' unterstellt, lautet ein Grundsatz einer an Michel Foucault orientierten sozialwissenschaftlichen Diskursanalyse: 'Wahrheit' – verstanden als gültiges, Geltung beanspruchendes Wissen über die Welt, an dem sich soziales Handeln orientiert und damit 'Wirklichkeit' schafft – ist der gesellschaftliche Effekt machtvoller diskursiver Praktiken." (Schneider 2001: 373 f) Jäger untersucht in seiner Diskursanalyse also die gesellschaftlich hergestellten und vermittelten Regelungen, in denen und durch welche eine bestimmte Wahrheit vermittelt werden soll, die dann auch als gültige Wahrheit wahrgenommen wird. Dabei kommt es auch und vor allem darauf an wann jemand eine Aussage treffen darf, damit dies noch gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert ist. „Die Diskursanalyse zielt auf die Rekonstruktion der institutionell-praktischen, symbolisch-semantischen Verknappungs-Mechanismen, die zum Auftauchen spezifischer Aussagen an bestimmten Stellen führen.“ (Keller 2004: 45) Es geht dabei nicht um individuelle, auf das jeweilige Subjekt bezogene Aussagen, vielmehr um die sozial konstruierte Fülle von möglichen Aussagen. Diskurse sind Aussagensysteme, die immer schon mit anderen gesellschaftlichen Bereichen in Beziehung stehen.
Von Interesse ist die für die Fragestellung bedeutenden Diskursfragmente herauszufiltern und andere, sofern sie nicht dazu benutzt werden um Wirklichkeiten zu erzeugen, auszublenden. Wie dies im Einzelnen geschehen kann, wird im Folgenden aufgezeigt.
3.1. Vorgehensweise
Siegfried Jäger stellt einen recht genauen Plan der Durchführung seiner Weiterführung der kritischen Diskursanalyse bereit. Dennoch ist ob der Vielseitigkeit der interessierenden Untersuchungsgegenstände und des Materiales ein genauer ‚Fahrplan’ nahezu nicht möglich. Die Vorgehensweise muss von Untersuchung zu Untersuchung, von Datenmaterial zu Datenmaterial teilweise geringfügig, teilweise bedeutend modifiziert werden. Das Konstrukt, welches Jäger vorstellt, soll im nun folgenden Teil näher bestimmt werden.[5]
3.1.1. Verortung des Diskursstrangs
„Aus dem Gesagten geht hervor, daß Diskursanalyse mit einer präzisen Bestimmung und Begründung seines Gegenstandes, seines Themas, wenn man so will, zu beginnen hat.“ (Jäger 1997; Hervorhebungen im Original) Zu Beginn steht also – unmittelbar nachvollziehbar – die Präzision des zu untersuchenden Forschungsgegenstandes mit einer genauen Definition der interessierenden Diskursstränge oder des interessierenden Diskursstranges. Die Verortung auf der Diskursebene bildet bei Jäger den zweiten wichtigen Ausgangspunkt. So ist zu bestimmen, auf welcher Ebene, also beispielsweise der Ebene der Politik, der Medizin, des Rechts, des Alltags und so fort der untersuchte Diskursstrang angesiedelt ist. Dabei ist zu beachten, dass die Diskursebenen nicht völlig losgelöst nebeneinander stehen, sondern durchaus auch ineinander greifen, sich vermischen und gegenseitig beeinflussen können. Weiterhin betont Jäger die Wichtigkeit der Bestimmung der Diskursposition, das heißt in welcher (meist medialen) Form jemand dem Diskurs beitritt.
Jäger betont als bedeutendsten Schritt der Verortung die Präzisierung der „ Form oder Struktur des Diskursstrangs “ (Jäger 1997; Hervorhebungen im Original). Diese lässt sich bei der später anschließenden Feinanalyse des Datenmaterials bestimmen, ist aber schon durch zum Beispiel die Textsorte vordeterminiert. „Kurz und knapp könnte man sagen, daß es bei der Verortung eines Diskursstrangs auf das Wer, Was, Wie, Wann und Wo ankommt, also auf das Subjekt der Aussage, das Referential oder die Aussage selbst, auf ihre Struktur oder Form, den Zeitpunkt oder auch Zeitraum und auf den extradiskursiven Rahmen, in dem sich der Diskursstrang bewegt. Den Bezug von Wie und Was könnte man daher auch als innerdiskursiv und die Relation von Subjekt und Rahmen als extradiskursiv bezeichnen.“ (Jäger 1997; Hervorhebungen im Original) Jäger übernimmt an dieser Stelle die Unterscheidung von Spezialdiskursen und Interdiskursen. Diese ist für die Analyse wichtig, da sich Spezial- und Interdiskurse auch gegenseitig beeinflussen und bedingen können. Spezialdiskurse sind dabei wissenschaftliche Diskurse, während Interdiskurse die nicht-wissenschaftlichen sind. Die Beziehungen zwischen ihnen dürfen nicht vernachlässigt werden, um ihren gegenseitigen Einfluss nicht zu übersehen. So ist denn ja auch gerade interessant, ob es dem Spezialdiskurs gelingen kann, Einfluss auf den Interdiskurs zu üben. Dies steht klar in der Absicht des Spezialdiskurses. Jäger formuliert dann die bedeutende Frage: „Wie ist diese Fragestellung so zu operationalisieren, daß sie diskursanalytisch sinnvoll untersucht werden kann?“ (Jäger 1997)
3.1.2. Materialaufbereitung für die Analyse des Diskursstrangs
Dazu muss zuvorderst das zu untersuchende Material bestimmt werden, wobei aus Zeitgründen kaum der komplette Diskursstrang herangezogen werden kann. Bei der genauen Auswahl ist daher auf Repräsentativität zu achten und die Auswahl als solche muss begründbar und argumentierbar sein. So ist denn auch zu erläutern auf welche Diskursebene man sich bezieht und warum dies erfolgt. Dazu wird die Diskursebene oder auch nur ein gewisser Sektor der behandelten Diskursebene charakterisiert. Das für die Untersuchung zugrunde gelegte Material wird dann nach Jäger zuerst in den Gesamtzusammenhang eingeordnet. So wird etwa – handelt es sich wie in dem Fall der Untersuchung dieser Arbeit um eine Zeitschrift – die Zeitschrift in ihrem Gesamtkontext bestimmt, etwa die allgemeine Intention der Zeitschrift, ihre Ausrichtung, das Publikum an die sie sich richtet, und so fort. Die der Untersuchung zugrunde gelegten Artikel werden dann in den Zusammenhang der Zeitschrift insgesamt gestellt und aufgelistet. Dabei ist auf auffällige Besonderheiten der Zeitschrift zu achten, etwa auf ausgewählte Thematiken der Zeitschrift unabhängig vom ausgewählten Diskursstrang und deren beabsichtigten oder unbeabsichtigten Einfluss auf den Untersuchungsgegenstand. Daran anschließend werden thematische Kategorien gebildet, denen die Einzelthemen zugeordnet werden können.
So soll ein zusammenfassender Überblick über die allgemeine Ausrichtung der Zeitschrift, über den jeweiligen Diskursstrang und seiner Verortung im Gesamtzusammenhang diesen Teil der Materialaufbereitung abschließen.
Nach diesen Schritten kann man dann nach Jäger zur Feinanalyse von Diskursfragmenten übergehen, was im nächsten Teil theoretisch nachvollzogen wird.
3.1.3. Materialaufbereitung für die Feinanalyse
Zu Beginn dieses Arbeitsschrittes steht die Bestimmung des nicht-sprachlichen Kontextes des jeweiligen Artikels, wenn man so will seines ‚institutionellen Rahmens’ (vgl. Jäger 1997). Das heißt zu bestimmen ist: Wer schreibt, warum, zu welchem Thema welche Art von Text?
Anschließend an diese Bestimmung folgt die Analyse dessen, was Jäger die „Text-‚Oberfläche’“ nennt: Dazu gehören die graphische Gestaltung, die Aufteilung unter Überschriften und auch unter Sinnzusammenhängen und das Auftauchen und Zusammenwirken von Diskursfragmenten im Text. Zudem ist hier auf die sprachlichen Besonderheiten zu achten, welche den Standpunkt unterstreichen sollen, etwa die Art und Form der Argumente und die Logiken der Begründung. Weiter behandelt dieser Arbeitsschritt die stilistischen Mittel, denen sich ihr Autor bedient, also ob er auf etwa Redewendungen oder Sprichwörter, auf Symboliken oder Metaphern, auf Kollektivsymbole zurückgreift um mit ihnen bestimmte Wirkungen zu erzielen. Kollektivsymbole sind dabei in Anlehnung an Jürgen Link Symbole, die in der Gesellschaft immer gleich verstanden werden, sie tauchen gewissermaßen im Interdiskurs immer wieder auf, es sind Bilder, die eine symbolische Bedeutung tragen. Kollektivsymbole sind vergleichbar mit kulturellen Deutungsmustern[6]. Weiter ist der Wortschatz und Stil zu beurteilen, welche Absicht steckt hinter der Wahl dieser Mittel. So stellt auch Keller fest: „Die Verwendung von Sprache – Begriffe (Kategorien), Klassifikationen, Verbildlichungen (Graphiken), Metaphern, Argumente, Akteursmarker, Handlungsmarker usw. – verweist immer auf einen Bedeutungshorizont oder –kontext, in dem sie Sinn macht und der in ihrem Gebrauch miterzeugt wird.“ (Keller 2004: 93) Abschließend in diesem Arbeitsschritt steht die Aufgabe, die Referenzbezüge des Autors aufzudecken, das heißt über welche Quellen macht der Autor sein Wissen, seine Informationen begründbar.
Hat man nun diese Oberfläche des Textes aufgedeckt und begründet, kann man zur Analyse der Aussagen selber, ihrer inhaltlichen und ideologischen Absicht, übergehen. An dieser Stelle empfiehlt sich meiner Meinung nach die Orientierung an der Grounded Theory und vor allem ihrer Strategie der Kodierung.
3.1.4. Die Feinanalyse
Die gegenstandsbegründete Theoriebildung basiert auf amerikanischem Pragmatismus und Meads Symbolischem Interaktionismus. Begründet von Barney G. Glaser und Anselm Strauss - Anhänger der Chicagoer Schule - besagt der Ansatz der Grounded Theory, dass die Datenerhebung und die theoretischen Annahmen selber eher in den Hintergrund treten und die Interpretation des gewonnenen Materials Priorität hat. Diese forschungspraktisch orientierte Herangehensweise geht davon aus, „daß wir über intuitive Kompetenzen der Theoriebildung, der Theoriegenerierung verfügen, die es auszuschöpfen, zu systematisieren und weiterzuentwickeln gilt.“ (Bohnsack 1999: 29) Glaser und Strauss haben dabei die Neugenerierung von Theorien und nicht ihre Überprüfung im Blick. Schon während des Prozesses der Datenerhebung werden die Daten ausgewertet und Hypothesen und Konstrukte am gewonnenen Material immer weiter entwickelt und verändert.
„Durch die zentrale Rolle, die der Interpretation von Daten (etwa gegenüber ihrer Erhebung oder der Vorab-Konstruktion ausgefeilten Designs) zukommt, wird der Umstand berücksichtigt, dass das eigentliche empirische Material der Text ist, an dem letztlich auch die Theorie entwickelt wird.“ (Flick 2002: 74)
Dabei ist das Ziel nicht etwa die Reduktion von Komplexität, es geht vielmehr um eine „Verdichtung von Komplexität durch Einbeziehung von Kontext“ (ebd.: 69). Die Grounded Theory soll die Theorie durch die Analyse des erhobenen Materials erst entwickeln, dies setzt eine sofortige Interpretation des gewonnenen Materials voraus. Der Prozess der Erhebung und Interpretation ist daher ein zirkulärer Prozess, der eine „permanente[n] Reflexion des gesamten Forschungsvorgehens und seiner Teilschritte im Licht der anderen Schritte“ (ebd.: 72) erzwingt und auch ermöglicht. Vorannahmen über den zu untersuchenden Forschungsgegenstand sind dabei notwendig, allerdings als vorläufig anzusehen und während der Interpretation des Materials gewonnene Informationen verändern die Theorie. Dieser Prozess treibt die Konstruktion des untersuchten Gegenstandes voran. (vgl. Flick 2002: 74) Der Forscher hält zentrale Aspekte, die während der Erhebung auftauchen, fest und bildet auf dieser Grundlage Kodes. Er versucht dann diesen Aspekt durch weitere Beobachtungen zu vervollständigen, an diesem Aspekt anzuschließen. Die unterschiedlichen Aspekte sollen dann miteinander verglichen werden, was durch die Kodes geschehen kann.
An diesem kurzen Einschub kann man sehen, dass die Grounded Theory durchaus Parallelen zur Diskursanalyse enthält beziehungsweise Aspekte ebenso hier anwendbar sind. Das heißt es müssen Codes gebildet werden nach dem Muster des offenen, axialen und selektiven Kodierens. Beim offenen Kodieren werden Aussagen „in ihre Sinneinheiten (einzelne Worte, kurze Wortfolgen) zergliedert, um die mit Anmerkungen und vor allem mit ‚Begriffen’ (Kodes) zu versehen“. (Flick 1995: 198) Dieses Verfahren ist sehr aufwendig und kann im vorliegenden Fall nicht ähnlich detailliert betrieben werden wie es Glaser und Strauss in ihrer Begründung der Grounded Theory vorschwebt. Dennoch ist es hilfreich, die zentralen Aussagen des Textes durch die so genannten W-Fragen (Was, wer, wie, wann, wie viel, warum, womit, wozu) zu erschließen. Letztlich soll geklärt werden, worum es eigentlich im Text geht und worauf er abzielt. Beim axialen Kodieren sollen dann die gefundenen Kategorien spezifiziert und differenziert betrachtet werden. „Dabei werden aus der Vielzahl entstandener Kategorien diejenigen ausgewählt, deren weitere Ausarbeitung am vielversprechendsten erscheint. Diese Achsenkategorien werden mit möglichst vielen Textstellen, auf die sie ‚passen’, weiter angereichert.“ (Flick 1995: 201) Es sollen die Beziehungen zwischen den einzelnen Kategorien, zwischen den Unterkategorien, den Ursachen von Ereignissen und ihren Konsequenzen und nicht zuletzt die Strategie der Akteure aufgedeckt werden. Das selektive Kodieren bildet den letzten Schritt der Kategorienbildung. Hier wird am axialen Kodieren angeschlossen und es soll am Ende eine zentrale Kategorien stehen, um die sich die einzelnen Unterkategorien gruppieren. So auch Flick: „Das zentrale Phänomen der Geschichte wird mit einem Begriff versehen und mit anderen Kategorien in Beziehung gesetzt. Ergebnis sollte auf jeden Fall eine zentrale Kategorie und ein zentrales Phänomen sein.“ (Flick 1995: 203; Hervorhebungen im Original) Hier wird gewissermaßen der rote Faden der Geschichte herausgearbeitet, das Hauptproblem kristallisiert sich heraus und wird offen gelegt.
Dieser sehr kurze Einblick in die Methode des Kodierens nach vor allem Anselm Strauss soll deutlich machen, auf welcher theoretischen Grundlage die Kategorien im praktischen Teil entstehen.
3.2. Einordnung der Untersuchungsergebnisse
Anschließend an die Feinanalyse müssen die gefundenen Ergebnisse benannt und entsprechend dargestellt werden. Hier wird der eigentliche Diskurs bestimmt. Um den Diskurs als Ganzen erfassen zu können, müssen die einzelnen Texte (diese können als Diskursfragmente verstanden werden) analysiert, die Ergebnisse ihrer einzelnen Feinanalyse herausgestellt und miteinander verglichen, in Beziehung gesetzt werden. „Bedeutsam für die Rekonstruktion von Gesamtdiskursen ist also das schrittweise Vorgehen und Vorantasten durch eine mehr oder weniger große Zahl einzelner Feinanalysen.“ (Keller 2004: 109) Erst dann kann der Diskurs als Gesamtheit erfasst werden. Dieser Schritt erfordert, dass die Ergebnisse der einzelnen Feinanalysen mit ihrem gesellschaftlichen Kontext in Beziehung gesetzt werden. Dabei sollen die Merkmale des Diskurses aufgedeckt werden. Erst hier lassen sich die Strategien der Akteure in eine soziologisch interessierende Fragestellung übertragen und erst hier lässt sich der Diskurs als solches fassen.
An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Problem der Validität der Daten eingehen. Es ist kaum möglich, den Diskurs als Ganzen zu erfassen. So bleibt die Analyse häufig – so auch in dieser Arbeit – auf einen kleinen Anteil an Diskursfragmenten begrenzt. Ist diese Auswahl aber reflektiert vorgenommen und auch hinreichend erläutert, kann man sich diesem Problem stellen. In der qualitativen Sozialforschung ist es nicht immer einfach, die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auch einzuhalten beziehungsweise deutlich zu machen, dass sie eingehalten wurden. Daher muss in einer solchen Analyse die verwendete Methode genau erklärt werden.
Damit soll der theoretische Rahmen für die nun folgende Diskursanalyse gelegt sein. Es werden im Verlauf der Analyse selbst verschiedene Aspekte in den Vordergrund treten, während andere teilweise vernachlässigt werden müssen. Dennoch soll am gezeigten Muster eine detaillierte Analyse des Diskurses um Sterbehilfe und Patientenverfügungen entstehen.
4. Die Diskursanalyse – praktisch
In der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, inwiefern das Bild des Sterbens und des Todes durch die Fortschritte der heutigen Medizin und durch Stellungnahmen von Experten und Nicht-Experten verändert oder generiert werden. Welche Sicherheiten werden durch welche Mittel in die soziale Wirklichkeit hineinkonstruiert? Sind diese Sicherheiten auch Sicherheiten, oder kehren sie sich nicht viel mehr in Unsicherheiten um? Und können die Sinnzusammenhänge bestehen? Wenn ja, wie? Können Patienten und deren Angehörige erleichtert aufatmen über die aktuellen gesetzlichen Regelungen und die vermehrten Diskussionen um Patientenrecht und -autonomie? Oder wissen sie jetzt noch weniger, was zu tun ist?
Das alles werden Fragen sein, die im Laufe der Analyse beantwortet werden sollen.
4.1. Zur Beschreibung des Diskurses
Das von mir behandelte Datenmaterial stellt eine ausgewählte Sammlung von Artikeln aus der Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ dar. Die Zeitschrift ist das offizielle Organ der 1986 gegründeten Akademie für Ethik in der Medizin (AEM). Die AEM hat es sich laut den Angaben auf der eigenen Homepage[7] zur Aufgabe gemacht, ethische Problematiken in einer vormals meist rein medizinisch-wissenschaftlichen Diskussion zu thematisieren. Sie setzt sich zusammen aus Ärzten, Pflegekräften, Klinikpersonal, Philosophen, Theologen, Juristen und anderen nicht-medizinischen Vertretern. Um die ethischen Aspekte im klinischen Alltag zu berücksichtigen engagiert sie sich etwa durch wissenschaftliche Projekte, trägt Symposien aus, organisiert Arbeitsgruppen wie etwa ‚ Ethik in Ethik-Komitees’ oder ‚ Sterben und Tod’. Seit 1989 gibt die AEM die Zeitschrift „Ethik in der Medizin“ heraus. Diese erscheint vierteljährlich im Springer-Verlag. Die Zeitschrift wird von ganz unterschiedlichen Professionen als Träger genutzt, so kann man Artikel von Medizinern, Juristen, Theologen, Krankenschwestern und Pflegern, Sozial- und Geisteswissenschaftlern und auch von Naturwissenschaftlern finden. Der ethische Diskurs ist also in den verschiedensten Diskursebenen verortet. Die AEM teilt der Zeitschrift zwei zentrale Aufgaben zu. Einerseits soll medizinischem Personal im weitesten Sinne die neuesten Informationen vermittelt werden, andererseits soll sie eben die ethischen Probleme der modernen Medizin thematisieren, eine Diskussionsplattform zur Verfügung stellen. Dabei äußert die AEM selbst den Anspruch der Objektivität und der Interdisziplinarität. Die Zeitschrift beinhaltet Diskussionsbeiträge zu ausgewählten Themen sowie Rechtsfälle, empirische Untersuchungen, Referate und auch Rezensionen aktueller Veröffentlichungen. Ich konzentriere mich – aufgrund der Fülle des Materials und der begrenzten Möglichkeiten solch einer Arbeit – ausschließlich auf den Jahrgang 2004. Hieraus werde ich die für die Fragestellung dieser Arbeit interessierenden Artikel zur Analyse heranziehen. Die Auswahl kann dem Anspruch an Validität in einem gewissen Sinne gerecht werden, denn es handelt sich um einen interdisziplinären Diskurs. Dabei wird eine zwar nur relativ kurze Zeitspanne betrachtet, aber gerade in einem Bereich wie der medizinischen Ethik, der einem ständigen und schnellen Wandel unterworfen ist, lässt schon ein Jahr ein breites Spektrum der Diskussion zu. Die Artikel sind von der Gestaltung, von ihrem Layout her, annähernd im gleichen Stil gehalten.
4.2. Aufstellung des Datenmaterials
Im Folgenden möchte ich kurz auf die von mir verwendeten Texte eingehen. Es handelt sich dabei ausschließlich um so genannte Originalarbeiten, also um Diskussionsbeiträge zur Debatte um Selbstbestimmung am Lebensende und Palliativmedizin, um Patientenverfügungen und Sterbehilfe, um Stellvertreterentscheidungen und Entscheidungsfindung im Sterbeprozess. Einige Artikel des Jahrgangs wurden dabei von mir ganz bewusst ausgespart, da sie kaum oder gar nicht mit dem Thema dieser Arbeit zusammenhängen. Zudem wurden der Bereich „Fall und Kommentar“, Rezensionen, Tagungsberichte und der Bereich „Übersichtsarbeit“ aus der Analyse ausgeklammert. Wie schon eingangs erwähnt beschäftigt sich die Zeitschrift mit allen Thematiken rund um die Ethik der Medizin. So behandelt sie einerseits Themen wie Organspende, wie Stammzellen- oder Embryonenforschung oder auch Abtreibung. Für die zu untersuchende Fragestellung sind die Themen rund um das Lebensende interessant. Die einzelnen von mir verwendeten Artikel aus den vier Heften des Jahrgangs 2004 (Band 16) sind dabei:
- Burchardi, Nicole/ Rauprich, Oliver/ Vollmann, Jochen: "Patientenselbstbestimmung und Patientenverfügungen aus der Sicht von Patienten mit amyotropher Lateralsklerose – Eine qualitativ-empirische Studie", in: Ethik in der Medizin, 2004, Band 16, Heft 1, Seite 7-21
[...]
[1] 1966 erschien Michel Foucaults gleichnamige Analyse ‚Die Ordnung der Dinge’.
[2] Vgl. dazu auch Kap. 2.1.2.
[3] Vgl.: „…ich möchte an präzisen Beispielen zeigen, daß man bei der Analyse der Diskurse selbst die offensichtlich sehr starke Umklammerung der Wörter und der Dinge sich lockern und eine Gesamtheit von der diskursiven Praxis eigenen Regeln ablösen sieht.“ (Foucault 1973: 74)
[4] Nicht-diskursive Praktiken sind beispielsweise symbolische Gesten.
[5] Vgl. zu dem gesamten Kapitel: Vortrag von Siegfried Jäger auf der Tagung ‚Das große Wuchern des Diskurses.’ 1997 in der Universität GH Paderborn, siehe auch Literaturverzeichnis.
[6] So existiert z.B. in der Diskussion um Einwanderung das Kollektivsymbol ‚Das Boot ist voll’.
[7] http://www.aem-online.de/main.htm
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832495107
- ISBN (Paperback)
- 9783838695105
- Dateigröße
- 731 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Sozialwissenschaftliche Fakultät, Soziologie
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- sterbehilfe patientenverfügung foucault todesbilder diskurstheorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de