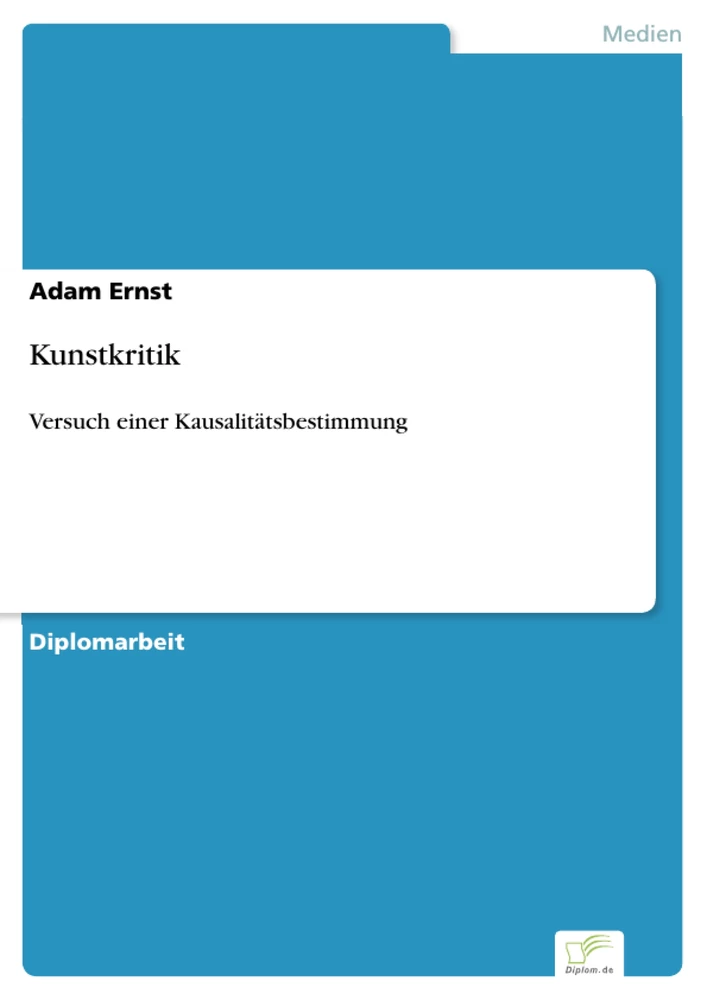Zusammenfassung
Die forschungsleitende Frage Wie beeinflusst Kunstkritik das aktuelle und zukünftige Kunstgeschehen? gibt gleichsam den Roten Faden für diese Arbeit vor. Zunächst wird auf die Begriffsbestimmungen in diesem Umfeld eingegangen um Begrifflichkeiten für den weiteren Verlauf klar abstecken zu können. Die einzelnen Eckpunkte - Künstler, Kritiker und Kritik - werden separat ausgefasst und mittels der Literatur modelliert; auf die Relevanz für die Kommunikationswissenschaft wird besondere Rücksicht genommen.
Mittels des empirischen Teiles werden nun die einzelnen Begriffe miteinander in Beziehung gebracht und diskursiv behandelt. Aus vier Experteninterviews wird die Richtung der Kausalität der wechselseitigen Beeinflussung von Künstlern und Kritikern eruiert.
Die zahlreichen Definitionsbemühungen, die versuchen das Phänomen der Kultur und das der Kunst klar begrifflich zu erfassen, sind in der Wissenschaftsliteratur bereits Legion. Trotzdem, oder gerade wegen der verbaldefinitorischen Uneinnehmbarkeit dieser Begriffe, ist die diskursive Auseinandersetzung mit Kultur, Gesellschaft und Kunst bereits zu Beginn dieser Arbeit unerlässlich. Es soll hierbei nicht versucht werden Position für die eine oder andere Theorie oder Definition zu beziehen, sondern die eigene Sicht auf diese begrifflichen Problemstellungen, welche schließlich eine Grundlage für diese Arbeit bilden, zu vermitteln.
Der Begriff Kultur weckt verschiedene Assoziationen, je nachdem, ob wir an die Entwicklung eines einzelnen, einer Gruppe oder Klasse oder einer ganzen Gesellschaft denken. Es gehört zu meiner These, dass die Kultur des Individuums auf die Kultur einer Gruppe oder Klasse angewiesen ist und dass die Kultur einer Gruppe oder Klasse von der Kultur der Gesamtgesellschaft abhängt, zu der diese Gruppe oder Klasse gehört. Das Grundlegende ist also die Kultur der Gesellschaft; es muss daher zuerst untersucht werden, was ,Kultur in Bezug auf die Gesellschaft als Ganzes bedeutet (Eliot 1961).
Schon 1961 weist Eliot in seinem Essay eindringlich auf die Zersetzung des Begriffs Kultur im Zusammenhang mit seiner immer verbreiteteren Aufnahme in den journalistischen Wortschatz hin. Weiter setzt er sich mit den vielschichtigen Bedeutungen dieses Wortes auseinander und begibt sich damit auf die semantische Ebene des Kulturproblems an sich: die Angleichung des Inhalts von Kultur an die benötigten Maßstäbe der jeweiligen Gesellschaftsordnung. Mittels […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
1 Kulturphilosophische Standortbestimmungen
1.1 Die Kunst der Kultur
1.1.1 Kulturbegriff, gesellschaftliche Kommunikation und symbolische Ordnung
1.1.2 Bildende Kunst und ihr Standort im Kulturgefüge
1.1.3 Situation der Gegenwartskunst im Zeitalter der Postmoderne
1.2 Der moderne Kunstbegriff und seine Problematik
1.2.1 Die kunstbegriffliche Problematik
1.2.2 Exkurs: Die Kommentarbedürftigkeit moderner Kunst
1.2.3 Das Problem der Interpretation des Emotionalen
1.2.4 Der Kommunikationsbegriff in Hinblick auf das Phänomen des modernen Kunstbegriffs
2 Der Künstler
2.1 Der Künstler im gesellschaftlichen Kontext
2.2 Der Künstler im medienspezifischen Kontext
2.2.1 Mißverständnisse im Kommunikationsprozess
2.2.2 Der mediengerechte Künstler
3 Der Kritiker
3.1 Der Kunstkritiker als Instanz
3.1.1 Modelle
3.2 Der Kunstkritiker als Journalist
3.2.1 Der Kunstkritiker als Multirollenspieler
4 Die Kritik
4.1 Kunstkritik im historischen Kontext
4.1.1 Kunstgeschichte vs. Kunsttheorie vs. Kunstkritik
4.1.2 Entstehung der Kunstkritik
4.1.3 Probleme der Kunstkritik heute
4.2 Kunstkritik im kommunikativen Kontext
4.2.1 Kunstkritik als Kommunikationsprozess
4.2.2 Werturteile in der Kunstkritik
4.3 Kunstkritik im massenmedialen Kontext
4.3.1 Fernsehen als Träger von Kunstkritik
4.3.2 Printmedien als Träger von Kunstkritik
5 Empirische Untersuchungen
5.1 Methodologische Überlegungen
5.1.1 Meinungen der Experten (Problemzentriertes Interview)
5.1.2 Vorgangsweise und Selektion
5.2 Diskurstheoretische Auswertung
5.2.1. Beschreibung der Interviewsituation
5.2.2 Gliederung der Sinnabschnitte
5.2.3 Weitere thematisierte Begriffe
5.2.4 Charakterisierung der „Künstler“/ Eigenschaften
5.2.5 Charakterisierung der „Kritiker“/ Eigenschaften
5.2.6 Narrative Strukturen
5.2.7 Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
Anhang
Kurzfragebogen
Gesprächsleitfaden & Interviews
Vorwort
Die forschungsleitende Frage „Wie beeinflusst Kunstkritik das aktuelle und zukünftige Kunstgeschehen?“ gibt gleichsam den Roten Faden für diese Arbeit vor. Zunächst wird auf die Begriffsbestimmungen in diesem Umfeld eingegangen um Begrifflichkeiten für den weiteren Verlauf klar abstecken zu können. Die einzelnen Eckpunkte - Künstler, Kritiker und Kritik - werden separat ausgefasst und mittels der Literatur modelliert; auf die Relevanz für die Kommunikationswissenschaft wird besondere Rücksicht genommen.
Mittels des empirischen Teiles werden nun die einzelnen Begriffe miteinander in Beziehung gebracht und diskursiv behandelt. Aus vier Experteninterviews wird die Richtung der Kausalität der wechselseitigen Beeinflussung von Künstlern und Kritikern eruiert.
1 Kulturphilosophische Standortbestimmungen
Die zahlreichen Definitionsbemühungen, die versuchen das Phänomen der Kultur und das der Kunst klar begrifflich zu erfassen, sind in der Wissenschaftsliteratur bereits Legion. Trotzdem, oder gerade wegen der verbaldefinitorischen „Uneinnehmbarkeit“ dieser Begriffe, ist die diskursive Auseinandersetzung mit Kultur, Gesellschaft und Kunst bereits zu Beginn dieser Arbeit unerlässlich. Es soll hierbei nicht versucht werden Position für die eine oder andere Theorie oder Definition zu beziehen, sondern die eigene Sicht auf diese begrifflichen Problemstellungen, welche schließlich eine Grundlage für diese Arbeit bilden, zu vermitteln.
1.1 Die Kunst der Kultur
1.1.1 Kulturbegriff, gesellschaftliche Kommunikation und symbolische Ordnung
„Der Begriff Kultur weckt verschiedene Assoziationen, je nachdem, ob wir an die Entwicklung eines einzelnen, einer Gruppe oder Klasse oder einer ganzen Gesellschaft denken. Es gehört zu meiner These, dass die Kultur des Individuums auf die Kultur einer Gruppe oder Klasse angewiesen ist und dass die Kultur einer Gruppe oder Klasse von der Kultur der Gesamtgesellschaft abhängt, zu der diese Gruppe oder Klasse gehört. Das Grundlegende ist also die Kultur der Gesellschaft; es muss daher zuerst untersucht werden, was ,Kultur’ in Bezug auf die Gesellschaft als Ganzes bedeutet“ (Eliot 1961: 21).
Schon 1961 weist Eliot in seinem Essay eindringlich auf die „Zersetzung“ des Begriffs „Kultur“ im Zusammenhang mit seiner immer verbreiteteren Aufnahme in den journalistischen Wortschatz hin. Weiters setzt er sich mit den vielschichtigen Bedeutungen dieses Wortes auseinander und begibt sich damit auf die semantische Ebene des Kulturproblems an sich: die Angleichung des Inhalts von Kultur an die benötigten Maßstäbe der jeweiligen Gesellschaftsordnung. Mittels dieser Assimilation läßt sich „Kultur“ in der geisteswissenschaftlichen Forschung als Raster operationalisieren unter dem die Anordnung von mit einander in Beziehung gebrachten, gesellschaftsrelevanten Komponenten untersucht werden kann Darunter auch selbstverständlich die Kommunikation. Der Begriff der Kultur ist also durch seinen intrinsischen Gehalt geprägt, der von der Gesamtgesellschaft und ihren Strukturen nicht zu trennen ist. Das Zu-Hilfe-Nehmen des Kulturbegriffs im Rahmen von sozialer Ordnung, Gesellschaftssystem und Wertewandel erschließt hierbei wesentlich universellere Strukturen: „Kultur“ kann neben der gesellschaftlichen Ordnung auch als symbolische Ordnung verstanden werden, wobei die Kommunikation eine Vermittlerrolle einnimmt und individuellen Sinn oder Bedeutung generiert.
Diesen Bedeutungen wird heute ihr prozessualer Charakter nicht mehr abgesprochen und weitgehend hat man sich auch von ihrem Objektivitätsanspruch gelöst. Ideologien sind ihrerseits nur Bestandteile dieses dynamischen Kulturbegriffes, den Albert Dresdner (1968: 124) als einen von der Gesellschaft als übergeordnetes Orientierungssystem erachteten, relativen Gemeinschaftssinn sieht, welcher dem historischen Wandel unterliegt. So beruhte früher etwa das ideologisierte Konzept der Kultur verstärkt auf Kontinuität und Tradition, während wir heute in Zeiten der Postmoderne aus einem fast schon Überangebot an Konfessionen wählen können, was das Festlegen eindeutiger Bezugsrahmen kaum mehr ermöglicht.
Auch die verwaschene Verwendung der einzelnen Begriffe führt zu einer anhaltenden Orientierungslosigkeit in diesem Bereich. Die Abgrenzung der Kultur von anderen Aktivitätsebenen einer Gesellschaft verdünnt diesen Begriff in einem solchen Maße, dass er fast mit dem Begriff „Kunst“ deckungsgleich wird, womit er zum Synonym degradiert wäre (Strube 1993: 17f). Diesem Deutungsmißverständnis unterliegt ein großer Teil des öffentlichen Kulturdiskurses. Das wird zum Beispiel an dem als Kulturseiten deklarierten Teil einzelner Zeitungen evident, wo ausnahmslos Kunstprodukte und Präsentationen thematisiert werden. Kultur sollte jedoch als ein übergeordnetes, universell integratives Wertesystem gesehen werden, welches das Wesen anderer Teilbereiche unseres Lebens, wie etwa der Wirtschaft und Politik, in gleichem Maße prägt.
1.1.2 Bildende Kunst und ihr Standort im Kulturgefüge
„(…) denn es läßt sich eine stetige Aufwärtsentwicklung des kulturellen Niveaus der Gesellschaft insgesamt feststellen, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit fortsetzten wird. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass mit jedem Fortschritt dieser Art gleichzeitig jener Bevölkerungsanteil zunimmt, der wirklich Zugang zur Kultur bekommt, und dass parallel dazu jene weit größere Schicht anwächst, die das Niveau einer so genannten Pseudokultur erreicht, das immerhin eine Art Antichambre zur wahren Kultur ist“ (Goldmann 1973: 20)
In seinem Buch „Kultur in der Mediengesellschaft“ erkennt Lucien Goldmann die Notwendigkeit, den Gesamtzustand der Gesellschaft, in deren Rahmen ein Kunstwerk entsteht, miteinzubeziehen um die Entstehung, Bedeutung und Wirkung eines Kunstwerkes, insbesondere in der Bildenden Kunst, untersuchen zu können. Auf der einen Seite steht für ihn eine Art Status Quo als Grundlage für ein intellektuelles und ästhetisches Regelsystem, das von in einer Gesellschaft miteinander korrelierenden Kräften bestimmt wird. Vor diesem Hintergrund trifft der Künstler als symbolisch handelnder Mensch eine Selektion von Reizen, die ihm der Kulturzustand entgegenbringt. So generiert der Gesellschaftszustand selbst ästhetische Erregungen, welche Handlungen im Sinne von Auseinandersetzungen mit der Kulturumwelt hervorbringen. Diese ästhetischen Gefühle erhalten einen sozial bedeutsamen Charakter, sei es nun in Bezug auf das Individuum, das Kollektiv oder die gesamte Gesellschaft.
Dies war jedoch nicht schon immer der Fall. Noch vor dem 20. Jahrhundert hat die Gesellschaft gewisse Kulturnormen produziert und vorgegeben, nach welchen sich die Künstler richteten und teils auch zu richten hatten. Seit dem Aufkeimen des Expressionismus gilt jedoch ein umgekehrtes Verhältnis; die kulturelle Stimmungslage ist nicht mehr der Indikator für das Maß der künstlerischen Anpassung, sondern das genaue Gegenteil (Read 1957: 90). Für die verschiedenen Strömungen der Moderne gilt, dass jene Antinomien, die sie den latenten „Geschmacks-Postulaten“ entgegensetzten, Indikatoren für die Funktionsverflechtung zwischen Gesellschaft und Kunst sind. Diese Wechselwirkungen laufen auf kommunikativen Bahnen. Sie können als gesellschaftliche Kritik im Raum stehen, können aber auf die Gesellschaft wirken, in ihr Zustimmung oder Ablehnung erzeugen. Somit ist Kunst als kulturelles Subsystem immer an eine Funktion gebunden. Sie existiert nicht für sich allein oder autonom, weil eine Kunst ohne Rezeption sich aus dem funktionellen Zusammenhang der Kultur ausgliedern würde (ebenda)[1].
Kunst im Gesellschaftszusammenhang gründet sich, wie bereits erwähnt, auf funktionelle Zusammenhänge. Sie ist in Strukturen eingebettet, die der Kunst erst diese Rollen verleihen: der Kunstproduzent auf der gesellschaftlichen Handlungsebene, die Kunstdistribution als Multiplikator und die Kunstrezension auf der kommunikativen Ebene als Gradmesser eines aus der Kunst abgeleiteten Kulturzustandes. In diesem Geflecht verankert ist sie ein Motor für die ständig neue kulturelle Erfahrungssuche einer Gesellschaft, sei es durch Anpassung derselben in der Kunst, oder eben durch ihre Ablehnung und Provokation.
1.1.3 Situation der Gegenwartskunst im Zeitalter der Postmoderne
Als ein wesentliches Kennzeichen der postmodernen Zeit ist festzuhalten, dass jene großen Ideengebäude der vergangenen Jahrhunderte, welche die Geschichte der Menschheit als einen einheitlichen Prozess erzählen konnten, brüchig geworden sind und sich als uneinlösbare Utopien und Fiktionen erwiesen haben. Die Grundidee der Moderne, wonach es etwas wie formulierbare Ziele der menschlichen Entwicklung wie Freiheit, Rationalität, Wohlstand durch Technik und Menschenrechte gibt, auf welche der Fortschritt abzielt und an denen er zu messen sei, hat sich im gesellschaftlichen Diskurs als höchst fragwürdig erwiesen.
Neben der Architektur, die den Begriff „Postmoderne“ geprägt hat, ist auch im Bereich der Bildenden Kunst seit den Zeiten von Herbert Read eine Akzentverschiebung zu stärker poetischen, emotionalen und ambivalenten Werken festzustellen. Der Ausdruck „Postmoderne“ selbst wird in diesem Feld jedoch weit weniger verwendet als in der Architektur. Das rührt letztlich daher, dass das Spektrum der Moderne in der Malerei ungleich breiter war als in der Architektur. Während – simplifiziert gesagt – in der Architektur das Modell „weißer Kubus“ den Geschmack bestimmt hat, umfasste die Malerei seit - Kandinsky - nicht nur die Abstraktion, sondern auch die Realistik. Später, um 1980, bekam diese immer größere Ausmaße annehmende Entwicklung von dem italienischen Kunsthistoriker Achille Bonito Oliva die Bezeichnung „Trans-Avantgarde“ verliehen. Dieser Begriff ist dem Ausdruck „Postmoderne“ parallel gesetzt, denn die Avantgarde fungierte als Schlagwort des ästhetischen Modernismus. Somit bedeutet „Trans-Avantgarde“ eine Position jenseits dieses Modernismus und ist in diesem Sinne eine postmoderne Position. (Welsch 1991: 34)
Für dieses Konzept der Trans-Avantgarde ist vor allem der Abschied von einem Sozialauftrag der Kunst charakteristisch. Der Künstler wehrt sich dagegen, der ästhetische Handlanger oder Propagandist einer gesellschaftlichen Utopie zu sein. Trotz aller Abkehr vom Sozialen impliziert die trans-avantgardistische oder die postmoderne Position dennoch einen Gesellschaftsbezug sekundärer Art, sodass ihr Unterschied zur Moderne in diesem Punkt kein absoluter, sondern eher der einer Nuance ist (Roh 1948/1993: 184). Natürlich kann der Kern der Postmodernität nicht allein hierin liegen, dieser muss vielmehr in etwas anderem zu suchen sein: In ihrem radikalen Verweis auf Pluralität per se und auch in den Möglichkeiten ihrer Entschlüsselung mittels der verschiedenen Codes.
Pierre Bourdieu fasst das Kunstwerk als ebensolchen Code auf, den es zu enträtseln gilt. Dementsprechend bemisst sich für ihn der Grad der „ästhetischen Kompetenz“ eines Betrachters danach, inwieweit er „die zu einem gegebenen Augenblick verfügbaren und zur Aneignung des Kunstwerkes erforderlichen Instrumente, d.h. Interpretationsschemata beherrscht, die (…) die Bedingung zur Entschlüsselung von Kunstwerken bilden“, und inwieweit jene einer Gesellschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt angeboten werden (Bourdieu 2000: 159ff). Für Liessmann wiederum ist der weitverbreitetste Aspekt der Postmoderne die „Doppelkodierung“, der Gebrauch von Ironie, Mehrdeutigkeit und Widerspruch (Liessmann 1993: 16). Postmoderne Architekturen, Bilder und Texte sind nach seiner Auffassung immer nach mehreren Codes entschlüsselbar, die sich gegenseitig ironisieren, aufheben oder widersprechen können und eben daraus ihren intellektuellen Witz beziehen. Dies führt zu einer weiteren, von der Postmoderne angestrebten Eigenschaft: der Mutivalenz ihrer Werke, einer prinzipiellen Vieldeutigkeit, die eine fortwährende, ständig mutierende Interpretation evozieren soll. Im Gegensatz zur Moderne liegt es nun wieder an der postmodernen Kunst zu erzählen, anzudeuten und die Kommunikation mit dem Betrachter zu suchen. Als Hilfe für den Betrachter erweisen sich hierbei Beschriftungen und erklärende Texte. Boris Groys geht hier sogar weiter indem er schreibt: „wenn Bilder nicht mit einem Text – im begleitenden Informationsblatt, im Katalog, in einer einschlägigen Zeitschrift oder sonst wo – versehen sind, scheinen sie schutzlos, verloren und unbekleidet der Welt ausgeliefert zu sein. Bilder ohne Text wirken peinlich, wie ein nackter Mensch im öffentlichen Raum. Der Text des Kritikers schützt das Kunstwerk weniger vor seinen Gegnern, sondern isoliert es vielmehr von seinen möglichen Verehrern. (…) So wehren sich die Künstler gegen den theoretischen Kommentar in der Hoffnung, dass das nackte Kunstwerk mehr Menschen verführen kann als ein vom Text bekleidetes (1997: 11f & 22). Dieses Verlangen nach textueller Bekleidung, das Arnold Gehlen als die Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst bezeichnet hat, entstand bekannterweise als Reaktion auf das Unverständnis, das die Kunst der Moderne jenseits ihres Kreises, das heißt beim breiteren Publikum, zunächst hervorgerufen hat (Gehlen 1960/1990: 74). Heute im Zeitalter der Postmoderne steht ebendieses Publikum zwar den Objekten vermeintlich offener gegenüber, erfährt zum Teil aber die gleiche Verstörung und das gleiche Unverständnis, empfindet die Peinlichkeit aber eher auf der eigenen Seite, aus Angst vor dem Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit im Bezug auf das Verstehen der Kunstaussage.
Von einem Wunsch müssen wir uns beim Betrachten von postmodernen Kunstwerken entschieden verabschieden: Fragen, die wir an die Objekte stellen, werden uns nicht beantwortet werden (Groys 1997: 76). Dazu lautet bislang der Ratschlag der ratlos Betroffenen, man solle heute in erster Linie versuchen zu verstehen und nicht kritisch zu sein. Am besten, so Helmut Schneider in seinem Artikel in „Die Zeit“[2], man antworte auf die Frage, ob etwas überhaupt Kunst ist, grundsätzlich mit „ja“, denn dies bedeutet, nicht „unkritisch“ zu sein, sondern sich auf ein Gefühl für Qualität zu verlassen. Man dürfe der heutigen Kunst nicht ankreiden, was sie sowieso nicht beabsichtigt – sie brauche ihre eigenen Unkritiker.
Und nicht nur das: Auch den Museumsbesucher, der heute immer noch unverrückbar die Auffassung hegt, dass das in einem Museum zur Schau gestellte bereits (historisch) als „Kunst“ legitimiert sei, unterstützt der langjährige Direktor der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf, Werner Schmalenbach, mit einer zunächst verblüffenden Selbstverständlichkeit: „Natürlich ist das Kunst! Was soll es denn sonst sein? – Wenn es sich um eine Kunstausstellung handelt, dann ist das, was da ausgestellt wird, in Gottes Namen Kunst. Ob das Kunst ist oder nicht, ist also die falsche Fragestellung. „Kunst“ ist bloß eine Überschrift, eine wertfreie Rubrik. Die Frage nach der Kunst – ob ja oder nein – ist eine sehr uninteressante Frage. Interessant wird es erst, wenn man innerhalb der Rubrik ,Kunst’ das einzelne Werk bewertet“ (Schmalenbach 1990: 191).
Ein weiterer, nicht weniger umstrittener Aspekt in diesem Problemfeld, der in unserer heutigen Zeit gerne unter der fast schon inflationär verwendeten Bezeichnung „Ästhetisierung des Alltagslebens“ diskutiert wird, ist die Beschreibung der Postmoderne als einer Haltung, die mit dem Wissen spielt, dass es kein Leben im Unmittelbaren mehr geben kann und deshalb diese Unmittelbarkeit nur mehr als Ästhetische Anspielung zitiert werden kann. Alles wird heutzutage „inszeniert“: Ausstellungen, Texte, Körper, Beziehungen, Politik etc. Dem ist jedoch entgegenzusetzen, dass das Ästhetische seine eigentliche Bedeutung nicht in der Affinität, sondern eben in der Opposition zum Alltagsleben gewinnt: „Daher ist und bleibt die ästhetische Erfahrung ein Sonderfall unserer gewöhnlichen Erfahrung. Können wir letztere beseitigen, müssten wir auf die erstere verzichten“ (Bubner 1994: 111f).
Die aktuelle Kunst nun als Kompensator zu betrachten, welche die aufbrechende inhaltliche Leere mit dieser Ästhetisierung, d.h. mit der Stilisierung des Lebens beantwortet, ist jedoch verfehlt. Hinter dem postmodernen Spiel der Formen und Farben steckt mitunter eine unbändige Sehnsucht nach dem eigentlichen Leben (vgl. Liessmann 1993: 192ff).
1.2 Der moderne Kunstbegriff und seine Problematik
1.2.1 Die kunstbegriffliche Problematik
Kunst ist allgemein jedes meisterhaft entwickelte, aus einer Fähigkeit zur Fertigkeit gewordene, vorwiegend produktive Können.[3]
Der oft bemühte, jedoch bei genauerer Betrachtung äußerst fragwürdige Konnex zwischen Kunst und Können[4], kann in Anbetracht der heutigen Kunstproblematik nicht mehr in ausreichendem Maße befriedigen. Zu oft erweist sich gerade in der theoretischen Einschätzung moderner Kunst das spezielle, rein technische Können als kein entscheidendes Kriterium mehr. Kunst selbst ist, ebenso wie die Ästhetik, die in engem Zusammenhang mit ihr zu sehen ist, ein historisch-dynamischer Prozess und dadurch sind auch die zahlreichen, geschichtlich faktisch gebundenen Begriffsperspektiven, die sich auf die Kunst richten, als durchaus historisch zeitpunktbezogen zu werten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Kunstbegriff ständig neuer interpretatorischer Orientierung bedarf.
Traditionelle Kunsttheorie forderte programmatisch, dass die Kunst die „schöne Natur“ nachzuahmen hätte und dabei höchster Bedacht auf die illusionistisch richtige Raumwiedergabe zu legen sei. Weiter noch wurde die stilistisch ausgewogene Beherrschung der thematischen Vorgabe und das völlige formalistische Kalkül, das den künstlerischen Prozess kontrollieren sollte, zur tugendhaften Vorrausetzung theoretisch hochstilisiert, um überhaupt „wahre“ Kunst produzieren zu können (Strube: 1993, 29).
Von dieser Vorstellung konnten wir uns im Laufe der Zeit schrittweise lösen und sehen uns nun heute mit einer Zersplitterung der Kunst in zahlreiche nur noch am Randzonen traditioneller Begrifflichkeit agierenden Schulen und Richtungen konfrontiert (Heilman: 1992, 64).
Kunst produziert in unserer heutigen Zeit vor allem ihren eigenen Zeitgeist, der zwar von der allgemeinen historischen Atmosphäre beeinflusst ist, diese aber durchwegs eigenständig interpretiert, und damit sehr oft auf Stimmungen reagiert, die außerhalb der „öffentlichen“ Kultur liegen (Vgl.: Loock: 1991, 102). Der künstlerische Prozess, so Loock weiter, beinhaltet somit eine bewusstseinserweiternde Funktion, die verborgene Winkel der gesellschaftlichen Situation ausleuchtet und später erst zum gefühlsmäßigen Allgemeingut einer Kultur wird.
Von eben dieser „bewusstseinserweiternden“ Funktion spricht auch das Buch „Kunstwerk und Kritik“ der „Jour fixe initiative berlin“. Kunst wird hier als eine Handlung, welche ihre Energie formal und fassbar konkretisiert und dabei in entscheidendem Maße ästhetisch vorgeht, verstanden. Sie orientiert sich ikonografisch wie stilistisch an den Gegebenheiten des situativ historischen Kontextes, um dadurch zeitbezügliche, subjektive Aussagequalität in Form von gesellschaftlich gespeister, innovativer Originalität zu erlangen (ebenda). Dieser kreativ-prozessuale Ablauf ereignet sich vor dem Hintergrund einer spezifisch historisch determinierten Kultur, die die prädisponierenden Impulse für das Kunstschaffen an sich liefert. Ein überzeitlicher Dauerhaftigkeitscharakter des physischen Bestandes oder der Bedeutung eines Kunstwerkes kann in diesem Zusammenhang nicht als zwingendes Definitionsargument fixiert werden.
1.2.2 Exkurs: Die Kommentarbedürftigkeit moderner Kunst
Um nun diese Distanz zwischen Kunstwerk und Betrachter überbrücken zu können, siedelte sich, wie Gehlen formuliert, neben dem Bild der Begleittext an. Gehlen stellt die interessante These auf, dass die Kunstkritik in dem Augenblick zum Kommentar wird, sobald die Frage „Was soll das überhaupt?“ vom Publikum gestellt wird. Die Kunst ist kommentarbedürftig geworden. Kunstwerk und Kommentar gehören nach der Auffassung Gehlens nun zusammen und werden unter Umständen vom Künstler zusammengedacht, auch wenn er die Art des Kommentars nicht voraussieht und nicht vorausbestimmt.
Die Kommentare haben nach Gehlen folgende Aufgaben (vgl.: Gehlen 1960/1990: 162ff):
1. Sie müssen den Souveränitätsanspruch der modernen Kunst rechtfertigen, weil diese sich nicht mehr an eine vorgegebene Natur oder an vorgegebene Ideenwelten anlehnt. Auf diese Mächte bezog sich früher die Kunst im allgemeinen Verständnis, auch in ihrem Selbstverständnis. Der Kommentar ließ diese Kunst vor der Frage „Was soll das?“ legitimieren. Dazu, so bemerkt Gehlen, argumentiert man gerne aus der „Künstlerpersönlichkeit“ oder mit Hilfe metaphysischer Vorstellungen, oder man weist die entwicklungsgeschichtliche Notwendigkeit des Entstehens dieser Art Kunst nach.
2. Die Kommentare haben dann die Aufgabe die Prinzipien des neuen Verfahrens zu erklären, wenn, wie im Kubismus, Expressionismus, Surrealismus etc., die Malerei zwar noch am Gegenstand bleibt, aber ein aus ihren eigenen Mitteln konstruiertes Zeichensystem benutzt.
3. Schließlich müssen die Kommentare die Ziele und Problemstellungen der Künstler plausibel machen, da sie sich ihre Aufgaben selbst stellen und im Allgemeinen die Gesellschaft keine Forderungen mehr an sie heranträgt. Das führt dazu, dass viele Kommentare dazu übergehen, den Ort der modernen Kunst im System der modernen Gesellschaft zu beschreiben.
Diese These Gehlens von der Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst soll hier nicht im Einzelnen erörtert werden, aber es sei darauf hingewiesen, dass diese Kommentarbedürftigkeit auch schon früher gegenüber Bildern empfunden wurde, die uns heute durchaus nicht erklärungsbedürftig erscheinen. Sulpiz Boisserée beispielsweise notierte 1815 in sein Tagebuch: „Jetziger Zustand der Kunst bei vielem Verdienst und Vorzug große Verkehrtheit. Maler Friedrich seine Bilder können ebenso gut auf dem Kopf gesehen werden“(Roh 148/1993: 264).
Solche kulturellen Mißverständnisse der Kritiker gegenüber zeitgenössischer Kunst sind vielleicht auf eine Besonderheit zurückzuführen, auf die Adorno einmal aufmerksam machte, indem er auf die Tatsache hinwies, dass „Stil“ das Medium ist, durch das das vom Kunstwerk Ausgedrückte in die herrschenden Formen der Allgemeinheit, die musikalische, malerische, verbale Sprache eingeht. Doch soll gleichzeitig die „Idee der richtigen Allgemeinheit“ damit versöhnt werden. Je mehr nun ein Künstler versucht, über die zu seiner Zeit bekannte Wirklichkeit hinauszugehen, desto größer wird die Diskrepanz zwischen seinem Wollen und den seiner Zeit (und damit auch ihm) zur Verfügung stehenden Stilmitteln. Das Moment am Kunstwerk, durch das es über die Wirklichkeit hinausgeht, ist in der Tat vom Stil nicht abzulösen – bemerkt Adorno – doch es besteht nicht in der geleisteten Harmonie der fragwürdigen Einheit von Form und Inhalt, Innen und Außen, Individuum und Gesellschaft, sondern in jenen Zügen, in denen die Diskrepanz erscheint, im notwendigen Scheitern der leidenschaftlichen Anstrengungen zur Identität. Anstatt sich diesem Scheitern auszusetzen, indem der Stil des Großen Kunstwerks seit je sich negiere, hat das Schwache sich immer an die Ähnlichkeit gehalten, an das Surrogat der Identität (vgl.: Adorno 1948: 50f).
Soweit zu den Bemerkungen Adornos. Zieht man nun die Konsequenzen aus diesen Überlegungen für den Kunstkritiker, wird deutlich, dass die oft gerade großen Künstler eigene Diskrepanz zwischen dem von ihnen Erkannten und den ihnen gegebenen Stilmitteln den Kritiker sehr leicht dazu verleitet, in dieser Disharmonie eine Unfähigkeit des Künstlers zu sehen. Dieser könnte doch mit den Stilmitteln seiner Zeit „akzeptierte“ Kunst schaffen, wenn er nur das anstreben würde, was seiner Zeit erstrebenswert, erkennbar und verständlich erscheint.
Nimmt man nun angesichts dieser Überlegungen die These Gehlens wieder auf, wird deutlich, wie unzulänglich sie ist, da ein Kommentar oft gar nicht möglich sein dürfte, polarisiert, oder sogar verfälscht, indem er diese Diskrepanz hinwegredet. Doch auch von einem anderen Aspekt ist die These angreifbar, denn das Nachempfinden bedarf gegenüber unverständlicher Werke keines Kommentars. Dies hat auch Paul Klee eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem er die Titel seiner Werke erst nachträglich kreierte.
1.2.3 Das Problem der Interpretation des Emotionalen
Nun findet jedoch neben der rationalen Interpretation und der Betrachtung des handwerklichen Könnens auch noch die emotionale Reaktion auf Kunst(werke) statt. Dabei sollte deutlich zwischen verstandesmäßiger Interpretation von und gefühlsmäßigen Reaktionen auf Kunstwerke unterschieden werden. Die intellektuelle Deutung stimuliert oft die emotionale Reaktion und umgekehrt, Gefühlsreaktionen färben auf rationale Reaktionen ab. Naturgemäß ist gefühlsmäßige Beteiligung eine intuitive Form der Interpretation. Ein Bild z.B., für das der Betrachter nicht empfänglich ist, wird einfach nicht wahrgenommen.
Ritual und Gewohnheit können die emotionale Teilnahme determinieren. Man kann davon ausgehen, dass der Spielraum persönlicher Reaktionen und Assoziationen desto größer wird, je höher der Grad sozialer und geistiger Emanzipation ist, aber tatsächlich bestimmen Moraltabus, Konventionen, Geschmack, Mode, usw. die Richtung emotionaler Reaktionen in der modernen Gesellschaft (Liessmann 1993: 61).
Heute kann jeder, der intuitiv begabt und überzeugt über Kunst schreibt und spricht, als eine Art Vermittler zwischen Kunstproduzent und Kunstkonsument agieren. Dieser Vermittler lenkt dabei die Emotionen moderner Gesellschaftsschichten und kann häufig auch Symbole erzeugen. Der Durchführungsprozess ist dabei jedoch recht kompliziert: denn was der Betrachter wirklich tut ist die Deutung des Interpreten nachzuinterpretieren, dessen Name zu einem Symbol für die Öffentlichkeit wurde. Nun sind aber – wie im vorigen Kapitel bereits erwähnt - professionelle Kunstkritiker in gleicher Weise, wie auch breite Gruppen der Öffentlichkeit, in ihren gefühlsmäßigen Reaktionen von offenen oder unbewusst eingenommenen theoretischen Grundeinstellungen und dem allgemeinen Diskurs in der Gesellschaft abhängig. Die Versuche, den autonomen Bereich der Künste und den Charakter ästhetischer Erfahrung zu definieren, sind – seit die Ästhetik als eigene Disziplin auftrat – kaum zufriedenstellend. Anfänglich wurde das emotionale Verständnis für das, was die ästhetische Oberfläche des Kunstwerkes genannt werden könnte, als der einzige legitime Zugang zur Kunst der Vergangenheit und der Gegenwart angesehen (Dresdner 1968: 214). Oft spricht man in diesem Zusammenhang auch von dem „sich der Einfühlung überlassen“. Der intuitive Zugang allein fängt jedoch selten die beabsichtigte Bedeutung visueller Zeichen vollständig ein. Dennoch ist es die emotionale Teilnahme, welche die Kunst zu einem lebendigen Erbe macht (Strube 1993: 59).
1.2.4 Der Kommunikationsbegriff in Hinblick auf das Phänomen des modernen Kunstbegriffs
Hierbei muss man sich einleitend die Frage stellen, ob die Entschlüsselung der künstlerischen Aussage oder die Unfähigkeit der Erstellung einer – ganz gleich ob das nun durch den Rezipienten, Kunstkritiker etc. ist – den Intentionen des Künstlers entsprechenden Interpretation, zum Kriterium werden darf, das endgültig entscheidet, ob Kommunikation vorliegt oder nicht. Damit würde an diesem Punkt das Merkmal der Verständigung wiederum zum regelnden Moment der Kommunikationsdiskussion werden; eine Betrachtungsweise, die unterstellt, dass Kommunikation nur dann erfolgt, wenn sie ungehindert und störungsfrei funktioniert. Es ist jedoch festzustellen, dass der moderne Kunstpräsentations- und Rezeptionsprozess oft von der grundlegenden Problematik des Mißverständnisses[5] betroffen ist.
Die speziellen Merkmale einer modernen Kunstaussage sind als nicht nationalistisch, antitraditionell, subjektiv und elitär einzustufen (vgl. Heilman 1992). Diese Art der Aussageform erweist sich als sehr problematisch, da sie all jene Charakteristiken aufweist um welche der als dynamisch zu verstehende Begriff der Kommunikation ringt. Wo jegliche Verbindlichkeit, Norm- und Wertvorstellungen in Frage stehen oder vom Grundsatz her verworfen werden, herrscht nur noch ein extremer Subjektivismus, der im Bereich der Kunst zum Verlust von Kommunikabilität, das heißt zu Sprachlosigkeit und damit zur Aufhebung der Kunst selbst führen muss (ebenda).
Weiters ist laut Sitt (1996: 214) festzustellen, dass diese Eigengesetzlichkeit der Kunstkommunikation zu untergliedern ist, nämlich in eine Mikro- und eine Makroebene. Dabei erfasst einerseits der Bezugsbereich der Mikrostruktur Probleme der Realisation und Rezeption und macht das ästhetische Objekt zum Zentrum und Gegenstand der kommunikativen Reflexion, andererseits erschließt die Makrostruktur den öffentlichen Charakter und die sich daraus ergebende Realisationssystematik sozialer Prägung. Diese beiden Ebenen sind natürlich nur modellhaft zu trennen; in der Praxis ergibt sich Kunstkommunikation ganzheitlich aus ununterbrochenen Wechselbeziehungen zwischen diesen beiden Ebenen.
Im Falle des modernen Kunstbegriffes erweist sich diese Verbindung als besonders schwierig und oftmalig als widersprüchlich. Zuerst wird nämlich eine nonverbale Botschaft emotional vom Betrachter mit dem ihm zur Verfügung stehenden Codes entschlüsselt, um dann diese Erfahrung in eine sprachlich-begriffliche Erkenntnis zu transformieren. Dabei erzeugen naturgemäß gerade subjektiv verkomplizierte und teilweise abstrakte Kunstäußerungen eine äußerst diffizile Interpretationsebene, welche anfällig für Mißverständnisse ist. Oftmals wird davon ausgegangen, dass wegen der Ähnlichkeit ihrer Ablaufmechanismen Massenkommunikation und die kunstkommunikative Problematik gleichzusetzen wären (Loock: 1991: 59). Diese Gleichsetzung erweist sich jedoch als nicht problemfrei; Kunstkommunikation geht von einer Aussage aus, die zwar durchaus dem Anspruch der Öffentlichkeit Folge leistet, aber in ihrer substantiellen Entstehung subjektiv gemeint ist. Andererseits zielen auch die von ihr erwarteten Wirkungseffekte, die nicht der definitorischen Norm massenkommunikativer Begrifflichkeit entsprechen, in eine konträre, um nicht zu sagen teils diametral entgegengesetzte Richtung (ebenda).
2 Der Künstler
Die im vorigen Kapitel noch teilweise isoliert thematisierten Begriffe werden nun in den konkreten Zusammenhang moderner gesellschaftlicher Bedingung gestellt. Da das Innenleben des Künstlers und die kommunikative Außenwelt in einem ununterbrochenen, beziehungsmäßigen Austausch stehen, scheint es mir notwenig, sie in einem Kapitel unter diesen Umständen zusammenzufassen. Weiters möchte ich, um exakter arbeiten zu können, an dieser Stelle die Spartenabgrenzung nach Stube anführen, welche sehr hilfreich ist um festzustellen mit welchen Begriffen in der Folge operiert werden wird.
2.1 Der Künstler im gesellschaftlichen Kontext
Da Kunst eine Art von öffentlicher Empfindung darstellt, kann sie wichtige Aufschlüsse quasi als soziologisch-methodisch zu interpretierendes Spiegelbild über die Atmosphäre einer jeweilig untersuchten Gesellschaft liefern. Dieses Verhältnis des Künstlers zu seiner geschichtlich geprägten Umwelt unterlag historisch betrachtet häufigen Veränderungen. So war die mittelalterliche Kunst in wesentlich größerem Maße funktionell ausgerichtet, als dies für die zeitgenössische westliche Kunst der Fall war. Der von der hierarchischen Sicht des Mittelalters noch durchaus als Handwerker eingestufte Künstler löste sich nun sukzessive aus den gesellschaftlichen Bindungen dieses Standes, bis er im 19. Jahrhundert sozial heimatlos wurde (Dresdner 1968: 124). Es kam während der Kunstperiode der Romantik zum Schulterschluss des Künstlertums mit der Bohème, ein „Akkulturationsprozess“, der den gesellschaftlichen Künstlertypus hervorbringt, der heute noch, wenn auch unterbewusst, im Selbstverständnis des modernen Künstlers weiterwirkt. Von dieser historischen Positionierung ist naturgemäß auch die spezifische Relation des modernen Künstlers zu seiner Gesellschaft gekennzeichnet.
Die heutige Gesellschaft tritt als kollektives Subjekt dem Künstler selbst sehr diffus gegenüber, dass heißt, dass sie keinerlei konkrete Vorstellung von den Berufsinhalten äußert, die das Künstlertum ihrer Ansicht nach haben sollte. Die höchst unpräzise Definition dieser Berufsart provoziert komplexe Orientierungsschwierigkeiten beim Künstler selbst, da die Beurteilung und Akzeptanz seiner Leistungen doch substantiell an gesellschaftliche Urteile gebunden bleibt. Diese Beurteilung drückt sich naturgemäß auch monetär aus und bedeutet eine finanzielle Abhängigkeit des Künstlers von der Gesellschaft. Das meinte unter anderen bereits Herbert Read 1957 und dieses Problem erörtert auch Zembylas Tasos 40 Jahre später:
„Ich sage Scheinfreiheit, weil der Künstler schließlich entdecken musste, dass er bloß eine Abhängigkeit gegen eine andere vertauscht hatte. Von nun an [Renaissance] mochte er ungehindert sein Ich ausdrücken, doch unter der Bedingung, dass der Ausdruck verkäufliche Ware ist; er geriet also in eine Art wirtschaftlicher Knechtschaft, die bis heute noch besteht und die sich nicht weniger erniedrigend erwiesen hat als die geistige Knechtschaft vorhergehender Jahrhunderte“ (Read 1957: 76).
„In der gegenwärtigen Gesellschaftsstruktur ist die Situation künstlerischer Produktion durch die Abhängigkeit von gesellschaftlicher Anerkennung gekennzeichnet“ (Zembylas 1997: 132).
Der Künstler muss also demnach danach trachten, die von der Gesellschaft von außen an ihn herangetragenen, für ihn nie genau entschlüsselbaren Ansprüche mit seinen persönlichen, individuellen Anliegen, nämlich die empfundene Realität schöpferisch subjektiv zu interpretieren, in Einklang zu bringen. Dies führt zu folgenden möglichen Szenaren: Der zeitgenössische Künstler, der oftmals Tradition und Werte, die eine Gesellschaft teilt, nicht akzeptiert, bricht die für eine wirkliche Sozialintegration notwendige Interaktion mit dieser ab (Vgl.: Groys 1997: 56). Der verbleibende schwache, von Mißverständnissen beeinträchtigte Kommunikationsstrang stellt einen äußerst dürftigen Kontaktkanal dar, der kaum geeignet erscheint, die Außenwelt mit der „Künstlerwelt“ in ausreichender Weise zu verbinden. Der Künstler schreitet ungewollt, vereinfacht gesagt, den Weg der Isolation ein. Herbert Read (1957: 84) meint hierzu „Wäre der Künstler zur Isolierung verurteilt, würde er steril. Er hofft und vertraut, dass die wenigen, bei denen er Anklang findet, einen weiteren Kreis beeinflussen und dass dadurch im Laufe der Zeit seine Wahrheit und Weisheit von der breiten Masse angenommen und Teil der Kultur seiner Epoche werden. Solcherart ist auch der Integrationsprozess, von dem die Anthropologen sprechen.“
Die zweite Möglichkeit, den - nicht zuletzt um auch finanziell erfolgreicher zu sein - der Großteil der Künstler heute bestreitet, ist die aggressive Selbstinszenierung und die daraus entstehende bewußte Manipulation des Bildes, welches die Öffentlichkeit von dem Künstler hat. Dazu meint Zembylas Tasos: „Deshalb hat die Selbstinszenierung der KünstlerInnen eine essentielle Bedeutung für ihre berufliche Laufbahn. Genauso wie ein Arzt, der in seiner Praxis sauber und gepflegt angezogen sein muss, um ein bestimmtes Image von sich zu schaffen, muss der/die KünstlerIn ein eigenes Bild von sich aufbauen. Die Selbstinszenierung als Stilisierung des Veraltens und als Selbstpräsentation (Kleidung, Sprache u. ä.) – sie muss „authentisch“ erscheinen – wird vom Publikum erwartet. Die Selbstinszenierung ist eine rituelle Form der Kunstvermittlung. Außerdem wird von KünstlerInnen erwartet, dass sie sich individuell positionieren und von anderen abgrenzen und, was sehr wichtig ist, ihr Dasein dramatisieren“ (Zembylas 1997: 104).
Diese beiden Positionen des Künstlers in der Gesellschaft korrelieren mit seinem außergewöhnlich hohen Maße an Identitätssuche. Künstlertum bietet die Chance, einen Beruf wählen zu können, der eine optimale Ich-Verwirklichung verheißt (vgl. Zembylas 1997: 121). Trotzdem, oder gerade deswegen ergeben sich vielfach Identitätskonflikte im Künstler selbst, da die radikale Realisation der Selbstverwirklichung in Form der Abkehr von allgemeingültigen Sozialnormen einerseits gelingen muss, um persönliche individuelle Originalität erzielen zu können, ohne dass dabei andererseits gänzlich der Kontakt zu der von „allgemeinen“ Kultur bestimmten Realität verloren gehen darf.
Die Aussagen der Kunst orientieren sich unter diesen Vorraussetzungen an der jeweilig vorhandenen gesellschaftlichen Atmosphäre, die sie aber nicht logisch sprachlich oder gar wissenschaftlich reflektiert, sondern unter Zuhilfenahme ihrer eigenen Methoden umsetzt. „Seine [die des Künstlers] primäre Funktion, und die einzige, die ihm seine außerordentlichen Vorzüge gibt, besteht darin, das Triebleben der tiefen psychischen Bereiche objektivieren zu können. Was diese Vereiche betrifft, dürfen wir annehmen, dass ihre Vorstellungen kollektiven Charakter besitzen. Gerade weil der Künstler diesen unsichtbaren Phantasmen sichtbaren Ausdruck geben kann, vermag er uns so tief zu bewegen“ (Read 1957: 101).
Die Wahl dieser einzigartigen und zumeist optischen Mitteilungssprache beinhaltet den Nachteil einer erschwerten Verstehbarkeit, andererseits aber können Bereiche spontan thematisiert werden, deren kompatible Erörterung die Möglichkeit der rationalen Sprache überfordern würde. Nicht aussprechbare Gedanken können also mit Kunst ausgedrückt werden, und deswegen entsteht ein umfassender als auch ergänzender gesellschaftlicher Anspruch der Kunst in Bezug auf ihre kommunikative Funktion. Unter den gegebenen, auch soziologisch geprägten Schwierigkeiten zwischen Künstler und Gesellschaft geschieht es leider häufig, dass nur ein geringer Teil der künstlerischen Mitteilungen von der Gesellschaft sinnadäquat rezipiert und ihrer Kultur einverleibt wird. Die bestehenden Normen und Schemata einer Gesellschaft bilden einerseits den Hintergrund für das Erleben, die Interpretation und die Kritik ästhetischer Produktion (Welsch 1991: 81), was seine Ursachen darin hat, dass, wie bereits erwähnt, verschiedene spezielle Rollen von Künstler und Rezipienten existieren. Der Kunstrezipient urteilt zumeist nicht direkt über das erlebte Kunstwerk selbst, sondern vielmehr über sein soziokulturell geprägtes und erlerntes Verhalten ihm gegenüber. Das bedeutet, dass der Rezipient von Kunst nicht vorurteilslos eine ästhetische Aussage aufnimmt und verarbeitet, da sein Urteilsvermögen von vorgefassten Meinungen besetzt ist, die ihm meistens durch Kritik in den Medien angeboten werden.
2.2 Der Künstler im medienspezifischen Kontext
Um sich diesem Teilbereich nähern zu können, erachte ich es für notwendig zuerst einmal die wesentlichen und charakteristischen Unterschiede zwischen dem Kunstwerk und dem massenmedialen Produkt festzuhalten:
1. Massenmediale Produkte verfolgen publizistische Zwecke – Kunstwerke können zum reinen Selbstzweck geschaffen werden.
2. Massenmediale Produkte sind in ihren Aussagen zumeist der Faktizität unterworfen – Kunstwerke können sich eigene Welten schaffen.
3. Massenmediale Produkte sind an aktuelle Tagesgeschehen gebunden - Kunstwerke können sowohl aktuelle Inhalte aufweisen, wie überzeitlichen Charakter besitzen (Vgl.: Delincée 1996: 86ff).
2.2.1 Mißverständnisse im Kommunikationsprozess
Die deutlichen Unterschiede in der Bestimmung beider Phänomene bedeuten aber per se noch nicht, dass automatisch bei der Beschäftigung der Medien mit der Kunst Mißverständnisse, Verzerrungen und Manipulationen auftreten müssen. Die spezielle Beschaffenheit der Medien selbst[6] verhindert bereits eine lückenlose publizistische Bearbeitung moderner Kunstprozesse, da die äußerst diverse Quantität neugeschaffener Kunstproduktion quasi mediensubjektiv strukturiert wird. Dadurch werden auch in der Kunstwelt durch Schwerpunktsetzungen der Medien Werte und Wirklichkeiten konstruiert.
Die Medien greifen also gezielt ausgewählten Kunstaussagen verstärkend unter die Arme und erhöhen somit deren kommunikative Wirksamkeit. Wie schon in den vorigen Kapiteln angedeutet, ist der Rezipient in Zusammenhang mit zeitgenössischer Kunst, die sich oftmals in abstrakter und subjektiver Form darstellt, auf mediale Unterstützung angewiesen. Für das Einlassen des Rezipienten auf ein ästhetisches Kommunikationsverhältnis ist eine (Vor)information über die künstlerische Realisation und das Ergebnis ihrer Präsentation notwendig. In der Folge erscheint es daher wichtig, dass die Mitteilungen des Künstlers, die Botschaft seiner Arbeit, durch die Medien in adäquater Weise auf die Ebene der Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache transferiert werden. Dabei sollte der Verlust an vorgegebenen Kulturinhalten möglichst gering gehalten werden, nicht zuletzt um ungewollte Mißverständnisse zu vermeiden. Um dies zu bewerkstelligen, muss der von Künstlern und Journalisten im Kommunikationsprozess eingesetzte Zeichenvorrat zur Deckung gebracht werden. Da aber die höchst problematische Umsetzung von ästhetischen künstlerischen Formen in sprachliche Zeichen von einer Presse vorgenommen werden muss, die, wie oben erwähnt, Aktualitätszwang und auch ökonomischen Interessen unterworfen ist, kann eigentlich keine wirklich fachgerechte Thematisierung der Kunst von dieser Seite erwartet werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass Verfälschungen der elitären, künstlerisch primär initiierten Kommunikation auftreten, sobald diese von den Medien aufgegriffen und nach ihren Gesichtspunkten bearbeitet und dargestellt wird.
Ein sehr anschauliches Beispiel hierzu bietet der folgende Auszug aus einem Interview, welches Gerald Matt, Direktor der Kunsthalle Wien, mit Elke Krystufek 2003 geführt hat (Matt 2003: 94 & 97):
GM: „Gibt es einen Punkt, an dem Zuordnungen, Kategorisierungen Ihrer Arbeit, ja Ihrer Persönlichkeit durch die Kunstöffentlichkeit das Maß überschreiten, das sie einkalkuliert haben und wenn ja, wie reagieren Sie darauf?“
EK: „Zu Ihrer Frage gibt es gerade eine aktuelle Problematik eines über mich kürzlich im ORF gezeigten Films mit dem seltsamen, nicht näher erklärten Titel ´2001 und 1 Nacht – Das fatale Schicksal des Voyeurs´, bei dem ein unbekannter mitteljunger Regisseur, nachdem er mir uneingeschränktes Mitspracherecht versprochen hatte und unter dem Vorwand ein Elke Krystufek Portrait machen zu wollen (nach dem Scheitern dieses Unterfangens wurde der Film dann als ´Kein Elke Krystufek- Portrait´ untertitelt), Dokumentationsmaterial von Performances und Ausstellungseröffnungen von mir an eine geldgierige österreichische Filmfirma verkaufte und diese Firma dann alles üblicherweise ab- oder anstößig empfundene Material, das Blut, Gewalt oder sexuelle Bilder enthielt sowie alle Textelemente meiner Arbeit, die den Betrachter etwas erklären könnten, und die gesamte Originalmusik aus meinen Performances herausschnitt und dann die geschönte, cleane und von Inhalten gereinigte Version an den ORF verkaufte, damit er seinem Publikum ein Elke Krystufek-Portrait präsentieren kann, das absolut gar nichts mit der Realität zu tun hat. Die als Reaktion gestarteten juristischen Mühen sind noch am Laufen…“
GM: „Irritation als Teil des Kunstprinzips beinhaltet das Risiko der Fehlinterpretation, des Übersehens von Zusammenhängen, die zur Erkenntnis des Beabsichtigten womöglich wichtig sind. … Gab es eine Schere zwischen Ihren Erwartungshaltungen und den Reaktionen des Publikums/ der Kunstkritik, die Sie an eine Änderung der Konzeption öffentlicher Performances denken ließ?“
EK: „Die Schere war so groß, dass ich die drei darauf folgenden Jahre auf Performancearbeiten weitgehend verzichtete…“
Wie läßt sich eine derartige Differenz zwischen der beabsichtigten Aussage des Künstlers in seiner Arbeit und den präsentierten Inhalten in den Medien erklären? Ein zentrales Bezugsmoment bildet dabei die publizistisch-wissenschaftlich interessante Frage nach der Konditionierung kultureller Aktivität durch Aussagen sekundärer Kommunikation, besonders durch die Massenmedien (Weischenberg 1992: 154). Kunst wird also aus ihren eigenen kommunikativen Zusammenhängen gerissen und in neue, medienspezifischen Grundsätzen folgende Verhältnisse gesetzt. Dabei besteht die Gefahr, dass die ursächliche Kunstaussage in ihrem Wesen selbst durch ihre Anpassung an die Medienbedürfnisse verändert wird und durch ebendiese „Metamorphose“ letztendlich eine neue Aussage entsteht, die prinzipiell von der Presse konstruiert und verbreitet wird. Die grundsätzliche Möglichkeit der Einflussnahme entsteht allerdings erst durch die Mechanismen des gesamten Kommunikationsprozesses, der durch die instabile Relation zwischen primärem Kommunikator, dem Künstler, und endgültigem Rezipienten, dem Publikum, gekennzeichnet ist. Dazwischen steht der Kritiker als Filter, der seinerseits die komplexen Kunstaussagen selektioniert und danach publikumskompatibel aufbereitet.
2.2.2 Der mediengerechte Künstler
Auch Kritiker können sich dem Kanon zum Teil nicht entziehen. Katalogtexte und vormalige Rezensionen sind in vielen Fällen Basis und Anknüpfungspunkte für weitere Besprechungen. Heinz Ohff meint hierzu in der Reihe Hanser: „Kunstbibliotheken sollten heutzutage weniger Kunstbücher als vielmehr Ausstellungskataloge sammeln. In ihnen geschieht das, was eigentlich in der Kritik überhaupt geschehen sollte, leider nicht geschehen kann, weil die Verhältnisse nicht so sind: in Worten klarmachen, was in Werken da ist. Hier würde ich die Kritik der Kritik ablehnen. Da hat niemand dreinzureden. Das ist Sache des Künstlers und des Formulierens der Definition. Kritik (meinetwegen: subjektiv) at its best“ (Ohff 1970: 117).
Was einmal prägnant über einen Künstler gesagt worden ist, wird häufig wiederholt (Roh 1948/1993: 65). Die für die Medien spezifisch relevante gesellschaftliche Wirklichkeit resultiert aus der Einschätzung der charakteristischen Eigenheiten ihres Publikums, das aus der Sicht dieser Medien im Zusammenhang mit der Präsentation künstlerischer Aussagen im wesentlichen an der Popularisierung künstlerischer Thematik interessiert zu sein scheint. Dies würde weiters dazu führen, dass die Medien im Allgemeinen und Tageszeitungen im Speziellen vor allem an dem Unterhaltungswert, den der kunstkommunikative Prozess unter anderem beinhaltet, interessiert sind. Die Person des Künstlers erscheint dabei oft von größerer Brauchbarkeit für die kunstinterpretatorischen Medienbedürfnisse zu sein, als die inhaltliche Beschäftigung mit den Aussagen der Kunstwerke selbst.
Diese Kausalität wirkt jedoch auch in die andere Richtung; Wie in keinem anderen Beruf ist die Performance der KünstlerInnen so essentiell für die Etablierung ihrer Reputation. Denn im Rahmen der herrschenden Ästhetik ist es unglaubhaft, dass ein künstlerisches Meisterwerk aus den Händen eines gewöhnlichen, unauffälligen Menschen stammen kann. Dieses Vorurteil zwingt die Künstlerinnen, die Erwartungen des Publikums nach Exzentrizität und Dramaturgie zu erfüllen (Vgl.: Zembylas 1997: 122).
Von einer anderen Seite betrachtet Sitt dieses Phänomen: „Das Kriterium der Persönlichkeit wird einerseits als unangebracht empfunden, als Eindringen in die Privatsphäre, andererseits sollen gerade Künstler-Psychogramme und Atelierbesuche Einblick in das Mysterium der „Kochkunstfertigkeiten“ eröffnen. Die Tendenz, den Künstler wieder mit Interesse zu betrachten, ist wohl durch die Tatsache ausgelöst worden, dass allein der Wahlakt ein Objekt zum Kunstwerk zu machen vermag (1992: 221).“
Inwieweit sich die beiden Kommunikationsansätze, der Selektions- und Adaptionsprozess der Medien, sowie die gewollte Selbstinszenierung der Künstlerpersönlichkeiten für die Medien beeinflussen, wird in weiterer Folge, vor allem mit Hilfe der Interviews, zu untersuchen sein.
3 Der Kritiker
3.1 Der Kunstkritiker als Instanz
„Die Kunstkritiker sind ängstlich darauf bedacht, sich vor den Kollegen keine Blöße zu geben. Eine Blöße gibt sich, wer die Augen aufreißt und sieht, wer das, was er sieht und was es in seinem Kopf bewegt, schildert, in schlichten Worten. Deshalb: Sollten Sie mit aller Leidenschaft Kunstkritiker werden wollen – seien Sie bereit, sich die ,Blöße´ des Beharrens auf Ihrer eigenen Wahrnehmung zu geben!“ (Heß 1991: 129).
Der ideale Kunstkritiker sollte durch seine individuelle Vorgangsweise und seine subjektiven Kriterien, auf welche er jedoch Einsicht gewährt, Interesse beim Leser wecken, indem er eine Position bezieht, die er objektiv begründen kann, damit der Leser in die eröffnete Diskussion einsteigen und seine Meinung der des Kritikers entgegenhalten kann. Für den Kritiker ist dies jedoch ein riskantes Wagnis, wenn er seine Autorität als „Instanz“ wahren will. Dazu meint Walser in einem Essay „Tagtraum, dass der Kritiker ein Schriftsteller sei“ Folgendes: „Es ist verständlich, dass die Kritiker, die so vorgehen, sich selbst kaum mehr ins Spiel bringen können. Sie funktionieren als öffentliche Sachverwalter, sie scheinen sich zu verstehen, als Bewehrter als Schiedsrichter. Selbst wenn es manchen von ihnen selber davor graut: sie werden zu Instanzen. Und daran sind sie selber schuld. Ich kann mir vorstellen, dass es kein Vergnügen ist, eine Instanz zu sein. Die damit verbundene Macht muss schmerzlich sein für den Kritiker, der als Schriftsteller doch auch professioneller Beobachter seiner selbst ist. Wer von den kritisierenden Schriftstellern diese Macht annimmt und sich ihrer gar bedient, ist natürlich verloren. Seine Sprache wird zum Teufel gehen. Schuld an der Erniedrigung des Kritikers zur Instanz ist der leichtfertige Umgang mit dem Urteilsvokabular“ (Walser 1970: 12).
Dabei hat der Kritiker in diesem Betrieb nicht die uneingeschränkte Macht. „Er kann einen Künstler gewiss nicht entdecken und pushen, wie die Leute oft glauben. Er reagiert bloß auf das, was immer schon stattgefunden hat. Wenn der Kritiker für einen Katalog schreibt, wird dieser von den gleichen Leuten bestellt und bezahlt, die den Künstler ausstellen, über den er schreibt. Wenn der Kritiker für eine Zeitschrift oder eine Zeitung schreibt, schreibt er wiederum über eine Ausstellung, von der man immer schon weiß, dass sie es verdient, erwähnt zu werden. Der Kritiker hat also gar keine reale Chance, über einen Künstler zu schreiben, wenn dieser nicht ohnehin schon etabliert ist. Seine Wertschätzung des Künstlers kommt also immer zu spät. (…) Durch die Jahrzehnte der künstlerischen Revolutionen, Bewegungen und Gegenbewegungen wurde das Publikum in diesem Jahrhundert endgültig zur Einsicht gebracht, dass eine negative Rezension sich von einer positiven nicht unterscheidet. Oder vielleicht sogar, dass eine negative Rezension für einen Künstler besser ist als eine positive“, führt Groys den Gedanken fort (1997: 22).
Diese Negation der Macht des Kunstkritikers hat für den Bereich der Bildenden Kunst noch ein gewisses Maß an Berechtigung. Denn hier kann sich der Kunstkritiker nicht irren. „Sicherlich wird den Kritikern immer wieder vorgeworfen, eine bestimmte Kunst falsch eingeschätzt oder interpretiert zu haben. Dieser Vorwurf ist aber unbegründet. (…) Der Künstler ist dagegen durchaus imstande, sich zu ändern und seine Arbeit dem theoretischen Ansatz und dem Urteil des Kritikers anzupassen. Wenn der Künstler das nicht tut – dann ist es seine eigene Schuld“ (Groys 1997: 24). Im Bereich der Literaturkritik ist jedoch laut Hamm „die Autorität des Kritikers so groß geworden, dass sogar viele Autoren schon beim Schreiben den Kritiker vor Augen haben, der einmal über sie entscheiden wird, die Art der Konsumtion entscheidet da bereits über die Produktion“ Der Großkritiker, will er es bleiben, darf sich keine Abstinenz von Kritik erlauben – er ist sonst aus dem Geschäft. Außerdem darf er es sich nicht erlauben, seine Position als fragwürdige einzugestehen, Abhängigkeiten zuzugeben, er muss als Instanz auftreten statt als Person, d.h. er muss seine Kategorien verabsolutieren (Vgl.: Hamm 1970: 13).
Diese Kategorien, oder Faktoren, die nach Venturi dem kritischen Urteil über Künstler und Kunstwerk zugrunde liegen, sind:
1. Der pragmatische Faktor, wie er durch das zu beurteilende Kunstwerk selbst gegeben ist.
2. Der ideelle Faktor, der durch die ästhetischen Auffassungen des Kritikers gegeben ist.
3. Der psychologische Faktor, der von der Persönlichkeit des Kritikers abhängt. (Vgl.: Venturi, Lionello 1983: 23).
Den oftmals geäußerten „Allerwelteinwand der Relativität von Kritik“ lässt Venturi bezugnehmend auf Adorno[7] nicht gelten. „Die subjektiven Reaktionen des Kritikers, die gelegentlich Kritiker selbst, um ihre Souveränität zu dokumentieren, für zufällig erklären, sind nicht der Objektivität des Urteils entgegengesetzt, sondern dessen Bedingung. (…) An der Moral des Kritikers wäre es, den Eindruck durch ständige Konfrontation mit dem Phänomen zur Objektivität zu erheben. (…) Kritiker sind schlecht nicht dann, wenn sie subjektive Reaktionen haben, sondern wenn sie keine haben, oder wenn sie undialektisch dabei verharren und Kraft ihres Amtes den kritischen Prozess sistieren, zu dem sie ihr Amt verpflichtet. Der Verfall von Kritik als eines Agens der öffentlichen Meinung offenbart sich nicht durch Subjektivismus, sondern durch Schrumpfung von Subjektivität, die sich als Objektivität verkennt (Vgl.: Venturi, Lionello 1983: 23).
Zurückkehrend auf den Aufruf von Heß zu mehr Mut, fordert auch Martina Sitt den Kunstkritiker auf, nicht bei oberflächlichen Beschreibungen zu verharren, sondern den Mut zu Wertungen aufzubringen: „Kritiker und sogar Kunsthistoriker müssen sich im Geschäft der Kritik die Hände schmutzig machen, statt sie wie bisher im Fahrwasser der Objektivität zu waschen und via vermeidlichen Berufsethos zu antworten: Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse!“ (Sitt 1993: 144).
Greenberg, der wahrscheinlich einflussreichste Kunstkritiker des zwanzigsten Jahrhunderts, meinte auf die Frage, wofür seiner Meinung nach der Kunstkritiker eigentlich gut sei: „Er soll auf die Kunst aufmerksam machen. Deshalb ist das Wichtigste, das einen Kunstkritiker ausmacht, die Fähigkeit, Werturteile zu fällen – Urteile darüber, was er schätzt und was er nicht schätzt. Ich glaube, ein Kunstkritiker sollte seine eigenen Präferenzen offen legen und auch seine Abneigungen. Und idealerweise sollte er – indem er das tut – den Leser einladen, die Kunstwerke, um die es geht, selbst zu betrachten, um festzustellen, ob er mit dem Kritiker übereinstimmt“ (Greenberg zit. Nach Lüdeking 1995: 230f).
[...]
[1] Foucault meint hierzu in „Was ist Kritik“, dass auch Kritik diesen Abhängigkeiten ausgesetzt ist. „Schliesslich existiert die Kritik nur im Verhältnis zu etwas anderem als sie selbst: Sie ist Instrument, Mittel zu einer Zukunft oder zu einer Wahrheit, die sie weder kennen, noch sein wird, sie ist ein Blick auf einen Bereich, in dem sie als Polizei auftreten will, nicht aber ihr Gesetz durchsetzen kann“ (Foucault 1992: 8).
[2] (vgl.) Schneider, Helmut: Die Zeit, 26.6. 1991, S. 39
[3] Lexikon der Kunst, 2001: 772
[4] Max Ernst meint hierzu: „Dieses ,Können’ (…) setzt voraus, dass auch das Publikum und vor allen Dingen der Kritiker etwas ,kann’. Der Kritiker muss in der Form, die der Künstler gestaltet hat, das Erlebnis wieder entdecken, wiedererleben können. Wenn er obendrein über das, was er von einem Kunstwerk erlebt hat, sich sprachlich ausdrücken kann, dann hat er das Recht, über Kunst zu schreiben. Vielleicht sogar über Kunst zu urteilen“ (Max Ernst, in: Bonner Volksmund 1912, abgedruckt in: Max Ernst-Retrospektive, Stuttgart 1979)
[5] Vgl. 2.3
[6] Vgl.: Schlüter, Hans-Joachim: Zeitungs-Journalismus: Darstellungsformen in Reitan, Claus (Hg.): Praktischer Journalismus 2004
[7] Venturi bezieht sich hier auf Adornos Einleitung in die Musiksoziologie
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832494704
- ISBN (Paperback)
- 9783838694702
- Dateigröße
- 835 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- künstler kausalität kommunikation werturteil kultur
- Produktsicherheit
- Diplom.de