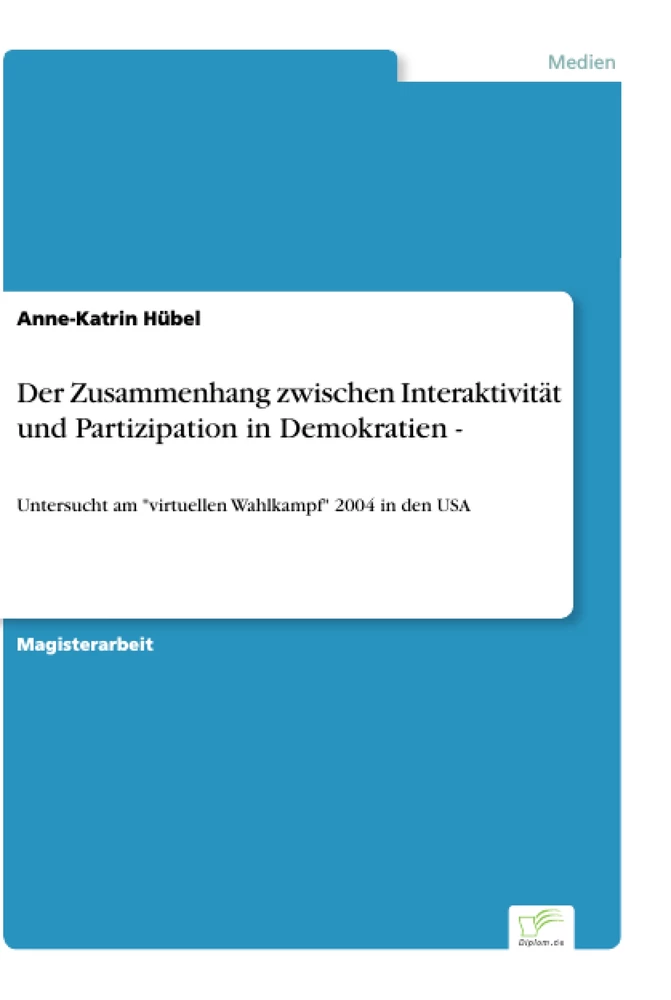Der Zusammenhang zwischen Interaktivität und Partizipation in Demokratien -
Untersucht am "virtuellen Wahlkampf" 2004 in den USA
©2005
Magisterarbeit
214 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Magisterarbeit widmet sich dem Potenzial zu Interaktivität auf Wahlkampfwebsites und sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu politischer Partizipation der Internetnutzer.
Obgleich der moderne Wahlkampf auf absehbare Zeit in erster Linie ein Fernsehwahlkampf bleiben wird, verspricht parallel dazu das Aufkommen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien einen Wandel politischer und gesamtgesellschaftlicher Kommunikation. Das Aufbrechen bislang hierarchischer Kommunikationsrollen, gesteigertes Interesse der Wahlberechtigten und das Aufblühen öffentlicher Debatten im Cyberspace werden von den einen erhofft, von den anderen befürchtet.
Da sich das Internet als ein zeitgemäßes und praktikables Instrument der Information, Kommunikation und Organisation erwiesen hat, ist es für politische Parteien und Kampagnen obligatorisch geworden, sich des Mediums zu bedienen. Dieser Modernisierungsprozess transformiert seit Mitte der 1990er Jahre von den Vereinigten Staaten ausgehend den Ablauf und das Aussehen von Wahlkämpfen die Notwendigkeit, den virtuellen Wahlkampf in die Offline-Kampagne zu integrieren, ist weitgehend unbestritten.
Das Internet als Prototyp der computervermittelten Kommunikation eröffnet einen neuen, integrierten, kontextvariablen und damit beeindruckend umfassenden Interaktionsraum für die Menschen. In ihrer Wirkung richten sich informationstechnische Innovationen unmittelbar auf die Veränderung der gesellschaftlichen Elementaroperation der Kommunikation und damit auf die Veränderung der Gesellschaft selbst. Aussagen dieser Art werden in Kapitel 3 im Zusammenhang mit der Diskussion um den technisch induzierten Wandel von Politik und Gesellschaft erörtert. Sie lassen sich auf die spezifischen Merkmale des Netzes, wie zum Beispiel Hypertextualität, die Fähigkeit zu multimedialen Darstellungen, die Möglichkeit bidirektionaler, synchroner und asynchroner Kommunikation sowie das große Volumen und die hohe Geschwindigkeit der Datenübertragung, zurückführen. Als Spezifikum neuer elektronischer Kommunikationsräume und Abgrenzung zu den sogenannten traditionellen Medien gilt aber vor allem das Potenzial des Internets, Interaktivität zu erlauben. Mit diffusen Bedeutungszuweisungen versehen, dient der Begriff verbreitet als Projektionsfläche für zahlreiche gesellschaftliche Utopien und als Ankerpunkt vieler Hoffnungen auf eine Revitalisierung politischer Kommunikation und Verbesserung bürgerlicher […]
Die Magisterarbeit widmet sich dem Potenzial zu Interaktivität auf Wahlkampfwebsites und sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu politischer Partizipation der Internetnutzer.
Obgleich der moderne Wahlkampf auf absehbare Zeit in erster Linie ein Fernsehwahlkampf bleiben wird, verspricht parallel dazu das Aufkommen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien einen Wandel politischer und gesamtgesellschaftlicher Kommunikation. Das Aufbrechen bislang hierarchischer Kommunikationsrollen, gesteigertes Interesse der Wahlberechtigten und das Aufblühen öffentlicher Debatten im Cyberspace werden von den einen erhofft, von den anderen befürchtet.
Da sich das Internet als ein zeitgemäßes und praktikables Instrument der Information, Kommunikation und Organisation erwiesen hat, ist es für politische Parteien und Kampagnen obligatorisch geworden, sich des Mediums zu bedienen. Dieser Modernisierungsprozess transformiert seit Mitte der 1990er Jahre von den Vereinigten Staaten ausgehend den Ablauf und das Aussehen von Wahlkämpfen die Notwendigkeit, den virtuellen Wahlkampf in die Offline-Kampagne zu integrieren, ist weitgehend unbestritten.
Das Internet als Prototyp der computervermittelten Kommunikation eröffnet einen neuen, integrierten, kontextvariablen und damit beeindruckend umfassenden Interaktionsraum für die Menschen. In ihrer Wirkung richten sich informationstechnische Innovationen unmittelbar auf die Veränderung der gesellschaftlichen Elementaroperation der Kommunikation und damit auf die Veränderung der Gesellschaft selbst. Aussagen dieser Art werden in Kapitel 3 im Zusammenhang mit der Diskussion um den technisch induzierten Wandel von Politik und Gesellschaft erörtert. Sie lassen sich auf die spezifischen Merkmale des Netzes, wie zum Beispiel Hypertextualität, die Fähigkeit zu multimedialen Darstellungen, die Möglichkeit bidirektionaler, synchroner und asynchroner Kommunikation sowie das große Volumen und die hohe Geschwindigkeit der Datenübertragung, zurückführen. Als Spezifikum neuer elektronischer Kommunikationsräume und Abgrenzung zu den sogenannten traditionellen Medien gilt aber vor allem das Potenzial des Internets, Interaktivität zu erlauben. Mit diffusen Bedeutungszuweisungen versehen, dient der Begriff verbreitet als Projektionsfläche für zahlreiche gesellschaftliche Utopien und als Ankerpunkt vieler Hoffnungen auf eine Revitalisierung politischer Kommunikation und Verbesserung bürgerlicher […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9447
Hübel, Anne-Katrin: Der Zusammenhang zwischen Interaktivität und Partizipation in
Demokratien - Untersucht am "virtuellen Wahlkampf" 2004 in den USA
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Universität Leipzig, Magisterarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ... 4
2. Interaktivität ... 7
2.1 Ein neuer Begriff für eine alte Idee? ... 8
2.2 Der begriffliche Ursprung ,,Interaktion" ... 12
2.2.1 Das Konzept der Interaktion in der Soziologie ... 13
2.2.2 Das Konzept der Interaktion in der Informatik ... 14
2.2.3 Das Konzept der Interaktion in der Kommunikations- und Medienwissenschaft .. 14
2.2.4 ,,Interaktion" = ,,Interaktivität"?... 15
2.3 Systematisierung vorhandener Definitionen ... 16
2.3.1 Kommunikationswissenschaftliche Definitionen von Interaktivität ... 18
2.3.1.1 Betonung auf der Technologie ... 18
2.3.1.2 Betonung auf der Umgebung der Kommunikation (Communication Setting) ... 20
2.3.1.3 Betonung der Wahrnehmung ... 22
2.3.2 Mehrdimensionale Definitionen von Interaktivität ... 23
2.3.2.1 Zweidimensionale Konzeption von Interaktivität ... 23
2.3.2.2 Dreidimensionale Konzepte von Interaktivität ... 24
2.3.2.3 Vierdimensionale Konzeption von Interaktivität ... 26
2.3.2.4 Fünfdimensionale Konzeption von Interaktivität... 27
2.3.2.5 N-dimensionale Konzeption von Interaktivität ... 29
2.4 Gemeinsamkeiten der Definitionen und ,,Neudefinition" von Interaktivität ... 30
2.4.1 Gemeinsamkeiten der bisherigen Definitionen ... 30
2.4.2 ,,Neudefinition" des Begriffes ... 33
2.5 Zweck und Grenzen von Interaktivität... 34
2.5.1 Wirkungen und Zwecke von Interaktivität... 34
2.5.2 Grenzen von Interaktivität... 37
3.
Partizipation ... 39
3.1 Begriff und Formen der Partizipation ... 40
3.1.1 Definition politischer Partizipation ... 40
3.1.2 Konventionelle Formen und Determinanten politischer Partizipation... 41
3.1.3 Funktionen und Realität politischer Partizipation ... 43
3.2 Politische Partizipation im Rahmen des Internets... 46
3.2.1 Politischer Netzoptimismus... 47
3.2.2 Netzpessimisten und -skeptiker... 50
3.2.2.1 Kritik an Optimisten... 50
3.2.2.2 Politischer Netzpessimismus... 51
3.2.2.3 Normalisierung und Verstärkung existierender Verhältnisse ... 52
3.2.3 Relativierung: Die Potenziale des Internets ... 54
3.2.4 Interaktivität als Voraussetzung für politische Partizipation?... 58
4. Das Internet als Werkzeug der politischen (Wahlkampf-)Kommunikation... 60
4.1 Online-Wahlkampf Das Internet im Wahlkampf der USA ... 62
4.1.1 Die virtuelle Wahlkampfarena ... 62
4.1.2 Funktionen und Elemente von Kandidatenseiten im Wahlkampf... 63
4.1.3 Vorteile, Nachteile und Implikationen des ,,virtuellen" Wahlkampfes... 68
4.1.3.1 Vor- und Nachteile des ,,virtuellen" Wahlkampfes für Kandidaten und Wähler. 68
4.1.3.2 Implikationen für den Online-Wahlkampf und die Wahlkämpfer ... 71
2
4.2 Die Entwicklung des Online-Wahlkampfes in den USA ... 73
4.2.1 Der ,,virtuelle" Wahlkampf 1996 ... 74
4.2.2 Der ,,virtuelle" Wahlkampf 2000 ... 75
4.3 Der Wahlkampf 2004 ... 78
4.3.1 Die Situation 2004 und allgemeine Trends des Wahlkampfes ... 78
4.3.2 Die Nutzung des Internets durch die Präsidentschaftskandidaten ... 79
4.3.3 ,,Online Political Citizens" die Zielgruppe der einflussreichen Multiplikatoren . 81
4.4 Zusammenfassung ... 83
5. Empirische Untersuchung: Strukturanalyse der beiden Kandidatenseiten ... 85
5.1 Die Analyse von Online-Kommunikation neue Wege mit Hilfe ,,alter" Methoden?.. 85
5.1.1 Chancen und Vorteile für die Analyse des Internets... 85
5.1.2 Herausforderungen des Internets... 86
5.1.3 Implikationen und Lösungsansätze für die Analyse von Websites... 89
5.2 Vorbemerkungen zur Strukturanalyse der Kandidatendomains des Wahlkampfes 2004
... 91
5.3 Planung und Vorbereitung der Strukturanalyse ... 94
5.3.1 Definition und Operationalisierung der Begriffe ... 94
5.3.1.1 Wahlkampfwebsite/ Kandidatenwebsite ... 94
5.3.1.2 Interaktive Elemente ... 95
5.3.1.3 Partizipation ... 96
5.3.2 Methode der Datenerhebung ... 97
5.3.2.1 Datensammlung... 97
5.3.2.2 Einschränkung des Erhebungszeitraumes ... 98
5.3.2.3 Einschränkung der Grundgesamtheit ... 99
5.3.2.4 Methodisches Vorgehen und Analyseaspekte der deskriptiven Untersuchung . 100
5.3.2.5 Vorgehen bei der Strukturanalyse zur Identifikation interaktiver Elemente... 100
5.4 Datenerhebung ... 101
5.4.1 Deskriptive Strukturanalyse ... 102
5.4.1.1 Die Website von John Kerry ... 102
5.4.1.2 Die Website von George W. Bush ... 108
5.4.2 Strukturanalyse interaktiver Elemente ... 111
5.4.2.1 Identifikation handlungsorientierter Elemente... 111
5.4.2.2 Identifikation interaktiver Elemente... 113
5.4.3 Darstellung der strukturanalytischen Ergebnisse ... 116
5.5 Auswertung Verbindung Struktur und Partizipationschancen ... 121
6. Schlussbetrachtung... 127
Abbildungsverzeichnis ... 129
Literaturverzeichnis... 130
Eidesstattliche Erklärung... 141
Anhang ... 142
3
1. Einleitung
At the heart of modern democratic politics lies a complex relationship between
the majority, who vote to be represented, and their representatives, the governing
elite. The success or failure of this relationship depends upon a flow of informa-
tion between the two, allowing representatives to know what citizens are thinking
and experiencing and the represented to know what their representatives are doing
and how it affects them.
1
Die vorliegende Arbeit widmet sich einem relativ neuen Aspekt dieser Beziehung: dem Po-
tenzial zu Interaktivität auf Wahlkampfwebsites und sich daraus ergebenden Möglichkeiten
zu politischer Partizipation der Internetnutzer.
Moderne Demokratien sind repräsentative Demokratien in ihrem Mittelpunkt stehen die
Information und Kommunikation zwischen Bürgern und Regierenden. Um letzteren zu er-
möglichen, auf responsive Art und Weise im Interesse der Bevölkerung zu handeln, sind zeit-
gemäße Kommunikationskanäle vonnöten, die einen freien Informationsfluss erlauben. Ange-
sichts allgegenwärtiger Klagen über Politikverdrossenheit der Bürger einerseits und Welt-
fremdheit der Politiker andererseits scheint diese Bedingung in westlichen Industriestaaten
nicht oder nur ungenügend erfüllt. Weder traditionelle Massenmedien, noch die wenigen per-
sönlichen Begegnungen zwischen Repräsentanten und Volk scheinen den Prozess der Politik-
vermittlung adäquat zu gewährleisten.
Gleichzeitig ist aber gerade zu Wahlkampfzeiten ein verstärktes Interesse der Parteien und
Bürger an öffentlicher politischer Kommunikation zu verzeichnen. Von politischer Seite wer-
den Wahlkampagnen geplant und implementiert. Diese werden wiederum durch die Wähler
beobachtet und in ihre Entscheidungsfindung zwischen den politischen Alternativen einbezo-
gen. Allerdings können die Bürger dem Wahlkampf nur die Informationen entnehmen, die er
tatsächlich offeriert. Und die Wahlkämpfer können sich von ihren Anstrengungen nur inso-
fern Wirkungen auf die Wähler erhoffen, wie sie von diesen überhaupt beachtet werden. Die
Gewinnung von Aufmerksamkeit und Etablierung öffentlicher Diskurse über politische Be-
lange stellen eine immense Herausforderung für politische Kommunikatoren dar.
Obgleich der moderne Wahlkampf auf absehbare Zeit in erster Linie ein Fernsehwahlkampf
bleiben wird, verspricht parallel dazu das Aufkommen neuer Informations- und Kommunika-
tionstechnologien einen Wandel politischer und gesamtgesellschaftlicher Kommunikation.
Das Aufbrechen bislang hierarchischer Kommunikationsrollen, gesteigertes Interesse der
1
Coleman (1999), S. 67.
4
Wahlberechtigten und das Aufblühen öffentlicher Debatten im Cyberspace werden von den
einen erhofft, von den anderen befürchtet.
Da sich das Internet als ein zeitgemäßes und praktikables Instrument der Information, Kom-
munikation und Organisation erwiesen hat, ist es für politische Parteien und Kampagnen obli-
gatorisch geworden, sich des Mediums zu bedienen. Dieser Modernisierungsprozess trans-
formiert seit Mitte der 1990er Jahre von den Vereinigten Staaten ausgehend den Ablauf und
das Aussehen von Wahlkämpfen die Notwendigkeit, den ,,virtuellen Wahlkampf" in die
,,Offline"-Kampagne zu integrieren, ist weitgehend unbestritten.
2
Das Internet als Prototyp der computervermittelten Kommunikation ,,eröffnet einen neuen,
integrierten, kontextvariablen und damit beeindruckend umfassenden Interaktionsraum für die
Menschen."
3
In ihrer Wirkung richten sich informationstechnische Innovationen ,,unmittelbar
auf die Veränderung der gesellschaftlichen Elementaroperation der Kommunikation und da-
mit auf die Veränderung der Gesellschaft selbst". Aussagen dieser Art werden in Kapitel 3 im
Zusammenhang mit der Diskussion um den technisch induzierten Wandel von Politik und
Gesellschaft erörtert. Sie lassen sich auf die spezifischen Merkmale des Netzes, wie zum Bei-
spiel Hypertextualität, die Fähigkeit zu multimedialen Darstellungen, die Möglichkeit bidirek-
tionaler, synchroner und asynchroner Kommunikation sowie das große Volumen und die hohe
Geschwindigkeit der Datenübertragung, zurückführen. Als Spezifikum neuer elektronischer
Kommunikationsräume und Abgrenzung zu den sogenannten ,,traditionellen Medien" gilt
aber vor allem das Potenzial des Internets, ,,Interaktivität" zu erlauben. Mit diffusen Bedeu-
tungszuweisungen versehen, dient der Begriff verbreitet als Projektionsfläche für zahlreiche
gesellschaftliche Utopien und als Ankerpunkt vieler Hoffnungen auf eine Revitalisierung
politischer Kommunikation und Verbesserung bürgerlicher Partizipationschancen am
politischen Geschehen.
Doch was verbirgt sich tatsächlich hinter dem Phänomen ,,Interaktivität"? Inwieweit lässt sich
das Konzept theoretisch definieren und empirisch erfassen? Was bedeutet das Angebot von
,,Interaktivität" für politische Kommunikation? Kann es ,,mehr und bessere" Partizipation der
Bürger bewirken? Und warum sollten sich Politiker auf dieses Experiment einlassen? Bieten
gerade im Wahlkampf die Imperative ,,Kommunikationshoheit" und ,,Massentauglichkeit"
2
Unter ,,virtuellem Wahlkampf" wird die Nutzung des Internets als Mittel politischer Kommunikation im Rah-
men von Wahlkämpfen und Wahlkampagnen verstanden. Der Begriff ,,virtuell" betont neben der Verwendung
des Internets als Instrument und Ort des Wahlkampfes vor allem die größere Raum- und Zeitunabhängigkeit der
Kommunikation. Die Erklärungen weiterer Begriffe zu den Themen Internet und computervermittelte Kommu-
nikation finden sich im Glossar im Anhang.
3
Krotz (1998), S. 126.
5
überhaupt Spielraum für interaktive und damit stärker individualisierte Kommunikationsfor-
men?
In der Auseinandersetzung mit den Themen ,,interaktive Netzangebote" und ,,politische
(Wahlkampf-)Kommunikation" drängen sich diese Fragen auf und eröffnen verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen ein breites Spektrum möglicher Forschungsfragen. Nicht jede lässt
sich im Rahmen der vorliegenden Magisterarbeit thematisieren oder gar abschließend beant-
worten. Deswegen fokussiert diese Untersuchung das Problem, inwieweit aus medienwissen-
schaftlicher Perspektive die interaktiven Potenziale des Internets auf politischen Websites
realisiert werden. Stärker politikwissenschaftlich orientiert ist die darauf aufbauende Frage
nach dem Zusammenhang zwischen Interaktivität und einem höheren Maß an politischen Par-
tizipationschancen der Bürger.
Die Grundlage der Betrachtungen bildet das Verständnis des Internets als eine Struktur, die
neben Information und Überzeugung auch verschiedene Formen politischer Handlungen und
Kommunikation ermöglicht. Im Zentrum sollen die politischen Handlungsmöglichkeiten der
Bürger stehen, die sich aus einer Nutzung von Wahlkampfwebsites ergeben können.
Mit Hilfe einer Strukturanalyse werden die Internetpräsenzen der beiden amerikanischen Prä-
sidentschaftskandidaten George W. Bush und John Kerry im Wahlkampf 2004 auf das Vor-
handensein interaktiver Elemente und Möglichkeiten zur Partizipation hin überprüft. Dabei
konzentriert sich diese Arbeit auf die Untersuchung der Strukturen der Websites. Demgegen-
über werden Aspekte der tatsächlichen Nutzung der jeweiligen Angebote und die Wahrneh-
mung von Interaktivität durch die Seitenbesucher ausgeblendet.
Der Fokus auf die Vereinigten Staaten begründet sich aus deren Pionierrolle: Im Präsident-
schaftswahlkampf 1996 spielte das Internet zum ersten Mal eine veritable Rolle. Seitdem gel-
ten die USA als Vorreiter in der Nutzung des Netzes für Wahlkampagnen. Auch in Bezug auf
die allgemeine Entwicklung und Verbreitung des Internets gilt die Faustformel: Die USA sind
den Deutschen ein bis zwei Jahre voraus; sie können also einen gewissen Vorbildcharakter für
sich beanspruchen.
4
Auf strategischer Ebene bilden die US-Kandidaten ebenfalls in vieler
Hinsicht das ,,'leading edge' innovativer Wahlkampfführung", da hier die Entwicklung post-
moderner Kampagnen am weitesten fortgeschritten ist und etliche Formen des Wahlkampfes
erstmals erprobt sowie publizistisch und wissenschaftlich reflektiert wurden.
5
4
Vgl. Sarfeld (2001), S. 286.
5
Vowe/Wolling (2000), S. 63.
6
Die Wahl der Websites http://www.johnkerry.com und http://www.georgewbush.com als Un-
tersuchungsobjekte reflektiert die personenzentrierte politische Kultur in den USA, die Partei-
en und bürgerlichen Organisationen eine weniger wichtige Rolle im Prozess der Informati-
onsproduktion und Mobilisierung der Bürger als in anderen westlichen Demokratien zuweist.
Vor der Durchführung der Strukturanalyse werden zunächst die beiden zentralen Konzepte
dieser Arbeit ,,Interaktivität" und ,,Partizipation" auf Basis der Diskussion relevanter Lite-
ratur theoretisch beleuchtet und hinsichtlich einer gegenseitigen Abhängigkeit untersucht.
Aspekte der Internetnutzung in früheren Wahlkämpfen sollen abschließend die Kandidaten-
websites des Jahres 2004 ,,historisch" einbetten und die Bandbreite möglicher Funktionen und
Elemente der ,,virtuellen Wahlkampfarena" aufzeigen.
2. Interaktivität
,,Wir wissen sehr wenig darüber, was Interaktivität tatsächlich bedeutet. Die meisten Men-
schen, die etwas Interaktives beschreiben, beschreiben etwas, das meiner Meinung nach nicht
gerade sehr interaktiv ist. Es ist im Grunde fast schon eine Beleidigung für das Wort. Ich weiß
nicht genau, was interaktiv tatsächlich bedeutet, aber ich glaube, dass es ein Abenteuer ist, die
tatsächliche Bedeutung herauszufinden."
6
Das ,,Abenteuer" der Begriffsfindung soll Inhalt dieses zweiten Kapitels sein. Inwiefern La-
niers Bewertung auf die derzeitigen diffusen Verwendungsweisen und den polarisierenden
Charakter von ,,Interaktivität" zutrifft, betont auch die Klage Carrie Heeters ,,[...] interactivity
and its derivatives are used to represent so many different meanings that the word rather
muddles rather than clarifies the speaker`s intent".
7
Die Erwartungen an Interaktivität bezüglich dessen, was technisch möglich und wirtschaftlich
zu verdienen sein wird, sind einerseits äußerst hoch. Sie lassen sich andererseits aber vor al-
lem aus der ,,Verwässerung des Konzepts" als Folge seiner allgemeinen Akzeptanz im all-
tagssprachlichen Gebrauch erklären.
8
Nichtsdestotrotz wird Interaktivität häufig als ,,Schlüs-
6
Lanier (1995) zitiert in Leggewie/Bieber (2004), S. 7.
7
Heeter (2000).
8
Jensen (1999), S. 161.
7
seleigenschaft des neuen Mediums Internet"
9
, zentrales Paradigma des Internets oder gar als
eines der stimulierendsten Features von Computernetzwerken
10
ausgezeichnet.
In diesem umstrittenen Begriff kulminiert die Debatte der Netzoptimisten und Netzskeptiker,
wobei die Diskussion auch heute noch von den beiden extremen Polen die Forderung nach
einem Verzicht auf ,,Interaktivität" im wissenschaftlichen Diskurs versus Interaktivität als
unabdingbare Voraussetzung für die Transformation von Konsumenten in politisch interes-
sierte und engagierte Bürger
11
- dominiert wird. In Bezug auf letztere Sichtweise, werden der-
artige Prophezeiungen, Hoffnungen und Befürchtungen aber meist von vereinfachten, tech-
nikdeterministischen Vorstellungen geleitet. Demgegenüber ist die Dichte der Interaktivität
eines Mediums, und damit sein Potenzial zur Veränderung gesellschaftlicher Strukturen,
Normen und Verhaltensweisen nicht nur abhängig von seiner technischen Leistungsfähigkeit,
sondern auch von der jeweiligen sozialen Gestaltung und tatsächlichen Nutzung.
12
Um mögliche Wirkungen einer wie auch immer gearteten Interaktivität untersuchen und ein-
schätzen zu können, ist es zudem nötig, begriffliche Klarheit und Eindeutigkeit zu schaffen.
Im Folgenden soll die Genese des Konzepts ,,Interaktivität" aus diesem Grund zunächst ,,his-
torisch" in eine Tradition verwandter Ideen und Denkschulen eingebettet und der Ursprung im
Begriff der ,,Interaktion" untersucht werden. Anschließend werden existierende explizite De-
finitionen auf Basis der jeweils eingeschlossenen Dimensionen systematisiert und erläutert.
Endpunkt der Fülle an Konzepten wird eine ,,konsensfähige" Definition des Begriffes ,,Inter-
aktivität" in Bezug auf computervermittelte Kommunikation (CMC) darstellen.
Ziel dieses Kapitels soll es nicht sein, eine exakte, allgemein und ewig gültige Festlegung von
,,Interaktivität" zu entwickeln. Dies ist durch den hybriden Charakter des Konstrukts, durch
seine zahlreichen unterschiedlichen Verwendungszusammenhänge und auch in Bezug auf
neue Medien durch die dynamische, unabgeschlossene Natur des Internets nicht möglich.
Deshalb wird der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Entwicklung eines allgemeinen Ver-
ständnisses für das Phänomen ,,Interaktivität" in seinen verschiedenen Bedeutungskontexten
und Ausprägungen liegen, um auf dieser Basis eine operationale Definition für die, in Kapitel
5 beschriebene Analyse der beiden Kandidaten-Homepages zu entwickeln.
9
Kleinsteuber/Hagen (1998), S. 63.
10
Vgl. Oblak (2003).
11
Vgl. Carey (1987) zitiert in Hacker (2000), S. 116.
12
Vgl. Kleinsteuber/Hagen (1998), S. 75.
8
2.1 Ein neuer Begriff für eine alte Idee?
Das Konzept der Interaktivität hat eine längere und kompliziertere Tradition, als es der erste
Blick auf dieses, vor allem in den 1990er Jahren geprägte Schlagwort der neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien vermuten lässt. Der Begriff wird zwar oft verwendet, um
die spezifische Differenz und den Vorsprung ,,neuer" Medien gegenüber den ,,alten" Print-,
Ton- und Bildmedien zu markieren. Damit verbundene Ideen wie Rückkanalfähigkeit, Re-
ziprozität und Responsivität finden sich allerdings schon weit vor dem Aufkommen von ,,In-
teraktivität" als Phänomen computervermittelter Kommunikation.
13
Interaktive Medien wur-
den keinesfalls aus dem Nichts geschaffen - ,,the cult of interactivity has been in the making
for a long time."
14
Dennoch ist ein Fehlen historischen Bewusstseins Merkmal vieler technokultureller Ansätze,
für welche die Vergangenheit meist nur interessant ist, insofern sie Impulse für die Entwick-
lung neuer Hardware und Software geben kann. Ein solches rationales, rein auf Technik fi-
xiertes Vorgehen reicht hingegen nicht aus, um zu verstehen, wie Technologie in die Struktur
der Kultur verwoben ist oder wie sich Nutzer ihre persönlichen Beziehungen zu Technik vor-
stellen.
15
In Bezug auf ,,Interaktivität" ist die Konsequenz derartig verkürzter Betrachtungen,
die Entwicklung technikzentrierter Definitionen, die das Phänomen jedoch nur partiell erfas-
sen können
16
.
Um das Bewusstsein für ideengeschichtliche Vorläufer zu schärfen schlägt Erkki Huhtamo
die Betrachtung computervermittelter Interaktivität durch die ,,Augen" der frühen Diskurse zu
,,Automation" und ,,Cybernation" vor.
17
Zum Beispiel entwickelte ihm zufolge Leonardo Tor-
res Y Quevedo bereits im Jahre 1915 die Idee, den Menschen systematisch durch Maschinen
zu ersetzen und die zuvor ,,nutzlosen" und unsystematisch verwendeten Automaten damit in
den Dienst einer methodischen ,,Automation" zu stellen. Ebenfalls in dieser Zeit verortet Huh-
tamo weitere Meilenstein in der diskursiven Entwicklung hin zu ,,Interaktivität". Zum einen
wurden mit der Entwicklung der ersten Computer auch die neuen Theorien der Kybernetik
13
Eine ausführliche Definition des Begriffes ,,Interaktivität" erfolgt im nächsten Kapitel. Um jedoch nicht auf
dessen Verwendung in vorhergehenden Kapiteln verzichten zu müssen, wird zunächst eine einfache, vorläufige
Begriffsbestimmung zurückgegriffen. Basis ist hierbei der wissenschaftliche Minimalkonsens, Rückkanalfähig-
keit und Zwei-Wege-Kommunikation als Kriterien für Interaktivität anzunehmen.
14
Huhtamo (1998), S. 109.
15
Vgl. ebd. (1998), S. 97.
16
Beispiele für technikzentrierte Definitionen siehe Kapitel 2.3.1.1.
17
Vgl. Huhtamo (1998), S. 99 ff.
9
und Informatik ins Leben gerufen,
18
zum zweiten prägte die Ford Motor Company mit der
Einführung des Fließbandproduktion 1913 den Begriff der ,,Automatisierung".
In verschiedenen einzelnen Entwicklungsschritten, die vor allem durch militärische und
industrielle Anwendungen (z.B. Automatic Data Processing) vorangetrieben wurden, vollzog
sich die Wende hin zu interaktiven Medien als Synthese der früheren Modelle des Mensch-
Maschine-Systems. Sie übernahmen einerseits von mechanisierten Systemen, wie dem Fließ-
band, das konstante Wechselspiel zwischen dem ,,Arbeiter" und der Maschine,
19
beinhalten
andererseits aber auch unzählige automatisierte Funktionen.
20
Als Konsequenz des techni-
schen Fortschritts erfolgte auf terminologischer Ebene ein sukzessiver Wechsel: In den
1980er Jahren wurde ,,Automatisierung" durch ,,Computerisierung" und ,,Informationstechno-
logie" ersetzt. In den 90ern traten ,,Informations- und Kommunikationstechnologie" und
,,Multimedia" als neue Begrifflichkeiten hinzu.
21
Mit Entstehung der ersten Dialogprogramme in der Informatik wurden für diese zunächst nur
Termini wie z.B. ,,Rückkommunikations-System" oder ,,Zwei-Wege-Kommunikation" ver-
wendet, die eine allgemeine Rückantwortfähigkeit des Nutzers implizieren. ,,Doch als die
ersten computerbasierten ,Neuen Medien' auf den Markt kamen (u.a. Bildschirmtext und Vi-
deotext), übernahm man hierfür die Eigenschaftsbezeichnung ,interaktiv'."
22
Ähnliche Überlegungen zur Entwicklung der Idee ,,Interaktivität" vollzieht Roberto Sima-
nowski. Allerdings blendet er technische Faktoren völlig aus und findet Referenzen, die meh-
rere Jahrhunderte zurückreichen. Als ästhetisches Ideal verortet er Interaktivität in den Fi-
gurengedichten des Barock, die zur Lektüre bestimmte körperliche Reaktionen vom Leser
verlangen. In sogenannten permutativen Gedichten muss der Leser zum Beispiel aus einer
Reihe von Wörtern eines auswählen, um dem Text Gestalt zu geben. Damit komponiert die
Aktion des Lesers zwar den Text, dennoch wird der Spielraum dieser Komposition klar durch
den Autor vorgegeben und damit die Freiheit des Lesers begrenzt.
18
Maßgeblich hierbei war unter anderem Norbert Wieners Entwicklung des Konzeptes ,,cybernetics" in den
späten 40ern, welches die Basis für den Begriff ,,"Cybernation" als Ausdruck des Zusammengehens von ,,Auto-
mation" und Computern, bildet. Genauere Ausführungen zu den beiden Theorien Kybernetik und Informatik
sowie ihrem Beitrag zur theoretischen Entwicklung des Konzeptes ,,Interaktivität" finden sich im Kapitel 2.2.2
dieser Arbeit.
19
Videospiele, Systeme virtueller Realität, verschiedene interaktive Kunstwerke usw. erfordern sogar physische
Interaktion.
20
Vgl. Huhtamo (1998), S. 107.
21
Vgl. Van Dijk (1999), S. 1.
22
Goertz (1995), S. 99.
10
Auch bezüglich der Diskussion um demokratische Potenziale interaktiver Technologien haben
sich Optimisten und Skeptiker nicht erst mit Aufkommen des Internets formiert.
23
Unterhalb
der sich verändernden Oberfläche der Technik finden sich beharrliche und langlebige intellek-
tuelle Strömungen, die von Zeit zu Zeit (und vor allem während Krisen und Umbrüchen) akti-
viert werden und damit als eine Art Meta-Diskurs die technische und gesellschaftliche Ent-
wicklung begleiten.
24
In dieser Hinsicht ließe sich zum Beispiel der Schriftsteller George Orwell als früher Skepti-
ker von Zwei-Wege-Technologien einordnen. In seinem Roman ,,1984" aus dem Jahr 1949
bestimmen Monitore den Alltag. Der ubiquitäre ,,Televisor", eine Art Empfangs- und Über-
wachungsfernseher, der nicht abgestellt werden kann, ist in doppelter Hinsicht von Bedeu-
tung: ,,Er ist den Unterdrückten nicht nur Fenster zur Welt, sondern dient gleichzeitig auch
ihrer Beobachtung."
25
Durch die Monitore bekommen die Bewohner des Landes Ozeanien
nicht nur Informationen vermittelt und erhalten Anweisungen, sondern werden durch diesen
technischen Kanal auch von der regierenden Partei erfasst und kontrolliert. Mit dieser negati-
ven Utopie verweist Orwell als einer der ersten Kritiker auf die Gefahr der Enthumanisierung
und Entfremdung durch Nutzung technischer Zwei-Wege-Systeme.
26
Das positive Gegenstück entwickelte Bertolt Brecht in seiner ,,Radiotheorie" gut 16 Jahre vor
Orwells ,,1984": ,,Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikati-
onsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsap-
parat des öffentlichen Lebens, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusen-
den, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur zu hören, sondern auch sprechen
zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in eine Beziehung zu setzen. Der Rundfunk
müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organi-
sieren."
27
Der Zuhörer verbleibt in dieser Vision nicht wie bei Orwell in der Rolle des passi-
ven Konsumenten und beobachteten Opfers der Technik, sondern soll sich emanzipieren und
selbst aktiv werden. Im Zentrum der Kritik steht in diesem Zusammenhang vor allem die
reale, begrenzte Ein-Weg-Kommunikation der Massenmedien.
Weitergeführt wurde dieser Strang des technologischen Meta-Diskurses unter anderem durch
Habermas, der 1962 warnte, die hierarchische Struktur der Massenmedien dränge dem Publi-
kum ein ,,don`t talk back" Format auf, sowie weiterhin durch Hans Magnus Enzensberger
23
Zur Diskussion um politische Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf das Internet siehe Kapitel 3.2.1
24
Vgl. Huhtamo (1998), S. 98.
25
Gangloff (1996), S. 132.
26
Hierbei ist jedoch einzuschränken, dass es sich bei seiner Vision des ,,Televisors" nicht um einen Rückkanal
im Sinne von zweiseitiger Kommunikation handelt, da der ,,Input" der Bürger durch die Überwachung quasi
erzwungen wird.
27
Brecht (1932) zitiert in Rollka (1971), S. 152.
11
mit seiner Kritik, die Menschen würden schnell zu passiven Konsumenten des manipulierten
oder zumindest kommerzialisierten Inhaltes der Massenmedien.
28
Dieser beispielhafte Ausschnitt der öffentlichen Debatte um Technik, Medien und Demokratie
soll verdeutlichen, dass die Ideen, die sich hinter dem Phänomen ,,Interaktivität im Internet"
befinden schon weitaus älter sind als die, für die Verwirklichung dieser Ideen notwendige
Technologien selbst.
29
Einschränkend muss jedoch bemerkt werden, dass die geschilderten
Ansätze keine direkten Vorläufer der heutigen Diskurse um Interaktivität im Sinne einer
stringenten Entwicklung sind, sondern lediglich verwandte Denkweisen oder Visionen dar-
stellen. Eindeutiger als diese relativ schwer fassbaren und eher im Spekulativen verbleibenden
ideengeschichtlichen Hintergründe lassen sich die begrifflichen Wurzeln von ,,Interaktivität"
nachvollziehen.
2.2 Der begriffliche Ursprung ,,Interaktion"
Trotz der begrifflichen Vieldeutigkeit und Mannigfaltigkeit an Interaktivitätskonzepten
herrscht in der Literatur zumindest in Bezug auf die Herkunft des Wortes ein weit verbreiteter
Konsens. Der Begriff ,,Interaktion", verstanden im Sinne von ,,Austausch", ,,Wechselspiel"
und ,,gegenseitiger Einfluss", wird als Anker- und Ursprungspunkt konzipiert, um die termi-
nologische Genese von ,,Interaktivität" zu beschreiben.
30
Über diesen Minimalkonsens, ,,Interaktion" als ,,Wechselbeziehung" zu verstehen hinaus er-
fährt der Begriff in einzelnen Wissenschaften und Verwendungskontexten sehr unterschiedli-
che Bedeutungszuschreibungen und kann aus diesem Grunde auch als multidiskursives Kon-
strukt bezeichnet werden. Wechselbeziehungen verschiedenster Art stimulieren eine breite
Palette an wissenschaftlichem Forschungsinteresse. In der Medizin werden zum Beispiel
Wechselwirkungen zwischen zwei gleichzeitig verabreichten Medikamenten unter ,,Interakti-
onen" subsummiert, während in der Ingenieurwissenschaft diese Begrifflichkeit für das Ver-
halten von zwei verschiedenen Materialien unter Belastung vorbehalten ist. Designer nutzen
,,Interaktion" oder auch ,,Interaktivität" oft als Synonym für Navigation oder um gutes Web-
design zu bezeichnen, und in Softwarebedienungsanleitungen beziehen sich ,,Interaktionen"
auf Aktionen der Computermaus.
31
28
Vgl. Schultz (1999).
29
Ein weiterer Vorläufer der Diskussion um Internet, Interaktivität und Demokratisierung ist die Debatte um das
(interaktive) Kabelfernsehen in den 70er Jahren.
30
Vgl. Jäckel (1995), S. 463 ff.
31
Vgl. Goertz (1995), S. 98 und Vgl. Heeter (2000).
12
Wichtiger für die Bedeutung von ,,Interaktion" als Basis für ein Verständnis der ,,Interaktivi-
tät" in Bezug auf computervermittelte Kommunikation sind allerdings die Verwendungswei-
sen des Begriffes in der Soziologie, der Informatik und der Kommunikationswissenschaften.
Konzepte, die in diesen Wissenschaften verfolgt werden sollen deshalb im Folgenden kurz
umrissen werden.
2.2.1 Das Konzept der Interaktion in der Soziologie
,,Interaction occurs as soon as the actions of two or more individuals are observed to be mutu-
ally interdependent."
32
,,Interaktion" auf Basis dieser Definition der ,,International Encyclo-
pedia of Communication" erfordert, dass sich jeder der (mindestens zwei) Teilnehmer der
Präsenz des jeweils anderen bewusst ist, die Interagierenden aneinander orientiert sind und
beiderseitig ihr Verhalten anpassen.
33
Die Teilnehmer der sozialen Interaktion entwickeln
einen Zustand reziproken Bewusstseins. Voraussetzungen hierfür sind die personale Anwe-
senheit und symbolische Interaktionen der Teilnehmer. Es finden ein wechselseitiger Aus-
tausch und Verhandlungen über Bedeutung zwischen zwei (oder mehr) Partnern statt, die sich
im gleichen sozialen Kontext befinden.
34
Interaktion kann in diesem Kontext auch als ein Sonderfall von Kommunikation aufgefasst
werden, wobei Sender und Empfänger ihre Rollen im Interaktionsprozess tauschen (wechsel-
seitige Kommunikation) und Informationen nicht einfach übermittelt, sondern kontinuierlich
im Kommunikationsablauf durch die Teilnehmer erschaffen werden. Hierfür muss, in Anleh-
nung an Habermas' Theorie des ,,kommunikativen Handelns", zwischen den Partizipierenden
eine gewisse Kongruenz bestehen. Sie müssen den Informationen bzw. Botschaften eine ge-
meinsame Bedeutung beimessen, um sich gegenseitig verstehen und ihr Handeln entspre-
chend aneinander ausrichten zu können.
35
Fazit: Das soziologische Grundmodell der Interaktion bezieht sich auf die Beziehung zwi-
schen mindestens zwei Menschen, die in einer gegebenen Situation, gegen- und wechselseitig
ihr Verhalten aneinander anpassen. In diesem auf face-to-face-Interaktion fokussierten Ver-
ständnis ist Kommunikation ohne Interaktion möglich (z.B. Radio hören, fernsehen), jedoch
impliziert Interaktion immer das Vorhandensein von Kommunikation.
36
32
Duncan (1989) zitiert in Jensen (1999), S. 165.
33
Vgl. auch Döbler/Stark (2001), S. 4.
34
Vgl. Leggewie/Bieber (2004), S. 8 und Vgl. Jensen (1999), S. 165.
35
Vgl. Navarra (2000), S. 19.
36
Vgl. Jensen (1999), S. 166.
13
2.2.2 Das Konzept der Interaktion in der Informatik
Informatiker haben den Interaktionsbegriff aus dem erläuterten soziologischen Zusammen-
hang auf Prozesse zwischen Menschen und Computern übertragen und damit auch dessen
Bedeutungsgehalt verändert. In Analogie zur Kommunikation zwischen Menschen wird die
Bedienung eines Computers als Mensch-Maschine-Interaktion gefasst. Hierbei bezeichnet
,,Interaktion" einen Prozess, der stattfindet, wenn Menschen eine Maschine bedienen; das
Verhältnis zwischen zwei Menschen oder Kommunikation zwischen Menschen, die durch
eine Maschine vermittelt wird, ist damit nicht gemeint.
37
Ein wichtiger Bestimmungsfaktor der Interaktion ist für Informatiker die Art der Kontrolle
zwischen Mensch und Computer.
38
Hierbei wird, wie zum Beispiel in der Definition des
Workshops "The Methodology of Interaction" im Jahr 1979, Kontrolle als Gegensatz zu dem
soziologischen Modell der Gegenseitigkeit, Reziprozität und Verhandlung über Bedeutung
gefasst: ,,Interaction is a style of control and interactive systems exhibit that style."
39
In der Tradition der Informatik ist demzufolge eine (Mensch-Computer-)Interaktion ohne
Kommunikation durchaus möglich, während (computervermittelte) Kommunikation ohne
(Mensch-Computer-)Interaktion undenkbar bleibt. Freilich bleibt dieses rein technikorientier-
te Verständnis von Interaktion sowohl aus soziologischer als auch aus kommunikationswis-
senschaftlicher Perspektive defizitär.
2.2.3 Das Konzept der Interaktion in der Kommunikations- und Medienwissenschaft
Im Vergleich zu den beiden Disziplinen Soziologie und Informatik ist in den Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaften kein genereller Konsens bezüglich der Verwendung von ,,In-
teraktion" zu finden. Stattdessen existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte, die hier
nur auszugsweise behandelt werden können.
Zwei Forschungszweige innerhalb der Kommunikations- und Medienwissenschaften, die For-
schung zu interpersonaler Kommunikation und die Medienwirkungsforschung, nutzen das
Konzept ,,Interaktion" in einem stark soziologischen Sinne. Vor allem Arbeiten im Bereich
der traditionellen Mediensoziologie liegen schon aufgrund des ähnlichen Erkenntnisinteresses
und Methodenhintergrundes innerhalb eines soziologischen Verständnisrahmens.
40
37
Vgl. Goertz (1995), S. 99.
38
Vgl. Downes/McMillan (2000), S. 158.
39
Jensen (1999), S. 169.
40
Vgl. ebd. (1999), S. 166 f.
14
Eine dritte Strömung stellt das Konzept der para-sozialen Interaktion dar. Uni-direktionale
Massenmedien haben zwar nicht das Potenzial, zwischenmenschliche Interaktion zu ermögli-
chen, können dessen ungeachtet aber eine Illusion scheinbar vertrauter interpersonaler Kom-
munikation erzeugen. Indem sie sich zum Beispiel mit Protagonisten im Fernsehen identifi-
zieren, reagieren und partizipieren Rezipienten, als ob sie sich in face-to-face-Kommunikation
einer Primärgruppe befänden trotz fehlender sozialer Interaktion kann Antizipation Handeln
auslösen und das Medium wird zum (scheinbaren) Kontakt zur Außenwelt.
41
Nichtsdestotrotz
bleibt diese ,,Intimität auf Distanz" einseitig, nicht-dialektisch, durch den Sender kontrolliert
und ohne jegliche effektive Reziprozität.
42
Alles in allem wird der Begriff ,,Interaktion" in den Kommunikations- und Medienwissen-
schaften oft verwendet, um die Handlungen eines Publikums oder von Rezipienten in Bezug
auf Medieninhalte zu erfassen. Dies kann sogar geschehen, um auf traditionelle Ein-Weg-
Medien zu verweisen, obgleich gar keine neue Medientechnologie, die Möglichkeiten für
Nutzer-Input oder Zwei-Wege-Kommunikation eröffnen würde, genutzt wird. Oft fehlt auch
der Bezug zu sozialen Situationen, in welchen ein interaktiver Partner physisch präsent ist,
weshalb es übertrieben wäre, von ,,Interaktion" im strengen soziologischen Sinne zu sprechen.
2.2.4 ,,Interaktion" = ,,Interaktivität"?
Computervermittelte Kommunikation eröffnet ein neues Handlungsfeld zwischen Massen-
und Individualkommunikation. Dennoch wird der Unterschied zwischen sozialer Interaktion
und Interaktivität unter Abwesenden nicht aufgehoben.
43
Lediglich die exakte Differenzierung
der Konzepte wird erschwert, da einerseits beide Begriffe sowohl im Alltagsgebrauch als auch
in wissenschaftlichen Arbeiten nicht trennscharf oder sogar synonym verwendet werden und
andererseits die Grenzen verschwimmen: ,,Die physische Kopräsenz anderer, mit denen man
sich an einem gegebenen Ort zu einer gegebenen Zeit verbal und non-verbal austauscht, wird
durch einen personalisierten und nicht-anonymen Austausch mittels Computern unterstützt
[...]. Man kann die betreffenden Vorgänge aber durchaus als soziales Handeln einordnen
[...]."
44
Zwar gilt noch immer die Feststellung, dass soziale zwischenmenschliche Interaktion
im strengen Sinne, die sich durch geringe Rückzugsmöglichkeiten definiert, auf dem Netz
41
Vgl. Navarra (2000), S. 18.
42
Vgl. Jensen (1999), S. 167.
43
Vgl. Leggewie/Bieber (2004), S. 10.
44
Leggewie/Bieber (2004), S.10 f.
15
nicht stattfinden würde.
45
Erschwert wird eine Abgrenzung zwischen ,,Interaktion" und
,,Interaktivität" jedoch durch die Tatsache, dass die Benutzeroberflächen und Anwendungen
von Computern zunehmend so gestaltet werden, dass sie den Eindruck von Wahlfreiheit und
nicht-determiniertem Angebot erwecken. Je mehr aber die Maschine vermenschlicht wird
desto mehr wird sie auch als ein (gleichberechtigter) Kommunikationspartner angesehen, mit
dem auch Interaktionen in Analogie zu zwischenmenschlicher Kommunikation möglich
scheinen. Doch gerade, um diese Entwicklung untersuchen zu können, ist darauf zu bestehen,
dass Interaktion und Interaktivität streng auseinandergehalten werden.
46
Der Begriff ,,Interak-
tion" sollte für die Kommunikation zwischen Menschen, als einem wechselseitigen Ablauf
von Mitteilungen zwischen zwei oder mehreren Personen und wechselseitigem Einfluss von
Individuen auf ihre Handlungen während ihrer unmittelbaren physischen Anwesenheit, reser-
viert bleiben, um einen eindeutigen wissenschaftlichen Diskurs zu beiden Phänomenen zu
ermöglichen.
47
Um den Unterschied zwischen beiden Begriffen zu fassen, stellt Marcinkowski zum Beispiel
dem soziologisch (und makroskopisch) ansetzenden Interaktionskonzept eine technologisch
(und mikroskopisch) orientierte Interaktivitätsperspektive gegenüber.
48
Inwieweit sich diese
relativ grobe Differenzierung im speziellen Anwendungsfall aufrecht erhalten lässt, bleibt zu
überprüfen und wird wohl auch von der technologischen Entwicklung im Bereich der compu-
tervermittelten Kommunikation abhängen.
Zweck der folgenden Kapitel soll es zunächst einmal sein, den Terminus der ,,Interaktivität"
auf theoretischer Ebene zu erfassen und in Abgrenzung zum Begriff ,,Interaktion" zu definie-
ren.
2.3 Systematisierung vorhandener Definitionen
Die soeben nachvollzogenen Schwierigkeiten, ,,Interaktivität" historisch und terminologisch
einzubetten, lassen erahnen, dass der Begriff sehr schwer zu beschreiben ist und auch im Kon-
text der neuen Medien auf vielfältige Art und Weise verwendet wird: ,,Interactivity is a wide-
ly used term with an intuitive appeal, but it is an underdefined concept."
49
Diese und ähnliche
Klagen bezüglich der definitorischen Lage sind in der relevanten Literatur weit verbreitet,
sollten meiner Meinung nach allerdings dahingehend relativiert werden, dass ,,Interaktivität"
45
Vgl. Marschall (1999), S. 116.
46
Vgl. Schulmeister (2004) zitiert in Mertens (2004), S. 274.
47
Mertens (2004), S. 274.
48
Vgl. Marcinkowski/Schrott (2004), S. 173.
49
Rafaeli (1988), S. 110.
16
zwar ein weit verbreiteter, multidiskursiver Begriff ist, aber keinesfalls als "underdefined"
gelten kann.
Als Beweis für die Fülle an unterschiedlichen Begriffsbestimmungen dient der folgende Ü-
berblick über vorhandene Definitionen, welcher sich vor allem auf Spiro Kiousis` Systemati-
sierung stützt.
50
Auch er beklagt zunächst den Mangel an theoretischem Konsens, der zu gro-
ßen Unterschieden in Bezug auf wissenschaftliche Ergebnisse führe. Um dennoch die vielfäl-
tigen Entwürfe systematisch erfassen zu können, hat Kiousis vorhandene Definitionen je nach
ihrem ,,Objektbezug" klassifiziert.
51
Diese Dimension gibt an, ob der Fokus des jeweiligen
Konzeptes auf der Technologie, auf der Umgebung der Kommunikation oder auf dem Rezi-
pienten liegt.
52
Abbildung 1 zeigt die im Folgenden zu beleuchtenden Definitionen als Übersicht.
Abbildung 1: Interaktivitätsdefinitionen
53
Technologie
·
Durlak (Sinnesreichtum)
·
Miller (wechselseitiger Dialog)
·
Steuer (Modifikation)
·
Jensen (Fähigkeit des Systems, Einfluss des Users zu
ermöglichen)
Umgebung der
Kommunikation
·
Rafaeli (Abhängigkeit dritter Ordnung)
·
Rice (Echtzeit)
·
Williams (Kontrolle)
·
Rogers (Kontrolle)
Betontes
Objekt
Wahrnehmer
(Rezipient)
·
Newhagen (psychologische Variable)
·
Chen (Interaktivität als Merkmal von Menschen)
·
Wu (Wahrnehmung beeinflusst Bewertung)
·
Sundar (Empfindung der Nutzer)
mehrdimensionale Kon-
strukte
·
Bucher (Forderung: umfassende Definition)
·
Stromer-Galley (zwei Verwendungsweisen)
·
Szuprowicz (Informationsflüsse)
·
Bieber/Leggewie (,,Dreiteilung" der Interaktivität)
·
Goertz (Einfühlungsvermögen)
·
McMillan (,,Cyberinteraktivität")
·
Heeter (n-dimensionales Konzept)
50
Kiousis (2002), S. 355-383.
51
Vgl. Kiousis (2002), S. 358.
52
Lässt sich eine Definition nicht eindeutig einer Objektdimension zuordnen, so wird sie entweder in die Kate-
gorie des jeweils besonders fokussierten Objektes einsortiert bzw., falls sie sich gleichermaßen auf mehrere
Objekte bezieht, als multidimensionales Konstrukt in einer von mir zusätzlich eingeführten Kategorie gesondert
betrachtet.
53
Eigene Zusammenstellung auf Basis von Kiousis` Schema (Ergänzung der Kategorie ,,mehrdimensionale
Konstrukte"); Vgl. Kiousis (2002), S. 358.
17
2.3.1 Kommunikationswissenschaftliche Definitionen von Interaktivität
2.3.1.1 Betonung auf der Technologie
In der Tradition des in der Informatik verwendeten Interaktionsbegriffes fokussieren zahlrei-
che Definitionen auf Interaktivität als Eigenschaft des Kommunikationskanals.
54
Einen frühen und sehr einfachen Definitionsversuch stellt T. Durlaks ,,Typologie interaktiver
Medien" aus dem Jahr 1987 dar, in dem er den Begriff auf Basis prototypischer Beispiele
erklärt. Ihm zufolge gehören das Telefon, ,,Zwei-Wege-Fernsehen", Audio-
Konferenzsysteme, Computer, die zur Kommunikation genutzt werden, E-Mail, Videotext
und ähnliche Technologien, die verwendet werden, um Informationen in Form von Bildern,
Zeichnungen und Daten auszutauschen zu den interaktiven Medien.
55
Als deren Ideal gilt
Durlak dabei die face-to-face-Kommunikation. Das Medium, welches die ,,natürlichste"
Kommunikation zwischen Menschen ermöglicht, wäre somit das interaktivste damit würden
Bildtelefone gegenüber Online-Diensten als interaktiver gelten. Ob es allerdings zweckmäßig
ist, Medien, die zwischenmenschliche Kommunikation ermöglichen, zu interaktiven Medien
zu zählen halte ich für fraglich. Vor allem im Kontext dieser Magisterarbeit erscheint es sinn-
voller, zwischen ,,Medien als Partner" und ,,Medien als Mittel der Kommunikation" zu diffe-
renzieren. Erstere Verwendungsweise bezieht sich dabei auf ,,angebotsorientierte Interaktivi-
tät" und verweist auf die interaktive Rezeption von Online-Angeboten, während ,,Medien als
Mittel der Kommunikation" zur Kennzeichnung ,,adressatenorientierter Interaktivität" ver-
wendet werden, also interaktive Kommunikationsformen markieren, in denen neue Medien
zur Interaktion dienen (z.B. E-Mail, Chatroom).
56
Alles in allem vermittelt Durlaks Aufzählung zwar einen ersten Eindruck seiner Vorstellung
von ,,Interaktivität", erweist sich aber in definitorischer Hinsicht als nicht sehr informativ. Es
wird weder herausgestellt, welche Kriterien ein Medium als interaktiv qualifizieren, noch
welche gemeinsamen Aspekte alle genannten Medien verbinden.
Eine exaktere Definition, die zudem soziologische Aspekte einbezieht, stammt von Rockley
Miller, der ,,Interaktivität" als ,,reciprocal dialogue between the user and the system" be-
schreibt und damit neben der informatiktypischen Konstruktion ,,Nutzer-System" auch wech-
selseitigen Dialog als Kriterium einschließt.
57
Auf dieser Basis charakterisiert er interaktive
Medien als ,,Media which involves [sinc!] the viewer as a source of input to determine the
54
Vgl. Kapitel 2.2.2.
55
Vgl. Jensen (1999), S. 169 f.
56
Vgl. Bucher (2004), S. 136.
57
Jensen (1999), S. 170.
18
content and the duration of a message, which permits individualized program material."
58
Trotz der größeren Genauigkeit bleibt auch diese Definition eng an spezifische Technologien
(Computer und Video) gebunden und macht es nicht möglich, die erforderliche Unterschei-
dung zwischen verschiedenen Formen und Stufen von Interaktivität zu treffen.
Ebenfalls technologisch basiert ist Steuers Definition von Interaktivität als das Ausmaß, in
dem Nutzer an der Modifikation der Form und des Inhalts einer medial vermittelten Umge-
bung in Echtzeit teilnehmen können.
59
Auf Grundlage dieser Festlegung entwickelt er eine
Matrix, die sich aus den Dimensionen ,,Interaktivität" und ,,Lebhaftigkeit"
60
zusammensetzt.
Dabei ist erstere auf die Fähigkeit des Nutzers, Informationen einzugeben und den Rezepti-
onsprozess zu beeinflussen fokussiert, während die letztere als unabhängige Dimension
Gradmesser für die (sinnesbezogene) Reichhaltigkeit eines medialen Angebotes ist.
61
Indes-
sen erfolgt die Einordnung der Medien auf den beiden Kontinua der Matrix ohne präzise
Messvorschriften, die Klassifizierung basiert vorrangig auf subjektiven Kriterien und ent-
spricht nicht den wissenschaftlichen Anforderungen der Nachvollziehbarkeit und intersubjek-
tiven Überprüfbarkeit. Zudem schließt Steuer auch rein fiktionale Elemente, wie ,,Cyber-
space" aus William Gibsons Roman ,,Neuromancer" auf der gleichen Basis wie real existie-
rende Medien ein.
Eine letzte Definition, die sich vorrangig auf Technologie als Objekt von Interaktivität be-
zieht, stellt Jensens Aufbrechen des Konzepts in Unteraspekte dar. Prinzipiell betrachtet er
Interaktivität als ,,a measure of a media`s potential ability to let the user exert an influence on
the content and/or form of the mediated communication."
62
Er differenziert zwischen vier
voneinander unabhängigen Kategorien - ,,transmissional", ,,consultational", ,,conversational"
und ,,registrational interactivity" , die sich durch folgende Merkmale auszeichnen:
63
o
,,transmissional interactivity": Maß für das Potenzial eines Mediums, den Nutzer aus ei-
nem kontinuierlichen Strom an Informationen wählen zu lassen; in einem Ein-Weg-
Mediensystem ohne Rückkanal (z.B. Teletext, Near-video-on-demand)
o
,,consultational interactivity": Maß der potenziellen Fähigkeit eines Mediums, den Nutzer
auf Anfrage aus einer existierenden Selektion an vorproduzierten Informationen wählen
58
Jensen (1999), S. 170.
59
Vgl. Downes/McMillan (2000), S. 159.
60
Steuer bezeichnet diese Dimension im Original als ,,Vividness".
61
Vgl. Jensen (1999), S. 175 f.
62
Ebd. (1999), S. 183.
63
Vgl. ebd. (1999), S. 183 f.
19
zu lassen; in einem Zwei-Wege-Mediensystem mit einem Rückkanal (Video-on-demand,
Online-Informationsdienste, FTP, WWW, CD-Rom-Lexika)
o
,,conversational interactivity": Maß der potenziellen Fähigkeit eines Mediums, den User
eigene Informationen produzieren und einspeisen zu lassen; gespeichert oder in Echtzeit
(z.B. E-Mail, Newsgroups, Chat)
o
,,registrational interactivity": Maß für das Potenzial eines Mediums, Informationen von
einem Nutzer zu registrieren und sich damit an die spezifischen Bedürfnisse/ Handlungen
eines Nutzers anzupassen bzw. auf diese zu reagieren (z.B. Überwachungssysteme, intel-
ligente Agenten, intelligente Führer, intelligente Interfaces)
Die ersten beiden Dimensionen betreffen die Verfügbarkeit von Auswahlmöglichkeiten, wäh-
rend die beiden letzteren individuellere Einflussmöglichkeiten des Nutzers ausdrücken.
Sehr fruchtbar erscheint bei diesem Ansatz die Aufspaltung des Interaktivitätskonzeptes in
verschiedene Dimensionen, da dies die Möglichkeit eröffnet, den hybriden Charakter des
Konzeptes ,,Interaktivität" zu erfassen. Jedoch ignoriert Jensen wichtige Aspekte anderer De-
finitionen von Interaktivität, wie zum Beispiel Zusammenhang und Kohärenz zwischen aus-
getauschten Informationen ein Kriterium, das vor allem in Definitionen betont wird, die das
Umfeld der Kommunikation fokussieren.
2.3.1.2 Betonung auf der Umgebung der Kommunikation (Communication Setting)
Sheizaf Rafaelis` theoretische Ausführungen, nahezu in allen für diese Arbeit verwendeten
Texten zitiert, stellen einen wichtigen Fixpunkt in der Diskussion um den Bedeutungsgehalt
von Interaktivität dar. Aufgrund der Tatsache, dass Online-Kommunikation ohne Aneig-
nungshandlungen und fortwährenden Austausch von Informationen ,,einfrieren" würde, be-
trachtet er Interaktivität, im Gegensatz zu den bislang beschriebenen Definitionen, nicht als
Charakteristikum eines Mediums, sondern als ein prozessbezogenes, variables Konstrukt von
Kommunikationsumgebungen.
64
Um den Begriff zu definieren, nutzt Rafaeli die Idee der
,,Abhängigkeit dritter Ordnung" (,,third order dependency") und macht die Existenz von In-
teraktivität somit vom Ausmaß abhängig, in dem sich Botschaften in einer Sequenz aufeinan-
der beziehen. In seiner Konzeptualisierung betrachtet er Interaktivität als ,,an expression of
the extent that in a given series of communication exchanges, any third (or later) transmission
(or message) is related to the degree to which previous exhchanges referred to even earlier
64
Vgl. Rafaeli/Sudweeks (1997).
20
transmissions."
65
Diese Begriffsbestimmung impliziert das Vorhandensein von ,,Responsivi-
tät" als Maß für die Fähigkeit eines Mediums, aufnahmefähig zu sein und auf den jeweiligen
Nutzer zu reagieren und erfordert, dass das Medium in der Lage ist, Informationen zu den
Eingaben und Handlungen des Nutzers zu registrieren und zu speichern.
66
Zudem müssten die
Botschaften einer Sequenz auch untereinander kohärent sein, das heißt aufeinanderfolgende
Nachrichten sind durch frühere bedingt oder von ihnen abhängig. Ausgehend davon identifi-
ziert Rafaeli drei progressive Niveaus an Interaktivität, die entlang eines Kontinuums ange-
ordnet sind, welches mit nicht-interaktiver Ein-Weg-Kommunikation (z.B. Fernsehausstrah-
lungen) beginnt und bis hin zu vollständig interaktiver Kommunikation führt. Letztere impli-
ziert, dass spätere Botschaften in einer Sequenz sich nicht nur auf die unmittelbar vorherge-
henden beziehen, sondern auch die Art und Weise berücksichtigen, in der frühere Botschaften
aufeinander bezogen waren. Dies schließt nicht nur ein, dass die Kommunikationsrollen von
Sender und Empfänger austauschbar sind, sondern erfordert zudem, dass die Interagierenden
aufeinander reagieren. Zwischen den beiden Polen des Kontinuums verortet Rafaeli zum ei-
nen Zwei-Wege-Kommunikation, die voraussetzt, dass Informationen in beide Richtungen
gesendet werden können, und zum anderen reaktive Kommunikation, bei der sich eine Bot-
schaft auf die jeweils vorhergehende bezieht.
67
Mit dieser Definition drückt Interaktivität nicht nur das Ausmaß aus, in dem Kommunikation
Reaktion überschreitet, sondern wird zudem zur Bedingung für Kommunikation, in deren
Verlauf sich simultane und kontinuierliche Austausche vollziehen.
68
Das Ideal dieser Respon-
sivität und Kohärenz der Botschaften ist, wie schon bei Durlak, face-to-face-Kommunikation.
Trotz seiner Bedeutung für den theoretischen Diskurs zu ,,Interaktivität" ist auch dieser An-
satz begrenzt, da einerseits durch Ausblendung der technologischen und individuellen Fakto-
ren von Interaktivität der Begriff lediglich eindimensional betrachtet wird, und andererseits
die Art der Zusammenhänge zwischen Online-Aktivitäten nicht geklärt ist. Ist die Kohärenz
zum Beispiel hoch oder niedrig? Und bezieht sie sich auf ein Feedback, auf das Auswählen
vorgegebener Optionen oder auf symmetrische Reziprozität?
69
Dennoch markiert Rafaelis Abkehr von der Betonung des Kommunikationskanals hin zum
Konzept der ,,Abhängigkeit dritter Ordnung" ein wichtiges Element von Interaktivität. Ergän-
zend verweist Williams auf den Faktor der Kontrolle, er beschreibt ihn als ,,the degree to
65
Rafaeli (1988), S. 111.
66
Vgl. Jensen (1999), S. 174.
67
Vgl. Schultz (1999).
68
Vgl. Rafaeli/Sudweeks (1997).
69
Vgl. Bucher (2004), S. 140.
21
which participants in a communication process have control over, and can exchange roles in,
their mutual discourse is called interactivity."
70
In ähnlicher Weise definiert Everett M. Rogers Interaktivität als ,,the capability of new media
communication systems (usually containing a computer as one component) to `talk back' to
the user, almost like an individual participating in a conversation."
71
Auch er versteht das
Phänomen als ein Kontinuum, welches zwischen Kommunikationstechnologien niedriger
(Presse, Radio, Film, Fernsehen), mittlerer (Teletext) und hoher Interaktivität (Computer-
kommunikation via Videotext, interaktives Kabelfernsehen, Telekonferenzen via Computer,
elektronische Nachrichtensysteme etc.) oszilliert. Wie schon Millers Kategorisierung ver-
bleibt aber auch dieses Klassifikationsmuster ohne explizite Kriterien für die Einordnung der
Medien auf dem Interaktivitätskontinuum: Es ist eng an die aktuellen Technologien seiner
Zeit gebunden und basiert auf einer relativ groben Definition von Interaktivität.
72
Zusammenfassend erweisen sich Definitionen, die auf die Umgebung der Kommunikation
fokussieren, zwar als sehr fruchtbar, da wichtige Elemente von Interaktivität, wie die Kohä-
renz und der Zusammenhang zwischen Botschaften, die Möglichkeit zum Rollenwechsel und
auch die Verteilung der Kontrolle zwischen den Teilnehmern der Kommunikation themati-
siert werden. In ihrer Eindimensionalität sind dabei auch diese Konzeptionen, wie schon die
technologieorientierten Begriffsbestimmungen, nicht in der Lage, das Konzept ,,Interaktivität"
jenseits der angesprochenen Teilaspekte in seiner Gesamtheit zu erfassen.
Einen dritten Baustein in Richtung einer ,,ganzheitlichen" Definition bilden Sichtweisen, die
die Wahrnehmung des Nutzers in den Mittelpunkt stellen.
2.3.1.3 Betonung der Wahrnehmung
Begriffsbestimmungen, die Interaktivität als Wahrnehmung sehen, sind gegenüber den beiden
schon erläuterten Arten der Definition in der Minderheit. Einige der wenigen Verfechter die-
ser Sichtweise sind Newhagen et al., die Interaktivität als psychologische Variable definie-
ren,
73
oder Chen, der technikdeterministischen Hoffnungen entgegnet, Passivität und Interak-
tivität seien Merkmale der Menschen, die ein Medium nutzen, nicht der Medien per se.
74
Die-
se Ansätze bleiben aber eine Erklärung schuldig, warum einige Technologien mehr Interakti-
vität erlauben als andere.
70
Kiousis (2002), S. 368.
71
Rogers (1986) zitiert in Jensen (1999), S. 172.
72
Vgl. Jensen (1999), S. 173.
73
Newhagen et al. (1995) zitiert in Kiousis (2002), S. 361.
74
Vgl. Downes/McMillan (2000), S. 160.
22
Auch Wu versteht Interaktivität als eine Variable, die im Bewusstsein des Einzelnen residiert
und bemerkt in diesem Zusammenhang, dass die Wahrnehmungen von Interaktivität Einfluss
auf die Bewertung von Websites durch die Nutzer haben.
75
Eine Brücke zwischen Aspekten der Kommunikationsumgebung und Aspekten der Wahr-
nehmung schlägt schließlich Sundar, indem er Interaktivität ebenfalls eng mit Kohärenz ver-
bindet, diesen Zusammenhang jedoch als Schlüssel für das Empfinden von Interaktivität
durch die Nutzer festlegt: ,,the key perceptual determinant of interactivity seems to lie in the
relatedness of the links and the corresponding pages, that is, the overall navigational structure
of the Web site."
76
2.3.2 Mehrdimensionale Definitionen von Interaktivität
Um die offensichtlichen Beschränkungen der beschriebenen Definitionskategorien zu über-
winden, haben vor allem in den vergangenen fünf Jahren verschiedene Autoren versucht, In-
teraktivität als multidimensionales Konzept zu begreifen und die einzelnen Dimensionen in
einem theoretischen Rahmen zu verbinden. Dieser ,,ganzheitliche Blick" verspricht eine ana-
lytische Bewältigung der kommunikativen Komplexität von Online-Medien, denn die ,,in den
unterschiedlichen Theorien aufgeworfenen Fragen, ob Interaktivität ein Merkmal des Nut-
zungskontextes, des Angebots, der Technik oder der Wahrnehmung des Nutzers darstellt,
führen insofern in die Irre, als sie versuchen, einen der Definitionsaspekte zu verabsolutieren
[...]. Eine umfassende Klärung des Begriffs muss all diese Dimensionen und Gesichtspunkte
integrieren."
77
Definitionsversuche, die versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden, kön-
nen je nach Anzahl der berücksichtigen Dimensionen bzw. Arten von Interaktivität in zwei-
dimensionale Modelle bis hin zu n-dimensionalen Konzepten untergliedert werden..
2.3.2.1 Zweidimensionale Konzeption von Interaktivität
Jennifer Stromer-Galley differenziert in ihrer Erläuterung des Begriffes zwischen zwei ver-
schiedenen Verwendungsweisen: computervermittelte menschliche Interaktivität und Interak-
tivität des Mediums an sich.
78
Erstere Kategorie bezieht sich auf Kommunikation zwischen
zwei oder mehr Menschen durch den Kanal eines Computernetzwerkes, wobei sich die Aus-
tausche in Echtzeit oder mit Verzögerung vollziehen können. Die Kommunikation gilt dann
75
Vgl. Kiousis (2002), S. 361.
76
Sundar/Kalyanaraman/Brown (2003) S. 48.
77
Bucher (2004), S. 137.
78
Vgl. Stromer-Galley/Foot (2002).
23
als interaktiv, wenn sie ein hohes Maß an Reflexivität und Responsivität aufweist und folglich
hierarchische, lineare Strukturen der Kommunikation unterläuft. Voraussetzung für die com-
putervermittelte menschliche Interaktion ist, dass alle Teilnehmer an der interaktiven Konver-
sation nicht nur über einen Kanal verfügen, der es ihnen erlaubt, Informationen zu senden und
zu erhalten, sondern auch die kognitiven Ressourcen besitzen, um am Austausch teilzuneh-
men.
Von dieser Art der Interaktivität trennt Stromer-Galley die sogenannte ,,media interaction",
also Interaktivität, die die Beschäftigung mit dem Medium an sich betrifft. Hierbei wird be-
tont, dass der Nutzer mit dem Medium interagieren kann, ohne direkt mit anderen Personen
zu kommunizieren, und die Struktur des Hypertextes eine ,,flüssigere" Erfahrung als mit ande-
ren Medien ermöglicht. ,,Media interaction" erfolgt zum Beispiel durch das Anklicken von
Hyperlinks oder das Herunterladen von Informationen aus dem Internet.
79
2.3.2.2 Dreidimensionale Konzepte von Interaktivität
Eine differenziertere Form der Untergliederung von Interaktivität vollzieht Bohdan O.
Szuprowicz mit seinem, auf der Art der multimedialen Informationsflüsse basierenden An-
satz. Ausgehend davon, wer mit wem interagiert, unterscheidet er zwischen drei grundsätzli-
chen Formen, Interaktivität zu ermöglichen:
80
a) ,,User-to-User"- Interaktivität: Diese Form der Interaktivität bezieht sich auf Informa-
tionsflüsse, die eine direkte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Nutzern
ermöglichen und in Echtzeit funktionieren.
b) ,,User-to-Documents"- Interaktivität: Inhalt dieser Kategorie sind erstens Interaktionen
mit Dokumenten (das Lesen von Dokumenten und Navigieren in ihnen), zweitens In-
teraktionen mit den Urhebern der Dokumente (z.B. E-Mail an Produzenten), und drit-
tens die Herstellung eigener Dokumente. Zwar verschwimmen dadurch die Grenzen
zwischen Leser und Schreiber, allerdings bleibt der Grad an Interaktivität relativ be-
schränkt, da in Bezug auf die ersten beiden Fälle keine oder nur geringe Möglichkei-
ten bestehen, den Inhalt zu verändern.
c) ,,User-to-System"- Interaktivität: Diese dritte Klasse beinhaltet Mensch-Maschine-
Interaktionen, die auf dem Interaktionsbegriff der Informatik beruhen.
79
Vgl. Stromer-Galley (2000), S. 118.
80
Vgl. Szuprowicz (1995) erklärt in Jensen (1999), S. 176 f. und Vgl. Marotzki (2004). S. 119 f.
24
Die drei grundsätzlichen Arten, auf die Interaktivität ermöglicht werden kann, kombiniert
Szuprowicz in einer Matrix mit anderen Faktoren, von denen die Informationsflüsse abhängig
sind und ordnet den jeweiligen Kombinationen Beispiele zu (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Interaktivitätsmatrix von Szuprowicz
81
User-to-Documents
User-to-Computer User-to-User
objektorientierte
Manipulation
Mail Datenbank
Groupware
,,Broadcast"
Newsletter Informationskiosk Präsentation
interaktiver Zugang
Hypermedia
graphisches Nutzer-
Interface
Konferenz, Weiterbil-
dung
Szuprowicz` Ansatz hat den Vorteil, logisch zwischen verschiedenen Traditionslinien von
Interaktivität zu differenzieren. Jedoch wird aus der Matrix ersichtlich, dass die Unterschei-
dung zwischen ,,User-to-Documents"- und ,,User-to-System"- Interaktivität kaum trennscharf
erfolgen kann. In Bezug auf Anwendungsbeispiele ist oft schwer zu bestimmen, ob die Inter-
aktivität auf ein Dokument oder eine Plattform ausgerichtet ist. In der Theorie wie auch in
ihrer praktischen Umsetzung ist diese Unterscheidung vor allem von subjektiven Einschät-
zungen bestimmt, denn ,,the very formulation of the difference appears to refer mostly to the
,degree of manipulability' rather than an actual qualitative difference."
82
Ein weiteres, etwas einfacheres Konzept dieser Kategorie stellt Biebers und Leggewies ,,Drei-
teilung" des Interaktivitätsbegriffes dar.
83
Technische Rahmensetzungen, Nutzer- und Rezep-
tionsebene sowie Inhalte und Inhaltsstrukturen bilden die Dimensionen und spiegeln die drei
Formen kommunikationswissenschaftlicher Definitionen aus Kapitel 2.3.1 wider. Zwar ver-
zichten Bieber und Leggewie auf eine explizite Erklärung der Kategorien, benennen aber fol-
gende miteinander verbundene Faktoren interaktiver Kommunikation:
1.) die technische Apparatur, als Bestimmungsgröße der Geschwindigkeit, der Reichwei-
te, der Flexibilität und der sensorischen Komplexität der Kommunikation,
2.) das Setting der Kommunikation, welches determiniert wird durch soziale Präsenz bzw.
Abwesenheit und ,,Abhängigkeit dritter Ordnung" zwischen den Botschaften und
81
Vgl. Jensen (1999), Fig. 5., S. 176.
82
Ebd. (1999), S. 177.
83
Vgl. Leggewie/Bieber (2004), S. 13.
25
3.) die psychische Struktur der Beteiligten, die die subjektiven Wahrnehmungen von
Technik und Setting betrifft.
84
Diese Systematisierung ist vor allem einleuchtend, da sie die drei Dimensionen des Interakti-
vitätsbegriffes übersichtlich zusammenführt und so als sinnvolle Grundlage für empirische
Untersuchungen des Phänomens dienen kann. Dennoch ist der Begriff damit nur in seinem
Bedeutungsausmaß umrissen, nicht aber definiert.
2.3.2.3 Vierdimensionale Konzeption von Interaktivität
Lutz Goertz stützt sich bei seiner Erläuterung des Interaktivitätsbegriffs auf die beiden nach-
stehenden Leitfragen:
o
,,In welchem Maße ist eine Medienanwendung in der Lage, sich auf die individuellen Be-
dürfnisse der Beteiligten ,einzustellen'?
o
Welche Medienanwendungen bieten dem Beteiligten den größten Handlungsspielraum?"
85
Dabei betrachtet er das Gespräch als Ideal der interaktiven Kommunikation, denn er vermutet
hier das größte Einfühlungsvermögen in den/die Kommunikationspartner. Um ,,Interaktivität"
adäquat zu erfassen, schlägt Goertz zudem die Einführung neuer Begriffe vor: Unter anderem
verwendet er statt ,,Rezipient" den Ausdruck ,,Beteiligter", denn dieser könne nun auch in den
Kommunikationsprozess eingreifen. Er verwendet ,,Kommunikationsstruktur", um die Um-
schreibung ,,Medium im technischen Sinne" zu ersetzen, da aufgrund der veränderten Me-
dientechnik unterschiedliche Geräte nun funktional gleiche Aufgaben wahrnehmen würden
bzw. ein Gerät unterschiedlichen Funktionen dienen könnte. Außerdem wird, um die Leistung
eines Endgerätes, also das Medium als Angebot oder Dienst zu erfassen, der Begriff ,,Me-
dienanwendung" (Bsp.: E-Mail, Fernsehempfang) eingeführt.
86
Aus diesen Überlegungen heraus entwickelt Goertz vier konstitutive Bedeutungsdimensionen
von Interaktivität, die er auch als Faktoren für das Einfühlungsvermögen in die jeweiligen
Kommunikationspartner versteht:
1) der Grad der Selektionsmöglichkeiten
2) der Grad der Modifikationsmöglichkeiten
3) die quantitative Größe des Selektions- und Modifikationsangebots
4) der Grad der Linearität/ Nicht-Linearität.
84
Vgl. Leggewie/Bieber (2004), S. 9.
85
Goertz (1995), S. 107.
86
Vgl. ebd. (1995),S. 107.
26
Jede der vier Dimensionen soll ein Kontinuum darstellen, wobei mit zunehmender Größe
bzw. zunehmendem Grad eines Faktors auch die Responsivität und folglich die Interaktivität
steigt. Zudem lässt sich aus den vier Dimensionen ein Summenindex bilden, der als Gesamt-
skala für Interaktivität dienen kann.
Trotz, aber auch gerade wegen der vierdimensionalen Konzeptionierung von ,,Interaktivität"
weist Goertz' Definition zwei Nachteile auf. Zum einen dient ihm das technische Potenzial
einer Kommunikationsstruktur als definitorische Basis, während die nutzerseitige Verwirkli-
chung von Interaktivität außen vor bleibt. Zum anderen ergeben sich aus den vier Bedeu-
tungskategorien mehr als 500 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten eine Größe, die in
der Forschungspraxis kaum zu bewältigen ist und eine gewisse Redundanz zwischen den Di-
mensionen nach sich zieht.
87
2.3.2.4 Fünfdimensionale Konzeption von Interaktivität
Schwer in diese Übersicht an Definitionen einzuordnen ist Sally McMillans und E. Downes`
Verständnis von Interaktivität, da sie mit verschiedenen Systematisierungen arbeiten. Basis
ihrer, explizit auf computervermittelte Kommunikation bezogenen theoretischen Ausführun-
gen bildet jedoch eine Aufgliederung des Begriffes in fünf Faktoren:
88
1) Richtung der Kommunikation,
2) Flexibilität in der Wahl des Zeitpunktes der Kommunikation (,,Timing"),
3) Ortsgefühl (,,Sense of place"),
4) Grad an Kontrolle und
5) Responsivität und das wahrgenommene Ziel der Kommunikation.
Als Kriterien für hohe Interaktivitätswerte gelten dabei größtmögliche Flexibilität in Bezug
auf Kommunikationszeit und -richtung, ein hohes Maß an Kontrolle des Nutzers über den
Kommunikationsvorgang und ein ausgeprägtes Ortsgefühl.
89
Mit Hilfe dieser Faktoren unterscheiden Downes und McMillan zwischen zwei Interaktivi-
tätsmodellen: ,,perception-based" und ,,feature-based models of interactivity". Erstere, teil-
nehmerbasierte Dimension betreffend, besteht oder realisiert sich Interaktivität in der Wahr-
nehmung der Nutzer: In ihren Aktionen entscheidet sich, ob ein Interface als interaktiv gelten
kann oder nicht.
87
Vgl. Jensen (1999), S. 180.
88
Vgl. Kiousis (2002), S. 362.
89
Vgl. Bieber (1999), S. 37.
27
Die zweite, auf der Botschaft basierende Dimension stellt das Interface in den Mittelpunkt,
fokussiert also darauf, welche Möglichkeiten, interaktiv zu agieren implementiert sind. Auch
in diesem Modell bildet jede der Unterdimensionen ein Kontinuum, wobei Interaktivität in
dem Maß zunimmt, in dem
·
Zwei-Wege-Kommunikation allen Teilnehmern aktive Kommunikation ermöglicht (Rich-
tung),
·
das Timing der Kommunikation flexibel genug ist, um den zeitlichen Anforderungen der
Teilnehmer gerecht zu werden (Zeit) und
·
die Umgebung der Kommunikation ein ausgeprägtes Ortsgefühl schafft.
90
Die speziellen, auf die Wahrnehmung der Teilnehmer bezogenen Interaktivitätspotenziale der
Online-Kommunikation präzisiert McMillan im Modell einer ,,Cyberinteraktivität".
91
Ausge-
hend von den beiden Annahmen, dass Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den Partizipie-
renden wechselseitig hin und her fließt und die Empfängerkontrolle eine Schlüsseldimension
computerbasierter Informations- und Kommunikationssysteme darstellt, entwickelt sie ein
vierteiliges Schema der ,,Cyberinteraktivität", welches in Abbildung 3 dargestellt ist.
Abbildung 3: Vierteiliges Modell der ,,Cyberinteraktivität"
92
Richtung der Kommunikation
Ein-Weg Zwei-Wege
hoch
Feedback (Kommunikation
vom Empfänger zum Sender)
wechselseitiger Diskurs (Rol-
len sind austauschbar)
Level der
Kontrolle
durch Emp-
fänger
niedrig
Monolog (Kommunikation vom
Sender zum Empfänger)
responsiver Dialog
Den Monolog als typische unidirektionale Kommunikationsweise mit der kommunikativen
Funktion der Überzeugung verortet McMillan auf den meisten Websites von Unternehmen.
Dieser ,,Marketing-Kommunikation" schreibt Christoph Bieber nur einen geringen Interakti-
vitätsgrad zu.
93
Feedback ist zwar ebenfalls auf Ein-Weg-Kommunikation begrenzt, erlaubt
dem Empfänger gleichwohl eine begrenzte Beteiligung am Kommunikationsprozess, z.B.
über Links zu E-Mail-Formularen. Dennoch bleiben die Rollen von Sendern und Empfängern
90
Vgl. Downes/McMillan (2000), S. 173.
91
Vgl. McMillan (2002), S. 275 f.
92
Vgl. ebd. (2002), S. 276.
93
Vgl. Bieber (1999), S. 37.
28
immer klar getrennt und es gibt keine Garantie, dass der eigentliche Sender wiederum auf das
erhaltene Feedback antwortet.
Wechselseitiger Diskurs als Kommunikationsform im mittleren Bereich des Interaktivitäts-
kontinuums ermöglicht einerseits Zwei-Wege-Kommunikation, andererseits verbleibt die
Kontrolle weitgehend bei dem Sender. Typisch für derartige ,,virtuelle Märkte" sind Techni-
ken der Registrierung, um den Kommunikationsprozess zu überwachen. Diese sind unter an-
derem in Anwendungen im Bereich Online-Shopping oder auf Websites, die nach der Teil-
nahme von ehrenamtlichen Helfern suchen, zu finden.
Spitzenwerte hinsichtlich der Interaktivität erzielen Anwendungen, die wechselseitigen Dis-
kurs ermöglichen.
94
Sie erlauben auch den Empfängern ein hohes Maß an Kontrolle über die
kommunikative Erfahrung. Die Rollen von Sendern und Empfängern sind kaum zu unter-
scheiden. Wechselseitige Diskurse finden sich zum Beispiel in Chats, Bulletin Boards und
offenen Diskussionsforen, welche als ,,virtuelle Gemeinschaften" funktionieren.
2.3.2.5 N-dimensionale Konzeption von Interaktivität
Von ihrem Grundgedanken her steht Carrie Heeter in der Tradition wahrnehmungsbezogener
Erklärungen von Interaktivität, da sie Interaktivität davon abhängig macht, inwieweit das je-
weilige Medium den Nutzer versteht (Responsivität), d.h. inwieweit sich Medien auf die
Wünsche und Eigenheiten des Nutzers einstellen können.
95
Gleichzeitig ,,entdeckt" sie Interaktivität auch in den Teilelementen eines Kommunikations-
mediums, wobei die Zahl der vorhandenen interaktiven Elemente den gesamten Interaktivi-
tätsgrad zum Beispiel einer Website bestimmt. Im Verlauf ihrer Untersuchungen zu Interakti-
vität in entstehenden Mediensystemen beobachtet Heeter unter anderem, dass Informationen
durch den Nutzer immer gesucht oder selektiert und nicht nur durch den Produzenten gesen-
det werden. Zudem erforderten verschiedene Mediensysteme unterschiedliche Stufen an Nut-
zeraktivität, womit sich Aktivität sowohl als Eigenschaft des Rezipienten als auch des Medi-
ums konzeptionalisieren ließe.
96
Aus diesen Beobachtungen heraus beschreibt Heeter erhöhte Interaktivität als primäres
Merkmal neuer Technologien, welches in sechs, jeweils kontinuierliche Dimensionen zerlegt
werden könne:
97
1. Komplexität der Wahlmöglichkeiten,
94
Diese werden von Bieber
[0]
als ,,virtuelle Gemeinschaften" bezeichnet.
95
Vgl. Goertz (1995). S. 101.
96
Vgl. Heeter (2000).
97
Vgl. Kiousis (2002), S. 361.
29
2. Anstrengung, die ein Nutzer aufwenden muss,
3. Verständnis für die Eingaben des Nutzers (Responsivität),
4. Aufzeichnung und Überwachung der Informationsnutzung,
5. Möglichkeiten, eigene Informationen hinzuzufügen,
6. Erleichterung der interpersonalen Kommunikation.
Allerdings ist auch diese Konzeptualisierung nicht ganz unproblematisch. So kritisiert zum
Beispiel Goertz die Dimensionen als nicht trennscharf, da die notwendige Anstrengung eines
Nutzers von der Komplexität der Wahlmöglichkeiten abhänge: ,,Je größer die Wahlmöglich-
keiten, desto größer der ,gedankliche Aufwand' des Nutzers."
98
Zudem stellt er die Validität
der Dimensionen als Indikator für Interaktivität in Frage. Die Aufzeichnung der Informati-
onsnutzung sei eher eine ,,Begleiterscheinung" interaktiver Medien, während eine leicht
durchführbare Messung und Beobachtung seiner Nutzung ein Medium nicht interaktiver ma-
che.
99
Ein dritter Kritikpunkt bezüglich Heeters Interaktivitätsbegriff bezieht sich auf die Zahl der
Dimensionen, welche den Komplexitätsgrad der Definition stark erhöhe und damit eine An-
wendung in der Praxis erschwere.
100
Dieser Nachteil betrifft die meisten der mehrdimensiona-
len Konstrukte von Interaktivität. Zwar definieren sie den Begriff genauer und umfassender
als Konzepte, die sich auf ein Teilphänomen beschränken, können aber oft nur schwer die
richtige Balance zwischen theoretischer Exaktheit und praktischer Anwendbarkeit auf existie-
rende Kommunikationstechnologien finden.
2.4 Gemeinsamkeiten der Definitionen und ,,Neudefinition" von Interaktivität
2.4.1 Gemeinsamkeiten der bisherigen Definitionen
Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe, Schwerpunkte und Ausformulierungen weisen die
bisher erläuterten Definitionen einige Gemeinsamkeiten und Parallelen auf. Wenn auch keine
Einigkeit hinsichtlich der genauen Bedeutung von ,,Interaktivität" herrscht, so finden sich
zumindest einige wiederkehrende Phänomene, die von fast allen Autoren im Zusammenhang
mit dem Konzept diskutiert werden.
Zwei-Wege-Kommunikation als Potenzial einer Technologie bzw. eines Mediums bildet den
Minimalkonsens aller Theoretiker. Damit im Zusammenhang steht der Anspruch, die Rollen
98
Goertz (1995), S. 104.
99
Vgl. ebd. (1995),S. 105.
100
Vgl. Jensen (1999), S. 182.
30
von Sender und Empfänger müssten zwischen den Teilnehmern der interaktiven Erfahrung
frei austauschbar sein, wobei als Kommunikatoren Menschen oder Maschinen fungieren
könnten. Weitergehend sollten die Individuen in der Lage sein, Inhalt, Form und Fortschritt
einer medial vermittelten Umgebung zu manipulieren.
101
In Bezug auf den Zusammenhang und die Kohärenz zwischen ausgetauschten Botschaften
wird des weiteren oft auf Rafaelis Konzept der ,,Abhängigkeit dritter Ordnung" verwiesen.
102
Außerdem definiert ein Großteil der Autoren Interaktivität als Kontinuum, das in verschiede-
nen Stufen wahrgenommen werden kann und/oder differenziert zwischen zwei oder mehr
Formen von Interaktivität.
Zwei weitere Themen, die sich in nahezu allen Definitionen finden, sind einerseits die Fakto-
ren Zeit und Geschwindigkeit und andererseits das Ideal der face-to-face- Kommunikation.
Das traditionelle Leitbild vieler Konzeptionen von ,,Interaktivität" sind Aktionen und Reakti-
onen in Echtzeit. Glaubt man Huhtamo, so basiert zum Beispiel ein interaktives System nicht
auf Warten, sondern auf konstanter (Re-)Aktion.
103
Rice und Williams betonen, Medien seien
nur interaktiv, wenn sie das Potenzial zu unmittelbarem Zwei-Wege-Austausch haben.
104
Allerdings ist Echtzeit als Grundvoraussetzung schwer in Einklang zu bringen mit asynchro-
nen Kommunikationserfahrungen, wie E-Mail oder Newsgroups, die indessen verbreitet als
interaktiv klassifiziert werden. Interaktive Erfahrungen müssen nicht immer schnell und in
Echtzeit sein. Wichtiger ist die Flexibilität in der Wahl des Zeitpunktes der Kommunikation
(,,message timing"), welche interaktive Kommunikation für Nutzer attraktiver macht. Unter-
scheidungen zwischen Geschwindigkeit und Flexibilität des Timings sowie zwischen objekti-
ven Standards von Geschwindigkeit und ihrer Wahrnehmung durch den Nutzer sind unum-
gänglich.
105
Kurzum, obwohl in vielen Definitionen als zentrales Charakteristikum aufgeführt,
stellt Kommunikation in Echtzeit keine Vorbedingung für Interaktivität dar.
Das zweite allgegenwärtige Thema im Diskurs um ,,Interaktivität" ist der Standard der face-
to-face-Kommunikation. Hans-Jürgen Bucher vergleicht Online-Kommunikation mit face-to-
face-Dialogen, da die menschlichen Teilnehmer jeweils Fortsetzungserwartungen als Basis
für das Verstehen der Kommunikationszusammenhänge bilden.
106
101
Vgl. Kiousis (2002), S. 368.
102
Vgl. Kapitel 2.3.1.2.
103
Vgl. Huhtamo (1998), S. 107.
104
Vgl. Downes/McMillan (2000), S. 159.
105
Vgl. Kiousis (2002), S. 368 f.
106
Vgl. Bucher (2004), S. 141.
31
Dieses Ideal erweist sich aber als problematisch, da es nur schwer mit den Möglichkeiten von
,,one-to-many"- und ,,many-to-many"-Kommunikation in Übereinstimmung zu bringen ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten interaktiven Erfahrungen mit technisch vermit-
telten Umgebungen in Zusammenhang stehen und somit die Formulierung ,,face-to-face" und
mit ihr verbundene Assoziationen (z.B. körperliche Anwesenheit) diesen Umgebungen nicht
gerecht werden. Passender erscheint auf begrifflicher Ebene deshalb die Formulierung ,,inter-
personale Kommunikation", um auf typische Charakteristika menschlicher Gespräche, wie
Responsivität zwischen Kommunikationsteilnehmern, hinzuweisen.
107
Zusammenfassend ist
wichtig, dass Interaktivität weder auf zwei Personen begrenzt ist noch auf Kommunikation
,,von Angesicht zu Angesicht".
Welche Anforderungen an eine Definition von ,,Interaktivität" lassen sich nun aus dieser Lite-
raturanalyse ableiten?
Zunächst sollte ,,Interaktivität" als eine relationale Variable kategorisiert werden. Auf
individuellem Niveau erfährt diese ihre Bedeutung in der Wahrnehmung der Nutzer, während
sie als Merkmal eines Mediums in dessen Form und Inhalt, in der Struktur der Technologie
sowie in der Beziehung zum Nutzer sichtbar wird.
Die Konvergenz neuer Technologien verwischt die Grenzen zwischen traditionellen und neu-
en Medien, weshalb Konzepte von ,,Interaktivität" in eine hybride Definition integriert wer-
den müssen.
108
Unangemessen sind deshalb Definitionen, die zu eng auf bestimmten histori-
schen Technologien beruhen oder ,,Interaktivität" auf Basis von Prototypen beschreiben.
109
Besser und flexibler ist eine Beschreibung von ,,Interaktivität" als Kontinuum, dessen Klassi-
fikationsprinzip auf formaler Ebene eindeutig sein und einheitlich gehandhabt werden sollte.
Des weiteren erfordert das Konstrukt eine Zerlegung in mehrere Dimensionen, von denen jede
wiederum ein Kontinuum bildet. Zudem sollten die Dimensionen trennscharf und wider-
spruchsfrei sein.
110
Eine einleuchtende und empirisch brauchbare Definition, die all diese Anforderungen erfüllt,
stellt meiner Meinung nach Spiro Kiousis` Konzept dar, welches als ,,Neudefinition" des Beg-
riffes im folgenden Kapitel der theoretischen Auseinandersetzung mit ,,Interaktivität" erläutert
wird.
107
Vgl. Kiousis (2002), S. 363.
108
Vgl. ebd. (2002), S. 379.
109
Dies betrifft z.B. im ersten Fall Rockley Millers Definition und im zweiten Durlaks ,,Typologie interaktiver
Medien" (Kapitel 2.3.1.1).
110
Vgl. Goertz (1995), S. 105.
32
2.4.2 ,,Neudefinition" des Begriffes
111
Kiousis identifiziert ,,Interaktivität" als Mediums- und als psychologische Variable, indem er
das Konzept zunächst in drei Hauptdimensionen untergliedert:
·
die Struktur des jeweiligen Mediums,
·
den Kontext der Kommunikationsumgebung und
·
die Wahrnehmung der Nutzer.
Auf dieser Basis legt er fest: ,,Interactivity can be defined as the degree to which a communi-
cation technology can create a mediated environment
·
in which participants can communicate (one-to-one, one-to-many, many-to-many),
·
both synchronously and asynchronously,
·
and participate in reciprocal message exchanges (third order dependency).
With regard to human users it additionally refers to their ability to perceive the experience as
a simulation of interpersonal communication and increase their awareness of telepresence."
112
Unter ,,Kommunikationstechnologie" versteht Kiousis dabei alles vom Telefon bis zum Com-
puter und unter ,,medial vermittelter Umgebung" alles vom Telefonkabel bis zu virtueller Re-
alität.
,,Kommunikation" umfasst sowohl lineare als auch nicht-lineare Kommunikationspfade und
kann zwischen einfachen Informationstransfers aber auch ausgeklügelten Bewegungen in Vi-
deospielen oder im World Wide Web variieren. Zudem schließt diese Definition sowohl syn-
chrone und asynchrone Kommunikation ein und untermauert damit das Kriterium der nutzer-
seitigen Flexibilität in der Wahl des Zeitpunktes.
Mögliche Beziehungen zwischen den Teilnehmern umfassen die Kommunikation Mensch-zu-
Maschine, Mensch-zu-Mensch via Maschine oder auch Maschine-zu-Maschine.
Telepräsenz erklärt Kiousis schließlich als die Fähigkeit eines Mediums, eine Umgebung her-
zustellen, die, in den Köpfen der Kommunikationsteilnehmer, Vorrang gegenüber der aktuel-
len physischen Umgebung hat.
So umfassend und flexibel diese Definition auch zu sein scheint, klar ausgeschlossen wird
,,pure" interpersonale Kommunikation, das heißt technologisch vermittelte Kommunikation
ist ein wichtiges Merkmal von ,,Interaktivität". Außerdem werden Wahrnehmungen explizit
auf Menschen begrenzt.
111
Vgl. Kiousis (2002), S. 372 ff.
112
Ebd. (2002), S. 372.
33
Empirisch beobachtbar wird ,,Interaktivität" damit, wenn:
1. wenigstens zwei Teilnehmer (menschlich oder nicht-menschlich) an der Kommunika-
tion beteiligt sind,
2. eine Technologie präsent ist, die einen medial vermittelten Informationsaustausch
ermöglicht (z.B. Computer Chatroom), und
3. die Möglichkeit für Nutzer besteht, die medial vermittelte Umgebung zu modifizie-
ren.
113
2.5 Zweck und Grenzen von Interaktivität
2.5.1 Wirkungen und Zwecke von Interaktivität
Die weitreichende Definition des Begriffs weist darauf hin, dass ,,Interaktivität" kein einfa-
ches Medienphänomen ist, sondern dass das Aufkommen interaktiver Kommunikationsräume
einen qualitativen Sprung in der Medienevolution mit Folgen für die gesellschaftliche Kom-
munikation nahe legt.
114
Diese potenziellen, oft ideologisch eingefärbten und vieldiskutierten
Folgen von ,,Interaktivität" auf der Ebene des gesellschaftlichen bzw. politischen Systems
werden im Kapitel 3.2 dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem Konzept der ,,politischen
Partizipation" erörtert.
An dieser Stelle sollen stattdessen mögliche (und beabsichtigte) Wirkungen von Interaktivität
auf den individuellen Nutzer von Kommunikationstechnologien im Mittelpunkt stehen. Das
Konstrukt wird oft als treibende Kraft hinter computervermittelter Kommunikation bezeich-
net, die den Nutzer dazu ermächtigt ,,to become dynamically involved with the media" und
ihnen mehr Kontrolle über die kommunikative Erfahrung zuspricht.
115
Obwohl die real stattfindende Kommunikation oft nicht interaktiv im strengen Sinn der Defi-
nition ist, können dennoch die formalen Merkmale vollständig interaktiver Kommunikation
mehr Gleichheit der Teilnehmer und größere Symmetrie der kommunikativen Macht implizie-
ren als reaktive, einfache Zwei-Wege- oder gar Ein-Weg-Kommunikation.
116
Durch das Ab-
flachen der Hierarchie zwischen Sender und Empfänger hin zu einer eher symmetrischen
Wechselwirkung werden dem Rezipienten mehr Wahl- und Kontrollmöglichkeiten über den
Kommunikationsprozess eröffnet.
113
Vgl. Kiousis (2002), S. 370.
114
Vgl. Leggewie/Bieber (2004), S.14.
115
Vgl. Weare/Lin (2000). S. 275.
116
Vgl. Schultz (1999).
34
Ergänzend zu diesen strukturellen Charakteristika haben wahrnehmungsbezogene Untersu-
chungen ergeben, dass die Erhöhung der Interaktivität, zum Beispiel einer politischen Websi-
te, mit einem erhöhten Maß an Zuneigung und psychologischer Affinität, die ein Wähler ge-
genüber dem auf der Website vorgestellten Kandidaten verspürt, korrespondiert. Verstärkte
Möglichkeiten zur Interaktivität werden zudem mit größerer Zufriedenheit der Nutzer, einem
stärkeren Gefühl von eigener Wirksamkeit, verbesserter Erinnerung der rezipierten Inhalte
sowie mit Involvement und Zugehörigkeit in Verbindung gebracht.
117
Die Hoffnung, dass
erhöhte Interaktivität zu erhöhter Wahrscheinlichkeit von Verhaltensweisen, wie wiederhol-
tem Aufruf einer Webseite, Empfehlung der Seite oder Kauf in einem Onlineshop führt, ist
unter den Betreibern der entsprechenden Homepages weit verbreitet.
118
Demzufolge kann die
Integration interaktiver Elemente in einen Webauftritt als Strategie zur Steigerung der Attrak-
tivität der Homepage und im Sinne von Marketinganstrengungen zur ,,Kundenbindung" ein-
gesetzt werden.
Neben dieser gezielten Beeinflussung der nutzerseitigen Wahrnehmung der kommunikativen
Erfahrung soll auf einer vorgelagerten Stufe des Rezeptionsprozesses Aufmerksamkeit für das
jeweilige Angebot generiert werden. Döbler und Stark bemerken, dass schon die Möglichkeit,
interaktiv zu agieren, Aufmerksamkeit zu wecken scheint.
119
Hinsichtlich politischer Websites betont Bieber Aufmerksamkeit als Voraussetzung, ,,um in
einer weitverzweigten, vernetzten, kommunikationsreichen und stark interaktiven Netzöffent-
lichkeit bestehen zu können."
120
Um sich als ,,zentrumsähnlicher Bereich" im Netz auszuwei-
sen, sei die beste Strategie, sich über interaktive Kommunikationsmodi ,,kommunikativ zu
öffnen", das heißt den Nutzer mit größerer Kontrolle auszustatten und das bislang passive
,,Publikum" stärker einzubinden. Als Ergebnis dieser Suche nach Aufmerksamkeit ,,wird es
nun zur vorherrschenden Geschäftsidee, den Nutzern Kommunikation zu ermöglichen
[...]."
121
Doch nicht nur die Produktionsseite setzt Interaktivität gezielt ein, um einen bestimmten
Zweck zu erreichen, sondern auch die Nutzer verfolgen in dieser Hinsicht bewusst oder un-
bewusst verschiedene Ziele. Rafaeli sieht zum Beispiel eine Art Ergänzungsmodus in der
Nutzung interaktiver Strukturen: Schon Medienanwendungen, die er in seiner Skala als reak-
117
Vgl. Sundar/Kalyanaraman/Brown (2003), S. 35.
118
Vgl. McMillan (2002a), S. 278.
119
Vgl. Döbler/Stark (2001), S. 2.
120
Bieber (1999), S. 191.
121
Ebd. (1999), S. 191.
35
tiv kennzeichnen würde, erlauben es, Medien als Substitut für Geselligkeit zu nutzen.
122
In
seiner Studie zur computervermittelten Gruppenkommunikation weist Rafaeli nach, dass On-
line-Gemeinschaften wiederum davon profitieren könnten, da weniger interaktive Anwendun-
gen des Netzes weniger stabile Mitgliedschaften aufweisen, während interaktivere Gruppen
ihre Mitglieder eher halten und andere wünschenswerte Ergebnisse, wie zum Beispiel größere
Kreativität, Produktivität und Zugehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern erzeugen könnten.
Diese Verbindung von Interaktivität und Langlebigkeit verdeutlicht wiederholt, dass Interak-
tivität nicht nur ein theoretisches Konstrukt darstellt, sondern auch praktischen Nutzen für die
Gestaltung von Internetanwendungen haben kann.
123
Ebenfalls auf der Ebene des einzelnen Nutzers setzt Hans-Jürgen Buchers Beschreibung von
Interaktivität als einer Art Orientierungshilfe an.
124
Ausgangspunkt für ihn ist die ,,Entbet-
tung" klassischer Kommunikationssituationen durch Online-Kommunikation im Internet, wo-
bei er darunter erstens die Aufhebung der Trennung von Autor und Publikum, zweitens die
Aufhebung von Zeit-, Raum-, (Medien-)Gattungs- und Speichergrenzen und drittens die zu-
nehmende Durchlässigkeit der Grenzen zwischen den Kommunikationsbereichen Medien,
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Privatsphäre fasst. ,,Entbettung" wird damit konzeptua-
lisiert als ,,das Herausheben sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusam-
menhängen und ihre unbegrenzte Raum-Zeit-Spannen übergreifende Umstrukturierung."
125
Der Begriff markiert für Bucher das Neuartige an Online-Kommunikation, lässt aber auch die
Risiken des kommunikativen Scheiterns steigen, denn in entbetteten Kommunikationsformen
würden ,,gesichtsabhängige Bindungen" durch ,,gesichtsunabhängige" ersetzt. Um dem resul-
tierenden Vertrauensdefizit entgegenzuwirken, könnten Nutzer die kommunikative Entbet-
tung interaktiv kompensieren. Dabei würde im kontrafaktischen Sinne, in der Aneignung des
digitalen Kommunikationsangebotes eine dialogische Situation durch den Nutzer unterstellt.
Nutzer setzen also voraus, dass das Angebot Handlungscharakter besitzt. Ihre Erschließungs-
und Deutungshandlungen beruhen dann auf einer antizipierten Dialogkonstellation. Diese
,,operative Fiktion" einer angenommenen interaktiven Grundkonstellation gleicht das Fehlen
und die Anonymität des Partner sowie raum-zeitliche Entgrenzungen und die Offenheit des
Kommunikationsverlaufes aus. Laut Bucher dient Interaktivität damit dem Zweck, eine Art
Gegenstück zu der, für Online-Medien typischen kommunikativen Entbettung zu bilden: ,,Wir
122
Rafaeli unterscheidet zwischen Zwei-Wege-, reaktiver und vollständig interaktiver Kommunikation (Vgl.
Kapitel 2.3.1.2).
123
Vgl. Rafaeli/Sudweeks (1997).
124
Vgl. Bucher (2004), S. 134 f.
125
Giddens (1996) zitiert in Bucher, S.134.
36
handeln als ob wir interagieren, um so die Anonymität, Adressatenoffenheit, die Verwischung
der Kommunikationsrollen, die unsichere Vertrauenslage und die raum-zeitlichen Distanzen
zu kompensieren. Die Virtualität der Online-Kommunikation wird auf diese Weise Teil unse-
rer Realität."
126
Wie lassen sich nun die möglichen Wirkungen und Zwecke der Integration interaktiver Ele-
mente in Online-Medien zusammenfassen?
Aus einer rein technischen und pragmatischen Perspektive wirken interaktive Kommunikati-
onszusammenhänge dem ,,Einfrieren" der Botschaftssequenzen und somit dem ,,Einfrieren"
des Kommunikationsflusses entgegen.
127
In Bezug auf die Kommunikationssituation entsteht
der Eindruck, dass dem Nutzer mehr Möglichkeiten zur Kontrolle der jeweiligen Erfahrung
eröffnet werden, wodurch unter anderem Aufmerksamkeit für das Online-Angebot, eine posi-
tive Einstellung zu diesem und eine generelle Bindung der Nutzer hervorgerufen werden sol-
len. Interaktivität wird zudem oft mit einem erweiterten Gemeinschaftsgefühl und höherer
Zufriedenheit der Teilnehmer assoziiert. Ein letzter Erklärungsansatz hinsichtlich des mögli-
chen Zwecks von Interaktivität, stellt schließlich die Unterstellung von Interaktivitätszusam-
menhängen durch den Nutzer dar, um der kommunikativen ,,Entbettung" durch neue Medien
entgegenzuwirken und sich online zurecht zu finden.
2.5.2 Grenzen von Interaktivität
Zwar ist der Begriff ,,Interaktivität" schillernd und sollte in einer hybriden, flexiblen Definiti-
on gefasst werden, jedoch lässt sich auch dieses Konzept nur bis zu einem bestimmten Grad
dehnen und anpassen, ohne den eigentlichen inhaltlichen Kern zu verwässern. Zwei deutliche
Grenzen markiert Kiousis selbst, indem er in seiner Definition den Aspekt der Wahrnehmun-
gen ausschließlich auf Menschen bezieht und ,,Interaktivität" nur als Potenzial technisch ver-
mittelter Kommunikation verstanden haben möchte. Keinesfalls darf dies aber als Gleichset-
zung von Interaktivität und computervermittelter Kommunikation aufgefasst werden, denn
nicht jede in CMC enthaltene Kommunikationstechnik wird zwangsläufig immer interaktiv
verwendet. Ganz im Gegenteil legen viele Studien sogar offen, dass diverse Nutzungsweisen
neuer Technologien weit davon entfernt sind, interaktiv zu sein.
128
Zum Beispiel suggerieren
sogenannte ,,pseudo-interaktive" Anwendungen lediglich eine aktive, inklusive und responsi-
126
Bucher (2004), S. 163.
127
Vgl. Fredin/David (1998), S. 36.
128
Vgl. Davis (1999), S. 91 f.; Ferber/Foltz/Pugliese (2003), S. 166; Gibson et al. (2003), S. 66; Levine (2003),
S. 52; Klinenberg/Perrin (2000), S. 17 und S. 34; Stromer-Galley (2000), S. 127 f.
37
ve Zwei-Wege-Kommunikation. Unter dieser Oberfläche sehen Bieber und Leggewie weitge-
hend begrenzte Auswahlmöglichkeiten aus starren Menüs, die lediglich minimale inhaltliche
Eingriffe ermöglichen.
129
Die Grenzen von Interaktivität scheinen sich weniger in begrifflichen Einschränkungen der
Definition zu finden, sondern werden momentan vor allem durch den eher zurückhaltenden
Einsatz interaktiver Elemente gezogen. ,,Die Implementation interaktiver Funktionen in eine
WWW-Präsentation erlaubt dem Nutzer grundsätzlich, in einen Dialog mit dem Anbieter zu
treten, auch wenn dieser Dialog nur zu den Bedingungen des Anbieters erfolgen kann, der ihn
durch die bereitgestellten Funktionen bestimmt. Unter technischen Gesichtspunkten müssen
für verschiedene interaktive Funktionen unterschiedliche Bedingungen erfüllt sein."
130
Fragen
der Macht und Kontrolle über Kommunikationsprozesse und -inhalte scheinen sich als kriti-
scher Faktor für den erweiterten Einsatz interaktiver Kommunikationsmodi im Internet zu
erweisen.
Zusätzlich verweisen mehrere Autoren auch auf ein nutzerseitiges Interesse an weniger Inter-
aktivität. Carrie Heeter hält das Angebot von mehr Interaktivität für nicht unbedingt wün-
schenswert, da unter Umständen ein schlecht designtes Interface mit vielen interaktiven
Strukturen mehr Aktionen des Nutzers erfordert und es länger dauern könnte, bis dieser sein
eigentliches Ziel erreicht hat.
131
Vor allem zum Zweck der Eindrucksbildung und gezielten Beeinflussung der Wahrnehmung
der Nutzer vermutet Shyam Sundar etwas wie ,,zu viel Interaktivität". Die Teilnehmer an der
kommunikativen Erfahrung könnten durch eine eventuelle Fragmentierung der Informationen
in zu viele Schichten und damit verbundene größere Anforderungen an die eigene Navigati-
onsleistung genervt sein, was wiederum zu einer negativeren Wahrnehmung des rezipierten
Inhaltes führen könnte.
132
Vor allem für Webseiten, die eine überzeugende Wirkung haben
sollen, wie im Falle der Homepages politischer Kandidaten, wäre dies äußerst kontraproduk-
tiv. Für deren Zwecke erscheinen eher reaktive Seiten sinnvoller als stark interaktive.
Technische Grenzen der Interaktivität könnten in der fehlenden Bandbreite der Übertra-
gungswege und/ oder in einer zu geringen Leistungsfähigkeit der Endgeräte liegen. Allerdings
sind diese Faktoren im Vergleich zu den gerade erwähnten Einschränkungen durch Interessen
129
Vgl. Leggewie/Bieber (2004), S. 9.
130
Kaiser (1999), S. 181.
131
Vgl. Heeter (2000).
132
Vgl. Sundar/Kalyanaraman/Brown (2003), S. 49.
38
der Anbieter bzw. Wahrnehmungen der Nutzer als weniger gravierend und leichter zu behe-
ben einzuschätzen.
3. Partizipation
Nicht ganz so umstritten wie der Terminus ,,Interaktivität", jedoch in ähnlich vielfältigen
Ausprägungen und mit normativen Konnotationen versehen, ist der ältere, politikwissen-
schaftliche Begriff der ,,Partizipation". Mit jedem Aufkommen eines neuen, elektronischen
Mediums, sei es Radio, Fernsehen, Kabelfernsehen oder zuletzt das Internet, werden im öf-
fentlichen Diskurs Stimmen laut, die Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft prophezeien,
erhoffen oder befürchten. Vor allem in Bezug auf computervermittelte Kommunikation schei-
nen dabei die beiden Konzepte der ,,Interaktivität" und ,,Partizipation" untrennbar miteinander
verbunden. Die Frage, wie sich diese Verbindung konkret gestalten könnte, wird dabei meist
ausgeblendet oder aber mit einem ideologisch eingefärbten Blick auf bestimmte demokratie-
theoretische Erwartungen thematisiert.
Aus einer neutralen Perspektive wäre deswegen zu klären, ob es sich zum Beispiel um gegen-
seitige Verstärkung oder eher um einen einseitigen Einfluss von interaktiven Angeboten auf
das Partizipationspotenzial handelt und inwieweit es möglicherweise Überschneidungen zwi-
schen beiden Begriffen gibt.
Die Existenz einer Beziehung zwischen dem Vorhandensein interaktiver Elemente und poli-
tisch orientierten Websites sowie sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu Kontaktaufnahme
und Teilhabe sollen an dieser Stelle nicht in Frage gestellt werden. Allerdings möchte ich die
Natur dieses Zusammenhangs untersuchen, um einerseits einschätzen zu können, inwieweit
beide Begriffe theoretisch miteinander in eine direkte Verbindung gebracht werden können,
und um andererseits eine Grundlage für die empirische Analyse der interaktiven Strukturen
auf den Websites von George W. Bush und John Kerry zu schaffen.
Zu diesem Zweck werden nach einer Definition von (politischer) Partizipation zunächst kon-
ventionelle Formen der Beteiligung, deren Funktionen und dahinterstehende Konzepte von
Demokratie erläutert. Anschließend wird von diesen ,,klassischen" Wegen der Teilhabe die
Brücke zum Internet geschlagen. Ausgehend von der Kontroverse um die demokratischen
Möglichkeiten neuer Medien sollen die tatsächlich vorhandenen Potenziale für Partizipation
via Internet herausgefiltert werden, um auf dieser Basis den Zusammenhang zwischen ,,Inter-
aktivität" und ,,Partizipation" zu untersuchen.
39
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832494476
- ISBN (Paperback)
- 9783838694474
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Leipzig – Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie, Kommunikations- und Medienwissenschaft
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- online-wahlkampf online-pr e-government präsidentschaftswahlen strukturanalyse websites
- Produktsicherheit
- Diplom.de