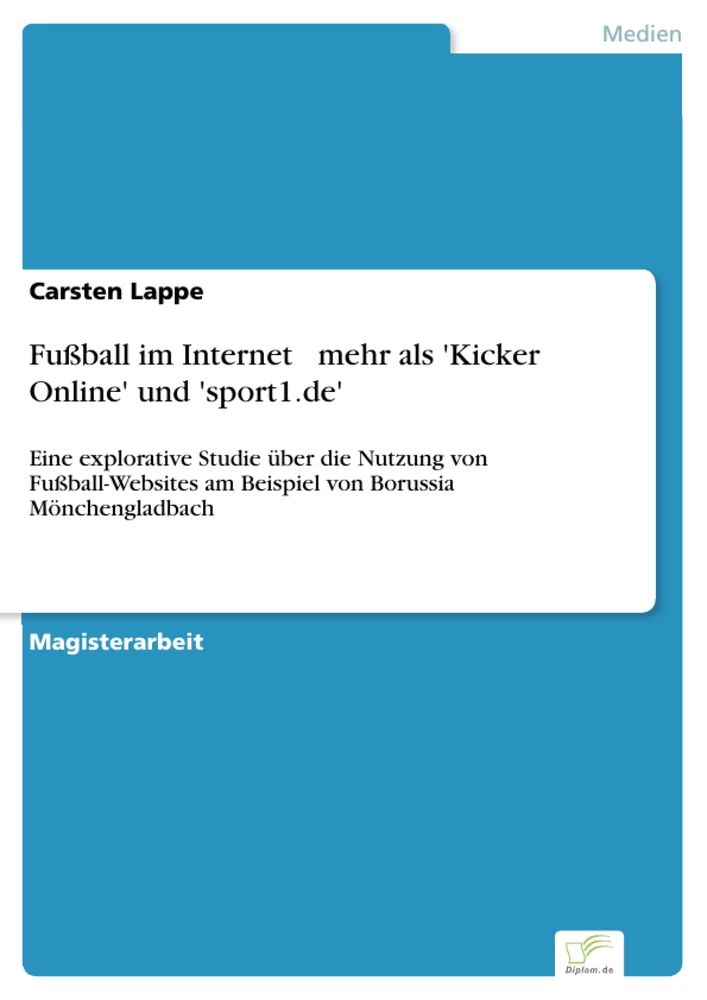Fußball im Internet - mehr als 'Kicker Online' und 'sport1.de'
Eine explorative Studie über die Nutzung von Fußball-Websites am Beispiel von Borussia Mönchengladbach
©2005
Magisterarbeit
187 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Arbeit ist grundsätzlich für alle interessant, die sich mit Fußball im Internet bzw. generell mit Fußballberichterstattung beschäftigen. Also gleichermaßen für Studenten, wissenschaftliche Assistenten, Doktoranden, Professoren, Sportjournalisten, Fußballvereine, Internetagenturen, Vermarktungsagenturen und viele mehr. Der Autor geht wissenschaftlich der Frage nach, wie sich Fußballfans im Internet informieren, worauf sie achten und was sie suchen.
Wenn sich Fußballfans im Internet informieren wollen, können sie dies auf sehr vielfältige Art und Weise tun. Den heutigen Internetbedingungen entsprechend ist das Angebot an Fußballwebsites immens. Trotz der hohen Auswahl herrscht bei den Nutzern jedoch keine Verwirrung, der Grad der selektiven Nutzung steigt stetig.
Mit Hilfe einer Online-Befragung der Anhänger von Borussia Mönchengladbach wird die Nutzung diverser Websites, die sich speziell mit diesem Verein befassen, untersucht. Dabei wird insbesondere das Verhältnis der verschiedenen Anbieter-Kategorien aus Sicht der Nutzer hinterfragt. Werden bei der selektiven Nutzung journalistische Angebote zielgerichtet angesteuert oder ist diesen durch alternative Anbieter oder PR-Angebote wie die Vereinshomepage borussia.de Konkurrenz erwachsen? Spielt der professionelle Sportjournalismus im Internet für die Anhänger noch eine Rolle als Informationsvermittler bzw. bietet er angesichts der unterschiedlichen Online-Kommunikatoren Orientierung? Darüber hinaus werden die möglichen Vorteile des WWW gegenüber den klassischen Medien für die Sportberichterstattung vorgestellt und basierend darauf gefragt, welche dieser Vorteile von den Angeboten umgesetzt und von den Anhängern genutzt werden.
Zumindest für das Angebot zu Borussia Mönchengladbach ist so festzustellen, dass die Bedingungen des Internets alternative Angebote ermöglicht haben, die für die Informationsbeschaffung der Anhänger maßgeblich sind. Die Nutzer wollen aktuelle und ganz spezielle Informationen zu ihrem Verein.
Gang der Untersuchung:
Die in Kapitel 1.1 aufgeworfenen Fragen lassen sich in drei zentrale Forschungsfragen konkretisieren, die dieser Arbeit zugrunde gelegt werden sollen.
F 1: Wie informieren sich Fußballanhänger im Internet?
F 2: Welche Gründe führen zu der Nutzung der einzelnen Informations-angebote?
F 3: Welche Unterschiede gibt es bei der Nutzung der verschiedenen Angebote?
Es wird also nach der Nutzung (F 1) und Bewertung (F 2) der […]
Die Arbeit ist grundsätzlich für alle interessant, die sich mit Fußball im Internet bzw. generell mit Fußballberichterstattung beschäftigen. Also gleichermaßen für Studenten, wissenschaftliche Assistenten, Doktoranden, Professoren, Sportjournalisten, Fußballvereine, Internetagenturen, Vermarktungsagenturen und viele mehr. Der Autor geht wissenschaftlich der Frage nach, wie sich Fußballfans im Internet informieren, worauf sie achten und was sie suchen.
Wenn sich Fußballfans im Internet informieren wollen, können sie dies auf sehr vielfältige Art und Weise tun. Den heutigen Internetbedingungen entsprechend ist das Angebot an Fußballwebsites immens. Trotz der hohen Auswahl herrscht bei den Nutzern jedoch keine Verwirrung, der Grad der selektiven Nutzung steigt stetig.
Mit Hilfe einer Online-Befragung der Anhänger von Borussia Mönchengladbach wird die Nutzung diverser Websites, die sich speziell mit diesem Verein befassen, untersucht. Dabei wird insbesondere das Verhältnis der verschiedenen Anbieter-Kategorien aus Sicht der Nutzer hinterfragt. Werden bei der selektiven Nutzung journalistische Angebote zielgerichtet angesteuert oder ist diesen durch alternative Anbieter oder PR-Angebote wie die Vereinshomepage borussia.de Konkurrenz erwachsen? Spielt der professionelle Sportjournalismus im Internet für die Anhänger noch eine Rolle als Informationsvermittler bzw. bietet er angesichts der unterschiedlichen Online-Kommunikatoren Orientierung? Darüber hinaus werden die möglichen Vorteile des WWW gegenüber den klassischen Medien für die Sportberichterstattung vorgestellt und basierend darauf gefragt, welche dieser Vorteile von den Angeboten umgesetzt und von den Anhängern genutzt werden.
Zumindest für das Angebot zu Borussia Mönchengladbach ist so festzustellen, dass die Bedingungen des Internets alternative Angebote ermöglicht haben, die für die Informationsbeschaffung der Anhänger maßgeblich sind. Die Nutzer wollen aktuelle und ganz spezielle Informationen zu ihrem Verein.
Gang der Untersuchung:
Die in Kapitel 1.1 aufgeworfenen Fragen lassen sich in drei zentrale Forschungsfragen konkretisieren, die dieser Arbeit zugrunde gelegt werden sollen.
F 1: Wie informieren sich Fußballanhänger im Internet?
F 2: Welche Gründe führen zu der Nutzung der einzelnen Informations-angebote?
F 3: Welche Unterschiede gibt es bei der Nutzung der verschiedenen Angebote?
Es wird also nach der Nutzung (F 1) und Bewertung (F 2) der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9439
Lappe, Carsten: Fußball im Internet mehr als 'Kicker Online' und 'sport1.de' -
Eine explorative Studie über die Nutzung von Fußball-Websites
am Beispiel von Borussia Mönchengladbach
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Magisterarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Die vorliegende Arbeit ist nach den Regeln der neuen deutschen Recht-
schreibung verfasst worden. Zitate sind in der Original-Fassung über-
nommen worden.
Meinen Eltern
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anm. d. Verf.
Anmerkung des Verfassers
ARD
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun-
desrepublik Deutschland
bzw.
beziehungsweise
ca.
zirka
ders.
derselbe
ebd.
ebendiese/r
et alt.
et altera
etc.
et cetera
evtl.
eventuell
DFB
Deutscher Fußball-Bund
d.h.
das heisst
DFL
Deutsche Fußballliga
DSF
Deutsches Sportfernsehen
DSB
Deutscher Sportbund
ebd.
ebendiese/r
f.
folgende Seite
ff.
folgende Seiten
FIFA
Weltfußballverband (Federation Internati-
onale de Football Association)
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
H.
Heft
HR
Hessischer Rundfunk
Hrsg.
Herausgeber
HTML
Hypertext Markup Language
Format von Dokumenten im Internet
Kap.
Kapitel
MDR
Mitteldeutscher Rundfunk
Mio.
Millionen
Nr.
Nummer
o.V.
ohne Verfasser
PR
Public Relations
Abkürzungsverzeichnis
s.
siehe
s.o.
siehe oben
S.
Seite
SID
Sportinformationsdienst
UEFA
europäischer Fußballverband
(United European Football Association)
URL
Uniform Ressource Locator
System zur Adressierung von Internetdo-
kumenten
v.
vom
vgl.
vergleiche
vs.
versus
WM
Weltmeisterschaft
WWW
Word Wide Web
z.B.
zum Beispiel
ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
Abbildungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abbildung 1: Der Mediensport. Wechselspiel dreier Systeme
11
Abbildung 2: Screenshot Kicker Online
35
Abbildung 3:
Screenshot sport1.de
37
Abbildung 4: Vier Journalismus-Dimensionen zur Abgrenzung
von professionellem zu Laienjournalismus
41
Abbildung 5: Vergleich traditionelle und Online-Journalisten
42
Abbildung 6: Screenshot borussia.de
53
Abbildung 7: Screenshot RP-Online
54
Abbildung 8: Screenshot WZ-Online
56
Abbildung 9: Screenshot torfabrik.de
57
Abbildung 10: Screenshot seitenwahl.de
59
Abbildung 11: Screenshot borussia-world.de
61
Abbildung 12: Screenshot christianziege.de
63
Abbildung 13: Screenshot thomasbroich.de
63
Abbildung 14: Screenshot oliverneuville.de
64
Abbildung 15: Screenshot bernd-thijs.be
64
Diagrammverzeichnis
Diagrammverzeichnis
Seite
Diagramm 1: Bewertung der Möglichkeiten des Internets
80
Diagramm 2: Frage 10
81
Diagramm 3: Frage 7
81
Diagramm 4: Altersstruktur
83
Diagramm 5: Erstzugriff
85
Diagramm 6: Frage 15
87
Diagramm 7: Bewertung der Angebote hinsichtlich der
Aktualität
92
Diagramm 8: Frage 21
95
Diagramm 9: Darstellung der Wichtigkeit der für den
professionellen maßgeblichen Kriterien
98
Diagramm 10: Frage 20
99
Diagramm 11: Frage 22
100
Tabelle 1:
Darstellung der individuellen Motive
entsprechend der Erstzugriffe
88
Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Seite
1 Einleitung
1
1.1 Einführung in die Thematik
1
1.2 Relevanz des Themas
3
1.3 Forschungsstand
5
1.4 Systematik der Arbeit
7
2 Sportjournalismus
9
2.1 Der Mediensport
10
2.2 Merkmale des Sportjournalismus
12
2.3 Funktionen des Sportjournalismus
15
2.3.1 Information vs. Unterhaltung
15
2.3.2 Kommunikative Funktionen
16
2.4 Fußball-Nutzung in den klassischen Medien
17
2.4.1 Tageszeitungen
17
2.4.2 Fachzeitschriften
18
2.4.3 Fernsehen
20
2.4.4 Radio
21
2.5 Zusammenfassung und Ausblick
21
3 Fußball im Internet
23
3.1 Das Internet als Medium
23
3.2 Veränderte Öffentlichkeit: Rezipienten- und
Kommunikatorenrolle im Internet
28
3.3 Fußballangebote im Internet und ihre Nutzung
30
3.3.1 Redaktionelle Angebote traditioneller Medien
33
3.3.2 Redaktionelle Nur-Online-Angebote
39
3.3.3 Vereinsangebote
43
3.3.4 Spielerangebot
45
3.3.5 Sonstige PR-Angebote
46
3.3.6 Angebote von Fanclubs
47
3.4 Zusammenfassung
47
Inhalt
4 Borussia Mönchengladbach im Internet
51
4.1 borussia.de
53
4.2 rp-online.de
54
4.3 wz-online.de
56
4.4 torfabrik.de
57
4.5 seitenwahl.de
59
4.6 fanprojekt.de
61
4.7 borussia-world24.de
61
4.8 Spielerwebsites
63
5 Untersuchungsdesign
66
5.1 Forschungsleitende Fragen
67
5.2 Wahl und Begründung der Methode
68
5.3 Vorgehen
69
6 Darstellung der Untersuchungsergebnisse
77
6.1 Nutzung von Fußballangeboten im intermediären
Vergleich
78
6.2 Nutzung von Fußballangeboten im intramediären
Vergleich
84
6.3 Bewertung der verschiedenen Angebote
90
6.4 Vergleich der verschiedenen Kategorien
97
6.5 Zusammenfassung
102
7 Fazit
106
Literaturverzeichnis
110
Anhang
1 Einleitung
1
1
Einleitung
1.1
Einführung in die Thematik
Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Deutschland ist Fußball hierzulande
in aller Munde und begeistert mehr denn je die Massen. Die für das riesige
Sportevent gebauten neuen, modernen Arenen sind jeden Bundesliga-
spieltag prall gefüllt. Die Vereine der höchsten deutschen Profiliga
verkauften für die letzte Saison vor der WM gut zehn Prozent mehr
Dauerkarten als in der Saison zuvor (vgl. Schülke 2005) und kaum ein Tag
vergeht, an dem nicht eine aktuelle Meldung zur weltweit beliebtesten
Sportart die mediale Runde macht. Die größte deutsche Boulevardzeitung,
BILD, zählt den Countdown zur WM im Sportteil ihrer gedruckten Ausgabe
beispielsweise herunter und veröffentlicht täglich einen vermeintlich neuen
Aspekt auf dem Weg zum Eröffnungsspiel in München am 9. Juni 2006.
Doch auch das Internet stillt mehr und mehr den Informationsdurst der
Fußballanhänger. Vor allem im Hinblick auf die WM darf man gespannt
sein, wie das Internet im kommenden Jahr genutzt wird. Die WM 1998 in
Frankreich ebnete dem Internet einst den Weg zum globalen Informati-
onsmedium (vgl. Koch 2001: 1) und für die WM 2002 in Japan und Südko-
rea stellten Forster und Rothfuß angesichts von 1,8 Milliarden Seiten-
zugriffen auf die offizielle WM-Homepage der FIFA fest: ,,Diese WM war
eine Internet-WM" (Forster/ Rothfuß 2002).
Den Anfang der Fußballberichterstattung machte ein zwölfjähriger Austra-
lier namens Tom Hadfield, der ab Sommer 1995 auf der Seite
http://www.soccernet.com im brandneuen Medium WWW aktuelle Informa-
tionen und Statistiken rund um das Thema Fußball veröffentlichte. Die Sei-
te hatte nachhaltigen Erfolg, wurde später für knapp eine halbe Millionen
Dollar an den TV-Sportsender ESPN verkauft und stellt heute dessen On-
line-Auftritt dar. (Vgl. Köster 2005: 28)
Gut zehn Jahre später hat sich das Internet in der Gesellschaft etabliert
und bringt laufend neue Angebotstypen hervor, die zwar jenseits der tradi-
tionellen journalistischen Strukturen entstanden sind und dennoch mit dem
Anspruch online gehen, die Nutzer informieren zu informieren. Neuberger
stellte allerdings bereits im vergangenen Jahr fest, dass dies ,,bisher noch
1 Einleitung
2
wenig Beachtung gefunden" (Neuberger 2004a) habe. Trotzdem machen
solche laienjournalistischen Angebote deutlich, dass der professionelle
Journalismus seine alleinige Gatekeeper-Funktion im Internet verloren hat.
Die Möglichkeit für jedermann zu publizieren, hat laien-journalistische An-
gebote geschaffen. Die Abgrenzung zum professionellen Journalismus
fällt teilweise schwierig: ,,Übrig bleibt nur noch ,Content'" (Neuberger
2001b: 118). Doch welche Angebote werden genutzt? Sind Angebote des
Laien-Journalismus eventuell attraktiver für den Rezipienten? Nimmt die-
ser die Problematik der Grenzverschiebung überhaupt wahr bzw. hat die-
se Wahrnehmung Auswirkungen auf seine Nutzung?
Die vorliegende Arbeit möchte untersuchen, wie sich Fußballanhänger im
Internet informieren. Exemplarisch soll dies an verschiedenen Online-
Angeboten zu Borussia Mönchengladbach geschehen. Obwohl der Fuß-
ballbundesligist nicht zu den Branchengrößen gehört und vor zehn Jahren
seinen letzten bedeutenden Titel gewann
1
, erfreut er sich größter Beliebt-
heit und kann auf Fans in ganz Deutschland zählen. Aus diesem Grund
gibt es auch ein umfangreiches Angebot an Websites, die sich mit Borus-
sia Mönchengladbach beschäftigen.
Verschiedene kontinuierliche Untersuchungen, wie z.B. die ARD/ZDF-
Online-Studie haben darauf hingewiesen, dass das Internet in erster Linie
ein Informationsmedium (vgl. Ridder 2002: 130) ist, in dem sich das Infor-
mationsverhalten der Nutzer in der Online-Umgebung verfeinert hat. Es
,,werden heute weniger die Generalisten, die zu vielen Fragestellungen
Inhalte anbieten, aufgesucht, sondern vermehrt die Spezialisten für be-
stimmte Themen, wie zum Beispiel spezielle Nachrichtenanbieter oder
Ratgebersites" (van Eimeren/ Gerhard/ Frees 2004: 369). Überhaupt
kommt der Selektion im Internet eine entscheidende Rolle zu. Durch die
Masse der abrufbaren Informationen scheint eine gezielte Auswahl gera-
dezu Vorrausetzung für eine regelmäßige Internetnutzung zu sein. (Vgl.
Rössler 2003: 514)
Dies könnte sich bezogen auf die Thematik Fußball und Internet darin
äußern, dass die Fans eines Fußballvereins Informationen gezielt auf
thematisch auf ihr Team fokussierten Seiten (Spezialisten) suchen und
1
Gewinn des DFB-Pokals 1995.
1 Einleitung
3
nicht mehr nur die universellen journalistischen Sport- bzw. Fußballange-
bote wie sport1.de oder Kicker Online (Generalisten) ansteuern, die hin-
sichtlich
der
Nutzungszahlen
die
Marktführer
des
Online-
Sportjournalismus in Deutschland darstellen.
Daraus ergeben sich für die vorliegende Arbeit ein inter- und ein intrame-
diärer Ansatzpunkt. Wie werden Online-Angebote im Vergleich zu Offline-
Medien genutzt, um an Fußballinformationen zu gelangen und welche Kri-
terien führen zur Nutzung der verschiedenen Angebote? Sind auch bezüg-
lich der Fußballinhalte die Internetseiten interessanter, die sich ganz spe-
ziell mit einem Gegenstand beschäftigen?
Ein weiterer Ansatzpunkt der Arbeit sind die vielen verschiedenen Anbie-
ter mit unterschiedlichen Interessen, auf die der Rezipient stoßen kann.
Welche Folgen hat dies für die Nutzer? Können die Fußballanhänger die
einzelnen Anbieter unterscheiden?
1.2
Relevanz des Themas
Für Josef Hackforth und Michael Schaffrath gab es 1998 an der Schwelle
zum neuen Jahrtausend angesichts der aktiven wie auch passiven Be-
geisterung für den Sport keine Zweifel, dass das Zeitalter der Sportgesell-
schaft eingeläutet war, denn ,,die Faszination des Sports ist ungebrochen,
er bleibt wichtigster Faktor der personalen Kommunikation, wichtigster
wirtschaftlicher Faktor der Medien und wichtigste Freizeitbeschäftigung"
(Hackforth/ Schaffrath 1998: 248). Nahezu jedes sportliche Ereignis, vor
allem mit deutscher Beteiligung, sorgt heute für eine Anteilnahme bei der
Bevölkerung wie sonst nichts: ,,Wahlkämpfe, politische Sendungen oder
Produktkampagnen können solche Tendenzen im Zuschauer- oder Rezi-
pientenverhalten nicht erreichen" (Hackforth 1987: 15). Einer Ufa-Studie
zufolge ist das Interesse am Sport in den 1990er Jahren noch einmal rapi-
de gestiegen. Der Anteil der über 14-jährigen, die sich für Sport interessie-
ren, ist im Zeitraum von 1994 bis 2000 von 73 % auf 89 % angestiegen.
(Vgl. Hermanns/ Riedmüller 2001: 5) Dies entspricht exakt dem Zeitraum,
in dem sich das Internet entwickelt, ausgebaut und durchgesetzt hat. Das
Internet ist heute das schnellste Medium und davon profitieren dessen
Nutzer, die ihrerseits durch die veränderten gesellschaftlichen Strukturen
1 Einleitung
4
immer weniger Zeit für langwierige Informationsbeschaffung haben und
deswegen auf der Suche nach schnellen, aktuellen Nachrichten häufig auf
das Internet zurückgreifen. Aus dem privaten und beruflichen Alltag ist es
nicht mehr wegzudenken. Studien, wie die von ARD und ZDF in Auftrag
gegebene Online-Studie dokumentieren diese Entwicklung: Während
1997 nur 4,1 Millionen Deutsche (6,5 %) online waren, waren es im Jahr
2004 schon 36 Millionen (55,3 %). (Vgl. van Eimeren, Birgit/ Heinz Ger-
hard/ Beate Frees 2004: 351) Es steht damit außer Frage, dass sich das
Internet als Massenmedium etabliert hat (vgl. Ridder 2002: 130). Auch gut
zehn Jahre, nachdem das WWW dem Internet den Durchbruch geebnet
hat, steigt die Anzahl der Internetnutzer stetig. In der ARD/ZDF-Online-
Studie 2004 heißt es: ,,Kein Medium hat sich in Deutschland so rasant
verbreitet, wie das Internet und ist so schnell in das geschäftliche wie pri-
vate Umfeld integriert worden" (van Eimeren/ Gerhard/ Frees 2004: 350).
Auf welch riesiges Interesse die Informationsbereitstellung zum Sport im
Internet stößt, verdeutlicht die Tatsache, dass sich knapp die Hälfte aller
Surfer täglich über Sportnachrichten informiert. Weltweit gehört Sport zu
den Top-Five-Interessen der Internet-Nutzer. (Vgl. Medau/ Reutner 2001:
186) Angesichts dieser Zahlen verwundert es nicht, dass alle deutschen
Online-Angebote, die Nachrichten verbreiten, besonderen Wert auf Sport-
nachrichten legen. Die Online-Angebote von Spiegel, Stern und Focus
bieten sogar mehr Sportbeiträge an als ihre Muttermedien. (Vgl. Medau/
Reutner 2001: 187)
Das Interesse am Sport liegt in Deutschland vor allem auch an der extrem
hohen Popularität des Fußballs. Er spielt heutzutage in unserer Gesell-
schaft eine zentrale Rolle. So stellt Schaffrath treffend fest:
,,Der Sport im allgemeinen, der Fußball im speziellen und die Fußball-
Bundesliga im ganz besonderen dringen immer tiefer in verschiedene
Lebenslagen ein, determinieren das Alltagshandeln, beeinflussen das
Kommunikationsverhalten und sind häufig Top-Thema der Medien- wie
Publikumsagenda." (Schaffrath 1999: 21)
Der Sportfive-Fußballstudie
2
von 2004 zufolge interessieren sich 50 Millio-
nen Deutsche für Fußball. Dabei geben 39 % der deutschen Bevölkerung
2
Die Sportfive-Fußballstudie wird alle zwei Jahre als Nachfolge der ehemaligen UFA-
Fußballstudie herausgegeben und dokumentiert die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Stellung des Fußballs und seine Präsenz in den Medien.
1 Einleitung
5
über 14 Jahren an, dass Fußball aus ihrem Leben nicht mehr wegzuden-
ken ist (vgl. Sportfive 2004a: 7). Dementsprechend erfreut sich auch die
Bundesliga eines hohen Interesses. Seit Anfang der 1990er Jahre steigen
die Zuschauerzahlen in den Bundesligastadien stetig. Live-Übertragungen
von Bundesligaspielen und mehr noch von Länderspielen im Fernsehen
sorgen konstant für hohe Einschaltquoten (vgl. Schaffrath 1999: 23 ff.).
1.3
Forschungstand
Den Stand der wissenschaftlichen Untersuchung des Internets bringt
Rössler auf den Punkt:
,,Während die Nutzung von OK [Online-Kommunikation, Anm. d. Verf.]
aufgrund ihrer ökonomischen Relevanz auch für die kommerzielle Nut-
zung attraktiv ist, steckt die systematische Beschreibung von deren In-
halten theoretisch und methodisch noch in den Kinderschuhen." (Rössler
2003: 513)
Einen Überblick über die bisherige Forschung zum Online-Journalismus
hat Neuberger 2002 gegeben (vgl. Neuberger 2002a). Für die Kommuni-
kationswissenschaft war bislang die Frage von größtem Interesse, ob im
Internet ein spezifischer Journalismus existiere. Dazu nahm man die Onli-
ne-Angebote eines traditionellen Muttermediums in den Blick und konzent-
rierte sich zunächst auf Presseerzeugnisse und deren Online-Ableger.
Neuberger und Tonnemacher veröffentlichten 1999 eine Sammlung von
Forschungsberichten zu diesem Thema
3
. Auch andere Publikationen
beschäftigten sich mit den journalistischen Aktivitäten der Presse im
Internet, analysierten die Online-Strategien in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre aber eher aus wirtschaftlicher Sicht der Muttermedien (vgl.
Pieler 2002, Wolff 2002).
Die Nutzung von Online-Medien erforschen bislang im Wesentlichen die
W3B-Studie, die ARD/ZDF-Online-Studie und die GfK-Online-Studie (vgl.
Scholl 2003: 252 ff.). Die vorliegende Arbeit bezieht sich in erster Linie auf
die Erkenntnisse aus der seit 1998 jährlich durchgeführten Online-Studie
von ARD und ZDF.
Die Relevanz der bisherigen Untersuchungen, die sich speziell mit Fuß-
ballinhalten im Internet beschäftigen, ist eher gering. Im Zuge eines Semi-
3
Neuberger, Christoph/ Tonnenmacher, Jan (1999): Online Die Zukunft der Zeitung?
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
1 Einleitung
6
nars am Institut für Kommunikationswissenschaft in Münster ist 1998 eine
Inhaltsanalyse über die Berichterstattung zur Fußball-WM 1998 entstan-
den. Untersucht wurde die Vorberichterstattung auf den Seiten von ran-
Online und sport1.de. Die gewonnenen Erkenntnisse haben für die vorlie-
gende Arbeit jedoch keine Bedeutung, da das Angebot ran-Online hin-
sichtlich der vorliegenden Arbeit keine Relevanz hat und sich die Struktur
von sport1.de seit Durchführung der Inhaltsanalyse mehrmals grundsätz-
lich verändert hat (vgl. Kap. 3.3.1). Dies bestätigt die auch für die vorlie-
gende Arbeit wichtige Erkenntnis, dass Forschungsergebnisse zum Inter-
net aufgrund dessen Dynamik sehr schnell veralten (vgl. Löffelholz et al.
2003: 477).
Gegen Ende der 1990er Jahre sind über das Genannte hinaus einige Ar-
beiten an der deutschen Sporthochschule in Köln entstanden, die sich mit
dem Sportjournalismus im Internet beschäftigt haben. Braun
4
, Beineke
5
und Bacher
6
reflektieren jedoch den Sportjournalismus als Ganzes, ohne
speziell auf den Fußball einzugehen und lassen laienjournalistische Ange-
bote gänzlich außer acht. Lediglich Braun geht explizit auf den Unter-
schied von journalistischen und nicht-journalistischen Angeboten im Inter-
net ein (vgl. Braun 1999: 30 ff.). Andere Publikationen haben sich lediglich
der wirtschaftlichen Bedeutung des Internets für den Sport gewidmet (vgl.
Grätz 2001), eine kommunikationswissenschaftliche Betrachtung fehlt
meist völlig. Anders ist dies beispielweise bei den von Becker und Böhm
untersuchten Internetauftritten der Bundesligisten in der Saison
2001/2002
7
. Im selben Jahr haben sich Dorlöchter et al. speziell mit den
,,Internetauftritten von Fußballbundesligisten im Rahmen der Ver-
eins(marken)führung" beschäftigt, dabei auch die spezifischen Ziele der
einzelnen Bundesligisten berücksichtigt und heraus gestellt, dass mit den
Websites der Profivereine zwar meistens kommerzielle Ziele verfolgt wer-
den, die Bereitstellung von Informationen jedoch wichtigster Bestandteil
4
Braun, Oliver (1999): Sportjournalistische Berichterstattung im World Wide Web. Ange-
bote, Spezialisierung, Themen.
5
Beineke, David (1997): Sportberichterstattung im Internet (WWW) und bei Online-
Diensten.
6
Bacher, Joachim (1999): Die Sportberichterstattung im Internet (WWW): Bedürfnisse,
Erwartungen und Wünsche.
7
Becker, Timo/ Böhm, Bastian (2002): Fußball Bundesliga. In: Stumm, Patrick (Hrsg.):
Der professionelle Internetauftritt im Sport. Eine Medien- und Marktanalyse der Homepa-
ges deutscher Sportunternehmen und Sportvereine in der Saison 2001/02.
1 Einleitung
7
aus Sicht der Vereine ist (vgl. Dorlöchter et al. 2002: 19 ff.). Becker und
Böhm bestätigen dieses Ergebnis: ,,Die Fußballvereine haben sich über-
wiegend den Erfordernissen des Online Marktes angepasst und bedienen
die Fans entsprechend mit Inhalten." (Becker/ Böhm 2002: 55) Auch Bau-
er (2001) widmete sich an der deutschen Sporthochschule den Fußball-
websites der ersten und zweiten Bundesliga. Die Website von Borussia
Mönchengladbach
8
wurde damals als ,,professioneller, verbesserungsfähi-
ger Web-Auftritt" (Bauer 2001: 222 f.) eingestuft .
Der Ansatzpunkt der vorliegenden Arbeit, ist jedoch ein anderer: Er geht
auf die unterschiedlichen Angebote ein und bezieht so z.B. auch die Ei-
genpräsentation des Vereins und laienjournalistische Angebote mit ein.
Außerdem wird er der Tatsache gerecht, dass in einem so dynamischen
Medium wie dem Internet, das Angebot der Vereine bei weitem nicht mehr
mit dem aus dem Jahr 2001 übereinstimmt, sondern sich auch in der Fuß-
ballberichterstattung mittlerweile neue Angebotstypen etabliert haben.
1.4
Systematik der Arbeit
Die in Kapitel 1.1 aufgeworfenen Fragen lassen sich in drei zentrale For-
schungsfragen konkretisieren, die dieser Arbeit zugrunde gelegt werden
sollen.
F 1:
Wie informieren sich Fußballanhänger im Internet?
F 2:
Welche Gründe führen zu der Nutzung der einzelnen Informations-
angebote?
F 3:
Welche Unterschiede gibt es bei der Nutzung der verschiedenen
Angebote?
Es wird also nach der Nutzung (F 1) und Bewertung (F 2) der verschiede-
nen Angebote gefragt, sowie danach, ob die Rezipienten Unterschiede
zwischen den Angeboten wahrnehmen (F 3). Dazu werden im theoreti-
schen Teil der Arbeit (Kap. 2 - 4) weitere Teilfragen erarbeitet, deren Be-
antwortung im empirischen Teil (Kap. 5 und 6) schließlich zur Klärung der
zentralen Forschungsfragen führen sollen.
Da traditionell der Sportjournalismus für die Vermittlung von Fußballinfor-
mationen zuständig ist und der Vergleich des professionellen Journalis-
8
http://www.borussia.de
1 Einleitung
8
mus mit weiteren Angebotskategorien im Internet im Mittelpunkt der Arbeit
steht, wird in Kapitel 2 zunächst auf Stand der wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzung mit dem Sportjournalismus eingegangen. Insbesondere
soll auf die Dreiecksbeziehung von Sport, Wirtschaft und Medien einge-
gangen werden, die den Sportjournalismus prägt und insbesondere im
Profifußball besonders ausgeprägt ist (vgl. Kap. 2.1). Weiterhin werden
Kritikpunkte am Sportjournalismus reflektiert, da diese zur Hoffnung auf
eine andere Präsentation im Internet geführt haben (vgl. Kap. 2.2), ehe die
Funktionen des professionellen Sportjournalismus diskutiert werden (vgl.
Kap. 2.3), um Erkenntnisse für eine detaillierte Thematisierung der verän-
derten Rolle des Journalismus im Internet zu gewinnen (vgl. Kap. 3.2).
Kapitel 2.4 beschäftigt sich folgerichtig mit der Nutzung von Fußballinhal-
ten in den klassischen Medien, da die Nutzung von Online-Angeboten, wie
in Kapitel 1.1 bereits erläutert, auch im intermediären Rahmen betrachtet
werden soll. Nach einer zusammenfassenden Diskussion der gewonne-
nen Erkenntnisse (vgl. Kap. 2.5), stellt Kapitel 3 die Rahmenbedingungen
und Besonderheiten dar, die die Internetkommunikation bestimmen. Dar-
aus ergeben sich verschiedenen Anbieter von Fußballinformationen, die in
Kapitel 3.3 vorgestellt werden.
In Kapitel 4 werden verschiedene Angebote, die sich mit dem Verein be-
schäftigen, vorgestellt und kategorisiert.
Im empirischen Teil der Arbeit werden die aus den theoretischen Überle-
gungen abgeleiteten Forschungsteilfragen zusammengefasst (vgl. Kap.
5.1). Danach wird das empirische Instrument der Online-Befragung (vgl.
Kap. 5.2) und ihre Durchführung (vgl. Kap. 5.3) vorgestellt. Kapitel 6 be-
antwortet schließlich die Forschungsteilfragen (AA 1-4/ AB 1-4/ B1-4/ C 1-
3) anhand der Ergebnisse der Befragung. Die so gewonnenen Erkenntnis-
se tragen in Kapitel 6.5 zur Beantwortung der zentralen Forschungsfragen
(F 1-3) bei. Kapitel 7 zieht ein abschließendes Fazit und schlägt anknüp-
fende Forschungsansätze vor.
2 Sportjournalismus
9
2
Sportjournalismus
Traditionell sind Sportjournalisten für die Bereitstellung von Fußballinhal-
ten in den Medien verantwortlich, weshalb zunächst auf den Sportjourna-
lismus als Subsystem des Journalismus eingegangen wird.
Siegfried Weischenberg verfasste 1976 als einer der ersten Wissenschaft-
ler eine Auseinandersetzung mit dem Sportjournalismus unter dem Titel
,,Die Außenseiter der Redaktion". Zuvor lag der Sportjournalismus im wis-
senschaftlichen Diskurs brach. Schon der Titel von Weischenbergs Veröf-
fentlichung war Programm: es wurde wenig über den Sportjournalismus
geforscht, da die Sportjournalisten in den Redaktionen wenig angesehen
waren. Verantwortlich war das vergleichsweise niedrige Ausbildungsni-
veau im Gegensatz zu den Kollegen in andern Redaktionsressorts (vgl.
Weischenberg 1976: 235 ff.), was zu einem geringen Selbstbewusstsein
der Sportredakteure und fehlender Anerkennung führte (vgl. Weischen-
berg 1976: 269 f.). Die Kritik, die damals schon an der Arbeit der Sport-
journalisten geäußert wurde, entspricht im Wesentlichen der Kritik von
heute (vgl. Kap. 2.1 und 2.2).
Trotz weiterhin bestehender Kritik verbesserte sich das Ansehen und das
Selbstverständnis der Sportjournalisten erheblich, was wiederum Wei-
schenberg knapp 20 Jahre in seinen ,,Annäherungen an die ,Außenseiter'"
(Weischenberg 1994) berichtete. Görner formulierte ein Jahr später sogar
,,Vom Außenseiter zum Aufsteiger" (Görner 1995). Nicht zuletzt das seit
Anfang der 1980er Jahre aufstrebende Privatfernsehen und der damit
verbundenen Zunahme an unterhaltenen Inhalten hatte dazu beigetragen,
dass sich die Sportjournalisten nun ihrer Aufgabe der Unterhaltungsprä-
sentation bewusst wurden und viel weniger Probleme mit ihrer Rolle und
Verortung in der Redaktion hatten. (Vgl. Weischenberg 1994: 443 ff.) Die
Sportjournalisten hatten nun ein anderes Ansehen: ,,Den redaktionellen
Außenseiterplatz in der Abstiegszone hat der Sportjournalist verlassen."
(Blöbaum 1988: 15) Auch Hackforth kam 1994 in der ,Kölner Studie' zu
dem selben Ergebnis: ,,Die Stellung und das Ansehen der Sportjournalis-
ten innerhalb und außerhalb der Redaktion hat sich verbessert." (Hack-
forth 1994: 28)
2 Sportjournalismus
10
Trotz dieses Gewinns an Ansehen, drängen sich Kritikpunkte auf (vgl.
Weischenberg 1994: 447 f.), die seit dem Bestehen des Sportjournalismus
latent vorhanden sind. Damit auf die Kritik sinnvoll eingegangen werden
kann, muss zunächst die wechselseitige Beziehung der Systeme Mas-
senmedien, Spitzensport und Wirtschaft erläutert werden, die vor allem im
Profifußball besonders ausgeprägt ist. Auf dieses Wechselspiel des Sys-
teme konzentrieren sich die wesentlichen Kritikpunkte.
2.1
Der Mediensport
Das System Sport unterteilt sich in die Kategorien Freizeit- und Leistungs-
sport, der wiederum aktiv betrieben und passiv rezipiert werden kann (vgl.
Koch 2001: 8 ff.). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Folgenden
ausschließlich mit dem Passivbereich des Leistungssports im Bereich des
Profifußballs. Der professionelle Leistungssport kann auf zwei Arten ver-
folgt werden, entweder direkt vor Ort eines Wettkampfes (zum Beispiel als
Zuschauer eines Fußballspiels) oder über die Medien. Vor allem für den
zweiten Aspekt hat sich der Begriff des Mediensports durchgesetzt.
Bereits 1976 berichtete Weischenberg von einer engen Verbindung zwi-
schen Hochleistungssport und den Massenmedien (vgl. Weischenberg
1976: 164). Heute wird der Begriff Mediensport für die wechselseitige Be-
ziehung dreier Systeme bezeichnet (s. Abbildung 1), die aufeinander an-
gewiesen sind, unmittelbar voneinander profitieren und in ihrer Ausprä-
gung nicht mehr alleine auskommen: ,,Sportjournalismus ist nutzbringend
für verschiedene Systeme: für den Sport, für die Wirtschaft und die Me-
dien." (Loosen 2001a: 133)
Der Profisport braucht die Medien, um sich zu vermarkten und so für die
Wirtschaftsinvestoren lukrativer zu werden. Vor allem im Fußball ist dies
besonders ausgeprägt: ,,Der moderne Spitzensport versteht sich in den
meisten professionellen Bereichen, besonders signifikant im Fußball [...]
als neuer Wirtschaftszweig" (Brinkmann 2001: 42). Dabei kann sich sport-
licher Erfolg direkt wirtschaftlich bemerkbar machen:
,,Je erfolgreicher ein Sportler oder ein Team ist, desto häufiger ist es im
Fernsehen, desto höher fallen die Sponsoren- und Ausrüster-Verträge aus
und desto mehr Merchandising-Artikel [...] lassen sich absetzen" (Mikos
2004: 9).
2 Sportjournalismus
11
Die wirtschaftliche Abhängigkeit kann jedoch auch negative Folgen haben,
nämlich dann, wenn ein Sport in den Medien kaum stattfindet. In diesem
Fall hat er in der Gesellschaft nicht nur eine untergeordnete Bedeutung,
sondern ist in seiner Ausprägung teilweise gar nicht überlebensfähig (vgl.
Mikos 2004: 9, Nötting 2000: 31) Starke Medienpräsenz wiederum be-
gründet eine enorme gesellschaftliche Stellung:
,,Mit der immer dichteren Folge an Übertragungen haben diese Medien maß-
geblich dazu beigetragen, den Sport zu einem gesellschaftlichen Ereignis
und dem weithin dominierenden Phänomen der Alltagskultur zu machen."
(Brinkmann 2001: 41).
Die Systeme Wirtschaft und Medien profitieren hingegen von der Populari-
tät des Sports. Für den Wirtschaftszweig Werbung zum Beispiel ,,erscheint
der Sport [...] als ideale Werbeplattform, weil hier wie sonst nirgendwo ein
Massenpublikum angesprochen werden kann." (Loosen 2001a: 135) Aus
demselben Grund präsentieren die Medien Leistungssport. Diese Entwick-
lung begann vor allem durch die Einführung des dualen Rundfunksystems
Anfang der 1980er Jahre:
,,Beschränkte sich der mediale Wettbewerb bis zu diesem Zeitpunkt auf ei-
nen publizistischen und weniger auf einen ökonomischen, so wird der journa-
listische Leistungsanspruch zunehmend durch wirtschaftliche Ziele domi-
niert." (Schauerte 2004: 28)
Mit ihrer Präsentation nehmen die Medien dabei auch erheblichen Einfluss
auf die Sportarten (vgl. Hackforth 1987: 17). Teilweise sehr direkt, z.B.
beim Fußball durch die Mitbestimmung bei den Anstoßzeiten bei Live-
Übertragungen im Fernsehen oder Regeländerungen, um einzelne Sport-
arten telegener zu machen (Nötting 2000: 31). Andererseits aber auch
Abbildung 1: Der Mediensport. Wechselspiel dreier Systeme.
2 Sportjournalismus
12
indirekt, z.B. im Rahmen der Insolvenz der Kirch-Gruppe 2002, die eine
massive wirtschaftliche Krise in der Fußballbundesliga auslöste
9
.
Bei der Beschreibung des Mediensports war zunächst mit dem Begriff
Medium in erster Linie das Fernsehen gemeint, doch im Hinblick auf die
Kommerzialisierung der populärsten Sportarten, wie z.B. des Fußballs hin
zu einem eigenen Wirtschaftszweig gewinnt auch zunehmend das Internet
als Vermarktungsfeld an Bedeutung (vgl. Brinkmann 2001: 42) und wird
von den Akteuren zur Vermarktung genutzt (vgl. Kap 3.3.3, 3.3.4):
,,Eine qualitativ neue Stufe im Verhältnis von Sport und Medien ist mit der
Verbreitung eigener Berichte, eigener Hörfunkreportagen, wie zum Bei-
spiel mit den Live-Reportagen von den Bundesligaspielen im Internet
und den exotisch anmutenden Beispielen eigener Vereinssender, wie
von Manschester United, Real Madrid und AC Mailand, erreicht worden"
(Brinkmann 2001: 50).
Auf die sich aus der Verschmelzung der Systeme Sport, Wirtschaft und
Medien im Internet ergebende Struktur, wird in Kapitel 3.2 eingegangen.
Zunächst sollen weitere Kritikpunkte dargestellt werden, die sich auf die
Ausprägungen des Mediensports, insbesondere im Fußball, beziehen.
2.2
Merkmale des Sportjournalismus
Auch wenn das Ansehen der Sportjournalisten in den letzten knapp 30
Jahren erheblich gestiegen ist, so wird das Produkt nach wie vor kritisiert:
,,Kritik am Sportjournalismus gibt es, seit sich der Sport in den Massenme-
dien durchgesetzt hat." (Weischenberg 1976: 188)
Gleich hat in seinem Aufsatz ,,Sportberichterstattung in den Medien:
Merkmale und Funktionen" (Gleich 2001) einen Überblick über sämtliche
Merkmale gegeben. Allerdings beschränkt er sich in seiner Betrachtung in
erster Linie auf die Sportberichterstattung im Fernsehen. Viele der Kritik-
punkte sind aber auch auf die anderen Medien zu beziehen und wiederho-
len sich in der Literatur als Vorwürfe an das gesamte System Sportjourna-
lismus. Aus der Vielzahl von Merkmalen, die Gleich entwickelt hat, werden
an dieser Stelle die für diese Arbeit relevanten vorgestellt.
10
9
Kirch hatte die Fernsehrechte an der Bundesliga inne und konnte im Zuge der Insolvenz
die bei den Bundesligisten eingeplanten Gelder nicht mehr zahlen.
10
Ausser Gleich haben auch Josef Hackforth (2001: Auf dem Weg in die Sportgesell-
schaft?) und Wiebke Loosen (2001: ,,Das wird alles von den Medien hochsterilisiert".
Themenkarrieren und Konjunkturkurven der Sportberichterstattung) gesammelte Kritik-
punkte formuliert.
2 Sportjournalismus
13
Zunächst wird eine fehlende kritische Auseinandersetzung mit problemati-
schen Aspekten des Sports ausgemacht (vgl. Loosen 2001a: 137). Es
,,wird in den Medien eine ,heile Welt' des Sports aufrechterhalten, deren
Bedrohung durch negative Ereignisse, wie zum Beispiel randalierende Fans,
Dopingskandale etc. nur unzureichend und einseitig kommentiert werden."
(Gleich 2001: 170)
Hackforth nennt sogar verharmlosende Tendenzen bei der Berichterstat-
tung über randalierende Hooligans (vgl. Hackforth 2001: 38). Grund dafür
könnte die bereits zu sehr fortgeschrittene Abhängigkeit der Sportjourna-
listen von ihrem Produkt im Zuge der Kommerzialisierung sein (vgl. Gleich
2001: 169 f.,), die ein weiteres Merkmal darstellt. Dieses bezieht sich un-
mittelbar auf die Notwendigkeit, die Ausgaben für Übertragungsrechte
wieder zu refinanzieren (vgl. Loosen 1997: 38). Die dazu benötigten mög-
lichst hohen Einschaltquoten führen zu einer Bevorzugung der beliebten
und ,telegenen' Sportarten (vgl. Kap. 2.1): ,,Die Medien versuchen daher
zunehmend Einfluss auf den Sport zu nehmen und die Verantwortlichen
des Sports dazu zu bewegen, sich auf fernsehgerechte Inszenierungen
einzulassen" (Gleich 2001: 171).
Gleich macht damit bereits auf einen weiteren Kritikpunkt aufmerksam, die
Entertainisierung von Sportereignissen:
,,Mit begleitenden Vor- und Nachberichten, Gewinnspielen, Comedy-
Einlagen, Interviews, Homestories von Sportlern, Features über Übertra-
gungsorte, prominenten Kommentatoren und nicht zuletzt mit Sponsoring
und neuen Formen der Werbung versucht man, ein möglichst unterhalt-
sames Rahmenprogramm um die eigentliche Berichterstattung zu ,stri-
cken'" (Gleich 2001: 171).
Eine Fernsehübertragung eines Fußballspiels kann so schon einmal deut-
lich länger als die eigentliche Spielzeit von 90 Minuten dauern: ,,Die Fuß-
ballspiele heutzutage dauern 240 Minuten und damit deutlich mehr als das
Doppelte ihrer Realzeit." (Hackforth 2001: 37) Diese Tendenz begann spä-
testens, seitdem der Privatsender Sat1 1994 die Erstverwertungsrechte
der Fußballbundesliga erwarb. Seitdem beobachtete man immer wieder
,,die [...] zunehmende Kommerzialisierung von Sportveranstaltungen, bei
denen zum Zwecke der Gewinnmaximierung beteiligter Veranstalter, A-
genturen, Sponsoren und Fernsehsender die Vor- und Nachberichter-
stattung das eigentliche Ereignis oft quantitativ, zuweilen auch qualitativ
(bezogen auf den Unterhaltungswert) übertrifft, während das Sportge-
schehen selbst zur Nebensache wird" (Amsinck 1997: 68).
2 Sportjournalismus
14
Die zunehmende ,Ver-Unterhaltung' der Sportpräsentation
11
(vgl. Loosen
2001a: 137) ist jedoch nicht nur im Fernsehen zu beobachten. Auch die
Internetsportanbieter sport1.de und kicker.de setzen nicht nur auf journa-
listische Inhalte, sondern auch auf Entertainmentelemente wie z.B. Ge-
winnspiele (vgl. Kap. 3.3.1, 3.3.2). Die Orientierung am Publikum führt je-
doch auch noch zu anderen Tendenzen. Einigen Sportjournalisten wird
vermehrt auch ausbleibende Kritik an populären Themen und Sportlern
vorgeworfen, weil die Kunden des entsprechenden Mediums bei Laune
gehalten werden müssen (vgl. Kistner 2004: 10 ff.).
Gleich weist außerdem auf eine Dramatisierung der Sportpräsentation hin,
die er vor allem bei Live-Ereignissen ausmacht. Er sieht darin die Ten-
denz, die natürliche Dramatik des Wettkampfes bei der Präsentation zu-
sätzlich zu verschärfen: ,,Es wird unterstützt durch die direkte Visualisie-
rung von Anspannung in Großaufnahme, Freude und Trauer des Athleten"
(Gleich 2001: 172). Unterstützend werden z.B. in der Vorberichterstattung
auf ein Fußballspiel auch aggressive Statements der Beteiligten verwen-
det, um das Interesse anzuheizen (vgl. Gleich 2001: 172). Diese Praxis ist
auch in der Internetvorberichterstattung im Vorfeld eines wichtigen Fuß-
ballspiels vorstellbar, wenn z.B. Unternehmenssynergien genutzt werden
sollen. Dies greift etwa dann, wenn die Seite sport1.de eine noch umfang-
reichere Vorberichterstattung zu einem Fußballspiel, welches im Deut-
schen Sportfernsehen (DSF)
12
zu sehen ist, mit diesen aggressiven bzw.
dramatischen Aussagen der Spieler oder Trainer anreichert. Diese Merk-
male der Inszenierung, der Dramatisierung und der Entertainisierung wer-
den als Boulevardisierung der Sportberichterstattung (vgl. Kühn 1998: 33
ff., Hackforth 1994: 19) bezeichnet.
Außer der Kritik am Sportjournalismus ist es auch wichtig, die traditionel-
len Funktionen des Sportjournalismus darzustellen, um vergleichend auf
11
Etwa durch Gewinnspiele in den Pausen der Fußballspiele oder neuerdings auch wäh-
rend der Live-Übertragung des DSF, dynamische Animationen während der Anmoderati-
on von Spielberichten oder auch Moderatorenduos wie Gerhard Delling und Günther
Netzer in der ARD, die mit ihren nicht immer sachlichen Dialogen mittlerweile zu den
Grimme-Preisträgern gehören.
12
Die EM.TV AG ist sowohl beim DSF als auch bei Sport1.de Hauptgesellschafter (vgl.
Kap. 3.3.2).
2 Sportjournalismus
15
die journalistisch relevanten Angebote im Internet eingehen zu können
(vgl. Kap. 3.3).
2.3
Funktionen des Sportjournalismus
Der Sportjournalismus als Subsystem des Journalismus erfüllt grundsätz-
lich auch dessen Funktionen wie Aufklärung, Kritik, Kontrolle und Mei-
nungsbildung. Auch der Sportjournalist soll Vermittler-, Kommentator-,
Mediator-, Orientierungs- und Unterhalterfunktionen erfüllen (vgl. Hack-
forth 1994: 33, Altmeppen 1998: 199), was im Internet aufgrund der vielen
Angebote wichtiger als in anderen Medien erscheint: ,,Bei der Überfülle
von Inhalten, die das Netz bietet, ist eine der wichtigsten Leistungen, die
man dem Nutzer liefern kann, Unterstützung bei der Selektion und Filte-
rung der gewaltigen Informationsmengen." (Lorenz-Meyer 1999: 26)
Speziell der Sportjournalist wechselt dabei zwischen den Aufgaben, In-
formationen zu vermitteln und Unterhalter zu sein (vgl. Gleich 2001: 176).
2.3.1
Information vs. Unterhaltung
Gleich geht in erster Linie von der Sportberichterstattung im Fernsehen
aus und versteht den Informationsbegriff hinsichtlich der Sportrezeption
dabei sehr eng:
,,Diese Personen verfolgen Sportsendungen hauptsächlich, um sich zu
informieren, die eigenen sportlichen Aktivitäten und Leistungen in einen
Beziehungsrahmen zu stellen und aus dem Gesehenen eventuell zu ler-
nen. Die Technik der Athleten, die Regeln des Sports und Information
über Taktik und Strategie stehen für solche Personen im Mittelpunkt des
Interesses" (Gleich 2001: 176).
Sport als Unterhaltung versteht Gleich als ,,Dramatik des Spielverlaufs, die
Spannung über den Ausgang des Wettkampfs oder die Freude am Sieg
der eigenen (favorisierten) Mannschaft" (Gleich 2001: 177).
Auch wenn in der Kölner Studie 1993 schon 70 % der 1.739 befragten
Sportjournalisten Unterhaltung als eine wichtige Aufgabe ansehen, bleibt
die Informationsfunktion im Selbstverständnis der Sportjournalisten am
wichtigsten (vgl. Hackforth 1994: 34 f.). Immerhin haben die Sportjourna-
listen anerkannt, dass sie nicht entweder als Informationsvermittler oder
Unterhalter auftreten:
2 Sportjournalismus
16
,,Die Rezeption von Sportberichterstattung entzieht sich einer eindeutigen
Einordnung in die Kategorien Unterhaltung und Information [...]. Sportbe-
richterstattung ist ein echtes Hybrid aus Information und Unterhaltung."
(Loosen 2001a: 137)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Folgenden in erster Linie mit der
Informationsfunktion. Dies liegt am Bestreben, die Nutzung von Fußball-
seiten im Internet zum Zweck der Informationsbeschaffung zu untersu-
chen.
Mehrere Studien und Aufsätze haben darauf verwiesen, dass die Betrei-
ber von Internetseiten in erster Linie Informationen vermitteln wollen (vgl.
Bauer 2001, Löffelholz et al. 2003: 483, Stumm 2002: 25). Nicht nur jour-
nalistische Angebote, sondern z.B. auch die Vereinswebsites sehen darin
ihre Hauptaufgabe (vgl. Dorlöchter et al. 2002, Kap. 3.3.3).
2.3.2 Kommunikative Funktionen
Die Sportberichterstattung erfüllt darüber hinaus auch soziale Funktionen.
Rudolf stellt dazu fest:
,,Durch die Identifikation mit Sportlern und die emotionale Bindungen (para-
soziale Beziehungen) zu ihnen ermöglicht der Mediensport, dass das Indivi-
duum Antriebe als erfüllt erleben kann, deren reale Erfüllung ihm jedoch ver-
sagt bleiben." (Rudolf 2004: 36)
Dabei besteht jedoch die Gefahr der Übertreibung, die sich im Vorwurf der
Erzeugung eines Starkultes äußert. Dies ist schon 1976 von Weischen-
berg beschrieben worden (vgl. Weischenberg 1976: 189 f.).
In der interpersonalen Kommunikation spielt die mediale Präsentation des
Sports jedoch eine unbestritten wichtige Rolle (vgl. Brinkmann 2001: 41).
Im Fußball sorgen belanglos erscheinende Informationen über Vereine
und Spieler (Verletzungen, Spielerwechsel, Karriere usw.) für Gesprächs-
stoff, der die Rezipienten in persönlichen Kontakt mit anderen Menschen
treten lässt. Für Hackforth ist es gar ,,wichtigster Faktor der personalen
Kommunikation" (Hackforth 1998: 248), da die Sportrezeption Gemein-
schaft schaffen kann. Dies zeigt sich insbesondere bei Fußball-
Länderspielen und noch mehr bei Großereignissen wie Welt- und Euro-
pameisterschaften (vgl. Kap. 1).
2 Sportjournalismus
17
2.4
Fußball-Nutzung in den klassischen Medien
Zu den gerade dargestellten Funktionen und Nutzungsmotiven kommen
weitere Gründe, die zu einer Rezeption von Sport und Fußball in den Me-
dien führen. Bedeutend ist zum Beispiel der Reiz der Spannung des sport-
lichen Wettkampfes (vgl. Schwier 2000: 92). Darüber hinaus ergeben sich
weitere Bedürfnisse,
,,beispielsweise ,Dabei sein können' (Partizipation, Aktualität), Mitfiebern
können (Spannung), Identifikation und öffentliche Thematisierung (mitreden
können) und schließlich auch das Durchbrechen des Alltags (Event)" (Ger-
hards/ Klingler/ Neuwöhner 2001: 150 f.).
Die Rezeption von Sport kann also auf all diesen Ebenen betrachtet wer-
den. Die Medien suggerieren dem Rezipienten dabei die eigene Partizipa-
tion am Geschehen und spielen damit eine wichtige Rolle. (Vgl. Gerhards/
Klingler/ Neuwöhner 2001: 151) Das Mitfiebern an Sportereignissen war
immer schon ungebrochen groß. Aufgrund seiner gesellschaftlichen Be-
deutung hat der Sport damit seit jeher dazu beigetragen, dass sich Mas-
senmedien als solche etabliert haben: ,,Mediengeschichte ist immer auch
Sportmediengeschichte" (Loosen 2001a: 138).
Im Folgenden soll nun die Rezeption von Fußball in den klassischen Me-
dien
13
im Mittelpunkt stehen. Zunächst wird kurz die traditionelle Vermitt-
lung von Fußballinhalten durch Sportjournalisten in den klassischen Me-
dien dargestellt. Denn die Vermittlung von Fußballinhalten im Internet er-
folgt unter anderen Rahmenbedingungen und muss daher isoliert betrach-
tet werden (vgl. Kap. 3.3)
2.4.1 Tageszeitungen
Nachdem sich der Sportjournalismus in England mit ersten Sportjournalis-
ten, Sportzeitschriften und Sportteilen in Tageszeitungen bereits entwi-
ckelt hatte (vgl. Weischenberg 1976: 120 f.), wurde 1886 auch in Deutsch-
land das Sportressort in der Tageszeitung ,,Münchener Neueste Nachrich-
ten" geboren und war in der Folgezeit besonders verkaufsfördernd (vgl.
13
Wenn im weiteren Verlauf von klassischen oder traditionellen Medien die Rede ist, so
sind die vor dem Internet etablierten Printmedien (Zeitungen und Zeitschriften), Radio
und Fernsehen gemeint.
2 Sportjournalismus
18
Gerhards/ Klingler/ Neuwöhner 2001: 149). Bis heute hat der Sportjourna-
lismus eine wichtige Bedeutung für die Zeitungen (vgl. Görner 1995: 38
ff.). Den größten Stellenwert hat auch hier der Fußball, der während der
Bundesligasaison die Sportseiten der Zeitungen füllt. In den Montagsaus-
gaben dominieren die Spielberichte vom Wochenende. An den Wochen-
tagen liefen die Zeitungen in erster Linie Hintergrundberichterstattung und
grenzen sich damit von den anderen traditionellen Medien ab (vgl. Riefler
1998: 114). Die Regionalzeitungen, als größte Gruppe der Tageszeitun-
gen, spielen auch im Sportressort ,,ihre besondere Kompetenz in der regi-
onalen Information" aus und berichten in erster Linie über die jeweiligen
lokalen und regionalen (Fußball-)Profivereine. Damit waren sie zumindest
bisher die wichtigste Informationsquelle für die Fußballfans in der Region.
2.4.2 Fachzeitschriften
Auch der Markt der Sportfachzeitschriften wird vom Fußball bestimmt. Die
Sportfachzeitschrift mit der derzeit größten Auflage ist Sport-Bild, die vom
Axel-Springer-Verlag seit 1988 herausgegeben wird und sich selbst als
größte Sportzeitschrift Europas bezeichnet. Die verkaufte Auflage betrug
im zweiten Quartal 2005 474.048 und die Druckauflage 649.386 Exempla-
re
14
. Sie erscheint einmal wöchentlich mittwochs und legt den themati-
schen Schwerpunkt auf Fußball. Der zweitwichtigste Inhaltsaspekt ist der
Motorsport, der jedoch deutlich weniger Beachtung findet.
15
Die Redaktion
arbeitet in Hamburg und unterscheidet sich in der journalistischen Tätig-
keit von üblichen Sportredaktionen in Tageszeitungen: ,,Die Redakteure
haben ausschließlich die Aufgabe ,Geschichten anzuschleppen' und das
möglichst exklusiv." (Kühne-Hellmessen 1994: 207) Das sonst in Tages-
zeitungsredaktionen übliche Verfassen von Meldungen, redigieren und der
Spätdienst entfallen bei der Sport-Bild, da auch am Erscheinungstag Mitt-
woch nicht über das aktuelle Geschehen von Dienstag (z.B. Champions
League) berichtet wird.
14
Sämtliche Daten zur Auflage der Fachzeitschriften basieren auf den Angaben der In-
formationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW),
http://www.ivw.de.
15
Vgl. http://www.sportbild.de/sportbild/impressum/mediadaten.html, 13.7.2005.
2 Sportjournalismus
19
Das bekannteste Fußballfachmagazin ist der Kicker aus dem Olympia-
Verlag, der 1920 von Walther Bensemann gegründet wurde (vgl. Koß-
mann 1994: 188). Die Hauptredaktion sitzt in Nürnberg und produziert die
Zeitschrift zweimal wöchentlich, montags und donnerstags. Im zweiten
Quartal 2005 erreichte er montags eine Auflage von 242.468 und donners-
tags 206.925 verkauften Exemplaren
16
. Auch wenn er sich selbst als rei-
nes Fußballmagazin bezeichnet, hat er dennoch andere Sportarten im
Angebot, wenn diese auch im Vergleich zum Fußball nur am Rande be-
handelt werden. Neben einem Tiefdruck-Mantelteil, indem sich vor allem
Hintergrundartikel, Analysen und Interviews befinden, beschäftigt sich die
Montagsausgabe in erster Linie mit den Fußballspielen sämtlicher Ligen
vom Wochenende. Die Donnerstagsausgabe bot ursprünglich vor allem
einen Ausblick auf den Spieltag des kommenden Wochenendes, hat aber
seitdem es auch immer mehr Spiele auch während der Woche gibt, einen
hohen aktuellen Wert. (Vgl. Koßmann 1994: 190 ff.)
Seit April 2000 ist ein weiteres Fußballmagazin auf dem Markt. Das mo-
natliche erscheinende Heft 11 Freunde bezeichnet sich selbst als ,,Maga-
zin für Fußballkultur"
17
. Es bietet keine aktuelle Berichterstattung, sondern
in erster Linie Hintergrundberichte, Interviews und Reportagen, die sehr
auf den Blickwinkel der Fans gerichtet sind. Es wird daher auch als ,,Fan-
zine" (Pollmeier 2004: 16) bezeichnet. Auffällig ist, dass ein Großteil der
angesprochenen Merkmale des Sportjournalismus auf dieses Format nicht
zutrifft. Die Redakteure klammern z.B. keine heiklen Themen aus (vgl.
Pollmeier 2002: 17). Trotz einer kontinuierlichen Steigerung der Auflagen-
zahlen (vgl. Pollmeier 2004: 16 f.) ist die verkaufte Auflage mit 27.700 und
einer Druckauflage von 70.000 Exemplaren
18
im zweiten Quartal 2005
deutlich niedriger als die der beiden zuvor erwähnten Fachzeitschriften mit
aktuellem Bezug.
Seit August 2005 gibt der Olympia-Verlag, in dem auch der Kicker er-
scheint (s.o.), ein eigenes, dem Magazin 11 Freunde ähnliches, monatli-
ches Heft mit dem Namen ,Rund' heraus. Auch hier fehlt der aktuelle Be-
16
Die Druckauflage betrug 376.515 (montags) bzw. 321.251 (donnerstags).
17
Diese Bezeichnung wird im Untertitel jeder gedruckten Ausgabe verwendet.
18
Vgl.: http://www.11freunde.de/about, 28.9.2005.
2 Sportjournalismus
20
zug zum Fußball und es wird ähnlich wie bei 11 Freunde berichtet
19
. Die
gedruckte Auflage beträgt 120.000 Exemplare
20
.
2.4.3 Fernsehen
Das Fernsehen stellt das Leitmedium schlechthin dar, das sich auch mit
Hilfe des Sports, insbesondere des Fußballs, als solches etabliert hat.
Mit der Live-Übertragung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin begann
eine ,,besondere Symbiose" (Loosen 2001a: 138) zwischen Sport und
Fernsehen: ,,Nicht zuletzt dank des Sports machte auch dieses neue Me-
dium relativ schnell Fortschritte." (Weischenberg 1976: 146) Vor allem die
Fußballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz sorgte für einen enormen
Absatz an Fernsehgeräten in Deutschland (vgl. Weischenberg 1976: 152).
Später nutzte die ARD die Popularität des Fußballs und etablierte ab 1961
mit der Sportschau eine Sendeform (vgl. Weischenberg 1976: 153), die
noch heute regelmäßig über die Fußballbundesliga berichtet.
Der Fußball hat ab den 1980ern auch erheblich zur Verbreitung und
Reichweitenerhöhung des Privatfernsehens beigetragen
21
. Die privaten
Fernsehsender wiederum sorgten mit ihrer Präsenz auf dem Markt für eine
rasante Entwicklung des Wettbewerbs um die interessantesten Sportrech-
te und damit auch für deren schnellen Anstieg, was wiederum zur endgül-
tigen Kommerzialisierung des Sports führte (vgl. Kap. 2.1, 2.2).
Es gibt auf dem deutschen Markt zwei reine Sportkanäle: das Deutsche
Sportfernsehen (DSF) und Eurosport, die beide 1993 auf Sendung gingen
(vgl. Görner 1995: 54). Das DSF ging aus dem Sender Tele 5 hervor, Eu-
rosport behielt seinen Namen, als es mit dem ,Sportkanal' fusionierte. Zu-
mindest das DSF versucht, von der Popularität des Fußballs zu profitieren
und erwarb ab 2003 die Erstverwertungsrechte für zwei Bundesligaspiele
am Sonntag.
19
Vgl.: http://www.rund-magazin.de/magazin, 28.9. 2005.
20
Vgl.: http://www.olympia-verlag.de/rund/media.aspx, 28.9. 2005.
21
Die Erstverwertungsrechte der Fußballbundesliga lagen seit dem Rechterwerb der Ufa
1988 bis 2003 durchgehend bei Privatsendern. Zunächst bei RTL, später bei Sat.1 (vgl.
Loosen 2001: 138).
2 Sportjournalismus
21
2.4.4
Radio
Der Sport spielte ab 1921 auch für die Verbreitung des Hörfunks eine
wichtige Rolle. Er erschien ,,vor allem in Hinblick auf Aktualität und Mobili-
tät besonders geeignet für das neue Medium [Hörfunk]" (Loosen 2001a:
138). Schnell trugen die ersten Live-Reportagen von Sportereignissen zur
Beliebtheit des neuen Mediums bei. Nachdem am 2. Juli 1921 in den USA
bereits der erste Boxkampf live im Radio übertragen wurde (vgl. Wei-
schenberg 1976: 141), war drei Jahre später eine Regatta in Hamburg
Anlass für die erste Live-Übertragung in Deutschland. Das erste Fußball-
spiel war 1925 live im Radio zu hören: Preußen Münster gegen Arminia
Bielefeld. (Vgl. Gödeke 2004: 32)
Hinsichtlich des Sports war das Radio ursprünglich von höherer Bedeu-
tung als das Fernsehen. Dieses hatte noch keine derartige Reichweite wie
der Rundfunk erlangen können, so dass zunächst das Radio ,,ein Monopol
für aktuelle Sportberichterstattung" (Digel 1983:23) inne hatte.
Heute ist das Radio in erster Linie bei solchen Live-Übertragungen inte-
ressant, die die Rezipienten nicht live im Fernsehen oder vor Ort verfolgen
können. Ein Fußballfan, der keine Karte für ein Bundesligaspiel und auch
keinen Pay-TV-Anschluss
22
hat, hat zum Beispiel die Möglichkeit, zumin-
dest Radioreportagen der Fußballbundesliga in den öffentlich-rechtlichen
Sendern zu verfolgen.
2.5 Zusammenfassung und Ausblick
Ob Fernsehen, Zeitung oder Radio: ,,Sportberichterstattung war und ist ein
wesentliches Zugpferd der Medien-Verkaufsförderung." (Loosen 1997: 38)
Mehrmals hat der Sport und seine Berichterstattung einem Medium zum
Durchbruch verholfen (vgl. Kap. 2.4). Doch die Popularität in der Bevölke-
rung hat dazu beigetragen, dass auch die Wirtschaft den Sport als Ver-
marktungsmöglichkeit erkannt hat. Dies führt zu einem hohen Grad an
Kommerzialisierung der populärsten Sportarten. Besonders ausgeprägt ist
dies folgerichtig beim Fußball (vgl. Kap. 2.1). Auf diese Sportart konzent-
22
Bis auf wenige Ausnahme werden Fußballbundesligaspiele live nur im Pay-TV-Sender
Premiere gezeigt.
2 Sportjournalismus
22
riert sich deswegen schon seit geraumer Zeit der Großteil der Kritik, die
dem Sportjournalismus gilt. So hielten Hackforth und Schaffrath Ende der
1990er Jahre fest:
,,Nachdenklichkeit muß aufkommen, wenn der Trend verstärkt wird, daß
Medien und damit Journalismus nicht mehr als autonomes System,
unabhängig von Wirtschaft und Sport, auftreten, sondern mit der Wirt-
schaft (Werbung, Sponsoring, Marketing) ebenso eng verbunden sind
wie mit dem Sport [...], den sie eigenständig organisieren und medienge-
recht inszenieren. Damit gerät ein Stück ,Mediendemokratie' in zweifel-
hafte Abhängigkeiten, würden den Medien gesellschaftliche Einflüsse
zustehen, die weder der Gesetzgeber noch die Politik je gewünscht hät-
ten" (Hackforth/ Schaffrath 1998: 250).
Der Durchbruch des Internets, der nicht zuletzt erneut an der Thematisie-
rung des Sports gelegen hat, schürte bei vielen die Hoffnung auf einen
neuen und qualitativ hochwertigeren Journalismus und damit auch Sport-
journalismus. Die Erwartungen gingen dahin, dass das Internet gerade
von einigen der angesprochenen kritischen Entwicklungen bei der Sport-
berichterstattung profitieren könnte, dass die Onlinesportjournalisten so-
zusagen aus den Fehlern ihrer Kollegen in den klassischen Medien lernen
könnten.
Im Folgenden soll dies am Beispiel des Fußballs näher erläutert werden.
Dabei wird insbesondere auf die speziellen Möglichkeiten eingegangen,
die das Internet bei der Präsentation von Fußball bietet und durch die es
sich von anderen Medien abgrenzt.
3 Fußball im Internet
23
3
Fußball im Internet
Auch für das Internet gilt, was zuvor schon für die anderen Medien festge-
stellt wurde: Der Fußball dominiert die Inhalte der Sportberichterstattung
und die Interessen der Nutzer (vgl. Sportfive 2004b: 60).
Dabei werden immer mehr die speziellen Möglichkeiten zur schnellen, ge-
zielten Informationssuche (über eine Mannschaft, ein Spiel etc.), genutzt,
die das Internet im Gegensatz zu den klassischen Medien bieten (vgl.
Gerhards/ Klingler/ Neuwöhner 2001: 165).
Bevor jedoch auf die medialen Möglichkeiten des Internets eingegangen
wird, muss zunächst geklärt werden, inwiefern es sich beim Internet um
ein Medium handelt.
3.1
Das Internet als Medium
Nachdem das WWW 1989 entwickelt und ab 1992 eingesetzt wurde
23
und
das Internet
24
somit theoretisch für jedermann sofern er denn über die
technischen Vorraussetzungen verfügt nutzbar wurde, ist eine völlig
neue Kommunikationsplattform entstanden
25
. Das Internet als vollwertiges
Medium anzusehen ist in der Wissenschaft allerdings umstritten bzw. wird
zumindest als problematisch angesehen.
In der wissenschaftlichen Diskussion wird in technische und institutionelle
Medien unterschieden. (Vgl. Neuberger 1999: 17 ff., Quandt 2004: 454 ff.,
Riefler 2002: 71, Rössler 2003: 505 f., Schmidt/ Kubicek 1994: 403) Der
Computer, der die Internet-Kommunikation technisch ermöglicht, ist ein
Medium im technischen Sinn und ,,funktionale[r] Bestandteil von institutio-
nellen Medien" (Schmid/ Kubicek 1994: 403). Schmid und Kubicek sahen
vor gut zehn Jahren aber auch Computernetze lediglich als technische
Medien an (vgl. Schmid/ Kubicek 1994: 403) und auch Altmeppen hält das
23
Im WWW können Informationen auf einem Server gespeichert und mit Hilfe eines
Browser-Programms von dort abgerufen werden (vgl. Bickel 1998: 213, Lehr 1999: 61).
24
Sennewald definiert Internet als einen ,,freie[n] Zusammenschluß weltweiter Computer-
netzwerke, die einen netzübergreifenden Datenverkehr ermöglichen" (Sennewald 1998:
11).
25
Zuvor war das Internet ein im kalten Krieg entwickeltes, zu militärischen Zwecken ge-
nutztes Netzwerk (vgl. Bickel 1998: 212, Lehr 1999: 61, Rössler 2003: 506 f., Vesper
1998: 12 f.).
3 Fußball im Internet
24
Internet für eine ,,technische Grundlage", das WWW jedoch auch nur als
,,hauptsächliche Zugangssoftware" (Altmeppen 2000: 124). Eine allgemei-
ne Bezeichnung als Medium findet er für das Internet daher problema-
tisch. Winter akzeptiert das Internet ebenfalls nicht als Medium, wohl aber
das WWW, das er als Einzelmedium bestimmt (vgl. Winter 2000: 274).
Auch wenn die Bezeichnung ,Medium' für das gesamte Internet problema-
tisch ist, akzeptiert die mehrheitliche Meinung zumindest das WWW als
vollwertiges (Massen-)Medium, mit dem Unterschied, dass es sich durch
die speziellen Eigenschaften des Internets
26
wechselseitig um ein Indivi-
dual- und Massenmedium handelt, während die traditionellen Medien als
einseitige Massenmedien betrachtet werden (vgl. Bickel 1998: 217, Neu-
berger 1999: 49, Quandt 2004: 457, Sennewald 1998: 10 f.). Das Internet
hat somit als Medium eine Sonderstellung gegenüber den traditionellen
Medien und stellt Kommunikatoren und Rezipienten neue Möglichkeiten
zur Verfügung.
Joshua Quittner sah Anfang der 1990er Jahre dadurch bedingt eine große
Chance und sprach 1995 von der ,,Geburt eines völlig neuen Journalis-
mus" (Quittner 1996: 425). Er war der Überzeugung, dass die einmaligen
Möglichkeiten des Mediums ein herausragendes Niveau schaffen würden
und setzte dabei vor allem auf die Verbindung aller traditionellen Medien,
die ein alles integrierendes, neues Medium bieten würde:
,,Ich spreche über eine grundlegende Wandlung im Journalismus selbst,
in der Art der Berichterstattung und Nachrichtenpräsentation. Diese
Wandlung wird viel einschneidender sein als alles, was wir seit der Ge-
burt des Journalismus jemals gesehen haben; vielleicht sogar revolutio-
närer als die Anfänge des Journalismus selbst. Es kann gar nicht anders
sein, betrachtet man die Menge der Werkzeuge, die wir nutzen können."
(Quittner 1996: 426)
Die Möglichkeiten wurden dabei gerade für die Sportberichterstattung als
perfekt angesehen:
,,Sport und Internet, diese Kombination schien aus mehreren Gründen
geradezu ideal zu sein: Inhalte können äußerst zeitnah bereitgestellt
werden und so die User mit brandaktuellen Informationen versorgt wer-
den. Außerdem können per Internet auch Bilder und Töne übertragen
werden, was das Erlebnis einer Sportberichterstattung deutlich aufwertet
und es mit einem einzigartigen Mehrwert versieht." (Medau/ Reutner
2001:186)
26
Wenn im Folgenden vom Internet die Rede ist, so ist damit das WWW als Nutzungs-
grundlage in medialer Hinsicht gemeint.
3 Fußball im Internet
25
Im Folgenden werden die Möglichkeiten näher erläutert
27
.
Interaktivität
Ein großer Unterschied zu den klassischen Medien besteht in der Mög-
lichkeit zur Interaktion. Bei der Interaktivität wird in die technik- und sozial-
orientierte Perspektive unterschieden (vgl. Stumm 2002: 34 f., Loosen/
Weischenberg 2000: 73 ff.). Die technikorientierte Vorstellung geht von
einer Mensch-Medium-Interaktivität aus. Interaktiv handelt der Nutzer
dann, wenn er die Informationen nach seinen Wünschen auswählt, in dem
er gezielt und selektiv rezipiert. Er hat dabei komplexere Selektionsmög-
lichkeiten als bei den klassischen Medien. Neuberger bezeichnet diese
Form der ,,Mensch-zu-Maschine-Beziehung" (Neuberger 1999: 40) ledig-
lich als Selektivität (vgl. ebd. 1999: 40). Sebastian Vesper versteht die
Mensch-Medium-Interaktivität außerdem aber auch als ,,Möglichkeit für
den Nutzer, in welcher Form auch immer Einfluss auf das Medienprodukt
zu nehmen" (Vesper 1998: 52). Dies würde dann zum Beispiel Umfragen
zu einem bestimmten Thema
28
beinhalten.
Die sozialorientierte Vorstellung, die Stumm als ,,echte Interaktion" (Stumm
2002: 35)
29
bezeichnet, geht von einer wechselseitigen, direkten Kommu-
nikation zwischen Personen mittels eines Mediums aus. Loosen und Wei-
schenberg sprechen dabei von der ,,computergestützten Mensch-Mensch-
Kommunikation" (Loosen/ Weischenberg 2000: 73). Diese Vorstellung von
Interaktivität beschreibt die Möglichkeit der Nutzer, auf Internetseiten mit
anderen Nutzern oder den Anbietern eines Online-Angebotes dank elekt-
ronischer Hilfsmittel in Kraft zu treten. Dies beinhaltet asynchrone Kom-
munikationsformen wie E-Mails an die Redaktionen oder Diskussionsforen
und synchrone Kommunikationsformen wie den Chat. Ausdrücklich sei
darauf verwiesen, dass es bei der Interaktivität in hohem Maße auf den
Nutzer ankommt. Keine Website ist automatisch interaktiv, sondern stellt
27
Der Verfasser beschränkt sich bei der Darstellung der Einfachheit halber auf die positi-
ve Darstellung der vorgestellten Möglichkeiten, um die Chancen herauszuarbeiten, die
das Internet der kritisierten Sportberichterstattung bietet. Gleichwohl ist ihm bewusst,
dass es gerade auch für den Journalismus negative Ausprägungen, wie z.B. steigende
Bedeutungslosigkeit journalistischer Standards, ausbleibende journalistische Eigenleis-
tungen und fehlende Abgrenzung von redaktionellen und werblichen Inhalten haben
kann. Dies ist z.B. bei Neuberger (2002b) nachzulesen.
28
Diese Umfragen werden auf Websites in der Regel Votings genannt.
29
Vgl. auch Neuberger 1999: 40.
3 Fußball im Internet
26
nur die Möglichkeit zur Interaktion zur Verfügung. Ob diese und in wel-
chem Maße sie genutzt wird, hängt vom jeweiligen Nutzer ab. (Vgl. Röss-
ler 2003: 506)
Seit die Möglichkeit zur Interaktivität im Internet besteht, werden interakti-
ve Elemente sowohl in den klassischen Medien, als auch im Online-
Journalismus thematisiert. Um z.B. den Unmut der Fans des VFB Stuttgart
über einen Wechsel ihres bisherigen Stürmers Kevin Kuranyi zum FC
Schalke 04 zu belegen, zitierte Redakteur Thomas Gaber von sport1.de in
einem Artikel mehrere Fanbeiträge im Forum der Websites des VfB Stutt-
gart (vgl. Gaber 2005). Damit können Internetnutzer Einfluss auf journalis-
tische Inhalte nehmen.
Aktualität
Das Internet ist außerdem rund um die Uhr ohne Probleme aktualisierbar
(vgl. Neuberger 2002a: 358), da es nicht an feste Sendezeiten und Er-
scheinungstermine wie gebunden ist: ,,Einer, wenn nicht der größte Vorteil
des Internets für die Sport-Berichterstattung ist die fast konkurrenzlose
Aktualität des Mediums." (Medau/ Reutner 2001: 191).
Dank moderner Redaktionssysteme können Online-Redaktionen sekun-
denschnell ihre Inhalte publizieren. Mit Hilfe des Live-Tickers
30
kann man
zum Beispiel jedes aktuelle Sportgeschehen zeitnah verfolgen. Lediglich
das Fernsehen bietet dem Rezipienten hier noch ein stärkeres Live-Gefühl
allerdings auch nur dann, wenn ein Sportereignis tatsächlich live über-
tragen wird. In den übrigen Fällen liegt der Vorteil wieder beim Internet,
wo sich jedermann über jedes gewünschte Ereignis aktuell informieren
kann. Selbst das Radio kann beim Sport nur bedingt konkurrieren, da
kaum ein Ereignis komplett live übertragen wird
31
. Meist schalten die Ra-
diosender mehrmals für einige Minuten zu einem Reporter vor Ort.
30
Mit dem Live-Ticker kann über jedes live stattfindende Sportereignis im Internet berich-
tet werden. Der Nutzer kann nahezu zeitgleich von Redakteuren chronologisch verfasste
Berichte in kurzen Sätzen und Statements über ein Ereignis verfolgen. (Vgl. Koch 2001:
76)
31
Siehe hierzu die Ausführungen zur Multimedialität in diesem Kapitel.
3 Fußball im Internet
27
Hypertextformat
Im Internet besteht zudem die Möglichkeit, Informationen flexibler zu prä-
sentieren. Im Gegensatz zu den Printmedien, wo nur lineare Texte ange-
boten werden, können einzelne Einheiten zu einem Netzwerk im Hyper-
textformat verknüpft werden. Die Urheber von Sportangeboten im Internet
können dem Netzer so etwa die Möglichkeit geben, sich durch einen
Zugriff auf eine Datenbank, die in einem Angebot oder Text verlinkt
32
wird,
weitere, eventuell interessante Details über ein Thema zu beschaffen.
Dies könnte in einem Artikel über ein Fußballspiel z.B. der Link zur Statis-
tik dieser beiden Mannschaften oder eines Spielers sein, der ein Tor ge-
schossen hat.
Speicherkapazität
Diesen Vorteil bedingt auch unmittelbar die hohe Speicherkapazität, an-
gesichts derer das Internet den klassischen Medien konkurrenzlos gegen-
über steht: ,,Der Umfang der bereitzustellenden Inhalte ist theoretisch nur
durch die Ressourcen des Anbieters begrenzt, während die klassischen
Medien den Zwängen der Sendezeit oder des Zeitumfangs unterliegen"
(Rudolf 2004: 22). Dank dieser hohen Kapazität können die Anbieter, die
oben angesprochenen Zusatzinformationen wie Datenbanken beliebig oft
anbieten und erweitern. Gerade bei Statistiken verweisen die klassischen
Medien gerne auf ihr Online-Angebot (vgl. Marx 2004: 30).
Multimedialität
Es besteht im Internet die Möglichkeit, Kommunikationstechniken, die zu-
vor stets getrennt waren, zu vereinen. Texte, Bilder, Grafiken, Videos und
Töne können beliebig kombiniert werden. Gerade die Sportpräsentation,
die davon lebt, Emotionen zu wecken und zu transportieren, profitiert von
der Möglichkeit im Internet, Videosequenzen oder Audiobeiträge von
Sportveranstaltungen online abrufen zu können: ,,Kaum eine andere Pro-
grammsparte eignet sich so gut wie der Sport zur multimedialen Verwer-
tung" (Fischer 1994: 58).
Das Potenzial der Multimedialität wird von den Sport-Onlineangeboten
immer mehr angenommen. Über die Website der deutschen Fußball-
32
Ein ,Link' bezeichnet die Verbindung von einer Internetseite zu einer anderen.
3 Fußball im Internet
28
Bundesliga
33
sind z.B. seit dem Jahr 2000 alle Fußballspiele der ersten
Bundesliga live als Audioreportagen zu hören. Auch für die Präsentation
von traditionellen Medien im Internet ergeben sich dadurch ganz neue
Möglichkeiten. Tageszeitungen etwa können anders als auf den wenigen
Sportseiten der gedruckten Ausgabe bei ihrem Internetauftritt viel mehr
auf Fotos zurückgreifen:
,,Nicht selten werden die ersten drei Geschichten des Ressorts [...] mit
einer zweistelligen Fotozahl bebildert. In der Zeitung ist das nicht mög-
lich. Hier wird in der Regel eine kräftige Aufmachung mit einem ästhe-
tisch herausragenden Bild gewählt. Oft ist es das einzige auf der Seite."
(Marx 2004: 30)
Durch die zuvor bereits beschriebene Mensch-Medium-Interaktivität kann
der Nutzer im Internet entscheiden, in welcher Form er sich über das ge-
wünschte Sportereignis informieren möchte: in Textform, unterstützt durch
Fotos, per Videostream
34
oder über das Webradio. Durch diese Einbezie-
hung des Rezipienten grenzt sich die Internet-Multimedialität von der bis-
herigen Multimedialität, z.B. im Fernsehen, ab (vgl. Neuberger 1999: 34).
Weltweiter Zugang
Ein großer Vorteil des Internets gegenüber den klassischen Medien liegt
zudem im globalen Zugang zu den gewünschten Informationen (vgl. Neu-
berger 2002a: 357). Die benötigten technischen Anforderungen vorraus-
gesetzt, kann man rund um die Uhr, egal in welchem Teil der Welt man
sich befindet, Inhalte schnell und aktuell abrufen.
3.2
Veränderte Öffentlichkeit: Rezipienten- und Kommunikato-
renrolle im Internet
Neben den besonderen Möglichkeiten im neuen Medium gelten jedoch
auch andere Rahmenbedingungen für die Kommunikation. Die in den
klassischen Medien alleinige Aufgabe der Journalisten, Inhalte zu vermit-
teln, gilt im Internet nicht mehr: ,,Journalisten sind im Zeitalter des Internet
nicht mehr Monopolisten der Öffentlichkeit. Sie sind ,nur' noch die Informa-
tionsprofis unter (theoretisch) gleichgestellten Mitbenutzern eines Medi-
33
http://www.bundesliga.de
34
Videostream bezeichnet die Möglichkeit, sich Sequenzen einer Videodatei mit Hilfe
eines Programms anzuschauen, das dies über den Browser abspielen kann. Streaming
(engl., stream=Strom) bedeutet dabei Datenstrom.
3 Fußball im Internet
29
ums" (Zender 1998: 187). Das Internet bietet quasi jedermann die Mög-
lichkeit, sich zu präsentieren. Die einzige Schwelle stellen technische
Determinanten dar. Seine Funktion als Kommunikator (vgl. Hackforth
1994: 33), hat der Journalist zumindest als Exklusivrolle verloren (vgl.
Neuberger 2002a: 358). Das Internet sorgt somit für eine ,,soziale
Entgrenzung" (Neuberger 2002a: 357). Jedermann kann im Internet zum
Kommunikator werden und zwischen dieser und der Rezipientenrolle
wechseln.
Dies führt zu einer Veränderung des traditionellen Öffentlichkeitsmodells,
wie es z.B. Weßler darstellt. Demnach gibt es drei Rollen für Akteure in
der Öffentlichkeit: Erstens die Sprecherrolle, die Themen verkünden und
den Medien anbieten. PR-Akteure in Parteien, Unternehmen oder auch
Sportvereinen vor allem im Leistungssport nehmen unter anderem
diese Rolle ein. Zweitens die Vermittlerrolle, die bislang den Journalisten
vorbehalten wahr und drittens das Publikum. (Vgl. Weßler 2002) Gerhards
stellt dazu fest: ,,Die Kommunikationsrichtung ist dabei einseitig von den
Akteuren, über die Medien an das Publikum gerichtet" (Gerhards 1998:
35). Dieses Öffentlichkeitsmodell geht davon aus, dass ,,alle, die sich in
der Öffentlichkeit zu Wort melden wollen, eine Sprecherrolle ein[nehmen]"
(Pfetsch/ Wehmeier 2002: 39) und Journalisten zwangsläufig die Vermitt-
lerrolle innehaben
35
. Sprecher und Vermittler sind dabei gegenseitig auf-
einander angewiesen. Die Sprecher benötigen die Journalisten als Ver-
mittler, um ihre Themen der Öffentlichkeit (Publikum) zugängig zu machen
und die journalistischen Vermittler benötigen die Sprecher, um mit The-
men versorgt zu werden. (Vgl. Pfetsch/ Wehmeier 2002: 39 ff.)
In der Internetkommunikation ändert sich dies. Die Annahme, ,,daß eine
Kommunikation mit dem Publikum massenmedial nicht stattfinden kann"
(Gerhards 1998: 35), gilt für das Internet durch interaktive Möglichkeiten
(vgl. Kap. 3.1) nicht mehr. Außerdem kann auch der Sprecher zum Ver-
mittler werden. Die Vermittlung durch den Journalismus wird also nicht
mehr benötigt (vgl. Neuberger 2003: 132). Besonders auffällig ist dies
beim Sport im Internet: ,,Dass journalistische Vermittler partiell ihre Funkti-
35
Diese Annahme geht dabei darauf zurück, dass sich Öffentlichkeitstheorien auf Demo-
kratietheorien beziehen und das Existieren einer Demokratie voraussetzen (vgl. Gerhards
1998: 25 f.). In diesem Kontext definiert Gerhards Öffentlichkeit als einen ,,kommunikati-
ve[n] Raum, der öffentliche Veranstaltungen, einfache Interaktionen zwischen Menschen
aber auch die Massenmedien umfasst" (Gerhards 1998: 28).
3 Fußball im Internet
30
on im Internet verlieren, zeigt sich besonders im Bereich des Sports"
(Neuberger 2000b: 107), wo relativ früh relevante Informationen auf Ver-
einshomepages bereit gestellt wurden (vgl. Kap. 3.3.3). Diskussionen, die
sich mit der Frage beschäftigen, ob der Journalismus im Internet dadurch
verschwinden werde (vgl. Neuberger 2001b: 118 f., Quandt 2004: 457),
enden überwiegend mit dem Schluss, dass sich der Journalismus im In-
ternet lediglich verändere (vgl. Loosen 2001b, Riefler 2002: 74, Wilke
1998), aber keinesfalls obsolet werde:
,,Der Journalismus ist und bleibt die Kernkompetenz derjenigen, die sich
in einer Gesellschaft professionell um die Informationsvermittlung, die
Meinungsbildung, die Herstellung von Öffentlichkeit und die Kontrolle der
Mächtigen kümmern" (Rosenberger 2002: 80).
Darüber hinaus haben Journalisten auch eine Orientierungsfunktion (Kap.
2.3), die gerade angesichts der unübersichtlichen Anzahl von Informati-
onsmöglichkeiten zukünftig noch wichtiger werden wird (vgl. Neuberger
2001a: 227 f., Rössler 2003: 516). Neuberger weist außerdem auf die
Funktion des Journalismus als ,,Qualitätskontrolle [.] im Internet" (Neuber-
ger 2003: 132) hin. Durch das herrschende unübersichtliche Überangebot
an Informationen grenzt sich der Journalist und damit auch der Sportjour-
nalist entschieden von den anderen Vermittlern ab. Dabei muss bedacht
werden, dass die unterschiedlichen Online-Kommunikatoren bei der Be-
reitstellung von Informationen im Netz von anderen Kriterien geleitet wer-
den, als Journalisten (vgl. Rössler 2003: 509). Die Konsequenzen, die sich
daraus ergeben können, sollen anhand der verschiedenen Kommunikato-
ren von Fußballinhalten im Internet erläutert werden.
3.3
Fußballangebote im Internet und ihre Nutzung
Zur Kategorisierung der verschiedenen Internet-Angebote haben sich die
Begriffe Commerce, Contact, Content und Community heraus gebildet. Es
ist durchaus denkbar, dass ein Online-Angebot mehrere dieser oder alle
Bereiche offeriert. Der Begriff Commerce bezeichnet dabei den kommer-
ziellen Zweck einer Homepage. Bei der Website eines Fußballvereins
könnte dies etwa der Karten- oder Fanartikelverkauf sein. Contact be-
zeichnet die Möglichkeit der Kontaktaufnahme für die Nutzer mit den
Betreibern der Seite, Content steht für die Bereitstellung von Informatio-
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832494391
- ISBN (Paperback)
- 9783838694399
- DOI
- 10.3239/9783832494391
- Dateigröße
- 2.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – Philosophische Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2006 (März)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- online-journalismus sportjournalismus mediensport fußballwebsites
- Produktsicherheit
- Diplom.de