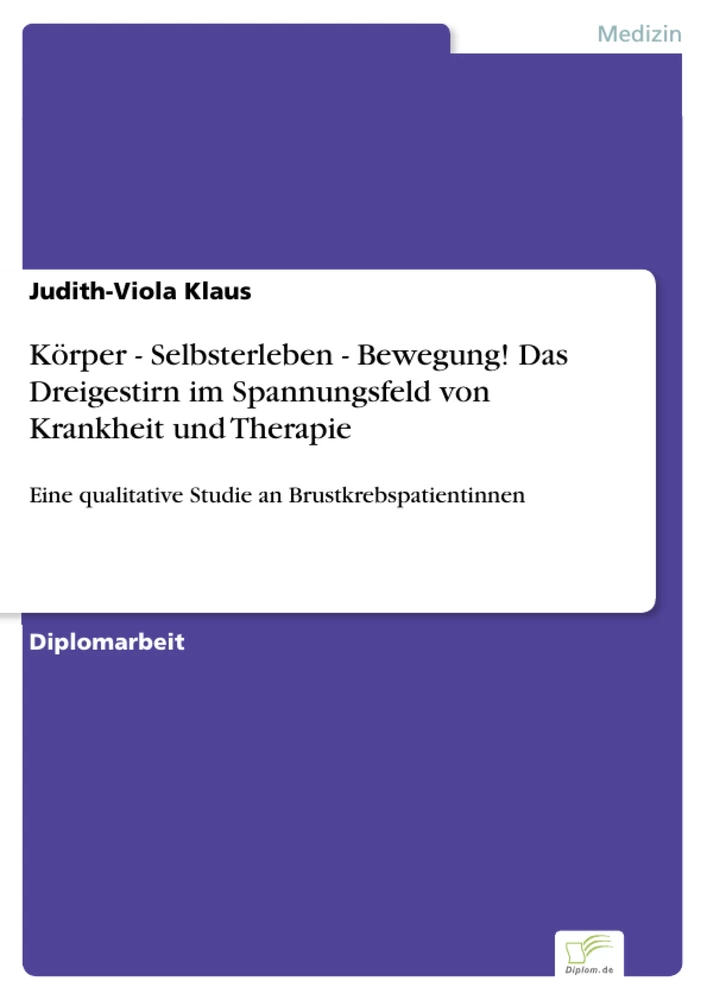Körper - Selbsterleben - Bewegung! Das Dreigestirn im Spannungsfeld von Krankheit und Therapie
Eine qualitative Studie an Brustkrebspatientinnen
©2002
Diplomarbeit
403 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Thema der vorliegenden Arbeit ist die Erforschung des Wechselspiels von Körper-, Selbsterleben und sportlicher Aktivität im Kontext einer Brustkrebserkrankung auf qualitativer Ebene. Zum einen wird aus psychosozialer Perspektive die Gefährdung der Identität und des Körpererlebens von Frauen durch eine Brustkrebserkrankung untersucht, zum anderen aus sportwissenschaftlicher Perspektive die Frage diskutiert, ob (regelmäßige) sportliche Aktivität geeignet ist, um mit den starken physiologischen und psychologischen Belastungen einer Mammakarzinomerkrankung besser fertig zu werden.
Einen Einstieg in den Themenkomplex bilden Ausführungen zu medizinischem Basiswissen und psychologischen Folgen einer Brustkrebserkrankung. Nach einer terminologischen Präzisierung der Konstrukte Selbst- und Körpererleben werden die negativen Auswirkungen einer Brustkrebserkrankung und ihrer Behandlungsformen auf die subjektive Sichtweise der Konzepte Selbst und Körper dargestellt. Es folgen nach einer kurzen Abhandlung der soziokulturellen Aspekte einer Mammakarzinomerkrankung theoretische Überlegungen zu den Möglichkeiten sportlicher Aktivierung in der Rehabilitation brustkrebserkrankter Frauen, die in einem Erklärungsansatz zur Wechselwirkung von Körpererleben, Selbsterleben, Lebenszufriedenheit und körperlicher Aktivität münden. Der Darstellung der Untersuchungsmethodik wird die Diskussion zur Auswahl der Forschungsstrategie vorgeschaltet. Die Erhebung der Daten erfolgt auf Basis leitfadenorientierter Einzelinterviews, von denen drei aufgrund ihrer besonderen Prägnanz und thematischen Divergenz detaillierter ausgewertet werden.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Auswirkungen einer Mammakarzinomerkrankung sowie sportlicher Aktivität auf das Körper- und Selbsterleben nur unter Berücksichtigung der individuellen Perspektive und einer Vielzahl mediatisierender Faktoren erklären lässt. Sportlicher Aktivität ist auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ein hoher Stellenwert für die körper- und selbstbezogene Krankheitsbewältigung beizumessen. Entsprechend den theoretischen Annahmen lässt sich eine positive Beeinflussung dieser Konstrukte auf mehreren Ebenen nachweisen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungs- und TabellenverzeichnisIII
1.Einleitung1
2.Das Krankheitsbild Brustkrebs medizinische und psychologische Aspekte5
2.1Der medizinische Aspekt: Nosologie der Brustkrebserkrankung5
2.2Der […]
Thema der vorliegenden Arbeit ist die Erforschung des Wechselspiels von Körper-, Selbsterleben und sportlicher Aktivität im Kontext einer Brustkrebserkrankung auf qualitativer Ebene. Zum einen wird aus psychosozialer Perspektive die Gefährdung der Identität und des Körpererlebens von Frauen durch eine Brustkrebserkrankung untersucht, zum anderen aus sportwissenschaftlicher Perspektive die Frage diskutiert, ob (regelmäßige) sportliche Aktivität geeignet ist, um mit den starken physiologischen und psychologischen Belastungen einer Mammakarzinomerkrankung besser fertig zu werden.
Einen Einstieg in den Themenkomplex bilden Ausführungen zu medizinischem Basiswissen und psychologischen Folgen einer Brustkrebserkrankung. Nach einer terminologischen Präzisierung der Konstrukte Selbst- und Körpererleben werden die negativen Auswirkungen einer Brustkrebserkrankung und ihrer Behandlungsformen auf die subjektive Sichtweise der Konzepte Selbst und Körper dargestellt. Es folgen nach einer kurzen Abhandlung der soziokulturellen Aspekte einer Mammakarzinomerkrankung theoretische Überlegungen zu den Möglichkeiten sportlicher Aktivierung in der Rehabilitation brustkrebserkrankter Frauen, die in einem Erklärungsansatz zur Wechselwirkung von Körpererleben, Selbsterleben, Lebenszufriedenheit und körperlicher Aktivität münden. Der Darstellung der Untersuchungsmethodik wird die Diskussion zur Auswahl der Forschungsstrategie vorgeschaltet. Die Erhebung der Daten erfolgt auf Basis leitfadenorientierter Einzelinterviews, von denen drei aufgrund ihrer besonderen Prägnanz und thematischen Divergenz detaillierter ausgewertet werden.
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Auswirkungen einer Mammakarzinomerkrankung sowie sportlicher Aktivität auf das Körper- und Selbsterleben nur unter Berücksichtigung der individuellen Perspektive und einer Vielzahl mediatisierender Faktoren erklären lässt. Sportlicher Aktivität ist auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ein hoher Stellenwert für die körper- und selbstbezogene Krankheitsbewältigung beizumessen. Entsprechend den theoretischen Annahmen lässt sich eine positive Beeinflussung dieser Konstrukte auf mehreren Ebenen nachweisen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungs- und TabellenverzeichnisIII
1.Einleitung1
2.Das Krankheitsbild Brustkrebs medizinische und psychologische Aspekte5
2.1Der medizinische Aspekt: Nosologie der Brustkrebserkrankung5
2.2Der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9421
Klaus, Judith-Viola: Körper - Selbsterleben - Bewegung!
Das Dreigestirn im Spannungsfeld von Krankheit und Therapie -
Eine qualitative Studie an Brustkrebspatientinnen
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Universität Bielefeld, Diplomarbeit, 2002
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Autorenprofil
Die Autorin Judith-Viola Klaus, geb. Roestel, hat an der Universität Bielefeld Diplom-
Sportwissenschaft sowie Geschichts- und Sportwissenschaft auf Lehramt Sek. I und II stu-
diert. Während ihres Studiums arbeitete Frau Klaus zunächst als studentische Hilfskraft und
später als Dozentin an der Universität Bielefeld unter der Obhut von Prof. Dr. Dr. Klaus Wil-
limczik. Ihr Diplom absolvierte sie mit sehr gut. Sie wurde für das beste Diplom der Sport-
wissenschaft 2002 ausgezeichnet und erhielt außerdem den Preis für die beste und interessan-
teste Diplomarbeit des Jahrgangs 2002. Seit Mai 2001 arbeitet Frau Klaus als Diplom-
Sportlehrerin in der ambulant-teilstationären Rehabilitation in Hannover. Derzeit befindet sie
sich in Elternzeit.
Danksagung
In erster Linie danke ich den Frauen, denen ich hoffentlich mit meiner Arbeit
eine Stimme geben konnte. Ich danke ihnen für das Vertrauen, das sie mir ge-
schenkt sowie die Freimütigkeit, mit der sie mir ihre Geschichte enthüllt haben
und hoffe, daß meine Arbeit einen kleinen Baustein auf dem Weg zu einer stär-
keren Berücksichtigung des individuellen Krankheitserlebens bildet.
Mein Dank gilt in besonderem Maße meinen Eltern, die mich durch jede Hürde
meines Studiums begleitet haben und immer für mich da waren, wenn ich ihrer
Hilfe bedurfte.
Bei Christian, Stini, Rolf, Peter, Felix und insbesondere bei meinem Bruder A-
xel, der sich trotz anstehender Abschlußprüfungen die Zeit zum Korrektur lesen
genommen hat, möchte ich mich für die konstruktive Kritik bedanken, die zeit-
weise zum Verzweifeln meinerseits, letztendlich aber zum Gelingen dieser
Arbeit beigetragen hat.
Kraft und Zuversicht schöpfte ich vor allem bei meinem zukünftigen Mann, dem
ich für seine immer währende Geduld und aufbauenden Worte sowie für sein
offenes Ohr und die guten Ratschläge bei allen auftretenden Problemen von Her-
zen danke.
Hannover, im April 2002
Judith-Viola Roestel
E
INLEITUNG
1
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis... III
1 Einleitung ...1
2 Das Krankheitsbild Brustkrebs medizinische und psychologische Aspekte...5
2.1 Der medizinische Aspekt: Nosologie der Brustkrebserkrankung ...5
2.2 Der psychologische Aspekt einer Brustkrebserkrankung ...17
2.2.1 Der Stellenwert der weiblichen Brust in der westlichen Gesellschaft...18
2.2.2 Psychische Folgen der Erkrankung ...19
3 Das Selbst- und Körpererleben unter dem Einfluss einer Krebserkrankung...25
3.1 Was bedeutet Körpererleben? ...26
3.2 Was bedeutet Selbsterleben?...29
3.3 Die Verbindung von Körper und Selbst...34
3.4 Selbstbild und Körpererleben unter onkologischem Einfluß...38
4 Soziokulturelle Aspekte einer Brustkrebserkrankung ...46
5 Körperliche Aktivität und Krebs...50
5.1 Sport- und Bewegungstherapie in der Krebsrehabilitation ...51
5.2 Der Einfluß körperlicher Aktivität auf das Selbst- und Körperbild von
Brustkrebspatientinnen...54
6 Relevante Fragestellung der Untersuchung...60
7 Methodik Planung und Durchführung der Untersuchung ...63
7.1 Entwicklung und Begründung der Forschungsstrategie ...63
7.2 Untersuchungsdesign ...68
8 Auswertung der qualitativen Studie...77
8.1 Darstellung und Interpretation des Interviews mit Frau A ...77
8.1.1 Kurzbiographie ...77
8.1.2 Sequenzanalyse...78
8.1.3 Detailanalyse ...86
8.2 Darstellung und Interpretation des Interviews mit Frau S ...95
E
INLEITUNG
2
8.2.1 Kurzbiographie ...95
8.2.2 Sequenzanalyse...96
8.2.3 Detailanalyse ...103
8.3 Darstellung und Interpretation des Interviews mit Frau M...114
8.3.1 Kurzbiographie ...114
8.3.2 Sequenzanalyse...114
8.3.3 Detailanalyse ...121
8.4 Vergleich der Ergebnisse und Einbettung in die Sekundärliteratur...131
Schlußbetrachtung ...142
Literaturverzeichnis...145
E
INLEITUNG
1
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2-1: Sterbefälle durch Herz-Kreislauferkrankungen und bösartige
Neubildungen im internationalen Vergleich ...6
Abbildung 2-2: Die häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland 1998 ...7
Abbildung 2-3: Brustkrebs-Neuerkrankungen 1998, aufgesplittet nach Alter ...8
Abbildung 2-4: Verschiedene Ursprungsorte des Mammakarzinoms ...10
Abbildung 3-1: Strukturmodell des Selbstkonzepts als assoziatives Netzwerk ...32
Abbildung 3-2: Die Entwicklung des Körpererlebens und die Verbindung zum Selbst ...37
Abbildung 5-1: Fortschreitender Substanzverlust als Folge eines Circulus Vitiosus...52
Abbildung 5-2: Das Wechselspiel von Sport, Körper- und Selbsterleben...59
Abbildung 8-1: Die Potentiale sportlicher Aktivität in der körper- und
selbstbezogenen Krankheitsbewältigung von Brustkrebspatientinnen ...141
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Stadien der Tumorgröße ...9
Tabelle 2: Bekannte Risikofaktoren beim Mammakarzinom ...13
Tabelle 3: Übersicht zum Interview mit Frau A ...84
Tabelle 4: Übersicht zum Interview mit Frau S...102
Tabelle 5: Übersicht zum Interview mit Frau M...119
E
INLEITUNG
1
1 Einleitung
,,Ich bildete mir ein, keine richtige Frau mehr zu sein"
(Heinze 1994, 4)
,,Ich wurde häufig gefragt, wie mein Mann damit zurechtkommt, daß ich nur
noch eine Brust habe. Ich wurde selten gefragt, wie ich damit zurechtkomme."
(Hasse 2000, 51)
Die Äußerungen dieser beiden Frauen im Rahmen verschiedener Interviews greifen
die zentrale Problematik einer Erkrankung an Brustkrebs auf. Durch die Verbindung
der Brust mit weiblichen, mütterlichen, sexuellen und kosmetischen Bedeutungen
trifft diese Erkrankung eine Frau zentral in ihrer Identität und ihrem Selbst (vgl.
Z
ETTL
&
H
ARTLAPP
1997, 37ff.; S
ALTER
1998, 137f.). Zudem führt der chirurgische
Eingriff zu einer Verletzung der körperlichen Integrität und des emotionalen Körper-
erlebens. Hinzu kommt, daß Krebs nach wie vor bewußt oder unbewußt mit
qualvollem Leiden und dem sicheren Tod assoziiert wird, so daß auch das emotiona-
le Erleben der Frau Beeinträchtigung erfährt (vgl. Z
IEGLER ET AL
. 1990, 3ff.). Die
Krankheit greift in das Passungsgefüge von Person und Umwelt ein und verlangt die
E
INLEITUNG
2
Anpassung gewohnter Lebensbezüge sowie den Aufbau einer neuen körper- und
selbstbezogenen Identität.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts beschäftigen sich zahlreiche Untersuchungen mit den
psychischen Problemen von Brustkrebspatientinnen. Bei der Erforschung der Krank-
heit zeigt sich eine große Heterogenität von Untersuchungsansätzen, Fragestellungen
und empirischen Vorgehensweisen. Dabei scheinen die meisten Arbeiten eher an
Konzepten als an der Praxis orientiert zu sein. Hochkomplexe theoretische Konstruk-
te stehen einer völlig zersplitterten, auf Teilaspekte spezialisierten empirischen
Forschung gegenüber. Das subjektive Erleben der Betroffenen, ihre viele Faktoren
integrierende Sicht der Lage und Handlungsmöglichkeiten wird dabei vielfach ver-
nachlässigt. Der einzelne kranke Mensch bleibt in den Untersuchungen als
Individuum oft blaß oder erscheint gar nicht erst. Erst in neuerer Zeit finden sich
zunehmend Bemühungen um qualitative Forschung und ein größeres Interesse am
einzelnen Menschen (vgl. S
CHÄFER
1995, L
UCIUS
-H
OENE
1998).
Die vorliegende Arbeit stellt den betroffenen Menschen und seine integrative Be-
trachtungsweise in den Mittelpunkt, denn nur eine ganzheitliche Sicht vieler
Teilaspekte scheint dem umfassenden menschlichen Erleben im Umgang mit Krisen
gerecht zu werden. Die Studie soll einen kleinen Beitrag zur Beleuchtung der ,,In-
nenseite" betroffener Frauen leisten und die Subjektivität des Krankheits- und
Behandlungserlebens in den Vordergrund stellen. Erkenntnisleitendes Interesse ist
es, mehr darüber zu erfahren, wie sich der Einbruch der Krankheit in die Lebenswelt
der Frau aus der Perspektive einer Betroffenen darstellt und wie Therapiephase sowie
das Leben mit der Krankheit von der Patientin selbst gesehen und beschrieben wer-
den. Die Vorgehensweise berücksichtigt die Tatsache, daß belastende Ereignisse und
Erfahrungen in Abhängigkeit vom soziokulturellen Lebenshintergrund einer Person
ganz unterschiedlich gewichtet sein können. Das zentrale Thema der Arbeit bildet
die Gefährdung der Identität und des Körpererlebens von Frauen durch eine
Brustkrebserkrankung. Aus sportwissenschaftlicher Perspektive wird zudem die
Frage diskutiert, ob (regelmäßige) sportliche Betätigung geeignet ist, um mit den
starken physiologischen und psychosozialen Belastungen einer Mammakarzinom-
erkrankung
1
besser fertig zu werden. Da Krebs heute allgemein als eine chronische
Krankheit gesehen wird, die ein Weiterleben ermöglicht und Anpassungen erfordert,
1
Das Wort Mammakarzinom ist der medizinische Fachausdruck für Brustkrebs.
E
INLEITUNG
3
müssen die psychosozialen Probleme und die Lebensqualität der Patientinnen stärker
in Überlegungen bezüglich Therapie und Nachsorge einbezogen werden. Sportliche
Aktivität bietet eine Möglichkeit, die psychosoziale Lebenssituation von Brust-
krebspatientinnen in positive Richtung zu beeinflussen. Dabei wirkt sich die
körperliche Betätigung nicht nur förderlich auf die physische Leistungsfähigkeit aus,
sondern wird vielfach auch in Zusammenhang mit psychischen Effekten diskutiert
(vgl. P
AHMEIER
1994, 44ff.;
S
CHULZ ET AL
. 1998, 398). Da der Körper die Grundlage
jeglicher Handlung darstellt, kann über die Bewegung ein Gefühl für die veränderte
Körperlichkeit infolge eines Mammakarzinoms vermittelt werden. Daneben finden
sich Potentiale des Sports in Bezug auf eine positive Beeinflussung von Wohlbefin-
den und Selbstwertgefühl (vgl. A
LFERMANN
& S
TOLL
2000, 47ff.).
Aufbau der Arbeit
Die interpretativ angelegte Arbeit orientiert sich an dem klassischen dreiteiligen
Schema Theorie Empirie Interpretation. Im theoretischen Teil erfolgt ein erster
Zugang zum untersuchten Themenkomplex. Nach einer kurzen medizinischen Vor-
stellung des Krankheitsbildes Brustkrebs, in deren Rahmen Ursachen und
Therapiemöglichkeiten thematisiert werden (vgl. Kap. 2.1), erfolgt die Darstellung
psychischer Auswirkungen der Erkrankung (vgl. Kap. 2.2). In diesem Kontext wird
die spezifische Problemsituation einer Brustkrebserkrankung erläutert, bevor die Ar-
beit auf das Selbst- und Körpererleben fokussiert (vgl. Kap. 3). Dabei erfolgt in
einem ersten Schritt ein allgemeiner Überblick über diese Konstrukte, der neben ei-
ner konzeptuellen Erläuterung die terminologische Präzisierung anstrebt (vgl. Kap.
3.1 und 3.2). Im Anschluß an die Ausführungen zum Zusammenhang von Körper
und Selbst (vgl. Kap. 3.3) geht die Arbeit ausführlich auf das Selbst- und Körperer-
leben von Brustkrebspatientinnen ein (vgl. Kap. 3.4). Nach einem kurzen Abriß der
soziokulturellen Aspekte einer Mammakarzinomerkrankung (vgl. Kap. 4) wird zu-
nächst allgemein der Themenbereich Krebs und Sport behandelt und unter
Berücksichtigung der Diskrepanz zwischen theoretischen Erwartungen bezüglich der
Wirkungsweise von Sport und der empirischen Befundlage das Potential einer sport-
lichen Intervention diskutiert (vgl. Kap. 5.1). Auf der Basis eines theoretischen
Modells zur Wirkungsweise der Bewegungstherapie auf den Komplex Selbst- und
Körpererleben erfolgt der Transfer der vorherigen Ausführungen auf den spezifi-
E
INLEITUNG
4
schen Untersuchungsgegenstand (vgl. Kap. 5.2). Der empirische Teil beginnt mit der
Präzisierung der relevanten Fragestellung (vgl. Kap. 6). Hieran schließt sich die Dis-
kussion zur Methodenwahl an (vgl. Kap. 7.1), die in Ausführungen zu
Untersuchungsdesign und Vorgehensweise mündet (vgl. Kap. 7.2). Es folgt die Dar-
stellung und Auswertung einzelner Interviews, deren Ergebnisse mit den
Erkenntnissen bisheriger Forschungsarbeiten in Konstrast gestellt und diskutiert
werden (Kap. 8). Mit einer Schlußbetrachtung, in der die Untersuchungsergebnisse
zusammengefaßt und Potentiale zukünftiger Studien aufgezeigt werden (vgl. Kap. 9),
endet diese Arbeit.
Persönliche Stellungnahme
Schon während des Studiums wurde bei mir das Interesse an der Erforschung malig-
ner Tumorerkrankungen geweckt. Dieses Interesse basierte zum einen auf der
Erfahrung, daß Untersuchungen an Krebskranken in der sportwissenschaftlichen For-
schung eher selten waren, demnach ein hoher Forschungsbedarf existiert und sich
mir ein weites Forschungsfeld eröffnet. Zum anderen erwuchs der Wunsch, diesen
Themenbereich näher zu ergründen, einer direkten, persönlichen Betroffenheit, da
Krebserkrankungen auch Personen aus meinem engeren und weiteren Umfeld betra-
fen. Im direkten Kontakt mit Erkrankten wurde jedoch deutlich, daß die Erkrankung
an einer lebensbedrohlichen Krankheit nicht bedeutet, daß der Kranke bereits tot ist,
sondern, im Gegenteil, bei ausreichender Aufklärung aktiv an seiner Lebensqualität
mitwirken kann. Die beobachtete Unsicherheit im Kontakt mit Tumorpatienten und
die Schwierigkeit, offen mit ihnen zu reden, führten mich zu einer intensiven Be-
schäftigung mit diesem Thema und bildeten die Motivation für eine Arbeit dieser
Art. So entstand dieses Werk aus einem verzahnten Wechselprozeß zwischen wis-
senschaftlichem Forschungsinteresse und persönlicher Betroffenheit in dem Wunsch,
Krankheit und Krankheitserleben aus der subjektiven Perspektive in ihrer Komplexi-
tät zu explorieren, um hieraus Hinweise für eine verbesserte Betreuung und erhöhte
Lebensqualität krebskranker Menschen zu erhalten.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
5
2 Das Krankheitsbild Brustkrebs medizinische und
psychologische Aspekte
2.1 Der medizinische Aspekt: Nosologie der Brustkrebser-
krankung
Brustkrebs das ist nur eine Erkrankungsform von über hundert verschiedenen
Krankheitsbildern, die dem Krebsleiden zuzuordnen ist. Vom medizinischen Stand-
punkt aus kann man nicht von der Krebserkrankung sprechen, vielmehr existiert eine
Vielzahl maligner Tumore, die sich in Wachstum und Prognostizierbarkeit völlig
unterschiedlich verhalten können (vgl. H
ELLMAN
1997, 59). Die verschiedenen
Krebsarten lassen sich anhand spezifischer histologischer, molekular biologischer
und biochemischer Merkmale differenzieren (vgl. A
EBISCHER
1987, 7). Dieses Kapi-
tel liefert medizinisches und psychologisches Basiswissen zum besseren Verständnis
einer Krebserkrankung. Da sich die Studie auf die Untersuchung brustkrebserkrank-
ter Frauen beschränkt, fokussiert das Kapitel die medizinischen und psychologischen
Aspekte einer Mammakarzinomerkrankung.
Epidemiologie
Krebserkrankungen gewinnen in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung.
Während früher die Mehrzahl der Todesfälle auf Infektionskrankheiten zurückge-
führt werden konnte, stehen heute die chronischen Zivilisationskrankheiten, zu denen
auch die bösartigen Neubildungen umgangssprachlich als Krebs bezeichnet zäh-
len, im Vordergrund (vgl. S
CHÜLE
1997, 11). Dieser ,Panoramawandel` betrifft
Morbiditäts- wie Mortalitätsraten gleichermaßen. Krebserkrankungen kommt eine
stetig wachsende Bedeutung zu; in den letzten dreißig Jahren hat sich die Zahl der
durch Krebsleiden bedingten Todesfälle verdoppelt. Zwei Bedingungen spielen dabei
eine wesentliche Rolle: Erstens ist Krebs eine Krankheit des höheren Lebensalters
und die Lebenserwartung ist im 20. Jahrhundert stetig angestiegen; zweitens werden
heutzutage aufgrund weiterentwickelter diagnostischer Methoden mehr Krebserkran-
kungen diagnostiziert. Mittlerweile machen Tumorerkrankungen international bereits
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
6
ein Viertel aller Sterbefälle aus und liegen damit an zweiter Stelle hinter den Herz-
Kreislauferkrankungen (vgl. Abb. 2-1).
A
BBILDUNG
2-1: S
TERBEFÄLLE DURCH
H
ERZ
-K
REISLAUFERKRANKUNGEN UND BÖSARTIGE
N
EUBILDUNGEN IM
INTERNATIONALEN
V
ERGLEICH
B
RD
1
99
4
N
ied
er
lan
de 1
99
1
Fra
nk
re
ic
h
199
1
It
al
ien
1
990
Be
lgi
en
1
989
K
ana
da 1
99
1
US
A 1
99
0
Jap
an
1
992
48 ,6
3 9,9
3 3,5
43 ,2
28,2
45,8
3 8,9
42 ,8
3 5,9
2 4
27 ,4
26 ,6
26 ,7
25 ,4
2 5,7
27 ,6
23 ,5
26 ,8
0
10
20
30
4 0
50
T
o
de
s
u
rs
a
c
he
n (
%
)
b ös artige N e ub ildu ng en
He rz -K reis la uf- Erk ra nk un ge n
Q
UELLE
: B
UNDESMINISTER FÜR
G
ESUNDHEIT
1995, 1996
Nach den neuesten Schätzungen des Robert-Koch-Instituts erkrankten 1998 insge-
samt etwa 179 000 Frauen und 168 000 Männer in Deutschland erstmalig an Krebs.
2
Während die Gesamtinzidenz der Tumorerkrankungen innerhalb der Geschlechter
also ungefähr gleichermaßen verteilt ist, lassen sich deutliche Unterschiede in der
Lokalisation des Tumorbefalls ausmachen. Bei den Männern stellt der Prostatakrebs
vor Lungen- und Darmkrebs die häufigste Krebserkrankung dar. Frauen erkranken
hingegen am häufigsten an Brustkrebs, gefolgt vom Krebs im Dick- und Mastdarm-
bereich (vgl. Abb. 2-2).
2
Daten zu Neuerkrankungen an Krebs werden in Deutschland noch nicht einheitlich dokumentiert.
So kann die Zahl der Krebsneuerkrankungen in Deutschland nur geschätzt werden. Diese Schät-
zungen werden regelmäßig von der Dachdokumentation Krebs im Robert-Koch-Institut
durchgeführt, wobei sich die neuesten Angaben auf das Jahr 1998 beziehen.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
7
A
BBILDUNG
2-2: D
IE HÄUFIGSTEN
K
REBSERKRANKUNGEN IN
D
EUTSCHLAND
1998
Q
UELLE
: R
OBERT
-K
OCH
-I
NSTITUT
Jede achte bis zehnte Frau erkrankt in ihrem Leben an einem Mammakarzinom. In
der Bundesrepublik Deutschland registrierten Epidemiologen 1998 rund 46 000 Neu-
erkrankungen an Brustkrebs, Tendenz steigend. Bei der Altersverteilung der
Patientinnen zum Zeitpunkt der Diagnostik sind die 60-74jährigen am häufigsten
betroffen, dicht gefolgt von den 45-59jährigen (vgl. Abb. 2-3). Nach K
OUBENEC
(2002, 8) steigt das Erkrankungsrisiko ab dem vierten Lebensjahrzehnt mit steigen-
dem Alter allmählich an. In zunehmendem Maße betrifft die Erkrankung aber auch
jüngere Frauen.
Jährlich sterben etwa 18 400 Frauen an den Folgen eines Mammakarzinoms (vgl.
D
EUTSCHE
K
REBSHILFE
2000, 5). Die Erkrankung an Brustkrebs ist die häufigste
Krebstodesursache bei Frauen, zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr stellt das
Mammakarzinom sogar die häufigste Todesursache bei Frauen überhaupt dar.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
8
A
BBILDUNG
2-3: B
RUSTKREBS
-N
EUERKRANKUNGEN
1998,
AUFGESPLITTET NACH
A
LTER
4 14 9
1 47 28
16 39 1
1 102 6
0
5 00 0
10 00 0
15 00 0
20 00 0
0 -4 4 Jah re
45 -5 9 Jah re
6 0-74 Ja hre
7 5 Jah re u nd älte r
Q
UELLE
: R
OBERT
-K
OCH
-I
NSTITUT
Trotz intensiver Grundlagenforschung, die zu einer Erweiterung der Kenntnisse über
die Krebsentstehung führte, fehlen präventive oder therapeutische Maßnahmen, die
einen sicheren Schutz vor Krebs gewährleisten (vgl. L
ÖTZERICH
& U
HLENBRUCK
1995, 86ff.). Obwohl medizinische Behandlungsmaßnahmen immer erfolgreicher
werden, ist es bislang nicht gelungen, die Sterberate am Mammakarzinom zu senken.
Noch immer sterben nach L
ÖTZERICH
& U
HLENBRUCK
(1995, 86) mehr als die Hälfte
der Patientinnen innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Diagnose an einem Rezidiv
oder an Metastasen
3
. Andere Autoren (vgl. K
EREKJATO ET AL
. 1996, 394; H
ELLMANN
& E
VERETT
1997, 70) beziffern die Fünf-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit bei
Brustkrebs mit 70 Prozent. Aus dieser Diskrepanz wird deutlich, daß grundsätzlich
alle Prognosen mit großer Vorsicht zu genießen sind. Selbst dieselbe Tumorart mit
gleicher Größe, Lokalisation und in gleichem Stadium kann sich bei verschiedenen
Patienten ganz unterschiedlich entwickeln (vgl. I
HDE
1997a, 999).
3
Der Begriff Metastase bezeichnet die Bildung eines Tumors an einer anderen, primär nicht erkrank-
ten Stelle im Organismus durch die Absiedlung von Tumorzellen über den Blut- und Lymphweg
(Tochtergeschwulst). Dabei unterscheidet man lokale (in der Umgebung des Primärtumors), regio-
näre (in der nächsten Lymphknotengruppe) und Fernmetastasen.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
9
Klassifikation
Krebstumore werden nach dem internationalen TNM-Schema eingeteilt, wobei T
(Tumor) für die Größe des Primärtumors, N (Nodulus) für das Fehlen oder Vorhan-
densein von Lymphknotenmetastasen und M (Metastase) für Fernmetastasen steht.
Durch die Verbindung der Buchstaben mit Zahlen wird die anatomische Ausdehnung
des malignen Prozesses angegeben. Diese Klassifikation kann auf der Basis einer
mikroskopisch exakten Untersuchung des entnommenen Gewebes ergänzt oder ab-
geändert werden. Im Fall einer pathologischen Untersuchung wird die Klassifikation
über den Buchstaben p kenntlich gemacht (pTpNpM). Die Tumorgröße (T) läßt sich
in vier verschiedene Stadien einteilen (vgl. Tab. 2-1).
T
ABELLE
1: S
TADIEN DER
T
UMORGRÖßE
Stadium
Tumorgröße
1a
Der Primärtumor ist bis 0,5 cm groß
1b
Der Primärtumor ist zwischen 0,5 und 1 cm groß
1c
Der Primärtumor ist zwischen 1 und 2 cm groß
2
Der Primärtumor ist 2 bis 5 cm groß
3
Der Primärtumor ist größer als 5 cm
4
Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung in die Nachbarschaft (Brustwand oder Haut)
Q
UELLE
: D
EUTSCHE
K
REBSHILFE
2000
Je kleiner ein Tumor ist, desto geringer ist das Risiko der Streuung. Bei einer Opera-
tion werden grundsätzlich Lymphknoten entfernt, um einen Lymphknotenbefall zu
überprüfen, der als Indikator für die Ausbreitung des Tumors gilt. Die Lymphkno-
tenentfernung stellt also lediglich ein diagnostisches Verfahren dar und dient der
Entscheidung über die weitere Therapieform.
Ebenso wenig wie man von dem Krebs sprechen kann, trifft diese Eingrenzung auf
das Mammakarzinom zu. Bösartige Tumore der Brust können von verschiedenen
Bereichen der Brust ausgehen, dementsprechend existieren auch unterschiedliche
Brustkrebsformen (vgl. K
OUBENEC
2002, 7). Meistens entstammen Mammakarzino-
me den Milchgängen (intraduktal), seltener den Drüsenläppchen (intralobulär). Nach
einem Vorschlag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1981 werden die malig-
nen Tumore der Brust in nicht-invasive und invasive Karzinome zusammengefaßt
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
10
(vgl. B
ISCHOF
& S
ENN
1999, 69). Während der Gruppe der nicht-invasiven Karzino-
me vor allem die intraduktalen Karzinome zuzuordnen sind, die bei steigender
Tendenz ca. 10 bis 15 Prozent der Brustkrebserkrankungen ausmachen, handelt es
sich bei 80 bis 85 Prozent der Brustkrebserkrankungen um ein invasives Karzinom.
Unter diesen infiltrierenden Tumoren treten am häufigsten Milchgangkarzinome in
ihrer unterschiedlichen Differenzierung auf (ca. 80 Prozent).
A
BBILDUNG
2-4: V
ERSCHIEDENE
U
RSPRUNGSORTE DES
M
AMMAKARZINOMS
Q
UELLE
: R
ÜDIGER
A
NATOMIE
, A
NATOMISCHE
T
AFELN
(
AUS
K
OUBENEC
2002)
Eine weitere Einteilung erfolgt bezüglich der Frage, ob es nur einen Krebsherd gibt
oder ob mehrere Zentren über die gesamte Brust verteilt existieren. Bei mehreren
Krebsherden spricht man von multizentrisch, liegen mehrere Herde nur in einem
Brustviertel spricht man von multifokal.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
11
Ätiologie
Nach dem heutigen Kenntnisstand der Medizin ist die Entstehungsfrage des Krebs
kein Rätsel mehr. Warum er sich entwickelt, ist hingegen noch nicht endgültig ge-
klärt. Diskutiert werden genetische, chemische, entzündliche, infektiöse und
physikalische Faktoren, die als Ursache in Frage kommen. Trotz der oben angespro-
chenen Verschiedenartigkeit von Krebserkrankungen entstehen alle Tumore offenbar
durch ähnliche grundlegende Prozesse. Allgemein haben Tumorerkrankungen ihren
Ursprung in Fehlregulationen des Zellwachstums und der Zelldifferenzierung, resul-
tierend aus einer Veränderung des Erbmaterials (vgl. W
EINBERG
1997, 7ff.). Der
grundlegende gemeinsame Nenner aller Krebserkrankungen ist eine mutierte Zelle.
Durch Mutationen bestimmter Klassen von Genen kann die Zelle aus dem Gleichge-
wicht gebracht werden. Man geht davon aus, daß Schädigungen und Störungen im
Erbmaterial zwei Klassen von Genen betreffen, die für die Krebsentstehung eine
wesentliche Rolle spielen: Die Proto-Onkogene, die allgemein für die Förderung des
Zellwachstums verantwortlich sind, und die Tumorsupressor-Gene, die das Zell-
wachstum bremsen. Mutationen von Proto-Onkogenen können dazu führen, daß eine
Zelle beginnt, sich schnell und unkontrolliert zu teilen und in ihrem Wachstum nicht
durch äußere Einflüsse regulieren läßt. Damit entzieht sich ein Teil des Körpers der
übergeordneten Kontrolle. Die ungebremste Proliferation der Krebszellen führt zur
fortwährenden Vergrößerung des Tumors. Im Laufe der Zeit dringt das Geschwulst
in umliegendes Gewebe ein. Besonders gefährlich ist die Eigenschaft, daß sich entar-
tete Zellen aus dem Primärtumor lösen, durch den Transport im Lymph- und/oder
Blutkreislauf in andere Körperregionen eindringen und dort Metastasen bilden kön-
nen. Der Vorgang der unkontrollierten Teilung kann aber nur dann stattfinden, wenn
die körpereigenen Überwachungsmechanismen nicht ausreichen, um den Tumor er-
folgreich abzuwehren (vgl. W
EINBERG
1997, 9f.). Demnach müssen
Tumorsupressor-Gene durch zusätzliche Gen-Mutationen deaktiviert werden, wo-
durch die Zelle wichtige Kontrollinstanzen verliert, die ihre Teilungsaktivität
normalerweise in Schranken halten.
Eine Krebserkrankung wird ebenfalls mit dem Immunsystem in Zusammenhang ge-
bracht. Bis vor kurzem ging man noch davon aus, daß Krebs durch eine Störung des
Immunsystems entsteht, in Folge dessen sich Krebszellen unkontrolliert vermehren
und Tochtergeschwülste bilden können. Beim gesunden Menschen existiert ein im-
munologisches Überwachungssystem, das körperfremde und abnorme Zellen erkennt
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
12
und eliminiert. Bei einem geschwächten oder zumindest teilweise defekten Immun-
system arbeitet dieses Überwachungssystem nicht mehr einwandfrei, so die These.
Daher könne es malignen Zellen gelingen, den Abwehrmechanismen zu entkommen
und einem eigenen, unkontrollierten Vermehrungsprogramm zu folgen (vgl.
L
ÖTZERICH
& U
HLENBRUCK
1995, 86ff.). Doch auch bei funktionierender immuno-
logischer Überwachung kann sich eine Krebserkrankung entwickeln. Nach heutigem
Kenntnisstand scheint die Rolle des Immunsystems bei Krebserkrankungen eine an-
dere zu sein als die, die körpereigene Abwehrmechanismen bei der Bekämpfung von
Krankheitserregern spielen, welche ist allerdings noch weitgehend unerforscht (vgl.
K
OUBENEC
2002, 6).
Für die Herausbildung einer Krebserkrankung gibt es nicht die Ursache, vielmehr
herrscht ein multifaktorielles Ursachengefüge vor. Es müssen viele interne und ex-
terne Faktoren zusammenwirken, um aus einer gesunden Zelle eine Krebszelle
werden zu lassen. Im Vorfeld jeder Krebserkrankung treffen verschiedene Karzino-
gene
4
aufeinander. Es gibt eine Fülle von Risikofaktoren, die die Entartung normaler
Zellen zu Krebszellen begünstigen können (vgl. K
OUBERNEC
2002, 8-11).
So sind bei der Suche nach möglichen Gründen der Brustkrebsentstehung die beiden
,specific cancer susceptibility genes` BRCA-1 und BRCA-2
5
entdeckt worden (vgl.
W
EINBERG
1997, 11; T
RICOPOULOS ET AL
. 1997, 33). Mutationen dieser Gene erhö-
hen das Brustkrebsrisiko erheblich. Schätzungsweise kommen diese Genmutationen
in ca. 5 bis 10 Prozent aller Brustkrebserkrankungen vor. Als weitere Risikofaktoren
für das Auftreten eines Mammakarzinoms werden höheres Alter, Kinderlosigkeit,
eine frühe Menarche
6
, ein später Eintritt der Menopause, Viruserkrankungen, späte
Schwangerschaften, nicht stillende Frauen, bestimmte Ernährungsgewohnheiten,
Problem-Mastophathie
7
sowie Adipositas angesehen (vgl. T
RICHOPOULOS ET AL
.
1997, 25ff.). Im Vergleich zu den Umwelteinflüssen scheint der genetische Einfluß
4
Karzinogene sind Faktoren oder Substanzen, die das Risiko, an einem malignen Tumor zu erkran-
ken, erhöhen.
5
Beide Gene gehören zu der Gruppe der Tumorsuppressor-Gene. Sie codieren für Proteine, welche
die Teilung einer Zelle unterdrücken, so daß eine Gen-Mutation zum Verlust dieser Kontrollinstanz
führt.
6
Zeitpunkt des ersten Auftretens der Menstruation
7
Der Begriff Mastopathie steht für degenerative oder wuchernde Umbauprozesse der Brustdrüse, die
sich in einfache, gering proliferierende und atypisch proliferierende Mastopathie differenzieren las-
sen. Die beiden letzten Formen gelten als Risikofaktoren für die Erkrankung an einem
Mammakarzinom.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
13
allerdings gering zu sein (vgl. K
EREKJATO ET AL
. 1996, 395; S
CHULZ ET AL
. 1998,
10). Nach B
ISCHOF
& S
ENN
(1999, 70) lassen sich zu einigen bekannten Risikofakto-
ren Angaben zur Risikovermehrung bzw. -verminderung machen (vgl. Tab. 2-1).
T
ABELLE
2: B
EKANNTE
R
ISIKOFAKTOREN BEIM
M
AMMAKARZINOM
Faktor
Erhöhtes Risiko
Relatives Risiko
(Vermehrung)
Niedriges Risiko
Relatives Risiko
(Verminderung)
Familiäre Belas-
tung
Erkrankte Mutter /
Schwester
(v.a. < 50 J.),
1 Person
3-5
8
Nicht zutreffend
Mehrere
Personen
6-10
Familienstand Ledig,
kinderlos 2
Verheiratet
Nullipara
8
Ja
1,5-4
Alter bei 1. Geburt > 35 Jahre
3
< 20 Jahre
Stillperioden
> 4 Wochen
Ja
0,5
Menarche
< 12 Jahre
2
> 16 Jahre
0,3
Menopause
> 55 Jahre
2
< 45 Jahre
0,5
Mastopathie II.
Grade
III. Grades
1-2
5
Ionisierende
Strahlen
> 90 cGy
5
< 90 cGy
Frühere Adeno-
karzinome
Mammakarzinom
Korpuskarzinom
Ovarialkarzinom
Kolerektalkarzinom
5
1,5
3
3
Q
UELLE
: B
ISCHOF
& S
ENN
1999 (Anm.: Relatives Risiko als multiplikativer Faktor)
Während die Forschung bezüglich der medizinischen Ursachen schon recht weit
fortgeschritten ist, wird die Frage, ob und inwieweit psychologische Faktoren
Einfluß auf die Krebsentstehung haben, noch kontrovers diskutiert. Da sich die Ent-
stehung einer Krebserkrankung allein mit genetischen und umweltbedingten
Faktoren nicht hinreichend erklären ließ, haben Wissenschaftler begonnen, nach psy-
chischen Ursachen zu forschen (vgl. Studien von B
AHNSON
1986; E
YSENCK
1988;
S
CHWARZ
1991). Hinsichtlich der Hypothese einer Krebspersönlichkeit sind die Er-
gebnisse jedoch mehr als unbefriedigend. Die vielen verschiedenen Untersuchungen
brachten recht unterschiedliche ,typische` Charaktere und Eigenschaften zu Tage, die
zum Teil sogar widersprüchlich sind. Bis heute gibt es keinen wissenschaftlichen
8
Nullipara ist die fachmedizinische Bezeichnung für eine Frau, die nicht entbunden hat.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
14
Nachweis darüber, daß eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur die Entstehung von
Krebs begünstigt (vgl. K
EREKJATO ET AL
. 1996, 399; B
ISCHOF
& S
ENN
1999, 203f.).
Hingegen scheint die Erforschung des Einflusses von Streß bei der Tumorgenese
erfolgreicher zu sein. Im Rahmen psychoimmunologischer Überlegungen wird ange-
nommen, daß streßreiche Belastungen, vor allem der mit Hilflosigkeitsstreß
einhergehende Kontrollverlust, immunsuppressiv wirken (vgl. B
IRBAUMER
1986,
217; K
EREKJATO ET AL
. 1996, 400) und somit eine Tumorentwicklung begünstigen.
Mit der Frage nach der krankheitsbegünstigenden Wirkung kritischer Lebensereig-
nisse hat sich besonders F
ILIPP
(1985a) intensiv befaßt.
9
Zusammenfassend bleibt
festzuhalten, daß die Tumorgenese multifaktoriell bedingt ist, wobei der konkrete
Einfluß der verschiedenen Faktoren noch zu erforschen ist.
Symptome und diagnostische Verfahren
Im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen, die sich durch Warnsignale ankündi-
gen, fehlen beim Brustkrebs in der Regel Frühsymptome. Unspezifischen
Symptomen wie z.B. Abgeschlagenheit werden häufig anderen Ursachen zuge-
schrieben. Erst mit dem Ertasten eines Knotens in der Brust zeigt sich für die
Patientin ein deutliches Leitsymptom. B
ISCHOF
& S
ENN
(1999, 68) nennt folgende
Symptome, die zur Diagnose von Mammakarzinomen führen: Knoten (63 Prozent),
Schmerzen/Druck/Spannung in der Brust (19 Prozent), Entzündung (8 Prozent),
Mamillenveränderung
10
(6 Prozent) und Sekretion aus der Mamille (4 Prozent).
Hat sich der Verdacht eines Mammakarzinoms beim Arzt durch Tastbefund erhärtet,
stehen der Frau eine Vielzahl diagnostischer Maßnahmen wie bspw. Sonographie
(Ultraschall), Mammographie und Biopsie bevor. Während bei der Mammographie
die Brust geröntgt wird, um die verschiedenen Strukturen bildlich darzustellen und
einer genaueren Beurteilung zugänglich zu machen, erfolgt bei der Biopsie die Ent-
nahme von Zellen und Gewebefragmenten zur histologischen Untersuchung von
verdächtigem Gewebe (vgl. B
ISCHOF
& S
ENN
1999, 72ff.). Finden sich in dem ent-
nommenen Gewebe Krebszellen, so steht die Diagnose Brustkrebs fest. In diesem
Fall beginnt die gezielte Behandlung, die auf der Basis der genaueren Analyse von
9
Eine vertiefende Darstellung der Thematik würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
10
Der Begriff Mamille ist der medizinische Fachausdruck für Brustwarze.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
15
Differenzierungstyp (Grading), Metastasensuche (Staging) und Hormonrezeptoren
ausgewählt wird.
Therapie
Allgemein unterscheidet man in der Tumortherapie drei Behandlungsansätze: Den
kurativen, den adjuvanten und den palliativen Ansatz. Während der kurative Ansatz
eine Heilung der Erkrankung anstrebt, versteht sich der adjuvante Ansatz als Rück-
fallprophylaxe. Es handelt sich um zusätzliche medizinische Maßnahmen, die der
Genesung unterstützende Hilfestellung leisten und in diesem Sinne einem Rezidiv
vorbeugen sollen. Ist eine Heilung nicht mehr möglich, so kann man nur noch pallia-
tiv behandeln diese Therapie dient lediglich einer Linderung von
Krankheitsbeschwerden (vgl. B
ISCHOF
& S
ENN
1999, 79f.).
Die Behandlungsmethoden bei Mammakarzinomen richten sich gegen die drei Cha-
rakteristika eines Tumors Vergrößerung, Invasion und Metastasierung
11
. Als
anerkannte Maßnahmen kommen der chirurgische Eingriff, die Bestrahlung und die
Chemotherapie zum Einsatz, die sich alle drei in ihren Begleitumständen als eingrei-
fend und aversiv charakterisieren lassen.
Die Akuttherapie zielt mittels operativer Verfahren auf die Beseitigung des Primär-
tumors ab. Je nach Diagnose wird radikal oder brusterhaltend operiert. Bei
Brustkrebs im Frühstadium geht der Trend in den letzten Jahren eindeutig in Rich-
tung Brusterhaltung, wobei eine brusterhaltende Operation ist nur dann möglich,
wenn keine Lymphknoten befallen sind, das Verhältnis von Tumor- zu Brustgröße
stimmt und es sich nicht um einen multizentrischen oder retromamillären Tumor
handelt (vgl. M
ORRIS ET AL
. 1992, 1712). Entsprechend der gewählten
Operationsmethode und der damit verbundenen Schnittführung ergeben sich
sekundär infolge von Operationsnarbe, Schonhaltung und Lymphödemgefahr mehr
oder weniger starke funktionelle Bewegungseinschränkungen im Arm- und
Schulterbereich. Häufig kommt es auch zu einer Fehlhaltung, die langfristig zur
einseitigen Belastung der Wirbelsäule und damit einhergehenden Rückenschmerzen
führt. Bei mehr als 70 Prozent der Frauen lassen sich funktionelle motorische
11
Bezeichnung für die Absiedlung von Zellen oder Zellverbänden über den Blut- oder Lymphweg in
primär nicht erkrankte Körperregionen.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
16
Prozent der Frauen lassen sich funktionelle motorische Einschränkungen nachweisen
(vgl. S
CHÜLE
1997, 11ff.).
Ein Großteil der Brustkrebspatientinnen wird im Anschluß an die Operation mittels
Radiotherapie behandelt. Die Bestrahlung zielt darauf ab, durch Röntgen- und Gam-
mastrahlen eventuell zurückgebliebene Krebszellen abzutöten, während sich gesunde
Zellen relativ schnell von der Belastung erholen. Da das Mammakarzinom zur frühen
Metastasierung, vor allem in Wirbelsäule, Schädel, Lunge und in die zunächst nicht
betroffene Brust hinein neigt, ist für die Heilungserwartung auch der Lymphknoten-
befall als Indikator für die Ausbreitung entscheidend. Im Falle eines solchen muß mit
einer Chemotherapie gegen eventuelle Streuherde vorgegangen werden. Bei dieser
werden Medikamente in die Blutbahn gegeben, die schnell teilende Zellen daran hin-
dern, sich zu vermehren. Infolge dessen sterben sowohl die Krebszellen als auch
andere sich schnell teilende Zellen ab. Strahlen- wie Chemotherapie führen zu teil-
weise erheblichen Beeinträchtigungen im körperlichen Bereich (vgl. Kapitel 3.4).
Neben diesen drei Therapiemaßnahmen besteht beim Mammakarzinom noch die
Möglichkeit der Hormontherapie. Bei einem Teil der betroffenen Patientinnen zeigt
der Tumor eine gewisse Hormonabhängigkeit. Wenn die Mammaepithelzellen Re-
zeptoren für Östrogen oder Progesteron
12
aufweisen, kann über Medikamente wie
bspw. Tamoxifen
13
eine Remission des Tumors erreicht werden. Häufig werden die
genannten Behandlungsmethoden kombiniert, da dies zur Potenzierung des therapeu-
tischen Erfolgs bei gleichzeitiger Abschwächung der Nachteile einzelner
Behandlungsmethoden führt. Bei Brustkrebserkrankungen erfolgt bspw. die operati-
ve Entfernung des Tumors in Verbindung mit Bestrahlung oder Chemotherapie, um
gegen eventuelle Metastasen vorzugehen. Ergänzende Therapien und Alternativmaß-
nahmen wie z.B. Misteltherapie sind sehr umstritten und beinhalten teilweise viel
Scharlatanismus.
14
Es ist jedoch zu bedenken, daß viele Patientinnen die Möglichkei-
12
Östrogen ist das weibliche Geschlechtshormon, Progesteron bezeichnet das physiologische Gelb-
körperhormon. Im Zusammenwirken mit bzw. nach vorheriger Einwirkung von Östrogenen auf die
Fortpflanzungsorgane sind Progesterone an der Regulation nahezu aller weiblichen Reproduktions-
funktionen beteiligt.
13
Tamoxifen ist ein Anti-Östrogen, das wie Östrogen aussieht, aber ein anderes Innenleben und dem-
nach eine andere Wirkung hat. Tamoxifen blockiert die Östrogenrezeptoren und damit die
Stoffwechselvorgänge der Zelle, was zur Folge hat, daß diese abstirbt.
14
Auf eine Diskussion dieses Aspektes muß an dieser Stelle verzichtet werden, da sie den Rahmen der
Arbeit sprengen würde.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
17
ten der Alternativmedizin jedoch als hilfreich erleben, da sie so einen eigenen Bei-
trag zur Heilung leisten können.
Der Einsatz häufig hoch aggressiver Methoden zur Krebsbekämpfung wird in neue-
rer Zeit vor dem Hintergrund der Lebensqualität diskutiert (vgl. K
EREKJATO ET AL
.
1996, 400f.; H
OLLAND
1997, 99ff.). So kann eine bloße Lebensverlängerung durch
Betonung der medizinischen Primärtherapie nicht mehr als Indikator für eine erfolg-
reiche Therapie gelten. Vielmehr muß die Qualität der hinzugewonnenen
Lebensspanne bei der Bewertung der Behandlungsmaßnahmen berücksichtigt wer-
den. Hinsichtlich der Therapie von Krebserkrankungen hat sich die Meinung
durchgesetzt, daß medizinische Maßnahmen allein zur optimalen Bewältigung der
Erkrankung und für eine hohe Lebensqualität nicht ausreichen. Eine Behandlung
muß vielmehr verschiedene Ansätze kombinieren und die Patientin ganzheitlich be-
handeln (vgl. S
CHÜLE
1993, 5). Das bedeutet, daß sich eine Therapie im Sinne des
Ganzheitsanspruchs auf Körper, Psyche und Umwelt beziehen muß. In immer stärke-
rem Maße empfiehlt sich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit des medizinischen,
psychologischen und bewegungtherapeutischen Personals bei der Behandlung von
Krebspatienten.
15
2.2 Der psychologische Aspekt einer Brustkrebserkrankung
Ein Mammakarzinom stellt nicht nur eine enorme und lebensbedrohliche Belastung
für den Körper dar, sondern das Wissen um die Krebserkrankung beeinträchtigt in
starkem Maße die Psyche und wirkt sich in diesem Zusammenhang auch auf das so-
ziale Umfeld aus. Schon lange ist bekannt, daß niemals nur der Körper allein
erkrankt. Die Seele leidet genauso manchmal sogar noch stärker. Ebenso wie die
körperlichen Prozesse einer Brustkrebserkrankung bestimmen demnach auch die
diesbezüglichen Vorstellungen, Phantasien, Gefühle und sozialen Veränderungen die
Symptomatik der Erkrankung mit. Der psychischen Situation Krebskranker ist in der
Forschung zunehmend mehr Beachtung geschenkt worden (vgl. im Überblick
W
IRSCHING
1990, K
EREKJATO ET AL
. 1996). Neben der Suche nach psychischen Äti-
ologiefaktoren in der Krebsgenese beschäftigen sich die unterschiedlichen
15
Auf diese wird in Kapitel 5 im Zusammenhang mit dem Nutzen der Bewegungstherapie eingegan-
gen.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
18
Forschungsrichtungen mit den psychologischen Auswirkungen von Krebs auf die
Kranken und ihr Umfeld (vgl. z.B. S
CHULZ ET AL
. 1998), dem Einfluß psychologi-
scher Faktoren auf den Verlauf der Erkrankung (vgl. z.B. F
ALLER ET AL
. 1997),
Phasenmodellen der Bewältigung (vgl. z.B. K
ÜBLER
-R
OSS
1977), verschiedenen
Bewältigungsformen (vgl. z.B. H
EIM ET AL
. 1993; K
LAUER
& F
ILIPP
1997;
S
CHRÖDER
1997) sowie der Bewertung aktiver oder passiver Strategien (vgl. z.B.
W
EBER
1994). Das folgende Kapitel setzt sich mit der psychischen Wirkung der Di-
agnose Brustkrebs sowie den krankheits- und therapiebedingten seelischen
Konsequenzen auseinander. Vielfach sind die psychischen Auswirkungen einer
Mammakarzinomerkrankung als besonders schwerwiegend beschrieben worden (vgl.
A
EBISCHER
1987, 56ff.; R
ITTER
-G
EKELER
1992, 97ff.). Denn über die allgemeinen
psychischen Auswirkungen einer Krebserkrankung hinaus zeichnen sich bei der Er-
krankung am Mammakarzinom spezifische Problemlagen ab, die sich aus der
Bedeutung ergeben, die der weiblichen Brust in unserer Gesellschaft zukommt. Des-
halb wird dieser Aspekt vorab eingehender beleuchtet.
2.2.1 Der Stellenwert der weiblichen Brust in der westlichen Gesell-
schaft
Um die Auswirkungen eines Organverlustes bzw. einer Organveränderung verstehen
zu können, muß man sich nach S
ALTER
(1998, 137) zunächst mit der Relevanz des
betreffenden Organs auseinandersetzen. Die weibliche Brust ist für eine Frau nicht
irgendein von einer bedrohlichen Erkrankung befallenes Organ und in diesem Sinne
ist Brustkrebs nicht vergleichbar mit anderen Krebsformen. Sie ist sowohl durch ihre
Funktion als auch durch ihre Gestalt von zentraler Bedeutung für das Selbstwertge-
fühl einer Frau. Biologisch gesehen sind die Brüste die Milchdrüsen des Säugetiers
Mensch und befähigen eine Frau in dieser Funktion, ihre Nachkommen zu ernähren.
Die Brustentwicklung setzt zwischen dem 8. und 10. Lebensjahr ein, also zu einer
Zeit, in der bereits ein bewußtes Erleben möglich ist. Über die reale physiologische
Funktion hinaus verbinden sich mit der weiblichen Brust viele symbolische Bedeu-
tungen für Weiblichkeit und Mütterliches (vgl. B
AHNSON
1986, 30; M
ANDLER
1993,
46). So steht die Ausbildung der Brust als sichtbares Symbol für die Entwicklung
vom Mädchen zur Frau. Besonders bedeutsam ist im Zusammenhang mit einem
Mammakarzinom die unbestrittene Tatsache, daß der weiblichen Brust in unserem
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
19
Kulturkreis eine herausragende sexuelle Komponente zukommt (vgl. Z
ETTL
&
H
ARTLAPP
1996, 69ff.). Die Brust verkörpert in unserer Gesellschaft nicht nur Müt-
terlichkeit, sondern in erster Linie die sexuelle Potenz der Frau. Einerseits besitzt sie
als Quelle körperlicher Lustempfindungen Bedeutung für die Frau selbst, anderer-
seits kommt ihr eine herausragende erotische Wirkung im Zusammenhang mit dem
männlichen Geschlecht zu. Die weibliche Brust ist mit Abstand das wichtigste se-
kundäre Geschlechtsorgan und der optische Blickfang schlechthin ein Großteil der
Männer blickt unbewußt als allererstes auf den Busen einer ihnen entgegentretenden
Frau (vgl. G
OESMANN
2000, 8).
Aus der gesellschaftlichen Wertung, aber auch aus der jeweils individuellen Bezie-
hung ist die Erkrankung an Brustkrebs zu betrachten. Die Brust wird ganz offenbar
zu jenem Organ, über das sich die Frau definieren lassen muß und vielfach auch
selbst definiert (vgl. B
ISCHOF
& S
ENN
1999, 257ff., G
OESMANN
2000, 9). Als Inbe-
griff der perfekten Frau kommt dem Busen in der westlichen Gesellschaft eine
enorme und vielschichtige symbolische Kraft zu. Brustkrebs betrifft demnach ein
Organ, das mit selbstwertbeeinflussenden Attributen der Sexualität und Weiblichkeit
assoziiert ist. Eine brustkrebserkrankte Frau wird nicht nur mit kosmetischen Verän-
derungen und dem Leben mit einer chronischen Krankheit konfrontiert, sondern
zusätzlich sind ,,die Selbstdefinition und das Selbstwertgefühl der Frau betroffen"
(N
IEHUES
1997, 288). Ein Großteil der Angst vor Makeln der Brust steht in unmittel-
barer Verbindung mit idealisierten anatomischen Vorstellungen. Wenn schon die
idealisierte und normierte Form und Größe des perfekten Busens vielen gesunden
Frauen in unserer Gesellschaft Probleme bereitet, so ist es nachvollziehbar, daß es
für viele Frauen ein traumatisches Erlebnis ist, wenn sich Form und Größe ihrer
Brust infolge einer Operation verändern. Diese Aspekte des Körper- und Selbsterle-
bens werden im dritten und vierten Kapitel ausführlich behandelt. Festzuhalten
bleibt, daß der weiblichen Brust eine besondere Bedeutung für die Frau zukommt,
die zumindest teilweise aus der gesellschaftlichen Wertung resultiert.
2.2.2 Psychische Folgen der Erkrankung
Eine Brustkrebserkrankung kann sich praktisch auf alle Lebensbereiche einschrän-
kend auswirken (vgl. N
EISES ET AL
. 1996). Im Krankheitsverlauf wird die Patientin
mit zahlreichen lebensqualitätsmindernden Belastungsfaktoren konfrontiert, die ih-
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
20
rerseits auch die Psyche beeinträchtigen können. Führt schon die Diagnose an sich
zur psychischen Destabilisierung, so stellen die anschließenden Behandlungsformen
zusätzliche Belastungsmomente dar, die nicht nur physiologische Auswirkungen
haben, sondern ebenso den psychosozialen Bereich tangieren und eigenständige
Streßfaktoren darstellen. S
ALTER
(1998, 124ff.) weist darauf hin, daß körperliche
Einschränkungen zu Beeinträchtigungen im Alltagsleben und des Allgemeinbefin-
dens beitragen und dadurch die negativen psychischen Folgen einer Krebserkrankung
noch verstärken können. Der enorme psychische Streß, dem eine Frau durch ihre
Krankheit ausgesetzt ist, wirkt sich seinerseits negativ auf den Erkrankungsverlauf
und die Prognose der Erkrankung im Sinne eines circulus vitiosus aus (vgl.
B
IRBAUMER
1986, 228). Zahlreiche Studien haben sich mit den psychosozialen Fol-
gen einer Brustkrebserkrankung auseinandergesetzt und liefern eindeutige Belege für
Beeinträchtigungen in psychischen, psychosomatischen, partnerschaftlichen und an-
deren sozialen Bereichen (vgl. A
EBISCHER
1987, P
ERREZ ET AL
. 1991, N
EISES ET AL
.
1996, K
EPPLINGER
1996, zusammenfassend auch S
CHULZ ET AL
. 1998 und S
ALTER
1998). Allerdings scheinen die psychischen Auswirkungen nicht tumorspezifisch zu
sein. Z
IEGLER
(1990, 8) konstatiert, daß nicht die Diagnose des Mammakarzinoms an
sich, sondern die Tatsache der Malignität ursächlich für die psychischen Reaktionen
ist.
Die Vielzahl an psychosozialen Belastungen läßt sich nach S
TELTER
(1997, 15) in
vier Bereiche einteilen. Sie finden sich hauptsächlich im Bereich der körperlichen
Integration, im Bereich des emotionalen Gleichgewichts und Wohlbefindens, in be-
zug auf die Selbstregulation und in den sozialen Beziehungen und Rollen. Die
nachfolgenden Ausführungen zeigen allgemein die psychischen Belastungsmomente
für das Wohlbefinden und emotionale Gleichgewicht im Verlauf einer Brustkrebser-
krankung auf, ohne jedoch Gültigkeit für den Einzelfall zu beanspruchen.
Zuvor ist herauszustellen, daß eine Krebserkrankung nicht zwangsläufig mit einer
Einbuße an Lebensqualität einhergehen muß. In einigen Untersuchungen berichten
Patientinnen retrospektiv sogar von einer neuen Sinnfindung in ihrem Lebensalltag
und in den Beziehungen zu ihrem Umfeld (vgl. z.B. H
ERSCHBACH
1985). Bis es al-
lerdings zu so einer positiven Wende in der Beurteilung dieser Erkrankung kommen
kann, hat die Patientin oftmals einen schwierigen und mühsamen Weg zurückzule-
gen.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
21
Schon die Diagnose an sich birgt eine Vielzahl psychosozialer Belastungsfaktoren.
Eine Krebserkrankung bedeutet ein Leben mit mehr oder weniger stark ausgeprägten
Krankheits- und Therapiefolgen bei einer potentiellen Todesbedrohung. Dement-
sprechend ruft die Diagnose Mammakarzinom eine Fülle von Gedanken,
Vorstellungen und Gefühlen hervor und stürzt die Betroffene in eine zumindest vo-
rübergehende Lebenskrise (vgl. R
ITTER
-G
EKELER
1992, 93-107; N
EUSER
1994, 153-
171). K
ÜCHLER
(1992, 67) berichtet von der Dominanz des Diagnoseschocks und der
damit verbundenen existentiellen Bedrohung. Oftmals haben die Frauen bis zur Di-
agnose keine körperlichen Symptome verspürt. Insbesondere dann treten die
Diagnose und die anschließende Therapie mit ihren Nebenwirkungen mit besonderer
Wucht in das Leben und verstärken die negativen psychischen Folgen der Erkran-
kung (vgl. B
ISCHOF
& S
ENN
1999, 145). Die wahrgenommene Unkontrollierbarkeit
der Erkrankung und die eventuelle Diskrepanz zwischen gutem körperlichen Befin-
den und medizinischem Befund lassen die Krankheit unheimlich erscheinen und
machen einen Großteil der Angst und Belastung aus. R
ITTER
-G
EKELER
(1992, 110)
sieht in dieser Phase Hilf- und Hoffnungslosigkeit als vorherrschende Emotionen,
betroffene Frauen würden häufig vom Verlust ihrer Selbstsicherheit und der Kontrol-
le über die Situation berichten. Nach dem Modell der kritischen Lebensereignisse
von F
ILIPP
(1990) existieren für die Konfrontation mit der Diagnose Brustkrebs keine
antizipierbaren Bewältigungsmuster, mit deren Hilfe man die Situation meistern
könnte. Der Tatsache, daß in der eigenen Brust ein Tumor unkontrolliert wächst,
stehen die Betroffenen zunächst relativ hilflos gegenüber, denn weder Kontext-
merkmale (z.B. ein sehr gutes soziales Netzwerk) noch Personenmerkmale (z.B. eine
ausgeprägte Selbstwirksamkeit) können an der Tatsache dieser existenzbedrohenden
Zellvermehrung etwas ändern. Dementsprechend kommt Abwehrmechanismen in
dieser Situation eine essentielle Bedeutung zu. Häufig leugnen Patientinnen die Di-
agnose oder erheben Zweifel an ihrer Richtigkeit (vgl. I
HDE
1997b, 1169ff.). Weitere
mögliche Abwehrmechanismen sind z.B. Bagatellisierung, Regression
16
und Projek-
tion
17
(vgl. S
CHULZ ET AL
. 1998, 407). Diese anfängliche Verdrängung der Diagnose
16
Regression bezeichnet die Rückkehr zu Verhaltensweisen, die für frühere, kindlichere Entwick-
lungsstufen typisch sind z.B. die Behauptung, Übungen trotz eigener Fähigkeit nicht alleine
durchführen zu können, um sich die fürsorgliche Zuwendung des Therapeuten zu sichern.
17
Von Projektion spricht man, wenn eine Person die eigenen Gefühle, Eigenschaften oder Vorstellun-
gen bei anderen sieht, die diese jedoch nicht haben.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
22
kann im Sinne einer möglichen positiven Schutzfunktion interpretiert werden.
18
Bis
zu einem gewissen Grad erscheint die Verdrängung sehr hilfreich, da sie der Patien-
tin Gelegenheit zur psychischen Erholung und prozeßhaften Annäherung an die
Wirklichkeit gibt (vgl. S
CHULZ ET AL
. 1998, 407; K
EREKJATO ET AL
. 1996, 412ff.).
Sie sollte jedoch immer wieder von Phasen der aktiven Auseinandersetzung durch-
brochen werden.
Eine Brustkrebserkrankung impliziert nicht nur eine direkte potentielle Lebensbe-
drohung, durch die Krankheit werden auch manche Lebensziele zunichte gemacht.
Erlebte und antizipierte Verluste infolge der Erkrankung münden meist in einen fata-
len Kreislauf von Stimmungswechsel, Niedergeschlagenheit und Trauer um
unerfüllte Hoffnungen (vgl. S
TELTER
1997, 15f.). P
ERREZ
(1991, 9) konnte zeigen,
daß brustkrebserkrankte Frauen in den ersten drei Monaten nach der Akuttherapie
vor allem kognitiv durch plagende Gedanken belastet werden. E
BERT
-H
AMPEL
(1990, 41ff.) nennt als häufigste emotionale Reaktionen auf eine Krebserkrankung
reaktive Depressionen sowie Ängste vor sozialer Isolation, Autonomieverlust, vor
Verschlechterung des Zustandes und Todesängste. Schätzungsweise eine von vier
Frauen entwickelt nach F
ALLOWFIELD ET AL
. (1990, 579) innerhalb eines Jahres
postoperativ eine klinische Depression oder Angstzustände, D
EROGATIS
nennt sogar
eine Quote von durchschnittlich 32 Prozent (1983 in S
CHREER
1992). Eine Übersicht
über verschiedene Studien (vgl. K
OCH
& B
EUTEL
1988) zeigt, daß die Prävalenzraten
der als behandlungsbedürftig eingeschätzten Depressionen bei Krebspatienten zwi-
schen 20 und 50 Prozent schwanken. Befunde von P
ERREZ
(1991, 9) und F
ALLER
(1998, 26) deuten darauf hin, daß die emotionalen Verläufe interindividuell höchst
unterschiedlich und vermutlich abhängig von einer Vielzahl personeller und kontex-
tueller Variablen sind.
Neben gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit, sozialem Rückzug und anderen cha-
rakteristischen Depressionssymptomen ist eine Krebserkrankung untrennbar mit
verschiedenen Ängsten verbunden, die im Prozeß des Krankheitsverlaufs in unter-
18
Auf der Stufe der Diagnosestellung und in der ersten Zeit des Krankheitsverlaufes können diese
Verleugnungsprozesse der Patientin helfen, sich die reale Bedrohung durch eine eingeschränkte
Wahrnehmung nur zum Teil bewußt zu machen. Es geht in dieser ersten Phase vor allem darum,
die Kontrolle zurückzugewinnen. Die Anpassung an die radikal veränderte Lebenssituation voll-
zieht sich langsam und schrittweise.
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
23
schiedlichem Maße relevant sind (vgl. E
BERT
-H
AMPEL
1990, 4ff.; S
ALTER
1998,
123ff.; I
HDE
1997a, 1000). Direkt nach der Diagnose beherrscht zunächst die Angst
vor dem Tod das Denken und Fühlen (vgl. K
EREKJATO ET AL
. 1996, 406f.). Die Be-
drohung des eigenen Lebens und der Mangel an effektiven
Bewältigungsmöglichkeiten führen der Patientin ihre Machtlosigkeit vor Augen, wo-
durch als emotionale Reaktion Angstgefühle entstehen. Nach S
CHREER
(1995, 162)
ist die Angst präoperativ am größten und nimmt infolge der erlebten Behandlung ab,
um dann wieder anzusteigen. N
EISES ET AL
. (1996, 140) findet noch fünf Jahre nach
der Operation bei einem Drittel der Patientinnen mit Mammakarzinom eine ständige
Angstbelastung, was durch die Aussage von H
ASSE
(2000, 13) untermauert wird.
Diese zeigt, daß selbst nach Operation, Therapie und Nachsorgeuntersuchungen die
Angst vor einer Wiedererkrankung über Jahre und Jahrzehnte hinweg latent vorhan-
den bleibt. Durch die Tatsache, daß die Patientin in ständiger Ungewißheit vor der
Wiedererkrankung in Form eines Rezidivs oder einer Metastasierung lebt, erfahren
wiederum Wohlbefinden und Lebensqualität erhebliche Einschränkungen.
Neben der Angst vor dem Tod nimmt die Angst vor Abhängigkeit und Autonomie-
verlust einen hohen Stellenwert ein (vgl. R
ITTER
-G
EKELER
1992, 194). Eine an Krebs
erkrankte Frau muß sich zunächst in die Abhängigkeit eines Arztes, später auch in
die Abhängigkeit von anderem medizinischen Personal und je nach Fortschreiten
der Krankheit von ihren Angehörigen begeben. Die Patientin erfährt während der
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, daß das eigene Überleben ent-
scheidend von der Fachkompetenz einer anderen Person und nicht mehr von ihr
selbst abhängt. Allein durch die Assoziation einer Krebserkrankung mit Abhängig-
keit kann sich nach
I
HDE
eine Patientin ihrer Selbstbestimmung beraubt fühlen
(1997a, 1000). Der auf diese Weise erfahrene Autonomieverlust nimmt zudem da-
durch zu, daß die Zukunft vollständig durch den Verlauf der Krankheit bestimmt
wird und vieles vorher noch sicher geglaubtes nur noch die Qualität von Eventuellem
hat.
Als weitere Angstform, die im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auftreten
kann, nennen A
LT
& W
EISS
(1991, 44) die Angst vor Isolation. Viele onkologische
Patienten berichten von dem Gefühl, selbst sehr nahestehenden Personen ihre Emp-
findungen nie ganz vermitteln zu können, so daß trotz sehr guter sozialer Kontakte
ein Isolationsgefühl auftreten kann (vgl. H
ASSE
2000, 33). Situationen, in denen an-
dere Menschen mit Unverständnis oder Ablehnung reagieren, können das Gefühl der
D
AS
K
RANKHEITSBILD
B
RUSTKREBS
MEDIZINISCHE UND PSYCHOLOGISCHE
A
SPEKTE
24
Isolation noch verstärken; insbesondere R
ITTER
-G
EKELER
weist auf diese Gefahr hin
(1992, 117f.). Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Umfeld erklärt sich
teilweise auch die Angst vor äußerlich sichtbaren Veränderungen infolge der Brust-
krebserkrankung und therapeutischen Folgebehandlungen, die im dritten und vierten
Kapitel ausführlich Berücksichtigung findet.
Die dargestellten emotionalen Reaktionen erwachsen aus der direkten Lebensbedro-
hung, entscheidender als die objektiv reduzierte Lebenserwartung ist jedoch das
subjektive Erleben dieser Bedrohung. Auf diesen Aspekt weisen insbesondere neuere
Arbeiten hin (vgl. L
UCIUS
-H
OENE
1998, S
CHÄFER
1995, S
ALTER
1998, F
ALLER
1998).
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich eine Brustkrebserkrankung in vielfältiger
Weise auf den psychischen Zustand der Patientin auswirken kann. Zum einen führt
sie zu realen körperlichen Beschwerden, die in engem Zusammenhang mit psychi-
schen Belastungen stehen, zum anderen beeinträchtigt sie direkt das emotionale
Wohlbefinden und zieht eine körperliche Identitätseinbuße nach sich, die häufig mit
depressiven Ausdrucksformen einhergeht. Auf die Aspekte eines veränderten Kör-
per- und Selbsterlebens infolge von Krankheit, Operation und Therapie den
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit wird im folgenden Kapitel ausführlich ein-
gegangen.
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
25
3 Das Selbst- und Körpererleben unter dem Einfluss
einer Krebserkrankung
Dem Aussehen kommt in der westlichen Gesellschaft eine ausschlaggebende Bedeu-
tung zu (vgl. auch Kap. 2). Der Druck, dem gesellschaftlich vermittelten Idealbild zu
entsprechen, ist äußerst groß. Nach S
ALTER
(1998, 3) entscheidet das Aussehen dar-
über, wie ein Mensch von anderen wahrgenommen und beurteilt wird und wie er sich
selbst einschätzt. ,,Wie ein Mensch sich selbst wahrnimmt, hängt maßgeblich davon
ab, wie er seinen Körper wahrnimmt" (ebd., 3). Unser Körper ist eng verflochten mit
unserer erlebten Identität. Als Dreh- und Angelpunkt jeglicher Handlung stellt er
zunehmend die Grundlage für die Identitätsfindung dar. Auf diesen Aspekt des Kör-
pers als identitätsstiftendes Medium, das Authentizitäts- und Kontinuitätserfahrungen
ermöglicht, verweist H
EINEMANN
: ,,Identität wird zunehmend über den Körper erfah-
ren und vermittelt" (1990, 197). Auch G
ILLIES
(1984, 187) betrachtet das
Körpererleben als essentiellen Bestandteil des Selbst, da sich der größte Teil des
Wissens über sich selbst aus der körperlichen Existenz und deren Beziehung zur so-
zialen und materiellen Umgebung herleitet. B
ETTE
(1993, 53) nimmt an, daß die
Arbeit am Körper und die am Körper demonstrierte Mentalität für Identifikations-
und Unterscheidungsprozesse bedeutend sind. Die Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers, insbesondere die körperliche Attraktivität, spielt also in unserer modernen
Gesellschaft für die Eigenwahrnehmung und Selbstbeurteilung eine große Rolle. So
verweist S
ALTER
(1998, 6) darauf, daß Menschen, die mit ihrer körperlichen Er-
scheinung zufrieden sind, wahrscheinlich auch ein stärker ausgeprägtes
Selbstwertgefühl besitzen. Insbesondere bei Jugendlichen und hier besonders bei
Mädchen scheint die körperliche Attraktivität eng mit dem Selbstwertgefühl ver-
knüpft zu sein (vgl. S
EIFFGE
-K
RENKE
1994 in A
LFERMANN
1998, 216). Geht man mit
A
LLPORT
(1970, 12) davon aus, daß unser körperliches Selbst ein Leben lang Anker-
grund unseres Selbstbewußtseins ist, da keine Emotion und Handlung ohne unseren
Körper vorstellbar ist, so wird nur allzu deutlich, daß eine Verletzung der körperli-
chen Integrität unmittelbare Auswirkungen auf das Selbstkonzept haben dürfte. Viele
Studien liefern Belege für diese These (vgl. E
BERT
-H
AMPEL
1990, N
IEHUES
1997,
W
EBER
& A
NDERLE
1997, A
LFERMANN
1998, S
ALTER
1998).
Als theoretischer Bezugsrahmen dieser Arbeit wurden Ansätze der Selbst- und Kör-
perkonzeptforschung gewählt. Aufgrund ihrer uneinheitlichen terminologischen
Verwendung in der Forschungsliteratur richtet sich der Fokus zunächst auf die für
diese Arbeit relevanten Aspekte des Selbst- und Körpererlebens. Anschließend wer-
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
26
den mögliche Auswirkungen einer Brustkrebserkrankung auf diese Konzepte disku-
tiert.
3.1 Was bedeutet Körpererleben?
In der naturwissenschaftlich orientierten Medizin, gekennzeichnet durch die Suche
nach objektiven Befunden, spielt das subjektive Erleben des eigenen Körpers eine
untergeordnete Rolle (vgl. B
RÄHLER
1986, 3ff.). Lange Zeit wurden Körpererfahrun-
gen nur unter pathologischem Aspekt beachtet. Erst allmählich setzt sich die
Erkenntnis durch, daß das Körpererleben ein wichtiger und vollwertiger Teil des
Selbsterlebens ist und eine grundlegende Bezugsgröße für die Entwicklung und Fes-
tigung des Kontakts zur Realität darstellt. Sämtliche Befunde sprechen dafür, daß das
Körperbild
19
eine der vielen Komponenten ist, auf der das Selbsterleben basiert und
daß das Erleben des eigenen Körpers einen wesentlichen Teil des Selbstbewußtseins
ausmacht (vgl. P
AULUS
1986, 88; M
RAZEK
1986, 224; E
BERT
-H
AMPEL
1990, 19;
T
HIEL
1994, 31). Doch was genau versteht man unter Körpererleben? Aus welchen
Komponenten setzt es sich zusammen? Zunächst soll ein Blick in die Vergangenheit
einen ersten Zugang zu dieser Thematik ermöglichen. In einem groben Überblick
werden die Entwicklungslinie nachgezeichnet, bevor eine definitorische Präzisierung
erfolgt.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts erforschen die unterschiedlichsten Wissenschafts-
bereiche das individuelle Körpererleben unter verschiedenen Gesichtspunkten und
mittels variierender Methodik (vgl. T
HIEL
1994, 6ff.). In jüngster Zeit haben auch die
Bewegungswissenschaften, Sportwissenschaft und Motologie, diese Thematik ent-
deckt. Ihren Anfang nahm die Erforschung des Körpers Ende des 19. Jahrhunderts in
der Neurologie, die sich mit dem kortikal repräsentierten Körperschema
20
und seiner
Funktion für die Reizverarbeitung befaßt. Dieser Forschungszweig hebt Prozesse der
Informationsaufnahme und -verarbeitung körperlicher Erfahrungen hervor, d.h. der
kognitive Aspekt tritt in den Vordergrund (vgl. T
HIEL
1994, 7). In der Folge schlos-
sen sich psychiatrische und psychologische Forschungsansätze an, die sich mehr mit
den emotionalen Bedeutungen des Körpererlebens sowie den Einstellungen zum
19
Im Rahmen dieser Arbeit werden Körperbild und Körpererleben als synonyme Begriffe verwendet,
da der Terminus Körperbild auf die Erlebnisqualität des Körpers bezogen wird.
20
Der Begriff Körperschema wurde 1908 vom Prager Psychiater P
ICK
eingeführt, der darunter ein
optisches Vorstellungsbild des Körpers verstand, das zur Orientierung am eigenen Körper dient.
T
EEGEN
(1992, 99) spricht von ,,Raumbilder(n) des Körpers, die sich aufgrund sensorischer Infor-
mationen entwickeln". Der englische Neurologe H
EAD
griff den Begriff Körperschema auf und
begann 1911/12 mit der Erforschung der kortikalen Repräsentation (vgl. T
EEGEN
1992, 99f.).
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
27
Körper auseinandersetzten und den Begriff Körperbild
21
prägten (vgl.
Z
.B. S
CHILDER
1950). Den Schwerpunkt auf die gefühlsmäßig bewertenden Prozesse setzend eruie-
ren diesbezügliche Untersuchungen zahlreiche subjektive Aspekte des Menschen
über seinen Körper wie zum Beispiel Körperbild (S
ECORD
& J
OURARD
1953;
B
IELEFELD
1986), Körperselbst (J
ORASCHKY
1986), Körperselbstbild (B
ONGERS
1984), Körperkonzept (M
RAZEK
1984), Körpererfahrung (S
HONTZ
1975; F
ISHER
1970; P
AULUS
1982) und Körperstörungen (S
ALTER
1998). Die Vielzahl der Begriffe
deutet die Fülle persönlichkeitstheoretisch orientierter Publikationen an. Durch inten-
sive Forschungstätigkeit hat die Körperbildforschung neben einer großen
Literaturfülle bedauerlicherweise auch eine verwirrende Begriffsinflation hervorge-
bracht, wodurch es schwierig scheint, diese subjektive Dimension einheitlich und
zufriedenstellend zu erforschen (vgl. B
IELEFELD
1986, 7ff.). Die Methoden sprechen
in unterschiedlicher Weise auf einzelne Aspekte dessen an, was der jeweilige Autor
als Körperbild versteht. Nach S
ALTER
(1998, 22) existiert bislang noch keine Metho-
de, die das Körperbild als Ganzes zufriedenstellend erfaßt. Die Fülle
wissenschaftlicher Fragestellungen, methodischer Zugriffe, historischer, kultureller
und anders gearteter Einflüsse haben den Forschungskomplex Körpererfahrung so
ausufern lassen, daß die bisherigen Erkenntnisse weitgehend zusammenhangslos
nebeneinander stehen. T
EEGEN
(1992, 97) weist darauf hin, daß eine genaue Ordnung
bisher noch nicht geleistet worden ist. Allerdings bemühen sich einige Autoren um
eine systematische Strukturierung der Vielzahl von Begriffen. Im Rahmen dieser
Arbeit sind hierbei vor allem die Strukturmodelle nach B
IELEFELD
(1986) und
P
AULUS
(1986) von Interesse.
Nach einer kritischen Analyse bisheriger Systematisierungsversuche stellt
B
IELEFELD
(1986, 13ff.) ein neues Strukturmodell vor, das sich um eine Integration
bisheriger Begriffe bemüht und die Gliederung unter einen Oberbegriff versucht. Als
einen allen anderen Bezeichnungen übergeordneten Begriff schlägt er den Terminus
,body experience' (Körpererfahrung) vor, der ,,die Gesamtheit aller im Verlauf der
individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung erworbenen Erfahrungen mit dem
eigenen Körper, die sowohl kognitiv wie affektiv, bewußt wie unbewußt sein können
[
umfaßt]" (B
IELEFELD
1986, 17). Es handelt sich um ein allgemeines Konstrukt, das
auf die Wahrnehmung verweist, wobei Wahrnehmung in diesem Sinne nicht nur neu-
rophysiologische Prozesse, sondern auch die Erlebnisqualität, also Empfindungen
21
Der Begriff Körperbild wurde 1923 von S
CHILDER
eingeführt. Das Körperbild bezieht sich mehr auf
die affektiv akzentuierte Dimension des Körpererlebens. S
CHILDER
s Konzept vom Körperbild be-
inhaltet psychische Aspekte, die soziologische Relevanz der äußeren Erscheinung sowie die
Einstellungen und Gefühle eines Menschen gegenüber seinem Körper. Das Körperbild enthält die
gesamten subjektiven Erfahrungen mit dem eigenen Körper (vgl. T
EEGEN
1992, 100f.).
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
28
und Gefühle beinhaltet. B
IELEFELD
sieht in dem Terminus einen idealen Oberbegriff,
unter den Aspekte der Körperwahrnehmung und des Körpererlebens in hervorragen-
der Weise subsumiert werden können. Dabei faßt er die beiden Themenkomplexe im
Sinne zweier Facetten eines Sachverhalts auf. Auf der zweiten Strukturierungsebene
finden sich die Termini Körperbild und Körperschema. B
IELEFELD
ordnet dem Kör-
perschema den neurophysiologischen Teilbereich der Körpererfahrung zu, der ,,alle
perceptiv-kognitiven Leistungen des Individuums bezüglich des eigenen Körpers"
umfaßt (1986, 17). Hierzu zählen die Orientierung im und am eigenen Körper, die
Einschätzung von Größendimensionen sowie alle Bereiche der Körperkenntnis. Dem
gegenüber stellt er den psychologisch-phänomenalen Teilbereich der Körpererfah-
rung (Körperbild), zu dem alle körperbezogenen Empfindungen, Gefühle und
Vorstellungen, über die das Individuum etwas aussagen kann, gehören.
Auch P
AULUS
(1982) zielt auf die Erarbeitung eines übergeordneten Konstrukts der
Körpererfahrung ab. Er geht von den gleichen Begriffen wie B
IELEFELD
aus, setzt
ebenfalls die Körpererfahrung gleich dem Wissensbestand über den eigenen Körper
als übergeordneten Begriff und strukturiert sie in einen kognitiv-perceptiven Aspekt
(Körperschema) und einen emotional-affektiven Aspekt (Körperbild). Allerdings
nimmt er eine andere Differenzierung dieser Teilbereiche vor. Körperschema im
Sinne von P
AULUS
meint die unmittelbare Orientierung am eigenen Körper, die als
Funktion autonom im Zuge der Entwicklung des Zentralen Nervensystems reift. Ge-
meint ist also die biologisch-materiale Körpermerkmalszuschreibung, die aus
kinästhetischen, propriozeptiven, optischen und taktilen Erfahrungen resultiert. Zum
Körperbild gehören nach P
AULUS
die affektiv-emotionalen Eigenschaftszuschrei-
bungen des Körpers und die Bedeutung, die diesen Eigenschaften beigemessen wird,
sowie das emotionale Verhältnis zum Körper. Es geht demnach um die subjektive
Körpersichtweise, d.h. die Erlebnisqualität des Körpers über die biologisch-materiale
Merkmalszuschreibung hinaus und die Bedeutung, die Personen ihren jeweiligen
Körpereigenschaften beimessen. Das emotionale Verhältnis zum Körper umfaßt
schwerpunktmäßig die (Un-)Zufriedenheit mit dem Körper bzw. verschiedenen Kör-
peraspekten (vgl. T
HIEL
1994, 13f.).
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der Begriff Körpererfahrung ein in sich selbst
sehr komplexes Konstrukt darstellt, dessen internen Bezüge noch weitgehend unge-
klärt sind. Ähnliches trifft auf den erlebnisorientierten Bereich, umschrieben mit den
Begriffen Körperbild oder Körpererleben, zu. Man nimmt an, daß das Körperbild in
Struktur und Ausdifferenzierung dem Selbstbild auf körperlicher Ebene entspricht
(vgl. M
RAZEK
1986, 224; S
EIFFGE
-K
RENKE
1996, 253). Sowohl die Arbeit von
A
LFERMANN
(1998) als auch von S
ONSTROEM ET AL
. (1991) zeigen, daß die Annah-
me eines multidimensionalen Körperkonzeptes von Erwachsenen berechtigt ist. Eine
exakte Bestimmung des Körperbildes gestaltet sich jedoch als äußerst schwierig, da
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
29
es sich um ein komplexes theoretisches Konzept handelt, zu dem verschiedene Beg-
riffsdefinitionen existieren. Die meisten Forscher teilen die Ansicht, daß das
Körperbild mehr ist als die bloße Bewertung des Körpers mit Hilfe der Wahrneh-
mung und daß kognitive Aspekte eine ausschlaggebende Rolle bei der Entstehung
des Körperbildkonzeptes spielen. Es ist zu vermuten, daß insbesondere durch das
komplexe Zusammenspiel von Wahrnehmungen, Einstellungen und emotionalen
Faktoren bei der Entwicklung des Körpererlebens die genaue Bedeutung des Kon-
zeptes oft nicht klar ist.
In Übereinstimmung mit S
ALTER
(1998) versteht diese Arbeit das Körpererleben als
ein dynamisches, mehrdimensionales Konzept, das sich auf den subjektiv wahrge-
nommenen und emotional abgespeicherten Bereich des Körpers bezieht. Dieser
umfaßt die Zuschreibung von Körpereigenschaften (z.B. attraktiv, gesund, feminin)
und die (kognitive wie emotionale) Beziehung zum eigenen Körper (vgl. P
AULUS
1986, 109) bzw. in den Worten von B
IELEFELD
,,alle emotional-affektiven Leistungen
des Individuums bezüglich des eigenen Körpers" (1986, 17).
3.2 Was bedeutet Selbsterleben?
Wissenschaftlich ist das Selbsterleben in sehr unterschiedlichem Ausmaß bearbeitet
worden, so daß im Ergebnis die Selbstforschung gegenwärtig durch einen Pluralis-
mus an Konzepten und Theorien gekennzeichnet ist. Der Beginn einer
systematischen Erforschung des Selbst läßt sich mit der Arbeit von J
AMES
(1890 in
B
IELEFELD
1986, 5f.) datieren. Im Laufe eines Jahrhunderts sind mit dem Begriff
,Selbst' jedoch höchst unterschiedliche Konzepte belegt worden, so daß im Rahmen
dieser Arbeit eine begriffliche Präzisierung erforderlich ist. Dabei stützen sich die
weiteren Ausführungen auf die konzeptionellen Ansätze sozialpsychologisch orien-
tierter Forschung.
Das Selbst läßt sich grob als das Bild verstehen, das eine Person von sich selbst ent-
wirft, es handelt sich also um eine individuell konstituierte laienhafte Theorie. In der
sozialwissenschaftlichen Literatur wird der Begriff ,Selbst' in die Elemente Selbst-
konzept, Selbsteinschätzungen und Selbstwertgefühl differenziert. Selbstkonzept
wird in diesem Sinne verstanden als die Summe der Urteile einer Person über sich
selbst. Während es sich hierbei um die reine Zuschreibung von Eigenschaften han-
delt, bedeutet Selbsteinschätzung die zu den einzelnen Kognitionen gehörigen
affektiven Komponenten, es handelt sich also um bewertende Urteile. Aus der Sum-
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
30
me aller gewichtigen Selbsteinschätzungen bildet sich schließlich das Selbstwertge-
fühl (vgl. F
REY
& B
ENNING
1983, 149; S
ALTER
1998, 4). Obwohl klare Definitionen
der Begriffe vorliegen, finden sie in der Literatur keine einheitliche Verwendung.
Diese Arbeit schließt sich zunächst der Aufteilung des Selbst in affektive und kogni-
tive Komponente an, wobei die affektive die selbstbezogenen Bewertungen
(Selbstwertgefühl) und die kognitive die selbstbezogenen Wahrnehmungen und das
Wissen bezüglich der eigenen Person (Selbstbeschreibungen) umfaßt (vgl. S
EIFFGE
-
K
RENKE
1996, 250f.; H
ANNOVER
1997, 66ff.). Beide Teilbereiche stehen in Interak-
tion und lassen sich in Anlehnung an P
AULUS
(1986, 87) unter dem Oberbegriff
Selbsterfahrung subsumieren, der die Grundlage der Selbsttheorie bildet. Der Ter-
minus Selbsterfahrung umfaßt die Gesamtheit aller Einstellungen eines Individuums
zur eigenen Person. Hierunter werden ,,sowohl Überlegungen, Auffassungen, Vor-
stellungen, Bewertungen, Gefühle als auch Handlungen subsumiert, die das
Individuum gegenüber der eigenen Person entwickelt" (W
EBER
& A
NDERLE
1997,
35) und auf deren Basis subjektive Konzepte konstruiert werden.
Die Theorie über die eigene Person entwickelt sich in einem fortlaufenden Differen-
zierungsprozeß, d. h. Selbsterfahrungen werden in konzeptuellen Systemen
gespeichert, emotional determiniert und mit anderen Bereichen verknüpft, die wie-
derum untereinander verbunden sind. So entsteht als ein differenziertes und
integriertes Konstruktsystem das Selbst(erleben), das immer einzigartig ist, sprich
jeweils nur die betreffende Person charakterisiert (vgl. H
ANNOVER
1997, 36). In die-
sem Sinne versteht die Arbeit den Begriff Selbsterleben auf die subjektive
Erlebnisqualität und die Bedeutung einzelner Komponenten für die Handlungskom-
petenz und Wertschätzung der eigene Person ausgerichtet.
Das Selbsterleben ist in erheblichem Maße sozial bedingt. In Anlehnung an W
ITTE
(1991, 11) kann die Selbsttheorie als die sozial vermittelte Stellungnahme zur eige-
nen Person definiert werden. Aufbau und Veränderung der Theorie basieren auf der
Grundlage von Informationen über die eigene Person, die zum einen aus der Eigen-
wahrnehmung, zum anderen aus der Interaktion mit der materialen und sozialen
Umwelt resultieren. P
AULUS
(1986, 105) unterscheidet auf der Basis von F
ILIPP
(1979) fünf Informationsquellen, über die ein Mensch Rückmeldungen aus der sozia-
len Umwelt über das Verhalten oder Eigenschaften seiner Person erhält: Direkte,
indirekte, komparative, reflexive und ideationale Merkmalszuweisungen. Andere
Menschen liefern kontinuierlich informationelles Rohmaterial über die eigene Per-
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
31
son, das subjektiv verarbeitet, interpretiert und bewertet wird. Daneben existieren
allgemeine soziokulturelle Sollsetzungen, die als kognitives Bezugssystem wirken
und an denen sich das Individuum in Wahrnehmung und Bewertung seines Selbst
orientiert. Die Komponenten des Selbst entstehen also aus der subjektiven Reflexion
des eigenen Verhaltens auf andere und der daraus folgenden positiven oder negativen
Bewertung. Sie entwickeln und verändern sich somit in einem wechselseitigen Per-
sonen-Umwelt-Bezug. Grundsätzlich muß dabei berücksichtigt werden, daß
Menschen aktive Konstrukteure ihres Wissens sind und Informationsquellen selektiv
aufsuchen oder vermeiden (vgl. F
ILIPP
1985c, 351).
Die konzeptionellen Divergenzen der unterschiedlichen Ansätze zur Selbsttheorie
finden sich hauptsächlich in den Bereichen Struktur, Funktion und Stabilität. Wäh-
rend früher die eigene Person in ihrem Selbsterleben als ganzheitlich gedachte Entität
angesehen wurde, scheint sich in jüngster Zeit die Annahme eines multiplen Selbst in
Form vieler bereichs- und situationsspezifischer Partialmodelle der eigenen Person
durchzusetzen. H
ANNOVER
(1997, 3ff.) spricht von zu unterscheidenden Selbstkon-
zepten einer Person, die durch den Kontext gebildet werden, mehr oder weniger
interagieren und damit ein dynamisches System darstellen. In neuen Theorien wird
also übereinstimmend von einem System von Teilkonzepten des Selbst ausgegangen,
d.h. das Selbst wird durch verschiedene Aspekte oder Komponenten der Person be-
stimmt. So differenziert bspw. F
UCHS
(1989, 8) ein soziales, körperliches und
leistungsbezogenes Selbstkonzept. Einen wichtigen Aspekt bildet diesbezüglich die
unterschiedliche Bedeutsamkeit der Selbstpostulate. Bei erwachsenen Frauen weisen
Aspekte des Körpers wie z. B. Figur, Weiblichkeit, Körpergröße, Jugendlichkeit etc.
verschiedene Relevanzen auf. Werden die zentralen Annahmen durch neue Erfah-
rungen in Frage gestellt, kann dies zu weitreichenden Krisen und zu Versuchen der
Rekonstruktion der Selbsttheorie Anlaß geben. Bezogen auf eine Brustkrebserkran-
kung könnte dies beispielsweise bedeuten, daß die Betroffene durch gezieltes
Körpertraining versucht, ihre veränderte Körperlichkeit zu erspüren oder aber kogni-
tiv eine veränderte Relevanzzuschreibung vornimmt.
Noch keine einheitliche Meinung gibt es bezüglich der Frage, in welcher Form das
oben erläuterte dynamische System organisiert ist. Je nach theoretischer Perspektive
finden sich hier unterschiedliche Ansätze. Ältere informationstheoretische Ansätze
begreifen das Selbst als ein System von Selbstschemata, das als Gedächtnisstruktur
repräsentiert ist und so die Verarbeitung neuer Informationen steuert (vgl. M
ARKUS
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
32
in H
ANNOVER
1997, 19ff.). Andere Forscher gehen hingegen von einer hierarchi-
schen Organisation von Selbstkognitionen verschiedenen Spezifitätsgrades aus, dem
gemäß Selbstkognitionen auf niedrigstem hierarchischen Niveau zu selbstbezogenen
Postulaten jeweils höherer Ordnungsstufen zusammengefaßt werden (vgl.
A
LFERMANN
1998, 213; E
PSTEIN
1977, 22). Neuere Ansätze schlagen ein assoziati-
ves Netzwerkmodell des Selbst vor (vgl. H
ANNOVER
1997, 20; Abb. 3-1). Das
Netzwerkmodell postuliert, daß selbstbezogene Erfahrungen um verschiedene Kon-
texte herum organisiert sind und gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Informationen werden in Sätzen gespeichert, die spezifische Informationen mit dem
Selbst verbinden (z.B. weiblich, sportlich, hilfsbereit).
A
BBILDUNG
3-1: S
TRUKTURMODELL DES
S
ELBSTKONZEPTS ALS ASSOZIATIVES
N
ETZWERK
Q
UELLE
: I
N
A
NLEHNUNG AN
H
ANNOVER
(1997)
Nach wie vor heftig umstritten ist in der Wissenschaft die Frage, ob das Selbst als
stabiler Kern der Persönlichkeit aufzufassen ist oder ob es eine hohe situative Fluk-
tuation und zeitliche Variabilität aufweist (vgl. H
ANNOVER
1997, 45ff.). Insgesamt
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
33
läßt sich aus den vorliegenden Forschungsergebnissen die Schlußfolgerung ziehen,
daß das Selbst zumindest kurzfristigen situativen Schwankungen unterliegt. Je nach
Kontext tritt ein bestimmtes Selbst in den Vordergrund, während andere Bereiche in
den Hintergrund treten. Selbstbewertungen höheren Abstraktionsniveaus, großer
Zentralität sowie solche mit hoher subjektiver Bedeutsamkeit weisen zeitlich stärkere
Konstanz auf (vgl. S
TELTER
1997, 115). Auf dieser Ebene werden möglicherweise
nur einschneidende Lebensereignisse zu zeitlich dauernden Selbstveränderungen
führen. M
ANDLER
(1993, 28) weist darauf hin, daß die stabilen Bereiche der Selbst-
bewertung auf langjährig gefestigten intrapsychischen Strukturen basieren,
wohingegen Selbstbereiche mit psychosozialer Komponente eine stärkere Variabili-
tät zeigen. Demnach nimmt das Maß der Veränderbarkeit der Selbsteinschätzungen
mit steigendem Einfluß von Umweltfaktoren zu.
J
AMES
führte mit Beginn der Selbstforschung 1890 die grundlegende Unterscheidung
zwischen dem Selbst als erkennendes Subjekt und als Objekt der Erkenntnis ein (vgl.
B
RÄHLER
1986, 4f.). Diese Differenzierung ist in der aktuellen Forschung in ande-
rem begrifflichen Gewand wieder aufgegriffen worden. Jeder Mensch erhält durch
Erfahrungen, die er in seinem persönlichen Alltag macht, kontinuierlich Informatio-
nen für den Aufbau seiner Selbsttheorie, umgekehrt beeinflußt aber auch das
Selbstwertgefühl die Informationsaufnahme. So gilt selbstbezogenes Wissen zum
einen als das Ergebnis der Verarbeitung selbstbezogener Informationen, zum anderen
bildet es einen Aktionsplan, demgemäß nachfolgende selbstbezogene Informationen
verarbeitet werden und steuert so den Prozeß der Konzeptbildung über die eigene
Person
22
. In diesem Sinne wird die duale Perspektive von J
AMES
in Form einer pro-
zeß- und produktorientierten Betrachtung von Selbstkonzepten weitergeführt (vgl.
F
ILIPP
1985c, 347ff.).
Abschließend soll die Frage diskutiert werden, welche Funktion der Selbsttheorie
zukommt. P
AULUS
(1986, 95) betont ihre herausragende Bedeutung für die seelische
Gesundheit und weist ihr konkret drei Ziele zu: Sie soll eine optimale Lust-Unlust-
Balance ermöglichen, eine positive Selbstwertschätzung sichern und die Anpassung
22
Ob die Verarbeitung im Sinne der Selbsterhöhungstheorie oder der Selbstkonsistenztheorie erfolgt,
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter diskutiert werden. Während die Vertreter der Selbster-
höhungstheorie postulieren, daß Menschen generell positive Informationen suchen und negative
vermeiden, werden aus konsistenztheoretischer Richtung Zweifel am Motiv des Selbstwertschutzes
laut. Vertreter dieser Perspektive behaupten, daß Personen Informationen den Vorrang geben, die
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
34
aller selbstbezogenen Erfahrungsdaten gewährleisten. Auch A
LFERMANN
(1998,
218f.) sieht im Selbsterleben eine wichtige Gesundheitsressource und verweist auf
den engen Zusammenhang der psychischen Gesundheit mit dem Selbstwertgefühl als
globale Bewertung der eigenen Person. Die praktische Relevanz der verschiedenen
Selbstkomponenten zeigt sich, wenn die Auswirkungen des Selbst betrachtet werden:
So wirkt sich das Ausmaß des generellen und bereichsspezifischen Selbstwertgefühls
auf die Wahl von Handlungen aus. Beispielsweise wird jemand, der sich sportliche
Fähigkeiten zutraut, eher sportlich aktiv werden, wobei aus dieser Verhaltensweise
dann auch wieder selbstwertförderliche Informationen zurückfließen (vgl. Kapitel 5).
Hohes Vertrauen in die eigene Person erleichtert zudem den Umgang mit Aufgaben
und Problemen. Aufgrund der selbsteingeschätzten Handlungskompetenz, für die als
vermittelnde Variable die Selbstwirksamkeit steht, finden sich eher zufriedenstellen-
de Lösungsmöglichkeiten. Eine hohe Selbstwirksamkeit führt auch zu verstärktem
Kontrollempfinden und wirkt sich in dieser Verbindung förderlich auf die Lebenszu-
friedenheit auswirkt. Auf kognitiver Ebene zeigt sich ein Einfluß der Selbsttheorie
auf die Informationsaufnahme und -verarbeitung, wobei die genaue Art und Weise
dieser Beeinflussung noch nicht hinlänglich bewiesen ist (vgl. H
ANNOVER
1997,
30ff.). Nicht zuletzt zeigt sich bei Personen mit hohem Selbstwertgefühl ein positiver
Einfluß auf ihr soziales Verhalten (vgl. A
LFERMANN
1998, 217).
3.3 Die Verbindung von Körper und Selbst
Menschen stellen sich über ihren Körper dar, über Körperhaltung, Gestik, Mimik
oder die Ausgestaltung von Bewegungen. Wie schon mehrfach angesprochen ma-
chen Körpererfahrungen einen integralen Bestandteil der Selbsterfahrungen aus. Das
Körperbild als komplexes inneres Erfahrungsmuster bildet die Grundlage des Selbst-
bildes und des Kontaktes zur Realität. Besinnt man sich darauf, daß die frühesten
Selbstwahrnehmungen Wahrnehmungen des eigenen Körpers sind (,sich be-
greifen'), so wird die Bedeutung der subjektiven Körpererfahrungen für das Selbster-
leben offensichtlich (vgl. T
EEGEN
1992, 100ff.; Z
IMMER
1993, 25ff.). Auch P
AULUS
betrachtet die Körpererfahrung als Teilaspekt einer umfassenden Theorie über das
Selbst und beurteilt ,,die Verwurzelung im eigenen Körper als wesentlich für die per-
sonale Identität" (1982, 88; vgl. M
RAZEK
1986). Über Körpererfahrungen nimmt das
mit ihren Selbstwerteinschätzungen kongruent sind, d.h. Personen mit negativem Selbst bevorzu-
gen Informationen, die negative Aussagen über sie beinhalten.
D
AS
S
ELBST
-
UND
K
ÖRPERERLEBEN UNTER DEM
E
INFLUSS EINER
K
REBSERKRANKUNG
35
Individuum sich selbst und seine Umwelt wahr und konstruiert daraus subjektive
Konzepte (vgl. T
HIEL
1994, 3). Subjektiv körperbezogene Wertungen konstituieren
und repräsentieren vielfältige subjektive Beziehungen des Individuums zu seinem
Körper und leisten damit einen zentralen Beitrag zum Selbsterleben. Für die zugrun-
de liegende Selbsttheorie ist von entscheidender Bedeutung, welche Eigenschaften
Individuen ihrem eigenen Körper zuschreiben, welche Aspekte mitberücksichtigt
werden, in welchem Beziehungsgefüge die Konzepte stehen und in welchem Aus-
maß sie eine innere Stabilität aufweisen. Die verschiedenen Konzepte erlangen für
die Selbsttheorie funktionale Bedeutung. So bedeutet beispielsweise körperliche Att-
raktivität nicht nur, einen schönen Körper zu haben, sondern aus Sicht der
Selbsttheorie, welche Funktionen sich für das Individuum damit verbinden. Hierzu
gehört zum Beispiel von anderen bewundert zu werden, einen gutaussehenden Part-
ner zu finden, einen schönheitsabhängigen Beruf (z.B. Model) zu erlangen usw..
Menschen, die sich subjektiv als attraktiv einschätzen, haben auch ein positiveres
Selbstbild (vgl. S
ALTER
1998, 4). So konnte in mehreren Studien nachgewiesen wer-
den, daß sich selbsteingeschätzte Schönheit offenbar förderlich auf die Frequenz und
Qualität von sozialen und sexuellen Kontakten und Erfahrungen auswirkt, die wie-
derum ein positiveres Selbsterleben fördern (vgl. A
LFERMANN
1998, 217). Als
materiale Basis des Selbsterlebens kommt der Körpererfahrung eine entscheidende
Bedeutung für den Aufbau einer positiven Ich-Beziehung, für emotionale Ausgegli-
chenheit und nicht zuletzt für das Selbstbewußtsein des Menschen zu, die von vielen
Autoren anerkannt wird (vgl. M
RAZEK
1986; P
AULUS
1986; T
EEGEN
1992; Z
IMMER
1993; A
LFERMANN
1998; S
ALTER
1998; A
LFERMANN
& S
TOLL
2000;
S
PÄTH
/S
CHLICHT
2000). Vor allem der Zusammenhang zwischen Wertschätzung und
Akzeptanz des eigenen Körpers und einer positiv ausgeprägten Selbsteinschätzung
scheint empirisch hinreichend belegt (vgl. B
IELEFELD
1986, 28f.). Andere For-
schungsergebnisse deuten darauf hin, daß die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper
mit Aspekten emotionaler Stabilität einhergeht (vgl. P
AULUS
1982, 111). ,,Wie der
Mensch Erscheinungsbild und Gegebenheiten seines Körpers akzeptiert, wie er seine
körperlichen Möglichkeiten einsetzt, wie er seinen Körper beachtet und mit ihm um-
geht, (...) diese Selbstannahme seiner Körperlichkeit (...) trägt nicht zuletzt zum
körperlichen Wohlbefinden, zur ,psycho-physischen Gesundheit' und damit ent-
scheidend zum Selbstgefühl und zur Ich-Findung bei" (B
IELEFELD
1986, XIII).
Ausmaß und Bedeutsamkeit der Konzepte über den eigenen Körper stehen in Ab-
hängigkeit der Gesellschaft und der in den einzelnen Lebensabschnitten der
individuellen Biographie wirksam werdenden Sozialisationsbedingungen. Körper-
lichkeit ist nicht einfach gegeben, der Wissensbestand beruht vielmehr auf der
Selbstwahrnehmung und auf Informationen, die durch Interaktion und Kommunika-
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2002
- ISBN (eBook)
- 9783832494216
- ISBN (Paperback)
- 9783838694214
- DOI
- 10.3239/9783832494216
- Dateigröße
- 2.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld – Psychologie und Sportwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2006 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- einzelinterviews aktivität krankheitsbewältigung sequenzanalyse onkologie
- Produktsicherheit
- Diplom.de