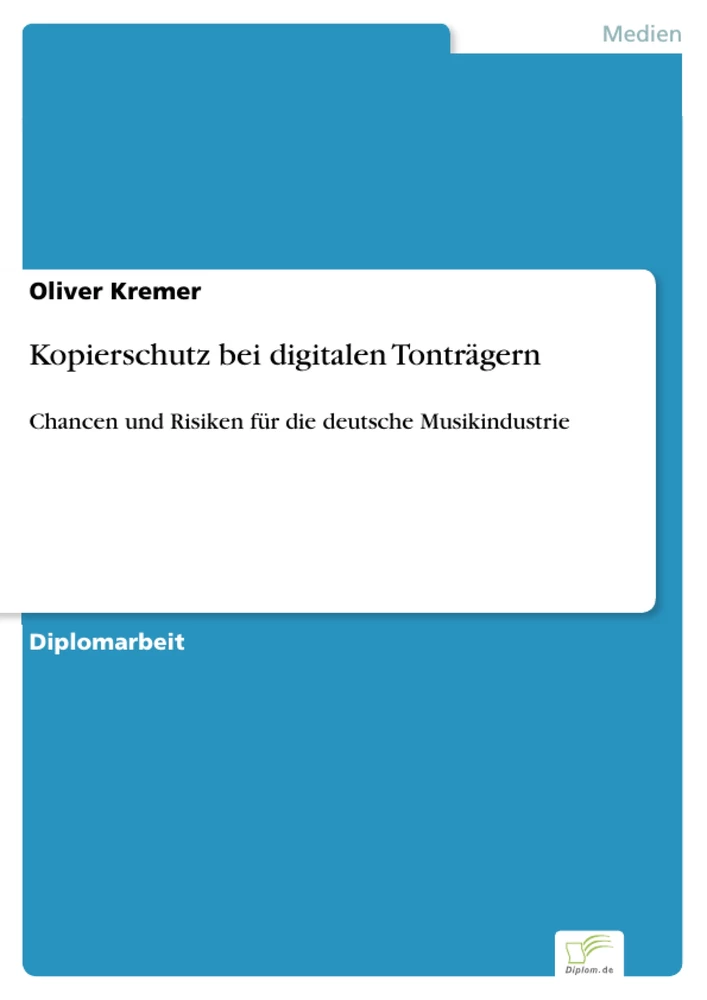Kopierschutz bei digitalen Tonträgern
Chancen und Risiken für die deutsche Musikindustrie
©2005
Diplomarbeit
76 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die deutsche Musikindustrie muss sich seit dem Jahr 2001 intensiv mit dem Thema Kopierschutz auseinandersetzen. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte hatte 2001 der Markt von digitalen Tonträgern mit minus 10,8 % einen zweistelligen Umsatzverlust zu verzeichnen. 2002/2003 setzten sich die Rückgänge in zweistelliger Höhe fort. Ende 2004 hatte der Tonträgermarkt gegenüber 2000 etwa 40 % seines Volumens eingebüsst. Tonträgerfirmen haben auf die negative Marktentwicklung in den letzten Jahren bereits mit Reorganisationen, Umstrukturierungen und Stellenabbau reagiert. Es haben so viele Unternehmen im Umfeld des Musikmarktes Konkurs anmelden müssen wie noch nie zuvor in so kurzer Zeit. Dazu gehören Promotionagenturen, Handelsbetriebe, Musikunternehmen und Musiklabels. Die Peripherie des Musikgeschäfts mit den Radiostationen, Musikmagazinen, Musikorientierten Fernsehprogrammen, Online-Magazinen und Clubs hat diese Marktentwicklung ebenfalls zu spüren bekommen.
Die wesentliche Ursache für diese Entwicklung wurde durch repräsentative Langzeituntersuchungen der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung), der größten Marktforschungsgesellschaft in Deutschland, belegt: es ist das massenhafte digitale Kopieren von Musik-CDs, der massenhafte Missbrauch der Möglichkeit, Musik-CDs über den PC-Brenner zu klonen. Nur einige Fakten hierzu: Selbstbrennen von Musik-CDs ist zum Volkssport geworden, 21,2 Millionen Musikkonsumenten haben im Jahr 2004 Musik-CD-Rs gebrannt oder brennen lassen. Das ist ein Drittel aller aktiven Musikhörer überhaupt und mehr als zwei Drittel aller Musikkäufer.
Der Kopierschutz soll verhindern, dass digitale Tonträger unautorisiert in großem Umfang weiterkopiert werden, was immer häufiger vorkommt. Massenhaftes Kopieren von Musik ist Diebstahl des geistigen Eigentums von Autoren, Komponisten, Musikern und Tonträgerherstellern. Es entzieht den Urhebern von Musik die Existenzgrundlage. Neue Musiktrends und Newcomerbands kann es nur geben, solange Musik auch gekauft wird und dadurch in die Entwicklung neuer und unbekannter Künstler investiert werden kann. Ansonsten haben neue Talente keine Chance. Nur wenn der illegalen Vervielfältigung von Musik wirksame Maßnahmen entgegengesetzt werden, bleibt die kulturelle Vielfalt der Musikszene erhalten. Dazu trägt der Einsatz von Kopierschutz bei digitalen Tonträgern bei.
Um die derzeitige Marktsituation der Musikindustrie positiv zu verändern, bedarf es einer Lösung, die […]
Die deutsche Musikindustrie muss sich seit dem Jahr 2001 intensiv mit dem Thema Kopierschutz auseinandersetzen. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte hatte 2001 der Markt von digitalen Tonträgern mit minus 10,8 % einen zweistelligen Umsatzverlust zu verzeichnen. 2002/2003 setzten sich die Rückgänge in zweistelliger Höhe fort. Ende 2004 hatte der Tonträgermarkt gegenüber 2000 etwa 40 % seines Volumens eingebüsst. Tonträgerfirmen haben auf die negative Marktentwicklung in den letzten Jahren bereits mit Reorganisationen, Umstrukturierungen und Stellenabbau reagiert. Es haben so viele Unternehmen im Umfeld des Musikmarktes Konkurs anmelden müssen wie noch nie zuvor in so kurzer Zeit. Dazu gehören Promotionagenturen, Handelsbetriebe, Musikunternehmen und Musiklabels. Die Peripherie des Musikgeschäfts mit den Radiostationen, Musikmagazinen, Musikorientierten Fernsehprogrammen, Online-Magazinen und Clubs hat diese Marktentwicklung ebenfalls zu spüren bekommen.
Die wesentliche Ursache für diese Entwicklung wurde durch repräsentative Langzeituntersuchungen der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung), der größten Marktforschungsgesellschaft in Deutschland, belegt: es ist das massenhafte digitale Kopieren von Musik-CDs, der massenhafte Missbrauch der Möglichkeit, Musik-CDs über den PC-Brenner zu klonen. Nur einige Fakten hierzu: Selbstbrennen von Musik-CDs ist zum Volkssport geworden, 21,2 Millionen Musikkonsumenten haben im Jahr 2004 Musik-CD-Rs gebrannt oder brennen lassen. Das ist ein Drittel aller aktiven Musikhörer überhaupt und mehr als zwei Drittel aller Musikkäufer.
Der Kopierschutz soll verhindern, dass digitale Tonträger unautorisiert in großem Umfang weiterkopiert werden, was immer häufiger vorkommt. Massenhaftes Kopieren von Musik ist Diebstahl des geistigen Eigentums von Autoren, Komponisten, Musikern und Tonträgerherstellern. Es entzieht den Urhebern von Musik die Existenzgrundlage. Neue Musiktrends und Newcomerbands kann es nur geben, solange Musik auch gekauft wird und dadurch in die Entwicklung neuer und unbekannter Künstler investiert werden kann. Ansonsten haben neue Talente keine Chance. Nur wenn der illegalen Vervielfältigung von Musik wirksame Maßnahmen entgegengesetzt werden, bleibt die kulturelle Vielfalt der Musikszene erhalten. Dazu trägt der Einsatz von Kopierschutz bei digitalen Tonträgern bei.
Um die derzeitige Marktsituation der Musikindustrie positiv zu verändern, bedarf es einer Lösung, die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9419
Kremer, Oliver: Kopierschutz bei digitalen Tonträgern -
Chancen und Risiken für die deutsche Musikindustrie
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Rheinische Fachhochschule Köln, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
3
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis... 3
Abbildungsverzeichnis... 5
Abkürzungsverzeichnis... 6
1
Einleitung... 8
2
Der Musikmarkt in Deutschland ... 10
2.1
Überblick ... 10
2.2
Definition Tonträger ... 10
2.3
Die Seite der Anbieter von Tonträgern ... 11
2.4
Die Seite der Nachfrager von Tonträgern ... 12
2.5
Das Volumen des deutschen Tonträgermarktes... 14
2.6
Aktuelle Marktsituation der CD ... 15
2.6.1 Rückgang des CD Absatzes ... 16
2.6.2 Anstieg des Absatzes von CD-Rohlingen ... 16
2.6.3 Darstellung der ,,Schere" von CDs und CD-Rs ... 18
3
Das Urheberrecht... 19
3.1
Aufgabe und Funktion des Urheberrechts ... 20
3.2
Das Urheberrecht im Musikbereich... 20
3.2.1 Das Urheberpersönlichkeitsrecht... 21
3.2.2 Das Verwertungsrecht ... 21
3.3
Bedeutung des Urheberrechts für den Einsatz von Kopierschutz ... 23
3.4
Vergütungsregelung... 24
3.5
Novellierung des Urheberrechts im Hinblick auf Kopierschutz ... 25
3.5.1 1. Korb - 13.09.2003 ... 26
3.5.2 2. Korb ... 29
4
Kopierschutz ... 30
4.1
Definition und Notwendigkeit des Kopierschutzes ... 30
4.2
Anwendung von Kopierschutz ... 34
4.3
Digital Rights Management (DRM) ... 34
4.4
Die verschiedenen Kopierschutzverfahren für Musikprogramme ... 35
4.4.1 Macrovision - "CDS-200/200/300" ... 36
4.4.2 Sony DADC Austria AG - "Key2Audio XS" ... 37
4.4.3. SunnComm - "MediaMax Music Management M4" ... 38
4.4.4 First4Internet - "XCP"... 38
4.5
Abspielprobleme ... 40
Inhaltsverzeichnis
4
4.5.1 Darstellung der häufigsten Abspielgerätprobleme ... 41
4.5.1.1 Abspielprobleme bei herkömmlichen Anlagen ... 42
4.5.1.2 Abspielprobleme auf PCs und Macintosh Rechnern... 42
4.5.1.3 Übertragungsprobleme auf mobile Abspielgeräte... 43
4.5.2 "Playability" vs. "Efficiency"... 43
5
Analyse des Einsatzes von Kopierschutzmaßnahmen: die Brenner-
und Kopierschutzstudie 2005 von GfK ... 45
5.1
Auswirkungen des Kopierschutzes auf das Verbraucherverhalten... 45
5.1.1 Verbreitung von CD-/DVD-Brenner und ihre Nutzung ... 45
5.1.1.1 Hardware-Kennzahlen: CD-/DVD-Brenner ... 46
5.1.1.2 Kennzahlen: Bespielte CD-/DVD-Rohlinge mit Musik/Musikvideos ... 47
5.1.2 Wahrnehmung des Kopierschutzes ... 49
5.1.3 Maßnahmen, die das Kopieren von Musik eindämmen können ... 50
5.2
Auswirkungen des Kopierschutzes auf das Musikgeschäft ... 51
5.2.1 Konsumentenverhalten gegenüber kopiergeschützten Musik-CDs ... 51
5.2.2 Kopiergeschützte Musik-CDs... 52
5.2.3 Nicht kopiergeschützte Musik-CDs ... 53
5.2.4 Musikkonsum: Original-CD oder Kopie... 54
6
Strategische Bedeutung des Kopierschutzes... 55
6.1
Kopierschutzmaßnahmen als Strategie der Musikindustrie... 55
6.2
Chancen für den deutschen Musikmarkt durch den Einsatz von
Kopierschutz ... 56
6.3
Risiken für den deutschen Musikmarkt durch den Einsatz von Kopierschutz... 59
6.4
Bewertung aus marktstrategischer Sicht - Empfehlung für die
Musikindustrie ... 61
6.5
Aktuelle Strategien der Musik-Majors ... 64
7
Schluss - Zukunft des Kopierschutzes... 66
Glossar... 68
Literaturverzeichnis... 69
Erklärung ... 74
Abbildungsverzeichnis
5
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gesamtumsatz des Phonomarktes in Deutschland 1995-2004 ... 14
Abbildung 2: Absatz von CDs ... 16
Abbildung 3: Absatz von CD-Rohlingen... 17
Abbildung 4: Mit Musik bespielte Rohlinge und verkaufte CD-Alben ... 18
Abbildung 5: Copy Control Logo ... 31
Abbildung 6: Content Protected Front Cover Logo ... 32
Abbildung 7: Content Protected InfoBox auf kopiergeschützter Audio-CD ... 32
Abbildung 8: Hatten Sie schon einmal Probleme beim Abspielen
kopiergeschützter Musik-CDs? ... 40
Abbildung 9: Falls sie auf einem oder mehreren Geräten schon einmal
kopiergeschützte Musik-CDs abgespielt haben, kam es dabei zu
Abspielproblemen? Wenn ja, bei welchen Geräten kam es zu
Abspielproblemen? ... 41
Abbildung 10: Entwicklung der Haushalts-Ausstattung mit CD-/DVD -Brennern... 46
Abbildung 11: Bespielte CD-/DVD Rohlinge mit Musik/Musikvideos ... 47
Abbildung 12: Ist Ihnen aufgefallen, dass es jetzt Musik-CDs mit Kopierschutz
gibt? ... 49
Abbildung 13: Maßnahmen, die das Kopieren von Musik eindämmen können ... 50
Abbildung 14: Wie verhalten bzw. wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie
bemerken, dass die Musik-CD, die Sie kaufen wollen, einen
Kopierschutz hat? ... 51
Abbildung 15: Bitte geben Sie für jede Musik-CD an, ob Sie diese als Original-CD
oder als Kopie besitzen?... 52
Abbildung 16: Frage:
Bitte geben Sie für jede Musik-CD an, ob Sie diese als
Original-CD oder als Kopie besitzen? ... 53
Abbildung 17: Bitte geben Sie für jede Musik-CD an, ob Sie diese als Original-CD
oder als Kopie besitzen?... 54
Abkürzungsverzeichnis
6
Abkürzungsverzeichnis
AAC
Advanced Audio Coding, Kompressionsverfahren für Musikdateien
Abb. Abbildung
Abs. Absatz
a.F.
alte Fassung (des Gesetzes)
BMJ
Bundesministerium der Justiz
bzw. beziehungsweise
ca. circa
CD Compact
Disc
CD-R
Compact Disc Recordable (Vom Anwender einmal beschreibbares, aber
nicht wieder löschbares optisches Speichermedium)
CD-ROM
Compact Disc-Read Only Memory (Optisches Speichermedium für den
lesenden Zugriff)
CD-RW
Compact Disc Re Writeable (Vom Anwender mehrfach zu
beschreibendes und löschbares optisches Speichermedium)
CDS
Cactus Data Shield
c´t
Magazin für Computertechnik
DAT
Digital Audio Tape
d.h. das
heißt
DRM
Digital Rights Management
DVD
Digital Versatile Disc
etc. et
cetera.
EMI
EMI Music Germany GmbH & Co. KG
n.F.
neue Fassung (des Gesetzes)
GEMA
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte
GfK
Gesellschaft für Konsumforschung
GVL
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
IFPI
International Federation of the Phonographic Industry
MC Musik
Cassette
MD Mini
Disc
Abkürzungsverzeichnis
7
MP3 MPEG-Audio-Layer
3
MPEG
Moving Picture Experts Group
PC Personal
Computer
RefE Referenten
Entwurf
SACD
Super Audio CD
sog. so
genannt
u.a. unter
anderem
UrhG Urheberrechtsgesetz
vgl. vergleiche
WIPO
World Intellectual Property Organization
WMA
Windows Media Audio, Kompressionsverfahren für Musikdateien
z.B. zum
Beispiel
Ziff. Ziffer
1. Einleitung
8
1. Einleitung
Die deutsche Musikindustrie muss sich seit dem Jahr 2001 intensiv mit dem Thema
Kopierschutz auseinandersetzen. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte hatte
2001 der Markt von digitalen Tonträgern mit minus 10,8 % einen zweistelligen
Umsatzverlust zu verzeichnen.
1
2002/2003 setzten sich die Rückgänge in zweistelliger
Höhe fort. Ende 2004 hatte der Tonträgermarkt gegenüber 2000 etwa 40 % seines
Volumens eingebüsst.
2
Tonträgerfirmen haben auf die negative Marktentwicklung in
den letzten Jahren bereits mit Reorganisationen, Umstrukturierungen und Stellenabbau
reagiert. Es haben so viele Unternehmen im Umfeld des Musikmarktes Konkurs
anmelden müssen wie noch nie zuvor in so kurzer Zeit. Dazu gehören
Promotionagenturen, Handelsbetriebe, Musikunternehmen und Musiklabels. Die
Peripherie des Musikgeschäfts mit den Radiostationen, Musikmagazinen,
Musikorientierten Fernsehprogrammen, Online-Magazinen und Clubs hat diese
Marktentwicklung ebenfalls zu spüren bekommen.
Die wesentliche Ursache für diese Entwicklung wurde durch repräsentative
Langzeituntersuchungen der GfK (Gesellschaft für Konsumforschung), der größten
Marktforschungsgesellschaft in Deutschland, belegt: es ist das massenhafte digitale
Kopieren von Musik-CDs, der massenhafte Missbrauch der Möglichkeit, Musik-CDs
über den PC-Brenner zu klonen. Nur einige Fakten hierzu: Selbstbrennen von Musik-
CDs ist zum ,,Volkssport" geworden, 21,2 Millionen Musikkonsumenten haben im Jahr
2004 Musik-CD-Rs gebrannt oder brennen lassen.
3
Das ist ein Drittel aller aktiven
Musikhörer überhaupt und mehr als zwei Drittel aller Musikkäufer.
4
Der Kopierschutz soll verhindern, dass digitale Tonträger unautorisiert in großem
Umfang weiterkopiert werden, was immer häufiger vorkommt. Massenhaftes Kopieren
von Musik ist Diebstahl des geistigen Eigentums von Autoren, Komponisten, Musikern
und Tonträgerherstellern. Es entzieht den Urhebern von Musik die Existenzgrundlage.
Neue Musiktrends und Newcomerbands kann es nur geben, solange Musik auch
gekauft wird und dadurch in die Entwicklung neuer und unbekannter Künstler investiert
werden kann. Ansonsten haben neue Talente keine Chance. Nur wenn der illegalen
Vervielfältigung von Musik wirksame Maßnahmen entgegengesetzt werden, bleibt die
1
Vgl. Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2005): Jahrbuch 2005; S.12.
2
Vgl. Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2005): Jahrbuch 2005; S.12.
3
Vgl. GfK (2005): Brenner-Studie 2005; S.35.
4
Vgl. GfK (2005): Brenner-Studie 2005; S.32.
1. Einleitung
9
kulturelle Vielfalt der Musikszene erhalten. Dazu trägt der Einsatz von Kopierschutz bei
digitalen Tonträgern bei.
Um die derzeitige Marktsituation der Musikindustrie positiv zu verändern, bedarf es
einer Lösung, die für Industrie wie auch Konsumenten gleichermaßen attraktiv ist. Die
immer besseren und sichereren Kopierschutzverfahren werden die Musikkonsumenten
hoffentlich vom Brennen digitaler Tonträger abhalten; aber die Frage ist, ob dies die
Konsumenten auch wieder zum vermehrten Kauf von Musik-CDs bewegen wird.
Absicht dieser Diplomarbeit ist es, die Chancen und Risiken für den deutschen
Musikmarkt durch den Einsatz von Kopierschutz bei digitalen Tonträgern aufzuzeigen.
Dem Einleitungskapitel folgt zunächst die Darstellung des Musikmarktes in
Deutschland und dessen aktuelle Marktsituation.
Weiterhin stellt die Diplomarbeit das Urheberrecht und speziell die themenrelevanten
Änderungen durch die Novellierung des Urheberrechts dar, welche die rechtliche Basis
für den Kopierschutz bilden.
Im vierten Kapitel wird explizit auf das Thema Kopierschutz eingegangen.
Die Analyse der GfK Brenner- und Kopierschutzstudie 2005 schließt sich an, so dass
der Autor anhand ihrer aussagekräftigen Daten die Auswirkung des Kopierschutzes
sowohl auf das Verbraucherverhalten als auch auf das Musikgeschäft darstellt, um im
sechsten Kapitel die strategische Bedeutung des Kopierschutzes hervorzuheben.
Das siebte und letzte Kapitel gewährt noch einen Ausblick in die Zukunft des Kopier-
schutzes.
2. Der Musikmarkt in Deutschland
10
2. Der Musikmarkt in Deutschland
2.1. Überblick
Da der Fokus dieser Arbeit auf dem deutschen Musikmarkt liegt, erfolgt nun eine kurze
Einführung in den Musikmarkt in Deutschland.
Innerhalb des Europäischen Musikmarktes, neben den USA dem zweitgrößten der Welt,
zählt der deutsche Musikmarkt mit Frankreich und Großbritannien zu den führenden
Märkten. Zusammen mit den übrigen vier bedeutenden Musikmärkten USA, Japan,
Großbritannien und Frankreich macht der deutsche Musikmarkt allein 76 Prozent des
Tonträger-Umsatzes der Welt aus.
5
Doch Deutschland liegt im internationalen Vergleich nicht nur im Hinblick auf den Konsum
unter den Top-Fünf. Auch Produktionen aus Deutschland sind in den letzten Jahren
sowohl auf nationaler, als auch auf internationaler Ebene in großer Anzahl und erfolgreich
in den Charts vertreten, so dass Deutschland mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.
6
Der Tonträgermarkt setzt sich, nach der klassischen ökonomischen Rollenverteilung
eines Marktes, zusammen aus den Anbietern (Musik-Labels), dem Tonträger-Handel
(Absatzmittler) und den Nachfragern (Musik-Konsumenten), die die Tonträger schließlich
kaufen.
7
2.2. Definition Tonträger
,,Tonträger sind technische Systeme zur Konservierung von Musik. Sie sind die ,,Software"
zur ,,Hardware" der Abspielgeräte."
8
Unterschieden wird zwischen Tonträgern, die als
Leermedium (Leerkassetten, CD-Rohlinge etc.) angeboten werden und der selbst-
ständigen Bespielung durch den Konsumenten dienen und Tonträger, die bereits mit Ton,
Bild oder auch Daten bespielt sind.
Die Musikindustrie produziert und vermarktet zwei unterschiedliche Arten von bespielten
Tonträgern: auf der einen Seite die von den Ursprüngen der Tonträger bis in die heutige
5
Vgl. Stein (2003): Music made in Germany, in: Handbuch der Musikwirtschaft; S.37
6
Vgl. Jahrbuch der Phonographischen Wirtschaft (2005): Der Musikmarkt konsolidiert sich; S.5-
6.
7
Vgl. Mahlmann (2005): EMI Fachlexikon für den Tonträgerhandel; Markt.
8
Vgl. Mahlmann (2005): EMI Fachlexikon für den Tonträgerhandel; Tonträger.
2. Der Musikmarkt in Deutschland
11
Zeit gängigste und immer wieder aktualisierte Form der Platte (Vinyl-Schallplatte, CD,
MD, SACD, DVD) und auf der anderen Seite das Magnetband (MC, DAT).
Die größte Hoffnung setzt die Musikindustrie mittlerweile auf das Tonträgerformat DVD-
Audio (Digital Versatile Disc). Die DVD liegt nicht nur aufgrund von guter Marktakzeptanz
von Konsumentenseite und steigenden Verkaufszahlen voll im Trend. Sie bietet eine
Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten von Audio- und Video-Inhalten, über Dateninhalte und
eine außergewöhnlich hohe Speicherkapazität. Die DVD bietet das, was der CD
(Compact Disc) fehlt. Sie hat das Potenzial der multiplen Einsetzbarkeit, sowohl im
Hinblick auf Vermarktungsansätze, als auch besonders im Hinblick auf Kapazität und
Inhalte.
Die Super-Audio-CD (SACD) ist, neben der DVD-Audio, eines der Nachfolgemedien
zur Audio-CD und eine spezielle Form der Digital Versatile Disc (DVD). Auf der Super-
Audio-CD sind nur Toninformationen gespeichert wie Musik, Sprache, Klänge oder
Geräusche.
Im Gegensatz zur DVD-Audio kann der Tonträger CD, trotz digitaler Technologie, die der
Audio-CD ebenfalls eine Kopplung mit multimedialen, interaktiven Inhalten ermöglicht,
nicht so vielfältig genutzt werden. Darüber hinaus sind Audio-CDs wesentlich einfacher zu
kopieren als DVDs, da die Hardware und Software dazu billiger, weiter verbreitet und der
Kopiervorgang mit weniger (finanziellem) Aufwand verbunden ist.
Grundsätzlich können die verschiedenen Tonträgerarten aber nicht nur nach Form,
Qualität und Kapazität differenziert werden, sondern auch nach Aufnahmeverfahren
(analog und digital).
2.3. Die Seite der Anbieter von Tonträgern
Die Anbieterseite wird vertreten durch die Plattenfirmen (Labels), die Tonaufnahmen
vervielfältigen, verbreiten, promoten und verkaufen
9
, um die Nachfragerseite zu bedienen
und damit Umsatz zu generieren. Obwohl in Deutschland mehr als 2500 Labels
existieren, hat sich der Haupt-Marktanteil des deutschen Tonträgermarktes mittlerweile
auf die vier größten Musikkonzerne konzentriert, die in den letzten 20 Jahren viele große
und kleine Labels übernahmen und eingliederten. Diese, auch Majors genannt, sind
deutsche Tochtergesellschaften von international organisierten und tätigen
Großkonzernen mit einem gemeinsamen Marktanteil von ca. 75 Prozent auf dem
deutschen Musikmarkt. Dazu gehören in alphabetischer Reihenfolge: ,,EMI Music
9
Vgl. Lyng (2002): Die Praxis im Musikbusiness; S.18.
2. Der Musikmarkt in Deutschland
12
Germany", zur EMI-Group gehörend, ,,SONY-BMG MUSIC ENTERTAINMENT
(Germany)", dass der Bertelsmann AG und der Sony Corporation of America jeweils
zur Hälfte gehört, ,,UNIVERSAL Music Germany", ist Teil des Vivendi-Universal-
Konzerns und ,,WARNER Music Germany", gehört zu der Warner Music Group.
10
Kleinere Musiklabels wie z.B. ,,Edel", ,,Indigo", ,,SPV" oder ,,Alive" kämpfen um die
restlichen Marktanteile des deutschen Musikmarktes.
2.4. Die Seite der Nachfrager von Tonträgern
Nach der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) kann der Markt mit ca. 64 Mio.
möglichen Konsumenten
11
von momentan etwa 82,5 Mio. Einwohnern in Deutschland
12
rechnen. Da aber nicht jeder Konsument gleichzeitig auch potenzieller Käufer ist, liegt
die Käuferreichweite bei durchschnittlich 50 Prozent. So unterteilt sich die
Nachfrageseite also in ca. 32 Mio. aktive Käufer und ca. 32 Mio. Nichtkäufer (jährliche
Fluktuationen sind zu berücksichtigen). Unter den aktiven Käufern ist es wichtig,
zwischen den Kaufintensitätsklassen zu differenzieren:
13
1. die Intensivkäufer (10-19 Tonträger pro Jahr), die lediglich 10% der
Bevölkerung und zwei Drittel der gesamten Nachfrage ausmachen
2. die Durchschnitts- oder auch Gelegenheitskäufer (4-9 Tonträger pro
Jahr), die ein Drittel der gesamten Nachfrage abdecken
Die Nachfragerseite ist aber nicht nur nach Kaufintensitätsklassen, sondern auch nach
Einstellung im Hinblick auf Kopierschutztechnologien zu charakterisieren, was für das
Thema dieser Arbeit zu berücksichtigen ist. Es wird zwischen folgenden
Nachfragertypen unterschieden:
Die ,,Nicht-Versteher", die Sinn und Funktion des Kopierschutzes nicht nachvollziehen
können und generell nicht verstehen, warum sie viel Geld für Tonträger und auch
10
Vgl. Mahlmann (2003): Struktur des deutschen Tonträgermarktes, in: Handbuch der
Musikwirtschaft; S.194ff.
11
Vgl. GfK (2005): Brenner-Studie 2005; S.4.
12
Vgl. www.destatis.de (2005): Einwohner und Erwerbsbeteiligung (Inländerkonzept)
Deutschland.
13
Vgl. Mahlmann (2003): Struktur des deutschen Tonträgermarktes, in: Handbuch der
Musikwirtschaft; S.200ff.
2. Der Musikmarkt in Deutschland
13
mittlerweile MP3s ausgeben sollten, da doch alles auch fast umsonst, wenn auch
illegal, erhältlich ist.
Die ,,Versteher", denen das aktuelle Problem und damit der Grund für das Handeln der
Musikindustrie bewusst ist und deshalb den Kopierschutz als nötiges Mittel
akzeptieren.
Und letztendlich diejenigen, die den Grund und die Notwendigkeit ebenfalls verstehen,
sich jedoch trotzdem nicht in der Nutzung von Tonträgern einschränken lassen und
unter den Kopierschutztechnologien leiden wollen.
14
14
nach Mahlmann (2005): persönliches Interview.
2. Der Musikmarkt in Deutschland
14
2.5. Das Volumen des deutschen Tonträgermarktes
Das Marktvolumen des deutschen Tonträgermarktes wird jährlich vom Fachausschuss
für Marktforschung und Prognose der Musikindustrie in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft berechnet, um die Größe des
Marktes darzustellen. Unterschieden wird zwischen dem mengenmäßigen
Marktvolumen (in Stück) und dem wertmäßigen Marktvolumen (in Euro).
15
Zur
Darstellung des Marktvolumens des deutschen Tonträgermarktes wird an dieser Stelle
die wertmäßige Darstellung genutzt, um den Umsatzeinbruch der letzten Jahre
herauszustellen. Hier wird zwischen den Mitgliedern des Bundesverbandes und
Sonstigen differenziert.
*seit 2002 inkl. Musikvideo (DVD und VHS) und seit 2004 inkl. Downloads
Abb. 1:
Gesamtumsatz des Phonomarktes in Deutschland 1995-2004
16
Abb. 1 zeigt den deutlichen zunehmenden Umsatzeinbruch von verkauften Tonträgern
ab dem Jahr 2001, der sich seit 1998 leicht andeutete. Schon für das Jahr 2001 wurde
ein erheblicher Umsatzrückgang um 10,8%
17
, für 2002 um 7,5%
18
und für 2003 mit
15
Vgl. Mahlmann (2005): EMI Fachlexikon für den Tonträger-Handel; Marktvolumen.
16
Eigene Darstellung / in Anlehnung an Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft
(2005): Jahrbuch 2005; S.11, Abbildung 1.
17
Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2005): Jahrbuch 2005; S.12.
2393
2472
2587
2574
2500
2490
2220
2054
1648
1589
135
140
158
165
168
145
148
161
235
286
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
in Mio. Euro
Verbandsstatistik
Sonstige Marktteilnehmer
2. Der Musikmarkt in Deutschland
15
19,8%
19
der bis dahin stärkste Umsatzrückgang in der Geschichte der Phonwirtschaft
errechnet. Im Jahr 2004 stabilisierte sich der Musikmarkt. Der Umsatz sank ,,nur" noch
um 3,6%
20
von 1,648 Milliarden Euro im Jahr 2003 auf 1,589 Milliarden im Jahr 2004.
2.6. Aktuelle Marktsituation der CD
Die aktuelle Marktsituation der CD spiegelt die fatalen Auswirkungen der in einem
immensen Maße gestiegenen Bedrohung des Musikmarktes durch die Nutzung von
CD-Rs, bzw. CD-Brennern und illegalen Downloads über das Internet wieder. Denn die
Schere zwischen verkauften CD-Alben und mit Musik kopierten Rohlingen geht stetig
immer weiter auseinander, wie folgende Abbildungen belegen. Der Grund für die
dermaßen schlechte Marktsituation ist also nicht das fehlende Interesse der
Konsumenten, sondern die massenhafte Nutzung von CD-Brennern zur Erstellung von
selbstgefertigten Privatkopien. Es wurden 2004 fast dreimal so viele mit Musik
bespielte CD-Rohlinge (316 Mio. Stück) wie CD-Alben (133,1 Mio. Stück) verkauft.
21
18
Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2003): Jahreswirtschaftsbericht 2002;
S.16.
19
Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2004): Jahrbuch 2004; S.7.
20
Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2005): Jahrbuch 2005; S.12.
21
Vgl. Jahrbuch der Phonographischen Wirtschaft (2005): Jahreswirtschaftsbericht 2004; S.11.
2. Der Musikmarkt in Deutschland
16
2.6.1. Rückgang des CD Absatzes
176,9
184,5
198
195,1
173,3
166,8
196,9 196,5
133,6 133,1
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
in
M
io
. S
tü
c
k
Absatz von CDs
Abb. 2:
Absatz von CDs
22
Abb. 2 veranschaulicht den generellen Absatzrückgang der CDs seit dem Jahr 2000,
den der Tonträgermarkt zu verzeichnen hat. Erstmals seit Jahren ist der Absatz von
CD-Alben im Jahr 2004 mit 133,1 Mio. Stück (-0,4%) im Vergleich zum Vorjahr
praktisch konstant.
2.6.2. Anstieg des Absatzes von CD-Rohlingen
Mehr als die Hälfte aller Deutschen hat Zugriff auf einen CD-Brenner und nutzt ihn
auch: Im Jahr 2004 wurden 688 Mio. CD-Rohlinge an private Haushalte verkauft,
während es 2003 noch rund 702 Mio. waren. Der Absatz von CD-Rohlingen sank zwar
leicht um 14 Millionen, wurde aber durch die Zunahme abgesetzter DVD-Rohlinge um
97 Mio.
23
, im gleichen Zeitraum, mehr als ausgeglichen: Da DVDs eine achtfach
größere Speicherkapazität als CDs haben, wiegt dieser Effekt besonders schwer, denn
auf einen DVD-Rohling können acht CD-Alben oder viele hundert MP3-Dateien
22
Eigene Darstellung / in Anlehnung an Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft
(2005): Jahrbuch 2005; S.27; Abbildung 16.
23
Vgl. Bundesverband der Phonographischen Wirtschaft (2005): Jahrbuch 2005; S.18.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832494193
- ISBN (Paperback)
- 9783838694191
- DOI
- 10.3239/9783832494193
- Dateigröße
- 773 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinische Fachhochschule Köln – Wirtschaft und Recht
- Erscheinungsdatum
- 2006 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- musikmarkt deutschland urheberrecht kopierschutz brenner- kopierschutzstudie strategische bedeutung
- Produktsicherheit
- Diplom.de