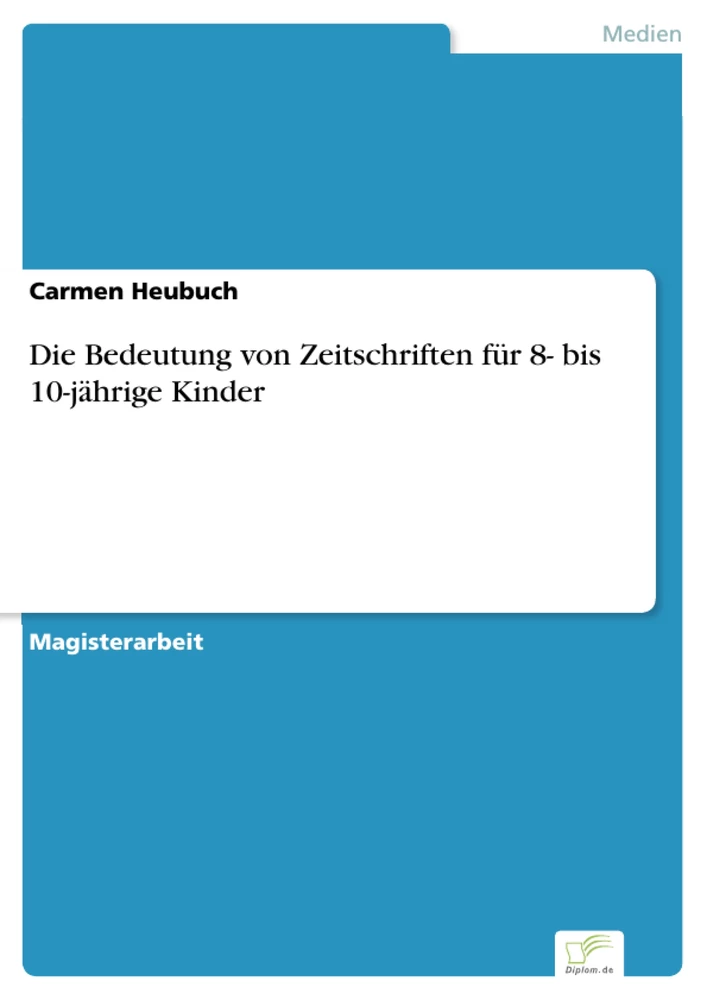Die Bedeutung von Zeitschriften für 8- bis 10-jährige Kinder
Zusammenfassung
Zeitschriften und Kinder - ein Thema, das in der Forschung nur wenig Beachtung findet. Was die Zeitschrift leisten kann, zum Beispiel den Kindern ein Fenster zur Welt zu öffnen, ihnen Wissen und Anregungen vermitteln, darüber findet nur wenig Diskussion statt. Abgesehen von den Interessen des Zeitschriftenmarktes, der hauptsächlich das Konsumverhalten ermittelt, wurde die Zeitschriftenforschung bisher insgesamt und vor allem in Bezug auf Kinder stark vernachlässigt. Das Fernsehen, aber auch immer mehr Analysen interaktiver Medien wie Computer und Videospiele stehen stattdessen im Mittelpunkt zahlreicher Untersuchungen. Generell überwiegen Wirkungsfragen gegenüber Analysen über die Medienbedürfnisse der Kinder. Diese Forschungsschwerpunkte verwundern nicht, hält man sich die starke Veränderung des Medienangebotes in den letzten Jahren vor Augen, die vor allem bei Kindern auf große Begeisterung trifft: Sie surfen im World Wide Web, zappen durch ein sehr viel üppiger gewordenes Programmangebot und spielen an ihrer Playstation oder Gamecube.
Lydia allerdings lässt sich von diesen Entwicklungen auf dem Medienmarkt nicht davon abbringen, auf dem Weg zum Bäcker einen Umweg über die Apotheke einzuschlagen, um sich und ihrem Bruder die neueste Ausgabe der an Kinder gerichteten Kundenzeitschrift 'Medizini' zu besorgen. Ihre von neuen Medienangeboten ungetrübte Freude an der Zeitschrift unterscheidet sie nicht von anderen Kindern ihres Alters: Mehr als jedes zweite 6- bis 13-Jährige Kind hat mehrmals pro Woche eine Zeitschrift in der Hand, hinzu kommt bei knapp der Hälfte der Kinder ein Comic-Heftchen. Der auf dem deutschen Kinderzeitschriftenmarkt dominierende Egmont Ehapa Verlag konnte seine verkaufte Auflage in den letzten vier Jahren um 15 Prozent steigern.
Wie kann die Zeitschrift vor dem Hintergrund steigender intermedialer Konkurrenz bestehen? Welche Bedeutung hat sie nach wie vor für die Kinder? Diesen Fragen möchte ich im Rahmen dieser Forschungsarbeit nachgehen.
Ich konzentriere mich dabei auf 8- bis 11-jährige Kinder in der Lebensphase der 'mittleren Kindheit': Vom lesefähigen Alter bis zur beginnenden Pubertät. Die Kinder setzen sich meinen Annahmen zu Folge aktiv mit den Angeboten der Zeitschrift auseinander, holen sich aus ihnen heraus, was sie brauchen und verwerten können. Das ist oft etwas anderes als das, was Erwachsene in diesen Angeboten sehen. Denn die Bedeutung der Zeitschrift für Kinder unterscheidet sich […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die 8- bis 11-Jährigen
2.1 Die Persönlichkeitsentwicklung
2.2 Interne Entwicklungsdimensionen
2.3 Externe Entwicklungsdimensionen
3 Kinder und Zeitschriften
3.1 Die Kinderzeitschrift
3.2 Der Kinderzeitschriftenmarkt
3.3 Die Nutzung der Kinderzeitschrift
4 Motivationale Ansätze zur Mediennutzung von Kindern
4.1 Uses-and-Gratifications-Approach mit Nutzen-Ansatz
4.2 Para-soziale Interaktion
4.3 Affektive Erlebensformen der Unterhaltung
4.4 Kognitive Erlebensformen der Unterhaltung
4.5 Unterhaltung als Spiel
4.6 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse
4.7 Das Struktur- und Prozessmodell der Medienrezeption
5 Integration der theoretischen Ansätze und Erschließung des Untersuchungsfeldes
6 Methode und Design der Studie
6.1 Diskussion der Methode
6.2 Das Leitfadeninterview
6.3 Durchführung der Untersuchung
6.4 Auswahl und Vorstellung der Interviewpartner
6.5 Transkription und Auswertung
7 Die Zeitschriftennutzung der 8- bis 11-Jährigen
8 Affektive und kognitive Gratifikationen
8.1 Spaß
8.2 Action und Spannung
8.3 Ästhetisch-sinnliche Anregung
8.4 Kognitive Anregung
8.5 Strukturierung des Alltags
8.6 Langeweile
8.7 Auszeit vom Alltag
8.8 Zusammenfassung
9 Handlungsleitende Themen
9.1 Erfahren und Lernen
9.2 Die Entwicklung des 'weiblichen' oder 'männlichen' Sozialcharakters
9.3 Selbstständigkeit und Geborgenheit
9.4 Zusammenfassung
10 Zeitschriftenspezifische Gratifikationen
10.1 Inhaltliche Gestaltung nach spezifischen Leserinteressen
10.2 Formale Gestaltung nach spezifischen Leserinteressen
10.3 Periodizität
10.4 Universalität und Disponibilität
10.5 Geringe Zugangsschwelle
10.6 Zusammenfassung
11 Typologie
11.1 Die Sozialen
11.2 Die Kämpfer
11.3 Die Wissbegierigen
11.4 Die Erlebnishungrigen
11.5 Die Nesthäkchen
11.6 Positionierung der Typen im Merkmalsraum
12 Fazit und Ausblick
Literatur- und Quellenverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Anhang I – Informationsblatt
Anhang II – Kurzfragebogen
Anhang III – Anschreiben
Anhang IV – Standardisierter Fragebogen
Anhang V – Leitfaden
Anhang VI – Zeitschriftenporträts
Anhang VII – Transkriptionen
1 Einleitung
"Also immer, zum Beispiel wenn ich Brezeln holen soll, dann gehe ich immer gleich in die Apotheke rein und frage, ob es neue Medizinis gibt... und halt jeden Monat neu gibt es wieder welche... apropos jeden Monat neu, ich könnte mir mal wieder welche holen." (Lydia, 9 Jahre, 131)
Zeitschriften und Kinder ‑ ein Thema, das in der Forschung nur wenig Beachtung findet. Was die Zeitschrift leisten kann, zum Beispiel den Kindern ein Fenster zur Welt zu öffnen, ihnen Wissen und Anregungen vermitteln, darüber findet nur wenig Diskussion statt. Abgesehen von den Interessen des Zeitschriftenmarktes, der hauptsächlich das Konsumverhalten ermittelt, wurde die Zeitschriftenforschung bisher insgesamt und vor allem in Bezug auf Kinder stark vernachlässigt. (Meyen, 2004, S. 197; Mädler, Plath, 2000, S. 170) Das Fernsehen, aber auch immer mehr Analysen interaktiver Medien wie Computer und Videospiele stehen stattdessen im Mittelpunkt zahlreicher Untersuchungen. Generell überwiegen Wirkungsfragen gegenüber Analysen über die Medienbedürfnisse der Kinder. (Mädler, Plath, 2000, S. 169-171) Diese Forschungsschwerpunkte verwundern nicht, hält man sich die starke Veränderung des Medienangebotes in den letzten Jahren vor Augen, die vor allem bei Kindern auf große Begeisterung trifft: Sie surfen im World Wide Web, zappen durch ein sehr viel üppiger gewordenes Programmangebot und spielen an ihrer Playstation oder Gamecube. (Böck, 2000, S. 184; 'Kinder und Medien 2003'; 'KIM-Studie 1999; 2000; 2002; 2003)
Lydia allerdings lässt sich von diesen Entwicklungen auf dem Medienmarkt nicht davon abbringen, auf dem Weg zum Bäcker einen Umweg über die Apotheke einzuschlagen, um sich und ihrem Bruder die neueste Ausgabe der an Kinder gerichteten Kundenzeitschrift 'Medizini' zu besorgen. Ihre von neuen Medienangeboten ungetrübte Freude an der Zeitschrift unterscheidet sie nicht von anderen Kindern ihres Alters: Mehr als jedes zweite 6- bis 13-Jährige Kind hat mehrmals pro Woche eine Zeitschrift in der Hand, hinzu kommt bei knapp der Hälfte der Kinder ein Comic-Heftchen ('KIM-Studie 2003'). Der auf dem deutschen Kinderzeitschriftenmarkt dominierende Egmont Ehapa Verlag konnte seine verkaufte Auflage in den letzten vier Jahren um 15 Prozent steigern (IVW/PZ-Online; Hansen, 2005, S. 52).
Wie kann die Zeitschrift vor dem Hintergrund steigender intermedialer Konkurrenz bestehen? Welche Bedeutung hat sie nach wie vor für die Kinder? Diesen Fragen möchte ich im Rahmen dieser Forschungsarbeit nachgehen.
Ich konzentriere mich dabei auf 8- bis 11-jährige Kinder in der Lebensphase der 'mittleren Kindheit': Vom lesefähigen Alter bis zur beginnenden Pubertät. Die Kinder setzen sich meinen Annahmen zu Folge aktiv mit den Angeboten der Zeitschrift auseinander, holen sich aus ihnen heraus, was sie brauchen und verwerten können. Das ist oft etwas anderes als das, was Erwachsene in diesen Angeboten sehen. Denn die Bedeutung der Zeitschrift für Kinder unterscheidet sich erheblich von der für Erwachsene: die Wünsche, die sie an die Zeitschrift herantragen, die Bedürfnisse, die sie durch sie befriedigen, die Erfahrungen, die sie dabei gewinnen und auf ihren Alltag übertragen – all das folgt eigenen Strukturen. Wer die Zeitschriftenvorlieben von Kindern verstehen will, wissen will, womit sie zusammenhängen und was Zeitschriften für Kinder bedeuten, muss meinen Annahmen zu Folge die Zeitschrift und ihre Angebote durch die Augen der Kinder sehen. Ein verstehender Zugang der auch den Lebenskontext der Kinder miteinschließt schien mir deshalb unumgänglich. Medienrezeption muss, wie es Charlton und Neumann (1986) herausgestellt haben, im Kontext erforscht werden, das heißt der Forscher muss "in jedem einzelnen Fall die Lebensumstände des Medienkonsumenten, seine Probleme und Bedürfnisse, seine Bewältigungsstrategien und persönlichen Begrenzungen kennenlernen [...]" (S. 12). Der Untersuchungsschwerpunkt dieser Arbeit liegt bei den handlungsleitenden Themen der Kinder, die entsprechend den theoretischen Annahmen der Auseinandersetzung mit der Zeitschrift zu Grunde liegen. Sie entstehen zum einen aus den Entwicklungs- und Sozialisationsprozessen von Kindern, zum anderen auf ihrem jeweiligen Lebenshintergrund und konstituieren und prägen die Wahrnehmungen und Handlungen, die Interpretationen und Bedeutungszuschreibungen der Kinder[1]. Kinder suchen nach Wissen und Kompetenzen, um ihre handlungsleitenden Themen zu bearbeiten und sich dadurch weiterentwickeln zu können. Die Bedeutung der Zeitschrift wird demnach davon beeinflusst, inwieweit den Kindern das von der Zeitschrift bereitgestellte Material dazu geeignet erscheint, ihre Themen zu bearbeiten.
Mit der Hervorhebung der Bedeutung der Zeitschrift für die Identitätsentwicklung der Kinder soll die Rolle der Zeitschrift als Unterhaltungsmedium allerdings nicht vernachlässigt werden. Spaß, Spannung und Action, aber auch kognitive Erlebensformen der Unterhaltung können den zu Grunde gelegten Annahmen zu Folge eine entscheidende Rolle bei der Zeitschriftennutzung der Kinder spielen.
Die von den Kindern genutzte Medienvielfalt lässt außerdem erwarten, dass sich die Funktionszuweisungen und Erwartungen an die einzelnen Medien recht deutlich voneinander abgrenzen und auch die Zeitschrift von den Kindern sehr gezielt genutzt wird (Böck, 2000, S. 184). So könnten gerade bei den Jüngeren der Untersuchungsgruppe die Lesemotivation und das Leseinteresse eng verknüpft sein mit dem Lesefähigkeitserwerb. Kinder, die gerade erst das Lesen gelernt haben, sind vermutlich nicht nur motivierter, es anzuwenden, sie legen wahrscheinlich auch größeren Wert auf abwechslungsreiche, kurzweilige und mit einer Vielzahl von Fotos und Bildern durchsetzte Literatur. Im leichten Zugang zur Zeitschrift und ihrer ständigen raum-zeitlichen Verfügbarkeiten lassen sich weitere medienspezifische Vorteile für die Kinder erahnen. (Sommer, 1994, S. 24-27; Mädler, Plath, 2000, S. 169-170) Anders als der Hörfunk, das Fernsehen oder das Internet kann die Zeitschrift außerdem durch die gezielte Einschränkung auf eine Zielgruppe die inhaltliche und formale Gestaltung den spezifischen Leserbedürfnissen und ‑interessen der Kinder anpassen, woraus weitere Vorteile für die Zeitschrift entstehen können (Sommer, 1994, S. 24-27; Vogel, 2002, S. 12).
Die vorliegende Studie gliedert sich in zwei große Teile, den theoretischen und den praktischen Teil. Da die 8- bis 11-jährigen Kinder im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen, widme ich mich in Kapitel 2 zuerst ihnen. Nach einer Einordnung der Untersuchungsgruppe in die Entwicklungsphase der 'mittleren Kindheit' gilt mein Interesse der persönlichen und sozialen Identitätsentwicklung und der aus ihr heraus entstehenden handlungsleitenden Themen der Kinder, die in ihrer Auseinandersetzung mit der Zeitschrift von Relevanz sein könnten. In Kapitel 3 'Kinder und Zeitschriften' gehe ich dann auf das Genre der Kinderzeitschriften ein. Dabei muss erst grundlegend definiert werden, was Kinderzeitschriften sind. Außerdem wird zusammengefasst, welche Segmente es auf diesem Markt gibt und nach welchen Merkmalen diese eingeteilt werden. Nach diesen definitorischen Grundlagen folgt eine kurze Schilderung des Kinderzeitschriftenmarktes. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über die Forschung, die bis dato zur Nutzung der Kinderzeitschrift betrieben worden ist, sowie einer kurzen Darstellung des Stellenwerts der Kinderzeitschrift im intramedialen Vergleich.
Die theoretischen Grundlagen der Arbeit sind die in Kapitel 4 dargestellten motivationalen Ansätze, auf die zur Erklärung der Motive im empirischen Teil zurückgegriffen wird. Ausgangspunkt ist der 'Uses-and-Gratifications-Approach' mit der Annahme eines aktiv handelnden Rezipienten. Dieser kann sich den dieser Arbeit zu Grunde gelegten Annahmen zu Folge in Form 'Para-sozialer Interaktion' mit dem Zeitschriftenangebot auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung kann zu affektiven oder kognitiven Erlebensformen der Unterhaltung führen. Lässt sich das Kind darüber hinaus auf eine spielerische Auseinandersetzung mit der medialen Lebenswelt ein, kann es die Zeitschrift zur Lebensbewältigung nutzen, wie in den Kapiteln 'Unterhaltung als Spiel' und 'Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse' gezeigt wird. Das 'Prozess- und Strukturmodell der Medienrezeption' geht darüber hinaus auf den persönlichen und sozialen Kontext ein, in den die Medienrezeption eingebettet ist. Das Modell gibt zudem Aufschluss über die unterschiedlichen Phasen des medialen Rezeptions- und Aneignungsprozesses.
Im zweiten Teil der Arbeit, dem empirischen Teil, findet in Kapitel 5 zunächst eine Integration der motivationalen Ansätze statt. Hieraus ergeben sich die Forschungsfragen, die im Rahmen dieses Kapitels vorgestellt werden. Da die Bedeutung von Zeitschriften für 8- bis 11-Jährige noch weitgehend unerforscht ist, muss für die vorliegende Untersuchung eine Methode angewandt werden, die ein hohes exploratives Potential aufweist. In Kapitel 6 wird hierfür die qualitative Methode des Leitfadeninterviews gewählt. Anschließend wird das Design der Studie erläutert. Hierfür wird die Konzeption des Leitfadens, die Auswahl der 22 befragten Kinder und die Durchführung der Untersuchung geschildert sowie die Auswertungsstrategie der Interviews transparent gemacht. Daran schließt sich die Auswertung an. In Kapitel 7 wird die Zeitschriftennutzung der untersuchten Kinder transparent gemacht. Kapitel 8 arbeitet die affektiven und kognitiven Bedürfnisse heraus, welche die untersuchten Kinder mit Hilfe ihrer Lieblingszeitschrift befriedigen. Kapitel 9 geht auf die handlungsleitenden Themen ein, für deren Bearbeitung sich die Kinder der Zeitschrift zuwenden. In Kapitel 10 widme ich mich dann den Gratifikationen, welche die untersuchten Kinder in besonderer Weise vom Medium Zeitschrift erhalten.
Die in den Kapiteln 8 und 9 gefundenen Motive fungieren als Grundlage für eine Typologie der untersuchten 8- bis 11-jährigen Kinder, die ich in Kapitel 11 vorstelle. Als Basis für zukünftige Forschungsarbeiten werden schließlich in Kapitel 12 die markantesten Ergebnisse zur Bedeutung von Zeitschriften für Kinder präsentiert.
2 Die 8- bis 11-Jährigen
Ausgangs- und Kernpunkt meiner Arbeit sind die Kinder, und zwar, altersmäßig eingegrenzt, die 8- bis 11-Jährigen. In diesem Rahmen gilt mein Interesse der Persönlichkeitsentwicklung und dabei speziell den internen und externen Dimensionen dieser Entwicklung und den daraus sich ableitenden handlungsleitenden Themen, die für die Zeitschriftennutzung der Kinder dieser Alterstufe Relevanz haben können. Ohne die Reflexion dieser handlungsleitenden Themen lässt sich der spezifische Umgang von Kindern mit Medien, im vorliegenden Fall mit Zeitschriften, nicht verstehen. Sie stellen die zentrale Grundlage der vielfältig dimensionierten Auseinandersetzung mit Medienangeboten dar.
Im Rahmen der entwicklungspsychologischen Betrachtungsweise lässt sich festhalten, dass sich Kinder etwa ab dem 7. oder 8. Lebensjahr bis zum Alter von elf oder zwölf Jahren in der konkret operationalen Phase befinden (Siegler, 2001, S. 52). Kinder dieses Alters sind im Stande, internalisierte Handlungen (Operationen) durchzuführen. Bei diesen Prozessen handelt es sich um geistige Vorstellungen sowohl von dynamischen als auch von statischen Aspekten der Umwelt. (Siegler, 2001, S. 52) Diese entwickeln sich zwar eng am Gegenstand, nehmen also auf Konkreta Bezug, werden aber nicht mehr ausschließlich am äußeren Handeln entwickelt (Baacke, 1999, S. 60). Nach Baacke (1999) befinden sich Kinder dieser Entwicklungsphase in der 'mittleren' Kindheit, die er einerseits vom Klein- oder Vorschulkind unterscheidet, andererseits vom Teenager, Jugendlichen oder Adoleszenten (S. 59). Bei aller zugestandenen und wesentlichen Subjektivität und Individualität hat die Lebensspanne der 'mittleren' Kindheit ihren eigenen Status mit speziellen Bedürfnissen und auch mit speziellen Entwicklungsaufgaben und -problemen, die für die Mehrheit der Kinder dieses Alters Gültigkeit haben (Baacke, 1999, S. 56-64). Von einer Modellvorstellung ausgehend, die Persönlichkeitsentwicklung als Interaktion von Person und Umwelt versteht, werde ich in Kapitel 2.2 die internen (persönliche Entwicklung) und in Kapitel 2.3 die externen (soziale Außenwelt) Dimensionen der Entwicklung beschreiben.
2.1 Die Persönlichkeitsentwicklung
Allen neueren Sozialisationstheorien gemeinsam ist die Vorstellung der wechselseitigen Beeinflussung von Individuum und Umwelt. Persönlichkeitsentwicklung geschieht demnach im Prozess einer Auseinandersetzung des menschlichen Organismus mit der sozialen und materiellen Gesellschaft bzw. in der gegenseitigen Beeinflussung psychischer (Person-)Faktoren und gesellschaftlicher (Umwelt-)Faktoren. (Hurrelmann, 2001, S. 9, 71) Das Subjekt wird innerhalb eines sozialen und ökologischen Kontextes gesehen, der subjektiv aufgenommen und verarbeitet wird, der in diesem Sinn also auf das Individuum einwirkt, aber zugleich immer auch durch das Individuum beeinflusst, verändert und gestaltet wird (Hurrelmann, 2001, S. 64). Im Zentrum dieser Modellvorstellung, die Hurrelmann (2001) 'Modell der produktiven Realitätsverarbeitung' nennt, steht die Persönlichkeit des Kindes. Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitsentwicklung definiert Hurrelmann als "die individuelle, in Interaktion und Kommunikation mit Dingen wie mit Menschen erworbene Organisation von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellungen, Handlungskompetenzen und Selbstwahrnehmungen eines Menschen auf der Basis der natürlichen Anlagen und als Ergebnis der Bewältigung von Entwicklungs- und Lebensaufgaben zu jedem Zeitpunkt der Lebensgeschichte". (S. 71)
Paus-Haase (1998) macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die Alltagswelten von Kindern auch als 'Medienwelten' begriffen werden müssen. Medien gehören nach Paus-Haase "zu den wichtigsten 'Dingen', mit denen Kinder in Interaktion und Kommunikation stehen". (S. 82) Sie tragen demnach großen Anteil an der Entwicklung kindlicher Handlungskompetenz, die als Abstimmungsstrategie zwischen inneren Bedürfnissen und äußeren Erwartungen verstanden wird (Paus-Haase, 1998, S. 82; Hurrelmann, 2001, S. 79).
Aus sozialen Erwartungen, biologischen Voraussetzungen und persönlichen Wünschen entstehen bestimmte Entwicklungsziele beim Individuum. Stellt nun beispielsweise ein Kind fest, dass sein momentaner Entwicklungsstand von seinen Entwicklungszielen abweicht, versucht es innere Bedingungen oder äußere Kontexte zu verändern, welche die Möglichkeit versprechen, zu den beabsichtigten Änderungen des Entwicklungstands zu führen. (Hurrelmann, 2001, S. 77-78) Voraussetzung hierfür ist allerdings die Fähigkeit des Kindes, seine eigene Entwicklung bewusst zu reflektieren (Hurrelmann, 2001, S. 79). Ausgehend von den Prämissen des Symbolischen Interaktionismus realisiert sich Identität nach Krappmann in der sozialen Kommunikation, in der die Beteiligten zwischen widersprüchlichen Anforderungen der Eigenständigkeit einerseits, der Übernahme von Zuschreibungen andererseits prozessual einen Ausgleich herstellen müssen. Identität ist in diesem Sinne dynamisch als kontinuierliche Balance des Individuums zwischen Selbstdarstellung und Zuschreibung in ganz unterschiedlichen Kommunikationssituationen bestimmt. (Krotz, 2003a, S. 28, 38) Ziel der Persönlichkeitsentwicklung ist auch bei Hurrelmann eine aus der Synthese von Individuation und Vergesellschaftung entstandene stabile Identität. Der Aufbau eines Selbstbilds als Voraussetzung für Identität findet seinen Annahmen zu Folge in der Kindheit statt. (2001, S. 175) Unter 'Selbstbild' versteht Hurrelmann "das strukturierte Gefüge von Ergebnissen der Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und Selbstreflexion der individuellen Handlungskompetenzen und der faktischen eigenen Verhaltensweisen" (2001, S. 169).
Im Gegensatz zur stabilen Identität Jugendlicher und Erwachsener ist das kindliche Selbstbild also wesentlich offener konzipiert. Typisch für das Kindesalter ist deshalb, dass soziale Vergleichsprozesse für die Bewertung der eigenen Person von zentraler Bedeutung sind.[2]
"Das Selbstbild entwickelt sich im Verlauf der Sozialisation im Prozess der Interaktion mit anderen Menschen, wie z.B. den Eltern, Geschwistern, Freunden, Mitschülern, Gleichaltrigen, Lehrern usw." (Hurrelmann, 2001, S. 167). Vor allem im Spiegel der anderen Individuen kann ein Mensch sich ein Bild von sich selbst machen (Hurrelmann, 2001, S. 169).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass handlungsleitende Themen genau dann entstehen, wenn ein Spannungsverhältnis zwischen internen (persönliche Entwicklung) und externen (soziale Außenwelt) Dimensionen der Entwicklung besteht, für dessen Verarbeitung das Individuum noch nicht über genügend Handlungskompetenz verfügt.
Im Anschluss an die Untersuchung von Mia-Kellmer-Pringel: 'The needs of children' listet Baacke folgende Grundbedürfnisse des Kindes in der 'mittleren' Kindheit auf:
- Bedürfnis nach Liebe und Geborgenheit,
- Bedürfnis nach neuen Erfahrungen,
- Bedürfnis nach Lob und Anerkennung,
- Bedürfnis nach Verantwortung und Selbstständigkeit,
- Bedürfnis nach Übersicht und Zusammenhang (1999, S. 145-146).
Versucht man diese Grundbedürfnisse den internen sowie externen Entwicklungsdimensionen in der mittleren Kindheit zuzuordnen, bekommt man ein Grundverständnis für die Entstehung handlungsleitender Themen.
2.2 Interne Entwicklungsdimensionen
Wahrnehmung
Die Kinder befinden sich in einer sogenannten 'realistischen Phase' der kindlichen Entwicklung. "Die eigene Fiktion über die Dinge weicht wachsendem Bemühen um konkrete Wirklichkeitserfahrung" (Bühler, 1967, S. 277-278). Dieses drückt sich zunächst in einer gesteigerten Neu- und Wissbegierde aus, einer betonten Sach- und Tatsachengerichtetheit. Von seiner Lektüre möchte das Kind jetzt lernen, wie es wirklich zugeht im Leben (Bühler, 1967, S. 277-278, 282). Damit einher geht auch ein exploratives Verhalten zur Umwelt. Die Kinder dieses Alters lieben es, selbst Reize zu erzeugen bzw. vorhandene Reize aktiv zu erforschen und zu manipulieren (Mattern, 1999, S. 40). Hurrelmann weist diesbezüglich darauf hin, dass die natürliche Umwelt und die Wohnumgebung heute für Kinder nur noch eingeschränkt als Erlebnis- und Entfaltungsräume zur Verfügung stehen. Die Plätze würden immer enger und immer weniger, in denen sich kindliche Aktivitäten spontan und ungeplant entfalten könnten und eine direkte Aneignung der Umwelt ohne didaktische und organisatorische Hilfen durch Erwachsene möglich sei. Dem spontanen, alle Sinne einsetzenden Such- und Tastverhalten der Kinder komme diese Situation nicht entgegen. (2001, S. 247)
In Bezug auf die Gegenstandswahrnehmung bemerkt Baacke einerseits ein gewisses Optimum bei 9-Jährigen: "Sie denken nicht zu kompliziert, verlieren sich nicht in weitergehenden Abstraktionen, sondern bleiben sachbezogen konzentriert, ohne doch die notwendige Flexibilität vermissen zu lassen, wenn sie ihr Wahrnehmungsurteil ändern müssen" (1999, S. 175). Kinder in diesem Alter sind scharfblickende, aufmerksame und treffend erkennende Beobachter (Baacke, 1999, S. 175). Andererseits sind ihre Wahrnehmungen häufig mit starken Emotionen verbunden. Insgesamt ist die Wahrnehmung noch mehr sinnlich bestimmt, die Kinder gehen eher in der Umwelt auf, als dass sie sich ihr distanziert gegenüber stellen. (Baacke, 1999, S. 176)
Im Hinblick auf die Wahrnehmung von Personen zählen im Grundschulalter nicht mehr nur die direkt sichtbaren Merkmale und Aktionen, sondern zunehmend das Charakterbild als Gesamtes. Äußere Merkmale, Absichten, Motive, Gefühle und Handlungen werden als Einheit betrachtet und bewertet. Die Realitätshaltigkeit der Zeichentrickcharaktere wird im Verlauf des Grundschulalters immer wichtiger, glaubwürdiges Denken, Fühlen und Handeln wird gefordert. (Theunert, Lenssen & Schorb, 1995, S. 57-58)
Auch die visuelle Aufmerksamkeit nimmt bis zum Alter von 6 Jahren zu und bleibt dann bis ins Jugendalter hinein hoch (Mattern, 1999, S. 41). Insbesondere das Differenzierungsvermögen für Farb- und Formmerkmale steigt an. "Verallgemeinern lässt sich die Erkenntnis, dass gerade jüngere Schüler und Schülerinnen eine Vorliebe für leuchtende, kräftige Farben entwickeln und dass sie sich in einem Entwicklungsprozess befinden, der von der Farb- hin zur Formdominanz führt" (Mattern, 1999, S. 46). Kennzeichnend für Kinder im Grundschulalter ist dabei eine detailorientierte Wahrnehmung (Mattern, 1999, S. 46).
Kinder dieser Altersstufe brauchen also "Umwelten, in denen sie sich zurechtfinden können (Übersichtlichkeit, Gegliedertheit), aber ihre Vitalität bedarf auch der Verlockung des Unüberschaubaren und ihr Streben nach Welterkenntnis sucht starke Eindrücke" (Baacke, 1999, S. 176). Den Grund, weshalb audiovisuelle Medien so sehr faszinieren sieht Baacke demnach in den außergewöhnlichen Eindrücken, die diese zur Verarbeitung anbieten (1999, S. 176).
Kreativität
Kindheit ist nach Baacke das Zeitalter der Kreativität. Kinder seien einerseits nicht durch Rollenzwänge und festlegende Erfahrung in ihrer Kreativität eingeschränkt, andererseits aber "in der Lage, neue Räume zu erobern, Entdeckungen zu machen und sich symbolisierender Mittel (malen, schreiben usf.) zu bedienen" (1999, S. 190). Kinder sind darüber hinaus "in der Regel wenig ängstlich, erheblich neugierig, tatendurstig, nicht festgelegt auf bestimmte Meinungen und immer bereit, die eigene Durchsetzungsfähigkeit zu erproben", erfüllen damit nach Ulmann wichtige Persönlichkeitsmerkmale kreativer Menschen (Baacke, 1999, S. 191, 192).
Baacke betont die Notwendigkeit der kindliche Kreativität, die sich vor allem im Spiel, aber auch in der Lust an verdrehten Äußerungen und in körpergebundenem Toben zeige, für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und bezeichnet sie als "vielleicht die zentrale Dimension dieses Altersstatus" (1999, S. 194).
Prosoziales Verhalten
Wenn man einem Menschen prosoziales Verhalten zuschreibt, dann setzt man bei ihm soziales Wissen und Verstehen voraus und erwartet darüber hinaus, dass er auf der Basis dieses Wissens in sozial verantwortlicher Art und Weise lebt und handelt (Mattern, 1999, S. 58). Zentral für die Entwicklung prosozialen Verhaltens ist die Fähigkeit zur Rollenübernahme. Das Kind muss sowohl die eigene Rolle als auch die Rolle des Gegenübers verstehen, um sich dann koordiniert zu verhalten. Diese Fähigkeiten, die sich beim Kind im Grundschulalter erst allmählich ausbilden, sind Voraussetzungen dafür, die Gefühle, Meinungen und Verhaltensweisen einer anderen Person verstehen zu können. (Mattern, 1999, S. 59) Prosoziales Verhalten im Sinne von "Empathie und Kooperationsfähigkeit sowie die Bereitschaft, sich unter bestimmten Bedingungen altruistisch zu verhalten, [entwickelt sich] im allmählichen Prozess sozialen Lernens, wobei die Schule und die Gleichaltrigen hier wichtige Anregungen bieten" (Baacke, 1999, S. 237). Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielen sportliche und spielerische Aktivitäten der Kinder, bei denen die Kinder zwar miteinander im Wettstreit liegen können, aber dabei die Regeln beachten und sich auch gegenseitig in der Einhaltung bewachen (Piaget, Inhelder, 1996, S. 119; Baacke, 1999, S. 237). Wichtig wird für die Kinder das soziale Beisammensein. Die bewusst erlebten und gestalteten Sozialerfahrungen geben ihnen die Möglichkeit, das eigene Verhalten und das des anderen zu reflektieren und sich so prosoziale Handlungskompetenz anzueignen. (Baacke, 1999, S. 237; Mattern, 1999, S. 59-60)
Die Fähigkeit zur Rollenübernahme versetzt die Kinder darüber hinaus in die Lage zu begreifen, dass ein Mensch widersprüchliche Gefühle haben kann oder dass Gefühle über ein Ereignis auch von anderen Ereignissen abhängig sind. Sie begreifen, dass die Bedeutung, die man einem Ereignis zumisst und die von Mensch zu Mensch und von Moment zu Moment verschieden sein kann darüber entscheidet, wie jemand sich fühlen muss. (Baacke, 1999, S. 209-210)
Die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und das damit einhergehende prosoziale Verhalten hat im Rahmen dieser Arbeit besondere Relevanz, nicht nur in der sozialen Interaktion des Kindes, insbesondere mit Gleichaltrigen, sondern vor allem in der para-sozialen Interaktion mit Medienfiguren. Denn "die Fähigkeit der Perspektivenübernahme bestimmt maßgeblich, wie ein Kind die dargebotenen, modellhaften Handlungen erfassen, verorten, vergleichen und bewerten kann" (Paus-Haase, 1998, S. 88)[3].
Die mittlere Kindheit ist nach Coles (1998) die Zeit, "in der sich die moralische Vorstellungskraft bildet, ständig gespeist von der Bereitschaft und dem Eifer der Kinder, sich in andere hineinzuversetzen und so ihre Perspektive auf das Leben zu erweitern" (S. 109).
Motorik
Im Hinblick auf die Entwicklung der Motorik betont Baacke vor allem die damit einhergehende 'Bewegungslust'. So lerne das typische amerikanische oder westeuropäische Kind in der mittleren Kindheit Radfahren, Schwimmen, Tauchen, Rollschuhlaufen, in den Kniekehlen an der Teppichstange hängen, Fußball spielen, mit den Fingern schnalzen, pfeifen und vieles mehr. (1999, S. 178) Hengst (1990) stellte bei einer ethnologisch orientierten Untersuchung der Bremer Kinder-Computerszene ein ausgeprägtes Interesse der befragten Kinder an Körpererfahrungen fest. Sie nannten Sportarten, wenn sie nach ihren Lieblingshobbys gefragt wurden und gingen auch in der Phase des intensivsten Engagements in der Computerszene regelmäßig wenigstens einer Sportart im Verein nach. (S. 203) Um den Spaß und die Freude an der Bewegung, am motorischen Ausgreifen, an der Welteroberung auszuleben und damit ihr Körperbewusstsein weiterzuentwickeln brauchen die Kinder dieser Entwicklungsstufe Raum, Zeit, Anregung und Unterstützung (Mattern, 1999, S. 52).
Jungen wünschen sich das Gefühl, stark zu sein. Bei ihnen spielt auch im Sport die Konkurrenz in der Leistung und das Thema 'Anführer sein' eine wichtige Rolle. Mädchen wollen einerseits auch sportlich und stark sein, andererseits entdecken sie in ihrem Körper aber auch schon die zukünftige Frau, die attraktiv aussehen will und sich 'schön' bewegen können möchte. Der Tanz bietet sich deshalb als eine gute Form des Ausdrucks und der Körpererfahrung an. (Mattern, 1999, S. 52)
Geschlechtsidentifikation
Wesentliches handlungsleitendes Thema ist die Entwicklung der Identifikation mit dem eigenen Geschlecht.
Im Alter von 5 bis 6 Jahren hat sich die Geschlechtsidentität, die nach Kohlberg die Voraussetzung für das Gelingen der Geschlechtsrollenidentifikation ist, in der Regel gefestigt. Die Kinder haben die Geschlechtskonstanz erkannt, das heißt sie wissen, dass sie ihr Geschlecht nicht mehr wechseln können. In den darauffolgenden Kindheitsjahren erfährt diese Stereotypisierung der Geschlechtsrolle durchweg eine Verstärkung, zum einen durch Selbstkategorisierung, zum anderen durch die Umwelt, bis jeweils der 'männliche' oder der 'weibliche' Sozialcharakter geprägt ist. (Baacke, 1999, S. 243) "Dieser ist das in sich zunehmend konsistente komplexe Produkt aus biologischer Determination, sozialer Zuschreibung und Verstärkung, interaktionsbezogener Psychodynamik und kognitiver Selbstkategorisierung" (Baacke, 1999, S. 243-244). Dieses 'Produkt' realisiert sich nach Baacke in Prozessen, in die auch die Beziehungsdynamik zwischen Mädchen und Jungen eingeht. So zeigt sich bei der Bildung von Gruppen und Cliquen vom achten oder neunten Lebensjahr an eine deutliche Vorliebe für das eigene Geschlecht. Im Alter von 10 Jahren grenzen sich die Kinder deutlicher denn je vom anderen Geschlecht ab, dennoch sind sie einander nicht völlig gleichgültig, sondern drangsalieren sich monatelang mit 'Distanz- und Ärger-Ritualen'. (1999, S. 245)
Hinsichtlich Beziehungen zu Partnern des anderen Geschlechts lässt sich feststellen, dass diese früher und intensiver einsetzen als noch vor einer Generation (Hurrelmann, 2001, S. 132). Dies lässt ein gleichfalls früher einsetzendes und stärkeres Interesse an Fragen der Sexualität vermuten. Mattern konnte dies vor allem bei den Kindern zeigen, die Stars der Musikszene als Lieblingsfiguren gewählt hatten und sich im Nachstellen dieser Figuren sehr wohl schon auf deren körperliche und sexuelle Attraktivität bezogen haben (1999, S. 53).
Kinder brauchen im Umgang mit den Geschlechtsrollen Vorbilder, Anregungen und Erprobungsmöglichkeiten um entsprechendes Handlungswissen sammeln und Erfahrungen mit der eigenen Geschlechtlichkeit und ihren Ausdrucksformen machen zu können. Die Medien bieten die Möglichkeit eines spielerischen Umgangs mit den Geschlechtsrollen. Sie regen zur Auseinandersetzung mit bereits gewonnenen Vorstellungen über Geschlechtlichkeit an und tragen dazu bei, den Spielraum für das Aushandeln der Geschlechtsrolle zu definieren. (Mattern, 1999, S. 57)
2.3 Externe Entwicklungsdimensionen
Baacke (1999) gliedert die kindliche Umwelt in vier sozialökologische Zonen.
1. Das ökologische Zentrum ist das 'Zuhause'. Hier halten sich die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes auf.
2. Der ökologische Nahraum ist beispielsweise die Nachbarschaft, der Stadtteil oder das Dorf. Hier nimmt das Kind die ersten Außenbeziehungen auf, hat Kontakt zu funktionsspezifischen 'behavioral settings', das heißt es geht in Läden einkaufen, besucht den Gottesdienst in der Kirche usw.
3. Die ökologischen Ausschnitte sind zweckbestimmte Ausschnitte eines Erfahrungsraumes, wie vor allem die Schule. "Das Kind muß hier lernen, bestimmten Rollenansprüchen gerecht zu werden und bestimmte Umgebungen nach ihren definierten Zwecken zu benutzen". (S. 113)
4. Die Zone der ökologischen Peripherie sind unvertraute Orte mit anderen Regulierungen, jenseits der Routinisierung wie beispielsweise im Urlaub oder bei gelegentlichen Freizeitangeboten. Baacke führt hier auch einen alten Fabrikschuppen an, der sich gerade weil er verboten sei für kindliche Abenteuer anbiete. (1999, S. 114)
Die ersten drei ökologischen Zonen werden, entwicklungspsychologisch betrachtet, in zunehmendem Maße erschlossen (Baacke, 1999, S. 114). Zunächst halten sich Kinder vorwiegend in der Familie auf; sodann erobern sie umliegende Plätze. Mit dem Schulbesuch zerfällt die bisher als Ganzes erfahrene Welt in funktionsspezifische Räume. Allerdings gilt nicht nur: "Die Welt wächst, sondern auch: Kinder wachsen in der Welt". (Baacke, 1999, S. 115) Während für das kleine Kind die Personen des ökologischen Zentrums einziger Bezugspunkt sind, kann das Vorschulkind im ökologischen Nahraum bereits neue Menschen kennen lernen und neue Erfahrungen machen. Im Schulalter bekommen gleichaltrige Freunde neben den Eltern wachsendes Gewicht. Schließlich löst sich der Jugendliche aus dem Zentrum um sich ein eigenes zu schaffen. (Baacke, 1999, S. 115)
Die Sozialisationsagenturen, das heißt die Lebensräume, die für die Entwicklung des kindlichen Selbstbildes von Bedeutung sind, sind dem zu Folge in erster Linie die 'Familie', die 'Gleichaltrigen' und die 'Schule'. Sie übernehmen als Sozialisationsagenturen die Aufgabe der Weitervermittlung der gesellschaftlichen Normen und Werte. (Mattern, 1999, S. 65) Große Relevanz haben in diesem Zusammenhang aber auch die 'Freizeitwelten' – die sich zum Teil mit der Lebenswelt der 'Peers' überschneiden – und als Teilbereich der 'Freizeitwelten' vor allem die Lebenswelt 'Medien' (Baacke, 1999, S. 287-330; Mattern, 1999, S. 66).
Die Familie
Im ersten Lebensjahrzehnt bleibt die Familie zentraler Bezugspunkt des Kindes und nimmt für den Aufbau wichtiger Dimensionen der kindlichen Persönlichkeit eine Schlüsselrolle ein (Hurrelmann, 2001, S. 133, S. 136). In ihrer Rolle als Umweltvermittler dient sie dem Kind als sozialer Filter für die Verarbeitung der äußeren Realität (Hurrelmann, 2001, S. 131-132). Jede Familie hat dabei eine charakteristische Interaktions- und Kommunikationsstruktur, die nach Charlton und Neumann von den in der Familie vorherrschenden 'Vorstellungsbildern' bestimmt wird. So einigen sich Familien auf Vorstellungsbilder von den einzelnen Familienmitgliedern (z.B. welche Rolle kommt dem Einzelnen zu, was wird einmal aus ihm werden), der Familie als Ganzes (z.B. was ist ihnen wichtig, was sind ihre Ziele) und der Welt außerhalb der Familie (z.B. wie bedrohlich ist die Welt, was gibt es draußen, was die Familie nicht bieten kann). (1986, S. 46-47) Diese Familienthemen beeinflussen das Kind gleichermaßen wie die Themen, die sich aus seinem geistigen und körperlichen Entwicklungsstand ergeben, sie werden im Sinne der produktiven Realitätsverarbeitung aber auch aktiv vom Kind verändert (Charlton, Neumann, 1986, S. 46-47; Hurrelmann, 2001, S. 134-135). Das familieninterne Interaktions- und Kommunikationsgeschehen findet innerhalb des mächtigen Rahmens der materiellen und sozialen Lebensbedingungen statt (Hurrelmann, 2001, S. 135). Diese Bedingungen werden nach Hurrelmann in besonderem Maße von dem Faktor 'Stellung im Beruf' beeinflusst (Hurrelmann, 2001, S. 134). Als Ergebnis einer Studie zu Differenzkriterien zwischen familialen Umgangsstilen speziell mit Medienangeboten erhielten Neumann-Braun, Charlton und Roesler die Dimensionen 'Bildung', 'Familienstand' (Alleinerziehung) und 'Einkommen' (Neumann-Braun, Charlton & Roesler, 1993, S. 497-511).
Die Familienwelt ist keineswegs insular, sondern vielmehr als Netzwerk zu sehen. Sowohl Mutter, Vater als auch Kind sind in außerfamiliale Beziehungsnetze von Kollegen, Freunden und Verwandten einbezogen, die auf die Familie Einfluss haben. Neben Nachbarschafts- und Gemeindenetzwerken können auch Kinderbetreuungseinrichtungen ein wichtiger Bestandteil dieser Netzwerke sein. (Baacke, 1999, S. 270; Hurrelmann, 2001, S. 241)
Ein Blick auf Unterschiede innerfamiliäre Sozialisationsprozesse zeigt deren größere Bedeutung für die Mädchen im Vergleich zu Jungen, da diese schon früher nach 'draußen' streben (Mattern, 1999, S. 69).
Familien befinden sich momentan in einem Strukturwandel. Die Kleinfamilie aus Vater, Mutter und in der Regel zwei bis drei Kindern verliert zunehmend ihre vorherrschende Position. Immer häufiger kommt es zur Trennung der Eltern und damit auch zu einer anwachsenden Zahl von Familien, in denen nur ein Elternteil über einen längeren Zeitraum mit einem oder mehreren Kindern zusammenlebt. 78 Prozent der unter 18-jährigen Kinder lebten im März 2004 noch in einer 'klassischen' Familie mit ihren verheirateten, zusammen lebenden Eltern. 7 Prozent wuchsen bei einer nichtehelichen oder gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft auf und 15 Prozent bei einem allein erziehenden Elternteil. (Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2004) Zudem ist nach Hurrelmann das Aufwachsen als Einzelkind 'eine typische Form des Erlebens von Kindheit' geworden (Hurrelmann, 2001, S. 236-237). Tatsächlich wuchs ein Viertel aller minderjährigen Kinder im März 2004 in Deutschland ohne Geschwister im Haushalt auf, drei Viertel lebten mit mindestens einer Schwester oder einem Bruder zusammen. Außerdem steigt die Erwerbsarbeit auch der Frauen mit Kindern und wird selbstverständlicher Bestandteil der Lebensführung. So waren 25 Prozent der Mütter im März 2004 voll beruftätig, 36 Prozent gingen halbtags zur Arbeit. (Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2004) Das monatliche Nettoeinkommen liegt bei 67 Prozent der Drei-und-mehr-Personen-Haushalte über 2.000 Euro (Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2003). Wirtschaftliche Krisenlagen insbesondere bei Familien mit Kindern nehmen allerdings derzeit an Stellenwert wieder zu und ‑ teilweise daraus resultierend ‑ auch soziale und psychische Krisen. Immer mehr Kinder werden mit der Arbeitslosigkeit ihrer Eltern konfrontiert. (Hurrelmann, 2001, S. 233-245) Hinsichtlich des Umgangsstils zwischen Eltern und Kind zeigen sich Veränderungen dahingehend, dass die Beziehungen, unabhängig von der sozialen und materiellen Lebenslage, liberaler und partnerschaftlicher geworden sind und in der Regel mehr Rücksicht auf die persönlichen Interessen der Kinder genommen wird (Hurrelmann, 2001, S. 136, 138, 249).
Hinsichtlich der Bedeutung der Eltern als Bezugspersonen des Kindes zeigt sich vor allem bei Jungen eine wichtige Vorbildrolle des Vaters, obwohl sich dieser rein zeitlich gesehen im Durchschnitt erheblich weniger der Kinderbetreuung widmet als die Mutter (Hurrelmann, 2001, S. 128-129). Kinder, die ihren Vater wenig zu Hause erleben, suchen sich häufig zusätzliche Vorbilder und emotionale Bezugspersonen außerhalb. Dies können andere Verwandte oder auch Lehrer sein. Nach Mattern ist es auch möglich, dass eine virtuelle Person diese Funktion übernimmt (1999, S. 69). Mädchen dieses Alters identifizieren sich eher mit ihren Müttern und wählen diese als Vertrauensperson (Baacke, 1999, S. 263-264). Nach den Untersuchungen von Mattern wählen Mädchen aber keinen Medienstar als 'virtuelle Ersatzmutter' (Mattern, 1999, S. 69).
Ein wichtiger Sozialisationsfaktor sind auch die Geschwister eines Kindes. Welche Rolle den Geschwistern im Leben des Kindes zukommt, hängt stark von ihrem Alter ab, wie Baacke unter Rückgriff auf Stone und Church sehr anschaulich beschreibt: "Sind die Geschwister annähernd gleichaltrig und liegen alle in der Altersgruppe der mittleren Kindheit, so ist das häusliche Zusammenleben wahrscheinlich durch Reizen, Necken, Streit, Schlachten, gegenseitige Herabsetzung und Tollereien gekennzeichnet. Gibt es zwei gleichgeschlechtliche und ungefähr gleichaltrige Geschwister, übernimmt das ältere Kind dem jüngeren gegenüber oft die Rolle des Mentors. [...] Stehen die Geschwister in verschiedenen Entwicklungsphasen, [...] erscheint die Kluft wahrscheinlich unüberbrückbar. [...] Ein Bruder oder eine Schwester im Vorschulalter wird dagegen vom Kind [...] als ständiges Hindernis oder lästiges Anhängsel empfunden; [...] Das ältere Kind verlangt die schwer errungenen Vorrechte seines Alters streng für sich allein, während das jüngere Kind sie als Bevorzugung ablehnt. [...]". (1999, S. 268-269)
Die Gleichaltrigen
In der mittleren Kindheit strebt das Kind nach mehr Autonomie. "Erwachsene bleiben zwar weiterhin wichtige Personen die das Kind respektiert, werden aber zunehmend mit mehr Distanz und auch Kritik betrachtet." (Mattern, 1999, S. 76) Die Gleichaltrigengruppe wird hingegen immer bedeutender. Sie ermöglicht dem Kind, soziale Anerkennung, Sicherheit und Solidarität außerhalb 'erzieherisch' definierten Beziehungen in Familie und Schule zu erfahren. Hierbei werden sowohl Kooperation als auch Wettbewerb erfahren. Die Eltern behalten zwar ihren Einfluss bei längerfristigen Lebensentscheidungen, die Kinder ziehen aber beispielsweise bei momentanen, spontan auftretenden Lebensfragen und -problemen die Gleichaltrigen zu Rate. (Hurrelmann, 2001, S. 132) Die Kinder sehen sich in der Gleichaltrigengruppe aber auch in einem Kampf um soziale Anerkennung und Zugehörigkeit (Oerter, 1995, S. 299). Hierbei ist vor allem die Mitgliedschaft in einer Gleichaltrigengruppe von großer Bedeutung für ein positives Selbstbild des Kindes (Oerter, 1995, S. 298). Cliquen oder Bande zeichnen sich in der mittleren Kindheit bereits durch eine relative zeitliche Stabilität aus, ihre Mitglieder gleichen sich meist in Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Nationalität, Kultur und sozioökonomischen Status und es existiert eine klare Rollenverteilung. Speziell in Jungengruppen gibt es 'Anführer', die sich durch bestimmte besondere Fähigkeiten - häufig sportlicher Art - , durch besondere Kenntnis der Freizeitkultur oder durch Besitz profiliert haben. (Mattern, 1999, S. 77-78)
Im Gegensatz zur Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen, die durch ein Macht- und Wissensgefälle immer asymmetrisch bleibt, sind Regeln und moralische Prinzipien in der Peer-Group immer Ergebnisse von Gruppenverhandlungen unter Personen von gleichem Status. Piaget betont aus diesem Grund die herausragende Bedeutung der Peer-Group für den Erwerb eines reifen, moralischen Urteils (1996, S. 126; 1995, S. 119; Baacke, 1999, S. 228). Das Gerechtigkeitsgefühl und die gegenseitige Achtung sind Beispiele für die für dieses Stadium eigentümlichen 'autonomen moralischen Gefühle' (Piaget, 1995, S. 107). So respektieren die Kinder die Regeln der Gleichaltrigen zwar weiterhin peinlich genau, "aber auf die einseitige und mystische Achtung folgt nun eine, die sich auf den anderen bezieht und in der Gegenseitigkeit gründet" (Piaget, 1995, S. 118). Aus diesem Grund empfinden Kinder eine größere Verpflichtung gegenüber ihren Peers und sind eher willens, deren Erwartungen zu entsprechen als denen der Eltern (Piaget, 1995, S. 116; Baacke, 1999, S. 229).
Hinsichtlich der Auffassung von Freundschaft unterscheiden sich die jüngeren Kinder in der mittleren Kindheit von den älteren. Freundschaften bieten für die jüngeren Kinder vor allem die Möglichkeit, etwas miteinander zu unternehmen und gemeinsam Spaß zu haben, sie dienen aber auch der Selbstdarstellung. Für ältere Kinder bedeutet Freundschaft hingegen, ihre Gedanken und Gefühle auf der Basis gegenseitigen Respekts und gegenseitiger Zuneigung zu teilen. Im Alter von 10 Jahren hat das Kind im allgemeinen einen engen gleichgeschlechtlichen Freund, die erste wesentliche menschliche Beziehung außerhalb der Familie. (Baacke, 1999, S. 345-346)
Mattern beschreibt mit Blick auf die handlungsleitenden Themen in der mittleren Kindheit die Spannung zwischen Geborgenheit und Selbstständigkeit. "9 bis 11jährige Kinder brauchen einerseits Halt und Unterstützung in eher regressiven Phasen, in denen sie sich wieder ganz als Kind fühlen, als auch in ihren ausgreifenden Phasen, in denen sie die Abgrenzung von den Eltern und von anderen erwachsenen Erziehern erproben, um als schon fast Jugendliche die eigene Stärke zu erfahren und eigene Wege und Werte zu finden." (1999, S. 51)
Die Schule
Die Interaktionsmuster unterscheiden sich in diesem Setting deutlich von denen innerhalb der Familie: "Erhielt das Kind die Zuwendung der Eltern bisher eher allein oder musste sie nur mit wenigen teilen, erlebt es sich in der Schule als eine(r) von vielen und muss zusätzlich noch erleben, dass der Lehrer sich bemüht, alle gleichermaßen zu sehen und zu behandeln." (Mattern, 1999, S. 72) Hinzu kommt eine klare Verteilung der Kompetenzen. Die Lehrer sind die anleitenden 'Experten', das Kind hingegen findet sich in der Rolle eines 'unmündigen', weitgehend unvernünftiger 'Laien', der etwas zu lernen hat, wieder. (Baacke, 1999, S. 276) Der Lernstoff ist dabei unabhängig von den Interessen des Kindes und muss innerhalb festgelegter Zeitrahmen gelernt werden (Baacke, 1999, S. 278). Dennoch kommt die Schule nach Baacke wichtigen Bedürfnissen des Kindes entgegen. Die Zunahme von Leistungssituationen, Fremdbewertung und Verbindlichkeit sieht Baacke ganz im Sinne des Kindes. Unter Rückgriff auf Erikson betont er den 'Werksinn' der Kinder in diesem Entwicklungsstadium, denn "obwohl alle Kinder es brauchen, dass man sie zeitweilig allein spielen lässt, [...] und obwohl alle Kinder Stunden und Tage in einer spielerischen Als-ob-Welt verbringen müssen, werden sie doch alle früher oder später unbefriedigt und mürrisch, wenn sie nicht das Gefühl haben, auch nützlich zu sein, etwas machen zu können und es sogar gut und vollkommen zu machen [...]". (1999, S. 275) Das Kind ist nun auch sehr motiviert eine begonnene Arbeit fertig zu stellen, und dies so perfekt wie nur möglich (Baacke, 1999, S. 275). Dem Werksinn entgegengesetzt ist nach Erikson die Gefahr der Entwicklung eines Gefühls der Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit (Baacke, 1999, S. 164, 275). Dieses kann sich zum einen aus den Systemerfordernissen der Schule ergeben, zum anderen aber beispielsweise auch Ergebnis einer unzureichenden Schulvorbereitung des Kindes durch die Familie und den Kindergarten sein oder aus einem starken kindlichen Bedürfnis nach familiärer Geborgenheit resultieren (Baacke, 1999, S. 275).
Wichtige Entwicklungsaufgabe im Schulkontext ist der Erwerb der Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Rechnens (Oerter, 1995, S. 278). Nach Chall entwickelt sich die für die vorliegende Arbeit besonders relevante Fähigkeit des Lesens in fünf Stadien. Die Stadien lassen das Lernen des Lesens systematischer und geordneter erscheinen als es tatsächlich ist, aber sie vermitteln auch einen Überblick über die wichtigsten Leistungen und die Reihenfolge, in der sie stattfinden.
Bis zur ersten Klasse beherrschen Kinder einige Voraussetzungen für das Lesen, wie beispielsweise das Wissen, dass Texte (im Deutschen) von links nach rechts geschrieben werden (Stadium 0). In der ersten und zweiten Klasse eignen sich Kinder die Fähigkeit an, Buchstaben in Laute zu übersetzen und die Laute in Worte einzupassen (Stadium 1). Erst zwischen der zweiten und dritten Klasse beginnen Kinder flüssig zu lesen. Die Anforderungen bei der Worterkennung sind allerdings für die kindlichen Verarbeitungsressourcen noch immer sehr hoch, so dass die Aneignung neuer Informationen durch das Lesen schwierig bleibt (Stadium 2). Dies ändert sich zwischen der vierten und achten Klasse (Stadium 3), doch erst in der High School[4] können Informationen verstanden werden, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln dargestellt sind (Stadium 4). (Siegler, 2001, S. 394-395)
Bei einer Untersuchung der Zeitschriftenpräferenzen von Grundschülern stellen Mädler und Plath einen im Vergleich mit der ersten Klasse erheblichen Anstieg sowohl des Anteils der Buchleser als auch des Anteils der Zeitschriftenleser in der Klasse 2 und 3 fest, was sie auf bereits gewonnene Lesefertigkeiten zurückführen. (2000, S. 171-172).
Nach dieser Untersuchung lesen mehr als ein Drittel der Schüler , 'sehr gerne', 43 Prozent lesen 'gern' und nur etwa ein Fünftel lesen nach eigenen Angaben 'nicht so gern'. Die Gruppe der Schüler, die 'nicht so gern' liest, nimmt dabei von Klasse 1 (35 Prozent) bis Klasse 5 (14 Prozent) kontinuierlich ab, Mädler und Plath schließen deshalb auf einen Zusammenhang zwischen dem Erwerb von Lesekompetenzen auf der einen und der Entwicklung von Leseinteressen auf der anderen Seite. (2000, S. 171-172)
Nach Böck ergibt sich die Attraktivität des Lesens für die Altersgruppe der 8- bis 10-Jährigen insbesondere aus der Tatsache, dass Kinder dieses Alters das Lesen in den meisten Fällen eben erst erlernt haben. Die ihnen bislang mit dem Zeichensystem der Schrift verschlossenen Welten wie die der Bücher, Comics und Zeitschriften zugänglich werden und sich damit verbunden ihre Erfahrungsbereiche entsprechend ausweiten. Darüber hinaus werden sie mit dieser Fähigkeit von Bezugspersonen unabhängig und können einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung hin zur Selbstständigkeit machen. Schließlich haben sie durch den Zugang zu und die Selektion von Lesestoffen ein größeres Ausmaß an Gestaltungsmöglichkeiten ihres Kommunikations- und Medienalltags und können dadurch auch ihre Bedürfnisse und Interessen individueller befriedigen. Gefördert werden diese Prozesse noch durch die Intimität der belletristischen Lektüre. (2000, S. 212-213)
Die Lebenswelt Freizeit
Die ARD/ZDF-Studie 'Kinder und Medien 2003' gibt einen Überblick über die Häufigkeiten nicht-medialer Freizeitaktivitäten der 8- bis 11-Jährigen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Draußen und drinnen spielen sowie sich mit Freunden treffen sind der Studie zu Folge die häufigsten nicht-medialen Freizeitaktivitäten der 8- bis 11-Jährigen[5]. Ebenfalls sehr häufig helfen die Kinder bei der Hausarbeit oder räumen ihr eigenes Zimmer auf. Knapp zwei Drittel der Kinder widmet sich außerdem mindestens ein mal pro Woche dem Malen, Zeichnen oder Basteln, mehr als die Hälfte treibt mindestens einmal in der Wochen zusätzlich zum Schulsport in der Freizeit Sport. Fast genau so viele unternehmen mindestens einmal in der Woche etwas mit ihrer Familie. In den Freizeitaktivitäten zeigen sich alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei einem Vergleich der Gruppe der 8- und 9-Jährigen und den 10- bis 11-Jährigen zeigt sich bei den älteren Kindern ein Abschied von Kinderaktivitäten wie Spielen, Malen und Basteln und dem Spielen im Haus und eine Hinwendung zu Jugendthemen wie Sport, Jugendgruppen oder Shoppen. Mädchen gehen stärker ruhigeren Tätigkeiten nach, spielen mehr drinnen und malen, zeichnen und basteln häufiger. Darüber hinaus helfen sie immer noch mehr bei der Hausarbeit, machen mehr Musik und shoppen häufiger[6]. Jungen wenden sich stärker Tätigkeiten zu, bei denen sie sich körperlich bewegen können. Folglich spielen sie öfter draußen und treiben mehr Sport. ('Kinder und Medien 2003')
Abbildung 1: Die nicht-medialen Freizeitbeschäftigungen der 8- bis 11 Jährigen nach Häufigkeit ('Kinder und Medien 2003')
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das IJF, Institut für Jugendforschung, fragte im Rahmen der Studie 'Märchen oder Popstars?' 6- bis 12-jährige Kinder nach den für sie spannendsten Orten und Themen. Sie sind in Abbildung 2 dargestellt. Spitzenreiter für die Kinder in diesem Alter sind demnach Haustiere, für die sich 62 Prozent begeistern. An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala sind Rummel/Kirmes mit 52 Prozent. 'Disney' finden knapp die Hälfte aller Kinder spannend. Ungefähr 40 Prozent sind von Popstar/Bands und von Zirkus fasziniert. Die Rubriken Dinosaurier, Fußball und Safari/Wilde Tiere fanden jeweils 37 Prozent der Kinder interessant. Von Computer/Internet werden fast genauso viele in den Bann gezogen wie von der Unterwasserwelt, für die sich 36 Prozent der Kinder begeistern. Ungefähr ein Drittel interessiert sich für Reiten/Pferde beziehungsweise für Natur/Bauernhof, während sich 31 Prozent Skaten spannend finden. Schließlich sind 30 Prozent der befragten Kinder Fans von Autos bzw. Motorrädern und 28 Prozent von Detektiven. ('IJF Märchen oder Popstars? 2004')
Abbildung 2: Die Top 15 der Themeninteressen der 6- bis 12-Jährigen ('IJF Märchen oder Popstars? 2004')
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Lebenswelt Medien
Wie die anderen Sozialisationsagenturen 'Familie', 'Schule' und 'Gleichaltrige' tragen auch die Medien zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern bei. "Kinder lernen täglich durch und mit den Medien, [...] sie machen täglich selbst Erfahrungen und Empfindungen mit Medien [...]" (Kübler, 2000, S. 70). Als einzige virtuelle Sozialisationsagentur nimmt sie jedoch eine besondere Stellung ein und durchmischt die anderen Lebenswelten. So können beispielsweise medienvermittelte Erfahrungen von besonderer Bedeutung in der Peer-Group sein. (Mattern, 1999, S. 83)
Eine Studie von Tulodziecki umreißt zunächst wesentliche Bedürfnisse, die der kindlichen Mediennutzung zu Grunde liegen können, anschließend soll die ARD/ZDF-Studie 'Kinder und Medien 2003' den Stellenwert der einzelnen Medien zum einen an Hand ihrer Nutzungshäufigkeit zum anderen im Zusammenhang ihrer Nutzung im kindlichen Tagesverlauf deutlich machen.
Tulodziecki untersuchte die Bedürfnisse von Kindern, die bei der Rezeption der Vorabendserie 'Alf' zum Tragen kommen. In Anlehnung an Maslow geht er von folgenden fünf Bedürfnisgruppen aus, die der Mediennutzung zu Grunde liegen können:
1. Die grundlegenden physischen und psychischen Bedürfnisse und kognitiven Antriebe wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Sinneserregung sowie das Bedürfnis nach Erkundung der Umwelt. Durch para-soziale Interaktion können die Kinder Umwelten virtuell erfahren und erproben und Sinneserregung erleben.
2. Die Orientierungs- und Sicherheitsbedürfnisse als die Bedürfnisse nach Struktur, Ordnung, Gesetz und Grenzen sowie nach Stabilität, Geborgenheit, Schutz und Angstfreiheit. Diese Bedürfnisse erfüllen Medien, indem Personen/Figuren immer wieder kehren, klare Handlungsverläufe gegeben sind und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen gezeigt werden. Sicherheitsbedürfnisse werden darüber hinaus angeregt, wenn Medienfiguren in Gefahr geraten, die sie aber unbeschadet bestehen. Diese Bedürfnisse können auch befriedigt werden, indem Medienerlebnisse entweder gemeinsam in angenehmer Atmosphäre rezipiert werden oder im Nachhinein zum ritualisierten verbindenden Thema werden.
3. Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse finden im Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nach Kontakt, nach persönlichen Beziehungen, nach Zuneigung, Freundschaft und Liebe ihren Ausdruck. Diese Bedürfnisse werden durch para-soziale Interaktionen bzw. Beziehungen mit Medienfiguren nur symbolisch befriedigt. Real können diese Bedürfnisse dadurch befriedigt werden, dass sich das Kind zur jeweiligen Fangruppe der Protagonisten bzw. des Medienangebots zugehörig fühlt; mit Fanartikeln kann dies auch nach außen gezeigt werden.
4. Die Achtungs- und Geltungsbedürfnisse sind die Bedürfnisse nach Stärke, Leistung, Bewältigung von Anforderungen, nach Kompetenz sowie nach Status, Ruhm, Anerkennung, Dominanz und Wertschätzung. Die Kinder können sich hierfür mit Medienstars und -helden identifizieren.
5. Die Selbstverwirklichungsbedürfnisse gewinnen nach Maslow erst nach dem Kindesalter an Bedeutung, da Kinder zuerst darauf ausgerichtet sind, die darunter liegenden Bedürfnisse zu befriedigen. (Tulodziecki, 1989, S. 147-152)
Im Hinblick auf den quantitativen Stellenwert der einzelnen Medien kann die ARD/ZDF-Studie 'Kinder und Medien 2003' herangezogen werden, in der unter anderem die Nutzungshäufigkeit medialer Freizeitaktivitäten erhoben wurde. Das Fernsehen ist dieser Studie zu Folge das mit Abstand am häufigsten genutzte Medium, wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird. Danach folgen die Musikträger Schallplatte, Kassette, CD und MP3-Dateien, die von zwei Drittel aller 8- bis 11-Jährigen mindestens einmal pro Woche genutzt werden. Der Computer hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und wird 2003 von 62 Prozent der Kinder genutzt, dicht gefolgt vom Radio, das 61 Prozent der Kinder mindestens mehrmals pro Woche nutzen. 58 Prozent der 8- bis 11-Jährigen Kinder lesen mindestens einmal pro Woche ein Buch. Fast jedes zweite Kind beschäftigt sich einmal pro Woche mit einer Zeitschrift, Comics und Heftchen werden von 44 Prozent der Kinder in dieser Häufigkeit genutzt, gefolgt von Hörspielen und der Spielkonsole. Videokassetten bzw. DVDs werden von jedem dritten Kind mindestens einmal pro Woche genutzt und damit fast genauso häufig wie das Internet. Im Geschlechtervergleich zeigt sich eine stärkere Zuwendung der Mädchen zu klassischen Medientätigkeiten wie Bücher oder Zeitschriften lesen und Musik hören. Außerdem nutzen sie das HPhilipp intensiver als Kommunikationsmittel, während Jungen nach wie vor stärker elektronische Medien wie Computer und Spielkonsole nutzen. Die Hälfte der Mädchen gibt an, noch nie auf einer Konsole gespielt zu haben, während dies nur für knapp ein Drittel der Jungen zutrifft. Comics sind eine Domäne der Jungen, Zeitschriften werden hingegen eher von Mädchen genutzt. Analog zum Abschied von nicht-medialen Kinderaktivitäten im Altersverlauf wenden sich die 8- bis 9-jährigen Kinder zunehmend vom Kindermedium Hörspiel ab, im Gegenzug gewinnen die HPhilipp-, Computer- und Internetnutzung sowie Musik stark an Bedeutung. Während die Comicnutzung nur marginal zunimmt, steigt außerdem die Zeitschriftennutzung in der Altersgruppe der 10- bis 11-Jährigen sprunghaft um 9 Prozentpunkte an. Die Buchlektüre verliert hingegen 10 Prozentpunkte. ('Kinder und Medien 2003')
Abbildung 3: Die medialen Freizeitbeschäftigungen der 8- bis 11-Jährigen nach Häufigkeit ('Kinder und Medien 2003')
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schule, Hausaufgaben, Mahlzeiten und feste Termine in Vereinen und Clubs strukturieren den Alltag der 6- bis 13 Jährigen sehr stark. Das Zeitbudget für die Mediennutzung ist damit eng umgrenzt. An einem normalen Werktag in der Schulzeit stehen die meisten Kinder (70 Prozent) zwischen 6.45 Uhr und 7.30 Uhr auf und gehen zwischen ca. 20.00 Uhr und 22.00 Uhr ins Bett. Außerhalb der Wohnung spielen die 6- bis 13-Jährigen meistens nachmittags in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr. Im Hinblick auf die medialen Nutzungszeiten lässt sich ein täglicher Nutzungsgipfel des Fernsehens zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr feststellen. Dabei schauen ältere Kinder ab zehn Jahren an einem normalen Wochentag bereits vermehrt nachmittags fern und bleiben auch abends länger vor dem Fernseher sitzen. Für die Radionutzung der Kinder ergeben sich an den Werktagen zwei Nutzungsschwerpunkte, morgens beim Aufstehen und nachmittags nach der Schule. Zu ähnlichen Tageszeiten wie das Radio werden an Werktagen auch Kassetten und CDs gehört. Den Computer und das Internet nutzen vor allem die älteren Kinder, vorwiegend am späteren Nachmittag ab ca. 15.00 Uhr bis zum Abend gegen 20.00 Uhr. Die tägliche Lektüre von Büchern, Zeitschriften und Heften findet vor allem am Abend statt, und hier insbesondere vor dem Einschlafen zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr. Mit Blick auf eine eventuelle Konkurrenzsituation der Zeitschrift mit anderen medialen und nicht-medialen Beschäftigungen könnte die Zeitschriftennutzung nach diesen Ergebnissen also mit der Fernsehrezeption und der Computernutzung kollidieren. ('Kinder und Medien 2003')
3 Kinder und Zeitschriften
Nach einer Definition der Kinderzeitschrift folgt innerhalb dieses Kapitels eine systematische Einordnung der Kinderzeitschrift als periodisches Presseprodukt. Daran anschließend wird die Kinderpresse in unterschiedliche Klassen aufgeschlüsselt. Ein kurzer Abriss zum Markt der Kinderzeitschrift soll schließlich dem Leser ein abgerundeten Bild des im Rahmen dieser Arbeit relevanten Mediums vermitteln und dient gleichzeitig als notwendige Basis einer profunden Analyse der Bedeutung von Zeitschriften für Kinder. Darüber hinaus gibt dieses Kapitel Aufschluss über die Bedeutung der Zeitschrift hinsichtlich ihrer quantitative (Nutzungshäufigkeit, -dauer und -zeit) und qualitativen (Titelpräferenzen, inhaltliche und formale Vorlieben) Nutzung. Der Stellenwert der Kinderzeitschrift im intramedialen Vergleich, der für die vorliegende Untersuchung von besonderem Interesse ist, wird ebenfalls im Rahmen dieses Kapitels beleuchtet.
3.1 Die Kinderzeitschrift
Definition
Zunächst scheint die 'Kinderzeitschrift' eindeutig definiert durch die Elemente 'Kind' als Zielgruppe sowie 'Zeitschrift' als Medium. Dennoch zeigen sich bei näherer Betrachtung verschiedene Hürden in der Begriffsbestimmung. Meier zeigt unter anderem folgende wesentliche Aspekte auf:
- Wie genau lässt sich eine Trennungslinie zwischen Kindheit und Jugend ziehen?
- Wie verhält es sich mit intentional für Kinder verfassten Periodika zu tatsächlich von Kindern rezipierten, aber nicht primär für sie gestalteten Zeitschriften?
- Ist es überhaupt sinnvoll, die Vielfalt des inhaltlichen Angebots unter den einen Begriff 'Zeitschrift' zu subsumieren? (2002, S. 639)
Oft wurden und werden Zeitschriften lediglich in der Abgrenzung von der Tageszeitung definiert. Die Zeitschrift wird als eigenständige Gattung gesehen, deren wesentliches Merkmal der Verzicht auf einen aktuellen und universellen Inhalt ist. (Kieslich, 1965, S. 318; Vogel, 1998, S. 19) In der Kommunikationswissenschaft hat sich zu 'Zeitschrift' die Definition von Dovifat durchgesetzt; dabei handelt es sich um ein "fortlaufend und in regelmäßiger Folge erscheinendes Druckwerk, das einem umgrenzten Aufgabenbereich oder einer gesonderten Stoffdarbietung (Bild, Unterhaltung) dient. Danach bestimmt sich ihre Öffentlichkeit, ihre Tagesbindung, ihr Standort, die Mannigfaltigkeit ihres Inhalts und die Häufigkeit ihres Erscheinens". (Meier, 2002, S. 639; Sommer, 1994, S. 15) Genau dies trifft für Kinderzeitschriften zu: Ihr Aufgabenbereich ist umgrenzt (bestimmte Zielgruppe), was einer gesonderten Stoffdarbietung bedarf (formale und inhaltliche Gestaltung gemäß den Fähigkeiten, Bedürfnissen, Interessen dieser Zielgruppe) (Sommer, 1994, S. 15).
Unter 'Kinderzeitschriften' werden nach der gängigsten Definition "besonders für Heranwachsende bis zu zwölf Jahren hergestellte selbstständige Publikationsorgane [...] verstanden, die periodisch erscheinen und eine Mischung aus Unterhaltung, Information und Wissensvermittlung enthalten" (Rogge, 1984, S. 146). Ob man nur jene Publikationen als Kinderzeitschriften auffassen kann, die diese Mischung enthalten, ist dabei aber ebenso fraglich wie die Ausgrenzung periodisch erscheinender Comic-Zeitschriften. Sommer wählt aus diesem Grund einen möglichst weit gefassten Begriff; neben der Selbstständigkeit und der Periodizität ist demnach einziges und entscheidendes Kriterium für die Kinderzeitschrift ihre Ausrichtung auf eine bestimme Zielgruppe: "Kinderzeitschriften sind für Heranwachsende bis zu etwa zwölf Jahren bestimmte selbständige Publikationen, die periodisch (mindestens dreimal im Jahr) erscheinen" (1994, S. 16).
Einordnung
Vogel segmentiert in seiner Pressesystematik, dargestellt in Abbildung 4, periodische Presseprodukte funktional-strukturell in elf Pressetypen. Im Hinblick auf die Kinderzeitschrift scheinen vor allem die Pressegattungen 'Populärpresse' und 'Kontaktpresse' von Relevanz zu sein. (1998, S. 31) Die Populärpresse, mit der Vogel die Publikumszeitschriften bezeichnet, unterteilt er in eine 'Objektgruppe eher genereller Orientierung' und eine 'Objektgruppe eher spezieller Orientierung'. Die 'Jugend und Kinder'-Presse verortet Vogel dabei in der eher generell orientierten erstgenannten Gruppe und untergliedert sie schließlich in die Jugend- und die Kinderpresse. (1998, S. 34, 37-42, 52-56) Interessant ist im Zusammenhang dieser Arbeit außerdem der Pressetyp 'Kontaktpresse', dessen Funktion nach Vogel in der Pflege und Anbahnung von Geschäftsbeziehungen zu sehen ist. Eine Unterkategorie der Kontaktpresse ist die Branchenpresse, die zumeist von einem Presseverlag für mehrere Firmen einer Branche erstellt und von diesen kostenlos an ihre Kundschaft weitergereicht wird. (Vogel, 1998, S. 53)
Abbildung 4: Pressesystematik nach Hauptfunktionen (Vogel, 1998, S. 31, 34, 89-99)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zur weiteren Ausdifferenzierung der von Vogel ausgearbeiteten Pressesystematik kann die Klassifikation der Kinderzeitschrift von Sommer herangezogen werden, die in Abbildung 5 dargestellt ist. Sommer gliedert die Kinderzeitschrift nach drei Ordnungspunkten: die Trägerschaft, die inhaltliche bzw. formale Ausrichtung und das Zielgruppenalter. Bei der Trägerschaft unterscheidet er die Kundenzeitschriften von den Verlagszeitschriften. Die Kundenzeitschrift entspricht dabei der Kontaktpresse im Sinne Vogels. Die Verlagszeitschrift teilt Sommer nach inhaltlichen und formalen Aspekten in drei Kategorien ein: Die Comic-Zeitschriften mit über 75 Prozent Comic-Anteil, die Magazine mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Inhalte und Formen sowie die Beschäftigungszeitschriften, die hauptsächlich Anleitungen und Material zum Spielen, Malen oder Basteln abdrucken. Schüler- bzw. kindereigene Publikationen, Kinderseiten in Erwachsenenzeitungen oder -zeitschriften sowie Mitgliederzeitschriften werden ausgeklammert, da diese Publikationen in ihrer Bedeutung für die Kinder nur schwer mit herkömmlichen Zeitschriften zu vergleichen seien. Als drittes Unterscheidungsmerkmal wählt Sommer das Alter der Zielgruppe. Hier unterscheidet er zwischen den für diese Arbeit vermutlich weniger relevanten Leseanfängermagazinen sowie den Schülermagazinen. (1994, S. 22-23) Unter einer Kinderzeitschrift sollen im Rahmen dieser Untersuchung demnach Magazine, Comiczeitschriften, Beschäftigungszeitschriften sowie Kundenzeitschriften im Sinne der Definitionen von Sommer verstanden werden.
Abbildung 5: Klassifikation der Kinderzeitschrift (Sommer, 1994, S. 23)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2 Der Kinderzeitschriftenmarkt
Marktführend sind die Comic-Zeitschriften. Ganz auf Unterhaltung ausgerichtet bieten sie neben Bildergeschichten oft auch kurze Sachbeiträge, Spiele, Witze oder Rätsel, häufig sind auch Kleinanzeigen der Kinder. Die Comic-Zeitschriften werden hauptsächlich über den Kiosk oder Handel vertrieben und in erster Linie durch den Heftverkauf finanziert. (Sommer, 1994, S. 226-227) Der Anteil der Werbeerlöse am gesamten Bruttoumsatz liegt nach Angaben des Ehapa Verlages bei etwa 10 Prozent (Hansen, 2005, S. 53). Eine Sonderform der Comic-Zeitschriften sind die japanischen Manga, die sich seit den 1990er Jahre in Deutschland etabliert haben. Mittlerweile erscheinen allein bei den größten deutschen Manga-Verlagen Carlsen, Egmont Manga und Anime (EMA), Planet Manga (Manga-Label von Panini Comics) und TOKYOPOP monatlich über 60 Manga-Bände. Die Entwicklung des Manga-Booms in Deutschland lässt sich zum Beispiel an den Umsatzzahlen des Carlsen-Verlags ablesen: Während der Verlag 1995 Mangas für knapp 400.000 Euro verkaufte, lag sein Manga-Umsatz im Jahr 2000 bei über 4 Millionen Euro und im Jahr 2002 bei über 16 Millionen Euro. (http://de.wikipedia.org/wiki/Manga) Dabei erzielten die Verlage ihre größten Erfolge auf dem Kinder- und Jugendzeitschriftenmarkt. Gerade in Kombination mit Animes im Fernsehen und Kartenspielen erfreuen sich Serien wie 'Dragonball', 'Pokémon' und 'Yu-Gi-Oh!' – für die Mädchen 'Sailor Moon' und 'Wedding Peach', größter Beliebtheit. (www.manga-geschichte.de/html/manga4.html)
Konzeptionell ist auch den Schülermagazinen die Unterhaltung am Wichtigsten, Comics wie auch fiktionale Textgeschichten lassen sich hier aber nur wenig finden, stattdessen liegt der Schwerpunkt auf sachinformierenden Texten, die sich inhaltlich an den Schulfächern ausrichten. Als Herausgeber fungieren oft pädagogische Vereinigungen; der Vertrieb ist in der Regel über Schul-Sammelabonnements organisiert. (Sommer, 1994, S. 227)
Als tatsächliche Konkurrenz zu allen bisher genannten Publikationstypen sind die Kundenzeitschriften anzusehen. Sie sind kostenlos zu haben, in ihrer Konzeption auf Unterhaltung, Spiel und Spaß angelegt und bieten sowohl Comics, Rätsel, Witze wie auch Sachtexte und Tipps. (Sommer, 1994, S. 227) Bei den Inhalten sind zwar bestimmte Themenschwerpunkte zu erkennen, die etwas mit der Branche zu tun haben, für die die jeweilige Kundenzeitschrift gedacht ist, doch bieten sie grundsätzlich nichts anderes als Sachtexte wie in Schulmagazinen. Dies trifft auch auf Comics zu, die in ihrer inhaltlichen Ausrichtung sich nicht eindeutig denen in Comic-Zeitschriften unterscheiden. Meist treten die Kinderzeitschriften für die grundlegende Intention der Brachen oder Organisation ein, wie z.B. das Thema 'Gesundheit' bei den Heften der Apotheken oder der Spargedanke für die Hefte der Geldinstitute. Unter ihnen gibt es wenige, die gezielt für ein Produkt werben. Es dominiert der Typ, der für eine Branche durch einen beauftragten Verlag publiziert wird. (Sommer, 1994, S. 108) Als Vertreter dieses Typs ist beispielsweise die in Apotheken ausgelegte Kinderzeitschrift 'medizini' zu nennen, die regelmäßig in einer Auflage von rund 2 Millionen Stück gedruckt wird (IVW/PZ-Online).
Auf dem deutschen Kinderzeitschriftenmarkt führend ist die Ehapa Verlagsgruppe. Die 1951 gegründete Verlagsgruppe gehört zur dänischen Egmont Gruppe, die in 22 Ländern einen Jahresumsatz von rund 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, zu dem die deutsche Egmont Holding, Berlin, etwa 150 Millionen Euro dazu beisteuert. Neben Comic-Klassikern wie 'Asterix' und 'Lucky Luke' bringt der Verlag nahezu zwei Dutzend Magazine für Kinder heraus, darunter das 'Micky Maus Magazin', 'Wendy', 'Winnie Puuh', 'Witch', 'Benjamin Blümchen', 'Disneys Prinzessin', 'Barbie' und 'Bibi Blocksberg', acht der zehn auflagenstärksten Titel im Kinderzeitschriftenmarkt, wie Abbildung 6 zeigt.
Abbildung 6: Top 10 der Kinderzeitschriften nach verkaufter Auflage (IVW/PZ-Online)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach eigenen Angaben konnte der Ehapa Verlag seine verkaufte Auflage in den letzten vier Jahren um 15 Prozent steigern und kommt damit auf eine monatliche Käuferreichweite von 71 Prozent (Hansen, 2005, S. 52).
Als unverzichtbare Fähigkeiten im Markt der Kinderzeitschriften nennt Hansen, Geschäftsleiter bei Ehapa, Schnelligkeit und Innovativität. "Wir testen zwischen fünf und zehn Zeitschriften im Markt und im Schnitt kommen drei bis fünf Newcomer dann tatsächlich auf den Kiosk." (Hansen, 2005, S. 53)
Um sich auf dem schnelllebigen und engen Markt behaupten zu können, haben die Verlage verschiedene Strategien entwickelt: Viele Verlage publizieren im Rahmen einer Produktdifferenzierung einen 'Ableger' ihrer Zeitschrift. Eine beispielhafte Umsetzung einer erfolgreichen Produktdifferenzierung kann Gruner+Jahr mit dem 1976 aus dem 'Stern' heraus entstandenen Titel 'Geo' vorweisen. Die Zeitschrift entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer sechsteiligen 'Geo'-Gruppe, zu der seit 1997 auch 'Geolino' gehört, mit der die 'Geo'-Familie bereits in jüngeren Zielgruppen verankert werden soll. (Wehrle, Busch, 2002, S. 91) 2001 erschien Geolino mit einer verkauften Auflage von 168.898 erstmalig als monatliches Heft. Seitdem klettern die Auflagenzahlen kontinuierlich nach oben und haben im 1. Vierteljahr 2005 den Höchststand von 272.418 verkauften Exemplaren erreicht. (IVW/PZ-Online)
Eine Ausdifferenzierung des Programms zeigt sich außerdem in der Veröffentlichung von Zeitschriften, die sich an ein spezifisches Alter wenden. Seit Juni 2002 gibt es die Zeitschrift 'Bibi und Tina', die ebenso wie das 'Bibi Blocksberg'-Magazin im Egmont Ehapa Verlag erscheint und seit dem die Medienfigur 'Bibi Blocksberg' auch für die älteren 'Bibi'-Fans zwischen zehn und 13 Jahren attraktiv positioniert (IVW/PZ-Online). Als weitere Marktstrategie fällt auf, dass insbesondere in Comics auf Handlungsträger zurückgegriffen wird, die auch in anderen Medien bzw. auf dem Spielzeugmarkt verbreitet werden. Hier greift das Prinzip des Merchandising, bei dem Rechte an Figuren und Stoffen an verschiedene Linzenznehmer verkauft werden und dadurch die öffentliche Präsenz und die Popularität dieser Stoffe steigern. (Sommer, 1994, S. 228-229; Bachmair, 1997, S. 159)
Als deutsche Lizenznehmer für Disney, aber auch mit Lizenzen für 'Asterix', 'Benjamin Blümchen' und 'Bibi Blocksberg' oder 'Diddl' ist insbesondere der Ehapa Verlag höchst erfolgreich (http://www.spotting-image.de/detail.html?12; http://www.ehapa.de/ehapa/e14/
e40/index_ger.html).
Eine zusammenfassende Betrachtung der Auflagenentwicklung aller Kinderzeitschriften ist leider nicht möglich. Die Gründe hierfür sind vielfältig und können hier nur angedeutet werden: So werden Kinderzeitschriften in der Regel als Teil der Jugendzeitschriften aufgeführt, eine getrennte Betrachtung der Auflagenentwicklung ist kaum möglich. Nur ein Bruchteil der Auflagentitel ist darüber hinaus überhaupt gemeldet, schließlich spielen Werbeeinnahmen für dieses Zeitschriftensegment nur eine untergeordnete Rolle. Hinzu kommen die kostenlos verteilten Kundenzeitschriften, die im Segment der Kinderzeitschriften durchaus von Bedeutung sind, jedoch keine Verkaufszahlen vorlegen können. Aus diesem Grund muss ich mich auf eine beispielhafte Darstellung der Auflagenentwicklung der Disney-Comic-Zeitschrift 'Micky Maus' beschränken. Micky Maus kann sowohl bei den jüngeren Kindern im Alter von 6 bis 9 als auch bei den 10- bis 13-Jährigen die höchste verkaufte Auflage auf dem Kinderzeitschriftenmarkt vorweisen und ist bereits seit 1979 bei der IVW registriert (IVW/PZ-Online).
Wie in Abbildung 7 dargestellt, befand sich die verkaufte Auflage der 'Micky Maus' von 1979 bis 1990 auf relativ konstantem Niveau von knapp 400.000 verkauften Exemplaren, stieg von 1990 auf 1991 sprunghaft auf den Spitzenwert von 801.017 verkaufte Exemplare an und sank ab 1997 wieder kontinuierlich bis zu einer verkauften Auflage 392.201 ab um sich dann wieder auf einem relativ konstanten Niveau zu halten, das nur leicht über dem vor 1990 liegt. Den Boom zwischen 1990 und 1997 führt Hansen, Geschäftsleiter des Egmont Ehapa Verlages auf die deutsche Wiedervereinigung zurück (2005, S. 53). Sieht man von diesem besonderen Ereignis ab, lassen sich – zumindest bezogen auf die 'Micky Maus' – über die Zeit hinweg sehr stabile Auflagenzahlen festhalten.
Abbildung 7: Die Entwicklung der verkauften Auflage von 'Micky Maus' von 1979 bis 2005 (IVW/PZ-Online)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.3 Die Nutzung der Kinderzeitschrift
72 Prozent der Zweit- bis Fünftklässler liest nach einer Untersuchung von Mädler und Plath Zeitschriften (2000, S. 171-172). Die Medienforschung Super RTL stellt bei 80 Prozent der 6- bis 13-Jährigen eine gelegentliche Nutzung fest ('Kinderwelten 2002'). Die subjektive Bedeutung der Zeitschrift für die Kinder macht sich auch in ihren Taschengeldausgaben für dieses Medium bemerkbar: 58 Prozent der 6- bis 12-Jährigen verwenden ihre durchschnittlich 16 Euro Taschengeld im Monat[7] auch für Comics, Zeitschriften oder Bücher ('IJF Taschengeldkalender 2004'; 'KidsVerbraucherAnalyse 2003'). Der Großteil der Kinder wendet für die Zeitschriftenlektüre ca. zwei bis maximal fünf Stunden pro Woche bzw. täglich ungefähr eine halbe Stunde auf ('Kinderwelten 2002'). Zeitschriften werden in erster Linie allein gelesen, was aber nicht ausschließt, sie auch einmal mit Freunden durchzublättern. Die der Zeitschrift entnommenen Informationen oder Themen werden dabei durchaus im Freundeskreis kommuniziert, gerne wird die Zeitschrift untereinander auch ausgetauscht. ('Kinderwelten 2004; 2002') Die Vielfalt der genutzten Kinderzeitschriften konnten Mädler und Plath in einer Untersuchung feststellen, bei der Schüler der Klassen 1 bis 5 unter anderem nach gern gelesenen Zeitschriften gefragt wurden. Insgesamt gaben die Kinder 918 Zeitschriften an, davon 175 unterschiedliche Zeitschriftentitel, von denen 98 nur einmal genannt wurden. (2000, S. 173) Die Top 10 der reichweitenstärksten Kinderzeitschriften sind aufgeschlüsselt in die Altersgruppen 6 bis 9 Jahre und 10 bis 13 Jahre in Tabelle 1 dargestellt ('KidsVerbraucherAnalyse 2004).
Tabelle 1: Die Top 10 der Kinderzeitschriftentitel in den Altersgruppen 6 bis 9 und 10 bis 13 Jahre nach Reichweiten ('KidsVerbraucherAnalyse 2004')
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Disney-Comic-Zeitschriften 'Micky Maus', 'Donald Duck Sonderheft' und 'Disneys Lustiges Taschenbuch' dominieren in beiden Altersgruppen 'Benjamin Blümchen', 'Bibi Blocksberg', 'die Maus', 'Pumuckl' und 'Winnie Puuh' sprechen nur die jüngeren Kinder von 6 bis 9 Jahren an. An ihre Stelle treten bei den 10- bis 13-Jährigen die Mädchenzeitschrift 'Girls Club', Pferde- und Tierzeitschriften sowie das Anime-Magazin 'Kids Zone'.
Schülermagazine spielen nach den Ergebnissen von Mädler und Plath für die Kinder keine Rolle, Special-Interest-Zeitschriften sind für Grundschüler ebenfalls nur von geringer Bedeutung. Als einzige Ausnahme heben sie die Zeitschrift 'Bravo Sport' hervor, die bei Jungen mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt. (2000, S. 174) Insgesamt betrachtet sind Häufungen besonders bei den Zeitschriften zu registrieren, die auf Unterhaltung, Entspannung und Spaß ausgerichtet sind (Mädler, Plath, 2000, S. 174). Mädchen interessieren sich darüber hinaus bereits im Grundschulalter für Zeitschriften, die Emotionalität, Beziehungen, Liebe und Freundschaft zum Thema haben (Mädler, Plath, 2000, S. 176).
Mädler und Plath stellen einen Zusammenhang zwischen Buchlektüre und Zeitschriftennutzung heraus. Dabei greifen Kinder, die sehr gern lesen, nicht nur signifikant häufiger zum Buch, sondern auch zur Zeitschrift. Während allerdings Schüler, die gern bzw. sehr gern lesen, das Buch eindeutig präferieren, ist dies bei Schülern, die nicht so gerne lesen, umgekehrt. Sie wenden sich, wenn sie lesen, deutlich häufiger den kürzeren Lesestoffen der Zeitschrift zu. Dies erklärt die Bevorzugung der Buchlektüre bei den Mädchen, die allgemein lieber lesen und den Gleichklang zwischen Zeitschrift und Buch bei den in der Regel lesescheuen Jungen. (2000, S. 171-172) Dies bestätigt ein Untersuchungsergebnis von Bischof und Heidtmann wonach mehr als die Hälfte der Jungen, die Bücher mit erzählender Literatur lesen, auch regelmäßig Comics nutzen, in der Altersgruppe der sechs- bis neunjährigen Jungen werden dieser Studie zu Folge Comics insgesamt sogar zeitaufwändiger rezipiert als Bücher. So würden die Jungen, die selten oder unregelmäßig Bücher lesen, zu mehr als 20 Prozent regelmäßig Comics nutzen. (2002, S. 255-256) Jungen im Grundschulalter würden sich dabei vor allem für Medienverbund-Comics interessieren, was Bischof und Heidtmann auch darauf zurückführen, dass sich der Lektüreaufwand für die Jungen durch den geringen Textanteil in Maßen hält (2002, S. 263).
[...]
[1] Siehe auch Kapitel 2.1 'Die Persönlichkeitsentwicklung' sowie Kapitel 4.7 'Das Struktur- und Prozessmodell der Medienrezeption'
[2] Siehe auch Kapitel 4.6 'Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse'
[3] Siehe auch Kapitel 4.2 'Para-soziale Interaktion'
[4] Aus dem amerikanischen Schulsystem: Nach der Einschulung im Alter von sechs Jahren gehen die meisten Kinder bzw. Jugendlichen zwölf Jahre zur Schule. Davon entfallen sechs Jahre auf die Grundschule (Elementary bzw. Primary School) und sechs Jahre auf die High School (Secondary School), die im Alter von 13 bis 18 Jahren besucht wird. (http://de.wikipedia.org/wiki/Schulsystem_in_USA)
[5] Zu Freizeitaktivitäten lagen keine Studien vor, die sich nur auf 8- bis 11-Jährige (diese Altersgruppe wurde für die vorliegende Untersuchung gewählt) bezogen. Aus diesem Grund werden hier – unter Annahme gleicher Stichprobengrößen - Durchschnittswerte aus den Altersgruppen 8 bis 9 Jahre und 10 bis 11 Jahre angegeben.
[6] Zu Freizeitaktivitäten differenziert nach Geschlecht lagen keine Studien vor, die sich nur auf 8- bis 11-Jährige bezogen. Die nach Geschlecht differenzierte Betrachtung bezieht sich deshalb auf die Altersgruppe 6 bis 13 Jahre.
[7] Angaben zur Höhe des Taschengeldes liegen nur differenziert nach Altersgruppen und Geschlecht vor. Der Wert von 16 Euro ist ein ‑ unter Annahme je gleicher Stichprobengrößen ‑ errechnet worden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832494001
- ISBN (Paperback)
- 9783838694009
- DOI
- 10.3239/9783832494001
- Dateigröße
- 2.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Kommunikationswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- qualitative studie mediennutzung zeitschriftennutzung motive gratifikationen
- Produktsicherheit
- Diplom.de