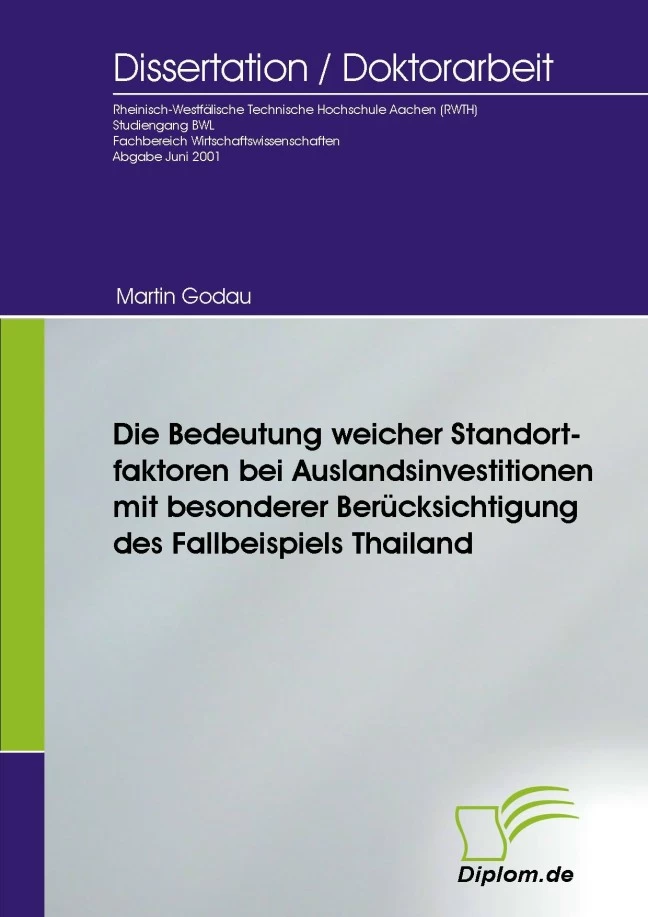Die Bedeutung weicher Standortfaktoren bei Auslandsinvestitionen mit besonderer Berücksichtigung des Fallbeispiels Thailand
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung weicher Faktoren bei Auslandsinvestitionen und ist somit thematisch im Umfeld der Internationalisierung und Globalisierung angesiedelt. Unternehmen sehen sich in fernen Ländern im Vergleich zum Heimatmarkt teilweise ganz neuen Bedingungen gegenübergestellt. Zu diesen gehören insbesondere auch die sogenannten weichen Standortfaktoren. Ihre Wirkungsweise lässt sich gerade anhand von Asien mit seinen soziokulturellen Besonderheiten und dort wiederum speziell am Beispiel Thailands eindrucksvoll verdeutlichen. Das erste Kapitel hat zum einen die Aufgabe, den Leser auf die Thematik weicher Standortfaktoren und das Umfeld der internationalen Unternehmenstätigkeit einzustimmen; zum anderen wird die Notwendigkeit der eigenen Untersuchung, unter Vorwegnahme der Ergebnisse des zweiten Kapitels, mit den bestehenden empirischen Erkenntnislücken begründet.
Im zweiten Kapitel wird nach erfolgter Definition grundlegender Begriffe der Stand der Forschung (State of the Art) zum engeren Thema der Arbeit dargestellt. Dieser lässt sich untergliedern in das Forschungsgebiet der weichen Standortfaktoren an sich und den Theoriekomplex der internationalen Standortwahl bei Auslandsinvestitionen. Dabei zeigt sich, dass es mit Grabow und Diller seit Mitte der 90er Jahre durchaus zu einer ernsthaften wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit weichen Faktoren bei innerdeutschen Standortentscheidungen kam. Weiche Standortfaktoren haben dabei entweder direkte Auswirkungen auf die Unternehmenstätigkeit (weiche unternehmensbezogene Faktoren) oder sind primär für die Entscheidungsträger relevant (weiche personenbezogene Faktoren). Die Dissertationen von Goette, Truijens, Autschbach und Hummel, um nur einige zu nennen, beschreiben, wie Unternehmen internationale Standorte wählen. Gerade Goette nimmt auch sehr detailliert auf den zugrundeliegenden Entscheidungsprozeß Bezug. Inwieweit weiche Faktoren dabei eine Rolle spielen wird jedoch nur am Rande angedeutet. Ist schon die Theorie der Standortentscheidungen nicht völlig konsequent auf die internationale Fragestellung erweitert worden, so lassen sich bei den weichen Faktoren noch nicht einmal Versuche einer Übertragung erkennen. Des Weiteren zeigt sich in der Literatur in zahlreichen Faktorkatalogen eine uneinheitliche Begrifflichkeit von Standortbedingungen und Zielen der Standortwahl.
Das dritte Kapitel knüpft zum Teil an die Erkenntnisse […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSÜBERSICHT
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Hinführung und Begründung der Themenwahl
1.2 Ausgangsfragen und Aufbau der Arbeit
2 GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG
2.1 Begriffsdefinitionen
2.1.1 Arbeitsdefinition weicher Standortfaktoren
2.1.2 Zum Begriff der Auslandsinvestition
2.1.3 Definition weiterer Begriffe
2.2 Das Forschungsgebiet „weiche Standortfaktoren“
2.2.1 Die Untersuchung von Grabow
2.2.2 Die Untersuchung von Diller
2.2.3 Weitere empirische und theoretische Beiträge
2.3 Ansätze der internationalen Standortwahl
2.3.1 Von der nationalen zur internationalen Standorttheorie
2.3.3 Der Ansatz von Goette
2.3.5 Der Ansatz von Tesch
2.3.6 Der Ansatz von Sabathil
2.4 Zwischenergebnis
3 THESEN, BEZUGSRAHMEN UND METHODIK
3.1 Thesen
3.2 Bezugsrahmen
3.2.1 Zielsysteme und Zielhierarchien
3.2.2 Unternehmensbezogene Oberziele der Auslandsinvestition
3.2.2.1 Gewinn, Unternehmenssicherung und Unternehmenswachstum
3.2.2.2 Alternative Oberziele
3.2.3 Unternehmensbezogene Bereichsziele der Auslandsinvestition
3.2.3.1 Absatzmarktorientierte Ziele
3.2.3.2 Produktionsorientierte Ziele
3.2.3.3 Beschaffungsorientierte Ziele
3.2.3.4 Finanzwirtschaftliche Ziele
3.2.4 Personenbezogene Ziele der Auslandsinvestition
3.2.5 Zusammenhang zwischen Zielen und Standortfaktoren
3.2.6 Zusammenhang zwischen harten und weichen Standortfaktoren
3.2.7 Zusammenspiel von Zielen, Alternativen und Umwelteinflüssen
3.2.8 Entscheidungsprozesse
3.3 Forschungskonzeption und -methodik
4 EINFLUSS DER STANDORTBEDINGUNGEN AUF DIE STANDORTFAKTOREN
4.1 Systematik der Standortbedingungen
4.2 Wirtschaftliche Standortbedingungen
4.2.1 Allgemeine Wirtschaftsentwicklung
4.2.2 Absatzmarkt
4.2.3 Arbeitsmarkt
4.2.4 Infrastruktur
4.1.5 Bedeutung als Standortfaktor
4.3 Politisch-rechtliche Standortbedingungen
4.3.1 Politische Grundordnung und Rechtssystem
4.3.2 Steuer- und Devisenrecht sowie gewerblicher Rechtschutz
4.3.3 Rechte ausländischer Investoren
4.3.4 Investitionsanreize
4.2.5 Bedeutung als Standortfaktor
4.4 Natürlich-geographische Standortbedingungen
4.4.1 Geographische Daten
4.4.2 Klima
4.4.3 Flora und Fauna
4.3.4 Bedeutung als Standortfaktor
4.5 Geschichtliche Standortbedingungen
4.5.1 Historischer Überblick
4.5.2 Politische Geschichte
4.5.3 Monarchie und Königshaus
4.5.4 Nationale Identität
4.5.5 Bedeutung als Standortfaktor
4.6 Soziokulturelle Standortbedingungen
4.6.1 Sprache
4.6.1.1 Die thailändische Sprache
4.6.1.2 Fremdsprachendichte
4.6.1.3 Bedeutung als Standortfaktor
4.6.2 Religion
4.6.2.1 Grundlagen des Buddhismus
4.6.2.2 Der Buddhismus in Thailand
4.6.2.3 Bedeutung als Standortfaktor
4.6.3 Soziokulturelles Umfeld
4.6.3.1 Gesicht und Harmonie
4.6.3.2 Hierarchie und Status
4.6.3.3 Zeitverständnis
4.6.3.4 Nonverbale Kommunikation
4.6.3.5 Soziokulturelles Umfeld als Ganzes
4.6.3.6 Bedeutung als Standortfaktor
4.7 Zwischenergebnis
5 EINFLUSS DES EntscheidungsprozeSSES AUF DIE STANDORTFAKTOREN
5.1 Phasenmodelle der Standortwahl
5.2 Impuls zur Auslandsinvestition
5.2.1 Bedeutung des Impulses
5.2.2 Herkunft des Impulses
5.2.3 Einfluß bisheriger Auslandserfahrungen
5.2.4 Bedeutung weicher Faktoren
5.3 Konzeptphase
5.3.1 Die Standortwahl als Teil der Gesamtstrategie
5.3.2 Die Form der Auslandsinvestition
5.3.2.1 Tiefekriterium
5.3.2.2 Einflußkriterium
5.3.2.3 Bestandskriterium
5.3.3 Bedeutung weicher Faktoren
5.4 Ländervorauswahl
5.4.1 Eingrenzung des Suchraumes
5.4.2 K.O.-Faktoren
5.4.3 Bedeutung weicher Faktoren
5.5 Grob- und Feinanalyse
5.5.1 Untersuchungskriterien
5.5.2 Informationen
5.5.3 Analytische Bewertungsverfahren
5.5.4 Bedeutung weicher Faktoren
5.6 Entscheidung
5.6.1 Organisation der Entscheidung
5.6.2 Entscheidungsfindung
5.6.3 Umwelteinflüsse
5.6.4 Standortbezogene Einflüsse
5.6.5 Subjektive Einflüsse
5.6.6 Bedeutung weicher Faktoren
5.7 Implementation
5.7.1 Realisation der Standortentscheidung
5.7.2 Bedeutung weicher Faktoren
5.8 Zwischenergebnis
6 SYSTEMATIK WEICHER STANDORTFAKTOREN
6.1 Reduktion auf Metafaktoren
6.2 Investitionsklima
6.3 Arbeits- und Geschäftskultur
6.4 Lebensqualität
6.5 Image
6.6 Persönliche Präferenzen
6.7 Zwischenergebnis
7 DISKUSSION DER ERGEBNISSE UND KRITISCHE WÜRDIGUNG
8 ZUSAMMENFASSUNG
Anhang
A Liste der Interviews
B Statistiken und Ländervergleiche
B.1 Wirtschaftsindikatoren ausgewählter asiatischer Länder
B.2 Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Südostasien und weltweit
B.3 Regionalstruktur der deutschen Direktinvestitionen im Ausland 1982-1997
B.4 Kenngrößen der deutschen Unternehmen in Thailand
B.5 Investitionsbedingungen ausgewählter ASEAN-Länder im Vergleich
LITERATURVERZEICHNIS
„Die Zeit des Daseins ist uns bestimmt, seinen Ort zu wählen aber sind wir weithin frei. Den rechten Standort finden, gehört mit zu einem gelungenen Leben, - aber auch mit zu einer geglückten Unternehmung.“
August Lösch
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Begriffspaare von Standortfaktoren
Tabelle 2: Standortfaktoren nach Grabow im Überblick
Tabelle 3: Relevanz einiger weicher Faktoren nach Stufen der Standortwahl
Tabelle 4: Merkmale der weichen, harten und unsicheren Faktoren
Tabelle 5: Ziele für die Vornahme von Auslandsinvestitionen
Tabelle 6: Vergleich verschiedener Gliederungsansätze für die Standortbedingungen
Tabelle 7: Wirtschaftliche Prognose für Thailand
Tabelle 8: Nettozuflüsse von Auslandsinvestitionen nach Thailand
Tabelle 9: Einkommenswachstum in Asien 1965-1990
Tabelle 10: Thailändischer Außenhandel nach Ländern
Tabelle 11: Thailändische Durchschnittslöhne
Tabelle 12: Wirtschaftliche Standortbedingungen als Standortfaktor
Tabelle 13: Investitionsbedingungen ausgewählter ASEAN- Staaten im Vergleich Seite 144f.
Tabelle 14: Politisch-rechtliche Standortbedingungen als Standortfaktor
Tabelle 15: Natürlich-geographische Standortbedingungen als Standortfaktor
Tabelle 16: Geschichtliche Standortbedingungen als Standortfaktor
Tabelle 17: Sprache als Standortfaktor
Tabelle 18: Religion als Standortfaktor
Tabelle 19: Soziokulturelles Umfeld als Standortfaktor
Tabelle 20: Verschiedene Phasenmodelle des Standortent- scheidungsprozesses
Tabelle 21: Bedeutung weicher Standortfaktoren in der Impulsphase
Tabelle 22: Dimensionen von Auslandsinvestitionen
Tabelle 23: Bedeutung weicher Standortfaktoren in der Konzeptphase
Tabelle 24: Bedeutung weicher Standortfaktoren in der Phase der Ländervorauswahl
Tabelle 25: Kriterienraster für die Makroanalyse im Rahmen der Standortwahl
Tabelle 26: Bedeutung weicher Standortfaktoren in der Phase der Grob- und Feinanalyse
Tabelle 27: Bedeutung weicher Standortfaktoren in der Entscheidungsphase
Tabelle 28: Bedeutung weicher Standortfaktoren in der Implementationsphase
Tabelle 29: Die gebildeten Metafaktoren und die subsumierten Einzelfaktoren Seite 269f.
Tabelle 30: Kennzahlen zur Lebensqualität in Thailand
Tabelle 31: Tourismus in Thailand: Einreisestatistik nach Ländern 1998
Tabelle 32: Charakteristik der weichen Standortfaktoren Thailands
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Wachstumsaussichten und Länderrisiken
Abbildung 2: Problemfenster der vorliegenden Arbeit
Abbildung 3: Weiche Standortfaktoren und angrenzende Begriffe
Abbildung 4: Bedeutung weicher Standortfaktoren in unterschiedlichen Phasen
Abbildung 5: Gewicht harter und weicher Faktoren nach Grabow
Abbildung 6: Standortfaktoren-Rangplätze im produzierenden Gewerbe nach Diller
Abbildung 7: Nationale und regional-lokale Komponenten von Standortbedingungen im Modell von Tesch
Abbildung 8: Zielbeziehungen bei Auslandsinvestitionen
Abbildung 9: Hierarchische Zielstrukturierung zur Ermittlung eines operationalen Zielkatalogs
Abbildung 10: Das Zielsystem bei Auslandsinvestitionen
Abbildung 11: Kontinuum der harten und weichen Standortfaktoren
Abbildung 12: Gegenseitige Beeinflussung der Teilmodelle des Entscheidungsproblems
Abbildung 13: Trichtermodell der Standortentscheidung
Abbildung 14: Thailand im Mittelpunkt der ASEAN-Region
Abbildung 15: Polarisierung der Häufigkeitsverteilung weicher und harter Standortfaktoren
Abbildung 16: Einfluß unterschiedlicher Unternehmens- organisationen auf die Standortentscheidung
Abbildung 17: Einfluß weicher Standortfaktoren im Entschei- dungsprozeß
Abbildung 18: Komponenten des Investitionsklimas
Abbildung 19: Kurve der kulturellen Anpassung
Abbildung 20: Spektrum der Haltungen gegenüber persönlichen Präferenzen und ihrer Entscheidungsrelevanz
Abbildung 21: Der Beitrag harter und weicher Standortfaktoren zur Zielerreichung der Auslandsinvestition
1 Einleitung
„Investieren im Ausland ist wirtschaftlicher und sozialer Prozeß zugleich.“[1]
1.1 Hinführung und Begründung der Themenwahl
Die Internationalisierung des Geschäfts ist ein langfristiger, dynamischer Prozeß, der für Unternehmen mit erfolgreichen Produkten nicht aufzuhalten ist.[2] Seit den siebziger Jahren sind internationale Investitionen immer mehr als Alternative zum Handel in Erscheinung getreten.[3] Nach den USA und Großbritannien ist Deutschland noch vor Japan und Frankreich der weltweit drittgrößte Auslandsinvestor.[4] Mit rund 58 Mrd. DM im Jahre 1997 haben sich die deutschen Direktinvestitionen im Ausland innerhalb von zehn Jahren fast verdreifacht.[5] Gemäß einer Umfrage des DIHT planten 1993 rund 30% aller westdeutschen Industrieunternehmen eine Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland.[6] Die gestiegene Bedeutung der Globalisierung für die Geschäftstätigkeit zeigt sich aber nicht nur in der Praxis, sondern auch in der einschlägigen Literatur. Als Folge der Auslandstätigkeit von Großunternehmen kam es regelrecht zu einem Wandel der betriebswirtschaftlichen Probleme.[7]
Aus der Internationalisierung ergeben sich für das Management neue Probleme und Herausforderungen, mit denen sich rein national agierende Firmen nicht konfrontiert sehen.[8] Die Vielzahl fremdartiger Kulturen und die unterschiedlichen natürlichen, ökonomischen, politischen und rechtlichen Umwelten erhöhen die Komplexität unternehmerischer Aktivitäten. Soziokulturelle Rahmenbedingungen wie Sprachbarrieren, Fremdenfeindlichkeit, Tradition und Geschichte, Religionen und deren Einfluß auf das Arbeitsverhalten sowie das Verhältnis zu Geld, soziale Bindungen, Arbeitsmoral, Korruptionsverbreitung und Zahlungssitten stellen weiche Standortfaktoren dar, die zu berücksichtigen sind. Eine Auslandsinvestition birgt neben vielen Chancen auch zahlreiche Risiken.[9] So kann eine falsche Standortwahl, insbesondere bei kleinen Firmen, die zukünftige Unternehmensentwicklung beeinflussen.[10] Deshalb kommt gerade dem Entscheidungsprozeß bei Auslandsinvestitionen eine strategisch wichtige Rolle zu. Dabei sind jedoch nicht nur quantitative, sondern auch zahlreiche qualitative Faktoren zu berücksichtigen.[11] Es ist betriebswirtschaftlicher Diskussionsstand, daß Firmen ganz allgemein in zunehmenden Maße mit weichen Daten umgehen müssen.[12] Immer häufiger werden in letzter Zeit auch die außergewöhnlichen Bedingungen, unter denen Auslandsengagements stattfinden, erkannt.[13] Der Begriff der „weichen Standortfaktoren“ verkörpert „schillernde Inhalte, über deren Kern es allenfalls stillschweigende Vereinbarungen gibt“.[14] Weiche Faktoren erklären, „warum Standortentscheidungen wider Erwarten anders ausfallen, als angenommen, also doch nicht allein auf der Grundlage von traditionellen ‚harten‘ Faktoren“.[15]
Nicht nur Berichte in der Fachpresse, sondern auch vereinzelte wissenschaftliche Fallstudien[16] deuten an, daß Investitionen meist unzureichend in die langfristige, strategische Unternehmensplanung integriert sind. Unsystematisch verlaufende Entscheidungsprozesse sind durchaus anzutreffen. Investitionsrechnungen werden entweder erst gar nicht vorgenommen oder die Ergebnisse werden nicht beachtet. Intuition und die Initiative einzelner Führungskräfte stellen oft die Basis der Auslandsinvestitionsentscheidung dar. Trotzdem wird dieses Phänomen[17] in der Literatur zur internationalen Unternehmenstätigkeit so gut wie gar nicht berücksichtigt. Hypothesen über die Auswirkungen nicht „lehrbuchgemäßer“ Entscheidungsverläufe auf den Erfolg der Internationalisierung liegen nicht vor.[18] Es wird in der Literatur akzeptiert, daß allgemeine wirtschaftliche Bedingungen auf das geschäftliche Verhalten einwirken. Den Autoren ist jedoch viel weniger bewußt, daß auch soziale Einflüsse von Bedeutung sind.[19] Kompensationsmöglichkeiten zwischen positiven und negativen Faktoren eines Standortes, persönliche Präferenzen[20] und das Risikoverhalten wurden bisher nicht untersucht.[21] Nur wenige Autoren stehen der klassischen Auffassung bezüglich des Entscheidungsverlaufs bei Auslandsinvestitionen kritisch gegenüber.[22] Dabei ist die Problematik seit langem bekannt.[23]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Asien hat in den neunziger Jahren stark von ausländischen Investitionen profitiert. Die Region wird als „power-house“ und „Wachstumsmotor“ der Weltwirtschaft bezeichnet (vgl. Abbildung 1).[24] Auch die deutschen Unternehmen wollen ihre Präsenz auf diesen Märkten verstärken.[25] Aufgrund der deutlichen kulturellen Distanz zu westlichen Ländern ist gerade Südostasien ein Musterbeispiel für die Erklärung weicher Faktoren.[26] Insbesondere am Beispiel Thailands, das in der Region mit den anderen Tigerstaaten[27] um die Gunst ausländischer Investoren wirbt, lassen sich besondere Bestimmungsgründe der Standortwahl zeigen. Zwischen den ASEAN[28] -Ländern bestehen dabei größere Unterschiede bezüglich der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als angesichts der oft pauschalen Betrachtung der Region zu vermuten wäre.[29] Eine Rangfolge der Länder bezüglich der Beliebtheit als Investitionsstandort kann nicht aufgestellt werden, da die Unternehmen den verschiedenen Standortfaktoren eine unterschiedliche Bedeutung beimessen. Thailand wird in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich Malaysia, Indonesien und den Philippinen gegenübergestellt, die von ihrem Entwicklungsstand her als alternative Standorte für ausländische Firmen anzusehen sind.[30] Die thailändische Investitionsförderbehörde, das Board of Investment (BoI), selbst sieht Malaysia als den stärkste Konkurrent im Wettbewerb um ausländische Unternehmen, gefolgt von Indonesien und den Philippinen.[31]
Die vorliegende Dissertation entstand vor dem Hintergrund der Asienkrise, die Mitte 1997 in Thailand begann und sich danach auf den gesamten Kontinent ausbreitete. Ihre Folgen waren auch im Jahr 2001 noch zu spüren. Hierdurch wurden die Rahmenbedingungen für Auslandsinvestitionen deutlich verändert. Bezüglich des Engagements deutscher Firmen in der Region lassen sich zwei Tendenzen erkennen. Zum einen ein gestiegenes Interesse, daß sich auf die „Gunst der Stunde“ mit vorteilhaften Währungsparitäten und mehr Zugeständnissen an ausländische Unternehmen zurückführen läßt.[32] Zum anderen eine Strategie des Abwartens und Zurückstellens bereits geplanter Projekte. Gerade die weichen Faktoren sind angesichts dieser Entwicklungen noch bedeutender geworden als zuvor.[33] Dies zeigt sich unter anderem an der Veränderung der relativen Standortqualitäten im Bereich der ASEAN. War Indonesien aufgrund des größten Marktes in Südostasien früher ein sehr beliebter Standort gewesen, so zeigten die ethnischen Auseinandersetzungen seit 1998, wie wichtig die soziale Stabilität eines Landes für Auslandsinvestoren ist. In diesem Sinne haben weiche Faktoren eine größere Bedeutung als harte. Am Beispiel von Firmen, die trotz des wirtschaftlichen Rückgangs ihre neu geplanten Investitionsprojekte zum Abschluß geführt haben, zeigt sich andererseits, daß nicht immer rein ökonomische Überlegungen dominierend sind. Es stellt sich deshalb die Frage, warum deutsche Unternehmen scheinbar mehr Kapital in Thailand angelegt haben als aufgrund der negativen Rahmenbedingungen zu erwarten war.[34] Insgesamt sind die ausländischen Investitionen in Thailand selbst in der gegenwärtigen Krisenzeit von 4,7 Mrd. US$ 1997 auf 6,9 Mrd. US$ Ende 1998 gestiegen.[35] Eine Umfrage des BoI zeigte, daß 45% der in Thailand aktiven ausländischen Firmen 1999 Erweiterungsinvestitionen planten.[36]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Problemfenster der vorliegenden Arbeit liegt die einführenden Überlegungen zusammenfassend im Schnittpunkt dreier Themenbereiche: Das thematische Umfeld der Auslandsinvestitionen, der Globalisierung und der multinationalen Unternehmen, das Erscheinungsbild oder das „Phänomen“ der weichen Standortfaktoren und dem Königreich Thailand als Fallbeispiel eines Investitionsstandorts. In Abbildung 2, Seite 23, wird dieser Zusammenhang graphisch dargestellt. Gerade in der Schnittmenge der drei Bereiche besteht, wie sich in Kapitel 2 zeigen wird, eine Erkenntnislücke.[37] Aus ihr heraus begründet sich die Themenwahl der vorliegenden Arbeit.
Das gewählte Thema kann dabei leicht zu der Auffassung führen, daß die isolierte Betrachtung der „soft factors“ herausgelöst aus der gesamten Standortproblematik, die mehrdimensionaler Natur ist, weder möglich noch sinnvoll sei. Darüber hinaus sind die weichen Eigenschaften eines Landes ja auch mit den harten, ökonomischen Qualitäten verwoben. Dazu ist zum einen anzumerken, daß die Multikausalität der Standortproblematik nicht die Existenz von durch weiche Faktoren dominierten Entscheidungen widerlegt, ebenso wie es Fälle gibt, die vor allem durch harte bestimmt werden. Zum anderen impliziert eine Beschäftigung mit weichen Aspekten ja nicht, daß die Querbeziehungen und Interaktionen mit anderen, namentlich „harten“ Standortfaktoren außer Acht gelassen werden. In der Tat sind viele Entscheidungen nur aus einer derartigen, integrierten Sichtweise heraus erklärbar. Es wird hier deshalb von einem Plädoyer für die Integration subjektiver Daten in die Standortlehre ausgegangen.[38]
1.2 Ausgangsfragen und Aufbau der Arbeit
Aus der gewählten Themenstellung ergeben sich eine Reihe von Ausgangsfragen: Welche weichen Faktoren treten speziell bei Auslandsinvestitionen auf? Wie wirken sie sich auf die Entscheidungsfindung aus? Was weiß man aus der Literatur dazu und was nicht? Inwieweit läßt sich vom Fallbeispiel Thailand abstrahieren und auf den Allgemeinfall schließen? Die Beantwortung dieser Fragen, die sich im Verlauf der Untersuchung weiter konkretisieren werden, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Aus den Antworten werden sich dabei zum Teil neue Fragen ergeben. Beispielsweise resultiert aus den in der Literatur vorhandenen Wissenslücken der Wunsch nach neuen Erkenntnissen. Aus der festgestellten Wirkung weicher Faktoren auf die Entscheidungsfindung ergibt sich die Frage, wie ein zu großer Einfluß verhindert werden kann.
Das folgende Kapitel 2 wird die Frage nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung auf dem Gebiet der weichen Standortfaktoren im allgemeinen und bei Auslandsinvestitionen im besonderen beantworten. Da zum engeren Thema der Arbeit tatsächlich nur wenige Beiträge existieren, ist es entsprechend kurz gehalten. In Kapitel 3 wird zunächst eine Reihe von Thesen aufgestellt, die sich zum einen aus der Literatur ableiten lassen und zum anderen eine didaktische Vorwegnahme der eigenen empirischen Erkenntnisse darstellen. Des weiteren wird ein Bezugsrahmen entwickelt, der die Grundlage der eigenen Untersuchung bildet. Abschließend wird die verfolgte Forschungsmethodik diskutiert. Kapitel 4 beschreibt die Standortbedingungen Thailands und untersucht die Frage, inwieweit sie mit den Zielen der Auslandsinvestoren zusammenhängen. Dabei werden erste Erkenntnisse gewonnen, die die im vorausgehenden Kapitel postulierten Thesen unterstützen. Es wird sich aber ebenfalls zeigen, daß zur vollständigen Erklärung weicher Standortfaktoren auch der Entscheidungsprozeß zu betrachten ist. Dies geschieht in Kapitel 5. Kapitel 6 trägt die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Kapitel zusammen und stellt sie aus einer anderen Sichtweise dar. Aus den zuvor identifizierten, weichen Standortfaktoren werden fünf Metafaktoren gebildet, die auch über den Standort Thailand hinaus eine mehr oder weniger allgemeine Gültigkeit aufweisen. Die Arbeit schließt mit der kritischen Würdigung bzw. Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 7) und einer Zusammenfassung (Kapitel 8) ab.[39]
2 GRUNDLAGEN UND STAND DER FORSCHUNG
„Alles, was mit einiger Sicherheit gesagt werden kann ist, daß sie bei der Standortentscheidung in irgendeiner Form berücksichtigt werden“.[40]
Im vorliegenden Kapitel wird untersucht wie der Stand der Forschung speziell zur Bedeutung weicher Faktoren bei Auslandsinvestitionen ist.[41] Teilkapitel 2.1 legt die für der Leser nötigen Grundlagen durch die Definition zentraler Begriffe. Danach wird in Teilkapitel 2.2 das Forschungsgebiet der weichen Standortfaktoren beschrieben. Letzteres beschäftigt sich bisher fast ausschließlich mit inländischen Investitionsentscheidungen. Die Theorie der internationalen Standortwahl, soweit man überhaupt schon von einem eigenständigen Forschungsgebiet sprechen kann, stellt eine Weiterführung der klassischen Standorttheorie dar und ist Gegenstand von Teilkapitel 2.3. Das vorliegende Kapitel schließt mit dem Zwischenergebnis (Teilkapitel 2.4) ab.
Das hier bearbeitete Thema berührt auch Fragestellungen, die in den Forschungsbereich anderer Theorien fallen, etwa entscheidungstheoretische, verhaltenstheoretische, motivationstheoretische, kulturbasierte und psychologische Ansätze. Dies liegt daran, daß die Bedeutungsentfaltung weicher Standortfaktoren in besonderem Maße von den Beteiligten der Standortwahl, dem zugrundeliegendem Entscheidungsprozeß und dem kulturellen Umfeld im bzw. der kulturellen Distanz zum Investitionsland abhängt. Da vor allem auch verhaltenswissenschaftliche Aspekte im Entscheidungsprozeß eine große Rolle spielen, erfordert die Beschäftigung mit weichen Standortfaktoren ein interdisziplinäres forschungsmethodisches Vorgehen.[42] Eine derart breite Fundierung der Prämissen des Unternehmerverhaltens scheint notwendig, da der Mensch nicht aufteilbar ist „in einen wirtschaftlichen Menschen und einen solchen, der sich in dieser oder jener anderen Sphäre betätigt. Überall steht er in seiner Ganzheit.[43] “ „Da Wirtschaften menschliches Handeln, menschliches Handeln aber keineswegs nur das Wirtschaften ist“[44], sollten zur Erklärung alle übrigen Wissenschaften, die sich mit dem menschlichen Verhalten befassen, mit einbezogen werden.
Insbesondere die vereinfachenden Annahmen der klassischen, ökonomischen Theorie weichen zum Teil so stark von der Realität ab, daß diese einen ineffizienten Bezugsrahmen für die Betrachtung von Investitionsentscheidungen darstellt.[45] In der vorliegenden Arbeit sollen deshalb in der Literatur bestehende Annahmen kritisch überprüft und das Problem der internationalen Standortwahl als Ganzes betrachtet werden. Die oben genannten Ansätze aus anderen Forschungsrichtungen werden an einzelnen Stellen, sofern nötig, zur Erklärung der empirischen Ergebnisse herangezogen. Ein Einbezug in die theoretischen Grundüberlegungen des vorliegenden Kapitels würde jedoch zu weit führen.
2.1 Begriffsdefinitionen
2.1.1 Arbeitsdefinition weicher Standortfaktoren
Alfred Weber prägte bereits 1909 den Begriff des Standortfaktors als „einen seiner Art nach scharf abgegrenzten Vorteil, der für eine wirtschaftliche Tätigkeit dann eintritt, wenn sie sich an einem bestimmten Ort oder auch generell an Plätzen bestimmter Art vollzieht“.[46] Der Begriff des weichen Standortfaktors hingegen ist eine Neuschöpfung aus den achtziger Jahren.[47] Neben den kulturellen und gesellschaftlichen Besonderheiten eines Standortes, dem Verhalten der Verwaltung und der politischen Entscheidungsträger, dem Wirtschafts- und Investitionsklima und der Lebensqualität, umfaßt er auch persönliche Präferenzen, Zufälle und sonstige, vermeintlich „irrationale“ Faktoren der Standortwahl. Ähnliche Inhalte verbergen sich hinter Bezeichnungen wie „sanfte Standortfaktoren“[48], „außerökonomische Faktoren“[49], „investor-spezifische Einflüsse“[50], „private Faktoren“[51] oder „kulturelle Standortfaktoren“.[52] Anstelle des Begriffs des weichen Faktors werden auch die Bezeichnungen „nichtquantifizierbare Faktoren“, „qualitative Kriterien“ und „qualitative Zielsetzungen“ verwendet.[53] Die englischsprachige Literatur spricht von „soft factors“ oder „soft facts“.[54] Dziembowska-Kowalska et al. unterscheiden dabei zwischen „soft“ und „quasi-soft“ factors.[55] Haigh definiert „nonquantifiable , subjective factors“ als Teilmenge der „non-cost factors“ der Standortwahl.[56] Azani und Khorramshagol sprechen von „intangible criteria“.[57] Diller sieht den begrifflichen Vorläufer weicher Faktoren in den sogenannten „mittelbar betriebsbezogenen Faktoren“.[58] Abbildung 3, Seite 29, versucht, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Begriffen anhand von Teilmengen darzustellen.
Die Analyse der einschlägigen Literatur zeigt, daß weiche Faktoren oft anhand von Begriffspaaren definiert bzw. erklärt werden. Hummel unterscheidet zwischen konventionellen und weichen Standortfaktoren.[59] Bullinger und
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Meinecke trennen in subjektive und objektive Faktoren.[60] Hummel unterscheidet Entscheidungsfaktoren prinzipiell in quantitative und qualitative.[61] Rüschenpöhler spricht im gleichen Zusammenhang von rechenhaften und nicht rechenhaften Faktoren.[62] Weber unterscheidet Standortfaktoren allgemein in natürlich-technische und gesellschaftlich-kulturelle.[63] Oft wird gemäß der historischen Entwicklung der Bedeutung von Standortfaktoren in klassische Faktoren (z.B. Fertigungsmaterial, Arbeitskraft, Abgaben, Energie) und moderne Faktoren (z.B. Kommunalpolitik, Wirtschaftsklima, Forschung/Wissenschaft, Lebensqualität) unterschieden.[64]
Bindlingmaier unterteilt die Nebenbedingungen der Standortwahl in ökonomische und außerökonomische.[65] Unter ökonomischen Nebenbedingungen versteht er dabei beispielsweise die Maximierung von Umsatz und Marktanteil, die Beschäftigung der Arbeiter, eine optimale Kapazitätsauslastung und größtmögliches Wachstum. Außerökonomische Nebenbedingungen liegen im Bereich Sicherheit, Machtstreben, Wahrung der Selbständigkeit, Gerechtigkeit, usw.
Jahreiß unterscheidet zwischen ökonomischen und metaökonomischen Standortfaktoren.[66] Der Begriff des metaökonomischen Faktors ist dabei weitgefaßt und ist am besten mit dem Begriff des Investitionsklimas zu beschreiben. Dadurch wird deutlich, daß nicht nur Kosten und Erlöse, sondern auch soziale und kulturelle Faktoren die Standortentscheidung bestimmen. Adebahr unterscheidet spezielle und generelle Faktoren der Auslandsinvestition. Spezielle Faktoren sind absatz- oder beschaffungsorientiert. Sie stellen die Voraussetzung für eine Investition dar. Die generellen Faktoren beziehen sich auf die politische Stabilität, das Rechtssystem, die Infrastruktur und staatliche Förderungsmaßnahmen.[67] Kreuter und Hansmeyer et al. fassen diese Begriffe etwas anders:[68] Generelle Faktoren stellen eine „conditio sine qua non“ dar; ein Standort kommt überhaupt nur dann in die engere Wahl, wenn diese Faktoren einem gewissen Anspruchsniveau genügen. Spezielle Standortfaktoren sind dagegen bei der Auswahl von potentiellen Standorten maßgebend. Inhaltlich weitgehend identisch ist die Zweiteilung in „ substitutionale “ und „ komplementäre “ bzw. „ limitationale “ Faktoren. Die komplementären Faktoren verkörpern dabei Mindestanforderungen. Sie sind eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für die Attraktivität eines Standortes. Umgekehrt sind substitutionale Faktoren gegeneinander aufrechenbar. Ein einzelner Faktor stellt keine unabdingbare Voraussetzung dar, eine Steigerung ihrer Qualität insgesamt aber führt kontinuierlich zu einer Erhöhung der regionalen Attraktivität.[69]
Tabelle 1, Seite 31, faßt die Vielfalt der Begriffspaare rund um weiche und harte Standortfaktoren zusammen. Ein Teil der Begriffe ist aus der Literatur entnommen, der Rest entstammt der eigenen Unternehmensbefragung.
Tabelle 1: Begriffspaare von Standortfaktoren
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der vorliegenden Arbeit wird ein Standortfaktor als „weich“ bezeichnet, wenn er entweder schwer quantifizierbar[71] bzw. meßbar ist, oder trotz bestehender Fakten auf der Basis von subjektiven Einschätzungen[72] beurteilt wird. Im Gegensatz zu einem harten besteht ein weicher Standortfaktor aus physischen und psychischen Komponenten, wobei letztere praktisch die externen Effekte der Investition darstellen. Die Subjektivität ist somit das wesentliche Element der Definition, da sie in beiden Fällen eine Rolle spielt. Weiche Standortfaktoren haben dabei entweder direkte Auswirkungen auf die Unternehmenstätigkeit (weiche unternehmensbezogene Faktoren) oder sind primär für die Entscheidungsträger relevant (weiche personenbezogene Faktoren).[73]
Diese von Grabow vorgeschlagene Unterteilung widerspricht der in der Literatur und von Praktikern häufig vertretenen Auffassung, weiche Standortfaktoren seien wirtschaftlich irrelevant und rein persönlicher Natur. Der häufigen Gleichsetzung von „weich“ mit „unwichtig“ wird sich auch in der vorliegenden Arbeit nicht angeschlossen. Eine weitere Eigenschaft weicher Faktoren besteht in der Schwierigkeit, ihren Einfluß auf die Standortentscheidung eines Unternehmens im Nachhinein zu bestimmen. Selbst vermeintlich harte Kriterien können teilweise subjektiven Einschätzungen unterliegen.[74] Insbesondere die häufig anzutreffende Definition weicher Faktoren auf der Grundlage des Rationalitätsbegriffs wird hier nicht gewählt. Interessant ist hingegen die Definition über ihre Rechenbarkeit bei Diller.[75] Weiche Faktoren sind demnach solche, die sich der betrieblichen Kostenrechnung grundsätzlich entziehen. Dziembowska-Kowalska et al. unterscheiden zwischen hart und weich aufgrund der direkten oder indirekten Wirkung auf den Unternehmensgewinn.[76] Erwähnenswert ist auch Kunzmann, der von nicht genau meßbaren Faktoren, die erklären sollen, „warum Standortentscheidungen wider Erwarten anders ausfallen, als angenommen“ spricht.[77]
2.1.2 Zum Begriff der Auslandsinvestition
Unter einer Auslandsinvestition im weiteren Sinne versteht man ganz allgemein eine Kapitalanlage außerhalb der Staatsgrenze des Investors. In §55 der Außenwirtschaftsordnung[78] wird sie als „Leistungen Gebietsansässiger, welche die Anlage von Vermögen in fremden Wirtschaftsgebieten zur Schaffung dauerhafter Wirtschaftsbeziehungen bezwecken“ definiert. Es kann zwischen privaten Auslandsinvestitionen und solchen der öffentlichen Hand unterschieden werden.
Auslandsinvestitionen werden hier als Kapitalanlagen im Ausland definiert, die zum Zwecke der unternehmerischen Betätigung durchgeführt werden, bei der eine direkte Einflußnahme auf die Geschäftstätigkeit gegeben ist. Nach diesem Verständnis fallen nicht nur Tochtergesellschaften, sondern auch Betriebsstätten, Niederlassungen, Representative Offices und Equity Joint Ventures unter den Begriff. Hauptkriterium für die Definition im Rahmen dieser Arbeit ist der Kapitaleinsatz im Ausland, der über die alternativen Formen der internationalen Unternehmenstätigkeit, wie Export und vertragliche Kooperation (Non-Equity Joint Ventures, Contractual Joint Ventures, Lizenzvergaben, Technologietransfer) hinausgeht. Auch letztere Betätigungsformen gehören zum Oberbegriff der investiven Internationalisierung, die zwei Formen hat:
- Kapitalgebundene Investition (equity investment)
- Kapitallose Investition (non-equity investment)
Die kapitalgebundene Form ist die Auslandsinvestition im engeren Sinne. Da bei der kapitallosen Form zwar kein Geld, jedoch Arbeitszeit und Know-how „investiert“ werden, stellt diese eine Auslandsinvestition im weiteren Sinne dar.[79] Es werden in der Literatur zwei Formen von kapitalgebundenen Auslandsinvestitionen unterschieden:
- Direktinvestitionen
- Portfolioinvestitionen
Beiden gemeinsam ist das Ertragsmotiv. Wesentliches Unterscheidungskriterium ist das bei der Direktinvestition vorhandene Kontrollmotiv . [80] Während bei der Portfolioinvestition[81] lediglich Anteile an ausländischen Unternehmen erworben werden, soll bei einer Direkt investition ein direkter Einfluß auf die Geschäftstätigkeit des betreffenden Unternehmens ausgeübt werden.[82] Portfolioinvestitionen sind tendenziell kurzfristig angelegt, womit dem Verhältnis von Rendite zu Risiko eine höhere Bedeutung zukommt. Über die Frage nach der erforderlichen Mindestkontrolle, um von einer Direktinvestition sprechen zu können, besteht in der Literatur keine Einigkeit. Für unsere Zwecke erscheint die Abgrenzung von Jahreiß sinnvoll, der allein das Vorliegen einer Kontroll absicht als entscheidendes Kriterium verwendet.[83]
Oft werden die Begriffe Direktinvestition und Auslandsinvestition einfach gleichgesetzt.[84] Während in der makroökonomisch orientierten Literatur der Begriff der ausländischen Direktinvestition dominiert, wird in mikroökonomischen Veröffentlichungen bevorzugt von Auslandsinvestitionen gesprochen, wobei der gleiche Sachverhalt gemeint ist. Da die vorliegende Arbeit betriebswirtschaftlich orientiert ist, wurde der Begriff der Auslandsinvestition gewählt. Um sprachliche Monotonien zu vermeiden, wird in Folge aber teilweise auch von Direktinvestitionen gesprochen. Ein großer Teil der begrifflichen Verwirrungen resultiert wohl aus eben dieser Vermeidung von häufigen Wiederholungen desselben Begriffs in längeren Abhandlungen.
Eine einheitliche Begriffsdefinition der Auslandsinvestition läßt sich in der Literatur nicht finden.[85] Allgemein einheitlich ist lediglich die Unterscheidung in eine direkte und eine indirekte Form. Glaum sieht Direktinvestitionen als „Auslandsinvestitionen mit unternehmerischer Zielsetzung“ an.[86] Buckley spricht sogar von „real investments“, um die Direktinvestition von der Portfolioinvestition abzugrenzen.[87] Die bekannteste und am häufigsten zitierte Begriffsdefinition stammt von der Deutschen Bundesbank, die solche Kapitalanlagen als Direktinvestitionen bezeichnet, die vom Investor „in der Absicht vorgenommen werden, einen unmittelbaren Einfluß auf die kapitalnehmenden Unternehmen zu gewinnen“, wobei eine Beteiligung von 25% als maßgeblich gilt.[88]
Die obige Definition ist auf die Bedürfnisse der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugeschnitten, die Aussagen über Kapitalströme und Bestände deut-scher Investitionen im Ausland machen will. Gerade deshalb ist sie aber nicht geeignet, das Engagement deutscher Unternehmen im Ausland vollständig zu beschreiben. Auch die Erschließung eines Exportmarktes kann einen beträchtlichen Kapitalaufwand im Ausland erfordern. Um Investitionen, die der Erschließung, Erhaltung und Ausweitung von Auslandsmärkten[89] dienen, zu erfassen, ist es also notwendig, den Direktinvestitionsbegriff zu erweitern. Dabei ist für eine Unternehmung, die zum ersten Mal daran denkt, ihre Produkte im Ausland abzusetzen, bereits die Informationsbeschaffung eine erste Investition. Diese Aufwendungen werden dem Auslandsmarkt zugerechnet und müssen durch Erträge von dort gedeckt werden. Somit handelt es sich um eine Investition in den Markt.[90] Das gleiche gilt für den Aufbau eines Außendienstes, die Errichtung von Verkaufsniederlassungen und Repräsentanten und die Schaffung einer Marktposition, bzw. eines Good-Wills durch Werbung, Verkaufsförderung oder persönliche Akquisition. Unter dem Aspekt der langfristigen Nutzung haben die dabei entstehenden Kosten Investitionscharakter.[91]
2.1.3 Definition weiterer Begriffe
Der Begriff des Ziels wird definiert als ein vorgestellter, verbal oder numerisch umschriebener, bewußt erstrebter sowie einen Wert darstellender Zustand.[92] Motive sind innere Beweggründe menschlichen Handelns und somit der Zielsetzung unmittelbar vorgelagert.[93] In zahlreichen Untersuchungen zur Erklärung von Auslandsinvestitionen wird anstelle einer Betrachtung von Zielen oder Motiven nach den Determinanten der Direktinvestition gefragt.[94] Eine klare Abgrenzung zu den vorgenannten Begriffen läßt sich nicht finden.[95] Oft werden diese drei Begriffe auch einfach synonym verwendet.[96] Um sprachliche Monotonien zu vermeiden wird sich dieser Praxis trotz bestehender Kritik angeschlossen.[97]
Präferenzen sind Einstellungen des Entscheiders zu Konsequenzen oder zu Handlungs alternativen.[98] Letztere werden synonym auch als Optionen oder Strategien bezeichnet. Unter einer Entscheidung soll die bewußte Auswahl einer Aktion aus einer Menge verfügbarer Maßnahmen unter Berücksichtigung möglicher Umweltzustände verstanden werden.[99] Umwelteinflüsse sind Ereignisse oder Zustände der Umwelt, die auf das Ergebnis der Entscheidung einen Einfluß haben, aber vom Entscheider nur teilweise oder gar nicht beeinflußt werden können.[100] Die Definition von Rationalität bringt einige Probleme mit sich. Es handelt sich nicht um eine objektive, beweisbare Eigenschaft, da man nur schwer feststellen kann, wie gut oder schlecht eine bestimmte Entscheidung ist. Deshalb kann man auch nicht von „irrational“ sprechen, sondern nur von „mehr oder weniger rational“.[101]
Der Standort ist der geographische Ort, an dem das Unternehmen Produktionsfaktoren zur teilweisen oder vollständigen betrieblichen Leistungserstellung einsetzt. Standortfaktoren sind alle Gegebenheiten eines Ortes, die seine Eignung für den Leistungsprozeß eines Betriebes bestimmen.[102] Aus dieser Definition läßt sich ein direkter Zusammenhang zwischen Standortfaktoren und Zielen der Unternehmung erkennen. Standortbedingungen sind im Vergleich dazu lediglich die (unbewerteten) Gegebenheiten eines Ortes.
Als Abgrenzung von der internationalen sollen die intranationale und die nationale Standortwahl unterschieden werden. Von intranationaler Standortwahl wird gesprochen, wenn es um die Wahl des inländischen Standortes, d.h. des Mikrostandortes, an einem ausländischen Standort geht. Die nationale Standortwahl bezieht sich auf die klassische Ressourcenallokation im Heimatland des betroffenen Unternehmens ohne Betrachtung des Auslands.
2.2 Das Forschungsgebiet „weiche Standortfaktoren“
2.2.1 Die Untersuchung von Grabow
Die Untersuchung von Grabow aus dem Jahr 1995 kann als das momentane Standardwerk im deutschsprachigen Raum zur Thematik weicher Standortfaktoren bezeichnet werden.[103] Es setzt an der Erkenntnislücke an, die sich aus den umfangreichen Aktivitäten der Kommunen zur Verbesserung ihres Images und anderen „weichen“ Qualitäten und den im Gegensatz dazu wenig fundierten Erkenntnissen zu diesem Thema ergibt. Dabei werden vier Ausgangshypothesen formuliert: Weiche Faktoren werden zum einen in ihrer globalen Bedeutung -bezogen auf die Standortwahl von Unternehmen - in der fachöffentlichen Diskussion deutlich überschätzt. Es gibt jedoch bestimmte Unternehmen oder Betriebe, unterscheidet man nach Branche, Betriebstypus, Größe des Betriebes oder Qualifikation der Beschäftigten, für die weiche Standortbedingungen eine erhebliche Rolle spielen. Weiche Standortfaktoren haben in unterschiedlichen Typen von Städten - z.B. Groß- oder Mittelstädten, Städten mit guten oder schlechten „weichen Qualitäten“ - unterschiedlichen Bedeutungsgehalt. Die Wirkung weicher Standortbedingungen im Zusammenhang mit der Bestandsentwicklung der Unternehmen wird bei weitem unterschätzt, insbesondere im Vergleich zur Wirkung in bezug auf die Ansiedlung von Unternehmen und Betrieben.
Nahezu alle grundsätzlich wichtigen Standortbedingungen - Transport, Arbeitsmarkt, Verfügbarkeit von Fläche und Kapital - haben mit einer Veränderung der Produktionsbedingungen, der Markteinzugsbereiche, der Tertiärisierung sowie dem technischen und gesellschaftlichen Wandel eine Veränderung ihres Bedeutungsgehaltes erfahren. Auch bei den weichen Standortfaktoren ist der Bedeutungswandel offensichtlich. Als Beispiele führt Grabow die Nachfrage nach bestimmten Formen von Kultur oder Freizeiteinrichtungen und die Anforderungen an das Wohnen an, die sich im Laufe der Jahrzehnte beträchtlich gewandelt hätten.
Zwei Befragungen bei insgesamt über 2000 Unternehmen und etwa 100 Expertengespräche mit kommunalen Akteuren und Unternehmensvertretern bilden die Grundlage der Aussagen Grabows zur Bedeutung harter und weicher Standortfaktoren. Sie machen es dem Autor zufolge möglich, beispielsweise nach Branchen und Betriebstypen zu differenzieren. Am Beispiel von neun Fallstudienstädten (Berlin, München, Wien, Augsburg, Würzburg, Ingostadt, Schweinfurt, Herne und Wolfsburg) wurden die Erkenntnisse über die Bedeutung weicher Standortfaktoren, über die Zufriedenheit mit Standortbedingungen und über kommunale Handlungsfelder konkretisiert.[104] Innerhalb seiner theoretischen Überlegungen räumt Grabow der Rolle von Bildern oder Images ein entsprechendes Gewicht ein. Die einzelnen Facetten des Themas „Bilder“ werden ausführlich betrachtet und eine Systematisierung oder Typologie verschiedener „Bildbestandteile“ vorgestellt. In folge beschäftigt sich Grabow mit Aspekten, die zum Verständnis des Zustandekommens und der Bedeutung von Standortentscheidungen wichtig sind. Der Autor beschreibt die unterschiedlichen Formen von Standortentscheidungen, die weit mehr ausmachen als Standortverlagerungen und Neugründungen, und das Ausmaß der Standortdynamik in Deutschland. Der Prozeß betrieblicher Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Standortwahl wird als betriebswirtschaftliches, organisationssoziologisches und organisationspsychologisches Thema behandelt, leider jedoch nur kursorisch, wie der Autor selbst eingesteht.[105] Neben der Präsentation der eigenen empirischen Ergebnisse, die hier in folge kurz zusammengefaßt wiedergegeben werden, setzt sich Grabow auch eingehend mit Städtetests und „Städtehitlisten“ auseinander, da deren Breiten- und Öffentlichkeitswirkung sehr groß ist und Hilfestellungen zu deren Aussagegehalt nötig sind.
Subjektive Präferenzen der Verantwortlichen für die Standortwahl haben, so ein Ergebnis der Untersuchung von Grabow, große Bedeutung. Sie spielen bei fast jeder zweiten Standortentscheidung eine erhebliche Rolle. Für ein Drittel der Befragten gehen die Standortwünsche wichtiger Mitarbeiter des Unternehmens in die Standortüberlegungen ein. Dies gilt vor allem für Branchen, in denen weiche Faktoren eine besonders wichtige Rolle spielen, und für kleine Unternehmen. In großen Unternehmen werden zwar häufiger als in kleinen formalisierte Verfahren der Standortwahl (z.B. Operations-Research-Methoden) eingesetzt. Dies geschieht aber auch nur teilweise; in den entsprechenden Fällen sind sie nur ein Baustein bei der Vorbereitung der Entscheidung. Letztlich spielen auch bei der Einbeziehung solcher Verfahren vielfach subjektive Elemente eine wesentliche Rolle. Standortentscheidungen in Mehrbetriebunternehmen werden meist in den Zentralen und nicht an den betroffenen Standorten gefällt. Daraus wird der begrenzte Handlungsspielraum der Kommunen in solchen Fällen deutlich.[106]
Die Bedeutung weicher Standortfaktoren ist in den einzelnen Phasen der Entscheidungsprozesse unterschiedlich (vgl. Abbildung 4, Seite 40): In der Phase der Vorauswahl von Standortalternativen spielen Bilder und Vorstellungen von Städten und Regionen - also weiche Standortfaktoren - eine vergleichsweise wichtige Rolle. Dies gelte Grabow zufolge insbesondere für die Standortwahl im überregionalen oder internationalen Maßstab, wird von ihm aber nicht empirisch begründet. In der Phase der Analyse und des Vergleichs der in die Betrachtung einbezogenen Standorte treten harte Faktoren in den Vordergrund. Bei der letztlichen Entscheidung können weiche Faktoren - ausgedrückt durch subjektive Präferenzen - wieder stärker ins Gewicht fallen. So ist die uneinheitliche Bedeutung, die weichen Standortfaktoren in unterschiedlichen Untersuchungen beigemessen wird, teilweise darauf zurückzuführen, daß die Untersuchungen jeweils verschiedene Phasen des Entscheidungsprozesses ins Blickfeld nahmen. Grabow kommt zu der Erkenntnis, daß den weichen Faktoren in Zusammenhang mit konkreten Standortentscheidungen eine deutlich geringere Bedeutung eingeräumt wird als in „unverbindlichen“ Aussagen oder allgemeinen Einschätzungen, bei denen zu den wichtigsten Standortfaktoren auch einzelne weiche gerechnet werden. Die wirkliche Bedeutung der weichen Faktoren liegt Grabow zufolge vermutlich zwischen diesen beiden Polen und hängt, wie bereits erwähnt, von der Entscheidungsphase ab.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5, Seite 41, zeigt die unterschiedliche Gewichtung harter und weicher Faktoren bei konkreten Standortentscheidungen. Weiche Standortfaktoren spielen demnach für 19% der Unternehmer eine nennenswerte Rolle bei Standortentscheidungen. Sie haben unter anderem deswegen Bedeutung, weil für viele Entscheider harte Standortfaktoren an sehr vielen Standorten gleichermaßen gut vorhanden sind. Für einen erheblichen Teil der Befragten können weiche Faktoren sogar Mängel bei harten Standortfaktoren überspielen. Insgesamt spielen weiche Standortfaktoren aber nur in den seltensten Fällen die allein ausschlaggebende Rolle bei Standortentscheidungen; meist sind sie nur in Zusammenhang mit „harten“ Qualitäten zu sehen; wenn überhaupt sind weiche unternehmensbezogene Faktoren wichtiger als personenbezogene.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Weiche Standortfaktoren sind eher Pull- als Push-Faktoren: Sie spielen als anziehende Faktoren (bzw. als nicht-attrahierende Faktoren bei schlechten weichen Qualitäten) eine wesentlich größere Rolle denn als „treibende“ Faktoren für eine Standortaufgabe oder -schrumpfung.[107] Weiche Faktoren spielen bei Entscheidungen „am Standort“ (Ausbau, Schrumpfung, Bleibeentscheidung) eine überdurchschnittlich wichtige Rolle. Bei Verlagerungen über große Entfernungen oder Gründungen von Niederlassungen an entfernteren (neuen) Standorten wird das Image in bestimmten Branchen oder bei bestimmten Betriebstypen zu einem wichtigen weichen Faktor.
Die wichtigsten Standortfaktoren sind die „harten“: Die Verkehrsanbindung, Flächen und Büros sowie der Arbeitsmarkt. Die wichtigsten weichen Standortfaktoren sind Wohnen und Wohnumfeld (auch: die Umweltqualität), sowie das Wirtschaftsklima in der Stadt und im Bundesland. Viele andere weiche personenbezogene Faktoren, unter anderem auch der in der öffentlichen Diskussion häufig angesprochene Bereich der Kultur, finden sich auf den letzten Plätzen in Grabows Bedeutungshierarchie von Standortfaktoren wieder. Es lassen sich typische Einschätzungsmuster erkennen und damit Gruppen von Befragten, die jeweils ein bestimmtes Profil von Standortansprüchen haben. Dazu gehören beispielsweise solche Unternehmer, für die fast nur bestimmte harte Faktoren wichtig sind, andere, die durchgängig nur geringe Standortanforderungen haben, und wieder andere, die in ihren Anforderungen sehr polarisiert sind. Manche dieser Einschätzungsmuster sind für bestimmte Branchen, Betriebsgrößen usw. ganz typisch. Die größten Unterschiede bezüglich der Bedeutung von harten und weichen Faktoren bestehen Grabow zufolge zwischen den Branchen.
Jede genauere Analyse der Bedeutung von harten und weichen Standortfaktoren, so die Schlußfolgerung von Grabow, erfordert eine differenzierte Betrachtung nach verschiedenen betrieblichen und räumlichen Kategorien, beispielsweise nach dem Typus der Standortwahl, der Branche, dem funktionalen Betriebstypus (Verwaltung, FuE-Abteilungen oder Produktionsbereiche), der Unternehmens oder Betriebsgröße, der Stadtgröße oder dem Stadttyp. Teilweise zeigten sich erhebliche Unterschiede je nach Kategorie, sowohl in bezug auf die Wichtigkeit von Faktoren wie auch auf die Zufriedenheit mit den jeweiligen Standortbedingungen. Tabelle 2, Seite 43f., zeigt die Standortfaktoren nach Grabow im Überblick.
Tabelle 2: Standortfaktoren nach Grabow im Überblick
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.68f.
2.2.2 Die Untersuchung von Diller
Die Untersuchung von Diller aus dem Jahr 1991 ist die erste umfangreiche Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum, die sich ausschließlich dem Thema weicher Standortfaktoren annimmt. Ausgangspunkt ist die ökonomische und soziale Polarisierung der deutschen Stadtstruktur, die häufig unter dem Schlagwort des „Nord-Süd-Gefälles“ diskutiert wird. Diller überprüft in seiner empirischen Untersuchung den hypothesenartig ausgeführten Erklärungsansatz, der die Entwicklungsunterschiede der Räume auch als Resultat unterschiedlicher Qualitäten der weichen Standortfaktoren sieht. Im zentralen Kapitel der Arbeit wird das räumliche Verhalten der Hauptakteure des vermuteten Bedeutungsgewinns der weichen Standortfaktoren untersucht: Die Standortwahl des zukunftsträchtigen Betriebs und das Freizeitverhalten sowie die Wohnortwahl der hochqualifizierten Arbeitskraft. Weiche Qualitäten eines Standortes bestimmen dessen Attraktivität zunächst für die Beschäftigten und daraus abgeleitet auch für die Betriebe, die ihre Investitionsentscheidung an den für sie notwendigen Arbeitskräften und deren Präferenzen ausrichten. Diller verdeutlicht, daß dieses Erklärungsmuster auf unüberprüften „Klischees“ basiert und demzufolge auch kontrovers und eher in Form bloßer Statements diskutiert wird. Obwohl die Wissenschaft sich noch nicht über die tatsächliche Bedeutung der weichen Standortfaktoren eines Raumes für seine ökonomische Entwicklung einig ist, zeigt sich aber bereits eine Reaktion der Kommunen auf den vermuteten Trend: Die Konkurrenz um die Entwicklung weicher Standortfaktoren.[108]
[...]
[1] Kortüm, Entscheidungsprozeß, 1972, S.7.
[2] Bierich, Fertigungsstandorte, 1988, S.825.
[3] Gab es Ende der sechziger Jahre noch 7.000 multinationale Unternehmen, so waren es 1994 schon gut 37.000 mit insgesamt über 200.000 Tochtergesellschaften und Niederlassungen. Siehe UNCTAD, Investment, 1996, S.2ff.
[4] Gesamtbestandsdaten (outward direct investment position) der ausländischen Direktinvestitionen von 1996. Siehe OECD, National, 1999, S.5ff. Betrachtet man die in 1997 neugetätigten Direktinvestitionen (direct investment outflow), so liegt Deutschland hinter Frankreich auf dem 4. Platz. Ein ganz anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Direktinvestitionen prozentual auf das Bruttosozialprodukt bezogen betrachtet. Nach den Outflow-Daten von 1997 liegt Deutschland mit 1,59% nur an 14. Stelle der OECD-Länder, u.a. hinter der Schweiz (5,69%), Holland (5,55%), Schweden (5%), Großbritannien (4,55%), Finnland (3,68%), Luxemburg (2,77%) und Belgien (2,77%). Allerdings schneiden die USA mit 1,46% und Japan mit 0,62% noch schlechter ab.
[5] BDI, Mittelstandsinformationen, 1999, S.10. Den Daten der OECD, National, 1999, S.15f., zufolge haben sich die deutschen Direktinvestitionsbestände im Ausland zwischen 1986 bis 1996 sogar mehr als verfünffacht.
[6] Befragt wurden 10.000 Unternehmen in den alten Bundesländern. Siehe Zentes, Wettbewerbsstrategien, 1995, S.19f. Asien befand sich 1993 auf dem Höhepunkt seines wirtschaftlichen Booms. 1999 dürfte die Zahl deshalb nicht mehr so hoch liegen. So stehen einer eigenen Befragung des Referatsleiters Asien der BfAI zufolge die deutschen Unternehmen 1999 Asien „abwartend“ gegenüber und überlegen neue Engagements „sehr sehr sorgfältig“.
[7] Günther, Wandel, 1975, S.220ff.
[8] Vgl. Scholl, Internationalisierungsstrategien, 1989, Sp.984.
[9] Zu den Chancen siehe Colberg, Präsenzstrategien, 1989, S.78f., zu den Risiken Raffee; Kreutzer, Länderrisiken, 1984, S.44.
[10] Siehe Hack, Process, 1984, S.33, und Pierdzioch, Investitionstheorie, 1998, S.187. Eine der Grundannahmen neuerer Ansätze der Investitionstheorie ist die Tatsache, daß viele Investitionsentscheidungen nur unter Hinnahme hoher Kosten wieder rückgängig gemacht werden können.
[11] Vgl. Döpper; Eversheim, Globalisierung, 1993, S.375.
[12] Siehe Pfriem, Überlegungen, 1994, S.125, und Hummel, Standortentscheidung, 1996, S.18f.
[13] Maisch, Beurteilungskriterien, 1996, S.215.
[14] Vgl. Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.63. Schönbrodt, Bedeutung, 1996, S.33, benützt das Bild einer Sahnetorte, die die Gesamtheit aller Standortfaktoren darstellt. „Unten ist der Kuchen, sozusagen die harten Standortfaktoren. Und oben, die weiche Sahne, sind die weichen Standortfaktoren, die der Torte die gewisse Attraktivität verleihen“.
[15] Kunzmann, Kultur, 1992, S.5.
[16] Neben Aharoni, Decision, 1996, auch Bower, Allocation, 1970, Mintzberg et al., Structure, 1976, Barton et al., Management, 1992, und Doz; Prahalad, Corporations, 1988.
[17] Glaum, Unternehmenserfolg, 1995, S.3, spricht vom Phänomen der „Verhaltensabhängigkeit von Auslandsinvestitionsentscheidungen“.
[18] Glaum, Unternehmenserfolg, 1995, S.3.
[19] Eine Ausnahme stellt Kortüm, Entscheidungsprozeß, 1972, S.7, dar, der zu Anfang des aktuellen Kapitels einleitend zitiert wurde.
[20] Persönliche Präferenzen sind, wie auch die oft erwähnten „soziokulturellen“ Faktoren, Spezialfälle von weichen Faktoren. In Kapitel 6 wird sich zeigen, daß die persönlichen Präferenzen sogar als eine eigenständige Kategorie („Metafaktor“) weicher Faktoren aufgefaßt werden können.
[21] Fürst, Standortwahl, 1971, S.190.
[22] Beispielhaft sei hier die Arbeit von Glaum, Unternehmenserfolg, 1995, erwähnt.
[23] Schon 1928 schrieb Salin, daß Industriestandorte „in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle mehr traditional als rational zu erklären sind“. Salin, Standortverschiebungen, 1928, S.79.
[24] BMWi, Wirtschaftsbeziehungen, 1997, S.3.
[25] BMWi, Asien-Pazifik-Handel, 1999, o.S.
[26] Im Gegensatz zu Lateinamerika, wo eine regelrechte Tradition deutscher Investitionen besteht, ist Asien für deutsche Unternehmen noch regelrecht „Neuland“.
[27] Als „kleine Tigerstaaten“ werden Indonesien, Malaysia, Thailand und die Philippinen bezeichnet. Die „klassischen“ Tigerstaaten sind Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea.
[28] Association of South-East Asian Nations.
[29] Vgl. Jungnickel, Investitionsbedingungen, 1986, S.305, und Lim et al., Investment, 1991, S.19.
[30] Dies spiegelt sich auch in vergleichenden Arbeiten wider. Wagner et al., Investitionsstrategien, 1985, betrachten Thailand, Malaysia, Indonesien und die Philippinen als „südostasiatischen Raum“. Einem Expertengespräch mit der Firma Baker&McKenzie zufolge betrachten Investoren die Philippinen teilweise noch auf einer Ebene unter Thailand, Malaysia und Indonesien. Malaysia hingegen wird gemäß BMWi teilweise bereits der „Liga“ von Taiwan und Singapur zugeordnet, und somit vor Thailand eingestuft. Siehe BMWi, Wirtschaftsbeziehungen, 1997, S.3.
[31] Dies ist auf übereinstimmende Aussagen mehrerer im Rahmen der eigenen Untersuchung befragter BoI-Büros in Europa und Thailand zurückzuführen. Auch bei anderen Autoren finden sich entsprechende Hinweise. Bei der Entscheidung für den Standort des BMW Regionaloffice in Südostasien etwa waren die drei Alternativen Singapur, Kuala Lumpur und Bangkok in der Endauswahl. Siehe Breuer, Singapur, 1994, S.227.
[32] Zahlreiche Delegationen westlicher Wirtschaftsvertreter kamen gerade aufgrund der Krise nach Thailand, um Investitionschancen zu untersuchen. Siehe Post, Baht, 1998, o.S.
[33] Diese Meinung wurde auch von einer befragten Expertin der Firma Baker&McKenzie in Bangkok geäußert.
[34] Von der gleichen Fragestellung in bezug auf amerikanische Investitionen in Israel geht 1966 Aharonis Dissertation „The Foreign Investment Decision Process“ an der Harvard University aus.
[35] Zahlen des BoI aus Post, Technology, 1999, o.S. Es handelt sich bei dem Anstieg der Auslandsinvestitionen jedoch überwiegend um Mergers und Acquisitions im „corporate sector“ und weniger um Re-investitionen in Schlüsselindustrien.
[36] Post, Recovery, 1999, o.S.
[37] Die Problemfelder sind isoliert betrachtet durchaus zufriedenstellend thematisiert worden. Zu Thailand als Investitionsstandort besteht zahlreiches, einschlägiges Informationsmaterial, in der Regel in der Form von sogenannten „Investitionsführern“, siehe etwa Barta, Kooperationsführer, 1997.
[38] Das gleiche Plädoyer vertreten Bullinger; Meinecke, Standortentscheidungen, 1985, S.413.
[39] Der Aufbau der Arbeit wird hier aus didaktischen Gründen vorweggenommen. Er läßt sich an dieser Stelle noch nicht begründen. Dazu ist erst die Präzisierung der Problemstellung in Kapitel 3 erforderlich.
[40] Fürst, Standortwahl, 1971, S.204, zur Bedeutung weicher Standortfaktoren.
[41] Dabei wird versucht, die hypothetische Frage zu beantworten, was man ohne die vorliegende Arbeit über die Bedeutung weicher Faktoren bei Auslandsinvestitionen wissen würde.
[42] Eine Reihe von Autoren sprechen sich gegen eine Beschränkung auf das rein Ökonomische in der Wirtschaftstheorie aus und befürworteten ein interdisziplinäres Vorgehen. Vgl. Schmölders, Volkswirtschaftslehre, 1962, S.205, sowie Krelle, Verhaltensweisen, 1953, S.9f., und Kantona, Verhalten, 1960, S.3f.
[43] Vershofen, Rechnen, 1942, S.198.
[44] Schmölders, Volkswirtschaftslehre, 1962, S.205. Vgl. auch Marshall, Economics, 1925, S.14, der schreibt: „Economics is a study of men as they live and move and think in the ordinary business of life“.
[45] Aharoni, Decision, 1966, Vorwort, S.ix.
[46] Weber, Standort, 1909, S.16.
[47] Vgl. Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.63. Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.41, zufolge wird dieser Terminus allerdings nur in Deutschland so eindeutig verwendet. In Österreich und der Schweiz werden andere Begriffe benutzt.
[48] Fees-Dörr et al., Standortentscheidungen, 1988, S.21.
[49] Bindlingmaier, Unternehmerziele, 1964, S.103. In den Unternehmensbefragungen zur vorliegenden Arbeit sprachen die Befragten selbst teilweise von „außergewöhnlichen“ Faktoren.
[50] Kortüm, Entscheidungsprozeß, 1972, S.186.
[51] Siehe Kreuter, Standortaffinität, 1974, S.6ff.
[52] Siehe Goette, Standortpolitik, 1994, S.233ff.
[53] Siehe Wandersleb, Berücksichtigung, 1985, S.59, der aus verschiedenen Literaturangaben entnommene Begriffe aufzählt.
[54] Siehe Goette, Standortpolitik, 1994, S.234. Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.41, zufolge wirft die Übersetzung des „weichen“ Standortfaktors häufig große Probleme auf. Grabow selbst übersetzt auf Seite 28 ins Englische mit „soft locational factor“.
[55] Dziembowska-Kowalska et al., Kulturtage, 1995, S.2.
[56] Haigh, Strategies, 1987, S.7.
[57] Vgl. Azani; Khorramshagol, Delphi, 1990, S.23. Zu den intangible factors gehören auch emotionelle Einflüsse: „Location decisions are based on multiple criteria at least some of which are intangible, even emotional“.
[58] Diller, Standortfaktoren, 1991, S1.
[59] Vgl. Hummel, Standortfaktor, 1990, S.5. Zu den konventionellen Faktoren gehören die Nähe zu Kunden und Lieferanten, die Verkehrs- und Kommunikationsmöglichkeiten, das Angebot an Arbeitskräften und die Wirtschaftsförderung um nur einige zu nennen. Zu den weichen Faktoren, d.h. Faktoren, die sich nicht unmittelbar im Unternehmenskalkül niederschlagen, werden soziale Einrichtungen, das Angebot an Wohnraum, das Image der Region sowie das Kultur- und Freizeitangebot gezählt.
[60] Bullinger; Meinecke, Standortentscheidungen, 1985, S.407f.
[61] Hummel, Beispiel, 1990, S.20.
[62] Rüschenpöhler, Standort, 1958, S.65, spricht von „rechenhaften“ und „nicht rechenhaften“ Faktoren.
[63] Die gleiche Gliederung übernimmt auch Förtsch, Verhaltenstheorie, 1973, S.24. Weitere Begriffspaare zur Unterteilung von Standortfaktoren sind „generell“ und „speziell“ sowie „agglomerativ“ und „deglomerativ“.
[64] Autschbach, Standortwahl, 1997, S.143.
[65] Bindlingmaier, Unternehmerziele, 1964, S.103.
[66] Vgl. Jahreiß, Direktinvestitionen, 1984, S.130 und S.143. Statt von „metaökonomischen“ spricht er auch von „politischen“ Standortfaktoren.
[67] Adebahr, Direktinvestitionen, 1981, S.34, bezeichnet die generellen Faktoren auch allgemein als „Investitionsklima“.
[68] Vgl. Kreuter, Standortaffinität, 1974, S.81, und Hansmeyer et al., Standortentscheidungen, 1975, S.139.
[69] Vgl. Diller, Standortfaktoren, 1991, S.40.
[70] Kaiser, Betriebstypenbildung, 1977, S.176, stellt die Investitionsentscheidung im ständigen Wechselspiel von Deliberanten und Determinanten dar. Dem Duden Fremdwörterbuch zufolge bedeutet Deliberation soviel wie Beratschlagung, Überlegung.
[71] Gann, Investitionsentscheidungen, 1996, S.38, definiert weiche Faktoren als nichtquantifizierbare Einflußfaktoren für Investitionsentscheidungen.
[72] Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.66, nennt als Beispiel eines zwar meßbaren, aber durch Einschätzungen überlagerten Standortfaktors die Grünflächen einer Stadt. Deren Anzahl kann zwar bestimmt werden, entscheidend ist jedoch die Meinung über deren Umfang und Qualität. Kolde, International, 1968, S.308f., führt an, daß Investoren Länder präferieren, die ihrem Heimatland in bezug auf den Lebensstandard, den kulturellen Hintergrund, das soziale Verhalten und das gängige Rechtssystem am ähnlichsten sind.
[73] Siehe Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.64. Die von uns vertretene Sichtweise, nach der einzelne weiche Faktoren gleichzeitig eine personenbezogene und eine unternehmensbezogene Komponente haben können, wird bei Grabow jedoch nicht thematisiert. Der Faktor „Religion“ etwa kann unternehmensbezogen sein in dem Sinne, daß die Religion beispielsweise durch den Freitag im Islam, eine direkte Auswirkung auf die Tätigkeit des Unternehmens an einem ausländischen Standort hat. Gleichzeitig besteht eine personenbezogene Komponente, falls eine persönliche Abneigung oder Zuneigung des Entscheidungsträgers zu einzelnen Religionsgruppen besteht.
[74] Die Entfernung der Philippinen von Europa wurde in den durchgeführten Unternehmensbefragungen im Vergleich zu der Indonesiens oft überschätzt.
[75] Siehe Diller, Standortfaktoren, 1991, S.28.
[76] Dziembowska-Kowalska et al., location factor,1998, S.3f.
[77] Vgl. den bereits in Kapitel 1.1 zitierten Beitrag von Kunzmann, Standortfaktor, 1992, S.5.
[78] Vgl. §55 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Außenwirtschaftsgesetzes vom 20. Dezember 1966 in der Neufassung vom 31. Dezember 1973 (BGB l. I, S.1070).
[79] Borrmann, Unternehmen, 1996, S.7, zufolge sind 71% der deutschen Unternehmen in Asien über sogenannte non-equity investments, d.h. kapitallose Formen der Internationalisierung aktiv.
[80] Hymer, International, 1976, S.1, faßt knapp zusammen: „If the investor controls the foreign enterprise, his investment is called a direct investment. If he does not control it, his investment is a portfolio investment.“
[81] Teilweise wird auch von „Portfeuille-Investition“ gesprochen, vgl. Meyer; Rühmann, Direktinvestitionen, 1993, S.62.
[82] Vgl. Jahreiß, Direktinvestitionen, 1984, S.25, und Buckley, Multinational, 1997, S.187.
[83] Jahreiß, Direktinvestitionen, 1984, S.26.
[84] Vgl. Pausenberger, Auslandsinvestitionen, 1980, S.1022ff., und Kortüm, Entscheidungsprozeß, 1972, S.13.ff.
[85] Vgl. Braun, Direktinvestition, 1988, S.7ff., sowie Pausenberger, Auslandsinvestitionen, 1980, S.1022ff., und Jahreiß, Direktinvestitionen, 1984, S.25ff.
[86] Glaum, Unternehmenserfolg, 1995, S.29.
[87] Vgl. Buckley, Multinational, 1997, S.186. Portfolioinvestitionen werden im Englischen als financial investment bezeichnet.
[88] Bundesbank, Direktinvestitionen, 1965, S.19.
[89] Bernkopf, Strategien, 1980, S.14, spricht von „absatzwirtschaftlichen Direktinvestitionen“. Bennet; Green, Instability, 1972, S.182, sprechen von „foreign investment in marketing“. Diese machen angeblich 49% aller Direktinvestitionen von US-Unternehmen aus.
[90] Bernkopf, Strategien, 1980, S.14.
[91] Ebenda, S.15.
[92] Vgl. auch Hauschildt, Entscheidungsziele, 1977, S.9, der Ziele als „Aussagen mit normativem Charakter, die einen von einem Entscheidungsträger gewünschten, von ihm oder anderen anzustrebenden, auf jeden Fall zukünftigen Zustand der Realität beschreiben“ und Kappler, Zieldurchsetzungsplanung, 1975, S.82ff., der Ziele als gewünschte Zustände, mittels deren Hilfe sich Kriterien zur Normierung und Messung von Verhaltensweisen bzw. Konsequenzen dieser Verhaltensweisen ableiten lassen definiert.
[93] Siehe Kortüm, Entscheidungsprozeß, 1972, S.10.
[94] Vgl. etwa Jungnickel, Direktinvestitionen, 1993, S.322-324, sowie Beyfuß; Kitterer, Direktinvestitionen, 1990, S.41-53 und Al-Ani, Direktinvestition, 1969, S.203-206, um nur einige zu nennen.
[95] Versuche finden sich bei Bernkopf, Strategien, 1980, S.3, sowie bei Scherhorn, Bedürfnis, 1959, S.86ff. und Bindlingmaier, Unternehmerziele, 1973, S.85-89.
[96] Siehe etwa Kantona, Verhalten, 1960, S.231ff.
[97] Dunning, Determinants, 1973, zitiert bei Gilroy, Enterprises, 1989, S.18, kritisiert beispielsweise die oft unterlassene Unterscheidung zwischen Motiven und Determinanten.
[98] Eisenführ; Weber, Entscheiden, 1999, S.31.
[99] Siehe Gabler, Wirtschafts-Lexikon, 1993, S.968. Geißler, Fehlentscheidungen, 1986, S.10, definiert folgendermaßen: „Eine Entscheidung ist eine zielbeeinflußte, bewußte und selbstverpflichtende Wahl einer Alternative aus mehreren Verhaltensmöglichkeiten, die das zukünftige Verhalten bestimmt.“
[100] Eisenführ; Weber, Entscheiden, 1999, S.16.
[101] Ebenda, S.4f.
[102] Vgl. Behrens, Standortbestimmungslehre, 1971, S.48.
[103] Deshalb wird es hier noch vor Dillers Untersuchung besprochen, obwohl diese zeitlich davor liegt.
[104] Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.15.
[105] Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.61.
[106] Ebenda, S.17.
[107] Grabow, Standortfaktoren, 1995, S.18f.
[108] Diller, Standortfaktoren, 1991, S.107 und S.1f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832495909
- ISBN (Paperback)
- 9783838695907
- DOI
- 10.3239/9783832495909
- Dateigröße
- 2.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Mai)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- investition management entscheidungstheorie ausland
- Produktsicherheit
- Diplom.de