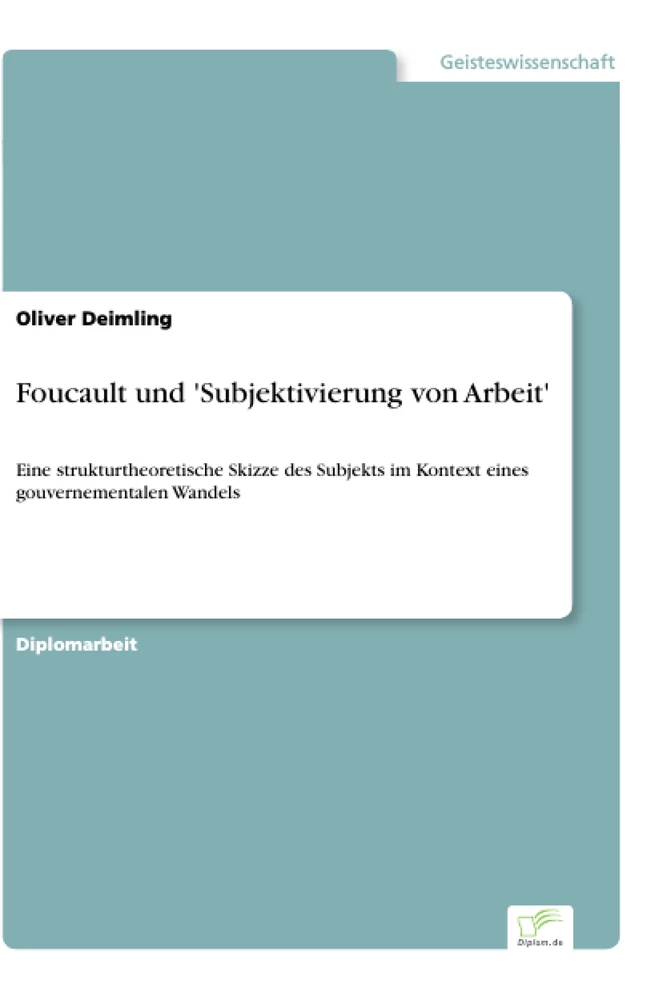Foucault und 'Subjektivierung von Arbeit'
Eine strukturtheoretische Skizze des Subjekts im Kontext eines gouvernementalen Wandels
Zusammenfassung
Diese Arbeit nimmt den Umstand zu ihrem Ausgangspunkt, dass der arbeitsoziologische Diskurs um die Thematik Subjektivierung von Arbeit bislang ohne fundierte Theorie des Subjekts bzw. der Subjektivität arbeitet. Dabei unterteilt sie den Gesamtdiskurs zunächst in einzelne Teildiskurse und fragt jeweils nach Unzulänglichkeiten und Aporien, welche sich aus diesem Mangel ergeben. Im Anschluss daran versucht sie aus den Arbeiten des französischen Poststrukturalisten Michel Foucault eine theoretische Skizze zu entwickeln, welche dazu dienen soll, die konzeptionellen Lücken zu schließen. Diese spannt sich über die begrifflichen Eckpfeiler Macht, Selbst und Gouvernementalität. Am Ende wird die gewonnene Betrachtungsweise wieder auf den Diskurs bezogen.
Problemstellung:
Die sich mit Arbeit befassenden kritischen Sozialwissenschaften erleben, so scheint es, zurzeit eine Art von Umbruch: Über Jahrzehnte hinweg hatten zahlreiche Theorien unterschiedlichster Couleur einen gemeinsamen Fluchtpunkt; ja teilweise lässt sich fast sagen einen gemeinsamen Klienten, als dessen Anwalt sie, implizit oder expliziert, agierten: das Subjekt.
Dieses Konstrukt bezeichnete dabei gewissermaßen das Individuum als sich in einem Spannungsfeld befindlich gedachtes: Auf der einen Seite standen seine spezifischen Eigenschaften als Exemplar der Gattung Mensch, also seine Fähigkeit zu Fortschritt durch Erkenntnis sowie seine Dispositionen und Intentionen in Bezug auf Denken und Handeln; auf der anderen Seite seine Geformtheit durch kulturelle und soziale Einfluss. Grund zur Beunruhigung war dabei zumeist, dass bestimmte moderne Organisationsweisen den Charakter von Arbeit so bestimmten, dass Zweites das Erstere überformte oder vollständig unterdrückte. Sämtliche Theorien, welche in irgendeiner Weise auf das Konzept der Entfremdung verweisen, können hier als beispielhaft gesehen werden.
Seit Beginn der neunziger Jahre des letzen Jahrhunderts ist nun zu beobachten, wie all diese Konzeptionen zunehmend in eine Art von Krise geraten. Der Grund dafür liegt hier hauptsächlich im zunehmenden Zurückweichen eines bestimmten Organisationsparadigmas, welche über einen immensen Zeitraum hinweg die Struktur von Arbeit im Kapitalismus prägte: der Taylorismus. Im tayloristischen Paradigma war die Subjektivität des Individuums stets als Störgröße definiert, welche es über hierarchische Kontroll- und Anweisungsstrukturen stets auszuschalten oder zumindest […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Hintergrund und Zielsetzung
1.2. Warum Foucault?
1.3. Vorgehensweise
1.4. Begriffsgeschichte
2. Darstellung des Diskurses
2.1. Machtverhältnisse
2.1.1. Hintergrund
2.1.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.1.2.1. Subjektivität als eigenständige Strukturierungsebene
2.1.2.2. Entmachtung durch Vermarktlichung
2.1.2.2.1. Exkurs : Das Rationalisierungsdilemma der Angestelltenarbeit: Berger/Offe (1984)
2.1.2.3. Subjektivierung durch Arbeit vs. Subjektivierung der Arbeit im Call-Center
2.1.3. Fazit
2.2. Techniken
2.2.1. Hintergrund
2.2.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.2.2.1. Autonomie und Verantwortlichkeit: Die Praktik des Accounting
2.2.2.2. Die Multiplizierung von Kundenschnittstellen
2.2.2.3. Ökonomisierte Bildungskonzepte: das Human Resource Management
2.2.3. Fazit
2.3. Legitimität
2.3.1. Hintergrund
2.3.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.3.2.1. Fallbeispiel
2.3.2.2. Fallbeispiel
2.3.3. Fazit
2.4. Identität
2.4.1. Hintergrund
2.4.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.4.2.1. abnehmende Rollendistanz
2.4.2.2. das narzisstische Arbeitssubjekt
2.4.3. Fazit
2.5. Widerstand
2.5.1. Hintergrund
2.5.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.5.2.1. Aufklärung
2.5.2.2. Bildung und Sicherung
2.5.2.2.1. Exkurs: Der Arbeitskraftunternehmer
2.5.1. Fazit
Transit//Passage
3. Foucault
3.1. Macht
3.1.1. Subjektlose Strategien: Erläuterung des foucaultschen Machtbegriffes
3.1.2. Macht und Wissen: eine Beziehung der Immanenz
3.1.3. Subjektivierung durch Macht
3.1.4. Eine neue Macht und ihre erste Erscheinungsform: Macht, Wissen und Subjektivierung am Beispiel der Disziplin
3.2. Selbst
3.2.1. Macht und Freiheit
3.2.1.1. Der Begriff der Regierung
3.2.1.2. Das Selbstverhältnis
3.2.2. Moral
3.2.2.1. Zur Ethik orientierte Moral
3.2.2.2. Zum Code orientierte Moral
3.2.2.3. Das Analyseraster
3.2.3. Widerstand
3.3. Gouvernementalität- die Rationalität der Führung
3.3.1. Hintergrund des Begriffes
3.3.2. Die Reflexion der Führung- Gouvernementalität als analytische Dimension der Macht
3.3.3. Darstellung der Gouvernementalitäten
3.3.3.1. Die liberale Gouvernementalität- die Geburt des Marktes
3.3.3.2. Die neoliberale Gouvernementalität- die Ökonomisierung des Sozialen
Transit//Passage
4. Fazit
4. 1. Betrachtungen entlang der Teildiskurse
4.1.1. Machtverhältnisse
4.1.2. Techniken
4.1.3. Legitimität
4.1.4. Identität
4.1.5. Widerstand
4.2. Schluss: Integrative Betrachtung
5. Literatur
5.1. Literatur von Michel Foucault (Sigelverzeichnis)
5.2. Sonstige wissenschaftliche Quellen
5.3. Nicht- wissenschaftliche Quellen
1.Einleitung
1.1. Hintergrund und Zielsetzung
Die sich mit Arbeit befassenden kritischen Sozialwissenschaften erleben, so scheint es, zurzeit eine Art von Umbruch: Über Jahrzehnte hinweg hatten zahlreiche Theorien unterschiedlichster Couleur einen gemeinsamen Fluchtpunkt; ja teilweise lässt sich fast sagen einen gemeinsamen Klienten, als dessen Anwalt sie, implizit oder expliziert, agierten: das Subjekt. Dieses Konstrukt bezeichnete dabei gewissermaßen das Individuum als sich in einem Spannungsfeld befindlich gedachtes: Auf der einen Seite standen seine spezifischen Eigenschaften als Exemplar der Gattung „Mensch“, also seine Fähigkeit zu Fortschritt durch Erkenntnis sowie seine Dispositionen und Intentionen in Bezug auf Denken und Handeln; auf der anderen Seite seine Geformtheit durch kulturelle und soziale Einflüsse[1] (vgl. Voß u.a. 2003: 59f). Grund zur Beunruhigung war dabei zumeist, dass bestimmte moderne Organisationsweisen den Charakter von Arbeit so bestimmten, dass Zweites das Erstere überformte oder vollständig unterdrückte. Sämtliche Theorien, welche in irgendeiner Weise auf das Konzept der „Entfremdung“ verweisen, können hier als beispielhaft gesehen werden.[2]
Seit Beginn der neunziger Jahre des letzen Jahrhunderts ist nun zu beobachten, wie all diese Konzeptionen zunehmend in eine Art von Krise geraten. Der Grund dafür liegt dabei hauptsächlich im zunehmenden Zurückweichen einer bestimmten Organisationsform von Arbeit, welche über einen immensen Zeitraum hinweg die Struktur des Kapitalismus prägte: der Taylorismus. Im tayloristischen Paradigma war die Subjektivität des Individuums stets als Störgröße definiert, welche es über hierarchische Kontroll- und Anweisungsstrukturen stets auszuschalten oder zumindest beherrschbar zu machen galt (vgl. Schöneberger/Springer 2003: 7). Die Frage, inwieweit Organisationsweisen von Arbeit das arbeitende Individuum dazu befähigen „sich selbst“, also seine eigene Subjektivität, in die Arbeit einzubringen oder eben dies behinderten, galt in der sozialwissenschaftlichen Theorie so als Indikator für den Grad der humanen Gestaltung der Arbeit, bzw. zeigte an, inwiefern der Mensch durch seine Arbeit seiner eigentlichen Natur fremd wurde (vgl.z.B. Moldaschl 2003a). Eine derartige Denk- und Forschungslogik scheint nun unter posttayloristischen Vorzeichen nicht länger angebracht: Der ehemalige Störfaktor „Subjektivität“ erhält unter den Bedingungen von „dynamisierten Märkten, die gleichzeitig innovative Flexibilität und ökonomische Effizienz fordern“, und der wachsenden Bedeutung des Produktionsfaktors Wissen, zunehmend den Status einer ökonomischen Ressource ( Schönberger / Springer 2003:7). In der Praxis bedeutet dies, dass betriebliche Organisationsweisen zunehmend nun geradezu darauf ausgerichtet werden, subjektive Potentiale, wie Kreativität, Eigeninitiative, Emotionalität und erfahrungsbasiertes Wissen, zu fördern, um diese dann ökonomisch nutzbar machen zu können.
Diese Verschiebung reflektiert die Industriesoziologie derzeitig im Rahmen eines fachlichen Diskurses, der den Namen „Subjektivierung von Arbeit“ trägt. Diesen Diskurs begleitet jedoch bis zum heutigen Tage ein Problem:
Unter seinem Label werden derzeit in der Literatur zahlreiche heterogene Arbeiten zusammengefasst, welche den kleinsten gemeinsamen Nenner besitzen, in irgendeiner Weise den Wandel der Anforderungen an das Individuum im Wechselverhältnis zwischen Person und Betrieb in Arbeitsprozessen zu untersuchen, und dabei eine Verschiebung zu Lasten des Individuums zu konstatieren (vgl. Kleemann u.a. 2003: 62f). Konkrete Befunde entstehen dabei, explizit oder implizit, vor den unterschiedlichsten theoretischen Hintergründen: Von am Marxismus orientierter Kritik (vgl. z.B. Pfeiffer 2003) über handlungstheoretische Zugänge (vgl. z.B. Matuschek 2003) bis hin zu psychoanalytischen Ansätzen (vgl. Eichler 2005), um nur einige Beispiele zu nennen, stößt man auf ein immens breites Ensemble von Zugangsweisen. Entsprechend unterschiedlich sind die entwickelten Forschungskonzepte, und entsprechend divergent stellen sich die Ergebnisse hinsichtlich brisanter Fragestellungen, wie beispielsweise die nach den Ursachen des Prozesses, der Auswirkungen auf das arbeitende Subjekt, der mikro- und makrosozialen Folgen, der angemessenen Strategie des Widerstandes usw. dar. Obgleich Multiperspektivität in einer Wissenschaft an sich kein Nachteil sein muss und sein sollte, erweisen sich Befunde und Handlungsempfehlungen aus diesem Grunde oftmals als schwer vergleichbar und existieren daher meist ohne gegenseitigen Bezug nebeneinander her. Was dem Diskurs um „Subjektivierung von Arbeit“ letztendlich fehlt, ist also eine konkrete Theorie der Subjektivierung, bzw. des Subjektes, welcher hier gewissermaßen als geteilter Horizont dienen könnte.
Diese Arbeit soll nun als ein Versuch gelesen werden, diese konzeptionelle Lücke zu schließen; sie verfolgt das Ziel, den arbeitssoziologischen Diskurs um „Subjektivierung von Arbeit“ in gewisser Weise theoretisch zu unterfüttern. Ich beabsichtige dies in Form der Erarbeitung einer Konzeption von „Subjektivierung“ geschehen zu lassen, welche sich auf die Arbeiten von Michel Foucault[3] bezieht. Im folgenden Abschnitt werde ich zunächst die Erwägungen erläutern, welche mich dazu bewogen haben, mich gerade für diesen Theoretiker geführt zu entscheiden.
1.2. Warum Foucault?
Die Idee, die Arbeiten des französischen Poststrukturalisten[4] Michel Foucault auf ihre Implikationen hinsichtlich des Phänomens „Subjektivierung von Arbeit“ zu befragen, ist zunächst einmal nicht neu. So beschäftigt sich bereits Manfred Moldaschl (2003), mit der Frage, ob „Foucaults Brille eine Möglichkeit“ biete „die Subjektivierung von Arbeit zu verstehen“ (149, Aufsatztitel). Dabei kommt er, im Zuge einer nicht ausschließlichen, aber bevorzugten Betrachtung von Foucaults mittlerer Schaffensphase[5], zu dem Schluss, dass Foucault in diesem Zusammenhang am ehesten im Zuge der kritischen Reflektion (arbeits-) wissenschaftlicher Diskurse oder als Ergänzung zu anderen Perspektiven nutzbar gemacht werden könne (vgl. Moldaschl 2003, 185ff). Neben dieser einzigen (mir bekannten) systematischen Betrachtung eines breiten Spektrums des foucaultschen Werkes in diesem Zusammenhang, lassen sich noch einige weitere Beiträge anführen, welche sich explizit auf einzelne Aspekte beziehen. So erklärt beispielsweise Kerstin Rieder (2003) die Bereitschaft zur Mehrarbeit bei Pflegekräften als Effekt diskursiver Machtwirkungen. An anderer Stelle zeichnet Alexandra Rau (2005) eine „gouvernementalitätstheoretische Skizze“ der Modifikationen von Selbsttechnologien im Zuge der Etablierung und Transformation des Konzeptes der Psyche innerhalb der (Arbeits-) Wissenschaften. Des Weiteren lassen sich im Diskurs eine Reihe von Texten finden, welche Foucault gewissermaßen „im Munde führen“, ohne sich jedoch explizit auf ihn zu beziehen. So untersucht beispielsweise Peter Miller (2005) die „Programme, Praktiken und Diskurse des Accounting im Hinblick auf die Hervorbringung einer spezifisch „kalkulierenden“ Subjektivität und als Bestandteil einer neoliberalen Regierungsweise“ (Drinkuth u.a. 2005:11) und hat dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit Foucaults Konzepte der „Gouvernementalität“ und der „Technologien des Selbst“ im Hinterkopf.
An diesen Beispielen lässt sich eines ablesen: eine Verbindung zwischen dem Phänomen „Subjektivierung von Arbeit“ und dem Werk Foucaults wird von zahlreichen Wissenschaftlern[6] (mehr oder minder) intuitiv erkannt, und diese Erkenntnis regt bereits zur facettenreichen Forschungsarbeit an. Was jedoch bis dato noch nicht geschehen ist, ist der Versuch, aus seinen Schriften systematisch ein theoretisches Fundament zu entwickeln, welches dazu in der Lage wäre, den Diskurs um „Subjektivierung von Arbeit“ als eigenständiges Paradigma zu etablieren, indem es bestimmte Defizite und Aporien, welche ihn zur Zeit noch begleiten, beseitigt. Genau darin besteht nun mein Anliegen. Die Schritte auf dem Wege dahin erläutert der nächste Abschnitt.
1.3. Vorgehensweise
Die Diplomarbeit lässt sich grob in zwei Hauptschritte untergliedern:
Der erste Schritt besteht in einer systematisierenden Darstellung des (neueren) arbeitssoziologischen Diskurses um die Thematik „Subjektivierung von Arbeit“. Dabei beabsichtige ich, diesen zunächst in Teildiskurse aufzuschlüsseln, d.h. ich werde innerhalb des Diskurses verschiedene Diskussionsstränge in Abhängigkeit von ihrem speziellen diskursiven Fokus (beispielsweise Führungstechniken) identifizieren und voneinander abgrenzen. Aus jedem Teildiskurs werden dann jeweils einzelne Forschungsbeiträge zusammenfassend dargestellt, welche ich zuvor nach subjektiven Kriterien[7] ausgewählt habe.
Mit dieser Vorgehensweise verfolge ich zwei grundlegende Ziele: Auf der einen Seite soll ein möglichst breit gefächerter Überblick über das Bestehende generiert werden, welcher es dem Leser ermöglicht, einen tiefgründigen Einblick in die Thematik zu gewinnen. Auf der anderen Seite soll der Diskurs in eine Form gebracht werden, in welcher es möglich wird, kontrastierende Vergleiche anzustellen, um auf diese Weise gewisse Stellen als systematische Mängel zu identifizieren, welche das Erkenntnispotential derzeitig einschränken. Des Weiteren soll auf diese Weise Anschlussfähigkeit für das theoretische Instrumentarium Foucaults; seine Sprache, sein Denken; generiert werden.
Erst im zweiten Schritt kommt schließlich Foucault selbst ins Spiel: Auf der Basis von ausgewählter Primär- und Sekundärliteratur[8] soll nun der Vorschlag für eine Konzeption von „Subjektivierung“ erarbeitet werden, welche dem Diskurs um „Subjektivierung von Arbeit“ als subjekttheoretisches Fundament dienen könnte. Dabei wird es zunächst unumgänglich sein, ausführlich in Foucaults sehr spezifische Denkweise einzuführen, und dabei ausgehend vom fundamentalen Begriff der „Macht“ elementare Konzepte wie „Wissen“ oder „Diskurs“ vorzustellen. Ausgehend von dieser Grundlage, wird es möglich erscheinen, eine spezifische Perspektive der Subjektivität einzuführen und diese im Anschluss aus verschieden Blickwinckeln auf ihre Implikationen zu befragen. Im letzen Teil dieses Abschnittes werde ich mit dem Konzept der „Gouvernementalität“ noch ein Analyseinstrument vorstellen, welches es uns erlaubt, das Phänomen der Subjektivierung von Arbeit als Effekt einer tieferliegenden und umfassenderen Rationalität zu begreifen, welche derzeitig im Begriff ist, die gesamte Gestalt unserer Gegenwart zu transformieren: dem Neoliberalismus.
Im Anschluss daran, soll schließlich erörtert werden, inwieweit das gewonne theoretische Gerüst dazu in der Lage ist, die im ersten Schritt aufgezeigten konzeptionellen Lücken des arbeitssoziologischen Diskurses zu schließen. Dabei werde ich mich erneut entlang der zuvor spezifizierten Teildiskurse orientieren.
Zunächst möchte ich jedoch noch kurz auf die Entstehungsgeschichte und das grobe inhaltliche Spektrum des Konzeptes „Subjektivierung von Arbeit“ eingehen. Ich tue dies um aufzuzeigen zu können, worauf der neuere Diskurs aufbaut; welche Ambivalenz seinen konzeptionellen Rahmen bildet.
1.4. Begriffsgeschichte
Wie bereits oben angedeutet, bedeutet „Subjektivierung von Arbeit“ ganz allgemein eine Zunahme der Bedeutung subjektiver, also an das arbeitende Individuum untrennbar gekoppelter, Faktoren im Arbeitsprozess. Erstmalig taucht der Begriff bei Baethge im Jahre 1991 auf, und bezeichnet dort eine zunehmende „Geltendmachung eigener Ansprüche an die Arbeit als neues gesellschaftliches Phänomen, (…) während zugleich das passive Geprägt- Werden durch die Arbeit abnehme“ (Kleemann u.a. 2003: 87). In der darauffolgenden Zeit entstand eine Reihe von Publikationen, welche, implizit oder explizit, die „Subjektivierung von Arbeit“ zum Gegenstand hatten und im Zuge derer eine breitere und differenziertere Sicht auf die Thematik erarbeitet werden konnte. Kleemann u.a.(2003) kristallisieren nach ihren synoptischen Überblick über diese Literatur „drei grundlegende Erscheinungsformen von Subjektivität“ heraus, „die in den Prozeß der Subjektivierung von Arbeit eingehen“ (ebd.: 88). Diese sollen im Folgenden kurz umrissen werden:
a, Kompensatorische Subjektivität
Mit kompensatorischer Subjektivität bezeichnen die Autoren subjektive Leistungen, welche von den arbeitenden Individuen erbracht werden müssen, um zunehmend komplexer werdende technische und organisatorische Vorgaben erfüllen zu können. Die an die Personen gebundenen Fähigkeiten, wie Kreativität, Eigeninitiative oder Erfahrungswissen müssen hier also zunehmend eingesetzt werden, um die Defizite noch tayloristisch konzipierter Arbeitsorganisation im Hinblick auf eine erfolgreiche Aufgabenbewältigung unter flexibilisierten Marktbedingungen kompensieren zu können (vgl.ebd.:89). Die Subjektivität findet ihren Eingang in den Arbeitsprozess hier also mehr oder weniger inoffiziell.
b, strukturierende Subjektivität
Im Falle strukturierender Subjektivität ist der Taylorismus als leitendes Organisationsprinzip von Arbeit bereits in seinem Schwinden begriffen. An die Stelle rigider Arbeitsvorgaben mit Prozesskontrolle treten Zielvorgaben (bzw. Zielvereinbarungen) mit Ergebniskontrolle, an die Stelle des Normalarbeitstages[9] treten flexible Arbeitszeitmodelle, und an die Stelle standardisierter Berufsbiographien tritt die zunehmende „De-Institutionalisierung gesellschaftlicher Biographiemuster“ (ebd.:77). „Gegenstand subjektiver Leistungen ist hier das Handeln von Personen in bezug auf die praktische Arbeitstätigkeit selbst, der Gestaltung der alltäglichen Lebensführung (insbesondere in der synchronen Verbindung von ‚Arbeit und Leben’), sowie des Lebensverlaufs (insbesondere hinsichtlich der diachronen Einbindung von Erwerbsarbeit in den individuellen Lebenslauf)“(ebd.:89). Subjektivität wird hier also bereits bewusst als Ressource begriffen und gezielt zur Effektivitätssteigerung eingesetzt.
c, Reklamierende Subjektivität
Mit dem Terminus Reklamierende Subjektivität bezeichnen die Autoren die Forderungen nach Selbstverwirklichung durch und in der Arbeit, welche von den arbeitenden Individuen selbst ausgehen. Als Hintergrund ist der in den späten sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts einsetzende s.g. „Wertewandel“ wahrgenommen, der eine Prioritätenverschiebung von s.g. „Pflicht und Akzeptanzwerten“ zu „Selbstverwirklichungswerten“ im gesellschaftlichen Wertegefüge impliziert haben soll.[10] Die „Subjektivierung von Arbeit“ ist nach dieser Sichtweise kein einseitig von „oben“ den Arbeitenden aufoktroyierter Prozess bzw. durch Veränderung der (Markt)-Umwelt erzwungene Anpassungsleistung, sondern sie ist durchaus ebenfalls im Sinne der Subjekte (vgl. ebd.: 76ff, 90).
Zusammenfassend konnte bis diesem Punkt der Begriff „Subjektivierung von Arbeit“ mit Moldaschl/Voß (2003) folgendermaßen bestimmt und hinsichtlich seiner Implikationen beleuchtet werden:
„Subjektivierung“ meint also zunächst eine infolge betrieblicher Veränderungen tendenziell zunehmende Bedeutung von „subjektiven“ Potentialen im Arbeitsprozeß – und zwar in zweifacher Hinsicht: einmal als wachsende Chance, „Subjektivität“ in den Arbeistprozeß einzubringen und umzusetzen, zum anderen aber auch als doppelter Zwang, nämlich erstens, mit „subjektiven“ Beiträgen den Arbeitsprozess auch unter „entgrenzten“ Bedingungen im Sinne der Betriebsziele aufrecht zu erhalten: und zweitens, die eigene Arbeit vielmehr als bisher aktiv zu strukturieren, selbst zu rationalisieren und zu „verwerten“ (ebd.: 16).
Von hieran ist es nun schließlich dieser Doppelcharakter, der die „Subjektivierung von Arbeit“ gleichzeitig als Chance und Zwang definiert, der die wissenschaftliche Diskussion prägt, theoretische Anschlusspunkte erzeugt und neue Fragen aufwirft. Das Ziel des nachfolgenden Abschnittes(2) besteht in der systematischen Darstellung dieses Diskurses.
2. Darstellung des Diskurses
Dieser Abschnitt, welcher den ersten Hauptteil der Diplomarbeit darstellt, dient der zusammenfassenden Darstellung von Forschungsbeiträgen, welche sich in der neueren arbeitssoziologischen Literatur[11] mit Thematiken auseinandersetzen, die rund um das Problem der „Subjektivierung von Arbeit“ angesiedelt sind. Bei der Sichtung der Literatur kam ich zu dem Urteil, dass eine Systematisierung dieser Beiträge am Besten zu erbringen sein würde, wenn man anhand der Thematiken und Aspekte, die sie behandeln, verschiedene Diskussionsstränge herauskristallisiert und diese jeweils im Einzelnen darstellt. Meines Erachtens gibt es zur Zeit fünf Diskussionsstränge[12], welche dem Diskurs vorwiegend ihren Stempel aufdrücken. Im Folgenden sei kurz dargestellt, welche dies im Einzelnen sind:
So nimmt sich ein Teil der Beiträge das Paradox, dass die zunehmende Forderung nach der Einbringung subjektiver Fähigkeiten in die Erwerbsarbeit den Subjekten sowohl als persönliche Entfaltungschance, als auch als auferlegter Zwang entgegentreten zum unmittelbaren Ausgangspunkt, und fragt nach dem Verhältnis, in dem diese beiden Aspekte zueinander stehen. Diesen Teil des Diskurses werde ich unter dem Abschnitt Machtverhältnisse (2.1.) behandeln. Andere Autoren beschäftigen sich mit den Instrumenten und Techniken der Personalführung, welche in den Organisationen dazu eingesetzt werden, die Mitarbeiter zur Einbringung ihrer subjektiven Fähigkeiten zu bewegen. Derartige Beiträge werde ich im Kapitel Techniken (2.2.) darstellen. Ein weiterer Teil beschäftigt sich mit den Begründungsformen und Legitimationsordnungen, welche der Anwendung derartiger Techniken zugrunde gelegt werden. Im Punkt 2.3. (Legitimation) wird dieser Aspekt beleuchtet. Ein andrer Teil des Diskurses stellt sich die Frage, inwiefern der neue Zugriff auf Aspekte der Subjektivität, welche unter tayloristischen Bedingungen unberührt blieben, die Persönlichkeitsstruktur der Beschäftigten berührt. Der Abschnitt Identität (2.4.) dient der Darstellung von Beiträgen dieser Perspektive. Um eine Art Gegenperspektive wird der Diskurs schließlich durch Beiträge bereichert, welche die Möglichkeiten von Formen des individuellen oder kollektiven Widerstandes gegen den totalitären Zugriff auf die Subjektivität des arbeitenden Individuums erörtern. Der letzte Abschnitt dieses Komplexes mit dem Titel Widerstand (2.3.) behandelt derartige Texte. Im Einzelnen werde ich bei der Darstellung dieser Diskussionsstränge nach dem folgenden Schema verfahren:
Zunächst erfolgt eine grobe Skizzierung der gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse, welche den empirisch positiven Hintergrund bilden, der vom jeweiligen Diskussionsstrang reflektiert wird. Dabei geht es vor allem darum, die mit dem Zurückweichen tayloristischer Arbeitorganisationsweisen einhergehenden Veränderungen auf dem jeweiligen Gebiet aufzuzeigen, die den Diskurs anreizen, indem sie „traditionelle“ arbeitsoziologische Denkweisen in Frage stellen und neue Herangehensweisen erfordern. Im Anschluss daran erfolgt eine Darstellung einzelner Forschungsbeiträge aus dem jeweiligen Teildiskurs. Die Texte werden dabei hinsichtlich ihres Gegenstandes, ihrer Hauptthesen, der zugrunde liegenden (theoriegeleiteten) Forschungsperspektive und ihrer Ergebnisse betrachtet. Das Ziel besteht dabei darin, zunächst einen Kontrast zwischen einzelnen Zugangsweisen zu erzeugen, um schließlich auf diese Weise auf tieferliegende Gemeinsamkeiten schließen zu können, aus welchen sich konzeptionelle Mängel bzw. „blinde Flecken“ ableiten lassen. Meine Positionen ist dabei quasi die eines Beobachters von Beobachtungen; also eines Beobachters zweiter Ordnung (vgl. Opitz 2004:18). Den Abschluss des jeweiligen Teilabschnittes bildet ein kleines Fazit, in welchem die Ergebnisse der Beobachtung kurz dargestellt werden. Das vorrangige Ziel besteht dabei jeweils in einer Erzeugung von Anschlussfähigkeit für den zweiten Hauptteil.
2.1. Machtverhältnisse
2.1.1. Hintergrund
Ist in der Soziologie von Macht die Rede, so herrscht dabei zumeist das webersche Begriffsverständnis vor, wonach diese als Chance eines Akteurs verstanden wird, „innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen (…)“(Weber 1972: 28). Spricht man von einem Machtverhältnis, so bezeichnet dies demnach die Verteilung dieser Chancen auf die in einer bestimmten sozialen Beziehung stehenden Akteure. In unserm Fall handelt es sich bei diesen Akteuren auf der einen Seite um die arbeitenden Individuen, welche das (besonders in der marxistisch orientierten Theorie antizipierte) Interesse nach Selbstverwirklichung im Zuge einer ganzheitlichen anspruchsvollen Arbeitstätigkeit verfolgen; auf der anderen Seite steht, grob gesagt, das Management, welches dafür Sorge zu tragen hat, dass vor allem nach Kriterien der ökonomischen Effizienz gearbeitet wird. Unter tayloristischen[13] Vorzeichen war dieses Machtverhältnis objektiv vollkommen asymmetrisch und daher denkbar einfach: Ein Arbeitsorganisationsparadigma, welches die vertikale Spezialisierung, also die strikte Trennung von planender und ausführender Arbeit, impliziert, lässt keinen Raum für die (Selbstverwirklichungs-) Bedürfnisse der Ausführenden (vgl. Schönberger/Springer 2003:7; Jürgens u.a. 1989). Das Verhältnis wird hier also eindeutig von den Interessen des Managements strukturiert.
Mit dem Wandel der ökonomischen Rahmenbedingungen (s.o.) gerät nun dieses auf Anweisung und Kontrolle basierende Paradigma zunehmend in die Krise, und das Management entdeckt in der Subjektivität des Mitarbeiters zunehmend ein effizienzsteigerndes Potential. Subjektgebundene Produktionsfaktoren wie Innovativität, Kreativität, Loyalität oder volle Einsatzbereitschaft (vgl.:. Schönberger/Springer 2003: 11) werden verstärkt als geeignet angesehen, um beispielsweise Unabwägbarkeiten des Markts zu kompensieren. „Die neuen Organisationskonzepte zielen (geradezu- A.d.V..) darauf, die Leistungspotentiale freizusetzen, die im subjektiv-persönlichen Erfahrungsschatz der Arbeitskräfte liegen und im tayloristischen Arbeitsprozess ungenutzt bleiben“ (ebd.). Diese Verschiebung im Managementdenken, so könnte man meinen, geht mit einer Verschiebung im Machtverhältnis zwischen Arbeitskraft und Management einher: Das neue Angewiesensein der Akteure des Managements auf das Einbringen subjektiver Fähigkeiten in den Arbeitprozess seitens der Mitarbeiter, kommt den Arbeitskräften einerseits in ihrem Selbstverwirklichungsbedürfnis ohnehin entgegen, andererseits verbessert sich durch diese Entwicklung ihre Verhandlungsposition gegenüber ersteren, da das Einbringen von Potentialen, wie beispielsweise Innovativität, kaum repressiv erzwungen werden kann. Allerdings wäre eine solch positive Sichtweise unhinterfragt äußerst kurzsichtig. Wie andere Ressourcen ebenfalls, hat der Produktionsfaktor Subjektivität für das Management nur dann einen Wert, wenn er im Sinne der Unternehmensziele einsetzbar ist. Dahingehend ist es nicht die Subjektivität per se, die eingefordert wird, sondern subjektive Fähigkeiten, welche einer bestimmten, „nützlichen“ Form entsprechen. Die wahre Intension neuer Managementkonzepte liegt also darin, sicherzustellen, dass das arbeitende Subjekt seine Subjektivität in einen Modus transformiert, welcher Anschlussfähigkeit für den Einsatz im Sinne der Organisationsziele garantiert. Anders ausgedrückt: was vom Subjekt verlangt wird ist die „Selbstverwirklichung im Sinne des Managements“ (vgl. ebd.). Diese Anforderung trifft nun auf Subjekte, welche mit Umweltbedingungen konfrontiert sind, die nicht mehr mit denen des Taylorismus vergleichbar sind. War dort dem Subjekt durch die Institutionen des Normalarbeitsverhältnisses, Normalarbeitstages, standarisierter Berufsbiographien usw. (vgl. Mikl-Horke 2000:458:ff) noch eine in gewisser Weise klar strukturierte Arbeitswelt vorgegeben, welche Sicherheiten bezüglich der Konsequenzen von Handlungen erzeugte, trifft es im Posttaylorismus auf das Phänomen der s.g. „Entgrenzung“ der Arbeitwelt (vgl. Voß 1998). Gemeint ist damit eine
„leitend(e) Tendenz der derzeitigen Veränderungen der Arbeitsverhältnisse insgesamt, die alle sozialen Ebenen der Verfassung von Arbeit betrifft: übernationale und gesamtgesellschaftliche Strukturen von Arbeit, die Betriebsorganisation nach innen und außen, Arbeitsplatzstrukturen und das unmittelbare Arbeitshandeln sowie schließlich insbesondere auch die Arbeitssubjekte, das heißt Persönlichkeitseigenschaften sowie ihre Lebensverhältnisse“ (Voß zitiert nach Schönberger /Springer 2003: 9 –Hervorheb. im Original)
Diese „Tendenz der Veränderung“ besteht vor allem in der zunehmenden Deregulierung durch Freisetzung. Dadurch, dass einer zunehmend globalisierten Wirtschaft kein „global agierender Staat“ regulierend entgegen treten kann, wird der Markt zum einzig regulierenden Prinzip der Arbeitverhältnisse. Freisetzung bedeutet so die Koordination aller Sphären der
Erwerbsarbeit nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Für den Arbeitnehmer hat dies nun folgende Konsequenzen:
„Weichen kollektive - betriebliche und lebensweltliche- Institutionen und ihre Grenzen auf, wie es die Tendenz der Entgrenzung nahe legt, ergibt sich für die Subjekte selbst die Notwendigkeit und Möglichkeit einer stärkeren Eigenstrukturierung. Netzwerkartige Unternehmensverbände, atypische Beschäftigungsverhältnisse, die Notwendigkeit, seine Person ständig neu auf dem internen und externen Arbeitsmarkt zu vermarkten (...) um nur einige Bespiele zu nennen, stellen an die Arbeitskräfte weitreichende –entgrenzte- Anforderungen an die persönlichen Leistungen, an ihre Subjektivität“ (Schönberger/ Springer (2003:10).
Der auf diese Weise entstehende Zwang zur Selbstvermarktung stellt die oben genannte positive Sichtweise auf die Tendenz des Managements zur Einforderung von mehr Subjektivität gewissermaßen auf den Kopf: Es findet keine Verbesserung der Machtposition des Mitarbeiters statt, weil das Management auf seine subjektiven Fähigkeiten angewiesen ist, sondern die Zugriffsmöglichkeiten des Managements auf das arbeitende Subjekt vervielfältigen sich bis in das „Selbst“ des Mitarbeiters hinein („Internalisierung des Marktes“), da dieser mehr und mehr gezwungen ist, sich als „ ganze“ Person zu vermarkten und seine Subjektivität den Erfordernissen der Logik des Marktes anzupassen (vgl. Moldaschl 2003a: 16f; Moldaschl1998).
Die im Folgenden von mir vorgestellten Forschungsbeiträge setzen sich auf verschiedene Art und Weise mit der Frage des Machtverhältnisses zwischen Mitarbeiter und Management im Kontext subjektvierter Arbeit auseinander. Alle Autoren nehmen die oben angeführten Ambivalenzen (Selbstentfaltungschance vs. entgrenzter Zugriff aufs Subjekt) zunächst als Ausgangsbasis und fragen aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven nach den konkreten Verhältnissen in der realen Arbeitswelt.
2.1.2.Darstellung der Forschungsbeiträge
2.1.2.1. Subjektivität als eigenständige Strukturierungsebene
Ursula Holtgrewe (2003) reflektiert in ihrem Aufsatz mit dem Titel „Informatisierte Arbeit und flexible Organisation: Unterwerfung, Distanzierung, Anerkennungskämpfe?“ zunächst den diesen vorangegangene Diskussion über die „Subjektivierung von Arbeit“. Dabei reflektiert sie einen eingleisigen Dualismus, welcher ihrer Meinung nach den Diskurs strukturiert: Auf der einen Seite stehen die s.g. „Unterwerfungsthesen“(ebd:23), welche in der zunehmenden Nutzung subjektiver Ressourcen im Arbeitsprozess entweder, in marxistischer (subsumtionstheoretischer) Tradition stehend, durch die antizipierte nun vollständige Aneignung des Arbeitvermögens des Subjekts seitens des Kapitals einen weiteren Schritt der Entfremdung des Arbeiters vom Produkt sehen (z.B. Boes 1996); oder, in Beerbung des Poststrukturalismus, den subjektivitätsorientierten Managementprogrammen die Macht zur einseitigen Konstitution von Subjektivitäten zuschreiben[14] (z.B. Lemke u.a. 2000); oder , wie Richard Senett (1998), in der Folge des Zwangs zur ständigen Flexibilität eine „Erosion“ der menschlichen Identität befürchten (vgl. Holtgrewe 2003: 23ff). Auf der anderen Seite stehend sieht die Autorin die Thesen der Entfaltung (z.B. Gorz 2002). Grob zusammengefasst proklamieren diese Ansätze, dass die Einbindung der Subjektivität in die Erfüllung zunehmend ganzheitlicherer und umfangreicherer Arbeitsaufgaben eine Art von Kreativität und Intersubjektivität erzeugt, welche nicht vollständig von der Logik des Kapitals absorbiert wird, sondern zur Grundlage sozialer Wandlungsprozesse, die „von unten“ ausgehen, werden kann (vgl.: Holtgrewe 2003: 26f).
Beide Sichtweisen unterstellen ihrer Auffassung zufolge „einen einlinigen Prozess sozialen Wandels, in dem es zwar Ungleichzeitigkeiten und sogar gut dialektische Widersprüche gibt, die den Prozess vorantreiben, aber dessen Richtung und/ oder Ergebnis schon festliegt“ (ebd.:30). Zur Umgehung dieses a priori Determinismus modifiziert sie die Frage nach Entfaltung oder Unterwerfung in die Frage nach der sozialen und subjektiven Vorstrukturierung von Entfaltungs chancen (vgl. ebd: 21). Um dieses Problemfeld erfassbar zu machen, erhebt sie die Subjektivität des arbeitenden Individuums in die Position einer eigenständigen Strukturierungsebene. Methodisch impliziert diese Vorgehensweise, dass unter der Anwendung empirisch- fallrekonstruktiver Arbeitsweisen untersucht wird, „wie und unter welchen sozialen Voraussetzungen die Arbeitenden von organisationellen Transformationsprozessen betroffen werden oder in diesen gestaltend agieren können“ (ebd.:31). In einer pragmatistischen Sichtweise wird so „Subjektivität durch die Weisen des Handelns konstruiert, und diese wiederum sind subjektiv voraussetzungsvoll und pfadabhängig“(ebd.:31f). Als Ergebnis dieser Methodik entsteht bei der Autorin eine „Typologie der Positionierungsweisen der Subjekte“. Holtgrewe stellt nun zwei dieser Positionierungsweisen, die im Zuge der Auswertung von empirischen Forschungsprojekten über Arbeit in der Telekommunikationsbranche entstanden, näher vor: „Selbstflexibilisierung“ und „aktivistischer Aufbruch“.[15] (vgl.: ebd.:32ff)
Mit dem Terminus „Selbstflexibilisierung“ umschreibt die Autorin eine Positionierungsweise, bei welcher sich das Subjekt zunächst scheinbar den organisationellen Anforderungen des ständig flexiblen Einsatzes subjektiver Fähigkeiten vollständig ausliefert: In der angestrebten Vermeidung von Enttäuschungen gibt es jeden Selbstverwirklichungsanspruch durch das Arbeitsergebnis auf, und bezieht seine Arbeitsmotivation einzig aus einer autosuggestiven „Freude“ am Arbeitsprozess (flow). Bei genauerem Hinsehen enthält der Autorin zufolge jedoch selbst diese Orientierung ein Element des Widerstandes; und zwar indem sie als reine Handlungsorientierung auftritt: Das Subjekt setzt sich hier nämlich individuelle Kriterien, welche diesen „Spaß am Prozess“ definieren und handlungsleitend sind. Diese müssen nicht unbedingt mit der Ergebnisorientierung der Organisation einhergehen; können ihr gar gegenüberstehen. Diese Positionierungsweise hat allerdings einen hohen Preis: Da diese Form der Selbstentfaltung impliziert, dass keine konkreten Handlungsergebnisse angestrebt werden, müssen auch Gestaltungsansprüche an die eigene Zukunft aufgegeben werden. Es kommt zur ‚Absorption der Subjektivität im Moment’ (vgl.ebd.:31).
Quasi das Gegenstück bildet der „Aktivistische Aufbruch“ : Im Unterschied zur ersten Positionierungsweise lässt sich das Subjekt hier nicht von äußeren Auforderungen an seine Subjektivität „treiben“ und sucht sein „Heil“ im Spähen jenseits von Nutzen für die biographische Entwicklung. Zwar greift es zu seiner Positionierung ebenfalls auf ein Feld zurück, welches jenseits der Ziele der Organisation steht, sucht sich dieses jedoch bewusst nach Kriterien des antizipierten zukünftigen Nutzens (z.b. Erwerb von Bildung und Erfahrungen) und strukturiert so die Anwendungsweisen seiner Subjektivität (und somit seine Subjektivität selbst ) maßgeblich mit.
Auf diese Weise beantwortet Holtgrewe in ihrer Perspektive der Positionierungsweisen die Frage des Machtverhältnisses (hier Verteilung der Entfaltungschancen) mit dem Rekurs auf individuelle Dispositionen und Ressourcen als Vermittlervariable: „Gestaltend und projektiv handeln zu können, und sich damit neue Perspektiven zu erschließen, hängt (...) davon ab, dass man schon welche hat.“(ebd.:39)[16]
2.1.2.2. Entmachtung durch Vermarktlichung
Ulrich Brinkmann beschäftigt sich in einem Aufsatz von 2003 mit der Verschiebung der Machtstellung von Wissensarbeitern[17]. Dabei wird untersucht, welche Veränderungsprozesse im Arbeitsumfeld jener ehemals machtvollen Angestelltengruppe dazu geführt haben, dass diese nun zunehmend ihre Selbstentfaltungsansprüche zurückschrauben und sich mehr und mehr den Anforderungen des Managements anpassen müssen.
Zunächst wird dabei Wissensarbeit als Tätigkeit vorgestellt, deren Ausführung traditionell mit einer hohen Machtstellung der entsprechenden Beschäftigten innerhalb der Organisation einhergeht. Diese Machtstellung speist sich vorrangig aus einem Spezifikum, welches den Gegenstand von (höherer) Dienstleistungsarbeit im Allgemeinen kennzeichnet: die Beherrschung von Ungewissheitszonen (vgl. Brinkmann 2003: 70). Hierzu folgender Exkurs:
2.1.2.2.1. Exkurs: Das Rationalisierungsdilemma der Angestelltenarbeit: Berger/Offe (1984)
Berger/Offe (1984) charakterisieren Dienstleistungsarbeit als Gewährleistungsarbeit: Angestellte im Dienstleistungssektor haben den Autoren zufolge die Funktion, den reibungslosen Ablauf von Prozessen innerhalb einer Organisation zu gewährleisten oder gegebenenfalls auch planend und steuernd in diese einzugreifen. Demnach besitzt Dienstleistungsarbeit, im Gegensatz zur Produktionsarbeit; einen völlig anderen Bezugspunkt: Ist in der Produktionsarbeit das Kriterium der Effizienz, also das Erreichen eines angestrebten Output unter dem Einsatz eines geringst möglichen Input ausschlaggebend, so ist es bei der Dienstleistungsarbeit das Kriterium Effektivität, also die möglichst zuverlässige und wirksame Erfüllung der Gewährleistungsaufgabe. Tayloristische Konzepte der Rationalisierung wie Standardisierung, Formalisierung und externe Kontrollen stoßen hier insofern an ihre Grenzen, dass Ungewissheiten in zweierlei Hinsicht bestehen: Einerseits „ist nicht eindeutig bestimmbar, welches Leistungsvolumen überhaupt vorgehalten werden muss, um prekäre Folgen für die Organisation abzuwenden“(edb.: 275;Output - Ungewissheit), andererseits existieren keine eindeutigen Produktionsfunktionen, die angeben könnten, wie viel Dienstleistungsarbeit nötig ist, um ein angestrebtes Gewährleistungsziel zu erreichen (Input- Ungewissheit). Die Organisationen reagieren auf diese Ungewissheiten mit der Schaffung sogenannter Reservekapazitäten, welche den Autoren zufolge in drei Formen auftreten:
1. Zeitreserven: Da es nicht möglich ist, zuverlässige Prognosen darüber abzugeben, wann genau die Dienste der Angestellten (z.B. durch auftretende Störungen oder verstärkten Kundenansturm) in Anspruch genommen werden müssen, erscheint es für Organisationen durchaus rational, Leerlaufzeiten der Angestelltenschaft in Kauf zu nehmen, um auf diese Weise angemessen auf unvorhersehbar auftretende Schwankungen im Arbeitsvolumen reagieren zu können.
2. Qulifikationsreserven: Organisationen können jederzeit in die Situation kommen, mit einem bis dato noch nicht aufgetretenen, normabweichenden Problem konfrontiert zu werden, welches jedoch immensen Schaden anrichten könnte. „Ganz im Gegensatz zu den auf die Produktionsarbeit zugeschnittenen Prinzipien des Taylorismus ist in diesen Fällen der Einsatz von Arbeitskräften mit höherer als der Durchschnittlich <abgerufenen> Qualifikation durchaus rational.“ (ebd: 276)
3. kontinuierliche Überproduktion von Informationen: Da im Vorfeld überhaupt nicht oder nur sehr vage abgeschätzt werden kann, welche Informationen für ein erfolgreiches Bewerkstelligen der Gewährleistungsaufgabe benötigt werden, erscheint es für Organisationen durchaus rational, kontinuierlich auch nur mit geringer Wahrscheinlichkeit benötigte Informationen zu produzieren.
Wie sind diese Reserven aber nun am günstigsten zu schaffen und am effizientesten zu nutzen? Oder anders ausgedrückt: Wie lässt sich Effektivität effizient gestalten? Da auf eine unkalkulierbare Umwelt logischerweise nicht effektiv mit Standardisierung der Arbeit reagiert werden kann, muss folglich ein anderes Mittel zur Effizienzsteigerung herangezogen werden. Nach Berger/ Offe (1984) erscheint den Organisationen hier folgende Doppelstrategie am rationalsten: Einerseits wird den Angestellten eine erhöhte Autonomie zugestanden, damit sie stets im Stande sind, auf auftretende Anforderungen schnell zu reagieren; andererseits werden Maßnahmen der Personalentwicklung (die zu unternehmensinternen Aufstiegschancen führen) ergriffen, welche die Arbeitskraft möglichst eng ans Unternehmen binden sollen. „ Dieses strategische Kalkül impliziert nun für die Personalplanung, dass (...) ein Maximum an Leistungsreserven, das je nach Problemlage in relativ unstrukturierten Situationen flexibel abgerufen werden kann, zustande kommt.“ (ebd.: 277). Die Dienstleistungsspezifischen Ungewissheiten fordern dem Unternehmen also ein verstärktes Eingehen auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ab.
Allerdings weisen die Autoren auch darauf hin, dass Autonomie nur bis zu einem gewissen Grade zugestanden werden kann; nämlich bis zu jenem Grade bei dem sich die autonominierten Dienstleistungsstäbe so verfestigen können, dass sie eine Gefahr für die Souveränität der Organisation darstellen. Dieser Spagat zwischen erforderlicher Autonomie und unabdingbarer Kontrolle stellt nun das eigentliche Dilemma dar.
Dachten Berger/Offe bei dieser Analyse noch vorrangig an produktionsbezogene Gewährleistungsaufgaben, wurde die Situation für das Management nach Brinkmann im Zuge der ansteigenden Bedeutung von Wissen als fundamentaler Produktionsfaktor in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmend prekärer: Zu der angeführten mangelnden Kontrollierbarkeit der Aufgabenerfüllung im Sinne der Organisation kam das weitere Problem, dass das Wissen, welches wissensbasierter Dienstleistungsarbeit zugrunde lag, meist nur bis zu einem bestimmten Grade objektivierbar war, und deshalb in gewisser Weise an konkrete Personen gebunden blieb. Die Abwanderung wichtiger Wissensarbeiter konnte somit für ein Unternehmen den Verlust der Produktionsbasis und damit den Ruin bedeuten. (vgl. Brinkmann 2003: 69ff). Dieser Umstand brachte die Souveränität des Managements in arge Bedrängnis: Die Machtstellung der Angestellten war teilweise sogar so stark, das Managemententscheidungen von der Belegschaft torpediert werden konnten, falls sie deren Intensionen entgegenliefen (vgl. ebd.: 75). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Dilemma, dem sich die Organisationsführungen entgegengesetzt sahen, nun darin bestand, „sowohl eine sichere Bindung der WissensarbeiterInnen an das Unternehmen zu gewährleisten, als auch eine möglichst hohe Unabhängigkeit von ihnen“ (ebd.:80).
Das Problem löste sich schließlich wie von selbst, als sich der Arbeitsmarkt für Wissensarbeit von Anbieter- zum Nachfragermarkt wandelte. Mit der Reflexion der drohenden Arbeitslosigkeit wandelten sich die Präferenzen der Wissensarbeiter nun vom bis dahin dominierenden Wunsch nach Selbstverwirklichung in abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeiten (was mit drohender Fluktuation verbunden war) hin zum Verlangen nach sicherer Beschäftigung (vgl.ebd.:81). Diese Entwicklung erlaubte dem Management nun die mit dem Spezifika von Wissensarbeit verbunden Bedrohungen durch eine „Verschiebung der Marktgrenzen“ (ebd.:75) in die Arbeitenden selbst zu externalisieren und somit die Machtverhältnisse (wieder) umzukehren. Die konkreten Maßnahmen, welche installiert wurden, sahen folgendermaßen aus:
Einerseits wurden die Beschäftigungsverhältnisse gewandelt: Ehemalige Angestellte werden zunächst entlassen, um anschließend als freie Mitarbeiter wieder eingestellt zu werden. Das Unternehmen tritt ihnen auf diese Weise nun nicht mehr als Arbeitgeber, sondern als Kunde gegenüber. Diese Verschiebung der Marktgrenzen zwischen Organisation und Mitarbeiter (vgl.ebd.82) entbindet so das Management von der Aufgabe, das Arbeitsvermögen des Subjekts in Arbeitsleistung zu transformieren: Indem das Unternehmen den vormals abhängig Beschäftigten nun, „auf eigen Rechnung“ arbeiten lässt, zwingt man ihn dazu, seine Arbeitskraft selbständig rational zu verwerten[18]. Die mangelnde Kontrollierbarkeit von (Wissens-) Dienstleistungsarbeit wird auf diese Weise für die Organisation ebenfalls entproblematisiert, da sich jede Nachlässigkeit auf direktem Wege im Lohn niederschlägt.
Korrespondierend dazu steht auf der anderen Seite der Versuch, die subjektgebunden Arbeitsleistungen in gewisser Weise zu „entmystifizieren“ (d.h. für den effizienzorientierten Führungsweisen des Managements zugänglich zu machen) indem ihnen ein „objektiver Wert“ zugemessen wird: der Marktpreis. In der Praxis bedeutet dies, dass der Mitarbeiter (oder besser: Interpreneur) mit dem Management Zielvereinbarungen darüber trifft, welche Menge an Dienstleistungen (z.B. Vertragsabschlüsse) in einem bestimmten Zeitraum zu welchem Preis (Entlohnung des Mitarbeiters) von ihm erstellt werden. Um dementsprechende „Aufträge“ zu erhalten, und damit den Fortbestand seines Beschäftigungsverhältnisses zu sichern, muss er ein Preis/Leistungs- Verhältnis anbieten können, das ihn „konkurrenzfähig“ gegenüber Mitbewerbern macht. Aufgrund der so betriebenen reinen Fokussierung des Abseitsergebnisses verliert die Kontrolle von Ungewissheitszonen ihren Status als Machtressource des Beschäftigten, da eventuelle Risiken von ihm selbst getragen werden müssen (vgl. ebd.: 85).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach dieser Perspektive das Angewiesensein auf die Einbringung subjektiver Potentiale seitens der Mitarbeiter nur dann eine Verbesserung der Machtverhältnisse für die Beschäftigten hinsichtlich deren Selbstverwirklichungschancen mit sich bringt, wenn die Arbeitmarktlage ohnehin gut ist. Sobald die arbeitenden Subjekte mit ungünstigen Bedingungen konfrontiert sind, können Arbeitsorganisationsweisen installiert werden, durch welche die Beschäftigten nicht nur „auf ihr Rollensegment als Marktteilnehmer reduziert“ werden (ebd.:86), sondern:
„Das marktzentrierte Unternehmen (...) geht noch einen Schritt weiter: Es ist auch an der Arbeit an sich kaum interessiert, sondern primär an ihrem Produkt, oder noch präziser, bei gegebener Qualität am Produktpreis. Alles was jenseits des Produkts oder der Dienstleistung liegt und was eventuell Projektionsfläche normativer Subjektivierung ist, wird vom Unternehmen in dieser Logik externalisiert“(ebd.:87)
Mit der Verschiebung der Marktgrenzen in die Subjekte hat das Management so also eine äußerst effektive Lösung der oben skizzierten Dilemmata der Dienstleistungs- bzw. Wissensarbeit gefunden, die (wieder) im Modus „Motivation durch Angst“ operiert und, indem sie die Subjekte als Marktteilnehmer konzipiert, Zugriffsmöglichkeiten auf deren Subjektivität impliziert, welche weit über die des Taylorismus hinausreichen.
2.1.2.3. Subjektivierung durch Arbeit vs. Subjektivierung der Arbeit im Call-Center
Frank Kleemann und Ingo Matuschek (2003) nähern sich in ihrem Forschungsbeitrag über Kommunikationsarbeit in Call-Centern der Frage nach den Machtverhältnissen aus einer interaktionstheoretischen Perspektive: Auf der Basis empirischer Erhebungen in zwei Bank-Call-Centern untersuchen die Autoren „Konstellationen subjektivierter Arbeit“, welche sich im Wechselspiel zwischen der „Ideologisierung von Subjektivität“, also der Implementierung von Leitbildern seitens des Managements, und der „reklamierten Subjektivität“, also an die Arbeit herangetragenen Ansprüche seitens der Subjekte, ergeben (vgl. ebd.:117f). Dazu werden zunächst die Maßnahmen des Managements analytisch spezifiziert, um sie anschließend mit den Motivationen der Angestellten in Verbindung setzen zu können.
Auf der Seite des Managements konstatieren die Autoren den Versuch einer „ideellen Vergemeinschaftung“: Über die (aufoktroyierte) Festlegung auf „gemeinsame“ Ziele, welche meist recht diffus formuliert sind („Wir müssen besser sein als die anderen“) und im Sinne einer (unternehmens-) kulturellen Präformierung des Beschäftigten wirken sollen, und die Etablierung von „Verhaltensrichtlinien mit Selbstverpflichtungscharakter“, welche das Verhalten der Mitarbeiter untereinander (vor-)strukturieren soll, um so die Formierung kollektiver Widerstände zu unterbinden, wird versucht, die Subjektivität des Mitarbeiters in eine verwertbare und steuerbare Form zu bringen (vgl.:ebd: 126ff).
Bei den Mitarbeitern treffen derartige Versuche einer „Subjektivierung durch die Arbeit“ (vgl.: ebd.) auf eine Motivationsstruktur, die hauptsächlich auf die Verwirklichung des Kriteriums „Spaß“ an der Arbeit im Sinne von Abwechslung durch wechselnde „Herausforderungen“ abzielt[19] (vgl.:ebd:131ff). An welchem Punkt kommen nun beide Partein zusammen?
Da die oftmals repetitive Call-Center Arbeit, wenn sie strikt nach den Vorgaben des Managements ausgeführt wird, keine Langzeitmotivation für intrinsisch motivierte Beschäftigte bieten kann, versehen diese ihre Tätigkeit mit s.g. subjektiven Sinnstiftungen. Dies bedeutet, dass die Beschäftigten sich jeweils individuell definierte Ziele hinsichtlich des zu erreichenden Arbeitsergebnisses setzen, deren Erreichung ihnen ein „subjektiv positives Erlebnis des einzelnen Kundenkontaktes“ beschert (ebd.: 133). So setzt sich der Mitarbeiter beispielsweise das Ziel, eine besonders hochwertige Dienstleistung zu erstellen und setzt sich über die Managementvorgaben hinausgehend für die Belange des Kunden ein. Dies kann sogar soweit gehen, dass er gegen das Unternehmen (beispielsweise unter Missachtung von Zeitvorgaben für Gespräche) als „Anwalt des Kunden“ auftritt (vgl.: ebd.).
Ironischerweise zeigt sich an diesem Verhalten, dass die Ideologisierungsversuche des Managements par exelance fruchten: Die „ideelle Vergemeinschaftung“ wird ja gerade mit dem Ziel betrieben, die ganze der Persönlichkeit Mitarbeiter, insbesondere Engagement und ihre Emotionalität, für die Unternehmensziele (wozu ein qualitativ hochwertiger Kundenkontakt zweifelsohne zählt) zu vereinnahmen. Allerdings führten diese Ideologisierungsbestrebungen nicht zur mechanistischen Konditionierung des Angestellten, sondern werden, so die Autoren, in jeweils individuellen Sinnstiftungssystemen reorganisiert. Auf der Handlungsebene führt dies zur (von Management) nicht intendierten Nebenfolge, dass Handlungsvorgaben, welche weniger stark ideologisiert wurden und zudem nicht den Arbeitsansprüchen des Subjekts einhergehen, bewusst unterlaufen werden.
Jedoch sind derartige subjektive Umdeutungen von Managementvorgaben den Autoren gemäß zu defensiv und individualistisch, um einen Ansatzpunkt für Machtverschiebungen zugunsten der Subjekte zu bilden, und so das Management „mit den eigen Waffen zu schlagen“.
„Zum einen wird der vorgegebene ‚unternehmenskulturelle Überbau’ weitgehend akzeptiert, weil die ‚unternehmenskulturellen’ Infiltrierungen angesichts individueller Dispositionen zur Arbeit tatsächlich Anklang bei den Beschäftigten finden (...). Findet dagegen nur eine vordergründige Rezeption der hegemonialen Unternehmenskultur statt, werden die vom Management sozial erwünschten Praktiken nur partiell (re) produziert (...) Allerdings trägt dies dazu bei, dass zumindest kollektiver Widerstand gegen die Managementvorgaben unterbleibt, und Widerstandspotentiale auf individuelle Arrangements der Arbeitenden hin kanalisiert werden“ (ebd.).
2.1.3. Fazit
Reflektiert man die im vorangegangen Abschnitt dargestellten Beispiele, so fällt vor allem auf, dass die Frage nach den Machtverhältnissen zwischen arbeitendem Subjekt und Management im Kontext subjektivierter Arbeit, je nach Perspektive des (bzw. der) Autore(n), jeweils von Variablen abhängig gemacht werden, die auf verschiedenen sozialen Ebenen angesiedelt sind: Brinkmann sieht den Arbeitsmarkt als strukturierendes Moment und propagiert so die Sichtweise, welche eine externe Determination der Machstellung des Subjekts seitens eines Aggregates der Makroebene impliziert. Kleemann/Matuschek forschen auf der Meso-Ebene der Organisation, und konstatieren eine ideologische Vereinnahmung des Subjektes im Zusammenhang neurer Managementstrategien. Schließlich bewegt sich Holtgrewe auf einer mikrosozialen (bzw. subjektiven) Ebene und analysiert subjektive Entfaltungschancen als Effekt biographischer Dispositionen. Auf diese Weise bleibt der Diskurs gewissermaßen auf halbem Wege stehen: er erkennt zwar, zumindest als Summe seiner Teile, dass es sich bei der Regkonfiguration der Machtverhältnisse zwischen Management und Subjekt im Feld der Arbeit um ein Phänomen handelt, welches sich parallel von auf mehren Ebenen stattfindenden Verschiebungen herleitet; er versäumt es dabei jedoch, nach tieferliegenden Transformationen zu fragen, welche uns diese Verschiebungen als einheitlichen Prozess begreifen lassen. Die Offenlegung derartiger (hypothetischer) Prinzipen könnte helfen, den Diskurs zu „Defragmentieren“ und auf diese Weise den analytischen Blick des Forschers zu schärfen. Sie könnte so schließlich als Ausgangsbasis für das Formulieren integrativer Forschungsprogramme bilden, welche zur Erarbeitung umfassendere Empfehlungen für die Steuerung verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche herangezogen werden könnten.
2.2. Techniken
Das vorrangegangene Kapitel beleuchtete den Teildiskurs, der sich mit der Frage der Machtverhältnisse, die sich im Rahmen subjektivierter Arbeit zwischen Organisation und Subjekt etablieren. Dabei wurde, grob gesagt, die Subjektivität des arbeitenden Individuums als in einem Spannungsfeld begriffen: Auf der einen Seite stehen individuelle Selbstentfaltungsbestrebungen, auf der anderen Seite die organisationellen Vereinnahmungsversuche. Der nächste Abschnitt beschäftigt sich nun mit Texten, welche letztgenannte näher unter die Lupe nehmen. Hier werden jene Techniken der (Personal-) Führung näher untersucht, welche die Zielsetzung verfolgen, die subjektiven Potentiale des Mitarbeiters abzuschöpfen bzw. die Subjektivität des Individuums so zu strukturieren, dass sie in eine ökonomisch verwertbare Form gebracht wird. Dabei besteht eine gewisse Schnittmenge mit dem vorangegangen Dargestellten: Bereits dort wurde das Thema mit der Darstellung der Instrumente ‚Verschiebung von Marktgrenzen’(2.1.2.2.) und ‚Ideologisierung der Mitarbeiter`(2.1.2.3.) angeschnitten. Da m.E. in der Literatur jedoch ein Teildiskurs existiert, der sich ausschließlich diesem Thema verschreiben hat, erscheint es mir angebracht, diesem hier einen separaten Platz einzuräumen.
2.2.1. Hintergrund
Wenn sich die Ansprüche der Arbeit an das Subjekt verändern, so impliziert dies auch einen Wandel im Modus der Mitarbeiterführung. Das Paradigma des Taylorismus implizierte, ausgehend von der grundlegenden und nicht wandelbaren Disposition des Menschen zur Arbeitsscheue (Theorie X), Führungstechniken, welche das Verhalten des Mitarbeiters über externe Faktoren zu steuern versuchten: Motivation und Deprivation über den quantitativ ausgerichteten Akkordlohn und Sanktion durch Sicherstellung der Austauschbarkeit des Einzelnen mittels maximaler Standardisierung der Arbeitsabläufe (Motivation durch Angst vor Entlassung) sind dabei die beispielhaftesten Führungsinstrumente, mittels welcher das arbeitende Subjekt dazu bewegt werden sollte, seine Arbeitskraft möglichst effektiv im Sinne des Unternehmen einzusetzen .[20]
Derartige Strategien implizieren jedoch stets einen immensen Organisationsaufwand, da sämtliche Arbeitstätigkeit bis ins Detail vom Management geplant und in ihrer Ausführung kontrolliert werden müssen. Um diese zahlreichen dipositven Operationen mittels Formalisierung und Standardisierung effizient gestalten zu können, wird der Aufbau eines umfangreichen unternehmensinternen Bürokratieapparates unumgänglich, welcher die Wandelbarkeit der Unternehmensstruktur behindert. Mit dem Verweis auf eine Flexibilität einforderte (Markt-)Umwelt werden aus diesem Grunde tayloristische Führungs- und Organisationstechnologien heute oftmals als ineffizient angesehen. Das Management sieht sich daher gezwungen, neue Führungstechniken zu entwickeln, welche im gleichem Zuge einerseits den Mitarbeiter zum vollen Einbringen seiner Leistungsfähigkeit im Sinne des Unternehmens veranlassen, andererseits jedoch keine internen Strukturen generieren, welche einer flexible Anpassung des Unternehmens an die sich permanent wandelnden Erfordernisse des Marktes im Wege stehen. Wie im vorrangegangen Kapitel (2.1.2.2.) schon angedeutet, wurde für dieses Problem bereits eine Lösung gefunden: die Verscheidung der Marktgrenzen. Noch einmal aus anderer Perspektive zusammengefasst bedeutet dies:
„Der Arbeitende wird weitgehend ‚dem Markt’ ausgesetzt und soll, ja muss in diesem Kontext so agieren wie ein ‚unternehmerisches Subjekt`. Man externalisiert gewissermaßen die Transaktionskosten organisations- bzw. betriebsförmiger Wirtschaftstätigkeit ‚nach innen’, an die Arbeitssubjekte. Sie ihrerseits internalisieren‚ den Markt’“ (Moldaschl 2003b).
Da der Markt allerdings nicht die natürliche Lebensumwelt ist, in die das Subjekt hineinsozialisiert wir, internalisiert sich dieser nicht von selbst. Es werden Techniken der Mitarbeiterführung und Arbeitsorganisation notwendig, welche den Mitarbeiter erst dazu bringen, in der Logik des Marktes zu denken, bzw. ein unternehmerisches Subjekt zu werden.
Die im Folgenden vorgestellten Forschungsbeiträge untersuchen drei dieser Techniken: die des s.g. Accounting, die Multiplizierung der Kundenschnittstellen und das Human –Resource Management.
2.2.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.2.2.1. Autonomie und Verantwortlichkeit: Die Praktik des Accounting
Ein Beitrag von Peter Miller (2005) geht folgender Frage nach: „ In welcher Weise eröffnen kalkulative Praktiken neue Möglichkeiten der Beeinflussung und Formung individuellen Handelns“(ebd.: 19)?[21]
Mit dem Begriff „Kalkulative Praktiken“ werden ganz allgemein betriebswirtschaftliche Verfahren bezeichnet, welche der Vorausberechnung zukünftiger Kosten dienen und deren Ergebnisse somit Handlungsweisen in der Gegenwart bestimmen. Verdeutlicht werden kann die Wirkungsweise dieser auch als „Accounting“ bezeichneten Praktiken am Beispiel des Konzeptes der Standardkosten: Im Zuge dieses Verfahrens werden zunächst die durchschnittlichen Kosten eines bestimmten innerbetrieblichen (Arbeits-) Vorgangs (z.B. Montage eines Motors, Schreiben eines Artikels, Behandlung eines Patienten etc.- der Einsatz derartiger Konzepte ist nach Miller universell möglich; vgl.: ebd.:23) anhand von Daten aus der Vergangenheit ermittelt. Diese Werte werden dann anschließend gewissermaßen in die Zukunft projiziert, indem sie als Maßstab effizienten Arbeitens dienen bzw. die Grundlage für die Festsetzung von Budgets bilden.
Auf der Ebene der Betriebsführung sind derartige Praktiken zunächst keinesfalls ein neues Phänomen. Im Gegenteil: sie bildeten als grundlegende Operationen der Normierung und Standardisierung der Arbeitsausführung bereits einen wichtigen Eckpfeiler des ‚scientific management`(vgl.: ebd:23ff). Was jedoch neu hinzutritt, ist, dass Standards, welche auf der Basis von Accountingpraktiken festgelegt wurden, jeweils eine individuelle Anwendung bei einzelnen Arbeitssubjekten finden. Konkret manifestiert sich dies in Führungstechniken, im Kontext derer dem Arbeitenden nur noch Ziel- und Budgetvorgaben (Zeit, Geld etc.) gemacht werden, und die konkrete (Handlungs-) Steuerung im Arbeitsprozess weitestgehend entfällt.
Die Gewährung dieser Art von Autonomie hat Miller zufolge nun einen bestimmten Effekt: sie konstituiert „kalkulierende Subjekte“. Die Logik der Argumentation ist die Folgende:
„Wenn ein Individuum in der Lage sein will, ferne Ziele zu antizipieren, über ein Ziel und die Mittel dieses zu erreichen zu entscheiden, so muss es über die Fähigkeit zur Kalkulation und Berechnung verfügen“ (ebd.:20)
Durch die individuelle Verantwortlichkeit für die Erreichung des Ziels ist das Subjekt dazu gezwungen, sich diese Fähigkeit anzueignen, und so in gewisser Weise unternehmerisch, also in Dimensionen wie Angebot und Nachfrage und/oder Investition und Ertrag zu denken und entsprechend zu handeln. Subjektive Deutungs- und Handlungsmuster werden auf diese Weise nach ökonomischen Prinzipien strukturiert. Die Subjektivität erhält damit den Status einer verwertbaren Ressource (vgl. ebd.).
2.2.2.2. Die Multiplizierung von Kundenschnittstellen
Gerd Möll (2003) stellt in seinem Beitrag die Auswertungsergebnisse einer Studie über neue Kooperationsformen zwischen Industrie und Handel dar und geht in diesem Zusammenhang u.a. auch auf veränderte Anforderungen an die Subjektivität der Beschäftigten ein.
Den Gegenstand der Studie bildeten sogenannte ECR[22] - Systeme. Dabei handelt es sich um (meist computergestützte) organisationstechnische Konfigurationen, welche das Ziel verfolgen, die zunehmend im permanenten Wandel begriffenen Ansprüche des Kunden schneller und effizienter bearbeiten zu können. In diesem Zusammenhang, versuchen Industrie- und Handelsunternehmen besonders auf der Ebene der Informationsbeschaffung und –verarbeitung intensiv zusammenzuarbeiten. So verspricht man sich beispielsweise doppelt anfallende Kosten, z.B. bei der Marktforschung, zu vermeiden, oder durch gemeinsam entwickelte Absatzstrategien Synergieeffekte generieren zu können, aus welchen beide Parteien gleichermaßen ihren Nutzen ziehen (vgl.: Möll 2003: 47ff).
Derartige Partnerschaften tangieren nun die Organisationsstruktur der beteiligten Unternehmen maßgeblich: So lässt die organisationsübergreifende Zusammenarbeit zunehmend bisherige Abteilungsgrenzen aufweichen und erfordert die (oft nur temporäre) Reorganisation weiter Teile der Belegschaft in Team- und Projektzusammenhängen. Für das arbeitende Subjekt impliziert dies (meist) eine grundlegende Veränderung der Anforderungsstruktur seiner Tätigkeit. Für Möll ist dabei folgender Punkt von zentraler Bedeutsamkeit:
Traditionell gab es in Unternehmen nur einige bestimmte Stellenprofile, deren Tätigkeitsfeld auf Bereiche jenseits der Unternehmensgrenzen (Markt, Kunden, Zulieferer, etc.) bezogen war. Diese speziellen Positionen der s.g. „Grenzstellenarbeiter“(z.B. Einkäufer, Außendienstler, etc.) wurden meist bereits mit Personen besetzt, welche, anhand spezieller subjektiver Dispositionen wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Neigung zu selbstverantwortlichen Handeln rekrutiert wurden.
Mit der Implementierung von ECR- Systemen kommt es nun jedoch im Zuge der unternehmensübergreifenden Kooperation zu einer „ Multiplizierung der Zahl interorganisationaler Grenzstellen“ (ebd.: 55) und
„entsprechend (...) steigt die Zahl der Beschäftigten, die direkten Kontakt zum Gegenüber haben und ihr Arbeitshandeln stärker auf ihr eigenes Verständnis über Kunden- und Marktanforderungen stützen müssen, als sich an formalen Ausführungsregeln für ihr Arbeitshandeln ausrichten zu können“ (ebd).
Jeder Beschäftigte, der in Unternehmen mit ECR-Sytemen involviert ist, ist daher also zunehmend angehalten, diejenigen subjektiven Kompetenzen zu erwerben, welche zuvor nur von den speziellen „Grenzstellenarbeitern“ erwartet wurden, um im Kontext dieser neuen Arbeitsumwelt bestehen zu können. „Hilfestellungen“ bekommt das Subjekt dabei vom Management: Neben Fortbildungsmodulen, welche den Mitarbeiter zu selbstverantwortlichem Handeln befähigen sollen, haben die Beschäftigen im dargestellten Fallbeispiel die Möglichkeit, „sich während der Arbeitszeit unter fachkundiger Anleitung mit kreativen künstlerischen Tätigkeiten (...) zu beschäftigen (ebd.:58)“. Derartige soziotechnische Maßnahmen liegen zwar offiziell unter dem Deckmantel der freiwilligen Teilnahme, Möll konstatiert jedoch bezogen auf ein Interview eines Vertreters der Geschäftsführung eines Handelsunternehmens:
„ Die nachgewiesene Bereitschaft zur ‚Selbstentwicklung` wird zur Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg. Wer es an Initiative, Flexibilität und Leistungsbereitschaft fehlen lässt, gibt damit zu erkennen, dass er sich nicht in ausreichendem Maße mit dem Unternehmen identifiziert und damit für weitere Karriereschritte nicht in Frage kommt“(ebd.).
Ergänzt werden derartige „Selbstentwicklungsmaßnahmen“ und Schließungssysteme, welche Möll bereits treffend als „Subjektivierungsstrategien“ (ebd.:59) charakterisiert, durch ein Kontrollsystem, welches impliziert, dass sich die Beschäftigten hinsichtlich ihres „vollen Einsatzes“ wechselseitig beurteilen. Auf diese Weise wird gezielt der Kontext einer „multiperspektivische(n) Aufsicht“ (vgl. ebd.) generiert, welcher seine disziplinarische Wirkung nicht verfehlen dürfte:
„Jeder ist Beobachter aller anderen, und Selbstreflexivität wird zur Pflicht für alle. Die Beschäftigenten wirken auf diese Weise an ihrer eigenen Kontrolle mit“ (ebd.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Falle eine neuartige Kooperationsform auf den Unternehmensebenen, welche sich (scheinbar) als Effekt von Markterfordernissen ergibt, es dem Management erlaubt, die arbeitenden Subjekte in eine Situation zu manövrieren, in welcher für diese der Zwang entsteht, ihre Subjektivität in eine Richtung zu entwickeln (oder besser: entwickeln zu lassen), welche in vollem Einklang mit den Unternehmenszielen steht (vgl. ebd:60).
2.2.2.3. Ökonomisierte Bildungskonzepte: das Human Resource Management
Im Zuge eines Beitrages von Peter Kels und Uwe Vormbusch (2005) wird das s.g. „ Human Resource Management als Feld der Subjektivierung von Arbeit“ (Aufsatztitel) vorgestellt. Dabei sind die Autoren vor allem darum bemüht, ein multiperspektivisches Bild zu zeichnen: Neben der Analyse der Beschaffenheit hegemonialer Managementstrategien und deren Auswirkung auf der Ebene der Subjektivität der Beschäftigten, findet so dort auch eine Ausleuchtung von Implementierungsproblemen aufgrund von möglichen sozial und individuell bedingten Modifizierungs- und Widerstandspotentialen statt. Aufgrund der Intension dieses Abschnittes widme ich mich hier jedoch lediglich der Darstellung des erstgenannten Aspektes.
Mit dem Begriff „Human Resource Management“ (HRM) bezeichnen die Autoren in Anlehnung an betriebswirtschaftliche Quellen einen neuen Modus in der betrieblichen Bildungspolitik: Waren früher (Weiter-) Bildungsmaßnahmen lediglich darauf ausgerichtet , das Qualifikationsniveau eines Beschäftigten an das Anforderungsprofil einer bestimmten Arbeitstätigkeit anzupassen, so erfordert die Implementierung von Maßnahmen, die eine Verwertung subjektgebundener Potentiale implizieren (s.o.), weiterreichende Bildungsprogramme:
„Bildungsinvestitionen in das ‚Können’ und ‚Wollen’ (der Mitarbeiter -A.d.V.) sollen die subjektiven Voraussetzungen für die Bewältigung der mit dezentraler Steuerung, Teilautonomie und Vermarktlichung verbundene Anforderungen schaffen“ (ebd.:38)
Diese Investitionen manifestieren sich dann vor allem in Maßnahmen zur „subjektorientierten Kompetenzentwicklung“(vgl.ebd:40). Konkret handelt es sich dabei vorrangig um einerseits psychologisch orientierte Lehrgänge, welche das Ziel verfolgen „...subjektive Fähigkeiten und Bereitschaften zur reflexiven Problemlösung, zu einem weitgehend selbstgesteuerten Lernen und Arbeiten, sowie einem ökonomisch verantwortlichen Handeln zu stärken“ (ebd.:40); anderseits um die Etablierung von Formen der Arbeitsorganisation, welche so strukturiert sind, dass von Mitarbeitern in starkem Maß selbstverantwortliches Handeln gefordert wird (teilautonome Arbeitsgruppen, KVP- Zirkel , Lerninseln, etc.). Folgt man der Logik und Sprache der Ökonomie, so handelt es sich hier um Investitionen in das Humankapital: Das Management wendet in einem gewissen Umfang zunächst Mittel für die Fortbildung der Belegschaft auf und steht dabei in der Erwartung, dass, aufgrund danach wesentlich effizienter arbeitender Mitarbeiter, diese Investitionen einen gewissen Profit abwerfen. Um die Rentabilität derartiger Investitionen nun sicherzustellen, impliziert das HRM -Paradigma die Anwendung eines s.g. „Bildungscontrolling“. Darunter ist zu verstehen, dass bestimmte Kostenrechnungsmodelle zur Anwendung kommen, welche eine Identifizierung des Beitrags von Bildungsaktivitäten zum Unternehmenserfolg gewährleisten sollen. Auf diese Weise kann dann gegebenenfalls entschieden werden, welche Bildungsmaßnahmen lukrativ sind, und vor allem bei welchen Mitarbeitern bzw. Mitarbeitergruppen sich die Förderung rentiert (vlg. ebd.: 42f). Das HRM verspricht auf diese Weise „eine kosten-, erfolgs-, oder wertschöpfungsorientierte Steuerung des gesamten Prozesses betrieblicher Qualifizierung“ (ebd.:42).
Für die Subjekte beinhaltet so auch dieses Paradigma, in welchem letztendlich „die Personen und ihre Subjektpotentiale (...) auf ihre verwertbaren Anteile und ihre strategische Bedeutsamkeit für das Unternehmen reduziert“ (ebd.:44) werden, den Zwang, sich im Sinne des Unternehmens zu verwirklichen: Zeigen die Bildungsmaßnahmen bei einem Individuum keinen Erfolg, der sich in den Bilanzen widerspiegelt, so erweist sich die Investition in diesem Falle als unrentabel und wird daher nicht wiederholt werden. Durch den Ausschluss von Kompetenzentwicklungsmaßnahmen fehlen dem Subjekt dann auf Dauer wichtige Ressourcen, welche es für den Aufstieg im Unternehmen oder gar für das Bestehen am Arbeitsmarkt überhaupt benötigt. Zumindest gemäß seiner Intension ist das HRM daher als Technik der Zurichtung von Subjektivität zu betrachten.
2.2.3. Fazit
Im diesem Abschnitt wurden drei Führungs- und Organisationstechniken vorgestellt, die eine gemeinsame Intension verfolgen: Subjekte gewissermaßen dazu veranlassen, die Umwelt des Unternehmens (den Markt) als ihre eigene zu reflektieren und entsprechend in einem ökonomischen Modus zu denken und zu handeln. Wie oben dargestellt, handelt es sich dabei um eine Form Rationalisierung, die weit über die des Taylorismus hinausreicht: Waren dort Planung und Kontrolle noch vom Management zu erbringende Leistungen, ermöglichen diese Techniken nun eine Delegierung dieser Aufgaben an das Subjekt. Vermochten tayloristische Anreiz- und Sanktionsmaßnahmen das Handeln und Denken des Subjekts lediglich äußerlich (instrumentell) zu steuern, handelt es sich hierbei um Versuche einer „inneren Landnahme“(Moldaschl 2002), welche die tiefsten Sphären der Individualität tangieren.
Betrachtet man die einzelnen Techniken, so kommt man zu dem Glauben, dass sie im einzelnen auf je sehr unterschiedliche Weisen agieren: die Technik des Accounting formiert ökonomische Subjekte über konkrete Zielvorgaben, welche durch autonomes Handeln zu erreichen sind; die Multiplizierung von Schnittstellen installiert neue Tätigkeitsfelder, für deren Bearbeitung ökonomisch-subjektives Handeln notwendig wird, und das Human- Recorce- Management operiert über den Zugang zu Bildungschancen. Wie auch schon im Falle der „Machtverhältnisse“ wird auch hier der Diskurs von seiner fragmentierten, multiperspektivischen Struktur gelähmt: All diese Techniken haben ein gemeinsames Ziel, soweit ist alles klar. Es erscheint unter gegenwärtigen Vorzeichen jedoch nur schwer möglich, sie auch hinsichtlich eines gemeinsamen impliziten Operationsmodus zu befragen, in welchem sie über die Subjektivität des Individuums wirksam werden.
2.3. Legitimität
Im letzen Kapitel wurde der Teildiskurs dargestellt, der sich mit der Frage beschäftigt, welche Techniken vom Management eingesetzt werden, um Beschäftigte dazu zu bringen, ihre Subjektivität in ihr Arbeitshandeln einzubringen bzw. diese nach ökonomischen Prinzipen zu strukturieren. Dabei wurde gezeigt, dass nahezu jede dieser Techniken auf marktförmige Prinzipen der Leistungserstellung und –bewertung zurückgreift. Der folgende Abschnitt wendet sich nun folgender Frage zu: Aus welchen Gründen werden derartige Steuerungsmaßnahmen von den Beschäftigten akzeptiert? Oder anders: Wie sehen die Legitimationsordnungen aus, die Leistungsansprüchen subjektivierter Arbeit zugrunde liegen?
2.3.1. Hintergrund
Um den Begriff der Legitimation soziologisch zu konzeptualisieren, greife ich, im Einklang mit den vorgestellten Autoren (vgl. Menz 2005), erneut auf die Herrschaftssoziologie Max Webers zurück. Für Weber ist Legitimität ein grundlegender Faktor für das Bestehen einer Herrschaftsordnung: Herrschaft wird bei ihm zunächst als „Chance“ definiert „für einen Befehl (…) bei einer abgebbaren Gruppe Gehorsam zu finden“ (Weber 1972:28) .Eine wichtige Vorraussetzung für diese Chance sieht Weber darin begründet, dass die Beherrschten ein Minimum an Willen zum Gehorchen aufweisen. Um diese Bereitschaft zu initiieren, muss der Herrschende bei den Beherrschten ein Motiv der Ordnung zu gehorchen erzeugen, welches über reine Nutzenkalkulation (Zweckrationalität) und Gewohnheitsmäßigkeit hinaus reicht (vgl. ebd.: 521ff). Dieses Motiv bezeichnet nach Weber den Glauben, dass die Herrschaftsform einen Aspekt besitzt, der sie über andere, zu einem gegebenen Zeitpunkt mögliche, Alternative stellt. Demzufolge kommt Legitimität nur zustande, wenn zwei Aspekte parallel zusammenkommen: Ein Legitimationsangebot seitens des Herrschenden und dessen Akzeptanz beim Beherrschen.
Wenn wir nun in unserem Zusammenhang das Verhältnis zwischen Management und Beschäftigten als Herrschaftsverhältnis im weberischen Sinne denken wollen, ergibt sich im Kontext von Arbeit nun folgende Frage: Wo liegen die Motive der Beschäftigten, die über reine Zweckrationalität und Gewohnheit hinausgehen, eine bestimmte Ordnung des Leistungsanspruchs bzw. der Leistungsbewertung zu akzeptieren?
Das tayloristische Paradigma konnte an dieser Stelle noch darauf verweisen, dass es bestimmte konstitutive Momente enthält, die auf den Prinzipen von Objektivität, Gleichheit und Gerechtigkeit gründen: Den Bezugspunkt der Arbeitsleistung bildete dort die unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden festgesetzte Normalleistung, die spezifisch für jede Tätigkeit vorgab, welches (quantitative) Arbeitsvolumen innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Einzelnen zu erbringen war. Wurde die Normalleistung übertroffen, erhielt der Beschäftige zusätzliche Vergütungen; wurde sie nicht erreicht, kürzte man ihm den Lohn (vgl. Menz 2005:100f).
Die neueren Leistungsbewertungskonzepte haben derartige Legitimationsgrundlagen hingegen nicht aufzuweisen: Ihr Bezugspunkt ist nicht die konstante Arbeitsleistung, sondern eine variable und externe Größe: das Arbeits ergebnis in Relation zu den gegenwärtigen Erfordernissen des Marktes (s.o.). Diese Ordnung impliziert erstens Ungerechtigkeit, da der Markt einen Faktor darstellt, der vom Subjekt in keiner Weise selbst beeinflusst werden kann, zweitens Ungleichheit, da je nach spezifischer Aufgabe und Ort unterschiedliche Marktbedingungen herrschen, und drittens keine maßgebliche Objektivität, da Kennzahlen des Markterfolges nicht im konkreten Bezug zur Arbeitleistung stehen (vgl.:ebd:101f). Die beiden im Folgenden behandelten Forschungsbeiträge fragen nun empirisch nach, welche Motive die arbeitenden Subjekte dazu trotzdem veranlassen, betriebliche Bewertungsregime zu akzeptieren, in welchen Leistungen allein mit dem Verweis auf Marktzwänge eingefordert werden.
2.3.2. Darstellung der Forschungsbeiträge
2.3.2.1. Fallbeispiel 1
Wolfgang Menz (2005) untersucht das Beispiel eines Unternehmens aus der Elektroindustrie, bei welchem sich die marktorientierte Leistungspolitik in Form eines speziellen Prämienlohnsystems niederschlägt. Dessen Hauptbestandteile stellen die beiden Kriterien Produktivität und Liefertreue dar, welche auf folgende Weise ineinander spielen:
[...]
[1] Ausführlich zur soziologischen und philosophischen Ausleuchtung des Subjektbegriffes: vgl. Daniel 1981
[2] exemplarisch sei hier auf den Marxismus selbst sowie auf alle von diesem inspirierten Denkweisen wie die Ansätze der „Frankfurter Schule“( Horkheimer/Adorno) sowie die „Theorie kommunikativen Handelns“ von Jürgen Habermas verwiesen (vgl. Mikl-Horke 2000: 391ff)
[3] Auf Quellen, welche auf diesen Autor zurückgehen, wird innerhalb dieser Arbeit grundsätzlich mittels Sigel verwiesen.
[4] Die Frage, ob das Denken Foucaults dem Strukturalismus oder dem Poststrukturalismus zuzuordnen sei, wird kontrovers diskutiert (vgl. Weiss 1993:143). Da Foucault sich jedoch selbst wiederholte Male vom Strukturalismus distanzierte (vgl. ÄdW), und m.E. nichts in seinem Denken auf die Annahme unveränderbarer, allen Denken und Handeln übergeordneter Strukturen (etwa im Sinne von Levi-Strauss) hinweiset, ordne ich ihn dem Poststrukturalimus zu.
[5] Vorrang werden die Werke „Überwachen und Strafen“ (ÜuS) und „Der Wille zum Wissen“ (WzW) analysiert.
[6] Eine männliche Schreibform steht in dieser Arbeit stets für beide Geschlechter.
[7] Konkret habe ich die Beträge nach folgenden Kriterien ausgewählt: Repräsentativität des theoretischen Hintergrundes für den jeweiligen Teildiskurs; Repräsentativität der verwendeten Forschungsmethoden, Repräsentativität des Forschungsgegenstandes, Autorenvielfalt. Hin und wieder musste zum Zwecke der Ermöglichung eines kontrastierenden Vergleiches das Kriterium der Repräsentativität dem der Multiperspektivität weichen (vgl. z.B.. 2.4.2.2.).
[8] In besonderem Maße beziehe ich mich auf die beiden starken Integrationsleistungen des foucaultschen Gesamtwerkes von Sven Opitz (2004) und Thomas Lemke (1997).
[9] Vgl. dazu z.B. Mikl-Horke 2000: 445ff
[10] vgl. dazu Ingelhart (1972); Klages (1992)
[11] unter „neuerer arbeitssoziologischer Literatur“ verstehe ich hier Veröffentlichungen, die ab der ersten Auflage des Sammelbandes „Subjektivierung von Arbeit“ von Manfred Moldaschl und Günther G. Voß (2002) erschienen sind. Des Weiteren beschränke ich mich in meiner Aufarbeitung auf den Inhalt der drei Sammelbände unter den Herausgeberschaften von: Moldaschl/Voß (2003); Schönberger/Springer (2003) und der Arbeitsgruppe SubArO (2005). Spreche ich über andere Quellen, so beziehe ich meine Informationen darüber meist ausschließlich ebenfalls von den Inhalten dieser Monographien. Diese Einschränkung erschien mir nötig wie sinnvoll: Einerseits trägt sie dem beschränkten Zeitbudget einer Diplomarbeit Rechnung; andererseits enthält der Sammelband von Moldaschl/Voß( 2003) einen starke systematische Aufarbeitung und Zusammenfassung des dem Erscheinungsdatum vorangegangen Diskurses (vgl. Kleemann u.a. 2003).
[12] Es sei darauf hingewiesen, dass der Diskurs einen sechsten wichtigen Diskussionsstrang aufweist. Dieser beinhaltet Texte, welche sich mit forschungstheoretischen Problemen befassen, d.h. Vorschläge für eine adäquate wissenschaftliche Erfassung des Gegenstandes „Subjektivierung von Arbeit“ unterbreiten (Kleemann u.a. 2003b; Volpert 2003) oder aus marxistischer (Pfeiffer 2003) oder feministischer (Henniger 2003; Aulenbacher 2005) Perspektive Kritik an bestehenden Zugängen üben. Da diese Arbeit gewissermaßen selbst in dieser Absicht steht, also das Ziel verfolgt, auf der Basis der Kritik des Bestehenden einen Zugang zur Thematik vorzuschlagen, erscheint es mir hier jedoch wenig sinnvoll, andere Unternehmungen dieser Art darzustellen und zu bewerten. Dies wäre m.E. ohnehin nur im Rahmen umfassender Theorienvergleiche legitim, was den Rahmen dieser Arbeit sicher sprengen würde.
[13] Da in dieser Arbeit mehrfach das Paradigma des Taylorismus als Gegenstück zur „Subjektivierung von Arbeit“ angeführt ist, scheint es mir an dieser Stelle notwendig, dieses genauer zu spezifizieren: Als „Taylorismus“ bezeichnet man das auf Frederik W. Taylor (1856- 1915) zurückzuführende Konzept des „ Scientific management“. Die wichtigsten Aspekte dieses Paradigmas der „ wissenschaftlichen Betriebsführung“ lassen sich kurz in vier Punkten skizzieren. Neben der oben angeführten vertikalen Spezialisierung (a), also der strikten Trennung von planender und ausführender Arbeit, sind des Weiteren gundlegend: b, horizontale Spezialisierung= Zerlegung des Arbeitsinhaltes in kleinste Arbeitsschritte bis hin zur Reduktion auf einen einzelne Handgriff pro Arbeitsgang; c:materielles Anreizsystem= Lohnerhöhung bei gesteigerter Produktion (welche allerdings nur anteilmäßig den so geschaffenen Mehrwert reflektiert) d: Normierung der Arbeitsobjekte= Standardisierung der Arbeitsgänge und Arbeitszeiten zur Sicherung der Austauschbarkeit der Arbeitskräfte ohne intensive Anlernphasen. Jürgens u.a. (1989) konstatierten in ihrer auf die Automobilindustrie bezogenen Abhandlung zusätzlich diese weiteren Merkmale tayloristischer Arbeitorganisation: unqualifizierte Arbeiterschaft, niedrige Arbeitsmotivation, konflikthafte Arbeitsbeziehungen, hierarchisch organisierte Betriebsführung, feste Arbeitsplatzzuordnung, individuelle Einzelarbeit und externe Kontrolle der Arbeitszeiten und Arbeitsgänge (vgl. Jürgens1989,eigene Übersetzung). Ziel des tayloristischen Arbeitsorganisationskonzeptes ist es, durch derartige Rationalisierungsmaßnamen Produktionsverluste, also die Differenz zwischen dem potentiell möglichen und tatsächlich erreichten Output eines Unternehmens, soweit wie möglich zu minimieren. Der Arbeitsfaktor Mensch gilt als uneingeschränkt austauschbar, seine individuellen Fähigkeiten finden im hoch standardisierten System keinen Platz.
[14] In diesem Zusammenhang taucht bei Holtgrewe (natürlich) auch der Name Foucault auf (vgl.ebd.:24f). Dass der (implizite) Vorwurf der Einseitigkeit dieser Denkweise mir unberechtigt erscheit, sollte spätesten im Abschnitt „Selbst“ klar werden.
[15] Die dritte im Text angeführte Positionierungsweise mit der Bezeichnung „kollektivistischer Aufbruch“ werde ich nicht berücksichtigen, da dort die unmittelbare Ebene des Subjektes verlassen wird.
[16] Folgenden Annmerkung zu diesen etwas tautologisch anmutenden Resümee: Bezeichnenderweise war die Person, welche als illustrierende Fallstudie für den Typus des „aktivistischen Aufbruchs“ diente 44 Jahre alt und hatte ihre berufliche Sozialisation mit hoher Wahrscheinlichkeit noch unter tayloristischen Rahmenbedingungen vollzogen (vgl. ebd. 35). Das Beispiel für den Typus der Selbstflexibilisierung war gerade mal 26 Jahre alt (vgl.ebd:32). Vielleicht wäre die Frage interessant, inwiefern eine posttayloristische beruflich Sozialisation das Subjekt überhaupt dazu befähigen kann, sich eigene Perspektiven der Biographiegestaltung selbständig zu erschließen.
[17] Zum arbeitsoziologischen Begriff von Wissen und Wissensarbeit vgl. Mikl-Horke 2000: 407ff; Brinkmann 2003: 64ff
[18] vgl. dazu auch das Konzept von „Arbeitskraftunternehmer“ von Voß/Pongratz (1998)
[19] Die Autoren weisen darauf hin, dass die Mitarbeiterstruktur von Call-Centern von einen gewissen Sonderfall darstellt: Da die Call-Center-Branche erst von relativ kurzer Zeit (ca. Mitte der 1990iger Jahre) entstand, wurde die Belegschaft oft schon mach Maßstäben rekrutiert, die aus den Ansprüchen der „neuen“ , auf subjektive Leistungen orientierten Arbeitwelt abgeleitet waren (z.b. intrinsische Motivation etc). Es ist also kein Zufall, wenn die Ideologisierungsversuche des Managements hier auf besonders fruchtbaren Boden fallen (vgl.: Kleemann/Matuschek (2003: 131f, 137ff).
[20] Natürlich ist diese Aussage überspitzt: Auch in der tayloristischen Personalführungspraxis kamen (bzw. kommen) Ansätze zum tragen, welche auf die intrinsische Motivation des Beschäftigten abzielen (Human –Relations-Ansatz, Soziotechnik, etc; vgl.: Mikl-Horke 2000: 159ff) Diese waren jedoch nie auf die Einbringung subjektiver Potentials bzw. die Absorption der Subjektivität des Beschäftigten ausgerichtet, sondern verfolgten (abgesehen von den humanistischen Intensionen ihrer Apologeten) eher den Zweck der Minimierung von (Arbeits-) Prozessverlusten (vgl.: Moldaschl 2003b).
[21] Millers Aufsatz „Kalkulierende Subjekt“ (2005) stellt eine Plädoyer für die Etablierung einer, m.E. implizit ansatzweise von Foucault inspirierten, allgemeinen „Soziologie des Accountings“ dar. Um den zweiten Teil dieser Arbeit an dieser stelle nicht zu weit vorzugreifen, beschränke ich mich auf die Darstellung dieses Aspektes.
[22] ECR= efficent consumer response
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783832495756
- ISBN (Paperback)
- 9783838695754
- Dateigröße
- 889 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Chemnitz – Philosophische Fakultät
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- subjekt poststrukturalismus gouvernementalität neoliberalismus arbeitssoziologie
- Produktsicherheit
- Diplom.de