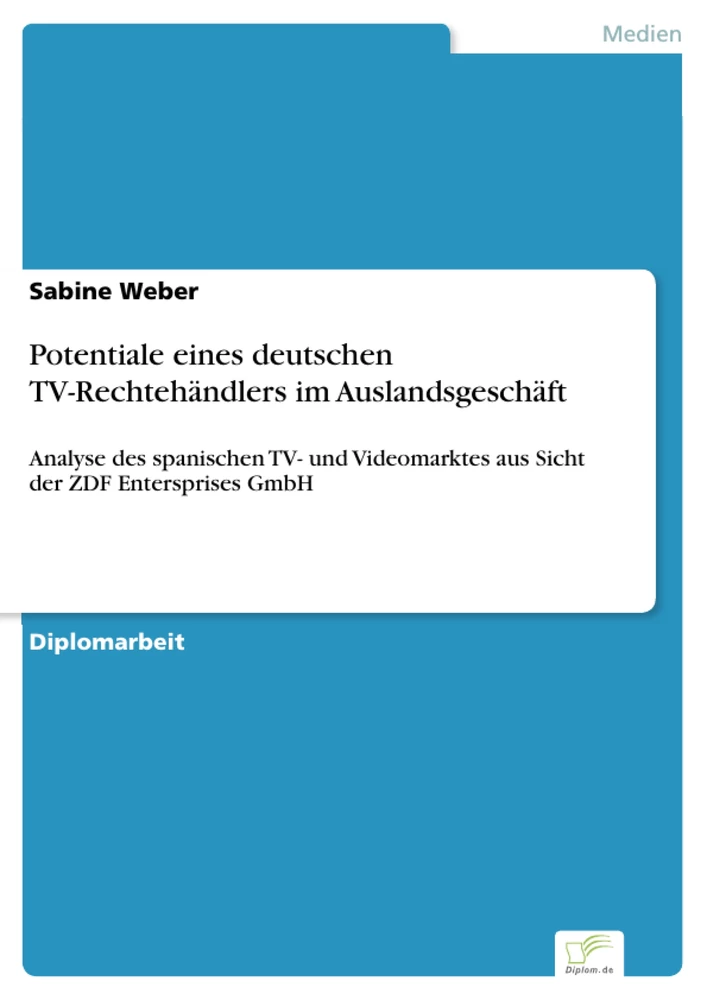Potentiale eines deutschen TV-Rechtehändlers im Auslandsgeschäft
Analyse des spanischen TV- und Videomarktes aus Sicht der ZDF Entersprises GmbH
©2005
Diplomarbeit
147 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
International sehen sich Fernsehprogrammanbieter mit steigenden Kosten und einem zunehmenden Konkurrenzdruck konfrontiert. Das wachsende Angebot an Kanälen, unter anderem durch die Digitalisierung, und die damit verbundende Fragmentierung der einzelnen Fernsehmärkte hinsichtlich Zuschauerquoten und Einnahmen bestimmt länderübergreifend das Marktbild.
Die Möglichkeiten zur Programmverwertung über die intendierte Ausstrahlung hinaus haben daher - auch in Deutschland - als zusätzliche Einnahmequelle eine immer größere Bedeutung. Im Rahmen der Mehrfachverwertung nimmt die Vermarktung von Programmen über deutsche Ländergrenzen hinweg eine wachsende Rolle ein. Der internationale Markt bietet zudem Potentiale im Hinblick auf Programmproduktion bzw. Rechtebeschaffung. In diesen beiden Sektoren des deutschen TV-Rechtehandels ist die vorliegende Arbeit angesiedelt.
Im internationalen TV-Rechtehandel ist es unerlässlich, die Marktstrukturen und aktuellen Entwicklungen anderer Länder zu kennen. Die Hauptmärkte im internationalen Markt, die USA und andere Länder wie Großbritannien und Frankreich, stehen dabei unter besonderer Beobachtung. Darüber hinaus geben jedoch auch andere Länder aufgrund ihres Marktpotentials Grund für nähere Betrachtungen. In diesem Zusammenhang ist wenig über den audiovisuellen Markt Spaniens veröffentlicht worden. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke und beleuchtet den spanischen TV- und Videomarkt aus Sicht eines deutschen Lizenzhändlers, der ZDF Enterprises GmbH.
Konkrete Ziele dieser Arbeit sind es daher, den spanischen Fernseh- und Videomarkt gemäß den Geschäftsaktivitäten eines deutschen TV-Rechtehändlers zu bewerten, die deutsche Position für Geschäftsbeziehungen mit Spanien im TV-Rechtehandel am Beispiel der ZDF Enterprises GmbH aufzuzeigen und Handlungsstrategien für das Unternehmen zu entwickeln.
Um Rückschlüsse über den spanischen Markt treffen zu können, wird eine Marktanalyse durchgeführt, die allerdings von der normalen Form abweicht. Es werden nicht wie üblich der Beschaffungs- und Absatzmarkt sowie darin vorherrschende Konkurrenzsituationen dargestellt. Dies ist aufgrund der Beschaffenheit des internationalen TV-Rechtehandels mit einer Vielzahl von weltweiten Anbietern und einem vielschichtigen Produktangebot nicht möglich. Daher findet detailliert die Analyse des Absatzmarktes, in diesem Fall der Fernseh- und Videomarkt Spaniens, statt. Der Markt wird aus Sicht eines […]
International sehen sich Fernsehprogrammanbieter mit steigenden Kosten und einem zunehmenden Konkurrenzdruck konfrontiert. Das wachsende Angebot an Kanälen, unter anderem durch die Digitalisierung, und die damit verbundende Fragmentierung der einzelnen Fernsehmärkte hinsichtlich Zuschauerquoten und Einnahmen bestimmt länderübergreifend das Marktbild.
Die Möglichkeiten zur Programmverwertung über die intendierte Ausstrahlung hinaus haben daher - auch in Deutschland - als zusätzliche Einnahmequelle eine immer größere Bedeutung. Im Rahmen der Mehrfachverwertung nimmt die Vermarktung von Programmen über deutsche Ländergrenzen hinweg eine wachsende Rolle ein. Der internationale Markt bietet zudem Potentiale im Hinblick auf Programmproduktion bzw. Rechtebeschaffung. In diesen beiden Sektoren des deutschen TV-Rechtehandels ist die vorliegende Arbeit angesiedelt.
Im internationalen TV-Rechtehandel ist es unerlässlich, die Marktstrukturen und aktuellen Entwicklungen anderer Länder zu kennen. Die Hauptmärkte im internationalen Markt, die USA und andere Länder wie Großbritannien und Frankreich, stehen dabei unter besonderer Beobachtung. Darüber hinaus geben jedoch auch andere Länder aufgrund ihres Marktpotentials Grund für nähere Betrachtungen. In diesem Zusammenhang ist wenig über den audiovisuellen Markt Spaniens veröffentlicht worden. Die vorliegende Arbeit schließt diese Lücke und beleuchtet den spanischen TV- und Videomarkt aus Sicht eines deutschen Lizenzhändlers, der ZDF Enterprises GmbH.
Konkrete Ziele dieser Arbeit sind es daher, den spanischen Fernseh- und Videomarkt gemäß den Geschäftsaktivitäten eines deutschen TV-Rechtehändlers zu bewerten, die deutsche Position für Geschäftsbeziehungen mit Spanien im TV-Rechtehandel am Beispiel der ZDF Enterprises GmbH aufzuzeigen und Handlungsstrategien für das Unternehmen zu entwickeln.
Um Rückschlüsse über den spanischen Markt treffen zu können, wird eine Marktanalyse durchgeführt, die allerdings von der normalen Form abweicht. Es werden nicht wie üblich der Beschaffungs- und Absatzmarkt sowie darin vorherrschende Konkurrenzsituationen dargestellt. Dies ist aufgrund der Beschaffenheit des internationalen TV-Rechtehandels mit einer Vielzahl von weltweiten Anbietern und einem vielschichtigen Produktangebot nicht möglich. Daher findet detailliert die Analyse des Absatzmarktes, in diesem Fall der Fernseh- und Videomarkt Spaniens, statt. Der Markt wird aus Sicht eines […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 9565
Weber, Sabine: Potentiale eines deutschen TV-Rechtehändlers im Auslandsgeschäft -
Analyse des spanischen TV- und Videomarktes aus Sicht der ZDF Entersprises GmbH
Druck Diplomica GmbH, Hamburg, 2006
Zugl.: Hochschule der Medien (ehem. Hochschule für Druck und Medien Stuttgart (FH)),
Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2006
Printed in Germany
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... I
Abbildungsverzeichnis...IV
Tabellenverzeichnis ...V
Abkürzungsverzeichnis...VI
Glossar...VIII
1 Einleitung... 1
1.1
Einführung in die Problemstellung ... 1
1.2
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit ... 2
2 Ökonomische und rechtliche Grundlagen der Rechteverwertung
im TV-Markt... 4
2.1
Gesetzlicher Schutz audiovisueller Werke... 4
2.2
Ökonomische Betrachtung audiovisueller Produkte ... 6
2.2.1
Wertschöpfungs- und Verwertungskette ... 6
2.2.2
Rechtemarkt und Rechtehändler ... 8
2.2.3
Ökonomische Besonderheiten ... 9
2.3
Vertragsformen zur Verwertung audiovisueller Produkte ... 11
2.3.1
Verwertung nach Fertigstellung der Produktion ... 11
2.3.1.1
Lizenzvertrag im TV- und Video-Bereich ... 12
2.3.1.2
Lizenz-Pakete ... 13
2.3.2
Verwertungspotentiale vor Fertigstellung der Produktion ... 13
2.3.2.1
Pre-Sale ... 14
2.3.2.2
Kofinanzierung ... 15
2.3.2.3
Koproduktion... 15
2.3.3
Vertriebsmandat... 17
2.3.4
Zusammenfassender Vergleich der Vertragsformen ... 18
3 Marktgesetze des internationalen TV-Rechtehandels ... 19
3.1
Ökonomie der internationalen Rechteverwertung ... 19
3.1.1
Kriterien der internationalen Verwertbarkeit... 19
3.1.1.1
Formal... 19
3.1.1.2
Inhaltlich und dramaturgisch ... 21
3.1.2
Höhe des Preises und der Produktionsbeteiligung ... 22
3.1.3
Märkte des internationalen TV-Rechtehandels ... 23
3.2
Stellung Deutschlands in der TV-Rechteverwertung ... 25
3.3
Marktentwicklungen mit Auswirkung auf den TV-Rechtehandel ... 27
II
3.3.1
Fragmentierung des Marktes ... 27
3.3.2
Konzentrations- und Expansionsprozesse... 28
3.3.3
Programmkosten... 28
3.3.4
Internationale Koproduktionen ... 28
3.3.5
Gehandelte Programminhalte ... 29
3.3.5.1
Globalisierung vs. Nationalisierung... 29
3.3.5.2
Boom bei Dokumentationen... 30
4 Der deutsche TV-Rechtehändler ZDF Enterprises GmbH ... 31
4.1
Aufgaben und Organisation des Unternehmens ... 31
4.2
Marktaktivitäten des Unternehmens zur Rechteverwertung ... 33
4.3
Programm-Portfolio des Unternehmens ... 36
4.4
Position des Unternehmens in der deutschen TV-Rechteverwertung ... 36
5 Analyse des spanischen TV- und Video-Marktes... 38
5.1
Der spanische Fernsehmarkt ... 38
5.1.1
Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen ... 38
5.1.2
Infrastrukturelle Zugangsvoraussetzungen ... 42
5.1.3
Nationales Nutzungsverhalten ... 43
5.1.4
Struktur der Sendelandschaft... 44
5.1.4.1
Frei empfangbares Fernsehen... 47
5.1.4.2
Digitales Fernsehen ... 51
5.1.4.3
Multikanal- und Bezahlfernsehen... 53
5.1.4.4
Ausländisches bzw. transnationales Fernsehen... 55
5.1.4.5
Konzernverbünde im Fernsehmarkt... 56
5.1.5
Zuschauerresonanz ... 57
5.1.5.1
Marktanteile einheimischer Sender... 57
5.1.5.2
Zuschauerprofile einheimischer Sender ... 58
5.1.6
Programminhalte... 59
5.1.6.1
Programmangebot einheimischer Sender ... 59
5.1.6.2
Zuschauerinteressen ... 64
5.1.7
Die spanische Produktionslandschaft ... 67
5.1.7.1
Struktur des Produktionssektors ... 67
5.1.7.2
Charakteristiken spanischer Produktionen ... 70
5.1.8
Die spanische Distributionslandschaft im Fernsehsektor... 72
5.2
Der spanische Videomarkt... 74
5.2.1
Infrastrukturelle Zugangsvoraussetzungen ... 74
5.2.2
Nationales Nutzungsverhalten ... 74
5.2.3
Struktur des Videomarktes... 75
5.2.3.1
Verkaufs- und Verleihstätten... 78
5.2.3.2
Video-Distributoren ... 80
5.2.4
Programminhalte... 81
III
6 Auslandsbeziehungen im spanischen TV- und Videomarkt ... 83
6.1
Import audiovisueller Programme Spaniens ... 83
6.1.1
Herkunft der Importe ... 83
6.1.1.1
Fernsehmarkt... 83
6.1.1.2
Videomarkt... 88
6.1.2
Preise der Importe... 89
6.1.2.1
Fernsehmarkt... 89
6.1.2.2
Videomarkt... 90
6.2
Internationale Koproduktionen Spaniens ... 90
7 Beurteilung der spanischen Marktverhältnisse aus Sicht eines
deutschen TV-Rechtehändlers am Beispiel der ZDF Enterprises
GmbH ... 92
7.1
Generelle Marktcharakteristika ... 92
7.2
Produktions- und Distributionssektor ... 94
7.3
Programminhalte und -beschaffung ... 96
7.4
Betätigungsfelder für die ZDF Enterprises GmbH... 98
7.4.1
Lizenzvergabe... 99
7.4.2
Internationale Koproduktionen ... 101
8 Schlussbemerkung ... 102
Literaturverzeichnis ...A
Anhang...H
IV
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Audiovisuelle Wertschöpfungskette mit Zwischenhändlern...6
Abbildung 2: Audiovisuelle Verwertungskette...7
Abbildung 3: Anzahl ausgeführter deutscher Filme, in Stunden...26
Abbildung 4. Organisationsstruktur der ZDF Enterprises GmbH...32
Abbildung 5: Tägliche Fernsehdauer der Zuschauer Europas 2004 ...43
Abbildung 6: Eigentümerstruktur von Sogecable...52
Abbildung 7: Programmstruktur spanischer Fernsehsender nach Programmgenre ...59
Abbildung 8: Zuschauerverteilung nach Programmgenre und Programmstruktur der
Sender ...66
Abbildung 9: Verteilung der Umsätze im Produktionssektor nach Autonomen Regionen 68
Abbildung 10: Entwicklung der Einzelhandelsgesamtumsätze von VHS/DVD...77
Abbildung 11: Entwicklung der Umsätze der Videodistributoren ...77
Abbildung 12: Herkunft ausgestrahlter ausländischer Fiktion im Free-TV...84
Abbildung 13: Herkunft ausgestrahlter ausländischer Fiktionsprogramme von TVE1,
TVE2, Antena 3, Telecinco, ohne USA ...T
Abbildung 14: Ausgestrahlte US-amerikanische Fiktionsprogramme von TVE1, TVE2,
Antena 3, Telecinco ... U
V
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vergleich der Vertragsformen im TV-Rechtehandel ...18
Tabelle 2: Preise für einen Fernsehfilm in den USA, Frankreich und Deutschland...22
Tabelle 3: Preise für eine einstündige Dokumentation in den USA, Frankreich und
Deutschland...22
Tabelle 4: Firmenbeteiligungen der ZDF Enterprises GmbH...33
Tabelle 5: Übersicht der spanischen TV-Landschaft ...46
Tabelle 6: Werbeeinnahmen und Betriebseinnahmen der Free-TV-Sender ...49
Tabelle 7: Übersicht zu den Hauptakteuren des Fernsehmarktes...56
Tabelle 8: Ganztägige prozentuale Marktanteile der spanischen Sender ...57
Tabelle 9: Die wichtigsten spanischen Produktionsfirmen im Fernsehbereich...68
Tabelle 10: Anzahl der Videoverkaufsstellen und Videotheken in Spanien und
Deutschland...79
Tabelle 11: Die größten spanischen Videoverlags- und vertriebsunternehmen ...80
Tabelle 12: Programmeinstufung im Videomarkt nach Altersklassen ...81
Tabelle 13: Herkunft importierter Fiktion der einzelnen Free-TV-Sender ...85
Tabelle 14: Programmimporte spanischer Fernsehsender...86
Tabelle 15: Lizenzerlöse von Programmexporten Deutschlands nach Spanien ...87
Tabelle 16: Vorhandene Filme und audiovisuelle Werke im spanischen Videomarkt
nach Nationalität ...88
Tabelle 17: Programmpreise in Spanien für Fiktion...89
Tabelle 18: Programmpreise in Spanien für Dokumentationen ...89
Tabelle 19: Geeignete Dokumentationssendeplätze für Programme der ZDF
Enterprises GmbH ...100
Tabelle 20: Auflistung spanischer Fernsehkanäle und ihre Charakterisierung...M
Tabelle 21: Dokumentationssendeplätze im spanischen Fernsehen ... Q
Tabelle 22: Die wichtigsten DVD-Distributoren in Spanien... S
Tabelle 23: Programmgestaltung von Cuatro nach Programmgenre ... V
Tabelle 24: Auszüge aus dem internationalen Programm-Portfolio der ZDF Enterprises
GmbH ... X
Tabelle 25: Übersicht wichtiger internationaler Film- und Fernsehmessen ... Y
VI
Abkürzungsverzeichnis
a
Jahr
AIMC
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(Verband für Medienforschung)
AV
Video
CITV
Compañía Independiente de Televisión
(unabhängiges Fernsehunternehmen, Produktionsfirma mit Spartenkanälen)
COPE
Cadena de Ondas Populares Españolas
(Kette der spanischen Volkswellen)
CDA
Centre de Desenvolupament Audiovisual
(katalanisch, Zentrum für audiovisuelle Entwicklung)
CMT
Castilia La Mancha Televisión
(Fernsehen von Kastillien-La Mancha)
DTT
Digitales terrestrisches Fernsehen
ebd ebenda
EGM
Estudio General de Medios
(Allgemeine Medienstudie)
ETA
Euskadi ta Askatasuna
(baskisch, Baskenland und Freiheit)
ETB
Euskal Telebista
(baskisch, Baskisches Fernsehen)
FAP
Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual
(Verband zum Schutz geistigen Eigentums)
FAPAE
Federación de Asociaciones Productores Audiovisuales Españoles
(spanischer Produzentenverband)
FORTA
Federación de la Radio y Televisión Autonómica
(Föderation des Radios und Fernsehens der Autonomen Regionen)
h Stunden
HD
High Definition
(hoch auflösender audiovisueller Formatstandard)
IB3
Illes Baleares 3
(katalanisch, Fernsehen von den Balearischen Inseln)
INE
Instituto Nacional de Estadística
(Nationales Statistikinstitut Spaniens, ähnlich Statistischem Bundesamt)
MCU
Ministerio de Cultura
(Kulturministerium)
N.N.
Not Nominated (nicht benannter Verfasser)
PRISA
Promotora de Medios S.A.
(AG zur Medienförderung)
VII
RTVE
Radio Televisión Española
(Spanisches Radio und Fernsehen)
SEPI
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(Staatliche Gesellschaft industrieller Beteiligungen)
SER
Sociedad Española de Radiodifusión
(Spanische Gesellschaft zur Radioverbreitung)
SGAE
Sociedad General de Autores y Editores
(Allgemeine Autoren- und Verlegergesellschaft)
TBI
Television Business International
Fachzeitschrift zum Internationalen Fernsehgeschäft
TV
Fernsehen
TVC
Televisión Canarias
(Fernsehen der Kanarischen Inseln)
TVE
Televisión Española
(Spanisches Fernsehen)
TVG
Televisión Galicia
(Fernsehen von Galizien)
VIII
Glossar
Auftragsproduktion Produktion einer Produktionsfirma für einen Fernsehsender, der alle
Herstellungskosten trägt und dafür alle Rechte erhält
Autonómicas
Fernsehsender der Autonomen Regionen Spaniens
Blockbuster
Großer Kinohit bzw. sehr erfolgreicher Film
Bouquet
Angebot mehrerer Themenkanäle durch einen Anbieter oder Dienst
Event-Programm
Aufwendig, teuer produziertes Programm, das dadurch zu einem
Fernseherlebnis werden soll
Fiktion
Szenische, nicht-reale Produktionsarten, z.B. Serien, Filme
Free-TV Frei
empfangbares
Fernsehen
Holdback
Zeitraum, in dem ein Programm einem Lizenznehmer exklusiv zur
Verfügung steht und daher für den Markt gesperrt ist
Licensing
Lizenzierung von Programminhalten, -marken und -charakteren zur
Nutzung bei der Herstellung anderer Produkte; Im Deutschen meist
äquivalent mit dem Begriff Merchandising verwendet.
Majors
Große, einflussreiche US-amerikanische Produktionsstudios
Marktanteil
Verhältnis der Zuschaueranzahl, die zu einem bestimmten Zeitpunkt
eine Sendung sehen, zur Gesamtzahl der Zuschauer, die zu diesem
Zeitpunkt fernsehen
Merchandising
Marketingstrategie zur Vermarktung von Programminhalten über Be-
gleitprodukte; Im Deutschen meist äquivalent mit dem Begriff Licen-
sing verwendet.
Non-Fiktion
Reale Produktionsgenres, z.B. Dokumentationen
Off-Ton
Stimme eines Sprechers, der sich außerhalb des Bildes befindet
On-Ton
Stimme eines Sprechers, der sich im Bild befindet
Overspill
Nicht zu verhindernde Überschreitung der Ländergrenzen durch dar-
über hinausgehende Senderreichweiten
Pay-TV Bezahlfernsehen
Primetime
Fernsehzeit mit dem höchsten Zuschaueraufkommen
Production Value Gestalterische Qualität und finanzieller Hindergrund eines Filmes
bzw. eines Programms
Re-enactment
Szenisches Nachspielen realer Ereignisse
Slot Sendeplatz
Split-Screen Geteilter
Fernseh-Bildschirm
mit jeweils unterschiedlichen Inhalten
Syndication-Markt In den USA Programmbeschaffung aus verbundsfremden Firmen,
unabhängigen Distributoren, im weiteren Sinn aus Verwertersicht die
Produktvermarktung in Zweit- und Drittmärkten im Heimatmarkt
Voice-Over
Eingesprochene Übersetzung, häufig bei Dokumentationen als Über-
setzung von Interviews genutzt
1
1 Einleitung
1.1 Einführung in die Problemstellung
International sehen sich Fernsehprogrammanbieter mit steigenden Kosten und einem
zunehmenden Konkurrenzdruck konfrontiert. Das wachsende Angebot an Kanälen, unter
anderem durch die Digitalisierung, und die damit verbundene Fragmentierung der einzel-
nen Fernsehmärkte hinsichtlich Zuschauerquoten und Einnahmen bestimmen länder-
übergreifend das Marktbild.
Die Möglichkeiten zur Programmverwertung über die intendierte Ausstrahlung hinaus
haben daher - auch in Deutschland - als zusätzliche Einnahmequelle eine immer größere
Bedeutung. Im Rahmen der Mehrfachverwertung nimmt die Vermarktung von
Programmen über deutsche Ländergrenzen hinweg eine wachsende Rolle ein. Der inter-
nationale Markt bietet zudem Potentiale im Hinblick auf Programmproduktion bzw.
Rechtebeschaffung. In diesen beiden Sektoren des deutschen TV-Rechtehandels ist die
vorliegende Arbeit angesiedelt.
Eine statistische Erhebung zur Ausfuhr von deutschen Fernsehprogrammen gibt es nicht.
Allerdings ist für Lizenzerlöse durch den Export von audiovisuellen Werken aus Deutsch-
land feststellbar, dass sie von 1997 bis 2004 um 128 Prozent stiegen.
1
Hierbei ist
zwischen der Ausfuhr deutscher und nicht-deutscher Filme zu unterscheiden.
2
Die
Lizenzerlöse für deutsche Filme stiegen um 65 Prozent. Von einem Anstieg ist auch im
Teilmarkt des Fernsehsektors auszugehen. Diese Einschätzung wird durch eine
Branchenmeinung gestützt, nach der sich ,,deutsche Fernsehfilme im Ausland
erfahrungsgemäß besser als deutsche Kinofilme verkaufen."
3
Im deutschen Fernsehsektor gibt es mittlerweile Firmen, die im internationalen Markt
präsent sind, deutsche TV-Programme ins Ausland vermarkten und an länder-
übergreifenden Produktionen beteiligt sind. Die in dieser Arbeit betrachtete Firma ist die
ZDF Enterprises GmbH mit Sitz in Mainz.
1
Eigene Berechnung, Vgl. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Filmstatistik 1997 bis 2004, Online
http://www.bafa.de, Zugriff 06.10.2005
In der Statistik sind prinzipiell alle audiovisuellen Werke mit einer Länge von über 45 Minuten erfasst.
Laut dem Bundesamt sind im speziellen ,,meldepflichtige Lizenzentgelte aus Verträgen mit Gebietsfremden für die Ver-
gabe und den Erwerb von Vorführungs-, Video- und Senderechten an Spiel-, Kinder- und Jugendfilmen mit einer Ab-
spieldauer von mindestens 45 Minuten" enthalten. ,,Gemeint sind damit die Kinorechte, Videorechte (AV) und Fern-
sehrechte (TV)." Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Filmstatistik 2004, S. 3. Online http://www.bafa.de
2
Die Definition für deutsche Filme erfolgt durch Kriterien der Filmförderungsanstalt. Für die Einordnung eines Filmes als
deutsch muss unter anderem der Produzent seinen Sitz in Deutschland haben und die Mehrzahl bzw. Hauptakteure der
Filmschaffenden deutsch sein. Die genauen Bestimmungen richten sich nach dem Filmförderungsgesetz. Vgl. Gesetz
über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films vom 22.12.2003, § 15 Abs. 2 und 3, § 16 und § 16a,
http://www.ffa.de
3
Satzstellung des Zitates geändert.
Gangloff, Von Leuchtturm bis Abklatsch. 20. Mipcom in Cannes (2): Filme und Formate; In: epd Medien 16.10.2004, S. 5
2
Als Akteur im internationalen TV-Rechtehandel ist es unerlässlich, die Marktstrukturen
und aktuellen Entwicklungen anderer Länder zu kennen. Die Hauptmärkte im inter-
nationalen Markt, die USA und andere Länder wie Großbritannien und Frankreich, stehen
dabei unter besonderer Beobachtung. Über den audiovisuellen Markt dieser Länder und
dessen Auslandsbeziehungen wurde auch im wissenschaftlichen Bereich bereits einiges
publiziert.
4
Darüber hinaus geben jedoch auch andere Länder aufgrund ihres Marktpotentials Grund
für nähere Betrachtungen. In diesem Zusammenhang ist wenig über den audiovisuellen
Markt Spaniens veröffentlicht worden. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen.
Ausgehend von den Marktaktivitäten eines deutschen Weltvertriebs wie der ZDF Enter-
prises GmbH sollen der spanische TV- und Videomarkt beleuchtet werden.
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Arbeit ist es, den spanischen Fernseh- und Videomarkt gemäß den Geschäfts-
aktivitäten eines deutschen TV-Rechtehändlers zu bewerten, die deutsche Position für
Geschäftsbeziehungen mit Spanien im TV-Rechtehandel am Beispiel der ZDF Enterprises
GmbH aufzuzeigen und Handlungsstrategien für das Unternehmen zu entwickeln.
Um Rückschlüsse über den spanischen Markt treffen zu können, wird eine Marktanalyse
durchgeführt, die allerdings von der normalen Form abweicht. Es werden nicht wie üblich
der Beschaffungs- und Absatzmarkt sowie darin vorherrschende Konkurrenzsituationen
dargestellt. Dies ist aufgrund der Beschaffenheit des internationalen TV-Rechtehandels
mit einer Vielzahl von weltweiten Anbietern und einem vielschichtigen Produktangebot
nicht möglich. Daher findet detailliert die Analyse des Absatzmarktes, in diesem Fall der
Fernseh- und Videomarkt Spaniens, statt. Der Markt wird aus Sicht eines Rechteanbie-
ters, der ZDF Enterprises GmbH, betrachtet. Darüber hinaus fließen Grundprinzipien des
internationalen TV-Rechtehandels in die Bewertung des spanischen Marktes ein. Die
Chancen im internationalen TV-Rechtehandel hängen sehr stark von den Eigenschaften
des angebotenen Produktes, den audiovisuellen Werken, sowie der territorialen Herkunft
und der individuellen Marktposition der Rechteanbieter ab.
Aus diesem Grund werden zuerst die ökonomischen und rechtlichen Grundlagen beim
Handel mit audiovisuellen Werken beleucht und Handlungsmöglichkeiten eines deutschen
TV-Rechtehändlers anhand von gängigen Vertragsformen dargestellt. Im folgenden wer-
den generelle Marktgesetze des internationalen TV-Rechtehandels aus deutscher Sicht
erklärt. Das Kapitel dient der späteren Vergleichbarkeit spanischer Marktverhältnisse mit
denen anderer Länder. Die anschließende Erläuterung zu dem deutschen TV-
Rechtehändler ZDF Enterprises GmbH ist Grundlage für Geschäftsstrategien der Firma
im Hinblick auf Importe nach Spanien und internationale Koproduktionen mit Spanien.
4
Beispielsweise dreht sich das Buch ,,Fernsehen in Europa. Strukturen, Programme und Hintergründe", herausgegeben von
Victor Henle 1998, u.a. um Frankreich und Großbritannien.
3
Hauptteil der Arbeit ist die Analyse des spanischen Fernseh- und Videomarktes ein-
schließlich der spanischen Geschäftsbeziehungen mit dem Ausland in den beiden
Märkten. Die Bewertung zu den Handlungsmöglichkeiten der ZDF Enterprises GmbH wird
auf Basis der nationalen und internationalen Marktbedingungen Spaniens getroffen.
Geschäftsmöglichkeiten mit Spanien im Vertrieb und bei internationalen Koproduktionen
werden für die ZDF Enterprises GmbH herausgearbeitet.
Branchenspezifische Begriffe werden weitgehend im Text erläutert oder sind im Glossar
zu Beginn der Arbeit enthalten. Einige Rückschlüsse wurden durch Verträge der ZDF
Enterprises GmbH getroffen. Einzelheiten zu Vertragsdaten und verhandelten Preisen
können jedoch aufgrund von Absprachen mit der ZDF Enterprises GmbH innerhalb dieser
Arbeit nicht veröffentlicht werden.
Da der audiovisuelle Rechtehandel von den sich häufig ändernden Programm-
bedürfnissen der Sender und anderer Distributoren bestimmt wird, wurde in der Arbeit
Wert darauf gelegt, möglichst aktuelle Zahlen über Marktverhältnisse zu verwenden oder
durch zusätzliche eigene Recherchen zu überprüfen bzw. zu aktualisieren.
In diesem Zusammenhang soll auf die unzureichende Datenlage sowie Intransparenz im
internationalen Programmhandel und bei länderübergreifenden Produktionskooperationen
hingewiesen werden. Sie stellen ein großes Problem bei der wissenschaftlichen Er-
forschung der Branche dar. Zudem bestehen Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit
international erfasster Daten durch Definitionsdiskrepanzen zwischen den unterschied-
lichen Ländern.
5
Außerdem existiert kaum Fachliteratur zur internationalen Verwertung
von TV-Rechten. Aus Kostengründen musste auch nach Kontaktaufnahme mit den
herausgebenden Unternehmen auf einige international angelegte Studien verzichtet wer-
den. Dennoch ist es in der Arbeit durch Kooperation mit anderen Unternehmen gelungen,
einige fachspezifische Publikationen unentgeltlich einzubinden. Viele Quellen der
vorliegenden Arbeit sind Veröffentlichungen international operierender Forschungsunter-
nehmen und anerkannter spanischer Organisationen. Die Materialen lagen in deutscher,
englischer, spanischer oder katalanischer Sprache vor. Durch den hohen Fremdsprachen-
Anteil wurde weitgehend auf wörtliche Zitate verzichtet.
Wird von der Autorin ohne weitere namentliche Spezifizierung gesprochen, so ist damit
die Verfasserin der vorliegenden Arbeit gemeint. Außerdem wurde zur besseren Lesbar-
keit auf die ausführliche Unternehmensbezeichnung der ZDF Enterprises GmbH teilweise
verzichtet. Die Kurzfassung ZDF Enterprises ist mit der ausführlichen Schreibweise
gleichzusetzen.
5
Vgl. European Audiovisual Observatory 2003, Yearbook 2003, Band 1, S. 20: Methodisches Vorgehen bei der Wirtschafts-
und Finanzanalyse des audiovisuellen Sektors in Europa oder European Audiovisual Observatory, Yearbook 2003, Band
5, S. 110: Methodik Fernsehprogrammproduktion
4
2 Ökonomische und rechtliche Grundlagen der Rechte-
verwertung im TV-Markt
Ziel dieses Kapitels ist es, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen audio-
visueller Produkte zu klären. Das Kapitel hat Überblickscharakter. Beleuchtet werden
Grundlagen des Rechtehandels und seine Aktivitäten in Form von gängigen Verträgen.
Die Erläuterungen zur Besonderheit des Wirtschaftsgutes ,,Film" und seiner ökono-
mischen Verwertbarkeit sind Bestandteil dieser Arbeit, um die Rahmenbedingungen für
einen Rechtehändler zu verstehen. Diese sind die Basis zu den Marktaktivitäten der ZDF
Enterprises GmbH.
Es wird häufig generell von audiovisuellen Produkten gesprochen, da die Ausführungen
meist nicht nur auf den TV-Bereich zutreffen. Gelten bei TV-Produktionen spezielle
Bedingungen werden diese explizit aufgeführt.
2.1 Gesetzlicher Schutz audiovisueller Werke
Grundlage der Verwertbarkeit von audiovisuellen Produkten liegt in dem rechtlichen
Schutz des audiovisuellen Produktes, ähnlich wie bei anderen wirtschaftlichen Produkten
bzw. Neuerfindungen auch.
In der Herstellung eines audiovisuellen Gutes werden kreative Leistungen eingesetzt, um
ein fertiges ,,Produkt" zu erhalten.
6
Jeder kreativ Beteiligte in einer Filmproduktion besitzt
Urheberrechte an den schöpferischen Tätigkeiten, die er in das Werk eingebracht hat.
Organisatorisch Mitwirkende an einer Filmproduktion besitzen keine Urheber-, sondern
Leistungsschutzrechte, die mit der Zahlung eines Honorars abgegolten sind.
Die Kreativleistungen sind immaterielle Leistungen, die gesetzlich durch das Urheberrecht
geschützt sind. Dieser Schutz greift bereits bei der Entwicklung eines Filmes, sobald eine
Idee, meist in Form eines Exposés, ausformuliert wurde.
7
Auf detaillierte Voraus-
setzungen und andere Regelungen des Urheberschutzes soll hier jedoch nicht tiefer ein-
gegangen werden.
Entscheidend für die Betrachtungen der Arbeit ist, dass ein Urheber seine Kreativ-
leistungen verkaufen kann. Nach deutschen Recht bleibt die natürliche Person immer
Urheber seiner Werke. Es können jedoch Nutzungsrechte für das Werk eingeräumt wer-
den. Diese Rechteübertragbarkeit stellt den entscheidenden Wert eines Filmes dar, der
über die Verwertungskette der Filmwirtschaft ökonomisch nutzbar gemacht wird.
8
Von der
ökonomischen Güterlehre her wird ein audiovisuelles Filmwerk daher als ein immaterielles
6
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen Beispiele, 2003, S. 8
7
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 23
8
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen - Beispiele, 2003, S. 9
5
Gut bezeichnet, an das Rechte und Lizenzen geknüpft sind, die ,,gegen Entgelt übertrag-
bar sind."
9
Neben den Urheberrechten ist bei der Herstellung eines Filmes das Recht am
Bild-/Tonträger selbst involviert. Es ist ein materielles Recht, das an das Filmmaterial
10
gekoppelt ist. Nach dem Gesetz erwirbt der ,,Filmhersteller" dieses Recht. Dieser ist in der
Praxis oft mit der Produktionsfirma bzw. dem Produzenten gleichzusetzen. Dem Film-
hersteller kommt damit eine Sonderrolle zu, denn er ist laut Rechtsprechung nicht
schöpferisch tätig und hat demnach auch keine Urheberrechte inne. Er hat jedoch wirt-
schaftliches Interesse am Film und erhält daher Rechte am Filmmaterial.
11
Indem er den
Träger des audiovisuellen Produktes besitzt, kann das Werk aus verschiedenen Kreativ-
leistungen erst als Ganzes verwertet werden.
Materielles Recht und immaterielle Rechte an einem audiovisuellen Gut können offen-
sichtlich nur gemeinsam ökonomisch nutzbar gemacht werden. Daher muss sich der
Filmhersteller die Nutzungsrechte der Urheber sichern. Erworben werden die Rechte über
vertragliche Abmachungen. Diese Verträge sind oft sehr lang, da jedes Nutzungsrecht
explizit aufgeführt werden muss (vgl. Näheres zu den Verträgen, Kapitel 2.3). Nur die
Rechte werden eingeräumt, die ausdrücklich genannt sind. Daher werden häufig in der
Rechteübertragung neben Rechten an der intendierten Auswertungsform, auch andere,
später denkbare Nutzungsrechte erworben.
12
Rein rechtlich können auch nur Ver-
wertungen zugesichert werden, die bis dato bekannt sind. In der Praxis entstehen da-
durch Grauzonen (z.B. aktuelles Beispiel ist die interaktive Verwertung), die dennoch ver-
traglich mit aufgenommen werden, auch wenn das Gesetz sie noch nicht ,,kennt".
13
Die
Rechteübertragung zwischen Urhebern und Filmhersteller ist der Anfang einer Kette, in
der die Rechte bzw. Teile der Nutzungsrechte zur wirtschaftlichen Verwertung an Sender,
Distributoren oder Rechtehändler wie ZDF Enterprises weitergegeben werden. Die Rech-
te bzw. deren Übertragbarkeit stellen damit die Grundlage des Rechtehandels dar, denn
,,nur wer diese Rechte besitzt, kann mit der Ware Film handeln."
14
Obgleich Grundlage des Rechtehandels ist die Vielzahl von involvierten Rechten im Rech-
tehandel zeitgleich zum Teil eine Schwierigkeit. Theoretisch muss für jedes, zu vermark-
tende Filmwerk genauestens geklärt werden, ob alle Rechte für den beabsichtigten Ver-
wendungszweck (verschiedene Formen der Nutzung, z.B. konkret die Fernsehaus-
strahlung in Deutschland) von dem Vertragspartner erworben wurden. Bei unberechtigter
Nutzung muss bei Anklage mit Nachzahlungen, zum Teil mit Schadensersatzzahlungen
gerechnet werden.
9
Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 129
10
Vgl. Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 179
11
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 164
12
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 161
13
Eine weiterführende Publikation zu Gesetzesänderungen im Urheberrecht wegen technologischen Neuerungen ist zum
Beispiel das Buch "Neue Nutzungsarten im Urheberrecht" von Stefan Drewes.
14
Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen - Beispiele, 2003, S. 9
6
2.2 Ökonomische Betrachtung audiovisueller Produkte
Wie im vorangegangenen Kapitel verdeutlicht, sind audiovisuelle Werke nach betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten immaterielle Güter, mit denen Gewinn erzielt werden
soll. Die Besonderheit eines immateriellen Gutes ist, dass es seinen wirtschaftlichen Wert
erst durch die Nachfrage erhält, denn die eingesetzten Kreativleistungen sind unabhängig
voneinander noch kein marktfähiges Produkt.
15
Eggers bezeichnet die Fertigstellung eines
Filmes daher als Betriebsleistung, aber erst durch die Anpreisung des Produktes Film am
Markt erreicht es seine Marktleistung
16
, die sich aus den Umsatzerlösen ergibt. Dieser
Punkt ist die Existenzgrundlage eines Rechtehändlers.
Diese Wertschöpfung des audiovisuellen Gutes lässt sich gut in der Wertschöpfungskette
veranschaulichen. Das komplexe System der Filmproduktion - mit besonderem Blick auf
die Fernsehproduktion - und die Position des Rechtehändlers wird dadurch deutlich.
Anschließend werden wirtschaftliche Besonderheiten des audiovisuellen Gutes auf-
gezeigt, die Einflüsse auf die internationale Vermarktung haben. Das Kapitel dient zudem
der Klärung von Begriffen, die für den TV-Rechtehandel unerlässlich sind.
2.2.1 Wertschöpfungs- und Verwertungskette
Anhand folgender Grafik sollen Wertschöpfungs- und Verwertungskette erklärt werden.
Abbildung 1: Audiovisuelle Wertschöpfungskette mit Zwischenhändlern
17
15
Vgl. Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 172
16
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen - Beispiele, 2003, S. 17
17
In Anlehnung an Hofmann, Schmidt 2002, Wertschöpfungskette Kinderfernsehen, S. 2, Online http://www.br-
online.de/jugend/izi/text/hofmann-schmid15_2.htm, 08.09.2005
Werbekunden
Kino
Inflight
Entertainment
Home Entertainment
(VHS/DVD)
Pay-TV
Internet
Free-TV
Heimatmarkt
Ausländischer Markt
Werbezeitenvermarkter
Merchandising-Agenturen
Idee / Autoren
Produzenten
Verlage
Distributoren
7
Am Anfang der Wertschöpfungskette stehen die Ideen zur Entstehung eines audio-
visuellen Werkes.
Die darauf folgende Stufe in der Wertschöpfungskette sind die Produzenten, bei denen
die schöpferische Kreativität und weitere Produktionsfaktoren zusammenlaufen und die
Idee in einer Filmproduktion realisiert wird. In einigen Fällen geht erste und zweite Stufe
der Wertschöpfung ineinander über. Dies ist besonders im Dokumentarfilm-Sektor keine
Seltenheit, wo geistiger Schöpfer und Produzent oft dieselbe Person sind.
18
Auf der Stufe
der Produzenten wird sendefähiges Material erstellt, das in der nächsten Stufe zur Aus-
strahlung des audiovisuellen Produktes dient.
Mit der Ausstrahlung beginnt die Verwertung des Produktes. Bei einer TV-Produktion wird
dies üblicherweise die Ausstrahlung im Fernsehen sein. Allerdings muss dies nicht der
Fall sein.
19
Außerdem sind andere Verwertungsformen für den Auslandsvertrieb von Be-
deutung. Daher wird im folgenden die gesamte Kette der Verwertung in einem Markt (z.B.
Heimatmarkt) vorgestellt, die ein Produkt in der Filmwirtschaft durchlaufen kann.
20
Abbildung 2: Audiovisuelle Verwertungskette
21
Inflight Entertainment ist die audiovisuelle Vorführung auf Flügen, Home Entertainment ist
der Videoverkauf und -verleih, TV-Merchandising bezeichnet die Fersehausstrahlung.
Dabei kommt in der Kette zuerst das Bezahlfernsehen bzw. Pay-TV, dann das frei
empfangbare Fernsehen bzw. Free-TV. Pay-TV wird kodiert ausgestrahlt und ist nur
Abonnenten zugänglich. Es finanziert sich vorrangig über Abonnementgebühren. Free-TV
ist frei empfangbar und finanziert sich über Werbung oder gesetzliche Gebühren bzw.
staatliche Zuschüsse. Damit ein Film auf jeder Stufe maximal ausgewertet kann, gilt eine
zeitliche Sperrfrist (auch hold back genannt), vor deren Ablauf der Film nicht in die nächst-
folgende Verwertungsstufe eintreten darf.
22
Die TV-Produktionen überspringen meist die ersten Verwertungsstufen bis hin zur Fern-
sehausstrahlung und durchlaufen danach gegebenenfalls Verwertungsstufen wie Home
Entertainment und Internet.
Verwertungsmöglichkeiten einer Produktion, die über die ursprünglich intendierte Auswer-
tung hinaus gehen (z.B. Ausstrahlung eines Kinofilmes im Kino, Ausstrahlung eines TV-
18
Vgl. Hachmeister; Lingemann, Die Ökonomie des Dokumentarfilms; In: Dokumentarisches Fernsehen, 2003, S. 20
19
Ausnahmebeispiele sind ,,Stadtgespräch" mit Katja Riemann und ,,Late Show" von Helmut Dietl. Vgl. Jacobshagen, Film-
recht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 47
20
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen - Beispiele, 2003, S. 19
21
Vgl. Ernst & Young, Die Filmbranche in schwierigen Zeiten, 2003, S.1, Online
http://www.ey.com/global/download.nsf/Germany/ Studie_FilmTVBranche_10_2003.pdf, Zugriff 08.09.2005
22
Durchschnittlich gelten dabei folgende Richtlinien: Etwa zeitgleich mit der Kinoauswertung beginnt die Inflight-
Auswertung, Videoverleih drei Monate nach Kinostart, Videoverkauf sechs Monate nach Kinostart, Pay-TV 12 bis 18
Monate nach Kinostart, Free-TV zwei Jahre nach Kinostart. Vgl. Ernst & Young, Die Filmbranche in schwierigen Zeiten,
2003, S.1 und Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen - Beispiele, 2003, S. 19
Kino
Inflight
Entertainment
Home Entertainment
(VHS/DVD)
TV Merchandising
Internet
8
Filmes im Pay-TV), werden als Zweit- und Drittverwertung bezeichnet. Darunter fällt auch
das Merchandising bzw. Licensing.
23
Schematisch ist nach Meinung der Autorin im
Bereich der Zweit- und Drittverwertung gut der Auslandsvertrieb anzusiedeln. Er schließt
sich bei ausgewählten audiovisuellen Produkten meist zeitlich verschoben an die Verwer-
tung im Heimatmarkt an. Bei der Auswertung von TV-Produktionen im Ausland sind alle
Verwertungsstufen, abgesehen von der Kino-Auswertung gängig. Es ist nicht unüblich,
dass deutsche TV-Produktionen aus dem Free-TV an einen ausländischen Video-
Vertrieb, einen Pay- oder Free-TV-Sender direkt vertrieben werden.
24
Zwischen den genannten Stufen der Wertschöpfungs- und Verwertungskette haben sich
mit zunehmender Spezialisierung des Mediensektors Unternehmen angesiedelt, die ,,als
Zwischenhändler oder Dienstleister einen reibungslosen Übergang in der Wert-
schöpfungskette sichern."
25
Sie vermitteln zwischen vor- und nachgelagerter Wert-
schöpfungsstufe bzw. bringen diese effizient zusammen. An der Schnittstelle zwischen
Autoren und Produzenten können daher Verlage arbeiten, zwischen Produzenten und
Sender Distributoren und zwischen Sender und Werbe- sowie Lizenzmarkt Werbezeiten-
vermarkter oder Merchandising-Agenturen.
26
Zudem komplex ist das System, da durch die vertikale Integration der Unternehmen die
Verflechtungen in der Branche immer mehr zunehmen. Die vertikale Integration bezeich-
net die Präsenz eines Unternehmens in mehreren Stufen der Wertschöpfung, um Syner-
gieeffekte zu nutzen.
27
Ein Unternehmen kann zum Beispiel als Produzent, Sender und
Verleiher auftreten. Andere Querverbindungen sind in der Branche üblich. Ein Unterneh-
men aus der Verwertung kann als Financier und Produzent in der Produktionsstufe mit-
wirken.
28
2.2.2 Rechtemarkt und Rechtehändler
Unternehmerischer Zweck eines Rechtehändlers liegt in der Umsatzerzielung durch die
Allokation von Produktionen bzw. Programmen, an denen das Unternehmen Auswer-
tungsrechte hält.
29
Sie fungieren in der Wertschöpfungskette als Zwischenhändler
zwischen unterschiedlichen Stufen. Beispielsweise sind es Unternehmen mit Verleihrech-
ten in der Kinowirtschaft, Vermarkter von Merchandisingrechten oder der Weltvertrieb von
TV-Produktionen, um den es in dieser Arbeit am Beispiel der ZDF Enterprises GmbH
speziell geht. Es wird bei Rechtehändlern enger gefasst auch von Lizenzgebern, Ver-
23
Licensing ist die Lizenzierung von Programminhalten, marken und charakteren zu deren Nutzung bei der Herstellung
andere Produkte. Nach strenger Auslegung der Definition ist Merchandising demgegenüber nur eine Marketingstrategie
zur Vermarktung von Programminhalten über Begleitprodukte. Beide Begriffe werden im Deutschen jedoch meist äquiva-
lent verwendet. Vgl. Brem, Merchandising und Licensing für Rundfunkunternehmen, 2002, S. 2
24
Eigene Recherchen, Vertriebsverträge ZDF Enterprises GmbH
25
Hofmann, Schmidt, Wertschöpfungskette Kinderfernsehen, 2002, S. 2
26
Vgl. Hofmann, Schmidt, Wertschöpfungskette Kinderfernsehen, 2002, S. 2
27
Vgl. Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 95
28
Ernst & Young., Die Filmbranche in schwierigen Zeiten, 2003, S. 2
29
Vgl. Hofmann, Schmidt, Wertschöpfungskette Kinderfernsehen, 2002, S. 2
9
triebsfirmen oder Distributoren gesprochen.
30
Dementsprechend werden diese Begriffe in
dieser Abhandlung äquivalent nebeneinander benutzt.
Das Interesse eines Rechtehändlers liegt in einem möglichst lückenlosen und langem
Rechteerwerb an audiovisuellen Produktionen, um diese an möglichst viele Kunden
weiterverkaufen zu können. Kunden sind Sender, Zwischenhändler, Produzenten, Video-
Vermarkter und andere.
31
Rechte können generell über folgende Vorgänge erworben
werden: über Eigenproduktionen als Filmhersteller, über Auftragsproduktionen als Auf-
traggeber (Fernsehsender, die ein Programm für sich selbst von Produktionsfirmen
erstellen lassen), über Koproduktionen als Koproduzent und den Ankauf von Program-
men. Die beiden letztgenannten Varianten kommen für Rechtehändler in Frage. Neben
dem Erwerb von Exklusiv-Rechten sichern sich Rechtehändler auch durch finanzielle Be-
teiligungen in der Produktionsphase Rechte an Produktionen. In beiden Bereichen ist ZDF
Enterprises aktiv. Aus diesem Grund werden in dem Kapitel 2.3 zu den Vertragsmodellen
beide Möglichkeiten behandelt.
2.2.3 Ökonomische Besonderheiten
Es gibt Eigenschaften audiovisueller Güter, die auf deren Verwertung und damit deren
Preisbildung Einfluss nehmen. Dies sind vorrangig
die Nichtrivalität im Konsum und
der Charakter der Einzelfertigung.
Im folgenden werden diese zwei Besonderheiten audiovisueller Güter näher erläutert.
Bei audiovisuellen Produkten gibt es keine Konsumrivalität, d.h. keine Person wird
wesentlich durch den gleichzeitigen Gebrauch einer anderen Person am Konsum des
audiovisuellen Produktes behindert. Durch die Nichtrivalität im Konsum fallen bei
audiovisuellen Gütern im Gegensatz zu Produktionsgütern zur Erschließung weiterer
Kunden kaum zusätzliche Kosten auf der Herstellungsseite an. ,,Die Grenzkosten der
Verfügbarmachung bereits produzierter Software für weitere Zuschauer (auch in an-
deren Ländern) sind nahe null."
32
Bei der Auswertung im Ausland fallen zusätzliche
Aufwendungen an, um das Produkt an die kulturellen Gepflogenheiten anzupassen
(vgl. Kriterien der internationalen Verwertbarkeit, Kapitel 3.1.1). Im Verhältnis zu den
Produktionskosten sind diese Kosten allerdings sehr gering. Die Aufwendungen wer-
den unter 3.1.1 näher erläutert.
Das Prinzip der Nichtrivalität trifft auch auf internationaler Ebene zu. Die Preisgestal-
tung ist völlig unabhängig von der Nutzung oder Nicht-Nutzung in einem anderen
30
Vgl. Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 196
31
Vgl. Massmann, Internationale Vermarktung von TV-Programmen: Erfahrungen bei ZDF Enterprises. Präsentation ZDF
Enterprises, 06.05.2004, Folie 9
32
Vgl. Kruse, Die amerikanische Dominanz bei Film- und Fernsehproduktionen; In: Rundfunk und Fernsehen H. 2/1994,
S.185
10
Land. Dadurch kann das gleiche Produkt in verschiedenen Territorien zu unterschied-
lichen Preisen angeboten werden.
33
,,Die spezifischen Rechte-Märkte der verschie-
denen Länder bilden völlig eigenständige relevante Märkte, auf denen sich für eine
bestimmte Einheit sehr unterschiedliche Preise bilden können."
34
(vgl. nähere Erläute-
rung zu den Preisen, Kapitel 3.1.2)
Audiovisuelle Produktionen sind Einzelfertigungen. Sie sind nach ökonomischem Ver-
ständnis ein einzigartiges Projekt. Mit jedem Projekt wechseln die Produktions-
faktoren, z.B. nehmen andere Mitwirkende an der Produktion teil. Da es kein Produkt
der Massenfertigung ist, kann nur über den Weg der Verwertung, und nicht über die
Produktion, die Produktivität des Gutes gesteigert werden. Nur eine Steigerung des
Absatzes bringt höhere Umsätze. Daher ist die Verwertung auf verschiedenen Stufen
so wichtig.
35
Bei Kiefer ist dieser Denkansatz auf die verschiedenen, einheimischen
Verwertungsstufen beschränkt, kann nach Meinung der Autorin jedoch auch auf den
Auslandsvertrieb ausgeweitet werden.
Außerdem tragen audiovisuelle Produktionen wegen ihrem Einzelprojekt-Charakter
ein hohes unternehmerischen Risiko und sind in der Qualität, verstärkt durch ihre
Immaterialität, schwierig zu definieren. Die Qualität wird von jedem Land bzw. jedem
Abnehmer anders festgelegt. Es herrscht eine hohe Unsicherheit darüber, wie die
Nachfrage für ein audiovisuelles Gut sein wird.
36
Aufgrund der genannten Punkte gestaltet sich die Preisfindung im internationalen Markt
recht diffizil und kann erheblich variieren (vgl. Höhe des Preises und der Produktionsbetei-
ligung, Kapitel 3.1.2). Die Preisgestaltung richtet sich nach dem Absatzmarkt, dort vor-
herrschenden Gesetzmäßigkeiten sowie Produktionskosten, und dem Marktwert eines
Filmes in einem Auswertungsgebiet, d.h. nach dem Preis vorheriger, ähnlicher Produk-
tionen. Sie ist zudem generell schwierig, da zwischen den Herstellungskosten und dem
Preis kein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Es gibt wohl eine Tendenz und die
Bestrebung, teure Produktionen auch teuer abzusetzen. Es ist allgemein anerkannt, dass
kostspielige Produktionen eher Chancen auf eine positive Auswertung bieten. Allerdings
garantieren hohe Herstellungskosten nicht den Erfolg eines Filmes.
37
33
Röscheisen, Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte, 1997, S. 11
34
Kruse, Die amerikanische Dominanz bei Film- und Fernseh-Produktionen; In: Rundfunk und Fernsehen, H. 2/1994,
S.185
35
Vgl. Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 162
36
Vgl. Kiefer, Medienökonomie, 2001, S. 176
37
Vgl. Holtmann, Programmbeschaffung und -entwicklung werbefinanzierte TV-Anbieter aus der Perspektive der Pro-
grammplanung, 1998, S. 7
11
2.3 Vertragsformen zur Verwertung audiovisueller Produkte
In diesem Kapitel wird auf die Vertragsarten eingegangen, die im internationalen TV-
Rechtehandel üblich sind. Auf eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus der einzelnen
Verträge wird dabei verzichtet. Die vorgestellten Vertragsmodelle sind Vertragsvarianten
für den TV-Vertrieb, wie sie auch bei ZDF Enterprises Anwendung finden. Sie spiegeln die
Aktivitäten eines Distributors wider, der Rechte an fertiggestellten Programmen erwirbt
und verwertet, sich aber auch an Produktionen beteiligt und daraus entstehende Rechte
vermarktet. Die in diesem Kapitel vorgestellten Begrifflichkeiten sind Grundlage zum
Verständnis der Geschäftstätigkeiten der ZDF Enterprises GmbH und möglicher Ge-
schäftsbeziehungen mit Spanien.
Da die Verträge zu fertigen Programmen wesentlich weniger komplex sind, werden sie
zuerst erläutert. Darauf aufbauend werden die Auswertungsverträge erklärt, die vor oder
während der Produktion geschlossen werden. Auf die Verträge zur Fernseh- und Video-
auswertung wird vertieft eingegangen, da dies die beiden Haupteinnahmequellen von
ZDF Enterprises sind (vgl. Marktaktivitäten des Unternehmens zur Rechteverwertung,
Kapitel 4.2).
Vorab sei darauf hingewiesen, dass Verträge aus der Praxis meist nicht eindeutig in die
eine oder andere Kategorie einzuordnen sind. Vertragsmodelle werden miteinander
kombiniert oder gehen ineinander über. Sie sind in der Praxis weniger klar voneinander
trennbar. Die theoretische Herangehensweise zeigt jedoch die Möglichkeiten des audio-
visuellen Rechtehandels und die Unterschiede zwischen den Vertragsmodellen.
2.3.1 Verwertung nach Fertigstellung der Produktion
Dieses Kapitel umfasst den Verkauf von Produktionen für einen bestimmten Zeitraum und
einen bestimmten Zweck. Derartige Verträge zur Auswertung eines audiovisuellen Gutes
werden als Lizenzverträge bezeichnet.
38
Es können in einem Vertrag einzelne (vgl. Kapitel
2.3.1.1) oder mehrere Programme (vgl. Kapitel 2.3.1.2) verkauft werden. Es findet in den
Verträgen eine Einigung zwischen Lizenzgeber, der Nutzungsrechte inne hat, und Lizenz-
nehmer, der diese Rechte oder Teile davon käuflich erwerben möchte, statt.
Jeder Lizenzvertrag hat drei Dimensionen, in denen Nutzungsrechte zugesichert werden.
Zeitliche Ebene:
Auf der zeitlichen Ebene wird festgelegt, wie lange die Vertragslaufzeit ist, in der dem
Vertragspartner die Nutzung der Rechte zugesagt werden. Heutzutage sind kürzere
Laufzeiten üblich, da immer mehr Sendestationen am Markt aktiv sind und der
Lizenzgeber nach Ablauf der Lizenzzeit die Rechte weiter vermarkten kann.
39
38
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen - Beispiele, 2003, S. 11
39
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 295, 112
12
Örtliche Ebene:
Die örtliche Ebene beschäftigt sich mit den Gebietsterritorien, in denen die Auswer-
tung stattfinden darf. Die Lizenzterritorien werden dabei an geografischen Territorien
(Länderbezeichnungen), oder aber an Sprachräumen festgemacht, was vor allem in
Gebieten mit Ländergrenzen überschreitenden Sendereichweiten (Overspill) zutrifft.
40
Sachliche Ebene:
Die sachliche Ebene schließlich drückt aus, für welche Auswertungsarten das Pro-
gramm genutzt werden darf. Auswertungsarten sind angelehnt an die Verwertungs-
kette (z.B. Senderechte, AV-Rechte für Arten der Videoverbreitung, Merchandising-
Rechte). Die Rechteübertragung ist Kernstück eines jeden Vertrages. Grundsätzlich
werden nur die Rechte eingeräumt, die explizit Bestandteil eines Vertrages sind.
Rechte können exklusiv oder nicht-exklusiv vergeben werden. Erwirbt man die Rech-
te exklusiv, stehen sie in der Vertragslaufzeit keinem anderem Mitbewerber in dem
Vertragsterritorium zur Verfügung.
41
Die genannten Aspekte haben einen entscheidenden Einfluss auf die Preisgestaltung der
gehandelten audiovisuellen Ware. Es ist einleuchtend, dass sich eine längere Vertrags-
laufzeit, ein größeres Lizenzterritorium und ein breiterer Rechteumfang steigernd auf den
Preis auswirken.
42
Neben dem Lizenzpreis werden zudem die Zahlungsmodalitäten in
dem Vertrag festgelegt, nach denen der Lizenzpreis von dem Lizenznehmer zu leisten ist.
Als Zeitpunkt der Zahlung gelten beispielsweise 40 Prozent bei Vertragsunterzeichnung
und 60 Prozent bei Lieferung des Filmmaterials für den Rechteverkäufer als günstig.
43
Aber auch viele andere Modalitäten sind gängig.
2.3.1.1 Lizenzvertrag im TV- und Video-Bereich
Der Lizenzgegenstand eines Einzel-Lizenzvertrages ist ein bestimmtes Programm. Der
Vertrag wird zum Zweck der Fernsehausstrahlung (TV-Bereich) oder zur Verbreitung auf
Video (Video-Bereich) geschlossen.
Bei der Fernsehausstrahlung kommt zu den genannten Vertragspunkten die Festlegung
der Anzahl der Wiederholungen (Runs) hinzu, die in der Vertragslaufzeit stattfinden
dürfen. Aus Sicht eines Rechtehändlers tragen Wiederholungen zur Entwertung des
Programms bei, da das Programm immer bekannter wird und damit wesentlich ein-
geschränkter attraktiv ist. Daher verteuern Wiederholungen das Lizenzprodukt.
44
40
Deutsche Programmanbieter sichern sich beispielsweise häufig neben Deutschland die Rechte für Liechtenstein, Sütdti-
rol, Österreich und Schweiz, da es zu Anbietern dieser Länder territoriale Überschneidungen gibt. Vgl. eigene Recher-
chen zur Vertragsgestaltung bei Programmeinkäufen bzw. Koproduktionen von ZDF Enterprises
41
Vgl. Holtmann, Programmbeschaffung und -entwicklung werbefinanzierte TV-Anbieter aus der Perspektive der Pro-
grammplanung, 1998, S. 26
42
ebd., S. 25
43
Vgl. Karstens, Schütte, Firma Fernsehen, 1999, S. 263
44
Holtmann, Programmbeschaffung und -entwicklung werbefinanzierte TV-Anbieter aus der Perspektive der Programmpla-
nung, 1998, S. 25
13
In dem Lizenzvertrag zur TV-Auswertung wird meist ein bestimmter Festpreis für die
eingeräumten Nutzungsrechte bezahlt. Im Gegensatz zur TV-Auswertung wird bei Video-
Verträgen, auch AV-Verträge genannt, in der Regel eine prozentuale Beteiligung pro
verkauftem Video und kein Festpreis verhandelt.
2.3.1.2 Lizenz-Pakete
Bei Paketen sind mehrere Programme Gegenstand des Vertrages. Dadurch können die
Verträge in ihrer Gestaltung schwieriger sein. Der Vertragsgegenstand kann gleiche oder
unterschiedliche Programm-Genres einschließen, bei denen für die einzelne Programme
unterschiedliche Rechteumfänge, Lizenzzeiten und Preise gelten können.
45
Zwei besondere Formen der Paketverkäufe, die von der Regel des Verkaufs nach Fertig-
stellung der Produktion abweichen, sind der Volume Deal und der Output Deal.
46
Sie
schließen zukünftige Produktionen mit ein, die nicht so genau umrissen werden können
wie in Produktionsbeteiligungen (vgl. folgendes Kapitel).
Beim Volume Deal wird eine feste finanzielle Gesamtsumme vereinbart, hinter der ein
bestimmtes programmliches Stundenvolumen steckt, aber nicht alle Lizenzgegenstände
werden fixiert. Der Lizenzgeber muss demnach, dem Lizenznehmer in Zukunft Pro-
gramme anbieten, die dem geeignet erscheinen, das vereinbarte Volumen zu erfüllen. Ein
Output Deal bedeutet, dass ein Käufer während eines festgelegten Zeitraumes pauschal
alles abnimmt, worauf man sich in dem Deal geeinigt hat. Dies kann sich auf alle
Programme beziehen oder nur bestimmte Genre betreffen.
47
Für Rechteverkäufer haben Paketangebote den Vorteil, nicht jedes Produkt einzeln
verhandeln zu müssen. Die Abnahme der Produktionen ist gesichert und eventuell weni-
ger attraktive Programme erzielen auch gute Erlöse.
48
2.3.2 Verwertungspotentiale vor Fertigstellung der Produktion
Beteiligungen bei geplanten Produktionen spielen in der Fachliteratur oft nur eine Rolle in
Bezug auf die Finanzierung eines Projektes und zur Programmbeschaffung von Sender-
anstalten.
Aus Vertriebssicht sind sie jedoch auch entscheidend, da Rechte in einem
größeren Umfang erworben werden können. In diesem Sinn versteht die Verfasserin des
vorliegenden Textes Produktionsbeteiligungen als strategisches Mittel eines TV-Rechte-
händlers, langfristig Rechte zu sichern. Dieses Verständnis teilt die Autorin Tanja Nadine
Ertel.
45
Vgl. Karstens, Schütte, Firma Fernsehen, 1999, S. 260
46
Vgl. ebd., S. 261
47
Vgl. ebd., S. 259
48
Vgl. Holtmann, Programmbeschaffung und -entwicklung werbefinanzierte TV-Anbieter aus der Perspektive der Pro-
grammplanung, 1998, S. 13
14
,,Internationale Koproduktionen und der internationale Pre-Sale müssen unter Marketing-
gesichtspunkten als Vorstudien gesehen werden im Zusammenhang mit dem inter-
nationalen Weiterverkauf von Fernsehproduktionen."
49
Durch die finanzielle Beteiligung an Produktionen sichern sich Rechtehändler, die darüber
hinaus eher nicht direkt im produzierenden Gewerbe tätig sind, frühzeitig einen hohen
Rechteumfang an Produktionen. Formen der Produktionsbeteiligung sind Pre-Sales,
Kofinanzierungen und Koproduktionen. Die Struktur des Kapitels von Pre-Sales, über
Kofinanzierungen bis hin zur Koproduktionen widerspiegelt den zunehmenden Grad der
Beteiligung an einer Produktion und den damit zunehmenden finanziellen Beitrag.
Ebenso wie in den bereits beschriebenen Verträgen enthalten die Beteiligungsverträge
eine zeitliche, örtliche und sachliche Dimension. Rechte werden in aller Regel exklusiv
vergeben, da der Vertragspartner frühzeitig ein Programm mitfinanziert.
50
Die Verträge
sind um einiges umfangreicher, da es um kein eindeutiges, fertiges Programm geht. Die
intendierte Form des Programm wird hinsichtlich Inhalt, Format und anderen Be-
dingungen, etwa die Beteiligung bestimmter Mitwirkender vor und/oder hinter der Kamera,
genau beschrieben.
51
Festgelegt wird über diesen Vertragsgegenstand hinaus, wer wel-
che Rechte, in welchem Umfang und für welchen Beteiligungsbetrag bekommt. Zudem
spielt bei den Verträgen eine entscheidende Rolle, was passiert, wenn die Produktion aus
finanziellen oder anderen Gründen nicht beendet wird, jedoch schon Geldmittel geflossen
sind.
52
2.3.2.1 Pre-Sale
Pre-Sales sind Vorabverkäufe ,,von Rechten zur Auswertung auf internationalen Märkten
oder Marktsegmenten eines projektierten, aber in der Regel noch nicht produzierten
Filmes".
53
Gemäß dieser Definition sind Pre-Sales zur Auswertung eines audiovisuellen
Gutes bestimmt und daher ebenso Lizenzverträge wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben. Da
der Vertrag schon in der Entstehung und nicht erst nach Abschluss des Programms
geschlossen wird, besitzt er jedoch Finanzierungscharakter und blieb in dieser Sonder-
rolle bei den vorangegangen Erklärungen außen vor.
Pre-Sales stellen bei der Herstellung eines audiovisuellen Produktes eine Finanzierung
durch einen Fremdkapitalgeber dar,
54
der die Produktion auf eine begrenzte Zeit mit
49
Ertel, Globalisierung der Filmwirtschaft, 2001, S. 360
50
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen Beispiele, 2003, S. 42
51
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 295, 213
52
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 295, 227
53
Pfänder, Gabriele, Finanzierung von Einzelproduktionen; In: Mühl-Benninghaus (Hrsg.), Ökonomie der AV-Medien, Bd.1:
Fernsehen 2000, S. 23
54
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen Beispiele, 2003, S. 49
Frau Pfänder unterscheidet genauer zwischen der Produktionsphase und abschließender Fertigstellung. Während Pre-
Sales in der Durchführung Fremdkapital sind, konvertieren sie bei Ablieferung des Produktes in Eigenkapital, da es der
Käufer für sich zur Auswertung einsetzt. Vgl. Pfänder, Gabriele, Finanzierung von Einzelproduktionen; In: Mühl-
Benninghaus (Hrsg.), Ökonomie der AV-Medien, Bd.1: Fernsehen 2000, S. 23
15
finanziellen Mitteln in Form eines Kredites an den Hersteller unterstützt. Die Fremd-
kapitalgeber sind nicht direkt in dem Projekt involviert, sondern ,,Gläubiger".
55
Sie haben
keinen Einfluss auf Entscheidungsprozesse, wollen das fertige Produkt bzw. Rechte
daran aber für einen Lizenzzeitraum später für sich nutzen. Daher wird eine Minimum-
garantie geleistet.
56
Pre-Sale-Vertragspartner einer Produktion können Videovertriebe,
Rechtehändler oder ausländische Vertriebsfirmen sein, die sich frühzeitig bestimmte
Auswertungsfenster an der Produktion sichern.
57
2.3.2.2 Kofinanzierung
Die Kofinanzierung bzw. englisch Pre-Buy Equity und die im folgenden Abschnitt erläu-
terte Koproduktion sind Eigenfinanzierungs-Modelle von audiovisuellen Produktionen.
Eigenkapitalgeber sind Mitunternehmer an der Produktion. Sie tragen das unterneh-
merische Risiko mit und sind anteilig sowohl an Gewinn, als auch Verlust der Produktion
beteiligt.
58
Ein Kofinanzier hat kein Mitspracherecht in Produktionsentscheidungen. Für ihn ist das
Projekt ein ,,Investitionsobjekt", bei dem er hofft, an Gewinnen beteiligt zu sein. Die
Gewinn-, aber auch Verlustanteile des Kofinanziers werden in dem Vertrag detailliert
geregelt. In der Regel halten Kofinanziers keine Rechte an der Produktion, sondern nur
eine Beteiligung an der Auswertung.
59
Damit geht die Kofinanzierung über einen Pre-Sale
hinaus, da es um Erlösbeteiligungen an einer Produktion und nicht nur um einen
Rechteerwerb geht.
60
2.3.2.3 Koproduktion
Bei Koproduktionen wirken mehrere Produzenten an einer Produktion mit und teilen sich
ihrem finanziellen Anteil entsprechend das unternehmerische Risiko der Produktion.
Durch die Verteilung der finanziellen Belastung besteht zudem die Möglichkeit, das
Produktionsbudget signifikant zu erhöhen, was die ,,Wettbewerbsfähigkeit des Projekts
erhöht oder die Realisation eines Projekts sogar erst ermöglicht".
61
Nach der Definition einer Koproduktion haben Koproduzenten neben den finanziellen
und/oder sachlichen Leistungen andere Pflichten. Die Aufgabenteilung gilt hinsichtlich
organisatorischer und künstlerischer Ausgestaltung. Alle Koproduzenten sind an ,,der
55
Vgl. Pfänder, Gabriele, Finanzierung von Einzelproduktionen; In: Mühl-Benninghaus (Hrsg.),Ökonomie der AV-Medien,
Bd.1: Fernsehen 2000, S. 21
56
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 135 und 1377
57
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 135
58
Vgl. Pfänder, Gabriele, ,,Finanzierung von Einzelproduktionen" 2000; In: Mühl-Benninghaus (Hrsg.),Ökonomie der AV-
Medien, Bd.1: Fernsehen 2000, S. 21
59
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 132
60
Vgl. Eggers, Filmfinanzierung. Grundlagen Beispiele, 2003, S. 70
61
Vgl. Röscheisen, Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte, 1997, S. 105
16
Entstehung der Urheberrechte beteiligt".
62
Der Koproduzent ist demnach in alle Ent-
scheidungsprozesse involviert. Er wirkt auf die Erfüllung seiner Produktionsinteressen hin.
Ein Rechtehändler, der deutsche Produktionen ins Ausland vertreibt, wird beispielsweise
auf eine möglichst breite internationale Verwertbarkeit achten (vgl. Kapitel 3.1.1.2).
Gemäß seiner Beteiligung erhält der Koproduzent im Gegenzug Anteil an den Rück-
flüssen (im positiven und negativen Sinn). In der Brachensprache als Equity bezeichnet.
Rechte an Koproduktionen gehören den Beteiligten häufig über einen unbegrenzten Zeit-
raum, einschließlich einer unbegrenzten Zahl an Runs.
63
Je nach Beteiligung kann ein Koproduzent passiv oder aktiv an der Koproduktion
involviert sein. Man unterscheidet hierbei, ob der Produzent die Herstellung federführend
(aktiv) inne hat oder nicht.
64
Koproduktionsverträge sind sehr umfangreich, da sie ein hohes Risiko für die Beteiligten
darstellen. Der Vertragsgegenstand wird genauestens definiert, ebenso die Rolle der
Produzenten, das Vorgehen bei Entscheidungsprozessen, die Verteilung von Kosten und
Erlösen, wer welche Rechte erhält etc. Verschiedene Vertragskonstrukte sind zudem
durch die unterschiedliche Rechtsauslegung der verschiedenen Länder nötig. Es gelten
andere Vorschriften in der Arbeits-, Steuer- oder Urheberrechtsgesetzgebung.
65
Aus
diesen Gründen gelten Koproduktionen als sehr kompliziert und langwierig.
66
In der Realität gibt es kaum Koproduktionen, die den Richtlinien der Definition genau ent-
sprechen. Nicht immer üben Produzenten ihr Mitspracherecht in diesem Maße aus. Erlös-
beteiligungen beziehen sich oft nicht auf die gesamten Rückflüsse der Verwertung.
67
Vielmehr erwerben Koproduzenten jeweils ein bestimmtes Territorium, meist ihr Heimat-
land, und werten das Produkt darin für sich selbst aus. Eventuell wird vereinbart, die
Umsätze aus den restlichen Weltterritorien prozentual zu teilen. Viele Koproduktionen
sind daher streng nach Definition in Wahrheit eher Kofinanzierungen.
Im internationalen Bereich kommt hinzu, dass Koproduktionen teilweise in anderen Län-
dern anders definiert werden. Sie werden zudem geschlossen, da sie den Vorteil bieten,
,,über den Koproduktionspartner ... an ausländische Fördertöpfe zu kommen"
68
. Der Erfolg
einer internationalen Koproduktion, die den Ansprüchen verschiedener Märkte genügen
soll, ohne dadurch an Echtheit zu verlieren, ist letztendlich vor allem von der Kompro-
missbereitschaft und Ganzsicht aller Beteiligten abhängig.
62
Röscheisen, Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte, 1997, S. 100
63
Vgl. Scheithauer, In: Frankfurter Rundschau, Billig einkaufen reicht nicht/Kirch Media setzt auf Koproduktionen,
01.08.2000, S. 21
64
Vgl. Röscheisen, Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte, 1997, S. 100
65
Vgl. Röscheisen, Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte, 1997, S. 103
66
Vgl. Hollstein, Aspekte internationaler Koproduktionen, Präsentation ZDF Enterprises 2003, Folie 4
67
Hülbusch, Dokumentarische Koproduktion, ZDF Enterprises, im Gespräch mit Sabine Weber am 28.09.2005
68
Röscheisen, Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte, 1997, S. 105
17
2.3.3 Vertriebsmandat
Beim Vertriebsmandat agiert der Rechtehändler im Namen eines anderen Unternehmens,
beispielsweise im Namen eines TV-Senders. Es wird der ,,Auftrag" zur Verwertung von
Programmen erteilt. Dazu werden die für diesen Zweck notwendigen Auswertungsrechte
an dem Produkt für den Zeitraum des Vertriebsmandates übergeben. Das Vertriebs-
mandat ist nur das Recht zur Auswertung von audiovisuellen Produkten.
69
Damit unter-
scheidet sich das Vertriebsmandat vom Lizenzvertrag, in dem direkt Rechte an bestimm-
ten audiovisuellen Produkten übertragen werden.
Es kann sich auf ein bestimmtes Programm beziehen oder auf mehrere Produktionen.
Letzteres kann eine Art strategische Partnerschaft bzw. Allianz innerhalb eines bestimm-
ten Zeitrahmens zwischen zwei Partnern sein. In diesem Zusammenhang kann es sich
auch auf noch nicht fertiggestellte Produktionen beziehen.
70
Der Mandatsinhaber arbeitet beim Verkauf der Programme auf Provisionsbasis oder
leistet vorab eine Minimumgarantie.
71
Die prozentuale Regelung bezüglich der Rückflüsse
lehnt sich ungefähr an folgende Rechnung an: Von den Brutto-Einnahmen des Vertriebes
werden angefallene Marketing-Kosten, andere Kosten und die Provision des Rechtehänd-
lers (ca. 20 bis 30 Prozent) abgezogen.
72
Man erhält die Netto-Erlöse, mit denen die be-
reits gezahlte Minimumgarantie des Mandatsinhabers verrechnet werden. Die übrigen
Erlöse werden nach dem im Vertrag verhandelten Rückflussplan verteilt.
Der Rechtehändler schließt im Namen des Auftraggebers Verkaufsverträge ab. Diese
Verträge heißen daher im branchenüblichen Englisch nicht License Agreement, gleich
Lizenzvertrag, sondern Distribution Agreement.
73
In ihnen taucht als Vertragspartner
neben dem Rechtehändler der Name des eigentlichen Lizenzgebers auf, in dessen
Namen der Rechtehändler agiert. In den Verträgen gilt es, Einschränkungen bzw. Vor-
gaben bezüglich des Vertriebes von Seiten des Mandatgebers zu beachten.
69
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 291
70
Vgl. Hülbusch, Dokumentarische Koproduktion, ZDF Enterprises, im Gespräch mit Sabine Weber, 28.09.2005
71
Die Minimumgarantie ist ein nicht rückzahlbarer Festpreis an das mandatvergebende Unternehmen, bei dem der Rechte-
händler davon ausgeht, dass er diesen Betrag über die Erlöse des Produktes auf jeden Fall erzielen wird.
72
Laut Jacobshagen liegt die Provision des Rechtehändlers zwischen 20 und 33 Prozent.
Vgl. Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 282
73
Eigene Recherchen, Verträge der ZDF Enterprises GmbH
18
2.3.4 Zusammenfassender Vergleich der Vertragsformen
Die Vertragsmodelle der Verwertung vor und nach Fertigstellung der Produktion werden in
diesem Kapitel einander gegenübergestellt. Der Vergleich erscheint der Autorin in Form
einer Tabelle am zweckmäßigsten.
Unterscheidungskriterien
Einfacher
Lizenzvertrag
Pre-Sale
Kofinanzierung Koproduktion
Grad der Herstellungsbeteiligung
keiner
gering
mittel
hoch
Budgetaufwand gering
gering
mittel
hoch
Produktionsrisiko
(unternehmerisch, Abhängigkeit von Partnern)
keins gering
hoch sehr
hoch
Rechteumfang gering,
Zeit / Runs
begrenzt
gering,
Zeit / Runs
begrenzt
hoch
,,Mit-
Eigentümer"
sehr hoch
,,Mit-
Eigentümer"
Zeitpunkt der Rechtesicherung
sehr spät
früh
früh
sehr früh
Inhaltliche Einflussnahme
keine
keine
keine
gegeben
Abschätzung des zu erwartenden Erfolgs
möglich
schwierig
schwierig
schwierig
Komplexität des Geschäftsvorganges
(Notwendigkeit betriebswirtschaftlicher Kenntnisse,
organisatorischer Aufwand)
gering mittel
hoch
sehr
hoch
Strategische Bedeutung
(Aufbau von Partnerschaften, Prestigegewinn,
Steigerung des Bekanntheitsgrades, Verbesserung
der Absatzchancen im Ausland, Profilierung im
internationalen Markt, Weg zu Fördergeldern)
gering gering
hoch
sehr
hoch
Tabelle 1: Vergleich der Vertragsformen im TV-Rechtehandel
74
Diese Gegenüberstellung der Vertragseigenschaften stellen Chancen und Risiken der
jeweiligen Vertragsform dar. Dies ermöglicht die Einordnung der in den folgenden Kapiteln
beleuchteten Geschäftsvorgänge im internationalen TV-Rechtehandel und im besonderen
der ZDF Enterprises GmbH.
74
Eigene Quantifizierung, in Anlehnung an Vgl. de Haas, Jan-Pelgrom, Internationale Co-Produktionen Deutscher Fernseh-
produzenten; In: Ökonomie der AV-Medien, Bd.1: Fernsehen 2000, S. 32, Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-
Geschäft, 2002, S. 291 und Jacobshagen, Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft, 2002, S. 291
19
3 Marktgesetze des internationalen TV-Rechtehandels
,,Der Lizenzhandel ist die Stufe der Wertschöpfungskette, auf welcher der nationale und
internationale Markt am stärksten miteinander verwoben sind."
75
Abgesehen von einer
möglichen Zweitverwertung im Heimatmarkt findet die Verwertung von TV-Rechten nur
außerhalb der nationalen Grenzen statt.
Das folgende Kapitel setzt die ökonomischen Überlegungen zu den Rahmenbedingungen
des Rechtehandels aus Kapitel 2 mit speziellen Überlegungen zum internationalen Markt
fort. Die Voraussetzungen für die internationale Verwertbarkeit von Programmen, die öko-
nomischen Gegebenheiten der internationalen Märkte und die deutsche Position im inter-
nationalen TV-Rechtehandel werden beleuchtet. Das Kapitel bildet zudem die Basis, um
die spanischen Marktverhältnisse mit anderen Ländern vergleichen zu können.
3.1 Ökonomie der internationalen Rechteverwertung
3.1.1 Kriterien der internationalen Verwertbarkeit
Audiovisuelle Produkte sind stark mit Kultur und Ästhetikempfinden der jeweiligen Länder
verknüpft. Jedes Land hat andere Ansprüche an audiovisuelle Werke. Dies macht die
Vermarktung über Landesgrenzen hinweg derartig schwierig. In dem Zusammenhang
wird des öfteren von ,,Cultural Discount", der kulturellen Kluft, gesprochen, die es zu
überwinden gilt.
76
Konkret kann beispielsweise ein erfolgreiches deutsches Produkt in
Spanien auf Attraktivitätsverlust, Unverständnis oder Ablehnung stoßen. Daher ist ein Teil
der Analyse zum spanischen Fernseh- und Videomarkt, die kulturell bedingten Anfor-
derungen an audiovisuelle Programme in Spanien herauszuarbeiten.
Neben Mentalitätsunterschieden, die inhaltliche und dramaturgische Unterschiede von
Programmen aus anderen Ländern erklären, spielen andere Vorgaben des Marktes hin-
sichtlich formaler Kriterien eine Rolle. Diese formalen sowie inhaltlichen und dramaturgi-
schen Kriterien werden im folgenden erläutert und direkt auf spanische Verhältnisse über-
prüft oder später bei der Analyse des spanischen Marktes einbezogen.
3.1.1.1 Formal
Der wichtigste Punkt unter den formalen Kriterien ist die Anpassung der Produktion an die
Sprache. Diese kann entweder durch Untertitelung oder Synchronisation erfolgen. Da
generell muttersprachliche Programme den synchronisierten und untertitelten vorgezogen
75
Hofmann, Schmidt, Wertschöpfungskette Kinderfernsehen, 2002, S. 4
76
Vgl. Holtmann, Programmbeschaffung und -entwicklung werbefinanzierte TV-Anbieter aus der Perspektive der Pro-
grammplanung, 1998, S. 31
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832495657
- ISBN (Paperback)
- 9783838695655
- DOI
- 10.3239/9783832495657
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule der Medien Stuttgart – Electronic Media
- Erscheinungsdatum
- 2006 (Mai)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- rechteverwertung lizenzhandel programmverwertung koproduktion fernsehrechte
- Produktsicherheit
- Diplom.de